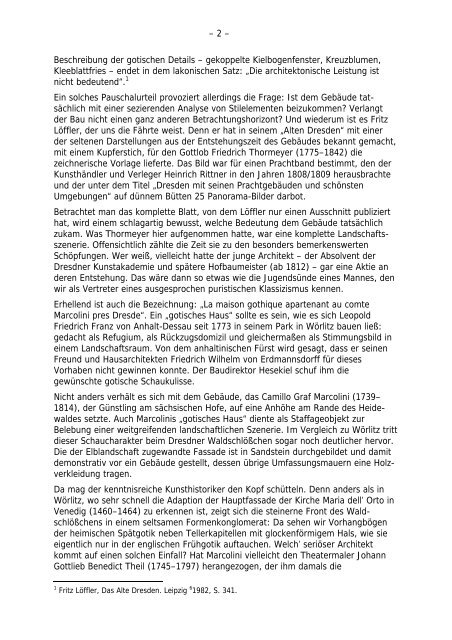Marcolinis Waldschlößchen – Staffageobjekt in einer ...
Marcolinis Waldschlößchen – Staffageobjekt in einer ...
Marcolinis Waldschlößchen – Staffageobjekt in einer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>–</strong> 2 <strong>–</strong><br />
Beschreibung der gotischen Details <strong>–</strong> gekoppelte Kielbogenfenster, Kreuzblumen,<br />
Kleeblattfries <strong>–</strong> endet <strong>in</strong> dem lakonischen Satz: „Die architektonische Leistung ist<br />
nicht bedeutend“. 1<br />
E<strong>in</strong> solches Pauschalurteil provoziert allerd<strong>in</strong>gs die Frage: Ist dem Gebäude tatsächlich<br />
mit e<strong>in</strong>er sezierenden Analyse von Stilelementen beizukommen? Verlangt<br />
der Bau nicht e<strong>in</strong>en ganz anderen Betrachtungshorizont? Und wiederum ist es Fritz<br />
Löffler, der uns die Fährte weist. Denn er hat <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em „Alten Dresden“ mit e<strong>in</strong>er<br />
der seltenen Darstellungen aus der Entstehungszeit des Gebäudes bekannt gemacht,<br />
mit e<strong>in</strong>em Kupferstich, für den Gottlob Friedrich Thormeyer (1775<strong>–</strong>1842) die<br />
zeichnerische Vorlage lieferte. Das Bild war für e<strong>in</strong>en Prachtband bestimmt, den der<br />
Kunsthändler und Verleger He<strong>in</strong>rich Rittner <strong>in</strong> den Jahren 1808/1809 herausbrachte<br />
und der unter dem Titel „Dresden mit se<strong>in</strong>en Prachtgebäuden und schönsten<br />
Umgebungen“ auf dünnem Bütten 25 Panorama-Bilder darbot.<br />
Betrachtet man das komplette Blatt, von dem Löffler nur e<strong>in</strong>en Ausschnitt publiziert<br />
hat, wird e<strong>in</strong>em schlagartig bewusst, welche Bedeutung dem Gebäude tatsächlich<br />
zukam. Was Thormeyer hier aufgenommen hatte, war e<strong>in</strong>e komplette Landschaftsszenerie.<br />
Offensichtlich zählte die Zeit sie zu den besonders bemerkenswerten<br />
Schöpfungen. Wer weiß, vielleicht hatte der junge Architekt <strong>–</strong> der Absolvent der<br />
Dresdner Kunstakademie und spätere Hofbaumeister (ab 1812) <strong>–</strong> gar e<strong>in</strong>e Aktie an<br />
deren Entstehung. Das wäre dann so etwas wie die Jugendsünde e<strong>in</strong>es Mannes, den<br />
wir als Vertreter e<strong>in</strong>es ausgesprochen puristischen Klassizismus kennen.<br />
Erhellend ist auch die Bezeichnung: „La maison gothique apartenant au comte<br />
Marcol<strong>in</strong>i pres Dresde“. E<strong>in</strong> „gotisches Haus“ sollte es se<strong>in</strong>, wie es sich Leopold<br />
Friedrich Franz von Anhalt-Dessau seit 1773 <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Park <strong>in</strong> Wörlitz bauen ließ:<br />
gedacht als Refugium, als Rückzugsdomizil und gleichermaßen als Stimmungsbild <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Landschaftsraum. Von dem anhalt<strong>in</strong>ischen Fürst wird gesagt, dass er se<strong>in</strong>en<br />
Freund und Hausarchitekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff für dieses<br />
Vorhaben nicht gew<strong>in</strong>nen konnte. Der Baudirektor Hesekiel schuf ihm die<br />
gewünschte gotische Schaukulisse.<br />
Nicht anders verhält es sich mit dem Gebäude, das Camillo Graf Marcol<strong>in</strong>i (1739<strong>–</strong><br />
1814), der Günstl<strong>in</strong>g am sächsischen Hofe, auf e<strong>in</strong>e Anhöhe am Rande des Heidewaldes<br />
setzte. Auch <strong>Marcol<strong>in</strong>is</strong> „gotisches Haus“ diente als <strong>Staffageobjekt</strong> zur<br />
Belebung e<strong>in</strong>er weitgreifenden landschaftlichen Szenerie. Im Vergleich zu Wörlitz tritt<br />
dieser Schaucharakter beim Dresdner <strong>Waldschlößchen</strong> sogar noch deutlicher hervor.<br />
Die der Elblandschaft zugewandte Fassade ist <strong>in</strong> Sandste<strong>in</strong> durchgebildet und damit<br />
demonstrativ vor e<strong>in</strong> Gebäude gestellt, dessen übrige Umfassungsmauern e<strong>in</strong>e Holzverkleidung<br />
tragen.<br />
Da mag der kenntnisreiche Kunsthistoriker den Kopf schütteln. Denn anders als <strong>in</strong><br />
Wörlitz, wo sehr schnell die Adaption der Hauptfassade der Kirche Maria dell’ Orto <strong>in</strong><br />
Venedig (1460<strong>–</strong>1464) zu erkennen ist, zeigt sich die ste<strong>in</strong>erne Front des <strong>Waldschlößchen</strong>s<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em seltsamen Formenkonglomerat: Da sehen wir Vorhangbögen<br />
der heimischen Spätgotik neben Tellerkapitellen mit glockenförmigem Hals, wie sie<br />
eigentlich nur <strong>in</strong> der englischen Frühgotik auftauchen. Welch’ seriöser Architekt<br />
kommt auf e<strong>in</strong>en solchen E<strong>in</strong>fall? Hat Marcol<strong>in</strong>i vielleicht den Theatermaler Johann<br />
Gottlieb Benedict Theil (1745<strong>–</strong>1797) herangezogen, der ihm damals die<br />
1 Fritz Löffler, Das Alte Dresden. Leipzig 6 1982, S. 341.