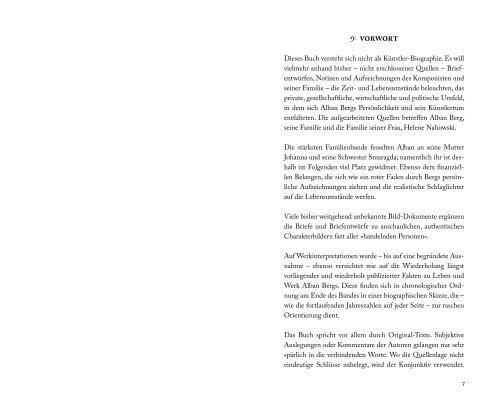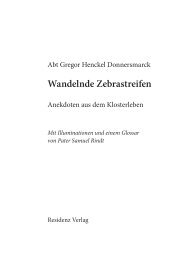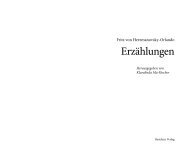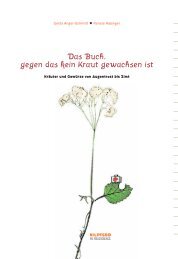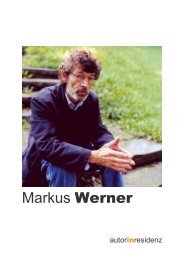Vorwort - Residenz Verlag
Vorwort - Residenz Verlag
Vorwort - Residenz Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
p<br />
VOrWOrt<br />
Dieses Buch versteht sich nicht als Künstler-Biographie. Es will<br />
vielmehr anhand bisher – nicht erschlossener Quellen – Briefentwürfen,<br />
Notizen und Aufzeichnungen des Komponisten und<br />
seiner Familie – die Zeit- und Lebensumstände beleuchten, das<br />
private, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Umfeld,<br />
in dem sich Alban Bergs Persönlichkeit und sein Künstlertum<br />
entfalteten. Die aufgearbeiteten Quellen betreffen Alban Berg,<br />
seine Familie und die Familie seiner Frau, Helene Nahowski.<br />
Die stärksten Familienbande fesselten Alban an seine Mutter<br />
Johanna und seine Schwester Smaragda; namentlich ihr ist deshalb<br />
im Folgenden viel Platz gewidmet. Ebenso dem finanziellen<br />
Belangen, die sich wie ein roter Faden durch Bergs persönliche<br />
Aufzeichnungen ziehen und die realistische Schlaglichter<br />
auf die Lebensumstände werfen.<br />
Viele bisher weitgehend unbekannte Bild-Dokumente ergänzen<br />
die Briefe und Briefentwürfe zu anschaulichen, authentischen<br />
Charakterbildern fast aller »handelnden Personen«.<br />
Auf Werkinterpretationen wurde – bis auf eine begründete Ausnahme<br />
– ebenso verzichtet wie auf die Wiederholung längst<br />
vorliegender und wiederholt publizierter Fakten zu Leben und<br />
Werk Alban Bergs. Diese finden sich in chronologischer Ordnung<br />
am Ende des Bandes in einer biographischen Skizze, die –<br />
wie die fortlaufenden Jahreszahlen auf jeder Seite – zur raschen<br />
Orientierung dient.<br />
Das Buch spricht vor allem durch Original-Texte. Subjektive<br />
Auslegungen oder Kommentare der Autoren gelangen nur sehr<br />
spärlich in die verbindenden Worte. Wo die Quellenlage nicht<br />
eindeutige Schlüsse nahelegt, wird der Konjunktiv verwendet.<br />
7
VOrWOrt<br />
Alle anderen Aussagen sind durch Primärquellen abgesichert.<br />
Zugunsten des Leseflusses wird jedoch in der Regel auf belegende<br />
Fußnoten – sie wären in die Hunderte gegangen – verzichtet:<br />
Der Text soll, wiewohl wissenschaftlich fundiert, angenehm<br />
lesbar bleiben. Präzise Auskunft über alle zwecks Aufrechterhaltung<br />
des Leseflusses vorgenommenen Korrekturen in<br />
den Zitaten geben die »Quellenkatalogen zur Musikgeschichte«,<br />
Bd. 29, 34 und 35, die sämtliche Dokumente unredigiert, inklusive<br />
getreulicher Übertragung sämtlicher Streichungen und Verweise<br />
enthalten.<br />
An Stelle eines Registers beschließt ein Personenverzeichnis in<br />
informativer Auswahl das Buch.<br />
Die Autoren haben vielen Helfern zu danken: Frau Professor<br />
Dagmar Schilling, der Großnichte Alban Bergs, der Österreichischen<br />
Nationalbibliothek, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek,<br />
der Wiener Stadtbibliothek und last but not least<br />
Frau Mag. Inge Haberler, der ersten kritischen Leserin.<br />
KnaSin<br />
8<br />
p AlbAn berg<br />
Zeitumstände – lebenslinien<br />
Jugend<br />
Alban Berg: Aquarellierte Karte mit seinem Gedicht »Faulheit«<br />
O! himmlische Faulheit<br />
Ewig verkannte<br />
Schimpfwort benannte<br />
Tochter der Zeit<br />
Ich würde was dichten<br />
Doch bin ich zu faul<br />
Du mußt d’rauf verzichten<br />
Denn ich halt’ jetzt mein M…l!<br />
AB!<br />
9
10<br />
1900<br />
Faul, das ist er vielleicht tatsächlich, faul, aber poetisch, der 15jährige<br />
Alban Berg, der seinem Schulkameraden Johannes Huber<br />
seine sehr persönliche Paraphrase von Lessings Lob der Faulheit<br />
sendet. Jenes offenkundige Gefühl für Sprache und Form, das<br />
sich in der Korrespondenz des Realschülers wiederholt in spontanen<br />
literarischen Vignetten äußert, bewahrt ihn keineswegs<br />
vor schlechten Zensuren in der Schule. Den Lehrern der Zeit<br />
um 1900 ist mit lyrischen Ergüssen nicht zu imponieren. Die<br />
Realität in der siebenklassigen k. k. Staats-Realschule in Wien<br />
I., Schottenbastei 7, nimmt sich in einem Brief mit lebendigen<br />
Schilderungen von Szenen des Klassen-Lebens recht profan aus;<br />
nicht viel anders als etwa der Schulalltag ein Jahrhundert später,<br />
sieht man vom damals gebräuchlichen Siezen der Schüler ab.<br />
Lieber Hannes! Du wirst gewiß schon böse sein daß ich<br />
Dir noch gar nichts geschrieben habe; aber 1. war ich zu<br />
faul und als ich 2. schreiben wollte hatte ich keine Zeit<br />
mehr (wegen des Lernens) Wozu aber soviel Entschuldigungen!!<br />
Denk Dir lieber Hans, ich habe im I. Semester Zeugnis<br />
in Deutsch eine 5. Welche Demüthigung einem Dichter<br />
wie ich bin. Das bin ich aber sicher daß ich in der nächsten<br />
Censur mindestens ein genügend haben<br />
Diesen Montag war mathematische Schularbeit es waren<br />
6 Aufgaben, 5 habe ich richtig. Während derselben<br />
schaute der Bing immer zu mir herein. Als das der Director<br />
sah sprach er zum Bing: »Bing Sie werden doch<br />
nicht vom Berg abschauen. Da muß es Ihnen schon sehr<br />
schlecht gehen, übrigens werden Sie nicht viel finden«<br />
Am Mittwoch las er die Noten vor und sagte »Berg 3,<br />
Bing 4. Jetzt versteh’ ich auch warum Sie sich immer an<br />
den Berg gewendet haben.« Du kannst Dir denken daß<br />
das den Director sehr geärgert hat. – – – Gestern trug<br />
der Sebald die Geographie Italiens in seiner gewöhnlich<br />
dummen Weise vor. Er sagte auch: »Wer das die nächste<br />
Stunde nicht weiß der bekommt einen Schinkwe 1 « und<br />
als ein Bub sagt der Zögernitz sagt er möchte die Thüre<br />
schließen da es zieht sagte Sebald: »Es wäre das beste sie<br />
kaufen sich Zugstiefletten.« Doch genug von der Schule!<br />
– Wie geht es denn Dir lieber Hannes? Hast Du schönes<br />
Wetter? Bei uns war es am Mittwoch so warm u schön<br />
daß man sich vornahm den nächsten Tag mit Sommermantel<br />
auszugehen. Doch siehe da!!!–!!!<br />
»Blickend heraus aus dem Fenster am schönen<br />
nächsten Tag des Donnerstags<br />
Lagen die Dächer beschneit mit weithin<br />
leuchtendem Schnee<br />
Hiehin und dorthin fielen die Flocken die<br />
Ströme die Winde<br />
Also weht von Winter den Nord die glizernden<br />
Flocken<br />
Jetzt stürmte der Süd ihn den Nordsturm hin<br />
zum Verfolger<br />
Jetzt sandte der Ost ihn den brausenden Weste<br />
zum Spiel<br />
Doch die Seite beschrieben vollende den Brief<br />
ich<br />
Gleich dem Versmass der schönen und nie<br />
vergessenen Ilias«<br />
All Heil! Dein Berg<br />
1900<br />
Bemerkenswert ist weniger der damals in der Jugendbewegung<br />
übliche »Heil«-Gruß, sondern eher, daß derselbe Schüler,<br />
11
1900<br />
der in Deutsch soeben ein »nicht genügend« eingeheimst hat,<br />
seinen Brief in Hexametern beschließt! Die Homerische Ilias<br />
steht gar nicht auf dem Lehrplan einer Realschule im Wien der<br />
Jahrhundertwende, doch gehört anspruchsvolle Lektüre dieses<br />
Zuschnitts ganz offenkundig noch zu den Selbstverständlichkeiten.<br />
Etwa drei Wochen nach dem unbeschwerten Brief, am 30. März<br />
1900, stirbt Alban Bergs Vater Conrad an Herzversagen. Conrad<br />
Berg ist als Leiter der Wiener Filiale des New Yorker Import-<br />
und Exporthauses Georg Borgfeldt & Co ein tüchtiger<br />
Geschäftsmann und kunstliebender Mensch gewesen. Eine <strong>Verlag</strong>sbuchhandlung<br />
und später eine Devotionalienhandlung in der<br />
Wiener Innenstadt bildeten seinen finanziellen Rückhalt. Conrad<br />
Berg war auch Freimaurer. Er wurde am 7. 5. 1876 in die im<br />
Jahr davor gegründete Grenzloge »Schiller« (Matrikelnummer<br />
20) aufgenommen. In Österreich verboten, arbeitete diese Loge<br />
nach dem schottischen Ritus in Preßburg. In Wien gründete sie<br />
den humanitären Verein »Bildung«. Conrad Berg wurden am<br />
Tag seiner Aufnahme sofort alle drei Grade der Freimaurerei<br />
verliehen, das heißt, er wurde als Lehrling aufgenommen, am<br />
selben Abend zum Gesellen befördert und hernach zum Meister<br />
erhoben. Er dürfte ein sehr rühriges Mitglied gewesen sein,<br />
denn er bekleidete in seiner Loge als »Beamter« mehrere für das<br />
Logenleben wesentliche Positionen.<br />
12<br />
Conrad Berg<br />
1900<br />
Nach Conrads Tod muß seine Frau Johanna über Nacht die Leitung<br />
aller finanziellen und privaten Angelegenheiten der Familie<br />
übernehmen. Zum Vormund des halbwüchsigen Alban wird<br />
dessen ältester Bruder, Hermann, bestellt, der seit Jahren erfolgreich<br />
bei der Firma Borgfeldt & Co. in New York arbeitet.<br />
Nur zwei der vier Kinder Johanna und Conrad Bergs sind<br />
zu jenem Zeitpunkt bereits selbständig. Charly, der zweite ältere<br />
Bruder, ist in der Firma Borgfeldt kaufmännisch tätig. Smaragda,<br />
die jüngere Schwester, steht jedoch noch unter der Aufsicht<br />
ihrer Gouvernante und Klavierlehrerin Ernestine Götzlik. Musisch<br />
wie Bruder Alban, scheint sie auf dem besten Weg, eine<br />
zumindest routinierte Pianistin zu werden.<br />
13
1900<br />
14<br />
Smaragda Berg mit ihrer Gouvernante Ernestine Götzlik<br />
Doch die finanzielle Lage der Familie ist alles andere als rosig.<br />
Johanna Berg ist lediglich imstande, die Devotionalienhandlung<br />
ihres Mannes weiterzuführen, nicht aber die lukrativen Geschäftsverbindungen<br />
aufrechtzuerhalten. Zumindest für Alban<br />
scheinen die Tage in der Realschule daher gezählt. Vielleicht<br />
sollte er zu seinem Bruder und Vormund nach New York übersiedeln<br />
und als Lehrling bei der Firma Borgfeldt beginnen?<br />
Smaragda schwingt die US-Flagge nebst Borgfeldt-Plakat<br />
1900<br />
Maria Bareis, Edle von Barnhelm, die Tante Johanna Bergs, will<br />
ihren Großneffen davor bewahren. Sie setzt zur Vollendung seiner<br />
Schulbildung ein entsprechendes Legat aus. Das ermöglicht<br />
dem jungen Mann zwar, in Wien zu bleiben, doch ist sein seelischer<br />
Zustand in jener Zeit labil. Halt verschafft ihm zuweilen<br />
der Kontakt mit Hermann Watznauer, einem Freund der Familie,<br />
den noch Conrad Berg, der um seine Krankheit wußte,<br />
in einer Unterredung auf dem Familiengut, dem am »Heiligen<br />
Gestade« am Ossiachersee in Kärnten gelegenen »Berghof«,<br />
gebeten hat, seinem jüngsten Sohn ein väterlicher Freund zu<br />
sein. Der nachmalige Baumeister und Ingenieur Watznauer,<br />
zehn Jahre älter als Alban, leitet in Wien und in Drosendorf<br />
im nördlichen Niederösterreich den sogenannten »Verein junger<br />
Männer«, dessen Mitgliedern soziales Gewissen sowie geistige<br />
und künstlerische Bildung vermittelt werden sollen. Im Rahmen<br />
der gemeinsamen Wanderungen und sportlichen Betätigungen<br />
wie dem Tennisspiel hält Watznauer, von den Mitgliedern der<br />
Jugendgruppe mit »Meister« angesprochen, nicht nur mit Alban<br />
Berg, sondern auch mit dessen Klassenkameraden Hans Huber<br />
Kontakt. Eine Grußkarte – vielleicht die Einladung zu einer<br />
Radpartie? – beweist das.<br />
Alban im Alter von 16 Jahren Smaragda im Alter von 14 Jahren<br />
15
1900 1901/02<br />
Radpartien mit seinen »Wandervögeln« dürfte Watznauer geliebt<br />
haben. Noch elf Jahre später schwärmt er auf einer Postkarte:<br />
16<br />
Der letzte Sonntag des vergangenen Monats schien uns<br />
bereits als Einzugstag des heißersehnten Frühlings zu<br />
gelten, und ich benützte diesen Tag natürlich um eine<br />
Morgenradparthie in den Prater zu machen. Der Nachmittag<br />
führte mich wieder denselben Weg, nur war mein<br />
junger Freund Alban der liebliche Begleiter, dessen weitere<br />
Charakterisierung unnöthig erscheint, da ich ihn ja<br />
»Freund« nenne. – – –<br />
Wie es genau um die »liebliche« Freundschaft bestellt ist, bleibt<br />
im dunkeln. Doch ist die Einstellung mancher der jungen Männer<br />
aus Watznauers Gruppe zum weiblichen Geschlecht in einem<br />
bemerkenswerten Diktum eines der Freunde überliefert:<br />
Herbert Strutz, der mit 15 Jahren den Wandervögeln beigetreten<br />
ist, urteilt: »Die Schönheit bestimmt die Sinnlichkeit … Der<br />
Körper eines Mädchens ist nicht schön, er ist anmutig; der Körper<br />
eines Knaben ist schön, heiter, frei.«<br />
1901/02<br />
Die väterliche Fürsorge Watznauers kann Alban Berg nicht vor<br />
schulischem Versagen bewahren. Im Jahr nach dem Tod des<br />
Vaters unterbricht er vor dem Abschluß des zweiten Semesters<br />
seine Schulzeit. Die sechste Klasse muß er im folgenden Jahr<br />
wiederholen. Dasselbe Schicksal wird ihn im Jahr darauf noch<br />
einmal ereilen, obwohl Klassenkamerad Paul Hohenberg Aufsätze<br />
für ihn verfaßt, die dem Geschmack des Deutschprofessors<br />
entsprechen. Auch die siebente und letzte Klasse absolviert Berg<br />
zweimal, ehe er am Ende des Schuljahres 1903/04 sein Reifeprü-<br />
fungszeugnis erhält. Die schlechten Leistungen, die Berg zum<br />
Repetenten machen, haben verschiedene Ursachen. Seine Gesundheit<br />
ist von jeher labil. Und die Irritationen in jener Zeit<br />
sind mannigfaltig: Der schmerzliche Verlust des Vaters einerseits,<br />
andererseits aber erste Versuche persönlichen künstlerischen<br />
Ausdrucks, Kompositionsversuche im Frühjahr 1901, wohl<br />
angeregt durch den singenden Bruder Charly und die Schwester<br />
Smaragda, die ihn auf dem Klavier begleitet.<br />
Die Familie Berg um 1898: Smaragda, Alban, Johanna, Hermann, Charly (v. li.)<br />
Das geschwisterliche Leben am Berghof wird durch Einladungen<br />
aus dem Freundeskreis der drei bereichert, nicht nur durch<br />
Hermanns amerikanische Geschäftsfreunde der Firma Borgfeldt,<br />
sondern auch durch junge Männer wie Adolf von Eger,<br />
»Pips« genannt, den Sohn des Präsidenten der Südbahngesellschaft,<br />
Smaragdas späteren Gemahl.<br />
Aus der Bahn geworfen wird der junge Alban jedoch nicht durch<br />
seine erwachende schöpferische Tätigkeit, sondern vor allem<br />
17
1901/02<br />
durch die sexuelle Beziehung zum Küchenmädchen der Familie<br />
Berg. Eine solche Liaison ist zur damaligen Zeit zwar keineswegs<br />
ungewöhnlich, Eltern gehobener Gesellschaftsschicht führen sie<br />
regelrecht herbei, um ihren Söhnen die Gelegenheit zu geben,<br />
erste Erfahrungen »unter Aufsicht« zu sammeln. Doch Alban<br />
Bergs Debüt als Liebhaber zeitigt Folgen: Marie Scheuchl, seit<br />
einiger Zeit im Bergschen Haushalt tätig, wird – wahrscheinlich<br />
während der Osterferien zwischen 7. und 16. März 1901 –<br />
schwanger. Sobald es nicht mehr möglich ist, Maries Zustand<br />
zu verbergen, entläßt Johanna Berg sie und schickt sie zurück ins<br />
heimatliche Linz. Möglicherweise findet man die junge Mutter<br />
mit einem Geldbetrag ab, um Albans Vaterschaft nicht publik<br />
werden zu lassen. Das entspräche den Usancen der Zeit.<br />
Das Kind, ein Mädchen, kommt jedoch am 4. Dezember<br />
1901 nicht in Linz, sondern in einem Wiener Krankenhaus<br />
zur Welt. Die Bindung Maries an den Kindesvater ist emotional,<br />
stärker jedenfalls, als die Familie Berg wahrhaben möchte:<br />
Zum Zeichen der innigen Verbindung wird das Mädchen<br />
auf den Namen Albine getauft! Alban erhält – wann, ist nicht<br />
mehr auszumachen – nicht nur ein Bild seiner Tochter, sondern<br />
auch Maries Tagebuch aus der Zeit ihrer Schwangerschaft und<br />
Niederkunft. Aus seinem Antwortbrief wird deutlich, daß er<br />
von Maries Schwangerschaft wußte, nicht aber von der Geburt<br />
seiner Tochter. Von Gefühlen hin und her gerissen, schreibt er<br />
zunächst aufgewühlt und durchaus pathetisch:<br />
18<br />
… Du trugst im Leibe ein Wesen − − und das Wesen wird<br />
Dich der ganzen Welt verraten, daß Du einmal schwach<br />
gewesen − Du offenbartest nun dieses Neue Leben dem<br />
Vater desselben − − − den ersten Moment sahst Du wie<br />
es ihn erschütterte − − − − da sah ich Deinen neuen Kummer<br />
− − Deine neue Angst – daß ich mich − der ich all<br />
dies Unglück über Dich gebracht – kränken möchte − −<br />
Du batst mich um Gleichgültigkeit − − Und ich − − ich<br />
1901/02<br />
Narr − nur um Dir darin Ruhe zu verschaffen − − stellte<br />
mich gleichgültig − − ja herzlos − − und ich ahnte nicht,<br />
wie noch weher Dir das tun mußte tat. Erst jetzt, wie ich<br />
Dein Tagebuch las merkte ich wie unrecht ich auch darin<br />
gehandelt hatte.<br />
Einen Tag später wird der Brief in weit nüchternem Ton vollendet.<br />
Berg berichtet Marie, Watznauer habe einen Bildhauer beauftragt,<br />
einen Gipsabguss von seinem Gesicht zu machen: »Es<br />
ist ziemlich gut getroffen – – !!«, gerät aber offenbar während des<br />
Schreibens wieder in Verzweiflung über »Schuld und Sünde«:<br />
Und ich habe nicht den Muth mich zu reinigen − − nein<br />
ich bleibe stecken in diesem Unrath meiner Sünden. Anstatt<br />
daß ich hinaustrete in die Welt und laut verkünde<br />
»Seht das ist mein Kind − das ich gezeugt − es ist mein<br />
2tes Ich!« anstatt dessen verberge ich alles hinter einem<br />
lügnerischen Schleier − − und bin vor der Welt der liebe<br />
unschuldige Alban …<br />
Er unterzeichnet dieses Schreiben nicht mit seinem Namen,<br />
sondern mit sieben Punkten. Ein Postskript lautet:<br />
Sollte irgend etwas vorkommen, was von Wichtigkeit für<br />
mich ist (z. Bsp. etwas Gerichtliches, od. Binchen u. Deine<br />
Gesundheit) dann schicke mir irgend eine anonyme<br />
Postkarte mit einem Fragezeichen darauf, das bedeutet<br />
für mich daß auf der Post unter Nummer 7272 ein Brief<br />
für mich liegt.<br />
Marie Scheuchl hat die Verbindung zu Alban Berg von sich aus<br />
gelöst und die Familie Berg nie wieder mit ihren Problemen<br />
konfrontiert. Dem Sittenbild Wiens um 1900 entspricht diese<br />
Handlungsweise durchaus. Berg hätte als Sohn einer wohlsitu-<br />
19
1901/02<br />
ierten bürgerlichen Familie niemals eine offizielle Verbindung<br />
mit einem Küchenmädchen eingehen können.<br />
Erstaunlicherweise ist dieser Brief an Marie Scheuchl in<br />
Bergs Nachlaß erhalten geblieben. Entweder – aber danach sieht<br />
es nicht aus – ist das überlieferte Dokument nur der Entwurf<br />
zu einem Schreiben, das nicht abgeschickt wurde. Oder es kam,<br />
was wahrscheinlicher ist, über Umwege wieder in Bergs Besitz.<br />
In diesem Nachlaß findet sich auch der Entwurf einer Vaterschaftsbestätigung<br />
vom 8. 12. 1903. »Daß ich mich den damit verbundenen<br />
Pflichten nie entziehen werde«, schreibt der Vater der<br />
gerade zweijährigen Albine. Ist eine solche Bestätigung, von der<br />
nur der Entwurf erhalten ist, doch notwendig geworden?<br />
Albine wird später jedoch Verbindung mit ihrem Vater aufnehmen.<br />
Sehr wahrscheinlich war sie die Benutzerin der entwerteten<br />
Karte für die Wozzeck-Aufführung in Wien am 30. März<br />
1930. Das Billett für einen Platz auf der IV. Galerie zum Preis<br />
von zwei Schilling hat sich im Nachlaß des Komponisten erhalten.<br />
Soma Morgenstern berichtet, daß Albine diese Karte »wie<br />
ein Heiligtum« aufbewahrte. Möglicherweise kamen der Brief,<br />
die Vaterschaftsbestätigung und das Opernbillett deshalb in den<br />
Nachlaß, weil Albine – nach dem Tod ihres Vaters – anläßlich<br />
eines Besuchs Helene diese Unterlagen zur Einsicht übergab, sie<br />
aber nicht mehr zurückerhielt.<br />
Im Tonfall sinnlichster Romantik entstehen Alban Bergs erste<br />
Lieder. Er versieht sie alle mit Opuszahlen. Freund Watznauer<br />
schreibt – aus welchen Gründen immer – einige dieser frühen<br />
Werke in kalligraphischer Notenschrift ab.<br />
Unter »Frühe Lieder« fällt auch Opus 10 – »Am Abend«,<br />
ein Lied nach einem Text von Emanuel Geibel. Diese Abschrift<br />
stammt von Hermann Watznauer.<br />
20<br />
Watznauers Abschrift von Alban Bergs Jugendlied »Am Abend«<br />
1901/02<br />
Die Komposition besitzt keine Vorzeichen, sie beginnt in F-Dur<br />
und endet in c-Moll. Ihre Modulationen und die Melodieführung<br />
sind genau dem Textgehalt angepasst. Die Singstimme wird<br />
immer durch die Oberstimme des Klaviers unterstützt, was vielleicht<br />
auf die leichtere Ausführung hinzielt. Sehr geschickt wird<br />
die formale Struktur behandelt. Das Gedicht beginnt mit einer<br />
Abendstimmung, die sich durch den Veilchenduft der zweiten<br />
Strophe von der Natur weg zum Betrachter hin konkretisiert. Er<br />
kann aber den »Klang nicht finden, so dunkel, mild und weich«.<br />
Bei dem durchkomponierten Lied, das in seiner Vertonung ganz<br />
auf den Text eingeht, berücksichtigt Berg dennoch die Strophenteilung;<br />
durch die mehrfache Textwiederholung in der zweiten<br />
Strophe wird deren Aussage so stark betont, daß nur durch die<br />
Wiederholung des Anfangstaktes zu Beginn der dritten Strophe<br />
ein dreiteiliges Gebilde entsteht.<br />
21