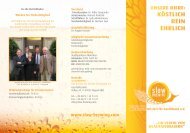Reinigungstechnik bei Schankanlagen (221.15 KB) - slow brewing
Reinigungstechnik bei Schankanlagen (221.15 KB) - slow brewing
Reinigungstechnik bei Schankanlagen (221.15 KB) - slow brewing
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Verschmutzung und zeitlich bedingtequalitative Veränderung des ProduktesAblagerungen von HefeKontaminationenBelagbildungSchimmel am ZapfhahnBiersteinVerfärbung der Leitungsofort, aber z.T. unbedenklich1-2 Tage bis zum Fassverderbmehrere Tage2-3 Tage, Anlagenstörungmehrere Wochen, Anlagenstörungmehrere MonateZu Beginn ist die Anlage sauber - Ausgangssituation: 1.Im Laufe der zeit nimmt die Verschmutzung,was jedoch mit dem unbewaffneten Auge nicht sichtbar ist, zu. Nach einerbestimmten Zeit wird nun gereinigt: 2. Im optimalen Fall wird mit Punkt 3 wieder die Ausgangssituationerreicht. Dies hängt u.a. von der Wahl des Reinigungsverfahrens ab.Eine Mechanische Reinigung geht sehr effektiv gegen Verschmutzungen vor, kann aberkeine Keimfreimachung garantieren. Chemische Verfahren können keimfreie Verhältnisseerreichen.Die Abbildung zeigt auch, dass die mittlere Verschmutzung der Anlage durchaus sehr hochsein kann: 4. Dadurch ist es möglich, daß die Geschmacksschwelle von z.B. infektionsbedingtemDiacetyl im ausgeschenkten Bier überschritten wird.. Wird dagegen häufiger gereinigt,liegt der mittlere Verschmutzungsgrad sehr viel niederiger: 5.Die Erfahrung zeigt, dass die Reinigungshäufigkeit einen viel höheren Einfluss auf die mittlereVerschmutzung einer Anlage hat, als die Art des Reinigungsverfahrens. Tabelle 2 gibteinen Überblick über die Minimalanforderungen der Reinigung bestimmter Anlagenteile.Tabelle 2: Übersicht über minimale ReinigungsanforderungenGegenstandTermin3
Zapfarmaturen, Getränkeleitungenincl. zwischengeschaltete Bauteilewechselweise mit Luft undGetränke berührter ArmaturteilGrundstoffleitungenLeitungsanschlussteileHinterdruckgestaltungGetränke-, Grundstoffbehälterunmittelbar vor erster Inbetriebnahmealle 2 Wochen<strong>bei</strong> jedem Wechsel der Getränkeartvor Unterbrechung (> 1 Woche)täglich einmalunmittelbar vor erster Inbetriebnahmealle 3 Monate<strong>bei</strong> Grundstoffwechselvor Unterbrechung (> 1 Woche)vor jedem Anschlußnach Herausnahme aus Behälteralle 12 Monatevor Befüllenwenn Betreiber selbst fülltAuf Grund der besonderen Eigenschaften von Schmutz kann dessen Struktur von kristallinbis hochviskos schleimig beschrieben werden. Die Haftung an Oberflächen der Schankanlagereicht von gering (Flockenbildung) bis hoch (und zwar durch Belagsbildung). Antrocknenerhöht die Festigkeit des Schmutzes und muss unbedingt vermieden werden (Bsp.Leergefahrene Anlagen), d.h. nicht gereinigte <strong>Schankanlagen</strong> müssen stets unter Flüssigkeitstehen. Entstehungsorte von Schmutz sind die Leitungsinnenwand (gut und leicht zureinigen), Innenflächen von Armaturen (mögliche Problemzone) und Verschraubungen sowieEinbauten (mögliche Problemzonen).Mikrobiologische SituationIn diversen Untersuchungen an <strong>Schankanlagen</strong> wurden in jüngster Vergangenheit teilweisesehr hohe Keimzahlen (10.000 – 100.000 Keime /ml) gefunden. Darüber hinaus wurdenpathogene Keime gefunden. Es ließen sich unter anderem Klebsiellen, Shigellen, Escherichiacoli, Staphylokokken, Schimmelpilze, wilde Hefen und andere mehr nachweisen.In Bier können, so Prof. Back (Lehrstuhl für Technologie der Brauerei I, TU-München-Weihenstephan) nach bisherigen Erfahrungen keine Krankheitserreger (pathogene Keime)überleben. Die Milieubedingungen innerhalb einer Bierleitung, die korrekt gepflegt wurde,lassen aufgrund des fehlenden Sauerstoffes und des Alkoholgehaltes zunächst kein Wachstumfür solche Keime zu. Nach Back werden pathogene Keime sogar abgetötet, wenndiese dem Bier zugesetzt werden. Trotzdem kann ihr Vorhandensein nicht ausgeschlossenwerden. Allerdings müssen dann die Milieubedingungen beachtet werden: Wird eine Leitung,ein Zapfhahn oder ein anderes Bauteil ohne Reinigung mit Produkt benetzt sichselbst überlassen, können andere Keimgruppen wachsen, als das unter Normalbedingungender Fall ist. Außerdem kann innerhalb von Belägen, die sich aus Mikroorganismen oderderen Ausscheidungen an den Wänden von Bauteilen und Leitungen gebildet haben, einMilieu für pathogene Keime entstehen. Die Keime können von dort ins Bier geraten unddarin nachgewiesen werden, obwohl sie hier nicht überlebensfähig sind. Gleiches gilt fürmangelhaft gepflegte Gläserspüleinrichtungen. Das mit Getränkeresten versetzte Wasserermöglicht ebenfalls beste Bedingungen für Keime, die in Bier selbst nicht wachsen. Der4
schwämmchen dienen nur der gleichmäßigen Verteilung einer Infektion in der gesamtenSchankanlage und nicht mehr der Reinigung.Eine weitere Möglichkeit, mechanische Effekte <strong>bei</strong> der Leitungsreinigung auszuüben, ist derEinsatz einer turbulenten Zweiphasenströmung. Hier wird ein Gemisch aus Luftblasen undReinigungsflüssigkeit durch das Leitungssystem transportiert. Zwischen Luft und Wasserbesteht ein Dichteunterschied von etwa 500; d.h. auf die Wand bzw. auf kleine Hindernissean der Wand werden schnelle Stöße (Impuls I = m ⋅ v) ausgeübt. Dadurch wird dieGrenzschicht an der Wandung zerstört, der Ablösevorgang von Verunreinigungen beschleunigt.Dieser Reinigungseffekt bleibt auch <strong>bei</strong> Durchmesseränderungen der Leitungerhalten. Bei langen Leitungen und Anlagen mit vielen engen Einbauten ist darauf zu achten,dass sich die zweiphasige Strömung nicht entmischt.Chemische EffekteDie Aufgabe der Chemie ist es also, die Haftkräfte so weit zu vermindern, dass die Strömungden abgelösten Schmutz aus dem System heraustransportieren kann. Es wurde bereitsgezeigt, dass die Strömungskräfte größer sind als die Gewichtskräfte und somit füreine Transportfunktion ausreichen.Die chemische Wirkung ist über die Parameter Temperatur, Zeit und Konzentration zu beeinflussen.Bestandteile von ReinigungsmittelnEin Haupteffekt <strong>bei</strong> der Reinigung wird durch eine signifikante Verschiebung des pH-Wertes erreicht (Schröder, 1981). Die freien lonen der Säuren oder Laugen verändern dieStruktur der Haftkräfte. Unterstützt wird dieser Einfluss durch die Zugabe von Netzmitteln,die die Oberflächenspannung der Reinigungslösung stark vermindern. Das Eindringen inSpalten und das Unterwandern von Belägen wird dadurch erleichtert.Für die Reinigung von <strong>Schankanlagen</strong> sollen nur nichtschäumende Reinigungsmittel eingesetztwerden. Des weiteren dürfen die Reinigungsmittel <strong>bei</strong> den eingesetzten Werkstoffenkeine Korrosion verursachen. Bei Edelstahlleitungen sollte daher vom Einsatz chlorhaltigerMittel abgesehen werden. Bei Kunststoffschläuchen dürfen die eingesetzten Weichmacherbzw. die nicht vernetzten Monomere durch die Reinigungsmittel nicht herausgelöstwerden (Casson, 1982). Verzinnte Bierleitungen in älteren Anlagen werden sowohl vonalkalischen als auch sauren Reinigungsmitteln angegriffen.Entsprechend der Aufgabenstellung ist ein abgestimmtes Gemisch verschiedener Chemikaliennotwendig. Die konfektionierten Reinigungsmittel werden von verschiedenen Herstellernangeboten.Der ReinigungsvorgangZunächst müssen die Reinigungsmittelkomponenten durch die Verschmutzungsschichthindurchdiffundieren bzw. lokale Schmutzstellen von den Rändern her unterwandern. Dieablaufenden Reaktionen mit den Schmutzpartikeln sind sehr schnell. Anschließend folgteine Ablösung der gebildeten Komplexe von der Oberfläche. Jetzt kann die Strömung dieseKomplexe aus Schmutz und Reinigungskomponente abtransportieren.Der Reinigungsvorgang kann mit folgendem Schema dargestellt werden:6
Schmutz + Reinigungsmittel → Komplex → Lösung.Die Tendenz in der <strong>Reinigungstechnik</strong> geht dahin, soviel mechanische Energie wie nurmöglich in das System einzubringen und die Reinigungsmittelkonzentrationen so niedrigwie möglich zu halten. Systematische Untersuchungen über den Temperatureinfluss liegennoch nicht vor, die Erfahrung zeigt aber einen positiven Einfluss höherer Temperaturen(Auerwald, 1987; Grasshoff, 1980, 1983).ReinigungsverfahrenIn der Brauindustrie hat sich in den letzten Jahren das CIP-Konzept durchgesetzt. Rohrleitungenund Armaturen werden in einem Umlaufverfahren gereinigt. Ansätze für eine Übernahmedes CIP-Konzepts zeigen sich schon <strong>bei</strong> der <strong>Schankanlagen</strong>reinigung. Die zu reinigendenLeitungsteile werden zu einem Umlaufverfahren gereinigt. Ansätze für eine Übernahmedes CIP-Konzepts zeigen sich schon <strong>bei</strong> der <strong>Schankanlagen</strong>reinigung. Die zu reinigendenLeitungsteile werden zu einem Kreislauf zusammengeschaltet. In den Kreislaufwird ein Steuergerät integriert. Das Steuergerät soll in der Lage sein, z.B. Dosieraufgabenvon Reinigungs- und/oder Desinfektionskomponenten zu übernehmen, die Strömungsrichtungim Kreislauf umzukehren, Spülschritte zu schalten, u.v.a.m. Die Konzentrationseinstellungsollte bevorzugt durch Portionspackungen der Chemikalien erfolgen. In der Gastronomieist es nicht sinnvoll, die Reinigungslösung wie in der Brauerei zu stapeln. Hier wirdsinnvollerweise das Prinzip einer verlorenen Reinigung angewendet. Nach Gebrauch wirddie Lösung in geeigneter Verdünnung in die Kanalisation abgelassen. Bei starken Verschmutzungenist ein Vorspülschritt mit Lauge vorzusehen. Dadurch werden grobe Verunreinigungenentfernt, die <strong>bei</strong>m Hauptreinigungsschritt einen Großteil der wirksamen Komponentenbinden würden.Reinigungsverfahren in der PraxisNach vielen Untersuchungen haben sich folgende Verfahren für die Reinigung von bierberührtenTeilen der Getränkeschankanlage als optimal erwiesen. Die folgenden Konzeptesind zwar ar<strong>bei</strong>tsintensiv, aber als Idealzustand anzusehen bzw. anzustreben. Hier werdenauch die Bierbrauer in die Pflicht genommen, ihr produziertes Bier nicht an der Rampe zuvergessen, sondern einen gewissen Einfluss auf die Qualität ihrer Biere im Glas des Gastronomiekundenzu nehmen.Die Grundreinigung der SchankanlageDie Grundreinigung wird durchgeführt <strong>bei</strong> Inbetriebnahme einer Schankanlage, nach längerenBetriebspausen und <strong>bei</strong> groben Verschmutzungen der Anlage. Darüber hinaus empfehlenwir eine Anwendung der Grundreinigung ebenfalls in regelmäßigen Zeitabschnitten,vielleicht vierteljährlich. Das Reinigungsprogramm (Idealkonzept) lautet folgendermaßen:1. Vorspülen der Leitung: 2 min;2. Umpumpen einer 2 % igen alkalischen Reinigungslösung unter Zugabe von Schwammgummibällchen:20 min (empfohlener Temperaturbereich: 30°C);3. Pulsierende Zwischenspülung mit warmem Wasser: 3 min;4. Umpumpen einer sauren Reinigungslösung im Kreislauf unter Zugabe von Schwamm-7
gummibällchen: 15 min:5. Zwischenspülung mit warmem Wasser und frischen keimfreien Schwammgummibällchen:5 min;6. Umpumpen einer Desinfektionslösung: 15 min;7. Pulsierende Nachspülung mit kaltem Wasser: 5 min.Dieses Grundreinigungsverfahren für <strong>Schankanlagen</strong> ist zwar sehr aufwendig, dennochsollten die angegebenen Zeiten nicht unterschritten werden; der Reinigungseffekt ist sonstin Frage gestellt. Bei Untersuchungen zur Wirksamkeit der CIP-Reinigung in Armaturenwurde festgestellt, dass <strong>bei</strong> Verwendung von kalten Reinigungslösungen die Zeitdauer verdoppeltwerden musste, um den gleichen Reinigungseffekt wie <strong>bei</strong> der Reinigung mit 70-gradiger Lösung zu erzielen.Die regelmäßige Reinigung einer SchankanlageFür die regelmäßige Reinigung im 14-tägigen Rhythmus oder eine Bedarfsreinigung istfolgendes Reinigungsschema sinnvoll:1. Vorspülen mit warmen Wasser möglichst über 30°C: 3 min.2. Umpumpen einer 2 %igen alkalischen Reinigungslösung zusammen mit Schwammgummibällchen:15 min (empfohlener Temperaturbereich: 30°C);3. Nachspülen mit kaltem Wasser und frischen keimfreien Schwammgummibällchen: 3min.Falls kein warmes Wasser zur Verfügung steht, muß die Zeit für Punkt 2 der regelmäßigenReinigung um mindestens 5 min verlängert, besser noch verdoppelt werden.Wichtig ist, daß das Anstichrohr und der Anstichkopf mitgereinigt werden. Wenn dies unterbleibtdann ist die chemisch-mechanische Reinigung fast nutzlos.Reinigung der AnstichrohreIm Anhang zur Verordnung über technische Anforderungen an Getränkeschankanlagen(TA Schanl) finden sich unter Punkt 6 deutliche Hinweise auf den Problembereich Anstichrohr.Ebenso fordert der § 9 NR. 4 SchanIV explizit eine unverzügliche Reinigung der Anstichvorrichtungnach Herausnahme aus dem Fass.Das Anstichrohr muß so beschaffen sein, daß es in seiner ganzen Länge besichtigt werdenkann. Durch diese optische Überprüfung sollen Verschmutzungen der Rohrinnenwand erkanntwerden. Die TA Schanl schreibt in der Nr. 6.106 vor, daß in jedem Getränkelagerraumein Anstichrohr zum Ersatz bereitgehalten werden muß, leider entpuppt sich dieseVorschrift häufig als Wunschtraum. Im Normalfall stimmt der Termin des Leerwerdens desFasses und der regelmäßigen Reinigung nicht überein. Hier greift der § 9 Nr. 4 SchanIVund fordert eine unverzügliche Reinigung des Anstichdegens nach Herausnahme aus demFass, d.h. vor dem Anzapfen eines neuen Fasses.Im Rahmen der regelmäßigen Reinigung der Getränkeschankanlage kann jedoch auch derAnstichdegen in den Reinigungskreislauf integriert werden. Laut Nr. 6.104 TA Schanl mußdas Faß mit einer Absperrvorrichtung versehen sein, die ein Herausziehen des Anstichrohrsohne Druckgasverlust und ohne Bierverlust ermöglicht. Der Anstichdegen kann alsomitgereinigt werden und nach erfolgter Reinigung wieder in das Faß eingebracht werden.8
Beim Einsatz von Keg-Fässern entfällt der Problembereich "Anstichrohr", da hier das Rohrfester Bestandteil des Fasses ist und in der Brauerei <strong>bei</strong>m Befüllen regelmäßig mitgereinigtwird. Der Zapfkopf sollte aber mindestens <strong>bei</strong> jedem Fasswechsel mit warmem Wasser undeiner Bürste gereinigt werden, geeignete Bürsten findet man bereits im Handel. Da<strong>bei</strong> istauch das CO 2 -Ventil und die Rückschlagsicherung herauszunehmen und zu reinigen. Umden Kegzapfkopf in den Reinigungskreislauf zu integrieren, wurden spezielle Reinigungsadapterfür die verschiedenen Zapfköpfe entwickelt.Der seitlich sichtbare Anschluss wird mit dem Wassernetz verbunden. Nach der Leitungsreinigungwird die Getränkeleitung wieder mit dem Zapfkopf verschraubt. Der Zapfkopf wirdnun auf den Reinigungskreislauf zu integrieren, wurden spezielle Reinigungsadapter für dieverschiedenen Zapfköpfe entwickelt.Der seitlich sichtbare Anschluss wird mit dem Wassernetz verbunden. Nach der Leitungsreinigungwird die Getränkeleitung wieder mit dem Zapfkopf verschraubt. Der Zapfkopf wirdnun auf den Reinigungsadapter gesetzt und die Frischwasserzufuhr geöffnet. Der Zapfkopfund die Leitung werden nochmals gespült.Ideal ist aber eine vollständige Integration des Zapfkopfes in die Kreislaufreinigung der Getränkeleitungen.Der Kreislauf wird über zwei solche Adapter hergestellt. Bei den derzeitigüblichen Kegzapfköpfen muss nun aus einem Zapfkopf die Rückschlagsicherung entferntwerden. Damit kann der Kreislauf zumindest in einer Richtung befahren werden. Der gesamteManipulationsaufwand vermindert sich, es müssen die Zapfköpfe vom Faß auf dieReinigungsadapter umgesetzt werden. Eine Verbesserung bringt der Ersatz durch einenKugelhahn, optimal wäre natürlich eine konstruktive Umgestaltung der Rückschlageinrichtung.Gastwirte, die ihre Leitungen durch gewerbsmäßige Reinigungsfirmen reinigen lassen,müssen bedenken, daß diese Firmen im Normalfall <strong>bei</strong> der Leitungsreinigung die Anstichvorrichtungnicht mitreinigen. Der Gastwirt muß daher die Kontrolle und gegebenenfalls dieReinigung selbst durchführen oder seinen Vertrag entsprechend erweitern.Potentielle Gefahrenstellen an SchankarmaturenDie Bemühungen um eine keimarme Leitung und keimarme Zapfhähne sind unnütz, wenndurch ungereinigte, infizierte Ansticharmaturen, Zapfköpfe, Bierfänger und Lippenventiledas Getränk direkt hinter dem Faß mit Mikroorganismen kontaminiert wird. Es müssen alsounbedingt alle Anlagenteile in die Reinigung integriert werden: CO 2 -Anschluß am Anstichkörper, Lippenventile; Anstichkörper mit Rückschlagsicherung; Keg-Anschlußkopf; Absperrhahn in der Bierleitung; Verschraubungen; Zapfhähne: ohne Kompensator, mit Kompensator, Entlüftungsbohrung.Abbildung ES1 zeigt biologische Abstrichproben nach der Reinigung einzelner Bestandteile<strong>bei</strong>m Offenausschankanlagen.Ein weiterer Problemkreis tritt auf, wenn eine Schankanlage nur mechanisch gereinigt wird,9
aber in großen Zeitabständen eine chemische Reinigung durchgeführt wird. Ist nun daschemische Reinigungsprogramm zu kurz bemessen, kann folgendes passieren: Währendder chemischen Reinigung werden aufgrund der geringen Zeit zwar die vorhandenen Belägeangelöst, aber nicht abgelöst. Die Ablösung und der Austrag aus dem Leitungssystemerfolgen erst mit dem Getränk. Diese unangenehmen Erscheinungen lassen sich durcheine ausreichende Einwirkzeit vermeiden.Überprüfung des hygienischen Zustands einer Getränkeschankanlage durchden Betreiber und Erkennbarkeit des VerschmutzungsgradesEine Gefährdung des Lebensmittels Bier bzw. AfG in Getränkeschankanlagen bestehthauptsächlich durch die Infektion mit Mikroorganismen, die im Biermilieu bzw. AfG-Milieuwachsen und sich vermehren können. Dieses Wachstum, das durch hohe Temperaturen imFassbierlagerraum gefördert wird, kann zu• Geschmacksveränderungen im Bier;• Trübungen im Bier;• Kolonienbildung der Mikroorganismen;• Ansätzen und Verkrustungen im Leitungssystemführen. Jeder Wirt ist gehalten, <strong>bei</strong> der Wiederaufnahme des Zapfens den Leitungsinhalt,der sich über Nacht im System befand, im Interesse seiner Kundschaft zu vernichten. Alsverantwortungsvoller Gastronom wird er sich mittels einer Kostprobe und einer visuellenPrüfung auf Flocken oder Trübung von der unveränderten Qualität des Getränks überzeugen..Der flexible Übergang vom Anstichrohr auf den festverlegten Leitungsteil besteht meistensaus einem durchsichtigen Kunststoffschlauch. Hier bieten sich ebenfalls gute Möglichkeiteneiner visuellen Kontrolle des Zustands der Leitungsinnenseite an.Ebenso soll <strong>bei</strong> jedem Fasswechsel das Anstichrohr gereinigt werden. Hier<strong>bei</strong> ist vor undnach der Reinigung eine visuelle Prüfung der Rohrinnenseite sinnvoll. Es können so leichtAnsätze, Verkrustungen und Kolonienbildung von Mikroorganismen festgestellt werden.Befinden sich derart grobe Verunreinigungen im Rohr, ist das Ersatzrohr zu verwenden undeine Grundreinigung der Anlage vorzusehen.Ein verantwortungsvoller Gastronom wird im Sinne der Qualität des Biers und im Sinne derVerantwortung für seine Kundschaft mindestens einmal wöchentlich <strong>bei</strong>m Fasswechselpersönlich anwesend sein und diese Kontrollen durchführen.Der Bierstein bildet sich an jeder produktberührten Oberfläche. Die Oberfläche wird dadurchrauher und bietet so ideale Bedingungen für die Ansiedlung von Mikroorganismen.Die Mikroorganismen werden normalerweise <strong>bei</strong>m Anzapfvorgang eingeschleppt. Werdeneinzelne Zellen aus der Umgebung eingeschleppt, dauert es mit Sicherheit länger als 14Tage, bis sich eine massive Infektion einstellt, die eine Gefahr für das Produkt darstellt.Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass die wesentlichen Einflussfaktoren für diemikrobiologische Situation <strong>bei</strong>m Offenausschank von Bier abhängen vom Konsum, derLänge der Getränkeleitung, dem Hygienic Design der Bauteile, der Außentemperatur derKühlzelle des Wirts sowie der Art und Weise der Reinigung.10
Grundsatzregeln für den FassbierausschankIm folgenden sollen die wichtigsten Regeln, die den ordnungsgemäßen Ausschank vonFassbier betreffen zusammenfassen aufgelistet werden:• Der Kunde sollte ein Fass in maximal 2 Tagen aufgebraucht haben• Volle Fässer dürfen nie der Sonne ausgesetzt werden• Das Bier muss vor Frost geschützt sein• Das Bierfass muss vor Verschmutzungen bewahrt werden• Jedes Fass im Anstich erfordert ein weiteres Fass, welches bereits die gleicheTemperatur aufweist• Ist ein Bierfass einmal angeschlossen, so darf die CO 2 -Zufuhr nicht mehr geschlossenwerden• Es ist stets das älteste Fass zum Ausschank zu bringen• In der Ausschanktheke darf außer Bierfässer nichts anderes untergebracht sein• Es ist sicherzustellen, dass in einer Theke ausschließlich das Bier zum Ausschankkommt, das von der Vertragsbrauerei geliefert wurde• Die Aufschrift bzw. das Logo des Bierglases muss dem eingeschenkten Bier entsprechen• Nur gut gewaschene und gut ausgespülte Gläser verwenden• Gläser nicht ausreiben: es ist besser sie auf einem geeigneten Gestell abtropfenlassen• Bevor sie eingeschenkt werden, mit frischem Wasser ausspülen, da<strong>bei</strong> kühlen sieab und werden auf der Glasinnenseite mit Wasser benetzt• Beim Einschenken darauf achten, dass keine Wirbel entstehen, <strong>bei</strong> einem ruhigenBierfluss entbindet sich weniger Kohlensäure• Das Glas geneigt halten• Schankhahn vollständig öffnen• Das Bier nicht in das Glas „fallen“ lassen• Das Bier entlang des Glases einfließen lassen• Etwa zu 2/3 das Glas einschenken; warten bis der Schaum kompakt wird und mit• 2-3 mal auffüllen, da<strong>bei</strong> muss sich eine Schaumkrone ausbilden (Dauer: etwa 1 Minute)• Sofort servieren• Wenn möglich nie „vorschenken“• Sog. „Nachtwärter“ (das in der Leitung über Nacht verbliebene Bier) werden weggeschüttet„7-Minutenbiere“ sind abgestandene Biere, das gilt auch für das PILS!·Für die Reinigung der Anlagen dürfen ausschließlich die von der Vertragsbrauerei zugelasseneMittel verwendet werden11