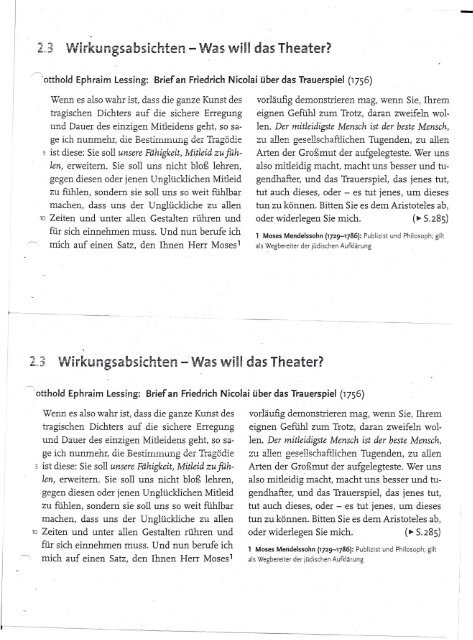2,3 Wirkungsabsichten - Was will das Theater? 2,3 ...
2,3 Wirkungsabsichten - Was will das Theater? 2,3 ...
2,3 Wirkungsabsichten - Was will das Theater? 2,3 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
~<br />
2,3 <strong>Wirkungsabsichten</strong> - <strong>Was</strong> <strong>will</strong> <strong>das</strong> <strong>Theater</strong>?<br />
/""'<br />
.otthold Ephraim Lessing: Brief an Friedrich Nicolai über <strong>das</strong> Trauerspiel (1756)<br />
Wenn es also wahr ist, <strong>das</strong>s die ganze Kunst des<br />
tragischen Dichters auf die sichere Erregung<br />
und Dauer des einzigen Mitleidens geht, so sage<br />
ich nunmehr, die Bestimmung der Tragödie<br />
5 ist diese: Sie soll<br />
len, erweitern. Sie soll uns nicht bloß lehren,<br />
.gegen diesen oder jenen Unglücklichen Mitleid<br />
zu fühlen, sondern sie soll uns so weit fühlbar<br />
machen, <strong>das</strong>s uns der Unglückliche zu allen<br />
10 Zeiten und unter allen Gestalten rühren und<br />
für sich einnehmen muss. Und nun berufe ich<br />
mich auf einen Satz, den Ihnen Herr Moses1<br />
vorläufig demonstrieren mag, wenn Sie, Ihrem<br />
eignen Gefühl zum Trotz, daran zweifeln wollen.<br />
ist beste<br />
zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen<br />
Arten der Großmut der aufgelegteste. Wer uns<br />
also mitleidig macht, macht uns besser und tugendhafter,<br />
und <strong>das</strong> Trauerspiel, <strong>das</strong> jenes tut,<br />
tut auch dieses, oder - es tut jenes, um dieses<br />
tun zu können. Bitten Sie es dem Aristoteles ab,<br />
oder widerlegen Sie mich. (••.5.285)<br />
1 Moses Mendelssohn (1729-1786): Publizist und Philosoph; gilt<br />
als Wegbereiter der jüdischen Aufklärung<br />
2,3 <strong>Wirkungsabsichten</strong> -<strong>Was</strong> \4\(111 <strong>das</strong> <strong>Theater</strong>?<br />
'otthold Ephraim Lessing: Brief an Friedrich Nicolai über <strong>das</strong> Trauerspiel (1756)<br />
Wenn es also wahr ist, <strong>das</strong>s die ganze Kunst des<br />
tragischen Dichters auf die sichere Erregung<br />
und Dauer des einzigen Mitleidens geht, so sage<br />
ich nunmehr, die Bestimmung der Tragödie<br />
5 ist diese: Sie soll -<br />
10<br />
len, erweitern. Sie soll uns nicht bloß lehren,<br />
gegen diesen oder jenen Unglücklichen Mitleid<br />
zu fühlen, sondern sie soll uns so weit fühlbar<br />
machen, <strong>das</strong>s uns der Unglückliche zu allen<br />
Zeiten und unter allen Gestalten rühren und<br />
für sich einnehmen muss. Und nun berufe ich<br />
mich auf einen Satz, den Ihnen Herr Moses 1<br />
,-......<br />
vorläufig demonstrieren mag, wenn Sie, Ihrem<br />
eignen Gefühl zum Trotz, daran zweifeln wollen.<br />
ist beste<br />
zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen<br />
Arten der Großmut der aufgelegteste. Wer uns<br />
also mitleidig macht, macht uns besser und tugendhafter,<br />
und <strong>das</strong> Trauerspiel, <strong>das</strong> jenes tut,<br />
tut auch dieses, oder - es tut jenes, um dieses<br />
tun zu können. Bitten Sie es dem Aristoteles ab,<br />
oder widerlegen Sie mich. (••.5.285)<br />
1 Moses Mendelssohn (1729-1786): Publizist und Philosoph; gilt<br />
als Wegbereiter der jüdischen Aufklärung I<br />
-<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I
Beispiel: Während in Goethes Drama [... ] zum Ausdruck kommt, so zeigt sich bei Büchner [... ],<br />
was nach Lessing darauf hinweist, [... ].<br />
und<br />
die ...<br />
4. Fazit<br />
• Rückbezug auf den Schwerpunkt Ihrer Untersuchung<br />
Beispiel: Der Vergleich der beiden Dramen bezogen auf Lessings Dramentheorie ergab, <strong>das</strong>s [... ],<br />
weswegen geschlossen werden kann, <strong>das</strong>s [... ].<br />
• Bezug zum Unterricht oder zu anderem Wissen!<br />
I Beispiel: Allerdings besagen andere Dramentheoretiker wie [... ], <strong>das</strong>s [... ]<br />
• Bezug zu der Epoche<br />
Beispiel: Berücksichtigt man jedoch, <strong>das</strong>s Lessing selbst der klassischen aufklärerischen Epoche<br />
zugeordnet wird, so ergibt sich für die Gegenüberstellung der Dramen der neue Gesichtspunkt,<br />
<strong>das</strong>s [... ] ODER<br />
Unter Berücksichtigung der Zeit und damit der verschiedenen literarischen und auch<br />
dramentheoretischen Strömungen, lässt sich sagen, <strong>das</strong>s [... ]<br />
• Ihre Stellungnahme, Ihre Aufassung zur Theorie bezogen auf die Dramen und<br />
eventuell weiteren Dramen oder mit Bezug auf heutiges <strong>Theater</strong>, heutige<br />
Inszenierungen der benannten Dramen und was sich verändert hat.<br />
----------------------~
\<br />
W;tJ)O ~<br />
I I I I<br />
Sachtexterschließung durch Visualisierung<br />
Gedankliche Zusammenhänge in Sachtexten lassen Flussdiagram stellen anders als Strukturdiasich<br />
durch eine Visualisierung häufig besser ver- gramme nie t in erster Linie die Zusammenhänge<br />
stehen und veranschaulichen. Geeignete Formen eines Sachverhalts oder eines Textes dar, sondern<br />
sind neben der Mind-Map vor allem <strong>das</strong> Struktur- visualisieren einen linearen Ablauf. Es empfiehlt<br />
diaqramm und <strong>das</strong> Flussdiagramm. sich, die aufgezeigten Strukturen in den Struktur-<br />
DaG"trukturdiagram3- stellt die innere Logik und Flussdiagrammen zusätzlich farbig und mit<br />
\!!!.g..StJ;.uktw;..e.i,nes..S.a&lJy.er.halts. in verzweigter entsprechenden Symbolen zu kennzeichne<br />
Struktur dar. Bei der Textanalyse hilft <strong>das</strong> Struktu .••• ru ur- un F ussdiagramme erleichtern nicht<br />
diagramm dementsprechend, den gedanklichen nur die Erschließung von Sachtexten, sondern<br />
Aufbau bzw. die Argumentationsstruktur eines können auch bei der Textproduktion (z. B. bei der<br />
Textes zu erschließen. Gliederung) heranzezozen.werden.<br />
~, I~<br />
'I -----"=--'1 ;-1"":::::>---------'1<br />
l"t~ l"t~<br />
DDDDDD<br />
Strukturdiagramm<br />
D~O:§s:D-D~D<br />
Flussdiagramm<br />
INFO<br />
J
Vergleich zweier Tragödien aus der Zeit des Epochenumbruchs vom 18. zum 19. Jahrhundert<br />
Vergleichsaspekte "Iphigenie auf Tauris" "Woyzeck"<br />
Aufbau - Gliederung<br />
Handlungsführung -<br />
Spannungsaufbau<br />
Gestaltung von Anfang bis<br />
Schluss<br />
Ort und Zeit - zeitliche<br />
Zusammenhänge<br />
Figuren (Herkunft, Stand,<br />
Lebensumstände,<br />
Handlungsmotive, Eigenschaften)<br />
Figurenkonstellation<br />
a) Zeichnen Sie zur besseren Veranschaulichung eine Verlaufsübersicht zur .Jphigenie" und zum "Woyzeck" mit den wesentlichen<br />
Handlungsmomenten.<br />
b) Ergänzen Sie die Tabelle um Angaben zur Struktur und zum Inhalt der beiden Dramen, markieren Sie auffällige Unterschiede.<br />
c) Erläutern Sie, welche mögliche Wirkung auf <strong>das</strong> Publikum oder welcher Spielraum für eine Inszenierung durch die spezifische Struktur gegeben<br />
. ist.
~ Zusatzmaterial<br />
Heilung durch die Götter<br />
~<br />
Wir kehren zu unserer Frage zurück: Hat Iphigenie<br />
den Orest geheilt? Davon kann keine Rede sein. Hat<br />
der Erschöpfungsschlaf die Heilung bewirkt? Das<br />
wäre doch eine äußerliche, fade Motivierung. Wir<br />
5 dürfen übrigens annehmen, <strong>das</strong>s Orest sich nicht<br />
zum ersten Mal bis zur Erschöpfung ausgetobt habe,<br />
doch ohne <strong>das</strong>s daraus eine Heilung hervorgegangen<br />
wäre.<br />
Wo liegt denn die Ursache der Heilung? Die Ant-<br />
10 wort ist sehr einfach: Die Götter haben ihn geheilt.<br />
Dass Goethe so verstanden sein möchte, deutet er<br />
durch <strong>das</strong> Gebet Iphigeniens an die himmlischen<br />
Geschwister an. In dem Augenblick, da Iphigenie<br />
betet, ist aber Orest schon geheilt, und zwar durch<br />
15 Intervention 1 der Götter, die damit ihre feierlich gegebene<br />
Zusage erfüllen. Apoll hat dem Orest <strong>das</strong><br />
Orakel gegeben:<br />
"Bringst du die Schwester, die an Tauris' Ufer<br />
Im Heiligtume wider Willen bleibt,<br />
20 Nach Griechenland, so löset sich der Fluch" (V. 6)<br />
[...]<br />
Orest, vom Freunde angetrieben, hat sich, wenn<br />
auch ohne Zuversicht, auf den Weg gemacht. Nun<br />
steht er im Heiligtume der Schwester gegenüber.<br />
25 Die gegenseitige Erkennung hat stattgefunden.<br />
Jetzt muss der Fluch sich lösen, gemäß der göttlichen<br />
Zusage. Und er löst sich auch. Iphigenie ist<br />
dabei gar nicht im Spiel. Die Heilung Orests hat keinen<br />
psychologischen oder psychiatrischen Hinter-<br />
Heilung<br />
grund. Nicht einmal <strong>das</strong> Gebet der Iphigenie ist die 30<br />
Ursache der Heilung, denn Orest war geheilt, als sie<br />
betete. Die transzendente Schuld und Strafe des<br />
Orest wird behoben durch transzendente Erlösung.<br />
Diese ist Göttergabe. Einem antiken Publikum wäre<br />
dieses Verständnis ganz selbstverständlich ge- 35<br />
wesen.<br />
Dass die Heilung des Orest gleich nach der Erkennungsszene<br />
geschieht, hat natürlich seine Bedeutung.<br />
Dadurch interpretiert der Gott die Meinung<br />
des Orakels: Dies ist die Schwester, von der der 40<br />
Gott redet.<br />
Aber Goethe konnte doch nicht an ein antikes Publikum<br />
.denken. Er schrieb für heutige Leser (Zuschauer).<br />
Die antike Form verstehen wir als Travestie?<br />
modemen Erlebens. Danach ist für uns die 45<br />
Furienbesessenheit Orests eine Metapher für<br />
schwere Gemütszerrüttung oder temporären Wahnsinn.<br />
[... ] Bedingt solche laufende Umdeutung des<br />
Dramas durch den modemen Zuschauer nicht auch<br />
eine veränderte Motivation? [... ] Möchte Goethe 50<br />
[... ] die Heilung als eine Gottesgabe verstanden<br />
wissen? Dies ist es, was wir allerdings glauben ...<br />
1 Intervention = Vermittlung, Einmischung<br />
2 Travestie = Umkleidung, Umbildung<br />
Werner Hodler: Zur Erklärung von Goethes "Iphigenie" . In: Gerrnanisch-romanische<br />
Monatsschrift (10) 1960, S. 159f.
~<br />
Erlösung durch reine Menschlichkeit<br />
Hein -Otto<br />
[...] Indem Orest allmählich begreift, wen er vor<br />
sich hat, erscheint ihm die Tatsache, <strong>das</strong>s nun die<br />
Schwester den Bruder am Altar wird opfern müssen,<br />
als "letzte, grässlichste" Auswirkung des Göt-<br />
5 terzorns. Mit Iphigenie jedoch fühlt er plötzlich tiefes<br />
Mitleid:<br />
Weine nicht! Du hast nicht Schuld.<br />
Seit meinen ersten Jahren hab' ich nichts<br />
Geliebt, wie ich dich lieben konnte, Schwester.<br />
10 Eine ganz neue Innigkeit bricht in diesen Worten<br />
auf. Danach heißt es von Orest: "Er sinkt in Ermattung."<br />
(Ende des zweiten Auftritts). "Aus seiner<br />
Betäubung erwachend" hat er einen Wachtraum,<br />
eine Halluzination. Er sieht im Hades alle<br />
15 seine Ahnen friedlich und freudig vereint, und auch<br />
ihn selbst, den Mörder Klyteirnnestras, heißen sie<br />
<strong>will</strong>kommen. Die Wut der Rache ist erloschen. Nur<br />
Tantalus bleiben "grausame Qualen ... fest angeschmiedet"<br />
.<br />
20 Im dritten Auftritt findet dann Orest zur Tageswelt,<br />
zu Iphigenie und Pylades zurück [...]<br />
Die Eumeniden, die Furien, die Geister der Rache<br />
haben ihre Macht über Orest verloren.<br />
Ausdrücklich nennt dieser im vierten Aufzug Iphi-<br />
25 genie seine Retterin (V. 1545) und sagt noch im<br />
. fünften (V. 2119f.);<br />
... Von dir berührt<br />
War ich geheilt, in deinen Armen fasste<br />
Das Übel mich mit allen seinen Klauen<br />
30 Zum letzten Mal und schüttelte <strong>das</strong> Mark<br />
Entsetzlich mir zusammen; dann entfloh's<br />
Wie eine Schlange zu der Höhle.<br />
Goethe nimmt <strong>das</strong>, den Sinn abstrahierend, wieder<br />
auf mit seiner Versformel, <strong>das</strong>s "Alle menschliche<br />
35 Gebrechen/Sühnet reine Menschlichkeit." Durch<br />
<strong>das</strong> Bild der Schlange und <strong>das</strong> Wort "sühnet"<br />
schimmert fern und wie verwischt noch immer etwas<br />
vom Hintergrund biblischer Theologie. Im Vordergrund<br />
steht, die Szene, <strong>das</strong> Geschehen bestimmend,<br />
Iphigenies reine Menschlichkeit. 40<br />
So hat es Goethe ohne Zweifel gemeint. So ist es<br />
aber auch Wirklichkeit im Drama. Orest, den Furien<br />
ausgeliefert, lebt unter dem Bann seiner furchtbaren<br />
Schuld. Alles, was ihm begegnet, wird, psychologisch<br />
gesprochen, in seinen Schuldkomplex 45<br />
und Verfolgungswahn einbezogen, bis er die<br />
Schwester sieht, mit den Augen des Herzens. Da<br />
empfindet er tiefes Mitleid. Liebe, wie er sie nie gekannt,<br />
liegt als Möglichkeit in diesem Mitleid beschlossen.<br />
Eine neue Hoffnung und Gewissheit er- 50<br />
greift von seiner Seele Besitz, der Glaube an die<br />
Macht solcher Liebe. Sie söhnt die Menschen miteinander<br />
aus und heilt die Qualen des Schuldgefühls.<br />
Das wird durch die Hadesvision veranschaulicht<br />
und mit den Worten Orests bestätigt: "Es löset 55<br />
sich der Fluch, mir sagt's <strong>das</strong> Herz ...",<br />
Der Vorgang scheint mir, wie gesagt, sowohl ein<br />
Höhepunkt in der Evokation reiner Menschlichkeit<br />
als auch ein sinnvolles Glied im ideellen Nexus des<br />
Dramas zu sein, geistig nachvollziehbar und von 50<br />
starker Überzeugungskraft. Unversehens hat sich<br />
uns freilich der Aspekt der Interpretation vom Mythologischen<br />
und Theologischen zum Psychologischen<br />
hinüber verschoben. Weist <strong>das</strong> auf eine Willkür<br />
der Interpretation oder hat der Wechsel im 65<br />
Wesen der Goethe'schen Dichtung seinen Grund?<br />
Ich möchte Letzteres meinen. Denn während sich<br />
in der Darstellung von Orests Schuld als Erbschuld<br />
die Dimension transzendenter Wahrheit auftut, wird<br />
die Befreiung Orests von den Furien, die Lösung 70<br />
des Schuldgefühls, als innerseelisches Ereignis vorgeführt<br />
[...]<br />
Heinz-Otte Burger: Zur Interpretation von Goethes Iphigenie. In: Germanisch-romanische<br />
Monatsschrift 9 (1959), S. 269ff.<br />
97
• Friedrich Schiller (1759-1805)<br />
Ankündigung<br />
Die Horen", eine Monatsschrift, von einer Gesellschaft<br />
verfasst und herausgegeben von Schiller 2<br />
Zu einer Zeit, wo <strong>das</strong> nahe Geräusch des Lesers, den der Anblick der Zeitbegebenhei-<br />
Kriegs 3 <strong>das</strong> Vaterland ängstiget, wo der ten bald entrüstet, bald niederschlägt, eine<br />
Kampf politischer Meinungen und Interessen fröhliche Zerstreuung gewähren. Mitten in 35<br />
diesen Krieg beinahe in jedem Zirkel erneuert diesem politischen Tumult soll sie für Musen-<br />
5 und nur allzu oft Musen und Grazien daraus und Charitinnen" einen vertraulichen Zirkel<br />
verscheucht, wo weder in Gesprächen noch schließen, aus welchem alles verbannt sein<br />
in den Schriften des Tages vor diesem allver- wird, was mit einem unreinen Parteigeist gefolgenden<br />
Dämon der Staatskritik Rettung ist, stempelt ist. Aber indem sie sich alle Bezie- 40<br />
möchte es ebenso gewagt als verdienstlich hungen auf den jetzigen Weltlauf und auf die<br />
10 sein, den so sehr zerstreuten Leser zu einer nächsten Erwartungen der Menschheit ver-<br />
Unterhaltung von ganz entgegengesetzter Art bietet, wird sie über die vergangene Welt die<br />
einzuladen. In der Tat scheinen die Zerturn- Geschichte und über die kommende die Phistände<br />
einer Schrift wenig Glück zu verspre- losophie befragen, wird sie zu dem Ideale ver- 45<br />
ehen, die sich über <strong>das</strong> Lieblingsthema des edelter Menschheit, welches durch die Ver-<br />
15 Tages ein strenges Stillschweigen auferlegen nunft aufgegeben, in der Erfahrung aber so<br />
und ihren Ruhm darin suchen wird, durch et- leicht aus den Augen gerückt wird, einzelne<br />
was anders zu gefallen, als wodurch allesjetzt Züge sammeln und an dem stillen Bau bessgefällt.<br />
Aber je mehr <strong>das</strong> beschränkte Inte- rer Begriffe, reinerer Grundsätze und edlerer 50<br />
resse der Gegenwart die Gemüter in Span- Sitten, von dem zuletzt alle wahre Verbesse-<br />
20 nung setzt, einengt und unterjocht, desto rung des gesellschaftlichen Zustandes abdringender<br />
wird <strong>das</strong> Bedürfnis, durch ein all- hängt, nach Vermögen geschäftigt sein. Sogemeines<br />
und höheres Interesse an dem, was wohl spielend als ernsthaft wird man im<br />
rein menschlich und über allen Einfluss der Fortgange dieser Schrift dieses einige Ziel 55<br />
Zeit erhaben ist, sie wieder in Freiheit zu set- verfolgen, und so verschieden auch die We-<br />
.25 zen und die politisch geteilte Welt unter der ge sein mögen, die man dazu einschlagen<br />
Fahne der Wahrheit und Schönheit wieder zu wird, so werden doch alle, näher oder entvereinigen.<br />
ternter, dahin gerichtet sein, wahre Humanität<br />
Dies ist der Gesichtspunkt, aus welchem die zu befördern. Man wird streben, die Schön- 60<br />
Verfasser dieser Zeitschrift dieselbe betrach- heit zur Vermittlerin der Wahrheit zu machen<br />
30 tet wissen möchten. Einer heitern und lei- und durch die Wahrheit der Schönheit ein<br />
denschaftfreien Unterhaltung soll sie gewid- daurendes Fundament und eine höhere Würmet<br />
sein, und dem Geist und Herzen des de zu geben.<br />
D Arbeiten Sie aus dem ersten Abschnitt heraus, mit welchen Themen sich die neu gegründete<br />
Zeitschrift nicht beschäftigen soll.<br />
D Stellen Sie aus dem zweiten Abschnitt heraus, welche Ziele die Zeitschrift Schiller zufolge<br />
verfolgen <strong>will</strong>.<br />
1 Die Horen: Griechische Göttinnen des Wachsens, Blühens und Reifens<br />
2 Textquelle: Friedrich Schiller: Sämtliche Werke. Fünfter Band. München: Carl Hanser Verlag, 1975, S. 870<br />
3 Gemeint ist der sogenannte 1. Koalitionskrieg, den Preußen und Österreich von 1792 bis 1797 gegen <strong>das</strong> revolutionäre<br />
Frankreich führten, um eine weitere Ausbreitung der Revolution zu verhindern.<br />
4 Musen: In der griechischen Mythologie Schutzgöttinnen der Künste und Wissenschaften<br />
5 Charitinnen (Singular: Charis): göttliche Dienerinnen, besonders Aphrodites und Apollons<br />
85
Linear in sich abgeschlossen sprunghaft, mit Aussparungen mehrsträngig<br />
Relative Eigenständigkeit einzelner Episoden ohne Sprunge oder Lücken<br />
logisch verknüpfte, psychologisch konsequente Abfolge (nicht austauschbar)<br />
Gliederung in Akte + Szenen, die sich zusammen fügen<br />
lose Folge von Bildern oder Stationen Reihung<br />
Szenen bilden eigenen Schwerpunkt Komposition Szenen funktional für den Zusammenhang<br />
große zeitliche Ausdehnung geringe Ausdehnung große zeitliche Distanz möglich<br />
Szenen schließen zeitlich aneinander an<br />
Viele Orte eingeschränkter bzw. gar kein Wechsel uneingeschränkte Wechsel Wenige Orte<br />
Einheitlich hoher gesellschaftlicher Stand der Protagonisten<br />
.Keine ständischen oder sozialen Beschränkungen bei den Handlungsträgem<br />
Motive der Figuren im Geistigen oder abgeklärt Seelischen<br />
Motive für die Figuren häufig im Kreatürlichen (Kreatur: geschaffenes, erdachtes, unschönes<br />
Wesen), Unbewussten oder Sozialen<br />
Vielfalt der Sprechweise (Alltagssprache, Dialekte) einheitliche, rhetorisch geformte Sprache<br />
Vorherrschen des aktionistischen Dialogs, der die Handlung vorantreibt<br />
häufig in Versform (Blankvers)<br />
verschiedene Gesprächsformen<br />
sprunghafte, stockende, zerfaserte Gespräche und Geplauder<br />
diese te den jede u<br />
soll.<br />
b) die in .<br />
c) die noch<br />
diese<br />
d) Und die in einen und die
Herrn DGK<br />
Dramentheorie zu Woyzeck und Iphigenie auf Tauris<br />
24.11.2010<br />
AUFGABE:.Überprüfen Sie Lessings Dramentheorie an<br />
den Dramen "W." und ,,1. a. T.".<br />
2~'"<br />
A. Alle lesen zunächst Lessings Brief mit dem Ziel, die Aufgabenstellung pot Text zu<br />
verstehen.<br />
B. Innerhalb der Gruppe wird überlegt, wer welche Teilaufgabe erfüllen kann. Legen Sie<br />
auch bereits jetzt fest, wer welche Gruppenaufgabe übernimmt: Zeitnehmer,<br />
Protokollant, Materialbeschaffer (falls nötig), Leiter, etc.<br />
C. Erstellen Sie aus den Teilaufgaben ein Ergebnisplakat hinsichtlich der<br />
AufgabensteIlung. ~ Zu diesem Zweck tauschen Sie sich aus und diskutieren Sie<br />
darüber, welche Ansicht zum <strong>Theater</strong> vertritt Lessing in seinem Brief<br />
Folgende Teilaufgaben gilt es zu verteilen:<br />
I. Anfertigung eines Strukturdiagramms zu dem Brief, was die Argumentationsstruktur<br />
darlegen soll (Thesen, Argumente, Beispiele, etc.)<br />
2. Zusammenfassung des Dramas "W.": <strong>Was</strong> passiert in dem Drama?<br />
3. Darlegung der Struktur von "W.": Visualisierung des Aufbaus, der Anordnung der<br />
Szenen. _<br />
4. Zusammenfassung des Dramas ,,1 a. T.": <strong>Was</strong> passiert in dem Drama?<br />
5. Darlegung der Struktur von ,,1 a. T.": Visualisierung des Aufbaus, der Anordnung der<br />
Szenen.<br />
Schließen Sie dieses Ergebnis bis zur nächsten Stunden (max. 10 min der nächsten Stunde)<br />
ab. (Damit sind die Teilergebnisse für <strong>das</strong> Gesamtergebnis als HA zu erledigen, wenn Sie <strong>das</strong><br />
nicht in der V-Stunde fertig stellen.)
--------------~----------.--------<br />
Überprüfen Sie Lessings Dramentheorie an dem Drama" Woyzeck" I<br />
von Büchner sowie an dem Drama "Iphigenie auf Tauris" von Goethe.<br />
~<br />
1. Einleitung zum Text von Lessing wie üblich.<br />
• Kurze inhaltliche u. formale Zusammenfassung bis zu drei Sätzen<br />
• eine Herleitung zum Arbeitsauftrag, was in Form einer Deutungshypothese<br />
2.<br />
formuliert werden kann.<br />
Dann wird der Text analysiert.<br />
~j<br />
• Hauptaussage benennen<br />
• Argumente u. Beispiele anführen<br />
• Die FORM der Darstellung benennen und entsprechende<br />
als Stilmittel!<br />
auswerten. Bspl. Ironie<br />
Beispiel: Die These Lessings wird durch die Verwendung eines eloquenten Wortschatzes und des<br />
Nominalstils unterstützt, wodurch der Eindruck vermittelt wird, <strong>das</strong>s [der Inhalt] durch ein<br />
umfangreiches Wissen fundiert ist. [... ]<br />
VOM Umfang her ist dieser Teil deutlich kürzer als Sie es von den l Ier Klausuren gewohnt<br />
ind!!!<br />
J<br />
•<br />
3. Anwendung der Theorie auf die beiden Dramen:<br />
• Überleitung zu den Dramen formulieren.<br />
Beispiel: Die Theorie Lessings lässt sich exemplarisch an den Dramen" W." und "I."<br />
[nachvollziehen, prüfen, beweisen, veranschaulichen, verstehen, aufzeigen, verdeutlichen,<br />
widerlegen, entkräften ... ]<br />
n die denn<br />
.<br />
• Einbindung der Dramen in den Kontext<br />
Beispiel: Bei den Dramen handelt es sich um die klassisch autklärerische Tragödie .Lv. T." von J.<br />
v. W. v. Goethe und um <strong>das</strong> offene Drama "W." von G. Büchner.<br />
Inhaltlich thematisiert Goethes Tragödie den antiken Mythos der Tantaliden. expliziert hier die<br />
Auflösung des Tantalosfluchs durch die friedliche Rettung I. von der Insel Tauris durch ihren<br />
Bruder Orest und dessen Freund Pylades. Dazu kontrastiv steht in Büchners Sozialdrama ein<br />
Mann aus dem Volk namens W. im Mittelpunkt, der stellvertretend die gesellscbaftlichen<br />
Strukturen damaliger Verhältnisse widerspiegelt. Zu dem Protagonisten gibt es entgegen<br />
bisheriger Dramen eine historische Vorlage und eine historische Begebenheit, die Büchner<br />
recherchiert hatte.<br />
• Aspektierung des Themas: <strong>Was</strong> genau wird hier womit wie verglichen?<br />
Beispiel: Der Schwerpunkt dieser Untersuchung bildet die [formale Struktw, <strong>das</strong> Thema, die<br />
Herangehensweise des gleichen Themas, die unterschiedliche Deutung des gleichen Themas, <strong>das</strong><br />
dargestellte Frauenbild, die dargestellte Gesellschaftsstruktur, die epochenspezifischen Merkmale,<br />
die epochenspezifischen Unterschiede, etc.] der Dramen, bezogen auf Lessings These, <strong>das</strong>s [... ]<br />
• Vergleich, Darstellung und Argumente für die eigene Stellungnahme<br />
sich ob die die is (Goethe und h<br />
nicht. gilt die ich<br />
die chließlich sind es<br />
ist ens doppelt so ie si