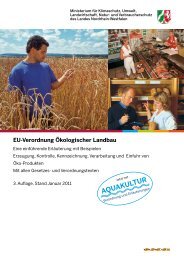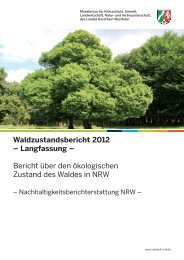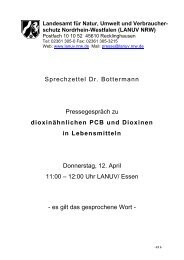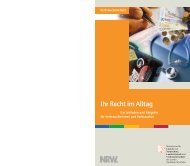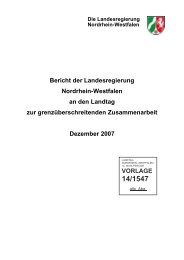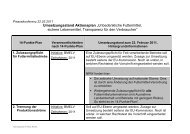Zur Lage der Regenerativen Energiewirtschaft in Nordrhein ...
Zur Lage der Regenerativen Energiewirtschaft in Nordrhein ...
Zur Lage der Regenerativen Energiewirtschaft in Nordrhein ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong><br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 2011, Teil 1<br />
– Monitor<strong>in</strong>gbericht –<br />
Münster, im Oktober 2012<br />
Studie im Auftrag des<br />
M<strong>in</strong>isteriums für<br />
Klimaschutz, Umwelt,<br />
Landwirtschaft, Natur- und<br />
Verbraucherschutz des<br />
Landes Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen (MKULNV)<br />
IWR<br />
Internationales<br />
Wirtschaftsforum<br />
Regenerative Energien<br />
Dr. Norbert Allnoch<br />
Ralf Schlusemann<br />
Bernd Kle<strong>in</strong>manns<br />
Franz Bertram<br />
Christoph Landeck
Inhalt<br />
1 Ausgangslage und Zielsetzung ......................................................................................... 1<br />
2 Methodischer Ansatz .......................................................................................................... 3<br />
2.1 Analysemodule und Methoden .............................................................................. 3<br />
3 Bilanz <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 2011 ................... 5<br />
3.1 Regenerative <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW – Überblick 2011 ................................... 5<br />
3.2 Energie- und Umwelt – Regenerative Erzeugung und EE-Beitrag zum<br />
Klimaschutz ........................................................................................................... 7<br />
3.2.1 Regenerative Energieerzeugung <strong>in</strong> NRW 2011 ....................................... 7<br />
3.2.2 CO2-Emissionen und Klimaschutz ......................................................... 14<br />
3.2.3 Gesamtüberblick regenerative Energien und Klimaschutz 2011 <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen .............................................................................. 16<br />
3.2.4 Stand Netzausbau, Speichertechniken und Elektromobilität ................. 17<br />
3.2.5 Zielsetzungen und Maßnahmen <strong>der</strong> NRW-Landesregierung im<br />
Bereich Energie & Umwelt ..................................................................... 19<br />
3.3 Wirtschaft, Standort und Struktur: Situation 2011 und Perspektiven ................... 20<br />
3.3.1 Konjunkturelle Situation <strong>der</strong> NRW-Unternehmen - Nationale Wirtschafts-<br />
und Geschäftslage im Sektor regenerative Energien ............... 20<br />
3.3.2 Industriewirtschaftliche Effekte <strong>in</strong> NRW - Beschäftigung und Umsatz ... 22<br />
3.3.3 NRW als regenerativer Industriestandort ............................................... 25<br />
3.4 Wissenschaft und Forschung .............................................................................. 27<br />
3.4.1 Regenerative Forschung <strong>in</strong> NRW .......................................................... 27<br />
3.4.2 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen an <strong>der</strong> Schnittstelle zwischen<br />
Forschung und Industrie ........................................................................ 27<br />
3.5 Bildung: Aus- und Weiterbildung <strong>in</strong> NRW ............................................................ 29<br />
3.5.1 Regeneratives Studiengang-Angebot <strong>in</strong> NRW ....................................... 29<br />
3.5.2 Betriebliche Aus- und Weiterbildung ...................................................... 30<br />
Langfassung <strong>der</strong> Studie<br />
4 Energie und Umwelt .......................................................................................................... 33<br />
4.1 Internationale und nationale Energietrends ......................................................... 33<br />
4.1.1 Internationaler Status quo, Energieverbrauchsprognosen und Ziele<br />
zum EE-Ausbau ..................................................................................... 33<br />
4.1.2 Nationale Energietrends – Atomausstieg und Energiewende,<br />
Status quo erneuerbare Energien .......................................................... 35
4.2 Entwicklung <strong>der</strong> regenerativen Energieerzeugung <strong>in</strong> NRW und Beitrag zum<br />
Klimaschutz ......................................................................................................... 39<br />
4.2.1 Status quo <strong>der</strong> Nutzung Erneuerbarer Energien <strong>in</strong> Deutschland ........... 39<br />
4.2.2 Regenerative Stromproduktion <strong>in</strong> NRW ................................................. 39<br />
4.2.3 Regenerative Wärmeerzeugung <strong>in</strong> NRW ............................................... 71<br />
4.2.4 Regenerative Treibstoffproduktion <strong>in</strong> NRW ........................................... 88<br />
4.2.5 Status quo: EE-Ausbautrends <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Überblick ..... 91<br />
4.3 CO2-Emissionen und Klimaschutz ....................................................................... 92<br />
4.3.1 Klimaschutz auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene .................................................. 92<br />
4.3.2 NRW-Klimaschutzziele vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>in</strong>ternationaler und<br />
nationaler Vorgaben ............................................................................... 96<br />
4.3.3 Entwicklung <strong>der</strong> CO2-Emissionen <strong>in</strong> NRW ............................................. 96<br />
4.3.4 Beitrag regenerativer Energien zum Klimaschutz <strong>in</strong> NRW .................... 99<br />
4.4 Stand Netzausbau, Speichertechniken und Elektromobilität ............................. 101<br />
4.4.1 Status quo des Netzausbaus und Perspektiven <strong>in</strong> NRW ..................... 101<br />
4.4.2 Status quo Speichertechniken und Planungen <strong>in</strong> NRW ....................... 105<br />
4.4.3 Elektromobilität .................................................................................... 108<br />
4.5 Ziele und Maßnahmen <strong>der</strong> NRW-Landesregierung im Bereich<br />
Energie & Umwelt .............................................................................................. 110<br />
4.5.1 Zum Stand <strong>der</strong> Maßnahmen-Umsetzung ............................................. 112<br />
5 Wirtschafts-, Standort- und Strukturanalyse: Unternehmen und Märkte .................. 115<br />
5.1 Regenerative Kernmärkte Internationale und nationale Trends ........................ 115<br />
5.1.1 Markt: Margendruck im W<strong>in</strong>denergie- und PV-Markt nimmt zu ........... 115<br />
5.1.2 Deutschland: Geschäftsklima <strong>in</strong> den Unternehmen ............................. 125<br />
5.2 Zum Industriestandort NRW .............................................................................. 126<br />
5.2.1 Regenerative Industriestruktur am Standort NRW ............................... 126<br />
5.2.2 Arbeitsplatz- und Umsatzentwicklung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagenund<br />
Systembau <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen .............................................. 128<br />
5.2.3 <strong>Zur</strong> konjunkturellen Situation <strong>der</strong> NRW-Unternehmen des<br />
<strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembaus 2011 und 2012<br />
– Zentrale Entwicklungen und Trends ................................................. 136<br />
5.2.4 Status quo - Industriestruktur und Konjunktur nach Sparten ............... 138<br />
5.3 Exkurs: Entwicklungen auf den Märkten für Ökostrom und<br />
Energieeffizienzdienstleistungen ....................................................................... 150<br />
5.3.1 EEG-Strom- und freier Ökostrommarkt ................................................ 150<br />
5.3.2 Regenerative Bürgerenergieanlagen - Energiegenossenschaften ...... 157<br />
5.3.3 Aktivitäten <strong>der</strong> NRW-EVU im Bereich Energieeffizienz ....................... 161<br />
5.4 <strong>Zur</strong> Bedeutung von Industrie und Forschung am Standort NRW ...................... 164<br />
6 Wissenschaft und Forschung – Regenerative Forschungsaktivitäten <strong>in</strong> NRW ........ 165<br />
6.1 Zum regenerativen Forschungsstandort NRW .................................................. 165<br />
6.2 Regenerative Energieforschung nach Sparten – Struktur und aktuelle<br />
Themengebiete .................................................................................................. 171<br />
6.3 NRW-Kompetenze<strong>in</strong>richtungen – Strukturen und Aktivitäten ............................ 175<br />
6.3.1 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Bioenergie ................................................... 177<br />
6.3.2 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Solarenergie ................................................ 178
6.3.3 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Geothermie (oberflächennahe und tiefe<br />
Geothermie) ......................................................................................... 181<br />
6.3.4 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Brennstoffzellen .......................................... 182<br />
6.3.5 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Batterietechnik, Speicherung und<br />
Elektromobilität .................................................................................... 183<br />
7 Bildung: Aus- und Weiterbildung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> ............... 185<br />
7.1 Regeneratives Studiengang-Angebot <strong>in</strong> NRW .................................................. 185<br />
7.1.1 Strukturen <strong>der</strong> regenerativen Hochschulausbildung im Überblick ....... 185<br />
7.1.2 Regenerative Studiengänge an den Hochschulen <strong>in</strong> NRW ................. 185<br />
7.2 Betriebliche Aus- und Weiterbildung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und<br />
Systembau <strong>in</strong> NRW ........................................................................................... 188<br />
8 Fazit und Ausblick ........................................................................................................... 191<br />
9 Marktbee<strong>in</strong>flussende Gesetze, Richtl<strong>in</strong>ien, Verordnungen und Programme <strong>in</strong><br />
Deutschland und <strong>in</strong> <strong>der</strong> EU ...................................................................................... 196<br />
9.1 Nationale Rahmenbed<strong>in</strong>gungen ........................................................................ 196<br />
9.1.1 Gesetze................................................................................................ 196<br />
9.1.2 Verordnungen ...................................................................................... 203<br />
9.1.3 Programme .......................................................................................... 207<br />
9.2 Europäische Union ............................................................................................ 209<br />
9.2.1 Richtl<strong>in</strong>ien ............................................................................................ 209<br />
10 Literaturverzeichnis ...................................................................................................... 213<br />
11 Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................ 217
1 Ausgangslage und Zielsetzung<br />
Der globale Markt für erneuerbare Energien hat sich <strong>in</strong> den letzten Jahren trotz<br />
<strong>der</strong> weltweiten F<strong>in</strong>anzkrise und <strong>der</strong> damit verbundenen Herausfor<strong>der</strong>ungen positiv<br />
entwickeln können. So stiegen die weltweiten Investitionen <strong>in</strong> regenerative Anlagentechniken<br />
im Jahr 2011 auf rd. 170 Mrd. Euro (2010: rd. 140 Mrd. Euro).<br />
Der Großteil <strong>der</strong> Investitionen entfällt auf den W<strong>in</strong>d- und Solarenergiesektor, die<br />
damit weiterh<strong>in</strong> zentrale Wachstumstreiber im globalen EE-Markt bleiben. Weltweit<br />
wurden 2011 W<strong>in</strong>denergieanlagen mit e<strong>in</strong>er Leistung von etwa 41.000 MW<br />
errichtet (2010: rd. 38.000 MW). Auf dem PV-Sektor 2011 ist mit e<strong>in</strong>er neu <strong>in</strong>stallierten<br />
Leistung von 29.700 MWp e<strong>in</strong> neuer Jahresrekord erzielt (2010: rd. 16.600<br />
MWp) worden.<br />
Trotz des globalen Ausbaus ist die <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> Unternehmen im PV- und W<strong>in</strong>denergiesektor<br />
auch 2011 <strong>in</strong>ternational angespannt. Gründe s<strong>in</strong>d Marktdeckelungen<br />
<strong>in</strong> wichtigen Absatzlän<strong>der</strong>n, Überkapazitäten und damit verbunden e<strong>in</strong> hoher<br />
Preisdruck sowie die Abschottung von asiatischen Märkten für ausländische Unternehmen.<br />
In Deutschland haben sich die nach <strong>der</strong> Atomkatastrophe von Fukushima im Juni<br />
2011 von <strong>der</strong> Bundesregierung beschlossene Energiewende und die daran geäußerte<br />
Kritik zu zentralen energiepolitischen Themen entwickelt. Im Fokus <strong>der</strong><br />
Kritik stehen unterschiedliche Auffassungen über den tatsächlichen Netzausbau-<br />
Bedarf sowie die Frage nach <strong>der</strong> planerischen und praktischen Umsetzung des<br />
Ausbaus. Kontrovers werden zudem das Thema Speichertechnik sowie e<strong>in</strong>e fehlende<br />
Koord<strong>in</strong>ierung und Abstimmung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Bundeslän<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Umsetzung<br />
<strong>der</strong> Energiewende diskutiert. Auf dem Stromsektor polarisiert <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
die Frage nach den Kosten, bei <strong>der</strong> vor allem die Strompreisentwicklungen<br />
durch die Höhe <strong>der</strong> EEG-Umlage im Fokus stehen.<br />
Ziel <strong>der</strong> nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Landesregierung ist es, die Gesamtemissionen<br />
von Treibhausgasen bis 2020 um m<strong>in</strong>destens 25 Prozent und bis 2050 um m<strong>in</strong>destens<br />
80 Prozent gegenüber 1990 zu senken [1]. Mit Blick auf den Ausbau <strong>der</strong><br />
regenerativen Stromerzeugung ist es das Ziel, den W<strong>in</strong>dstromanteil an <strong>der</strong> NRW-<br />
Stromversorgung bis 2020 auf 15 Prozent auszubauen. Insgesamt sollen mehr<br />
als 30 Prozent des Stroms <strong>in</strong> NRW im Jahr 2025 durch erneuerbare Energien erzeugt<br />
werden. Gemäß Koalitionsvertrag will die Landesregierung auf Basis des<br />
im Jahr 2011 beschlossenen Klimaschutzgesetzes 2013 e<strong>in</strong>en begleitenden Klimaschutzplan<br />
vorlegen, <strong>der</strong> Zwischenziele und die notwendigen Maßnahmen zur<br />
Erreichung <strong>der</strong> Zielsetzungen des Klimaschutzgesetzes enthält [1], [2]. Gegenüber<br />
dem Landtag ist e<strong>in</strong> jährlicher Umsetzungs-Bericht geplant. Neben <strong>der</strong> Nutzungsseite<br />
<strong>der</strong> erneuerbaren Energien will die Landesregierung <strong>in</strong>dustriepolitisch<br />
die Voraussetzungen zur Sicherung und zum Ausbau des EE-<br />
Technologiestandortes NRW schaffen [2].<br />
Kernziel des vorliegenden Endberichts (Teilbericht 1) <strong>der</strong> Studie „<strong>Zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW 2011“ ist es, die <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong><br />
<strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW ganzheitlich zu analysieren. Für das Monitor<strong>in</strong>g<br />
wird <strong>der</strong> vom IWR entwickelte 4-Sektoren-Systemansatz herangezogen, bei dem<br />
die vier Kernfel<strong>der</strong> Energie & Umwelt, Wirtschaft, Wissenschaft & Forschung sowie<br />
Bildung für die Regenerative <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW untersucht werden.<br />
1
Ziel <strong>der</strong> Energie- und Umweltpolitik ist <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> Erzeugung von Strom,<br />
Wärme und Treibstoffen aus regenerativen Energien sowie die Erhöhung des<br />
Beitrags zum Klimaschutz (CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung) <strong>in</strong> NRW. Auf <strong>der</strong> Grundlage des<br />
3.600 NRW-Unternehmen umfassenden IWR-Firmenkatasters (2011: 3.500)<br />
werden die <strong>in</strong>dustriewirtschaftlichen Effekte (Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung)<br />
des <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembaus untersucht und strukturelle<br />
Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> NRW aufgezeigt. Im Bereich Wissenschaft & Forschung<br />
werden auf <strong>der</strong> Grundlage des Forschungskatasters die aktuellen regenerativen<br />
Forschungsaktivitäten an den NRW-Hochschulen ermittelt und forschungspolitische<br />
Umsetzungsfortschritte dargestellt. Zudem stehen die Aktivitäten <strong>der</strong> regenerativen<br />
Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen im Fokus, die an <strong>der</strong> wichtigen<br />
Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung<br />
stehen. Zentraler Untersuchungspunkt im Schwerpunktbereich Aus- und Weiterbildung<br />
s<strong>in</strong>d <strong>der</strong> Stand und die Trends bei den akademischen bzw. betrieblichen<br />
Aus- und Weiterbildungsangeboten bei erneuerbaren Energien <strong>in</strong> NRW.<br />
E<strong>in</strong>e erfolgreiche Standortpolitik für das Bundesland NRW gründet auf e<strong>in</strong>em optimierten<br />
Zielsystem-Mix aller vier Analysefel<strong>der</strong> sowie e<strong>in</strong>er erfolgreichen<br />
Zielumsetzung im Zusammenwirken mit den verschiedenen Instrumenten. Das<br />
quantitative und qualitative Monitor<strong>in</strong>g <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> im<br />
Rahmen des vorliegenden Teilberichts bildet die Ausgangsbasis für e<strong>in</strong>e gezielte<br />
und systematische Weiterentwicklung <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> vor<br />
dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> Landeszielsetzungen.<br />
Der zweite Teilbericht <strong>der</strong> Studie gibt vor diesem H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>en Überblick<br />
über e<strong>in</strong> Portfolio möglicher Handlungsoptionen, die zu e<strong>in</strong>em ganzheitlichen<br />
Ausbau <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW beitragen können. Die aufgeführten<br />
Maßnahmen basieren auf den <strong>in</strong> <strong>der</strong> Studie „<strong>Zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong><br />
<strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW 2010“ vorgestellten Optionen und berücksichtigen<br />
aktuelle Trendentwicklungen [3]. Bei den Maßnahmen handelt es sich um Vorschläge,<br />
die z.T. mittelfristig bzw. auch langfristig angelegt s<strong>in</strong>d. Im Vergleich<br />
zum Vorjahr können erkennbare Entwicklungsfortschritte bereits <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorie<br />
laufende Maßnahmen dokumentiert werden. Aktuell wird auf Landesebene <strong>der</strong><br />
Klimaschutzplan erarbeitet, <strong>der</strong> zahlreiche weitere Maßnahmen speziell zur Erreichung<br />
<strong>der</strong> NRW-Klimaschutzziele enthalten wird.<br />
2
2 Methodischer Ansatz<br />
2.1 Analysemodule und Methoden<br />
Aufbauend auf <strong>der</strong> Def<strong>in</strong>ition <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> nach Allnoch<br />
(1996) erfolgt die ganzheitliche Analyse <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong><br />
NRW auf <strong>der</strong> Grundlage des die folgenden vier Kernbereiche umfassenden 4-<br />
Sektoren-Systemansatzes des IWR (Allnoch 2010): Energie & Umwelt / Wirtschaft<br />
/ Wissenschaft & Forschung sowie Bildung (Abbildung 2.1).<br />
Energie & Umwelt<br />
Energie &<br />
Ressourcen<br />
Klima‐<br />
schutz<br />
Energie‐ / CO 2‐Preise<br />
Netzausbau<br />
Speicherung<br />
Elektromobilität<br />
Wärmebedarf<br />
regenerative Erzeugung,<br />
Energieträger‐Mix<br />
CO 2‐M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung / ‐Äquivalente<br />
Abbildung 2.1: Methodik des 4-Sektoren-Systemansatzes des IWR zur Analyse <strong>der</strong><br />
<strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW im Überblick (Quelle: IWR, 2012)<br />
Energie & Umwelt<br />
Wirtschaft<br />
Standort & Struktur<br />
Wert‐<br />
schöpfung<br />
Der Fokus im Analysebereich Energie & Umwelt liegt auf <strong>der</strong> Erhebung und<br />
Auswertung statistischer Daten zur regenerativen Energieerzeugung (Strom,<br />
Wärme und Treibstoffe) aus unterschiedlichen Quellen. Auf dieser Basis wird <strong>der</strong><br />
jährliche NRW-Beitrag zur CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung ermittelt. Zusätzlich werden die Beiträge<br />
<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen regenerativen Energieträger, die Marktentwicklung sowie<br />
Ausbautrends <strong>in</strong> NRW dargestellt.<br />
Wirtschaft, Standort & Struktur<br />
Industrie‐<br />
kataster<br />
Arbeitsplätze & Umsätze<br />
Konjunktur , Export<br />
Standort‐Struktur<br />
Stärke‐ / Schwächeprofil<br />
Arbeitsplätze / Umsätze<br />
Wissenschaft &<br />
Forschung<br />
Industrie‐<br />
kataster<br />
Forschungs‐<br />
kataster<br />
Forschungsstruktur &<br />
Forschungsthemen<br />
Kompetenzzentren<br />
Forschungsschwerpunkte<br />
/ Benchmark<br />
Bildung<br />
Aus‐ & Weiterbildung<br />
Hochschulen<br />
Industrie &<br />
Handwerk<br />
Studienangebot / Fachbereiche<br />
Betriebliche<br />
Aus‐ & Weiterbildung<br />
Regenerative<br />
Ausbildung<br />
Struktur / Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
© IWR, 2012<br />
Das Modul Wirtschaft, Standort & Struktur be<strong>in</strong>haltet die Ermittlung <strong>der</strong> Arbeitsplatz-<br />
und Umsatzzahlen im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau. Zusätzlich<br />
werden erstmalig auch die auf Modellrechnungen basierenden Beschäftigungseffekte<br />
<strong>in</strong> den Bereichen Betrieb und Wartung sowie Brenn- und Kraftstoffbereitstellung<br />
erfasst. Des Weiteren wird die konjunkturelle Situation <strong>der</strong> NRW-<br />
Unternehmen untersucht, u.a. gestützt durch e<strong>in</strong>e Umfrage unter den rd. 3.600<br />
Unternehmen (2011: 3.500) des IWR-Unternehmenskatasters. Im Bereich<br />
Ökostrom werden die Aktivitäten <strong>der</strong> Stromversorger bei Ökostrom, Effizienzdienstleistungen<br />
sowie För<strong>der</strong>angeboten für regenerative Energien ausgewertet.<br />
3
Neben dem Industriekataster wird <strong>in</strong> die Standort- und Strukturanalyse e<strong>in</strong> NRWspezifisches<br />
Forschungskataster für regenerative Energien e<strong>in</strong>bezogen. Wichtige<br />
Grundlage <strong>der</strong> Standort- und Strukturanalyse ist das IWR-Analyseraster für regenerative<br />
Anlagentechniken, das für alle regenerativen Teilsparten e<strong>in</strong>e eigene<br />
Zerlegungssystematik entlang <strong>der</strong> Wertschöpfungskette umfasst (Abbildung 2.2).<br />
Abbildung 2.2: Bewertungsschema auf <strong>der</strong> Grundlage des IWR-Klassifizierungs- und<br />
Zerlegungsansatzes für regenerative Anlagentechniken (Kategorie I)<br />
(Quelle: IWR, 2007)<br />
Wissenschaft & Forschung<br />
Im Analysefeld Wissenschaft & Forschung werden auf <strong>der</strong> Grundlage des IWR-<br />
Analyserasters per Hochschulumfrage und Auswertung weiterer Quellen zentrale<br />
Aspekte <strong>der</strong> NRW-Forschung im EE-Bereich untersucht (u.a. Forschungsschwerpunkte<br />
und -struktur, Stellenwert <strong>der</strong> EE-Forschung an den NRW-<br />
Hochschulen). Untersucht wird zudem die Entwicklung <strong>der</strong> NRW-Forschungs-<br />
und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen, die an <strong>der</strong> Schnittstelle zwischen Industrie und<br />
Forschung e<strong>in</strong>e wichtige Brückenfunktion übernehmen.<br />
Bildung: Aus- und Weiterbildung <strong>in</strong> NRW<br />
Der Bereich <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildung <strong>in</strong> NRW umfasst die Analyse <strong>der</strong> akademischen<br />
und betrieblichen Aus- und Weiterbildungsangebote <strong>in</strong> NRW. Bei <strong>der</strong><br />
akademischen Ausbildung stehen die von den NRW-Hochschulen angebotenen<br />
Studiengänge mit EE-Bezug im Vor<strong>der</strong>grund. Bei den betrieblichen Aus- und<br />
Weiterbildungsangeboten werden <strong>der</strong> Status quo im Bereich <strong>der</strong> Ausbildungsberufe<br />
sowie <strong>der</strong> aktuellen Weiterbildungsangebote <strong>in</strong> NRW untersucht.<br />
Umsetzung und Masterplan <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong><br />
Die <strong>in</strong> den vier Analysefel<strong>der</strong>n jeweils gewonnenen Erkenntnisse können <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
weiteren Schritt als Grundlage für e<strong>in</strong>en Masterplan „Regenerativ <strong>Energiewirtschaft</strong>“<br />
dienen. Die Vernetzung und Verzahnung <strong>der</strong> vorhandenen Handlungsoptionen<br />
auf allen vier Fel<strong>der</strong>n ermöglicht e<strong>in</strong>e ganzheitliche Entwicklung<br />
<strong>der</strong> erneuerbaren Energien für den Standort NRW. E<strong>in</strong>en Überblick über mögliche<br />
Handlungsoptionen enthält Teilbericht 2 zur vorliegenden Studie.<br />
4
3 Bilanz <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 2011<br />
Die weitere Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW ist vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> <strong>in</strong>ternationalen Marktentwicklung sowie <strong>der</strong> nationalen Zielsetzungen<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Energiewende eng mit den <strong>in</strong>ternationalen und nationalen<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen verbunden. NRW hat als e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> zentralen Industrie-<br />
und Energieregionen <strong>in</strong> Europa dabei e<strong>in</strong>e Vorbildfunktion für an<strong>der</strong>e Industrienationen,<br />
u.a. auch im Bereich des Klimaschutzes. Ziel des ganzheitlichen 4-<br />
Sektoren-Systemansatzes für den Anwendungsfall <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong><br />
<strong>in</strong> NRW ist es, ihre Entwicklung entlang <strong>der</strong> zentralen Analysefel<strong>der</strong><br />
(Energie & Umwelt, Wirtschaft, Wissenschaft & Forschung sowie Bildung) unter<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> vielfältigen Interdependenzen zu analysieren. Dabei ist die<br />
Analyse des Stellenwertes nordrhe<strong>in</strong>-westfälischer Unternehmen im globalen<br />
Wettbewerb ebenso von Bedeutung wie die Entwicklungen am Standort NRW im<br />
Bereich Wissenschaft & Forschung sowie Aus- und Weiterbildung.<br />
3.1 Regenerative <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW – Überblick 2011<br />
Im Vergleich zum Vorjahr 2010 weist die Regenerative <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW<br />
2011 im Analysefeld Energie & Umwelt nach den vorliegenden Daten e<strong>in</strong> vergleichsweise<br />
starkes Wachstum auf. Auf dem Stromsektor ist im Segment Klimaschutz<br />
(regenerative Erzeugung zuzüglich Grubengas) die Strommenge um etwa<br />
21 Prozent gestiegen. Gegenüber 2010 ist auf dem Wärmesektor 2011 im Bereich<br />
<strong>der</strong> Nutzenergie e<strong>in</strong> Wachstum von etwa 6 Prozent zu verzeichnen. Gegenläufig<br />
ist dagegen <strong>der</strong> Trend bei den biogenen Treibstoffen. Im Umfeld e<strong>in</strong>es<br />
bundesweit schwachen Marktes ist die Produktion von Biodiesel um etwa 7 Prozent<br />
auf rd. 350.000 t zurückgegangen (2010: 378.000 t).<br />
Mit Blick auf die Umsetzung <strong>der</strong> Energiewende s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>der</strong>zeit<br />
vor allem die Entwicklungen <strong>in</strong> den Bereichen Netzausbau, Speicher und<br />
Elektromobilität bedeutsam. In NRW sollen im Rahmen des Energieleitungsausbaugesetzes<br />
(EnLAG) <strong>in</strong>sgesamt zehn Netzausbau-Projekte umgesetzt werden.<br />
Davon ist bislang e<strong>in</strong> Projekt realisiert, für den Großteil wird e<strong>in</strong>e Fertigstellung<br />
zwischen 2016 und 2018 erwartet. Im Bereich Energiespeicherung existieren <strong>in</strong><br />
NRW <strong>der</strong>zeit Pumpspeicherkraftwerke mit e<strong>in</strong>er Leistung von 300 MW, aktuelle<br />
Planungen sehen e<strong>in</strong>en Ausbau um rd. 1.000 MW auf <strong>in</strong>sgesamt etwa 1.350 MW<br />
vor. Für den Umbau <strong>der</strong> Mobilität setzt die Bundesregierung auf Elektrofahrzeuge,<br />
<strong>in</strong> NRW s<strong>in</strong>d bislang rd. 830 Fahrzeuge zugelassen, bis 2020 sollen es<br />
250.000 se<strong>in</strong>. Dazu beitragen sollen die im Land tätigen Kompetenzzentren sowie<br />
die Erkenntnisse aus <strong>der</strong> Modellregion „Rhe<strong>in</strong>-Ruhr“.<br />
Im Analysebereich Wirtschaft zeigt sich, dass die NRW-Unternehmen 2011 über<br />
alle Energieteilsparten h<strong>in</strong>weg trotz <strong>der</strong> Eurokrise gegenüber dem Vorjahr 2010<br />
noch e<strong>in</strong>en Anstieg <strong>der</strong> Arbeitsplätze und Umsätze verbuchen können.<br />
Grundlage zur Ermittlung <strong>der</strong> <strong>in</strong>dustriewirtschaftlichen Effekte im Rahmen <strong>der</strong><br />
vorliegenden Studie ist e<strong>in</strong>e umfragegestützte Erhebung <strong>der</strong> tatsächlichen Arbeitsplätze<br />
und Umsätze bei den Unternehmen des <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und<br />
Systembaus <strong>in</strong> NRW. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Beschäftigung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Projektion<br />
auf den gesamten Unternehmenspool des IWR-Katasters <strong>der</strong> Regenerati-<br />
5
ven <strong>Energiewirtschaft</strong> (3.600 NRW-Unternehmen) um etwa 7 Prozent auf rd.<br />
28.200 Beschäftigte (2010: rd. 26.500). Gleichzeitig s<strong>in</strong>d die Umsätze <strong>in</strong> NRW im<br />
Betrachtungszeitraum um knapp 5 Prozent auf rd. 8,7 Mrd. Euro gewachsen<br />
(2010: rd. 8,3 Mrd. Euro).<br />
Über e<strong>in</strong>e Modellrechnung werden seit e<strong>in</strong>igen Jahren im Auftrag des Bundesumweltm<strong>in</strong>isteriums<br />
die Beschäftigungseffekte von erneuerbaren Energien für die<br />
Bundesebene berechnet. Im Rahmen dieses Ansatzes werden die Beschäftigungsäquivalente<br />
rechnerisch ermittelt. In e<strong>in</strong>er weiteren auf dem bundesweiten<br />
Modellansatz basierenden Modellrechnung ist dieser Ansatz jetzt auch auf die<br />
Ebene <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> übertragen worden. Im Ergebnis wird davon ausgegangen,<br />
dass sich <strong>in</strong> NRW 2011 die Beschäftigungseffekte im Bereich „neue Anlagen“<br />
auf rd. 36.000 sowie <strong>in</strong> den Bereichen Betrieb und Wartung sowie Brennund<br />
Kraftstoffbereitstellung auf rd. 11.000 bzw. rd. 7.000 Beschäftigungsäquivalente<br />
belaufen. Diese Beschäftigungsäquivalente bilden danach die rechnerisch<br />
ermittelte mögliche Bruttobeschäftigung ab.<br />
Wirtschaftliches Umfeld: Anhaltende Marktkonsolidierung belastet weitere<br />
Branchenentwicklung<br />
Ungünstig bleibt trotz <strong>der</strong> positiven Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>dustriewirtschaftlichen<br />
Kennzahlen das wirtschaftliche Umfeld für e<strong>in</strong>en Teil <strong>der</strong> Branche. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
die Hersteller<strong>in</strong>dustrie bef<strong>in</strong>det sich im PV- und W<strong>in</strong>denergiesektor auch 2011<br />
weltweit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er angespannten Situation. Zum Teil geht diese Entwicklung mit<br />
Werksschließungen und dem Abbau von Beschäftigten e<strong>in</strong>her. Die <strong>in</strong> NRW per<br />
Saldo positive Entwicklung bei <strong>der</strong> Beschäftigung und den Umsätzen ist z.T.<br />
auch darauf zurückzuführen, dass die Nachfragedelle bei den Anlagen- und<br />
Komponentenherstellern auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene durch die nationale Konjunktur<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bilanz kompensiert wird. Dabei profitieren vor allem Unternehmen des<br />
Dienstleistungssektors sowie Installationsbetriebe. Die vorliegenden Konjunktur<strong>in</strong>dikatoren<br />
deuten jedoch darauf h<strong>in</strong>, dass das letztjährige Beschäftigungs- und<br />
Umsatzniveau im laufenden Jahr 2012 nicht mehr gehalten werden kann.<br />
Das Analysefeld Wissenschaft & Forschung hat sich im Jahr 2011 solide weiterentwickelt.<br />
In Summe umfasst das Forschungskataster Regenerative Energien<br />
<strong>der</strong>zeit rd. 135 Forschungse<strong>in</strong>richtungen (Vorjahr: rd. 125). Gegenüber 2010 s<strong>in</strong>d<br />
das 8 Prozent mehr E<strong>in</strong>richtungen mit Aktivitäten <strong>in</strong> <strong>der</strong> EE-Forschung. Fortschritte<br />
hat es 2011 auch beim Ausbau <strong>der</strong> NRW-Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
gegeben, die an <strong>der</strong> Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie<br />
wichtige Schlüsselpositionen besetzen. Neben dem Ausbau des Mitarbeiterstamms<br />
ist an den Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong><br />
Test<strong>in</strong>frastruktur fortgesetzt worden.<br />
An den NRW-Hochschulen bilden <strong>in</strong> <strong>der</strong> akademischen Ausbildung grundständige<br />
Studiengänge mit EE-Schwerpunkten den Großteil <strong>der</strong> regenerativen Studienangebote.<br />
Die Zahl eigenständiger regenerativer Studiengänge ist mit lediglich<br />
drei Angeboten (5 Prozent) noch sehr übersichtlich. An den Hochschulen überwiegt<br />
damit <strong>der</strong> Ansatz, zunächst Basisqualifikationen <strong>in</strong> Fachbereichen wie<br />
Elektrotechnik, Masch<strong>in</strong>enbau o<strong>der</strong> Wirtschaftswissenschaften zu vermitteln. Erst<br />
danach erfolgt die weitere Spezialisierung.<br />
6
3.2 Energie- und Umwelt – Regenerative Erzeugung und EE-<br />
Beitrag zum Klimaschutz<br />
3.2.1 Regenerative Energieerzeugung <strong>in</strong> NRW 2011<br />
3.2.1.1 Regenerative Stromerzeugung 2011<br />
Die regenerative Stromerzeugung <strong>in</strong> NRW (ohne Grubengas) ist im Jahr 2011<br />
um 23 Prozent auf fast 13 Mrd. kWh (2010: 10,5 Mrd. kWh) gestiegen. Wichtigste<br />
regenerative Stromquellen s<strong>in</strong>d 2011 die Bioenergie und die W<strong>in</strong>denergie. Zusammen<br />
entfallen etwa 80 Prozent <strong>der</strong> regenerativen Stromerzeugung auf diese<br />
beiden Sparten (Tabelle 3.1).<br />
Tabelle 3.1: Regenerative Stromerzeugung <strong>in</strong> NRW 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Referenzwerte auf Basis von Bezreg. Arnsberg, BNetzA, Büro für<br />
Wasserkraft NRW, DBFZ, DEWI, ITAD, IT.NRW, IWR, LANUV NRW, LWK NRW, z.T. eig. Berechnung<br />
/ Schätzung)<br />
Bioenergie<br />
Biomasse fest<br />
Biogas<br />
biogener Abfall<br />
Biomasse flüssig<br />
Klärgas<br />
Deponiegas<br />
Strom<br />
[Mrd. kWh]<br />
5,10<br />
1,50<br />
1,62<br />
1,33<br />
0,14<br />
0,32<br />
0,18<br />
2011 1 2010 Veränd.<br />
Anteil [%] Strom<br />
[Mrd. kWh]<br />
39,4 4,81<br />
1,40<br />
1,15<br />
1,42<br />
0,34<br />
0,28<br />
0,22<br />
Vorjahr<br />
Anteil Bund<br />
(2011)<br />
Anteil [%] [%] [%]<br />
45,8 + 6,0 13,8<br />
W<strong>in</strong>denergie 5,15 39,8 3,93 37,4 + 31,0 10,5<br />
Photovoltaik 2,18 16,9 1,20 11,4 + 81,7 11,3<br />
Wasserkraft 0,50 3,9 0,57 5,4 - 12,3 2,8<br />
Summe Strom<br />
regenerativ<br />
12,93 100,0 10,51 100,0 + 23,0 10,5<br />
Grubengas 0,71 0,81 - 12,2 64,5<br />
∑ Strom Klimaschutz 13,64 11,32 + 20,5 11,0<br />
1 = Werte vorläufig<br />
Insgesamt erreicht die Stromerzeugung aus Bioenergie 2011 e<strong>in</strong>e Größenordnung<br />
von 5,1 Mrd. kWh. Insbeson<strong>der</strong>e die Stromproduktion im Biogassektor kann<br />
angesichts e<strong>in</strong>es dynamischen Branchenwachstums bei landwirtschaftlichen Biogasanlagen<br />
<strong>in</strong> 2011 deutlich um etwa 40 Prozent auf rd. 1,6 Mrd. kWh zulegen<br />
(Zubau 2011: rd. 140 Anlagen, 67 MW). E<strong>in</strong>e mo<strong>der</strong>ate Zunahme im Vorjahres-<br />
7
vergleich zeigt sich zudem bei <strong>der</strong> Stromerzeugung aus biogenen Festbrennstoffen<br />
sowie Klärgas. Deutlich rückläufig s<strong>in</strong>d 2011 die Stromerzeugung aus Deponiegas<br />
sowie flüssiger Biomasse.<br />
Die W<strong>in</strong>dstromproduktion steigt 2011 um etwa 30 Prozent auf fast 5,2 Mrd. kWh<br />
an. Dieses Wachstum geht allerd<strong>in</strong>gs weniger auf den Zubau neuer Anlagen<br />
(2011: 160 MW, Gesamtleistung: rd. 3.060 MW), son<strong>der</strong>n vor allem auf e<strong>in</strong> im<br />
Vergleich zu 2010 deutlich besseres W<strong>in</strong>djahr 2011 zurück.<br />
Angesichts des auch 2011 hohen Zubaus an neuer PV-Leistung von 850 MWp<br />
sowie des erstmals ganzjährig produzierenden 2010er-Rekordzubaus (rd. 900<br />
MWp) steigt die Stromerzeugung aus PV im Jahresvergleich deutlich auf etwa 2,2<br />
Mrd. kWh (2010: 1,2 Mrd. kWh) an. Im Vorjahresvergleich weist <strong>der</strong> PV-Sektor<br />
2011 mit e<strong>in</strong>em Plus von 82 Prozent wie<strong>der</strong> das größte Wachstum auf. Der Anteil<br />
<strong>der</strong> Solarstromerzeugung an <strong>der</strong> regenerativen Stromerzeugung <strong>in</strong> NRW steigt<br />
damit weiter an und liegt mittlerweile bei 17 Prozent.<br />
Die Stromerzeugung aus Grubengas erreicht 2011 e<strong>in</strong>e Größenordnung von etwa<br />
0,7 Mrd. kWh. Im Vergleich zum Vorjahr (0,81 Mrd. kWh) entspricht das e<strong>in</strong>em<br />
Rückgang um etwa 12 Prozent. Damit setzt sich die rückläufige Entwicklung<br />
<strong>der</strong> Stromproduktion aus Grubengas weiter fort. Es bestätigt sich zunehmend,<br />
dass das Maximum <strong>der</strong> Grubengasverstromung <strong>in</strong> NRW seit dem Jahr 2007 (rd.<br />
1,1 Mrd. kWh) überschritten ist. In Summe ergibt sich unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>der</strong><br />
Stromerzeugung aus Grubengas e<strong>in</strong>e umweltfreundliche Stromerzeugung <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Größenordnung von knapp 14 Mrd. kWh (2010: rd. 11,3 Mrd. kWh) (Tabelle 3.1,<br />
Abbildung 3.1).<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Stromerzeugung [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
Abbildung 3.1: Entwicklung <strong>der</strong> regenerativen Stromerzeugung und <strong>der</strong> Stromerzeugung<br />
im Bereich Klimaschutz (<strong>in</strong>kl. Grubengas) <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR,<br />
2012)<br />
Strom reg. m<strong>in</strong>/max Strom (<strong>in</strong>kl. Grubengas)<br />
© IWR, 2012<br />
Im Vergleich mit dem Bund resultiert für die regenerative Stromerzeugung <strong>in</strong><br />
NRW (ohne Grubengas) mit rd. 13 Mrd. kWh e<strong>in</strong> stabiler Anteil von knapp 11<br />
Prozent an <strong>der</strong> bundesweiten Stromproduktion 2011 (rd. 123 Mrd. kWh) aus erneuerbaren<br />
Energien.<br />
8
Fazit regenerative Stromerzeugung 2011 <strong>in</strong> NRW<br />
� Struktur regenerative Stromerzeugung<br />
- regenerative Stromproduktion steigt 2011 um 23 Prozent auf fast 13<br />
Mrd. kWh (Vorjahr 2010: 10,5 Mrd. kWh)<br />
- Bioenergie mit 5,1 Mrd. kWh und W<strong>in</strong>denergie mit 5,2 Mrd. kWh tragen<br />
2011 zu etwa 80 Prozent zur regenerativen Gesamtstromerzeugung bei<br />
(2010: Bio 4,8 Mrd. kWh, W<strong>in</strong>d 3,9 Mrd. kWh)<br />
- PV-Stromerzeugung steigt auf 2,2 Mrd. kWh (2010: rd. 1,2 Mrd. kWh),<br />
Anteil <strong>der</strong> PV-Stromerzeugung an regenerativer Gesamtstromerzeugung<br />
stabilisiert sich bei rd. 17 Prozent<br />
- Stromproduktion im Bereich Klimaschutz (regenerativ und Grubengas)<br />
steigt 2011 um etwa 21 Prozent auf fast 14 Mrd. kWh (2010: 11,3 Mrd.<br />
kWh)<br />
- NRW-Anteil an EE-Stromerzeugung <strong>in</strong> Deutschland (2011: 123 Mrd.<br />
kWh) bleibt 2011 stabil bei rd. 11 Prozent<br />
� Marktzubau EE-Strom<br />
- W<strong>in</strong>denergie 2011: Zubau rd. 90 W<strong>in</strong>denergieanlagen (WEA) mit rd.<br />
160 MW (2010: rd. 50 WEA / 95 MW), Gesamtbestand steigt auf rd.<br />
2.830 WEA mit rd. 3.060 MW (2010: 2.800 WEA, 2.920 MW)<br />
- Bioenergie 2011: Zubau rd. 140 landwirtschaftliche Biogasanlagen mit<br />
fast 70 MW (2010: rd. 100 Anlagen mit 45 MW, Gesamtbestand steigt<br />
auf 570 Anlagen mit etwa 240 MW (2010: rd. 430 Anlagen, 174 MW)<br />
- PV 2010: Zubau von 850 MWp erhöht Gesamtleistung auf etwa 2.850<br />
MWp (2010: Rekordzubau 900 MWp, Gesamtleistung 2.000 MWp)<br />
� Beson<strong>der</strong>heiten<br />
- Prozentual stärkstes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr 2010 bei <strong>der</strong><br />
Stromerzeugung aus PV (+ 82 Prozent), Biogas (+ 40 Prozent) und<br />
W<strong>in</strong>denergie (+ 31 Prozent)<br />
- Wachstum bei PV- und Biogasnutzung hat Ursache <strong>in</strong> Kapazitätseffekten<br />
(hoher Anlagenzubau <strong>in</strong> den Jahren 2010 bzw. 2011)<br />
- Anstieg bei W<strong>in</strong>dstromerzeugung geht weniger auf Anlagenneubau,<br />
son<strong>der</strong>n vielmehr auf e<strong>in</strong> im Vergleich zu 2010 relativ gutes W<strong>in</strong>djahr,<br />
d.h. W<strong>in</strong>dangebot, zurück<br />
9
3.2.1.2 Regenerative Wärmeerzeugung 2011<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie wird die bislang auf die Nutzenergie fokussierte Betrachtung<br />
<strong>der</strong> regenerativen Wärmebereitstellung um den Bereich <strong>der</strong> potenziellen<br />
Endenergie erweitert. Dadurch wird aus methodischer Sicht e<strong>in</strong> direkter Vergleich<br />
mit den Daten auf Bundesebene möglich.<br />
Im Teilbereich Nutzenergie ist die regenerative Wärmeerzeugung (ohne Grubengas)<br />
<strong>in</strong> NRW im Vergleich zum Vorjahr um etwa 6 Prozent auf 11,1 Mrd. kWh gestiegen<br />
(2010: rd. 10,4 Mrd. kWh). Davon entfällt auf die Wärmebereitstellung<br />
aus Biomasse (fest und gasförmig) mit 9,5 Mrd. kWh e<strong>in</strong> Anteil von etwa 86 Prozent<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong>sgesamt bereitgestellten regenerativen Wärmemenge (Tabelle 3.2).<br />
Tabelle 3.2: Regenerative Wärmeerzeugung <strong>in</strong> NRW – Nutz- und Endenergieanteile<br />
im Jahr 2011 (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Nutz- und Endenergie-Referenzwerte auf<br />
Basis von StaBA, IT.NRW, AGEE-Stat, BAFA, Bezreg. Arnsberg, BWP, DBFZ, FNR, ITAD, IWR, LWK<br />
NRW, MKULNV, z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Bioenergie<br />
Biomasse fest (HKW und HW)<br />
Biomasse fest<br />
(Holzheizungen / E<strong>in</strong>zelfeuerstätten)<br />
Biogas<br />
biogener Abfall<br />
flüssige Biomasse<br />
Klärgas<br />
Deponiegas<br />
Nutzenergie<br />
[Mrd. kWh]<br />
9,45<br />
1,70<br />
4,1<br />
0,83<br />
2,3<br />
0,33<br />
0,16<br />
0,03<br />
2011 1) Anteil Endenergie<br />
Bund<br />
Anteil [%] Endenergie<br />
[Mrd. kWh]<br />
85,5 15,99<br />
4,64<br />
6,48<br />
1,52<br />
2,3<br />
0,69<br />
0,31<br />
0,05<br />
Anteil [%] [%]<br />
90,5 12,2<br />
Geoenergie 1,09 9,9 1,1 6,2 18,4<br />
Solarthermie 0,51 4,6 0,57 3,2 10,2<br />
Summe Wärme regenerativ 11,05 100,0 17,66 100,0 12,3<br />
Grubengas 0,11 0,44 n.b.<br />
Summe Wärme Klimaschutz 11,16 18,10 n.b.<br />
1 = Werte vorläufig<br />
Am stärksten ist das Wachstum im Bioenergiesektor im Segment <strong>der</strong> Wärmenutzung<br />
aus Biogasanlagen. Bed<strong>in</strong>gt durch den soliden Anlagenzubau <strong>der</strong> letzten<br />
Jahre sowie zusätzliche <strong>in</strong>dustrielle / kommunale Biogasanlagen steigt die genutzte<br />
Wärme 2011 um etwa 54 Prozent auf 0,83 Mrd. kWh an (2010: 0,54 Mrd.<br />
kWh). In den übrigen Sektoren <strong>der</strong> biogenen Wärmenutzung ist die Zunahme<br />
aufgrund e<strong>in</strong>es ger<strong>in</strong>geren Anlagenzubaus niedriger. So steigt die Wärmemenge<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorie <strong>der</strong> Biomasseheiz(kraft)werke um gut 4 Prozent auf 1,7 Mrd.<br />
kWh (2010: 1,63 Mrd. kWh). Auf die Bioenergienutzung folgt an zweiter Stelle die<br />
Wärmeerzeugung aus oberflächennahen Geothermieanlagen, die 2011 bei etwa<br />
1,1 Mrd. kWh liegt.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr hat die Wärmeerzeugung durch Solarthermieanlagen<br />
um 13 Prozent auf etwa 0,5 Mrd. kWh zugelegt (Vorjahr 2010: rd. 0,45 Mrd.<br />
10
kWh). Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Wärmemenge aus Grubengasanlagen (2011 =<br />
Mio. kWh) resultiert im Bereich Klimaschutz e<strong>in</strong>e Gesamtwärmebereitstellung von<br />
etwa 11,2 Mrd. kWh (Tabelle 3.2, Abbildung 3.2).<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Wärmeerzeugung (Nutzenergie) [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
Wärme reg. m<strong>in</strong>/max Wärme (<strong>in</strong>kl. Grubengas)<br />
Abbildung 3.2: Entwicklung <strong>der</strong> regenerativen Wärmeerzeugung (Nutzenergie) und <strong>der</strong><br />
Wärmeerzeugung im Bereich Klimaschutz (<strong>in</strong>kl. Grubengas) <strong>in</strong> NRW<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Insgesamt erreicht die regenerative Wärmebereitstellung bei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong><br />
Endenergie <strong>in</strong> NRW nach vorläufigen Berechnungsergebnissen e<strong>in</strong>e Größenordnung<br />
von 17,7 TWh. Bezogen auf die bundesweite regenerative Wärmeerzeugung<br />
(ohne Grubengas) von etwa 143,5 Mrd. kWh im Jahr 2011 liegt <strong>der</strong> NRW-<br />
Anteil damit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung von etwa 12 Prozent (Tabelle 3.2).<br />
Fazit regenerative Wärmeerzeugung 2011 <strong>in</strong> NRW<br />
© IWR, 2012<br />
� Struktur Wärmeerzeugung Nutzenergie<br />
- regenerative Wärmeerzeugung steigt 2011 um 6 Prozent auf 11,1 Mrd.<br />
kWh (2010: 10,4 Mrd. kWh)<br />
- Wärmeerzeugung aus Biomasse bleibt mit rd. 85 Prozent (rd. 9,9 Mrd.<br />
kWh) im Wärmesektor wichtigster Teilsektor (2010: 8,6 Mrd. kWh), danach<br />
folgt die regenerative Wärmebereitstellung aus oberflächennaher<br />
Geothermie mit 1,1 Mrd. kWh (nur regenerative Nutzenergie) vor Solarthermie<br />
mit 0,51 Mrd. kWh (2010: 0,45 Mrd. kWh)<br />
- Wärmeerzeugung im Bereich Klimaschutz (<strong>in</strong>kl. Grubengas) steigt um 6<br />
Prozent auf 11,2 Mrd. kWh (2010: 10,5 Mrd. kWh)<br />
� Endenergieanteil<br />
- NRW-Anteil an regenerativer Gesamtwärmemenge (Endenergie) <strong>in</strong><br />
Deutschland von 143,5 Mrd. kWh (ohne Grubengas) erreicht 2011 etwa<br />
12 Prozent<br />
11
3.2.1.3 Regenerativer Treibstoffsektor 2011<br />
Die Produktion von regenerativen Treibstoffen <strong>in</strong> NRW fokussiert sich im Jahr<br />
2011 auf die Herstellung von Biodiesel, da die Produktion von Bioethanol (Absolutierung)<br />
aus wirtschaftlichen Gründen e<strong>in</strong>gestellt worden ist. Zentraler Absatzweg<br />
für die Biodieselhersteller ist die Beimischung von Biodiesel. Der Vertrieb<br />
von Biodiesel als Re<strong>in</strong>kraftstoff (B 100) ist <strong>in</strong> Deutschland und NRW 2011 weiter<br />
rückläufig.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr 2010 ist die Produktion von Biodiesel im Jahr 2011 <strong>in</strong><br />
NRW um ca. 7 Prozent zurückgegangen. Damit hat sich <strong>der</strong> bereits <strong>in</strong> den Vorjahren<br />
zu beobachtende Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Insgesamt haben die <strong>in</strong><br />
NRW ansässigen Biodiesel-Hersteller im Jahr 2011 rd. 350.000 t (2010: rd.<br />
380.000 t) Biodiesel produziert (Tabelle 3.3, Abbildung 3.3). Bezogen auf die genutzten<br />
Produktionskapazitäten von etwa 585.000 t, liegt die Auslastung <strong>der</strong><br />
NRW-Produktionsstätten 2011 damit bei etwa 60 Prozent.<br />
Tabelle 3.3: Biogene Treibstoffproduktion <strong>in</strong> NRW 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
2011 1 2010 Veränd. Vorjahr<br />
Biodiesel ca. 352.000 t ca. 378.000 t - 6,9 %<br />
Pflanzenöl n.b. n.b. -<br />
Bioethanol - - -<br />
Gesamt ca. 352.000t ca. 378.000 t - 6,9 %<br />
1 = Werte vorläufig<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
Biodieselproduktion [t]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Abbildung 3.3: Entwicklung <strong>der</strong> Biodieselproduktion <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012)<br />
© IWR, 2012<br />
Als marktbelastend erweist sich <strong>in</strong> Deutschland und NRW <strong>der</strong> weitere Rückgang<br />
des Marktes für Biodiesel <strong>in</strong> Re<strong>in</strong>form. Im Jahr 2011 ist dieses Marktsegment <strong>in</strong><br />
12
Deutschland weitgehend zum Erliegen gekommen. Bundesweit wurden nach<br />
knapp 300.000 t im Jahr 2010 im letzten Jahr nur noch knapp 100.000 t abgesetzt.<br />
Im Jahr 2007 lag <strong>der</strong> B100-Absatz <strong>in</strong> Deutschland noch bei etwa 3,3 Mio. t.<br />
Gleichzeitig bleibt die Beimischung von Biodiesel <strong>in</strong> Deutschland mit etwa 2,3<br />
Mio. t stabil. Insgesamt ergibt sich für Deutschland damit e<strong>in</strong> Biodieselabsatz von<br />
etwa 2,4 Mio. t.<br />
Seit Anfang 2011 gilt <strong>in</strong> Deutschland für Biotreibstoffe die Nachhaltigkeitsverordnung.<br />
Für Produzenten von Biodiesel auf Basis von pflanzlichen Ölen (Raps-<br />
Methyl-Ester) haben sich dadurch die Produktionsbed<strong>in</strong>gungen verschärft. Nunmehr<br />
muss nachgewiesen werden, dass bei <strong>der</strong> Produktion von Biodiesel gegenüber<br />
fossilen Brennstoffen e<strong>in</strong>e CO2-E<strong>in</strong>sparung von m<strong>in</strong>destens 35 Prozent erfolgt.<br />
Das gilt für den gesamten Produktionsprozess, d.h. angefangen beim<br />
Pflanzenanbau, über die Düngung, Ernte, Transport etc.<br />
Für Hersteller von Biodiesel auf Basis von Altspeisefetten ist dieser Nachweis<br />
leichter zu führen, da Produktionsstufen wie Pflanzenanbau, Düngung und Ernte<br />
nicht <strong>in</strong> die Bilanzierung mit e<strong>in</strong>fließen. Mit Blick auf die Geschäftslage im Jahr<br />
2011 äußern sich daher die NRW-Hersteller, die Biodiesel auf <strong>der</strong> Basis von Altspeisefetten<br />
bzw. tierischen Fetten anbieten, zufriedener als Anbieter von Biodiesel<br />
auf Rapsbasis.<br />
Biotreibstoffangebot <strong>der</strong> NRW-Tankstellen<br />
Von den knapp 3.000 Tankstellen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bieten rd. 40 den Bioethanol-Kraftstoff<br />
E85 an. Nach <strong>der</strong> schleppenden E10-Markte<strong>in</strong>führung zum<br />
Jahresbeg<strong>in</strong>n 2011 gehört E10 <strong>in</strong> NRW mittlerweile flächendeckend zum Portfolio<br />
<strong>der</strong> Tankstellenbetreiber. Der vor dem Zusammenbruch des B100-Marktes an rd.<br />
270 NRW-Tankstellen angebotene Biodiesel bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> NRW nur noch sporadisch<br />
im Angebot.<br />
Fazit biogene Treibstoffe 2011<br />
� Biogener Treibstoffsektor 2011 weiter rückläufig<br />
� Biodieselproduktion nimmt um etwa 7 Prozent auf rd. 350.000 t ab (2010:<br />
rd. 380.000 t), Produktion (Absolutierung) von Bioethanol <strong>in</strong> NRW e<strong>in</strong>gestellt<br />
� Markt für re<strong>in</strong>en Biodiesel (B100-Markt) tendiert gegen Null, strengere<br />
Nachhaltigkeitskriterien belasten Produzenten von RME, Hersteller von<br />
Biodiesel auf Basis von Altspeisefetten profitieren<br />
13
3.2.2 CO2-Emissionen und Klimaschutz<br />
3.2.2.1 Klimaschutz auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene<br />
Im Jahr 2011 ist die <strong>in</strong>ternationale Staatengeme<strong>in</strong>schaft bei den Bemühungen<br />
um den <strong>in</strong>ternationalen Klimaschutz auf <strong>der</strong> Stelle getreten. Die 17. UN-<br />
Klimakonferenz im südafrikanischen Durban ist im Dezember 2011 ohne e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>igung<br />
auf e<strong>in</strong> Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll zu Ende gegangen.<br />
Zwar haben die Vertragsstaaten e<strong>in</strong>e Fortsetzung des Abkommens mit neuen<br />
Klimazielen vere<strong>in</strong>bart. E<strong>in</strong> neues verb<strong>in</strong>dliches Abkommen für alle Staaten soll<br />
demnach bis 2015 ausgehandelt werden. Dieses Abkommen, an dem diesmal<br />
auch Ch<strong>in</strong>a und die USA teilnehmen wollen, soll jedoch erst 2020 <strong>in</strong> Kraft treten.<br />
In Bonn wurde im Vorfeld <strong>der</strong> nächsten Klimakonferenz <strong>in</strong> Rio (Dezember 2012)<br />
im Mai 2012 <strong>der</strong> Verhandlungsprozess für das neue Abkommen auf den Weg<br />
gebracht und e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>igung über e<strong>in</strong>e grobe Verhandlungsagenda ausgehandelt.<br />
2011 hat sich <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> weltweiten CO2-Emissionen nach dem zwischenzeitlichen<br />
Rückgang <strong>in</strong>folge <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 aufgrund<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong>ternationalen wirtschaftlichen Erholung auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene<br />
weiter fortgesetzt. Weltweit haben die Emissionen um knapp 3 Prozent auf 34,0<br />
Mrd. t CO2 zugenommen (2010: rd. 33,2 Mrd. t CO2). Größter CO2-Emittent ist<br />
Ch<strong>in</strong>a, dessen CO2-Ausstoß 2011 um rd. 7 Prozent auf rd. 9 Mrd. t angestiegen<br />
ist. Auf dem zweiten Rang liegen mit 6 Mrd. t (- 2 Prozent) die USA. In Deutschland<br />
s<strong>in</strong>d die Emissionen 2011, begünstigt durch e<strong>in</strong>e milde Witterung, um etwa 3<br />
Prozent auf 0,8 Mrd. t gesunken [4]. Damit rangiert Deutschland h<strong>in</strong>ter Japan auf<br />
dem sechsten Rang unter den weltweit größten CO2-Emittenten.<br />
3.2.2.2 NRW-Klimaschutz: Beitrag regenerativer Energien zur CO2-<br />
M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
Tabelle 3.4: CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung durch die Nutzung regenerativer Energien und<br />
Grubengas <strong>in</strong> NRW im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
2011 1 2010<br />
Menge [Mio. t] Menge [Mio. t]<br />
regenerative Energien 14,3 10,8<br />
Grubengas 2 3,3 3,8<br />
Klimaschutz gesamt 17,6 14,6<br />
1 = Werte vorläufig, 2 = Bezirksregierung Arnsberg / DMT<br />
Die CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung durch die Nutzung erneuerbarer Energien <strong>in</strong> NRW (Strom,<br />
Wärme und Treibstoffe) liegt 2011 bei etwa 14,3 Mio. t (2010: 10,8 Mio. t). Die<br />
Gründe für den im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Beitrag erneuerbarer<br />
Energien zum Klimaschutz liegen vor allem <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutlich höheren W<strong>in</strong>dstromproduktion,<br />
dem boomenden PV-Sektor sowie dem vergleichsweise hohen Zubau<br />
im Bereich Biogas im Jahr 2011. Die zusätzliche Emissionsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung (CO2-<br />
14
Äquivalente) durch die Nutzung von Grubengas erreicht 2011 ca. 3,3 Mio. t und<br />
weist damit weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e rückläufige Tendenz auf (2010: 3,8 Mio. t, 2009: 4,1<br />
Mio. t). In Summe liegt <strong>der</strong> Beitrag zur Emissionsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>in</strong> NRW 2011 im Bereich<br />
Klimaschutz bei 17,6 Mio. t (2010: 14,9 14,6 Mio. t). Verglichen mit dem<br />
Wert für 2010 hat sich <strong>der</strong> Beitrag erneuerbarer Energien und Grubengas zur<br />
CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung damit um etwa 21 Prozent erhöht (Tabelle 3.4, Abbildung 3.4).<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
CO 2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung [Mio. t]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 3.4: Entwicklung <strong>der</strong> CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung durch regenerative Energien und Grubengas<br />
<strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012)<br />
15
3.2.3 Gesamtüberblick regenerative Energien und Klimaschutz 2011 <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Tabelle 3.5: Regenerative Energieerzeugung (<strong>in</strong>kl. Grubengas) <strong>in</strong> NRW und <strong>der</strong><br />
Beitrag zum Klimaschutz 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Referenzwerte auf Basis von BAFA, Bezreg. Arnsberg, BNetzA, Büro<br />
für Wasserkraft, BWP, DBFZ, DEWI, FNR, ITAD, IT.NRW, IWR, LANUV NRW, LWK NRW, MKULNV,<br />
z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
2011 1<br />
Strom [Mrd. kWh] Anteil [%] Anteil Bund [%]<br />
Bioenergie<br />
Biomasse fest<br />
Biogas<br />
biogener Abfall )<br />
flüssige Biomasse<br />
Klärgas<br />
Deponiegas<br />
5,10<br />
1,50<br />
1,62<br />
1,33<br />
0,14<br />
0,32<br />
0,18<br />
39,4 13,8<br />
W<strong>in</strong>denergie 5,15 39,8 10,5<br />
Photovoltaik 2,18 16,9 11,3<br />
Wasserkraft 0,50 3,9 2,8<br />
Summe Strom regenerativ 12,93 100,0 10,5<br />
Grubengas 0,71 64,5<br />
Summe Strom Klimaschutz 13,64 11,0<br />
Wärme Nutzenergie Endenergie Anteil Endenergie<br />
Bund<br />
Bioenergie<br />
Biomasse fest (HKW und HW)<br />
Biomasse fest (Holzheizungen /<br />
E<strong>in</strong>zelfeuerstätten)<br />
Biogas<br />
biogener Abfall<br />
flüssige Biomasse<br />
Klärgas<br />
Deponiegas<br />
[Mrd. kWh] Anteil [%] [Mrd. kWh] Anteil [%] [%]<br />
9,45<br />
1,70<br />
4,1<br />
0,83<br />
2,3<br />
0,33<br />
0,16<br />
0,03<br />
85,5 15,99<br />
4,64<br />
6,48<br />
1,52<br />
2,3<br />
0,69<br />
0,31<br />
0,05<br />
90,5 12,2<br />
Geoenergie 1,09 9,9 1,1 6,2 18,4<br />
Solarthermie 0,51 4,6 0,57 3,2 10,2<br />
Summe Wärme regenerativ 11,05 100,0 17,66 100,0 12,3<br />
Grubengas 0,11 0,44 n.b.<br />
Summe Wärme Klimaschutz 11,16 18,10 n.b.<br />
Treibstoffe [t] bzw. [Mrd. kWh] Anteil [%] Anteil Bund [%]<br />
Biodieselproduktion 352.000 / 3,64 100,0 12,6<br />
Pflanzenölproduktion n.b. n.b. -<br />
Bioethanol 0 0,0 n.b.<br />
Summe biogene Treibstoffe 352.000 / 3,64 100,0 10,4<br />
Klimaschutz<br />
(CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung)<br />
Menge [Mio. t] Anteil [%] Anteil Bund [%]<br />
regenerative Energien 14,3 81,3 11,2<br />
Grubengas 2 3,3 18,7 n.b.<br />
Gesamt CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung 17,6 100,0 n.b.<br />
1 = Werte vorläufig, 2 = Bezirksregierung Arnsberg / DMT<br />
16
3.2.4 Stand Netzausbau, Speichertechniken und Elektromobilität<br />
3.2.4.1 Status quo des Netzausbaus und Perspektiven <strong>in</strong> NRW<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf den weiteren Ausbau des Hochspannungsnetzes <strong>in</strong> NRW s<strong>in</strong>d<br />
<strong>der</strong>zeit <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) erfassten<br />
bundeslandübergreifenden Netzausbauvorhaben von Bedeutung. Von 24 <strong>der</strong> bis<br />
2020 geplanten EnLAG-Projekte verlaufen zehn Vorhaben mit e<strong>in</strong>er Trassenlänge<br />
von 428 km ganz o<strong>der</strong> abschnittsweise durch NRW. Von diesen Vorhaben<br />
wurde bislang allerd<strong>in</strong>gs erst e<strong>in</strong> Projekt mit e<strong>in</strong>er Trassenlänge von 8 km realisiert.<br />
Bei den verbleibenden Projekten ist wegen <strong>der</strong> langen Planungs- und Genehmigungszeiträume<br />
größtenteils erst ab 2016 e<strong>in</strong>e Fertigstellung zu erwarten.<br />
Mit Blick auf die vielfach <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeit diskutierte Akzeptanz <strong>der</strong> Netzausbauvorhaben<br />
ist zu berücksichtigen, dass die neuen 380 kV-Leitungen bei e<strong>in</strong>em<br />
Großteil <strong>der</strong> EnLAG-Projekte vornehmlich <strong>in</strong> den bereits bestehenden 220-kV-<br />
Trassen umgesetzt werden sollen. Nach dem jetzigen Planungsstand ist daher<br />
i.d.R. nicht davon auszugehen, dass komplett neue Trassenverläufe mit dem<br />
Netzausbau verbunden s<strong>in</strong>d. So s<strong>in</strong>d von rd. 430 km Stromtrassen <strong>der</strong>zeit lediglich<br />
5 km als tatsächlicher Neubau mit neuer Trassenführung e<strong>in</strong>zustufen [5].<br />
Der im Mai bzw. August von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) vorgelegte<br />
Entwurf für den Netzentwicklungsplan (NEO) 2012 enthält im Kern vier Nord-<br />
Süd-Korridore, die aber noch ke<strong>in</strong>e konkreten Trassenverläufe darstellen. Innerhalb<br />
dieser Korridore bef<strong>in</strong>den sich die Anfangs- und Endpunkte wichtiger Stromtrassen.<br />
Je nach Ausbauszenario stehen <strong>in</strong> den Korridoren ca. 50 Leitungsprojekte<br />
mit Maßnahmen <strong>in</strong> den Bereichen Neubau, Ausbau und Netzverstärkung<br />
auf <strong>der</strong> Agenda. Für NRW s<strong>in</strong>d dabei die Korridore A und B relevant, die vor allem<br />
die Stromübertragung zwischen Nie<strong>der</strong>sachsen, dem Rhe<strong>in</strong>land und Baden-<br />
Württemberg optimieren sollen.<br />
Gemäß Koalitionsvertrag strebt die nordrhe<strong>in</strong>-westfälische Landesregierung e<strong>in</strong>e<br />
Novellierung des EnLAG und die Umsetzung zusätzlicher Pilotstrecken für Erdkabeltrassen<br />
an. Ziel ist es, dadurch die Akzeptanz für den Netzausbau bei <strong>der</strong><br />
Bevölkerung vor Ort zu erhöhen. Bundesweit s<strong>in</strong>d bislang erst vier Erdkabel-<br />
Pilotstrecken <strong>in</strong> Planung, davon e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> NRW.<br />
3.2.4.2 Status quo Speichertechniken und Planungen <strong>in</strong> NRW<br />
E<strong>in</strong> weiterer Bauste<strong>in</strong>, <strong>der</strong> im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Integration von erneuerbaren<br />
Energien <strong>in</strong> den Strommarkt auf <strong>der</strong> Agenda steht, ist die (Weiter)-<br />
Entwicklung und <strong>der</strong> Bau von zusätzlichen Speicherkapazitäten. E<strong>in</strong>e unmittelbare<br />
Bedeutung hat dieses Themenfeld vor dem H<strong>in</strong>tergrund des <strong>der</strong>zeitigen Ausbaugrades<br />
erneuerbarer Energien <strong>in</strong> Deutschland allerd<strong>in</strong>gs noch nicht. Deutlich<br />
wird dies an dem <strong>in</strong> Abbildung 3.5 exemplarisch dargestellten gemittelten Lastprofil<br />
<strong>der</strong> Stromerzeugung <strong>in</strong> Deutschland im Juni 2012. Hier zeigt sich, dass die<br />
Solarstromerzeugung (gelb) dem Tagesgang entsprechend parallel mit dem steigenden<br />
Strombedarf <strong>der</strong> Verbraucher bis auf e<strong>in</strong> Maximum zur Mittagszeit zu-<br />
und zum Nachmittag und Abend h<strong>in</strong> wie<strong>der</strong> abnimmt. Die Stromproduktion aus<br />
PV-Anlagen erreicht dabei zur Mittagszeit mit etwa 14.000 MW e<strong>in</strong> Niveau, das<br />
fast ausreicht, den Spitzenbedarf abzudecken. Aufgrund des Tagesgangs <strong>der</strong><br />
17
Photovoltaik, <strong>der</strong> genau <strong>der</strong> Nachfragekurve folgt, besteht kaum Bedarf, weitere<br />
konventionelle Spitzenlastkraftwerke zuzuschalten.<br />
60.000<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
Leistung [MW]<br />
20.000<br />
00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, Amprion, TenneT TSO, Transnet BW, 50 Hertz<br />
konv. W<strong>in</strong>d Solar<br />
Abbildung 3.5: Mittleres Lastprofil <strong>der</strong> Stromerzeugung <strong>in</strong> Deutschland im Juni 2012<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, Amprion, TenneT TSO, Transnet BW, 50 Hertz)<br />
Status quo und Perspektiven – Pumpspeicherkraftwerke unter Tage<br />
© IWR, 2012<br />
Pumpspeicherkraftwerke stellen aufgrund ihres technologischen Reifegrades<br />
<strong>der</strong>zeit die national am weitesten verbreitete Option zur großtechnischen Speicherung<br />
von Strom dar. Insgesamt liegt die Kapazität <strong>der</strong> <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong>stallierten<br />
Pumpspeicherkraftwerke bei etwa 6.700 MW. Auf NRW entfallen davon<br />
<strong>der</strong>zeit etwa 300 MW (Koepchenwerk Herdecke: 150 MW, Rönckhausen: 140<br />
MW, Sorpetalsperre: 10 MW). In NRW laufen <strong>der</strong>zeit Planungen für den Bau weiterer<br />
Pumpspeicherkraftwerke. Bekannt s<strong>in</strong>d die Pläne des Energieversorgers<br />
Trianel, an zwei Standorten <strong>in</strong> NRW Pumpspeicherkraftwerke zu bauen. Das geplante<br />
Pumpspeicherkraftwerk „Nethe“ auf dem Gebiet <strong>der</strong> Städte Beverungen<br />
und Höxter soll über e<strong>in</strong>e Leistung von 390 MW verfügen und bei 6-stündigem<br />
Dauerbetrieb etwa 2,3 Mio. kWh Strom erzeugen können. Die Inbetriebnahme ist<br />
für 2020 geplant. Das Pumpspeicherkraftwerk „Rur“ an <strong>der</strong> Rurtalsperre <strong>der</strong><br />
Städteregion Aachen ist für e<strong>in</strong>e Leistung von 640 MW ausgelegt. Die Anlage soll<br />
bei 6-stündigem Dauerbetrieb etwa 3,8 Mio. kWh Strom erzeugen können.<br />
Die Landesregierung prüft darüber h<strong>in</strong>aus die Entwicklung und Realisierung von<br />
Unterflur-Pumpspeicherwerken (UPW) <strong>in</strong> stillgelegten Bergwerken. Wissenschaftler<br />
e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är besetzten Forschungsteams mit Vertreten <strong>der</strong> Universitäten<br />
Duisburg-Essen (UDE), <strong>der</strong> Ruhr-Universität Bochum (RUB), <strong>der</strong> RAG<br />
Deutsche Ste<strong>in</strong>kohle AG sowie des Mercator Research Center Ruhr (MERCUR)<br />
und weiterer Partner untersuchen <strong>der</strong>zeit das Potenzial und die technische<br />
Machbarkeit von Unterflur-Pumpspeicherwerken <strong>in</strong> NRW. Da sich die technische<br />
Entwicklung noch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em frühen Stadium bef<strong>in</strong>det, s<strong>in</strong>d bislang noch ke<strong>in</strong>e<br />
konkreten UPW-Projekte umgesetzt worden. Die RAG strebt für den Abschluss<br />
<strong>der</strong> Entwicklungsarbeiten e<strong>in</strong> Zeitfenster von drei Jahren an [6].<br />
18
3.2.4.3 Elektromobilität<br />
Status quo, Zielsetzungen und Perspektiven <strong>in</strong> NRW<br />
E<strong>in</strong> Ziel <strong>der</strong> NRW-Landesregierung im Bereich Elektromobilität ist es, dass bis<br />
zum Jahr 2020 bis zu 250.000 Elektroautos <strong>in</strong> NRW zugelassen s<strong>in</strong>d. Derzeit bef<strong>in</strong>det<br />
sich die Nutzung <strong>in</strong> NRW wie auch auf Bundesebene noch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Initialisierung.<br />
Anfang 2011 waren <strong>in</strong> NRW 500 Elektrofahrzeuge zugelassen. Bis Anfang<br />
2012 wurden weitere rd. 330 Fahrzeuge angemeldet. Im Zuge <strong>der</strong> NRW-<br />
Ausbaustrategie ist es auf <strong>der</strong> <strong>in</strong>dustriepolitischen Ebene e<strong>in</strong>e wichtige Zielsetzung,<br />
<strong>in</strong> NRW Fertigungskapazitäten aufzubauen, die es ermöglichen, e<strong>in</strong>en<br />
Großteil <strong>der</strong> benötigten Komponenten im Land zu produzieren. Langfristig soll<br />
NRW zu e<strong>in</strong>em zentralen Innovations- und Produktionsstandort für Elektromobilität<br />
aufgebaut werden. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> Arbeitsgruppen <strong>der</strong> Nationalen<br />
Plattform Elektromobilität (NPE) liegen die FuE-Schwerpunkte <strong>in</strong> NRW <strong>der</strong>zeit<br />
auf den Bereichen Batterie-, Fahrzeugtechnik, Infrastruktur und Netze. In jedem<br />
Teilsektor wurde <strong>in</strong> NRW e<strong>in</strong> eigenes Kompetenzzentrum gegründet (Kompetenzzentrum<br />
„Batterie“ <strong>in</strong> Münster, Kompetenzzentrum „Fahrzeugtechnik“ <strong>in</strong><br />
Aachen, Kompetenzzentrum „Infrastruktur & Netze“ <strong>in</strong> Dortmund). Das Projekt<br />
„Modellregion Rhe<strong>in</strong>-Ruhr“ dient dazu, Erkenntnisse über den praktischen E<strong>in</strong>satz<br />
von Elektromobilen zu gew<strong>in</strong>nen. In <strong>der</strong> 2011 beendeten ersten Phase des<br />
Feldtests wurden acht verschiedene Projekte umgesetzt. Um e<strong>in</strong> breites Themenfeld<br />
abzudecken, wurden dabei etwa 200 Fahrzeuge für unterschiedliche<br />
Nutzungen e<strong>in</strong>gesetzt und das Nutzerverhalten und die Anfor<strong>der</strong>ungen an den<br />
Elektroantrieb untersucht. 2012 hat die zweite Phase des Projektes begonnen.<br />
3.2.5 Zielsetzungen und Maßnahmen <strong>der</strong> NRW-Landesregierung im Bereich<br />
Energie & Umwelt<br />
Zentrales Klimaschutzziel <strong>der</strong> Landesregierung ist es, die Treibhausgasemissionen<br />
<strong>in</strong> NRW bis 2020 um m<strong>in</strong>destens 25 Prozent und bis 2050 um m<strong>in</strong>destens 80<br />
Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 zu reduzieren. Mit dem 2011 bzw. 2012<br />
<strong>in</strong> den Landtag e<strong>in</strong>gebrachten Klimaschutzgesetz soll dieses Ziel gesetzlich verankert<br />
und e<strong>in</strong> rechtlicher Rahmen für die Ableitung und Umsetzung von Emissionsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />
geschaffen werden [1]. Die Konkretisierung <strong>der</strong><br />
Maßnahmen zur Erreichung <strong>der</strong> Klimaschutzziele erfolgt unter breiter gesellschaftlicher<br />
Beteiligung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em begleitenden Klimaschutzplan, <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeit erstellt<br />
wird und alle 5 Jahre fortgeschrieben werden soll. Die E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Klimaschutzziele<br />
und Umsetzung <strong>der</strong> Maßnahmen des Klimaschutzplans soll durch<br />
e<strong>in</strong>en Klimaschutzrat erfolgen, <strong>der</strong> auch bei <strong>der</strong> Weiterentwicklung des Klimaschutzplans<br />
berät. Noch vor <strong>der</strong> Erstellung des Klimaschutzplans wurde im Oktober<br />
2011 das KlimaschutzStartProgramm beschlossen, das zentrale Klimaschutzmaßnahmen<br />
<strong>in</strong> 10 Themengebieten umfasst. Zu den speziellen Maßnahmen<br />
im Bereich erneuerbare Energien zählen u.a. <strong>der</strong> Ausbau des W<strong>in</strong>denergieanteils<br />
an <strong>der</strong> NRW-Stromversorgung bis 2020 auf 15 Prozent durch Instrumente<br />
wie e<strong>in</strong>en neuen W<strong>in</strong>denergieerlass, e<strong>in</strong>en speziellen Leitfaden für die W<strong>in</strong>denergienutzung<br />
<strong>in</strong> Waldgebieten sowie e<strong>in</strong>e Repower<strong>in</strong>g-Initiative. Weitere EE-<br />
Maßnahmen s<strong>in</strong>d die Initiierung des Informations- und Beratungszentrums<br />
„EnergieDialog.NRW“ sowie die Erstellung von kommunalen Potenzialstudien zu<br />
den verschiedenen regenerativen Energieträgern.<br />
19
3.3 Wirtschaft, Standort und Struktur: Situation 2011 und Perspektiven<br />
3.3.1 Konjunkturelle Situation <strong>der</strong> NRW-Unternehmen - Nationale Wirtschafts-<br />
und Geschäftslage im Sektor regenerative Energien<br />
Die gesamtwirtschaftliche <strong>Lage</strong> <strong>in</strong> Deutschland im Jahr 2011 wird von den NRW-<br />
Unternehmen des <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembaus <strong>in</strong> <strong>der</strong> Retrospektive<br />
sehr gut beurteilt. Zum Umfragezeitpunkt (März/April 2012) wird die aktuelle Geschäftslage<br />
unter dem E<strong>in</strong>druck <strong>der</strong> zunehmenden Eurokrise etwas schlechter<br />
bewertet. Damit deckt sich die E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> NRW-Unternehmen auch mit<br />
dem Verlauf des ifo-Geschäftsklima<strong>in</strong>dex. Dieser spiegelt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
ersten Jahreshälfte 2011 sowie zum Jahresende die positive Grundstimmung <strong>der</strong><br />
deutschen Wirtschaft wi<strong>der</strong>, büßt <strong>in</strong> den ersten 6 Monaten des Jahres 2012 allerd<strong>in</strong>gs<br />
deutlich an Dynamik e<strong>in</strong> (vgl. S. 125).<br />
Parallel zum Bundestrend zeigt die E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> NRW-Unternehmen des<br />
<strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembaus, dass sich seit dem Jahr 2010 e<strong>in</strong>e<br />
Entkopplung zwischen <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en wirtschaftlichen <strong>Lage</strong> und <strong>der</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong><br />
NRW-Unternehmen im Geschäftsfeld erneuerbare Energien vollzieht. Vor 2010<br />
wurde die EE-Geschäftslage von den NRW-Unternehmen des <strong>Regenerativen</strong> Anlagen-<br />
und Systembaus besser als die allgeme<strong>in</strong>e wirtschaftliche <strong>Lage</strong> <strong>in</strong><br />
Deutschland bewertet. Seit 2010 ist e<strong>in</strong>e Trendumkehr zu erkennen: Über alle<br />
regenerativen Teilsparten h<strong>in</strong>weg wird die Geschäftslage im EE-Sektor retrospektiv<br />
(2011) schlechter beurteilt als die gesamtwirtschaftliche <strong>Lage</strong>. Angesichts<br />
<strong>der</strong> Diskussionen um die Energiewende, das EEG-Vergütungssystem sowie steigende<br />
Strompreise schwächt sich die Stimmung im Geschäftsfeld Regenerative<br />
Energien bis zum Umfragezeitpunkt weiter ab (Tabelle 3.6).<br />
Tabelle 3.6: Geschäftslage im Bereich erneuerbare Energien <strong>in</strong> NRW und gesamtwirtschaftliche<br />
<strong>Lage</strong> <strong>in</strong> Deutschland<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Unternehmensumfrage März/April 2012)<br />
Geschäftslage nur erneuerbare Energien<br />
Anteil [%]<br />
Geschäftslage <strong>in</strong>sgesamt<br />
Anteil [%]<br />
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2012 2011 2010 2009 2008 2007<br />
Gut 31,8 48,8 40,8 35,4 55,9 42,6 40,1 62,7 44,9 18,2 55,2 47,4<br />
befriedigend 49,8 38,7 40,8 46,1 31,5 33,1 50,2 31,3 42,7 48,1 38,3 35,3<br />
schlecht 17,0 12,0 17,3 17,8 11,9 23,1 6,0 3,7 10,5 32,7 5,8 15,5<br />
k. Angabe 1,4 0,5 1,1 0,7 0,7 1,2 3,7 2,3 1,9 1,0 0,7 1,8<br />
Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Die differenzierte Betrachtung <strong>der</strong> konjunkturellen Situation zeigt, dass zwischen<br />
den e<strong>in</strong>zelnen regenerativen Teilsparten erhebliche Unterschiede bestehen. Die<br />
beste Geschäftslage ist im Jahr 2011 bei den NRW-Unternehmen des W<strong>in</strong>denergie-,<br />
KWK- und PV-Sektors zu verzeichnen. Dabei weisen im W<strong>in</strong>denergiesektor<br />
20
sowohl Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes als auch Dienstleister wie<br />
Planer und Projektierer e<strong>in</strong>e gute Geschäftslage auf. Auf dem PV-Sektor profitieren<br />
angesichts <strong>der</strong> starken asiatischen Konkurrenz bei <strong>der</strong> Herstellung von PV-<br />
Komponenten und dem Preisverfall vor allem Planer und das Handwerk, während<br />
die Herstellerunternehmen wirtschaftlich stark unter Druck stehen<br />
(Abbildung 3.6).<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Anteile [%]<br />
W<strong>in</strong>d Thermie Geo Bio KWK PV Wasser<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, eigene Erhebung („ke<strong>in</strong>e Angabe“ nicht berücksichtigt)<br />
Abbildung 3.6: Geschäftslage <strong>der</strong> NRW-Unternehmen nach regenerativen Teilsparten<br />
im Jahr 2011 (Quelle: IWR, 2012)<br />
Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Umfrage hat sich die Konjunktur <strong>in</strong> den meisten Sparten sichtbar<br />
abgeschwächt. Vergleichsweise am besten stellt sich die Geschäftslage noch<br />
im W<strong>in</strong>denergiesektor dar. Die von Teilen <strong>der</strong> Branche angeführten erneuten<br />
Probleme bei <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierung von Projekten spiegeln sich demnach bei den<br />
NRW-Unternehmen nur z.T. wi<strong>der</strong>. E<strong>in</strong>e deutliche E<strong>in</strong>trübung weist angesichts<br />
<strong>der</strong> öffentlichen Diskussionen und Pläne zur Anpassung <strong>der</strong> EEG-Vergütung <strong>der</strong><br />
PV-Sektor auf. Auch im Solarthermiesektor wird die Geschäftslage zurückhalten<strong>der</strong><br />
als 2011 beurteilt. Neben den branchenspezifischen Faktoren ist auch die<br />
angespannte Situation <strong>der</strong> Weltwirtschaft für die E<strong>in</strong>trübung <strong>der</strong> Geschäftslage <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> regenerativen Branche im Jahr 2012 mit verantwortlich.<br />
Fazit zur wirtschaftlichen <strong>Lage</strong> des <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und<br />
Systembaus <strong>in</strong> NRW 2011 und 2012 (Ausblick)<br />
� Geschäftslage im Geschäftsfeld regenerative Energien 2011 und 2012<br />
schlechter als gesamtwirtschaftliche Situation, Entkopplung zwischen allgeme<strong>in</strong>er<br />
wirtschaftlicher Entwicklung und Geschäftslage im Bereich EE<br />
� Höhere F<strong>in</strong>anzierungsanfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Banken, Kreditbeschaffung, EEG-<br />
und Energiewende-Diskussionen belasten Geschäftslage 2011 und 2012<br />
� Geschäftslage 2012 im W<strong>in</strong>d-Sektor tendenziell stabil, deutliche Verschlechterung<br />
im PV-Bereich<br />
gut<br />
befriedigend<br />
schlecht<br />
© IWR, 2012<br />
21
3.3.2 Industriewirtschaftliche Effekte <strong>in</strong> NRW - Beschäftigung und Umsatz<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
Arbeitsplätze Umsätze [Mrd. Euro]<br />
10<br />
Abbildung 3.7: Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen-<br />
und Systembau <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012)<br />
Die Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung <strong>in</strong> den NRW-Unternehmen des regenerativen<br />
Anlagen- und Systembaus ist im Jahr 2011 trotz nachlassen<strong>der</strong> Dynamik<br />
noch positiv. Während die Beschäftigung gegenüber 2010 um rd. 7 Prozent<br />
(2010: rd. 10 Prozent) zugelegt hat, ist bei den Umsätzen e<strong>in</strong> Wachstum von<br />
knapp 5 Prozent (2010 rd. 20 Prozent) zu verzeichnen (Abbildung 3.7).<br />
Tabelle 3.7: Die NRW-Beschäftigung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, eigene Erhebung)<br />
Energiesparte 2011 1 2010 2009 2008<br />
W<strong>in</strong>denergie 8.151 7.229 6.559 6.315<br />
Solarenergie<br />
(Photovoltaik, Solarthermie<br />
und Solararchitektur)<br />
7.894 7.626 6.677 5.497<br />
Bioenergie 3.846 3.575 3.418 3.472<br />
Querschnitts-Dienstleister<br />
(W<strong>in</strong>d, Solar, Wasser, Bio etc.)<br />
Sonstige<br />
Installationsbetriebe<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
2.449 2.351 2.267 2.471<br />
2.430 2.391 2.014 1.697<br />
Geoenergie 1.617 1.544 1.362 1.063<br />
Brennstoffzelle 866 875 943 1.080<br />
KWK 805 709 693 670<br />
Wasserkraft 163 168 161 163<br />
Gesamt 2 28.220 26.470 24.090 22.430<br />
1= vorläufige Daten, 2 = gerundet<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
© IWR, 2012<br />
22
Auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Erhebung unter den Unternehmen erreicht die Beschäftigung<br />
<strong>in</strong> NRW im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau Ende 2011 rd. 28.200<br />
Mitarbeiter (Vorjahr 2010: rd. 26.500 Beschäftigte). Trotz <strong>der</strong> z.T. angespannten<br />
Geschäftslage aufgrund von <strong>in</strong>ternationalen E<strong>in</strong>flussfaktoren wie Marktverschiebungen,<br />
Margenrückgängen und Überkapazitäten haben die NRW-Unternehmen<br />
damit per Saldo auch 2011 ke<strong>in</strong>e Beschäftigungsverluste verbucht (Tabelle 3.7).<br />
Im energiespartenspezifischen Vergleich zeigt sich, dass vor allem auf dem<br />
KWK-, W<strong>in</strong>d- und Bioenergiesektor e<strong>in</strong> Beschäftigungswachstum zu verzeichnen<br />
ist. In <strong>der</strong> W<strong>in</strong>d<strong>in</strong>dustrie hat dazu offensichtlich u.a. das auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene<br />
an Fahrt gew<strong>in</strong>nende Offshore-Segment beigetragen. Im Bereich Bioenergie profitieren<br />
<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Biogas-Unternehmen, die 2011 bed<strong>in</strong>gt durch Vorzieheffekte<br />
<strong>in</strong>folge <strong>der</strong> seit 2012 greifenden EEG-Novelle e<strong>in</strong>e hohe Nachfrage verzeichnet<br />
haben. Der Zubau-Boom auf dem PV-Sektor kommt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Unternehmen<br />
des Installationshandwerks, Händlern sowie Planern und Projektierern<br />
zu Gute. Schwieriger ist dagegen die wirtschaftliche Situation <strong>der</strong> PV-Hersteller-<br />
Industrie. Hier sehen sich die Unternehmen verstärkt mit <strong>der</strong> Konkurrenz aus<br />
Asien, vor allem aus Ch<strong>in</strong>a, konfrontiert.<br />
Parallel mit <strong>der</strong> Beschäftigung steigen auch die Umsätze <strong>der</strong> NRW-Unternehmen<br />
des <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembaus. Bezogen auf die Grundgesamtheit<br />
<strong>der</strong> 3.600 Unternehmen ist e<strong>in</strong> Umsatzwachstum um knapp 5 Prozent auf<br />
etwa 8,7 Mrd. Euro zu verzeichnen (Vorjahr 2010: 8,3 Mrd. Euro) (Tabelle 3.8).<br />
Tabelle 3.8: Die NRW-Umsätze im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, eigene Erhebung)<br />
Angaben <strong>in</strong> Mio. Euro<br />
Energiesparten 2011 1 2010 2009 2008<br />
Solarenergie<br />
(Photovoltaik, Solarthermie<br />
und Solararchitektur)<br />
4.069,5 4.147,0 3.158,4 2.523,9<br />
W<strong>in</strong>denergie 2.083,5 1.947,4 1.898 1.957,9<br />
Bioenergie 1.180,7 960,8 712,6 882,4<br />
Sonstige<br />
Installationsbetriebe<br />
Querschnitts-Dienstleister<br />
(W<strong>in</strong>d, Solar, Wasser, Bio etc.)<br />
433,4 443,7 399,2 368,5<br />
378,4 364,5 329,4 431,8<br />
Geoenergie 278,9 223,8 204,0 180,3<br />
KWK 249,2 216,1 193,9 214,8<br />
Brennstoffzelle 18,1 16,3 21,8 14,2<br />
Wasserkraft 16,0 16,9 15 15,1<br />
Gesamt 2 8.708 8.337 6.932 6.589<br />
1= vorläufige Daten, 2 = gerundet<br />
23
Gestützt durch die anhaltend hohe Nachfrage nach PV-Technik rangiert <strong>der</strong> Solarenergiesektor<br />
mit rd. 4,1 Mrd. Euro auch 2011 <strong>in</strong> Bezug auf die Umsätze auf<br />
dem ersten Rang. Im Vergleich zum Vorjahr 2010 ist <strong>der</strong> Umsatz bed<strong>in</strong>gt durch<br />
den hohen Margendruck auf dem PV-Sektor damit allerd<strong>in</strong>gs leicht rückläufig. An<br />
zweiter Stelle liegen die Unternehmen des W<strong>in</strong>denergiesektors (rd. 2,1 Mrd. Euro)<br />
mit deutlichem Abstand vor <strong>der</strong> Bioenergiebranche. Hier konnten die Unternehmen<br />
dank <strong>der</strong> bundesweit guten Konjunktur des Biogassektors im Jahr 2011<br />
erstmals e<strong>in</strong>en Umsatz von mehr als 1 Mrd. Euro erzielen. Bei den Betrieben des<br />
Installationshandwerks (rd. 430 Mio. Euro) sowie den energiespartenübergreifend<br />
tätigen Dienstleistern (rd. 380 Mio. Euro) verbleiben die Umsätze <strong>in</strong> etwa auf Vorjahresniveau<br />
(Tabelle 3.8).<br />
Fazit Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen-<br />
und Systembau <strong>in</strong> NRW<br />
� Beschäftigung<br />
- Beschäftigungsentwicklung im Anlagen- und Systembau bleibt 2011<br />
positiv (+ 6,6 Prozent)<br />
- KWK-Sektor mit größtem Wachstum (+ 13,6 Prozent) vor <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergie<br />
(+ 12,8 Prozent)<br />
- hohe Nachfrage auf Biogassektor trägt zum Beschäftigungswachstum<br />
bei<br />
- Beschäftigungsausbau im PV-Sektor schwächt sich ab, Margendruck<br />
und <strong>in</strong>ternationale Konkurrenz belasten PV- und W<strong>in</strong>d-Branche<br />
� Umsätze<br />
- Umsatzwachstum <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> schwächt<br />
sich im Jahresvergleich von + 20 Prozent auf knapp 5 Prozent ab<br />
- Umsatzspitze im PV-Sektor vorerst überschritten, Margen- und Kapazitätsdruck<br />
hemmen Branchenentwicklung auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene<br />
- Vorzieheffekte auf dem Biogassektor stützen Umsatzwachstum<br />
Die dargestellte Arbeitsplatz- und Umsatzentwicklung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen-<br />
und Systembau basiert auf dem vom IWR entwickelten Erhebungsansatz unter<br />
den NRW-Firmen des Unternehmenskatasters (rd. 3.600 Unternehmen). Auf<br />
Bundesebene werden bereits seit mehreren Jahren über e<strong>in</strong>en modelltheoretischen<br />
Ansatz die potenziellen Beschäftigungseffekte durch erneuerbare Energien<br />
berechnet. Ausgehend von diesen Ergebnissen wurden jetzt im Auftrag des<br />
BMU die potenziellen Beschäftigungseffekte auf Bundeslän<strong>der</strong>ebene abgeleitet.<br />
Kapitel 5.2.2.3 (S. 132) enthält e<strong>in</strong>en Überblick zu diesem methodischen Ansatz<br />
und den NRW-spezifischen Kernergebnissen.<br />
24
3.3.3 NRW als regenerativer Industriestandort<br />
3.3.3.1 Entwicklungstrends am regenerativen Industriestandort NRW<br />
Von zentraler Bedeutung für die systematische Weiterentwicklung des regenerativen<br />
Industrie- und Forschungsstandortes s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>dustrie- und gewerbeseitig rd.<br />
210 wichtige Betriebe des <strong>in</strong>sgesamt 3.600 Firmen umfassenden IWR-<br />
Unternehmenskatasters. Unter diesen Unternehmen bef<strong>in</strong>den sich etliche Firmen,<br />
die als <strong>in</strong>ternationale Player auf den verschiedenen regenerativen Teilmärkten<br />
agieren. Diese Unternehmen übernehmen zusammen mit den an <strong>der</strong> Schnittstelle<br />
zwischen Industrie und Forschung stehenden NRW-Forschungs- und<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong>e wichtige Funktion als Innovations- und Kompetenzträger<br />
für den Ausbau des regenerativen Industrie-Standortes NRW.<br />
Im direkten Vergleich zum Vorjahr zeigt sich bei den Unternehmen des Standortkatasters,<br />
dass sich trotz e<strong>in</strong>zelner Anpassungen durch Unternehmens<strong>in</strong>solvenzen<br />
bzw. Standortverlagerungen sowie e<strong>in</strong>ige Neuzugänge <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bilanz ke<strong>in</strong>e<br />
großen Än<strong>der</strong>ungen ergeben haben. Derzeit s<strong>in</strong>d wie im Vorjahr <strong>in</strong> Summe rd.<br />
210 wichtige NRW-Betriebe erfasst, darunter rd. 170 Industriebetriebe und rd. 40<br />
Dienstleister (Abbildung 3.8).<br />
Abbildung 3.8: NRW-Standortkarte <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> (Quelle: IWR,<br />
2012, Datengrundlage: Unternehmensumfrage, -<strong>in</strong>formationen <strong>der</strong> Hauptkategorie I und<br />
II, Forschungsumfrage)<br />
25
Im H<strong>in</strong>blick auf strukturrelevante Entwicklungstrends nach Energiesparten zeigt<br />
sich, dass Unternehmen im Bioenergiesektor ihre Produktionskapazitäten <strong>in</strong><br />
NRW ausgebaut haben. Ziel <strong>der</strong> Unternehmen ist es <strong>der</strong>zeit, vor allem die Auslandsaktivitäten<br />
zu erweitern und neue Märkte zu erschließen.<br />
Weitere Expansionstendenzen <strong>in</strong> Bezug auf die Erschließung bzw. den Ausbau<br />
ausländischer Märkte s<strong>in</strong>d auch bei Unternehmen des W<strong>in</strong>denergiesektors sichtbar.<br />
Auf dem Brennstoff- und Wasserstoffsektor hat <strong>der</strong> Wasserstoffspezialist Air<br />
Liquide <strong>in</strong> Düsseldorf die erste öffentliche Wasserstofftankstelle <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen eröffnet.<br />
Der PV-Sektor bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong>dustrieseitig <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ausgeprägten<br />
Konsolidierungsphase. Davon s<strong>in</strong>d Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet<br />
und <strong>in</strong> NRW betroffen.<br />
26
3.4 Wissenschaft und Forschung<br />
3.4.1 Regenerative Forschung <strong>in</strong> NRW<br />
E<strong>in</strong>e wichtige Grundlage für die Analyse des Forschungsstandortes NRW bildet<br />
das <strong>der</strong>zeit rd. 135 Forschungse<strong>in</strong>richtungen (Vorjahr 125) umfassende NRW-<br />
Forschungskataster Regenerative Energien. Innerhalb von NRW verteilen sich<br />
diese E<strong>in</strong>richtungen auf etwa 40 Standorte. Der Hauptteil <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungen gehört<br />
zur Kategorie „Hochschule“, auf diesen Bereich entfallen rd. 120 Hochschule<strong>in</strong>richtungen<br />
(Institute, Fachbereiche etc.) an 26 Standorten (Vorjahr 24 Standorte).<br />
Des Weiteren s<strong>in</strong>d rd. 15 außeruniversitäre NRW-E<strong>in</strong>richtungen mit Forschungsaktivitäten<br />
im Bereich regenerative Energien <strong>in</strong> dem Forschungskataster<br />
erfasst.<br />
Mit Blick auf die aktuellen Forschungsthemen <strong>der</strong> NRW-Forschungse<strong>in</strong>richtungen<br />
spiegelt sich die wachsende Bedeutung <strong>der</strong> System<strong>in</strong>tegration erneuerbarer<br />
Energien im Zuge <strong>der</strong> Energiewende wi<strong>der</strong>. Neben den energiespartenspezifischen<br />
Forschungsfel<strong>der</strong>n (W<strong>in</strong>d-, Bio-, Solarenergie etc.) haben nach <strong>der</strong> Umfrage<br />
unter den NRW-Forschungse<strong>in</strong>richtungen Forschungsprojekte zur technischen<br />
und wirtschaftlichen Integration <strong>der</strong> Erneuerbaren Energien <strong>in</strong> das gesamte<br />
Energiesystem erheblich an Bedeutung gewonnen. Die aktuellen Forschungsprojekte<br />
<strong>der</strong> NRW-Institutionen befassen sich dabei <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e mit den technischen<br />
Aspekten <strong>der</strong> Netzoptimierung, Netzplanung und dem Netzbetrieb. Außerdem<br />
stehen <strong>in</strong>telligente Netze (Smart Grids) immer mehr im Fokus <strong>der</strong> Forschung.<br />
E<strong>in</strong>en weiteren Schwerpunkt bildet die mit dem Ausbau <strong>der</strong> erneuerbaren<br />
Energien wachsende Dezentralisierung <strong>der</strong> Energieversorgung. Eng mit diesem<br />
Themenkomplex verknüpft s<strong>in</strong>d die Forschungsaktivitäten im Bereich <strong>der</strong><br />
(großtechnischen) Speichertechnologie. So forschen unter an<strong>der</strong>em mehrere Institute<br />
an <strong>der</strong> Option, ehemalige Bergwerke als Standorte für potentielle Pumpspeicherkraftwerke<br />
zu nutzen.<br />
3.4.2 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen an <strong>der</strong> Schnittstelle zwischen Forschung<br />
und Industrie<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> <strong>in</strong>dustriellen Standortentwicklung kommt den Forschungs- und<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> NRW e<strong>in</strong>e zentrale Rolle zu. Durch Bündelung von<br />
Forschungs- und Technologie-Know-how und die Ausstattung mit leistungsfähigen<br />
Test- und Prüfe<strong>in</strong>richtungen übernehmen sie e<strong>in</strong>e wichtige Brückenfunktion<br />
an <strong>der</strong> Schnittstelle zwischen Industrie und anwendungsnaher Forschung. In<br />
NRW gibt es <strong>der</strong>zeit über alle regenerativen Teilsparten h<strong>in</strong>weg 12 bestehende<br />
zentrale Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen. Darüber h<strong>in</strong>aus bestehen<br />
Pläne zur E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es weiteren Kompetenzzentrums im Bereich W<strong>in</strong>denergie.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich, dass <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> Kompetenzzentren mit<br />
unterschiedlicher Dynamik voranschreitet. So ergibt sich nach dem Vorjahresvergleich<br />
<strong>in</strong> etlichen Fällen e<strong>in</strong> Ausbau des Mitarbeiterbestandes. Außerdem wurden<br />
<strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen die technischen Test- und Prüfe<strong>in</strong>richtungen teilweise weiter<br />
ausgebaut. An<strong>der</strong>erseits bestehen bereits konkrete Pläne für den weiteren Ausbau<br />
<strong>der</strong> technischen Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen bzw. es wurde mit dem Bau bereits<br />
begonnen (Tabelle 3.9).<br />
27
Tabelle 3.9: Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> NRW – Bestehende<br />
Technische Ausstattung und Aktivitäten (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Sparte E<strong>in</strong>richtung / [Schwerpunkt] Teste<strong>in</strong>r. Zertifizierung Normung Lizensierung<br />
Solarenergie Deutsches Zentrum für Luft und<br />
Raumfahrt (DLR)<br />
[Solartherm. Kraftwerke]<br />
Solar-Institut Jülich<br />
[Solartherm. Kraftwerke]<br />
Fraunhofer ISE, Labor- und<br />
Servicecenter Gelsenkirchen<br />
[Photovoltaik]<br />
Inst. für Energie- und Klimaforschung,<br />
Photovoltaik (IEK-5) am FZ Jülich<br />
[PV-Dünnschichttechnologie]<br />
TÜV Rhe<strong>in</strong>land<br />
[Solarthermie NT, Photovoltaik]<br />
Bioenergie Fraunhofer UMSICHT<br />
[Bioenergie / Biogas / Biotreibstoffe]<br />
FH Münster / Standort Ste<strong>in</strong>furt<br />
[Biogas / Biotreibstoffe]<br />
Brennstoffzelle ZBT Duisburg<br />
[Brennstoffzellentechnik]<br />
Inst. für Energie- und Klimaforschung,<br />
Brennstoffzellen (IEK-3) am FZ Jülich<br />
[Brennstoffzellentechnik]<br />
Wasserkraft Uni Siegen, FB Wasserbau und<br />
Hydromechanik<br />
[Kle<strong>in</strong>wasserkraft]<br />
Geothermie Internationales Geothermiezentrum<br />
[Geothermie, im Aufbau]<br />
Netze / Infrastrukturen<br />
/<br />
Elektromobilität<br />
MEET (Münster Electrochemical Energy<br />
Technology)<br />
[Energiespeicher, Batterieforschung]<br />
Kompetenzzentrum für Elektromobilität,<br />
Infrastruktur & Netze (TIE-IN) (virtuell)<br />
[Netze, Elektromobilität, im Aufbau]<br />
Geschäftsstelle Elektromobilität (virtuell)<br />
[Fahrzeugtechnik, Elektromobilität]<br />
W<strong>in</strong>denergie Center for W<strong>in</strong>d Power Drives (CWD)<br />
[WEA-Antriebstechnik, im Aufbau]<br />
Kompetenzzentrum W<strong>in</strong>dkrafttechnik<br />
[W<strong>in</strong>denergie, geplant]<br />
+++ = sehr gut, ++ = gut, + = vorhanden, – = noch nicht vorhanden<br />
+++ – – ++<br />
+++ – – +<br />
++ – – ++<br />
+++ + – –<br />
+++ +++ ++ +<br />
+++ + – ++<br />
++ – + –<br />
++ ++ + +<br />
+++ + – +<br />
+ – + –<br />
+ – – –<br />
++ – – –<br />
++ – – –<br />
++ – – –<br />
+ – – –<br />
– – – –<br />
Im Unterschied zu den technischen E<strong>in</strong>richtungen und <strong>der</strong> Personalausstattung<br />
zeigen sich im Vorjahresvergleich bei den Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>in</strong> den für den <strong>in</strong>dustriellen Fertigungsprozess wichtigen Bereichen Zertifizierung,<br />
Normung und Lizensierung nach <strong>der</strong> Monitor<strong>in</strong>g-Analyse kaum Verän<strong>der</strong>ungen.<br />
28
3.5 Bildung: Aus- und Weiterbildung <strong>in</strong> NRW<br />
3.5.1 Regeneratives Studiengang-Angebot <strong>in</strong> NRW<br />
Tabelle 3.10: Studiengänge im Bereich erneuerbare Energien <strong>in</strong> NRW nach Fachbereichen<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Fachrichtung 2012<br />
absolut<br />
2012<br />
Anteil <strong>in</strong> [%]<br />
2011<br />
absolut<br />
2011<br />
Anteil <strong>in</strong> [%]<br />
Elektrotechnik 17 30,4 12 31,6<br />
Wirtschafts<strong>in</strong>genieurwesen /<br />
Wirtschaftswissenschaften<br />
16 28,6 12 31,6<br />
Masch<strong>in</strong>enbau 13 23,2 7 18,4<br />
Bau<strong>in</strong>genieurwesen 5 8,9 4 10,5<br />
Sonstige (Agrarwissenschaften, Informatik,<br />
Architektur)<br />
5 8,9 3 7,9<br />
Gesamt 56 100,0 38 100,0<br />
Im Zuge des Ausbaus regenerativer Energien steigt <strong>der</strong> Bedarf an qualifizierten<br />
Fachkräften. Dies gilt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für Ingenieure. Im H<strong>in</strong>blick auf die von den<br />
Hochschulen angebotenen Studiengänge zeigt sich, dass unter strukturellen Gesichtspunkten<br />
zwei verschiedene Ansätze verfolgt werden:<br />
� Klassische Studiengänge: EE-Schwerpunktergänzung<br />
� Neue Spezial-Studiengänge zu erneuerbaren Energien<br />
Im Vorjahresvergleich wurden im Rahmen <strong>der</strong> Recherche mit 56 Studiengängen<br />
etwa 47 Prozent mehr Angebote an NRW-Hochschulen ermittelt als im Vorjahr<br />
(38 Studiengänge). Dabei handelt es sich überwiegend um klassische Studiengänge<br />
(Elektrotechnik, Masch<strong>in</strong>enbau etc.), die um regenerative Studienmodule<br />
ergänzt werden. Unter den 56 Studiengängen gibt es lediglich drei Angebote, <strong>in</strong><br />
denen ausschließlich e<strong>in</strong>e Spezialisierung auf regenerative Energien erfolgt.<br />
Die dom<strong>in</strong>ierenden Fachbereiche mit regenerativen Inhalten an den NRW-<br />
Hochschulen s<strong>in</strong>d Elektrotechnik (30 Prozent), Wirtschafts<strong>in</strong>genieurwesen / Wirtschaftswissenschaften<br />
(29 Prozent) und Masch<strong>in</strong>enbau (23 Prozent).<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf die energiespartenspezifische Differenzierung liegen Studiengänge<br />
mit Schwerpunktmodulen zur Solarenergie (34 Prozent), W<strong>in</strong>denergie (18<br />
Prozent) und Bioenergie (14 Prozent) vorne. Auch <strong>der</strong> Bereich <strong>der</strong> Energieeffizienz<br />
(14 Prozent) spielt e<strong>in</strong>e zunehmend wichtigere Rolle (Tabelle 3.10).<br />
29
3.5.2 Betriebliche Aus- und Weiterbildung<br />
Die betriebliche Aus- und Weiterbildung <strong>in</strong> Industrie und Handwerk bildet neben<br />
<strong>der</strong> Hochschulausbildung e<strong>in</strong>en weiteren wichtigen Schwerpunkt für die Vermittlung<br />
von regenerativem Wissen. Grundsätzlich kann dabei zwischen zwei Ausbildungswegen<br />
unterschieden werden.<br />
� Klassische Ausbildung mit Modul im Bereich regenerative Energien<br />
� Spezieller regenerativer Ausbildungsberuf<br />
Ähnlich wie bei <strong>der</strong> Hochschulausbildung zeigt die Analyse, dass Auszubildende<br />
i.d.R. zunächst e<strong>in</strong>e klassische Ausbildung wie z.B. Anlagenmechaniker, Fertigungsmechaniker,<br />
Mechatroniker o<strong>der</strong> auch Fach<strong>in</strong>formatiker absolvieren. Zum<br />
Teil enthalten die Ausbildungen bereits spezielle regenerative Module, <strong>in</strong> denen<br />
EE-Fragestellungen thematisiert werden. Die eigentliche Spezialisierung auf den<br />
Bereich erneuerbare Energien erfolgt allerd<strong>in</strong>gs erst später über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.<br />
Regenerative Weiterbildungsangebote <strong>in</strong> NRW<br />
In NRW gibt es bei regenerativen Energiethemen e<strong>in</strong> umfangreiches Angebot im<br />
Bereich <strong>der</strong> Weiterbildung. Im Rahmen des vorliegenden Berichtes wurden die<br />
Angebote und Maßnahmen ausgewertet, die im Weiterbildungsportal <strong>der</strong> EnergieAgentur.NRW<br />
(http://www.wissensportal-energie.de) im Bereich regenerative<br />
Energien erfasst s<strong>in</strong>d. 1<br />
Zu den Anbietern <strong>der</strong> Weiterbildungsangebote gehören Volkshochschulen, Verbraucherzentralen,<br />
Handwerkskammern sowie Bildungszentren und Akademien<br />
des Baugewerbes, des Handwerks und des Ingenieurwesens.<br />
Insgesamt hat sich das Angebot gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verän<strong>der</strong>t.<br />
In Summe werden 71 Angebote erfasst, die sich mit dem Themengebiet erneuerbare<br />
Energien befassen (Vorjahr 65 Angebote, + 9 Prozent).<br />
Hauptzielgruppe <strong>der</strong> Maßnahmen s<strong>in</strong>d Handwerker aus den Bereichen Baugewerbe,<br />
Elektro<strong>in</strong>stallation, SHK und Dachdecker. Insgesamt entfallen auf diese<br />
Gruppe über 60 Prozent <strong>der</strong> Angebote. Dienstleister wie z.B. Fachplaner, Energieberater,<br />
Energiemanager, Umweltbeauftrage o<strong>der</strong> Architekten bilden mit über<br />
40 Prozent e<strong>in</strong>en weiteren Zielgruppenschwerpunkt. Vergleichsweise ger<strong>in</strong>g ist<br />
dagegen <strong>der</strong> Anteil an Maßnahmen, die sich an Mitarbeiter aus dem <strong>in</strong>dustriellen<br />
Sektor (rd. 11 Prozent) richten (Tabelle 3.11).<br />
1 Dabei s<strong>in</strong>d die Übergänge zwischen Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien z.T. fließend. Die<br />
dargestelllten Ergebnisse zum Weiterbildungsangebot <strong>in</strong> NRW basieren auf <strong>der</strong> Analyse des Sem<strong>in</strong>arangebotes mit<br />
Schwerpunkten im Bereich erneuerbare Energien. Angebote aus Segmenten wie ökologischer / energieeffizienter Hausbau,<br />
Bauphysik o<strong>der</strong> energetische Sanierung, die den Bereich erneuerbare Energien laut Sem<strong>in</strong>arbeschreibung nur unspezifisch<br />
o<strong>der</strong> gar nicht behandeln, werden dagegen nicht bei <strong>der</strong> Auswertung berücksichtigt.<br />
30
Tabelle 3.11: Zielgruppen <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildungsangebote im Bereich erneuerbare<br />
Energien <strong>in</strong> NRW<br />
(Quelle: IWR, 2012, Datengrundlage: EnergieAgentur.NRW, eigene Berechnung)<br />
Zielgruppe Anteil [%] 1<br />
Handwerk 66,2<br />
Dienstleister 42,3<br />
Endverbraucher 15,5<br />
Industrie / Gewerbe 11,3<br />
1 = Mehrfachkategorisierung möglich<br />
Der handwerklichen Orientierung <strong>der</strong> Maßnahmen entsprechend zeigt sich, dass<br />
<strong>der</strong> thematische Schwerpunkt auf <strong>der</strong> Solarenergie liegt. Dabei steht die Photovoltaik<br />
<strong>in</strong> 51 Prozent <strong>der</strong> Fälle auf <strong>der</strong> Weiterbildungsagenda, auf die Solarthermie<br />
entfallen rd. 44 Prozent. Die Themengebiete Erdwärme (Geothermie / Wärmepumpen,<br />
rd. 18 Prozent) und Bioenergie (rd. 13 Prozent) bilden unter <strong>in</strong>haltlichen<br />
Gesichtspunkten e<strong>in</strong>en weiteren Schwerpunkt <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildungsangebote.<br />
Relativ ger<strong>in</strong>g ist das Angebot von Maßnahmen, die Aspekte <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>denergie (rd. 7 Prozent) und Wasserkraftnutzung (rd. 6 Prozent) betrachten.<br />
31
Langfassung <strong>der</strong> Studie<br />
32
4 Energie und Umwelt<br />
4.1 Internationale und nationale Energietrends<br />
4.1.1 Internationaler Status quo, Energieverbrauchsprognosen und Ziele<br />
zum EE-Ausbau<br />
Die Entwicklung auf den globalen Energiemärkten wurde im Jahr 2011 durch e<strong>in</strong>e<br />
Reihe von Großereignissen geprägt. Neben <strong>der</strong> Atomkatastrophe im japanischen<br />
Fukushima zählen dazu vor allem die Entwicklungen im Rahmen des arabischen<br />
Frühl<strong>in</strong>gs und die damit e<strong>in</strong>hergehenden Öl-Lieferausfälle, die nach dem<br />
Preisverfall im Jahr 2009 wie<strong>der</strong> zu e<strong>in</strong>em drastischen Anstieg des Ölpreises<br />
beigetragen haben. Trotz dieser Zäsuren hat <strong>der</strong> weltweite Energieverbrauch<br />
auch 2011 weiter zugenommen. Er erreichte nach Daten des M<strong>in</strong>eralölkonzerns<br />
BP etwa 12.300 Mio. Tonnen Öläquivalente (Mtoe). Gegenüber 2010 (12.000<br />
Mtoe) ist <strong>der</strong> Energieverbrauch damit um 2,5 Prozent gestiegen. Das Wachstum<br />
des Energieverbrauchs geht <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie auf die steigende Energienachfrage<br />
von Schwellenlän<strong>der</strong>n zurück. Dabei ist alle<strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a für etwa 71 Prozent des<br />
Nachfrageanstiegs verantwortlich. Der Energiebedarf <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> OECD organisierten<br />
Industrienationen ist dagegen mit e<strong>in</strong>em M<strong>in</strong>us von knapp e<strong>in</strong>em Prozent<br />
zum dritten Mal <strong>in</strong> Folge zurückgegangen [8]. Die wichtigsten Energieträger s<strong>in</strong>d<br />
im Jahr 2011 weiterh<strong>in</strong> fossilen Ursprungs. Insgesamt entfallen 2011 auf Öl, Kohle<br />
und Gas rd. 10.700 Mtoe, d.h. rd. 87 Prozent des weltweiten Verbrauchs.<br />
Wichtigster fossiler Energieträger bleibt mit rd. 4.060 Mtoe das Öl. Die aus Sicht<br />
des Klimaschutzes beson<strong>der</strong>s CO2-<strong>in</strong>tensive Kohlenutzung legt beim Verbrauch<br />
von 3.500 Mtoe auf rd. 3.700 Mtoe zu (+ 6 Prozent). Erneuerbare Energien (<strong>in</strong>kl.<br />
Wasserkraft) erreichen mit fast 1.000 Mtoe global e<strong>in</strong>en Anteil von etwa 8 Prozent<br />
und liegen damit vor <strong>der</strong> Atomenergie, die mit 600 Mtoe auf gut 5 Prozent<br />
kommt (Abbildung 4.1).<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
Quelle: IWR, Daten: BP<br />
Primärenergieverbrauch [MtoE]<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Öl Gas Kohle Atomenergie Reg. Energien<br />
Abbildung 4.1: Weltweiter Primärenergieverbrauch nach Energieträgern (Quelle: IWR,<br />
2012, Daten: BP)<br />
© IWR, 2012<br />
33
Dem volumenmäßig weiterh<strong>in</strong> hohen Öl-Anteil am globalen Primärenergieverbrauch<br />
steht <strong>der</strong> künftig erwartete Rückgang <strong>der</strong> weltweiten Ölför<strong>der</strong>ung gegenüber.<br />
Wann <strong>der</strong> Peak Oil-Zeitpunkt erreicht wird, ist schwer vorherzusagen.<br />
Wie rasch Ölför<strong>der</strong>kurven nach dem Überschreiten e<strong>in</strong>er Maximalför<strong>der</strong>ung trotz<br />
Neufunden und verme<strong>in</strong>tlich hoher Reserven allerd<strong>in</strong>gs zurückgehen können,<br />
zeigt die zeitliche Entwicklung <strong>der</strong> Ölför<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nordsee.<br />
Nachdem 1996 mit e<strong>in</strong>er För<strong>der</strong>menge von rd. 260 Mio. t das För<strong>der</strong>maximum<br />
(Peak Oil) erreicht wurde, ist die Ölför<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nordsee <strong>in</strong> den Folgejahren<br />
deutlich rückläufig. 2011 wurden nur noch 124,7 Mio. t Rohöl geför<strong>der</strong>t. Das entspricht<br />
e<strong>in</strong>em Rückgang um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2010: 140 Mio.<br />
t) und ist zugleich <strong>der</strong> niedrigste Stand seit 30 Jahren (1982). Im Vergleich zum<br />
Rekordjahr 1996 mit 260 Mio. t ist die Ölför<strong>der</strong>ung aus <strong>der</strong> Nordsee sogar bereits<br />
um über 50 Prozent zurückgegangen (Abbildung 4.2) [9].<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Ölför<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nordsee (Mio. t)<br />
0<br />
1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010<br />
Großbritannien Norwegen Dänemark Nie<strong>der</strong>lande Deutschland<br />
Quelle: IWR, Daten: DECC (UK), NPD (NW), RWE Dea AG (G), NLfB/LBEG (G), DEA (DK), NlOG (NL)<br />
Abbildung 4.2: Rohöl-För<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nordsee nach Län<strong>der</strong>n von 1971 - 2011<br />
(Peak Oil: Norwegen = 1996, GB = 1999, Dänemark = 2004, Quelle: IWR, 2012, [10])<br />
Erneuerbare Energien im globalen Strommix<br />
Tabelle 4.1: Energieträgermix <strong>der</strong> weltweiten Stromerzeugung 2009 und 2008 im<br />
Vergleich zu 1990 (Quelle: IWR, 2012, Daten: EIA [11])<br />
2009 2008 1990<br />
© IWR, 2012<br />
[Mrd. kWh] Anteil [%] [Mrd. kWh] Anteil [%] [Mrd. kWh] Anteil [%]<br />
Fossile Energieträger 12.671,5 66,8 12.871,5 67,4 7.136,3 63,2<br />
Erneuerbare Energien 3.760,6 19,8 3.654,1 19,1 2.270,2 20,1<br />
Kernenergie 2.568,7 13,5 2.602,4 13,6 1.908,8 16,9<br />
Pumpspeicherstrom -20,9 -0,1 -24,9 -0,1 -19,9 -0,2<br />
Gesamt 18.979,9 100,0 19.103,2 100,0 11.295,3 100,0<br />
34
Bezogen auf den weltweiten Stromverbrauch weisen erneuerbare Energien im<br />
Jahr 2009 e<strong>in</strong>en Anteil von 20 Prozent auf, <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Kernenergie beträgt<br />
etwa 14 Prozent, <strong>der</strong> Großteil von etwa 67 Prozent wird über fossile Energieträger<br />
abgedeckt (Tabelle 4.1). Damit liegt <strong>der</strong> prozentuale Anteil trotz des <strong>in</strong>ternationalen<br />
Ausbaus <strong>der</strong> erneuerbaren Energien lediglich auf e<strong>in</strong>em ähnlichen Niveau<br />
wie 1990.<br />
4.1.2 Nationale Energietrends – Atomausstieg und Energiewende, Status<br />
quo erneuerbare Energien<br />
In Deutschland haben sich <strong>der</strong> nach <strong>der</strong> Atomkatastrophe von Fukushima beschlossene<br />
Atomausstieg und die Energiewende zum zentralen Thema auf dem<br />
Energiesektor entwickelt. Im Fokus <strong>der</strong> öffentlichen Diskussion stehen <strong>der</strong>zeit vor<br />
allem die Kosten, die mit <strong>der</strong> Energiewende verbunden s<strong>in</strong>d. Zentrale Themen<br />
dabei s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Kostenentwicklung <strong>der</strong> EEG-Umlage sowie die Kosten<br />
für den Netzausbau.<br />
Umlagekosten und Strompreisentwicklung<br />
E<strong>in</strong>e wichtige Größe für die Preisbildung des Strompreises ist <strong>der</strong> Handel von<br />
Strom-Futures am Term<strong>in</strong>markt. Hier kaufen die Stromhändler bereits zum jetzigen<br />
Zeitpunkt e<strong>in</strong>en großen Teil ihrer Stromkont<strong>in</strong>gente für die nächsten Jahre zu<br />
festen Preisen e<strong>in</strong>. Am Term<strong>in</strong>markt s<strong>in</strong>d bed<strong>in</strong>gt durch den wachsenden Anteil<br />
von Strom aus erneuerbaren Energien trotz des im letzten Jahr von <strong>der</strong> Bundesregierung<br />
beschlossenen Atomausstiegs die Strompreise seit Jahresbeg<strong>in</strong>n weiter<br />
deutlich gefallen. Stand September 2012 notiert <strong>der</strong> Futurepreis (Phelix Baseload<br />
Year Future) für Grundlaststrom zur Lieferung im Jahr 2013 bei unter 5 Cent<br />
pro kWh, das ist <strong>der</strong> niedrigste Wert seit dem Jahr 2007 (Abbildung 4.3).<br />
15<br />
14<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
Settlement-Preis [ct/kWh] Aktuell: Lieferung 2013<br />
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012<br />
Quelle: IWR, Daten: EEX, eigene Berechnung<br />
Abbildung 4.3: Entwicklung <strong>der</strong> Futurepreise für Grundlast- und Spitzenlaststrom <strong>in</strong><br />
Deutschland seit 2007 (aktuelle Lieferung 2013) (Quelle: IWR, 2012, Daten:<br />
EEX)<br />
Phelix Baseload Year Future Phelix Peakload Year Future<br />
© IWR, 2012<br />
35
Nach dem momentan angewendeten EEG-Umlagemechanismus wird <strong>der</strong> erzeugte<br />
EEG-Strom von den Netzbetreibern vergütet und am Spotmarkt <strong>der</strong><br />
Strombörse vermarktet. Dadurch wird <strong>der</strong> EEG-Strom zu sog. Graustrom. Wie<br />
die aktuelle Entwicklung <strong>der</strong> Strompreise am Spotmarkt zeigt, führt das angewendete<br />
Verfahren dazu, dass Strom aus EEG-Anlagen sich aufgrund des hohen<br />
Handelsvolumens senkend auf den Börsenstrompreis auswirkt. Im Vergleich zum<br />
Vorjahreszeitraum ist <strong>der</strong> Preis für Grundlaststrom (Baseload) von Januar bis<br />
September 2012 im Durchschnitt um 16,4 Prozent von 5,2 Cent pro kWh auf 4,3<br />
Cent pro kWh gesunken (Abbildung 4.4). Im Vergleich zu Frankreich war Grundlaststrom<br />
damit <strong>in</strong> den ersten neun Monaten 2012 <strong>in</strong> Deutschland um etwa 9<br />
Prozent günstiger als im Nachbarland.<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Jahresmittel Börsen-Strompreis (Base- & Peakload) [Cent/kWh]<br />
2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *<br />
Baseload ct/kWh Peakload ct/kWh <strong>in</strong>kl.WE Peakload ct/kWh ohne WE<br />
Quelle: IWR, Daten: EEX, eigene Berechnung. * = unterjährig (Feb.-Dez 2005 / Jan-Sep 2012)<br />
Abbildung 4.4: Durchschnittliche jährliche Strompreise (Base- und Peakload) <strong>in</strong><br />
Deutschland von 2005 bis 2012 (Quelle: IWR, 2012, Daten: EEX)<br />
© IWR, 2012<br />
Auch die Spotmarktpreise für Peakloadstrom s<strong>in</strong>d 2012 von Januar bis September<br />
gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich von 6,1 Cent / kWh um 13,2 Prozent<br />
auf 5,3 Cent / kWh (ohne Wochenenden) zurückgegangen. Im Vergleich zu<br />
Frankreich ist die kWh Peakloadstrom <strong>in</strong> Deutschland 2012 bislang damit um etwa<br />
12 Prozent günstiger. Deutlich niedriger als nach <strong>der</strong>zeitigem Börsenstandard<br />
berechnet, s<strong>in</strong>d die Peakload-Preise am Spotmarkt, wenn neben den Wochentagen<br />
Montag bis Freitag auch die Wochenenden für die Mittelwertbildung e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden (Abbildung 4.4).<br />
Mit den s<strong>in</strong>kenden Börsenstrompreisen am Spotmarkt steigen aber gleichzeitig<br />
die Differenzkosten im Rahmen des EEG-Umlageausgleichs an. Während die<br />
Kunden von den Strompreissenkungen bislang kaum profitieren, kommen die<br />
EEG-Umlagekosten direkt beim e<strong>in</strong>zelnen Verbraucher an. Der aktuelle Umlagemechanismus<br />
führt dazu, dass s<strong>in</strong>kende Börsenstrompreise zu e<strong>in</strong>er Erhöhung<br />
<strong>der</strong> EEG-Umlage beitragen und damit zusätzliche Kosten für den Endverbraucher<br />
verursachen. Für 2012 werden bei e<strong>in</strong>er prognostizierten EEG-Strommenge<br />
von 110 Mrd. kWh nach dem jetzigen Stand <strong>der</strong> EEG-E<strong>in</strong>speisung zusätzliche<br />
EEG-Umlagekosten von bis zu 1 Mrd. Euro erwartet.<br />
36
Netzausbau und Netzausbaukosten<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> beschlossenen Energiewende und dem geplanten Ausbau<br />
erneuerbarer Energien gehören <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> Netze und die damit verbundenen<br />
Netzausbaukosten <strong>in</strong> <strong>der</strong> öffentlichen Wahrnehmung zu den zentralen<br />
Themen. Dabei wird die Kostenseite häufig ausschließlich mit dem weiteren Ausbau<br />
<strong>der</strong> erneuerbaren Energien verknüpft. Die Entwicklung <strong>der</strong> Investitionen <strong>in</strong><br />
die Stromnetze auf Jahresbasis zeigt jedoch, dass die Stromversorger auch <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Vergangenheit erhebliche Netz<strong>in</strong>vestitionen vorgenommen haben. Von 1991<br />
bis 2011 wurden die höchsten Investitionen <strong>in</strong> die Netze demnach im Jahr 1993<br />
mit rd. 4 Mrd. Euro getätigt. Nach <strong>der</strong> Strommarktliberalisierung im Jahr 1998<br />
wurden die Investitionen zunächst deutlich zurückgefahren. Den niedrigsten<br />
Stand erreichten die Ausgaben 2003 mit 1,7 Mrd. Euro. Seit 2005 s<strong>in</strong>d wie<strong>der</strong><br />
steigende Investitionen zu verzeichnen. Im Jahr 2011 wurde mit 3,6 Mrd. Euro<br />
wie<strong>der</strong> annähernd das Niveau von 1993 (4 Mrd. Euro) erreicht (Abbildung 4.5).<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Investitionen Stromnetze [Mrd. Euro]<br />
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011*<br />
Quelle: IWR, Daten: BDEW, AEE, * = Planungsstand Frühjahr 2009<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 4.5: Investitionen <strong>der</strong> Elektrizitätswirtschaft <strong>in</strong> die Stromnetze im Zeitraum<br />
1991 – 2011 (Quelle: IWR, 2012, Daten: BDEW, AEE)<br />
EnLAG und Netzentwicklungsplan - Rahmen für den Netzausbau<br />
<strong>Zur</strong> Beschleunigung des Baus <strong>der</strong> wichtigsten Leitungsvorhaben im Stromnetz<br />
und <strong>der</strong> Integration erneuerbarer Energien wurde 2009 das Energieleitungsausbaugesetz<br />
(EnLAG) verabschiedet. Insgesamt s<strong>in</strong>d dar<strong>in</strong> 24 Vorhaben mit e<strong>in</strong>er<br />
Gesamttrassenlänge von etwa 1.800 km identifiziert.<br />
Zudem haben die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) Ende Mai 2012 den Entwurf<br />
für e<strong>in</strong>en Netzentwicklungsplan (NEP) vorgelegt, <strong>in</strong> dem aufbauend auf den<br />
EnLAG-Vorhaben weitere wichtige Netzausbauvorhaben im deutschen Übertragungsnetz<br />
dargestellt s<strong>in</strong>d. Nach dem Verständnis <strong>der</strong> ÜNB gibt <strong>der</strong> NEP e<strong>in</strong>en<br />
Überblick über alle Maßnahmen, die <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> nächsten 10 bzw. 20 Jahre für<br />
e<strong>in</strong> sicheres Übertragungsnetz erfor<strong>der</strong>lich s<strong>in</strong>d. Kern<strong>in</strong>halte s<strong>in</strong>d die Def<strong>in</strong>ition<br />
von Anfangs- und Endpunkten von zukünftig benötigten Leitungsverb<strong>in</strong>dungen<br />
und weniger die konkreten Trassenverläufe. Nach e<strong>in</strong>er Konsultationsphase bis<br />
37
zum 10. Juli 2012 haben die ÜNB e<strong>in</strong>en zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplanes<br />
erarbeitet. Dieser wurde <strong>der</strong> Bundesnetzagentur im August 2012 übergeben,<br />
er soll die Basis für den Bundesbedarfsplan darstellen.<br />
Kosten für Netzausbau noch unklar<br />
Die mit dem Ausbau <strong>der</strong> Höchstspannungsnetze verbundenen Kosten beziffern<br />
die ÜNB für die nächsten zehn Jahre auf etwa 20 Mrd. Euro [12], [13]. Dar<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d<br />
rd. 7 Mrd. Euro für Investitionen <strong>in</strong> das gemäß EnLAG def<strong>in</strong>ierte Startnetz enthalten.<br />
Das Startnetz umfasst den Status quo des deutschen Übertragungsnetzes<br />
und berücksichtigt zusätzlich Stromleitungen, die bereits im Bau o<strong>der</strong> genehmigt<br />
s<strong>in</strong>d. Damit ergeben sich für den Ausbau des Übertragungsnetz gegenüber dem<br />
Startnetz <strong>in</strong> den nächsten zehn Jahren re<strong>in</strong> rechnerisch Zusatzkosten von rd. 13<br />
Mrd. Euro (jährlich rd. 1,3 Mrd. Euro). Zusätzlich werden noch Kosten <strong>in</strong> Höhe<br />
von rd. 37 Mrd. Euro für den Anschluss von Offshore-W<strong>in</strong>dparks und für den<br />
Ausbau <strong>der</strong> regionalen Verteilnetze erwartet [14].<br />
Wie hoch die tatsächlichen Kosten s<strong>in</strong>d, die im Zuge des künftigen Netzausbaus<br />
<strong>in</strong> Summe jährlich zu erwarten s<strong>in</strong>d, lässt sich angesichts <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Datenlage<br />
nicht e<strong>in</strong>deutig beziffern. Unklar ist, wie das Verhältnis und die genaue Abgrenzung<br />
zwischen den ohneh<strong>in</strong> auf den e<strong>in</strong>zelnen Spannungsebenen anfallenden<br />
Netzkosten und den zusätzlichen Kosten für den Netzausbau im Rahmen<br />
<strong>der</strong> Energiewende ist.<br />
38
4.2 Entwicklung <strong>der</strong> regenerativen Energieerzeugung <strong>in</strong> NRW<br />
und Beitrag zum Klimaschutz<br />
4.2.1 Status quo <strong>der</strong> Nutzung Erneuerbarer Energien <strong>in</strong> Deutschland<br />
In Deutschland entfallen 2011 mit etwa 123 Mrd. kWh rd. 20 Prozent des Stromverbrauchs<br />
(rd. 609 Mrd. kWh) auf erneuerbare Energien. Gemessen am weltweiten<br />
Energiemix im Stromsektor liegt Deutschland damit genau im Durchschnitt.<br />
Bezogen auf den Wärmeverbrauch <strong>in</strong> Deutschland (Endenergie, rd. 1.300<br />
TWh) liegt <strong>der</strong> EE-Anteil am Endenergieverbrauch für Wärme 2011 mit 143,5<br />
TWh bei e<strong>in</strong>em Anteil von etwa 11 Prozent [15].<br />
Neben dem Strom- und Wärmesektor soll <strong>der</strong> EE-Anteil national auch im Treibstoffsektor<br />
ausgebaut werden. Hier erreicht <strong>der</strong> Beitrag biogener Kraftstoffe am<br />
Kraftstoffverbrauch <strong>in</strong> Deutschland mit 34,2 TWh etwa 6 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen,<br />
dass <strong>der</strong> Absatz von Biotreibstoffen <strong>in</strong> Deutschland mittlerweile<br />
fast ausschließlich über die Beimischung erfolgt, da <strong>der</strong> B100-Biodieselmarkt seit<br />
2009 weitgehend zusammengebrochen ist. Die zum 01.01.2011 nur schleppend<br />
gestartete Markte<strong>in</strong>führung von E10-Bioethanol gestaltet sich weiterh<strong>in</strong> schwierig.<br />
Neuesten Analysen zufolge hat bislang erst rund e<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong> Haushalte mit e<strong>in</strong>em<br />
Benz<strong>in</strong>-Pkw schon e<strong>in</strong>mal Super E10 getankt. Die <strong>Zur</strong>ückhaltung <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Haushalte wird zumeist mit technischen Bedenken begründet [16].<br />
Über alle regenerativen Teilsparten (Strom, Wärme, Treibstoffe) liegt <strong>der</strong> Substitutionseffekt<br />
erneuerbarer Energien und damit <strong>der</strong> Beitrag zum Klimaschutz <strong>in</strong><br />
Deutschland 2011 bei etwa 128 Mio. t CO2. Dem stehen Emissionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Größenordnung von rd. 800 Mio. t gegenüber [4].<br />
4.2.2 Regenerative Stromproduktion <strong>in</strong> NRW<br />
Im Jahr 2011 ist die regenerative Stromerzeugung <strong>in</strong> NRW (ohne Grubengas) im<br />
Vergleich zum Vorjahr 2010 um 23 Prozent auf knapp 13 Mrd. kWh (2010: 10,5<br />
Mrd. kWh) angestiegen. Damit hat das Wachstum <strong>der</strong> regenerativen Stromerzeugung<br />
nach e<strong>in</strong>er Stagnation im Jahr 2009 und e<strong>in</strong>em mo<strong>der</strong>aten Wachstum<br />
im Jahr 2010 (+ 7 Prozent) weiter an Dynamik gewonnen. Insbeson<strong>der</strong>e die<br />
Stromerzeugung aus W<strong>in</strong>denergie, Photovoltaik und Biogas haben gegenüber<br />
dem Vorjahr deutlich zulegen können. Während bei <strong>der</strong> PV- und Biogasnutzung<br />
Kapazitätseffekte für das Wachstum verantwortlich s<strong>in</strong>d, geht die Steigerung <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>dstromerzeugung vor allem auf e<strong>in</strong> besseres W<strong>in</strong>djahr 2011 zurück.<br />
Wenn im S<strong>in</strong>ne des Klimaschutzes die Stromerzeugung aus Grubengas <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Größenordnung von 0,7 Mrd. kWh (2010: rd. 0,8 Mrd. kWh) mit e<strong>in</strong>gezogen wird,<br />
so erhöht sich die klimafreundliche Gesamtstromerzeugung auf etwa 13,6 Mrd.<br />
kWh (2010: rd. 11,3 Mrd. kWh) (Tabelle 4.2, Abbildung 4.6).<br />
Bezogen auf die regenerative Gesamtstromerzeugung <strong>in</strong> Deutschland von 123,2<br />
Mrd. kWh entfällt mit e<strong>in</strong>er regenerativen NRW-Stromerzeugung von rd. 13 Mrd.<br />
kWh (ohne Grubengas) e<strong>in</strong> Anteil von knapp 11 Prozent auf NRW.<br />
39
Tabelle 4.2: Regenerative Stromerzeugung <strong>in</strong> NRW 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Referenzwerte auf Basis von Bezreg. Arnsberg, BNetzA, Büro für<br />
Wasserkraft NRW, DBFZ, DEWI, ITAD, IT.NRW, IWR, LANUV NRW, LWK NRW, z.T. eig. Berechnung<br />
/ Schätzung)<br />
Bioenergie<br />
Biomasse fest<br />
Biogas<br />
biogener Abfall<br />
Biomasse flüssig<br />
Klärgas<br />
Deponiegas<br />
Strom<br />
[Mrd. kWh]<br />
5,10<br />
1,50<br />
1,62<br />
1,33<br />
0,14<br />
0,32<br />
0,18<br />
2011 1 2010 Veränd.<br />
Anteil [%] Strom<br />
[Mrd. kWh]<br />
39,4 4,81<br />
1,40<br />
1,15<br />
1,42<br />
0,34<br />
0,28<br />
0,22<br />
Vorjahr<br />
Anteil Bund<br />
(2011)<br />
Anteil [%] [%] [%]<br />
45,8 + 6,0 13,8<br />
W<strong>in</strong>denergie 5,15 39,8 3,93 37,4 + 31,0 10,5<br />
Photovoltaik 2,18 16,9 1,20 11,4 + 81,7 11,3<br />
Wasserkraft 0,50 3,9 0,57 5,4 - 12,3 2,8<br />
Summe Strom<br />
regenerativ<br />
12,93 100,0 10,51 100,0 + 23,0 10,5<br />
Grubengas 0,71 0,81 - 12,2 64,5<br />
∑ Strom Klimaschutz 13,64 11,32 + 20,5 11,0<br />
1 = Werte vorläufig<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Stromerzeugung [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.6: Entwicklung <strong>der</strong> regenerativen Stromerzeugung und <strong>der</strong> Stromerzeugung<br />
im Bereich Klimaschutz (<strong>in</strong>kl. Grubengas) <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR,<br />
2012)<br />
Strom reg. m<strong>in</strong>/max Strom (<strong>in</strong>kl. Grubengas)<br />
© IWR, 2012<br />
40
Beim Ausbau regenerativer Stromerzeugungskapazitäten legt NRW gestützt<br />
durch den anhaltenden Boom im PV-Sektor sowie e<strong>in</strong>en starken Zubau auf dem<br />
Biogassektor um etwa 17 Prozent auf e<strong>in</strong>en Gesamtbestand von fast 7.300 MW<br />
zu (Vorjahr 2010: rd. 6.200 MW). In Bezug auf den Zubau liegt NRW auf e<strong>in</strong>em<br />
Steigerungsniveau, das auch auf Bundesebene zu verzeichnen ist (Tabelle 4.3).<br />
Tabelle 4.3: Regenerative Stromerzeugungskapazitäten <strong>in</strong> NRW und <strong>in</strong> Deutschland<br />
2011 und 2010 im Vergleich<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: AGEE-Stat, BMU, IWR-Referenzwerte auf Basis von Bezreg. Arnsberg,<br />
BNetzA, Büro für Wasserkraft NRW, DBFZ, DEWI, ITAD, IT.NRW, IWR, LANUV NRW, LWK NRW, z.T.<br />
eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Bioenergie (ohne Deponie-<br />
/ Klärgas und Abfall)<br />
2011 1 2010 Veränd.<br />
NRW<br />
Veränd.<br />
Bund<br />
NRW Bund NRW Bund [%] [%]<br />
rd. 450 MW 5.131 MW rd. 370 MW 4.659 MW + 21,6 + 10,1<br />
W<strong>in</strong>denergie 3.060 MW 29.071 MW 2.920 MW 27.191 MW + 4,8 + 6,9<br />
Photovoltaik 2.850 MW 25.039 MW 2.000 MW 17.554 MW + 42,5 + 42,6<br />
Wasserkraft<br />
(regenerativ)<br />
rd. 190 MW 4.401 MW rd. 190 MW 4.395 MW + 1,1 + 0,1<br />
Sonstige Erneuerbare 540 MW 2.055 MW 540 MW 2.012 MW +/- 0 + 2,1<br />
Grubengas 186 MW 240 MW 183 MW 237 MW + 1,6 + 1,3<br />
Summe 7.280 MW 65.940 MW 6.200 MW 56.050 MW + 17,4 + 17,6<br />
1 = Werte vorläufig<br />
41
4.2.2.1 W<strong>in</strong>dstromproduktion und Marktentwicklung<br />
Zum W<strong>in</strong>dstrompotenzial <strong>in</strong> NRW<br />
Die Landesregierung NRW hat zur Unterstützung bei <strong>der</strong> Erstellung kommunaler<br />
Klimaschutzkonzepte dem Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz<br />
(LANUV NRW) den Auftrag für die „Potenzialstudie Erneuerbare Energien<br />
NRW“ erteilt. Ziel ist es, den Bestand und die regionalen Potenziale <strong>in</strong> NRW im<br />
Bereich W<strong>in</strong>d-, Solar- und Bioenergie sowie Geothermie zu erfassen [17]. Die<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Potenzialuntersuchungen sollen <strong>in</strong> das Fach<strong>in</strong>formationssystem<br />
„Energieatlas Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen“ e<strong>in</strong>gepflegt und Kommunen bzw. den weiteren<br />
Planungsebenen zur Verfügung gestellt werden. Ergebnisse liegen <strong>der</strong>zeit für<br />
die Bereiche W<strong>in</strong>d- und Solarenergie vor. Im Rahmen <strong>der</strong> Potenzialanalyse<br />
W<strong>in</strong>denergie werden neben dem Status quo <strong>der</strong> WEA-Nutzung und den Potenzialen<br />
auf <strong>der</strong> Angebotsseite (W<strong>in</strong>dverhältnisse) auch die zur Verfügung stehenden<br />
Flächenpotenziale unter Berücksichtigung <strong>der</strong> verschiedenen Raumnutzungsfunktionen<br />
ermittelt. In die Flächenanalyse fließen dabei Kriterien aus den Bereichen<br />
Siedlung, Infrastruktur, Natur- und Landschaft, Wald und Gewässer e<strong>in</strong>. Auf<br />
dieser Grundlage wird die Gesamtfläche von Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen nach drei Kategorien<br />
klassifiziert: Tabuflächen, Prüfflächen und grundsätzlich geeignete Flächen.<br />
Durch Überlagerung <strong>der</strong> grundsätzlich geeigneten Flächen mit den Ergebnissen<br />
<strong>der</strong> W<strong>in</strong>dpotenzialanalyse werden für die W<strong>in</strong>denergienutzung nutzbaren<br />
Areale identifiziert und drei Szenarien erstellt.<br />
� NRWalt-Szenario: Flächen, die ohne Restriktionen genutzt werden können<br />
und nicht im Wald liegen,<br />
� NRW-Leitszenario: Flächen aus NRWalt-Szenario zuzüglich <strong>der</strong> Kyrillflächen<br />
und Nadelwaldflächen (Laubbaumbestände nach E<strong>in</strong>zelfallprüfung)<br />
� NRWplus-Szenario: NRW-Leitszenario plus Flächen von Laub- und<br />
Mischwäl<strong>der</strong>n, sofern ke<strong>in</strong>e sonstigen Ausschluss- o<strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelfallprüfkriterien<br />
(z.B. Schutzgebiete) vorliegen<br />
Zusätzlich fließt <strong>in</strong> die Ergebnisdarstellung e<strong>in</strong>, ob sich die ermittelten Flächen im<br />
öffentlichen Besitz bef<strong>in</strong>den. <strong>Zur</strong> Optimierung <strong>der</strong> Anlagenstandorte wird zudem<br />
für e<strong>in</strong>e def<strong>in</strong>ierte Referenz-WEA e<strong>in</strong>e Analyse <strong>der</strong> mit dem WEA-Betrieb verbundenen<br />
möglichen Schallemissionen vorgenommen [17], [18], [19].<br />
W<strong>in</strong>dstromproduktion <strong>in</strong> NRW steigt w<strong>in</strong>djahresbed<strong>in</strong>gt um mehr als 30<br />
Prozent auf über 5 Mrd. kWh<br />
Mit 5,15 Mrd. kWh haben die W<strong>in</strong>dkraftanlagen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 2011<br />
über 30 Prozent mehr Strom produziert als im Vorjahr 2010 (rd. 3,9 Mrd. kWh).<br />
Dieser deutliche Anstieg hat se<strong>in</strong>e Ursache nicht im Ausbau <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergienutzung<br />
<strong>in</strong> NRW, son<strong>der</strong>n geht v.a. auf e<strong>in</strong> im Vergleich zu 2010 deutlich besseres<br />
W<strong>in</strong>djahr 2011 zurück. Nach dem IWR-W<strong>in</strong><strong>der</strong>trags<strong>in</strong>dex verbuchten die Betreiber<br />
von WEA im Landschaftsraum B<strong>in</strong>nenland 2010 e<strong>in</strong> um etwa 25-Prozent unter<br />
dem 10-jährigen Mittel liegendes W<strong>in</strong>djahr. Mit e<strong>in</strong>em Plus von 2,3 Prozent<br />
wurde 2011 dagegen wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong> normales bzw. leicht überdurchschnittliches<br />
W<strong>in</strong>djahr erzielt (Tabelle 4.4, Abbildung 4.7). Ziel <strong>der</strong> Landesregierung ist es, den<br />
Anteil <strong>der</strong> W<strong>in</strong>dstromerzeugung bis 2020 auf 15 Prozent zu steigern. Bezogen<br />
auf e<strong>in</strong>en NRW-Stromverbrauch von etwa 140 Mrd. kWh (2010) entfällt damit bei<br />
5,15 Mrd. kWh <strong>der</strong>zeit e<strong>in</strong> Anteil von fast 4 Prozent auf die W<strong>in</strong>denergienutzung.<br />
42
Tabelle 4.4: W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, DEWI, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung)<br />
Zubau WEA-Leistung<br />
davon Repower<strong>in</strong>g<br />
Abbau im Zuge<br />
von Repower<strong>in</strong>g<br />
NRW-WEA-<br />
Gesamtleistung<br />
Daten: IWR, DEWI IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd. Vor-<br />
163,8 MW<br />
36,9 MW<br />
94,6 MW<br />
21,8 MW<br />
163,8 MW<br />
36,9 MW<br />
94,6 MW<br />
21,8 MW<br />
jahr<br />
+ 73,2 %<br />
+ 69,3 %<br />
15,7 MW 11,2 MW 15,7 MW 11,2 MW + 40,2 %<br />
3.057 MW 2.909 MW 3.060 MW 2.910 MW + 5,2 %<br />
W<strong>in</strong>dstromproduktion 5,15 Mrd. kWh 3,93 Mrd. kWh 5,15 Mrd. kWh 3,93 Mrd. kWh + 31,0 %<br />
1 = Werte vorläufig<br />
4.800<br />
4.000<br />
3.200<br />
2.400<br />
1.600<br />
800<br />
0<br />
[MW] [Mrd. kWh]<br />
0,0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
WEA-Leistung [MW] Strom [Mrd. kWh]<br />
Abbildung 4.7: Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten WEA-Gesamtleistung und W<strong>in</strong>dstromerzeugung<br />
<strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, 2011 vorläufig)<br />
NRW-Marktentwicklung 2011 gew<strong>in</strong>nt an Dynamik<br />
Der Zubau von W<strong>in</strong>denergieanlagen hat 2011 <strong>in</strong> NRW wie<strong>der</strong> deutlich angezogen.<br />
Insgesamt wurden knapp 90 Anlagen mit e<strong>in</strong>er Gesamtleistung von etwa<br />
164 MW neu errichtet. Gegenüber 2010 (rd. 95 MW) ergibt sich bei <strong>der</strong> neu <strong>in</strong>stallierten<br />
Leistung damit e<strong>in</strong> Wachstum von etwa 73 Prozent. Gleichwohl liegt<br />
<strong>der</strong> WEA-Neubau <strong>in</strong> NRW auch 2011 um etwa 62 Prozent unter dem bislang<br />
besten Branchenjahr 2002 (rd. 430 MW neue W<strong>in</strong>denergieleistung) (Abbildung<br />
4.8).<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
© IWR, 2012<br />
43
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
WEA-Leistung [MW]<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
Quelle: IWR, Daten / Berechnung: IWR * = vorläufig<br />
Abbildung 4.8: NRW-Marktentwicklung W<strong>in</strong>denergie: Die jährlich neu <strong>in</strong>stallierte WEA-<br />
Leistung seit 2000 (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, 2011 vorläufig)<br />
Insgesamt waren <strong>in</strong> NRW Ende 2011 über 2.800 WEA mit e<strong>in</strong>er Gesamtleistung<br />
von rd. 3.060 MW am Netz. Damit liegt NRW an fünfter Stelle h<strong>in</strong>ter den Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
Sachsen-Anhalt (rd. 3.640 MW) und Schleswig-Holste<strong>in</strong> (rd. 3.280 MW).<br />
Angeführt wird das Bundeslän<strong>der</strong>rank<strong>in</strong>g mit großem Abstand von Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
(rd. 7.000 MW) vor Brandenburg (rd. 4.600 MW) auf dem zweiten Rang.<br />
Repower<strong>in</strong>g <strong>in</strong> NRW und Repower<strong>in</strong>g-Initiative<br />
© IWR, 2012<br />
Mit Blick auf die Zielsetzung des Landes NRW zur Erhöhung des W<strong>in</strong>dstromanteils<br />
auf 15 Prozent an <strong>der</strong> Stromversorgung bis 2020 hat neben dem Anlagenneubau<br />
das WEA-Repower<strong>in</strong>g, d.h. <strong>der</strong> Austausch von älteren Anlagen durch<br />
neue und leistungsfähigere WEA, e<strong>in</strong>e große Bedeutung.<br />
Um diesen Prozess zu begleiten, hat die Landesregierung e<strong>in</strong>e Repower<strong>in</strong>g-<br />
Initiative <strong>in</strong>itiiert. Zu den Zielen <strong>der</strong> Initiative zählen die Mo<strong>der</strong>ation und Unterstützung<br />
des Repower<strong>in</strong>g-Prozesses, das Aufzeigen von Problemkreisen, die Entwicklung<br />
von Lösungsansätzen sowie <strong>der</strong> Aufbau e<strong>in</strong>es NRW-spezifischen<br />
Repower<strong>in</strong>g-Katasters.<br />
Für die Betreiber von W<strong>in</strong>denergieanlagen ist <strong>der</strong> betriebswirtschaftliche Rahmen<br />
e<strong>in</strong>e zentrale Größe bei <strong>der</strong> Durchführung e<strong>in</strong>es Repower<strong>in</strong>gprojektes. Dabei<br />
werden die Kosten für das neue Projekt und <strong>der</strong> zu erwartende Mehrertrag <strong>der</strong><br />
E<strong>in</strong>nahmen- und Kostenseite für das bestehende WEA-Vorhaben gegenübergestellt.<br />
Betreiber ziehen es dabei aus wirtschaftlichen Erwägungen oft vor, e<strong>in</strong>e<br />
WEA nach Ablauf <strong>der</strong> Kapitaldienstphase nicht direkt durch e<strong>in</strong>e Neuanlage zu<br />
ersetzen. Stattdessen werden die schuldenfreien Altanlagen zunächst weiter betrieben<br />
und erst später durch neue W<strong>in</strong>denergieanlagen ersetzt.<br />
Nach den Eckdaten bislang durchgeführter Repower<strong>in</strong>g-Projekte auf Bundesebene<br />
ist davon auszugehen, dass die abgebauten Altanlagen vor diesem H<strong>in</strong>tergrund<br />
i.d.R. e<strong>in</strong> Betriebsalter von m<strong>in</strong>destens 12 Jahren aufweisen. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
mit Blick auf Projekte an B<strong>in</strong>nenlandstandorten ist aufgrund <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>geren<br />
44
W<strong>in</strong>dhöffigkeit vor e<strong>in</strong>em WEA-Repower<strong>in</strong>g von höheren Betriebslaufzeiten <strong>der</strong><br />
Alt-WEA auszugehen. Bundesweit f<strong>in</strong>det e<strong>in</strong> Großteil des WEA-Repower<strong>in</strong>gs<br />
aufgrund des höheren Anlagenalters bislang <strong>in</strong> den Küstenbundeslän<strong>der</strong>n statt.<br />
Mit zunehmendem Anlagenalter ist e<strong>in</strong> Anstieg des Repower<strong>in</strong>g-Volumens <strong>in</strong> den<br />
übrigen Bundeslän<strong>der</strong>n zu erwarten.<br />
Unter <strong>der</strong> Annahme, dass W<strong>in</strong>denergieanlagen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ab e<strong>in</strong>em<br />
Betriebsalter von 15 Jahren repowert werden können, bef<strong>in</strong>den sich zum jetzigen<br />
Zeitpunkt <strong>in</strong> NRW rd. 730 WEA mit e<strong>in</strong>er Leistung von 250 MW am Netz, die aus<br />
heutiger Sicht als repower<strong>in</strong>gfähig e<strong>in</strong>gestuft werden können (Abbildung 4.9).<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Jahreszubau WEA<br />
0<br />
≤ 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
repower<strong>in</strong>gfähig zu jung für Repower<strong>in</strong>g<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 4.9: Annahme 15 Jahre Betriebszeit: Zahl <strong>der</strong> repower<strong>in</strong>gfähigen und für e<strong>in</strong><br />
Repower<strong>in</strong>g nicht geeigneten WEA <strong>in</strong> NRW, Betrachtungszeitpunkt<br />
2012 (Quelle: IWR, Daten: IWR, eigene Berechnung, 2012)<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Jahreszubau WEA<br />
0<br />
≤ 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
repower<strong>in</strong>gfähig zu jung für Repower<strong>in</strong>g<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 4.10: Annahme 12 Jahre Betriebszeit: Zahl <strong>der</strong> repower<strong>in</strong>gfähigen und für e<strong>in</strong><br />
Repower<strong>in</strong>g nicht geeigneten WEA <strong>in</strong> NRW, Betrachtungszeitpunkt<br />
2012 (Quelle: IWR, Daten: IWR, eigene Berechnung, 2012)<br />
45
Wenn davon ausgegangen wird, dass WEA bereits ab e<strong>in</strong>em Betriebsalter von<br />
12 Jahren repowert werden, so erhöht sich <strong>der</strong> für das Repower<strong>in</strong>g geeignete<br />
Anlagenbestand <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen entsprechend. Unter diesen Randbed<strong>in</strong>gungen<br />
wären <strong>der</strong>zeit etwa 1.200 WEA mit e<strong>in</strong>er Leistung von 640 MW<br />
repower<strong>in</strong>gfähig (Abbildung 4.10).<br />
Als e<strong>in</strong>geschränkt repower<strong>in</strong>gfähig müssen WEA mit Errichtungszeitpunkt vor<br />
1999 betrachtet werden, da für diese WEA i.d.R. anzunehmen ist, dass e<strong>in</strong>e Errichtung<br />
außerhalb von WEA-Konzentrationszonen stattgefunden hat. E<strong>in</strong><br />
Repower<strong>in</strong>g durch Neuanlagen ist dabei aus planungsrechtlicher Sicht oftmals<br />
nur an e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>en Standort <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er ausgewiesenen Konzentrationszone<br />
möglich, nicht aber am ursprünglichen Orig<strong>in</strong>alstandort <strong>der</strong> Anlage.<br />
Status quo WEA-Repower<strong>in</strong>g <strong>in</strong> NRW Ende 2011<br />
Über e<strong>in</strong>e Umfrage unter den 396 NRW-Kommunen (Rücklauf: 289 Kommunen,<br />
73 Prozent) durch das IWR im Rahmen <strong>der</strong> NRW-Repower<strong>in</strong>g-Initiative im Jahr<br />
2011 wurden zentrale Informationen zur W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong> den NRW-<br />
Kommunen erhoben. Erfasst wurde u.a. e<strong>in</strong> erster Status quo zum WEA-<br />
Repower<strong>in</strong>g und zu den Aktivitäten <strong>der</strong> Kommunen zur Neuausweisung bzw. Erweiterung<br />
ihrer Konzentrationsflächen. Des Weiteren wurden Repower<strong>in</strong>g-<br />
Hemmnisse ermittelt. Ziel <strong>der</strong> Umfrage ist es, e<strong>in</strong> NRW-Repower<strong>in</strong>gkataster aufzubauen,<br />
<strong>in</strong> dem die wichtigen Basis<strong>in</strong>formationen zum WEA-Repower<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />
NRW gebündelt werden.<br />
Nach <strong>der</strong> Umfrage unter den Kommunen sowie anschließen<strong>der</strong> Nachmeldungen<br />
wurden <strong>in</strong> NRW bis Ende 2011 rd. 50 WEA mit e<strong>in</strong>er Leistung von 35 MW abgebaut<br />
und durch 40 neue Anlagen mit e<strong>in</strong>er Leistung von etwa 83 MW ersetzt.<br />
Beim WEA-Neubau liegt <strong>der</strong> regionale Schwerpunkt auf dem Regierungsbezirk<br />
Münster, auf den rd. 40 Prozent <strong>der</strong> neuen Anlagen bzw. Leistung entfallen. Danach<br />
folgt Detmold mit etwa 29 Prozent <strong>der</strong> neuen WEA und WEA-Leistung, vor<br />
Köln mit rd. 24 Prozent <strong>der</strong> neuen WEA bzw. rd. 27 Prozent <strong>der</strong> neu <strong>in</strong>stallierten<br />
Leistung. Ke<strong>in</strong>e Repower<strong>in</strong>gaktivitäten lassen sich bislang im Regierungsbezirk<br />
Düsseldorf nachweisen (Tabelle 4.5). E<strong>in</strong> Überblick über bisherige Repower<strong>in</strong>gprojekte<br />
<strong>in</strong> NRW auf Kreisebene ist <strong>in</strong> Abbildung 4.11 dargestellt.<br />
Tabelle 4.5: WEA-Repower<strong>in</strong>gaktivitäten <strong>in</strong> NRW nach Regierungsbezirken<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, Stand: Ende 2011)<br />
Rückbau WEA-Repower<strong>in</strong>g<br />
WEA [%] Leistung [%] WEA [%] Leistung [%]<br />
Arnsberg 11,3 2,7 7,3 4,3<br />
Detmold 30,2 21,7 29,3 29,6<br />
Düsseldorf - - - -<br />
Köln 22,6 29,6 24,4 26,6<br />
Münster 35,9 46,0 39,0 39,5<br />
Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
46
Abbildung 4.11: Status quo WEA-Repower<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen auf Kreisebene<br />
Ende 2011 (Quelle: IWR, Daten: IWR, eigene Berechnung, Werte gerundet, 2012)<br />
Entwicklung des WEA-Repower<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> NRW und E<strong>in</strong>flussfaktoren<br />
Auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> im Herbst 2011 durchgeführten Umfrage erwarten von 226<br />
NRW-Kommunen, auf <strong>der</strong>en Geme<strong>in</strong>degebiet WEA stehen, <strong>in</strong> den nächsten Jahren<br />
rd. 17 Prozent (rd. 40 Kommunen) Repower<strong>in</strong>g-Projekte <strong>in</strong>nerhalb des Geme<strong>in</strong>degebietes.<br />
Für etwa 65 Prozent <strong>der</strong> Kommunen ist die Frage nach dem<br />
mittelfristigen Repower<strong>in</strong>g-Aufkommen dagegen noch unklar.<br />
E<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Kommunen hat sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Umfrage auch zu den aus kommunaler<br />
Sicht bestehenden Hemmnissen und E<strong>in</strong>flussfaktoren für das WEA-Repower<strong>in</strong>g<br />
geäußert. Neben dem häufig noch vergleichsweise ger<strong>in</strong>gem Betriebsalter <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>denergieanlagen werden von den Kommunen vor allem Aspekte aus folgenden<br />
Bereichen angeführt:<br />
� Planungs- und Genehmigungsrecht (Immissionsschutz, Höhenbeschränkungen<br />
und Artenschutz)<br />
� privatrechtliche Faktoren<br />
47
Planungs- und Genehmigungsrecht<br />
Die Umsetzung von Repower<strong>in</strong>gprojekten ist an Konzentrationszonen gebunden,<br />
die das Potenzial zur Errichtung von leistungsfähigeren Groß-WEA aufweisen.<br />
Bei älteren Konzentrationszonen kann es beim Repower<strong>in</strong>g mit größeren Anlagen<br />
aus kommunaler Sicht aufgrund <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen vor Ort z.T. zu<br />
Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>haltung des Immissionsschutzes (Schallemissionen<br />
und Schattenwurf) kommen. E<strong>in</strong> weiteres Hemmnis bei bestehenden Konzentrationszonen<br />
können Höhenbeschränkungen se<strong>in</strong>, die nicht pauschal aufgehoben<br />
werden und <strong>der</strong> Errichtung größerer Repower<strong>in</strong>g-WEA entgegenstehen können.<br />
Sofern die bereits ausgewiesenen Konzentrationszonen den Anfor<strong>der</strong>ungen an<br />
die Errichtung mo<strong>der</strong>ner Groß-WEA nicht entsprechen, rückt optional die Ausweisung<br />
neuer Zonen auf die Agenda. Dabei kann die im Zuge <strong>der</strong> Bauleitplanung<br />
durchzuführende Artenschutzprüfung aus zeitlichen und f<strong>in</strong>anziellen Gründen<br />
die Planung aus kommunaler Sicht bremsen.<br />
Privatrecht<br />
Zum Teil ergeben sich nach den Erfahrungen von Kommunen Schwierigkeiten,<br />
weil auf Seiten <strong>der</strong> Betreiber von Alt-WEA ke<strong>in</strong> Konsens <strong>in</strong> Bezug auf die Umsetzung<br />
von Repower<strong>in</strong>g-Projekten erzielt werden kann. E<strong>in</strong>e Basis, um <strong>der</strong>artige<br />
Probleme zu vermeiden, bilden aus Sicht <strong>der</strong> Kommunen die frühzeitige Interessenbündelung<br />
<strong>der</strong> Investoren und die Entwicklung e<strong>in</strong>es konsensfähigen<br />
Repower<strong>in</strong>g-Konzeptes.<br />
Planungshilfen für die Kommunal- und Regionalplanung<br />
Der neue W<strong>in</strong>denergieerlass<br />
<strong>Zur</strong> Beschleunigung des W<strong>in</strong>denergieausbaus <strong>in</strong> NRW durch den Abbau von<br />
Planungshürden hat das Land den W<strong>in</strong>denergieerlass überarbeitet [20]. In dem<br />
neuen Erlass, <strong>der</strong> am 11. Juli 2011 <strong>in</strong> Kraft getreten ist, werden die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
für den weiteren Ausbau <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergienutzung dargestellt. Ziel <strong>der</strong><br />
Novellierung ist es, Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu entwickeln bzw. aufzuzeigen, die<br />
den weiteren Ausbau <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergienutzung (Neuanlagen und Repower<strong>in</strong>g)<br />
vor dem H<strong>in</strong>tergrund des 15-Prozent-Landeszieles beschleunigen. Zusätzlich zu<br />
konkreten Regelungen und Empfehlungen auf <strong>der</strong> Grundlage rechtlicher Normen<br />
werden <strong>in</strong> dem Erlass auch Instrumente aufgezeigt, die durch mehr Transparenz<br />
vor Ort bei den Kommunen und Bürgern e<strong>in</strong>e w<strong>in</strong>denergieoffene Haltung för<strong>der</strong>n<br />
sollen. Diesbezüglich wurde z.B. mit <strong>der</strong> Informations- und Beratungsplattform<br />
EnergieDialog.NRW e<strong>in</strong> Instrument e<strong>in</strong>gerichtet, das gezielt <strong>in</strong> Bezug auf die<br />
konkreten Belange vor Ort beraten und unterstützen kann.<br />
Auch im neuen W<strong>in</strong>denergieerlass wird dem ausreichenden Schutz von Mensch<br />
und Natur Rechnung getragen. So s<strong>in</strong>d auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> rechtlichen Grundlagen<br />
und Verordnungen weiterh<strong>in</strong> die geltenden Grenzwerte z.B. bei Schallemissionen<br />
und Schattenwurf maßgeblich. Restriktiv ausgelegte Regelungen des vorangegangenen<br />
Erlasses wurden dagegen angepasst. Beispielsweise wurde die im alten<br />
Erlass de facto e<strong>in</strong>geführte Höhenbeschränkung von 100 m aufgehoben. Die<br />
Kommunen haben jetzt bei <strong>der</strong> Abwägung zu berücksichtigen, dass durch e<strong>in</strong>e<br />
48
Höhenbeschränkung auf 100 m die Wirtschaftlichkeit von W<strong>in</strong>denergievorhaben<br />
ggf. nicht mehr gegeben ist. Dies gilt auch für bestehende Konzentrationszonen<br />
im Zuge von Repower<strong>in</strong>g-Vorhaben. Der NRW-Erlass empfiehlt den Kommunen<br />
diesbezüglich e<strong>in</strong>e Überprüfung und Aufhebung <strong>der</strong> Höhenbegrenzung, um so<br />
bestehende Konzentrationszonen auch für neue mo<strong>der</strong>ne Groß-WEA zu öffnen.<br />
Im Übrigen wird den Kommunen im Erlass die Erstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Repower<strong>in</strong>g-Konzeptes empfohlen, um die Grundlage für e<strong>in</strong>e optimierte und effektive<br />
Umsetzung von Repower<strong>in</strong>g-Vorhaben zu gewährleisten. Beim Thema<br />
Abstände zur Wohnbebauung enthält <strong>der</strong> Erlass ke<strong>in</strong>e konkreten Empfehlungen<br />
mehr und verweist stattdessen auf die Prüfung des konkreten E<strong>in</strong>zelfalls.<br />
Mit Blick auf den Naturschutz werden wertvolle Gebiete auch weiterh<strong>in</strong> als Ausschlussflächen<br />
behandelt, zu denen entsprechende Abstände e<strong>in</strong>zuhalten s<strong>in</strong>d.<br />
Bei weniger wertvollen Waldflächen (z.B. Schadensflächen), soll die Nutzung <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>denergie vere<strong>in</strong>facht werden. Die Landesregierung hat dazu e<strong>in</strong>en Leitfaden<br />
erstellt, <strong>der</strong> die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die Nutzung im Wald konkretisiert.<br />
Leitfaden W<strong>in</strong>denergie im Wald<br />
Mit dem Leitfaden zur Nutzung <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergie im Wald hat das Umwelt- und<br />
Klimaschutzm<strong>in</strong>isterium NRW im April 2012 e<strong>in</strong>e Planungshilfe für die E<strong>in</strong>zelfallprüfung<br />
und Planung von WEA auf Waldflächen vorgelegt [21], [22]. Damit soll es<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Regionen mit e<strong>in</strong>em hohen Waldflächenanteil möglich werden,<br />
die Potenziale zur Nutzung <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergie im Wald besser zu erschließen. Der<br />
Leitfaden konkretisiert die Waldflächentypen, die für e<strong>in</strong>e WEA-Nutzung <strong>in</strong> Frage<br />
kommen. Darüber h<strong>in</strong>aus enthält er H<strong>in</strong>weise und Empfehlungen für den Umgang<br />
mit weiteren Bewertungskriterien wie dem Natur- und Artenschutz, dem<br />
W<strong>in</strong>dpotenzial sowie den Belangen Dritter. Exemplarisch werden bestehende<br />
Praxis-Erfahrungen zur W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong> Waldregionen erläutert. Des Weiteren<br />
werden <strong>in</strong> dem Leitfaden Effekte für die regionale Wertschöpfung und geme<strong>in</strong>schaftliche<br />
Betreibermodelle thematisiert. Es ist vorgesehen, den Leitfaden<br />
auf <strong>der</strong> Grundlage von Praxiserfahrungen weiterzuentwickeln und zu verbessern.<br />
Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW soll dazu e<strong>in</strong>mal jährlich aus <strong>der</strong> praktischen<br />
Anwendung des Leitfadens gegenüber dem Umwelt- und Klimaschutzm<strong>in</strong>isterium<br />
berichten.<br />
Grundsätzlich kommen nach dem Leitfaden Waldflächen für die W<strong>in</strong>denergie <strong>in</strong><br />
Betracht, die aus naturschutzfachlicher Sicht weniger wertvoll s<strong>in</strong>d. Dabei handelt<br />
es sich z.B. um Flächen, die durch W<strong>in</strong>dwurf o<strong>der</strong> sonstige Schadenereignisse<br />
wie z.B. Käferbefall o<strong>der</strong> Eisbruch bee<strong>in</strong>trächtigt s<strong>in</strong>d. Für die W<strong>in</strong>denergie nicht<br />
zur Verfügung stehen i.d.R. beson<strong>der</strong>s wertvolle Waldflächen (vor allem standortgerechte<br />
Laubwäl<strong>der</strong>). Zudem ist bei WEA im Wald wie an an<strong>der</strong>en Standorten<br />
auch <strong>der</strong> Natur- und Artenschutz zu berücksichtigen, ggf. s<strong>in</strong>d Ersatzmaßnahmen<br />
vorzunehmen (Aufforstungen, Aufwertung bestehen<strong>der</strong> Biotope etc.).<br />
49
W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong> NRW auf Kreisebene<br />
Abbildung 4.12: Stand <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong> NRW auf Kreisebene Ende 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
E<strong>in</strong> wichtiger Faktor für die regionale Differenzierung <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen s<strong>in</strong>d das lokal vorhandene W<strong>in</strong>dpotenzial sowie die planungs-<br />
und baurechtlichen Voraussetzungen vor Ort. E<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong> bis Ende<br />
2011 <strong>in</strong> NRW <strong>in</strong>stallierten WEA-Leistung wurde daher vor allem <strong>in</strong> den Kreisen<br />
errichtet, die sich <strong>in</strong> den w<strong>in</strong>dklimatologischen Gunsträumen im Bereich <strong>der</strong> Höhenlagen<br />
des Haarstrangs und Eggegebirges bef<strong>in</strong>den.<br />
E<strong>in</strong>e hohe W<strong>in</strong>denergieleistung weisen zudem die Kreise im Regierungsbezirk<br />
Münster auf. Niedrig ist die <strong>in</strong>stallierte WEA-Leistung dagegen erwartungsgemäß<br />
<strong>in</strong> den dichtbesiedelten Kreisen im Ruhrgebiet sowie im Rhe<strong>in</strong>land (Abbildung<br />
4.12).<br />
50
4.2.2.2 Stromerzeugung aus Biomasse und Marktentwicklung<br />
Biomasseheiz(kraft)werke – Neuanlagen lassen Stromproduktion um 7<br />
Prozent steigen<br />
Tabelle 4.6: Biomasseheizkraftwerke <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(elektrische Nutzung)<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: FNR, IWR, DBFZ, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Daten: FNR, IWR, DBFZ IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung ca. 12 MWel - 12 MWel - -<br />
Vorjahr<br />
NRW-Gesamtleistung ca. 210 MWel ca. 200 MWel 210 MWel 200 MWel + 5,0 %<br />
Stromproduktion<br />
Annahme: typische Volllaststundenwerte<br />
1 = Werte vorläufig<br />
1,3 – 1,7<br />
Mrd. kWh<br />
1,2 – 1,6<br />
Mrd. kWh<br />
1,50<br />
Mrd. kWh<br />
1,40<br />
Mrd. kWh<br />
+ 7,1 %<br />
Im Vergleich zum Vorjahr 2010 hat die Stromproduktion <strong>in</strong> Biomasseheiz(kraft)werken<br />
<strong>in</strong> NRW um 7 Prozent zugenommen. Das Wachstum geht auf<br />
neue Anlagenkapazitäten zurück, die erstmalig <strong>in</strong> die Analyse e<strong>in</strong>bezogen werden<br />
können.<br />
320<br />
280<br />
240<br />
200<br />
160<br />
120<br />
80<br />
40<br />
0<br />
[MW] [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: FNR, IWR, DBFZ / eigene Berechnung: IWR * = vorläufig<br />
Leistung [MW] Strom [Mrd. kWh]<br />
Abbildung 4.13: Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten elektrischen Gesamtleistung und Stromerzeugung<br />
im Bereich Biomasseheizkraftwerke <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012,<br />
Daten: FNR, IWR, DBFZ / eigene Berechnung, 2011 vorläufig)<br />
In Summe waren <strong>in</strong> NRW Ende 2011 knapp 40 Biomasseheizkraftwerke mit e<strong>in</strong>er<br />
Leistung von etwa 210 MWel <strong>in</strong> Betrieb. Unter Zugrundelegung typischer anla-<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
© IWR, 2012<br />
51
genspezifischer Volllaststundenwerte resultiert 2011 e<strong>in</strong>e Stromerzeugung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Bandbreite zwischen 1,3 bis 1,7 Mrd. kWh (2010: 1,2 bis 1,6 Mrd. kWh). Auf<br />
dieser Basis wird als IWR-Referenzwert e<strong>in</strong>e mittlere Stromproduktion von 1,5<br />
Mrd. kWh festgelegt (2010: 1,4 Mrd. kWh) (Tabelle 4.6, Abbildung 4.13).<br />
Im Unterschied zur Stromerzeugung aus W<strong>in</strong>denergie und Wasserkraft, die stark<br />
von den witterungsklimalogischen Verhältnissen abhängig ist, besteht bei <strong>der</strong><br />
Stromerzeugung aus Biomasseheizkraftwerken vor allem e<strong>in</strong>e enge Korrelation<br />
mit <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Leistung. Parallel mit dem Anstieg des Zubaus zeigt daher<br />
auch die zeitliche Entwicklung <strong>der</strong> NRW-Stromerzeugung <strong>in</strong> Biomasseheizkraftwerken<br />
von 2002 bis 2011 e<strong>in</strong> deutliches Wachstum. Da e<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong> Biomasseheizkraftwerke<br />
<strong>in</strong> NRW bereits vor 2007 errichtet wurde, verläuft die<br />
Wachstumskurve bis zu diesem Zeitpunkt relativ steil. Bed<strong>in</strong>gt durch den nachlassenden<br />
Neubau hat sich die Kurve seitdem deutlich abgeflacht (Abbildung<br />
4.14).<br />
Marktentwicklung <strong>in</strong> NRW bleibt auf niedrigem Niveau<br />
Für 2011 ist nach e<strong>in</strong>er Unterbrechung im Jahr 2010 wie<strong>der</strong> die Neu<strong>in</strong>betriebnahme<br />
e<strong>in</strong>es Biomasseheizkraftwerkes zu verzeichnen. Es handelt sich dabei um<br />
e<strong>in</strong>e Anlage im Regierungsbezirk Düsseldorf mit e<strong>in</strong>er elektrischen Leistung von<br />
3 MWel und 9 MWth. Zusätzlich wird für 2011 erstmalig e<strong>in</strong>e Anlage <strong>in</strong> die Analyse<br />
e<strong>in</strong>bezogen, die bereits früher errichtet wurde, bislang aber im Rahmen <strong>der</strong> statistischen<br />
Meldung noch nicht erfasst war. Per saldo zeigt sich jedoch, dass seit<br />
Beg<strong>in</strong>n des Monitor<strong>in</strong>g die Dynamik beim Zubau großer Biomasseheizkraftwerke<br />
<strong>in</strong> NRW seit 2006 deutlich nachgelassen hat. Bisherige Boomjahre s<strong>in</strong>d 2004 mit<br />
etwa 60 MWel neuer Leistung und 2006 mit 45 MWel. Zu berücksichtigen ist bei<br />
<strong>der</strong> Interpretation <strong>der</strong> Entwicklung, dass Biomasseheizkraftwerke relativ lange<br />
Planungs- und Genehmigungszeiträume aufweisen, die e<strong>in</strong>e hohe Volatilität beim<br />
Neubau nach sich ziehen (Abbildung 4.14).<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Leistung Biomasseheizkraftwerke [MW el]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten (vorläufig): FNR, IWR, DBFZ, eigene Berechnung / Schätzung, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.14: NRW-Marktentwicklung Biomasseheizkraftwerke: Die jährlich neu <strong>in</strong>stallierte<br />
Leistung im Zeitraum 2002 - 2011 (Quelle: IWR, 2012, Daten: FNR,<br />
IWR, DBFZ / eigene Berechnung, 2011 vorläufig)<br />
© IWR, 2012<br />
52
Stromerzeugung durch Biogasanlagen<br />
Jahres-Stromproduktion aus Biogas über 1,5 Mrd. kWh<br />
Tabelle 4.7: Biogasanlagen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(elektrische Nutzung)<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: LWK NRW, IWR, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Landwirtschaftliche Biogasanlagen<br />
Daten: LWK NRW, IWR IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung ca. 67 MWel ca. 45 MWel 67 MWel 45 MWel + 48,9 %<br />
NRW-Gesamtleistung ca. 238 MWel ca. 171 MWel 238 MWel 171 MWel + 39,2 %<br />
Stromproduktion<br />
Annahme: typische Volllaststundenwerte,<br />
unterjähriger Betriebszeitraum<br />
bei Zubau berücksichtigt<br />
1,43 – 1,64<br />
Mrd. kWh<br />
Industrielle / kommunale Biogasanlagen<br />
1,04 – 1,19<br />
Mrd. kWh<br />
1,54<br />
Mrd. kWh<br />
1,12<br />
Mrd. kWh<br />
Daten: IWR IWR-Referenzwerte<br />
+ 37,5 %<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung ca. 7 MWel n.b. 7 MWel n.b. -<br />
Vorjahr<br />
NRW-Gesamtleistung ca. 10 MWel ca. 3 MWel 10 MWel 3 MWel + 233,3 %<br />
Stromproduktion<br />
Annahme: typische Volllaststundenwerte<br />
0,06 – 0,09<br />
Mrd. kWh<br />
0,02 – 0,03<br />
Mrd. kWh<br />
0,08<br />
Mrd. kWh<br />
Biogas gesamt (landwirtschaftliche + <strong>in</strong>dustrielle / kommunale Biogasanlagen)<br />
0,03<br />
Mrd. kWh<br />
+ 166,7 %<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
NRW-Gesamtleistung ca. 248 MWel ca. 174 MWel 248 MWel 174 MWel + 42,5 %<br />
Stromproduktion<br />
Annahme: typische Volllaststundenwerte,<br />
unterjähriger Betriebszeitraum bei Zubau<br />
berücksichtigt<br />
1 = Werte vorläufig<br />
1,45 – 1,67<br />
Mrd. kWh<br />
1,06 – 1,22<br />
Mrd. kWh<br />
1,62<br />
Mrd. kWh<br />
1,15<br />
Mrd. kWh<br />
+ 40,9 %<br />
Die Gesamtstromproduktion aus landwirtschaftlichen sowie <strong>in</strong>dustriellen / kommunalen<br />
Biogasanlagen hat <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 2011 um etwa 40 Prozent<br />
auf rd. 1,6 Mrd. kWh zugenommen (2010: 1,15 Mrd. kWh). Insgesamt hat sich<br />
<strong>der</strong> Bestand bei den marktbestimmenden landwirtschaftlichen Biogasanlagen im<br />
Jahr 2011 bed<strong>in</strong>gt durch e<strong>in</strong> weiteres Rekordjahr <strong>der</strong> Branche auf etwa 570 Anlagen<br />
mit e<strong>in</strong>er Leistung von etwa 240 MWel erhöht. Auf <strong>der</strong> Grundlage e<strong>in</strong>er typischen<br />
Volllaststundenbandbreite und unter Berücksichtigung des unterjährigen<br />
Betriebszeitraumes <strong>der</strong> im Jahr 2011 neu errichteten Biogasanlagen resultiert e<strong>in</strong>e<br />
Stromproduktion von etwa 1,43 bis 1,64 Mrd. kWh. Als IWR-Referenzwert<br />
wird vor diesem H<strong>in</strong>tergrund für die landwirtschaftlichen Biogasanlagen e<strong>in</strong>e mitt-<br />
53
lere Stromproduktion von 1,54 Mrd. kWh festgesetzt. Wenn zusätzlich die Stromproduktion<br />
<strong>der</strong> <strong>der</strong>zeit bekannten <strong>in</strong>dustriellen und kommunalen Biogasanlagen<br />
mit e<strong>in</strong>er Leistung von rd. 10 MWel e<strong>in</strong>bezogen wird, so ergibt sich e<strong>in</strong>e Gesamtstrommenge<br />
von 1,6 Mrd. kWh (Tabelle 4.7, Abbildung 4.15).<br />
270<br />
240<br />
210<br />
180<br />
150<br />
120<br />
90<br />
60<br />
30<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
Quelle: IWR, Daten: LWK / eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.15: Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Gesamtleistung und Stromerzeugung im<br />
Bereich Biogas <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012, Daten: LWK NRW, IWR, eigene Be-<br />
rechnung, 2011 vorläufig)<br />
NRW-Marktentwicklung Biogas - Vorzieheffekte sorgen für weiteres<br />
Boomjahr<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
[MW] [Mrd. kWh]<br />
Leistung Biogasanlagen [MW]<br />
Abbildung 4.16: NRW-Marktentwicklung im Segment landwirtschaftliche Biogasanlagen:<br />
Die jährlich neu <strong>in</strong>stallierte Leistung von 2002 - 2011 (Quelle: IWR, 2012,<br />
Daten: LWK NRW, 2011 vorläufig)<br />
Leistung [MW] Strom [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
Quelle: IWR, Daten: LWK NRW, eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
1,8<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
© IWR, 2012<br />
© IWR, 2012<br />
54
Die Biogasbranche <strong>in</strong> NRW hat 2011 im Segment <strong>der</strong> landwirtschaftlichen Biogasanlagen<br />
mit e<strong>in</strong>em Zubau von 76 MWel das bereits gute Ergebnis des Vorjahres<br />
2010 (rd. 45 MWel) um knapp 50 Prozent übertroffen und ihr bis dato bestes<br />
Branchenjahr erzielt (Abbildung 4.16). Bundesweit wurden 2011 nach Angaben<br />
des Fachverbandes Biogas rd. 1.300 Anlagen mit e<strong>in</strong>er Leistung von 613 MWel<br />
(2010: 920 Anlagen, 400 MWel) <strong>in</strong>stalliert. Damit entfallen <strong>in</strong> Bezug auf die Leistung<br />
rd. 12 Prozent des Anlagenzubaus 2011 auf Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. <strong>Zur</strong>ückzuführen<br />
ist die Fortsetzung des Booms auf Bundes- und Landesebene im Jahr<br />
2011 auf Vorzieheffekte im Zusammenhang mit <strong>der</strong> zum Jahr 2012 erfolgten Anpassung<br />
des EEG-Vergütungsrahmens. Mit Blick auf das Jahr 2012 ist davon<br />
auszugehen, dass <strong>der</strong> Anlagenneubau aufgrund des geän<strong>der</strong>ten Vergütungsrahmens<br />
deutlich zurückgeht. Branchenteilnehmer rechnen damit, dass <strong>der</strong> Biogasmarkt<br />
bundesweit von ca. 1.200 Anlagen im Jahr 2011 um etwa 70 Prozent<br />
auf rd. 300 neu <strong>in</strong>stallierte Anlagen zurückgehen wird. Der Marktrückgang wird<br />
auch auf NRW-Ebene erkennbar. So verzeichnet die Landwirtschaftskammer<br />
NRW für 2012 e<strong>in</strong>e deutlich zurückgehende Beratungstätigkeit [23]. Von Interesse<br />
ist <strong>der</strong>zeit vor allem die Erweiterung bestehen<strong>der</strong> Anlagen sowie <strong>der</strong> Bau von<br />
Kle<strong>in</strong>anlagen auf Basis von Gülle (bis 75 kW).<br />
Regionalverteilung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Biogasleistung (landwirtschaftlich)<br />
Der regionale Schwerpunkt <strong>der</strong> landwirtschaftlichen Biogasnutzung liegt <strong>in</strong> den<br />
stärker landwirtschaftlich geprägten Regierungsbezirken (RB) Münster und Detmold,<br />
auf die 2011 etwa 40 Prozent bzw. 35 Prozent <strong>der</strong> <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong>stallierten<br />
Biogasleistung entfallen. Am niedrigsten ist <strong>der</strong> Bestand an Biogasanlagen im<br />
Regierungsbezirk Köln mit etwa 5 Prozent (Abbildung 4.17).<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Anteil [%]<br />
Münster Detmold Arnsberg Düsseldorf Köln<br />
Quelle: IWR, Daten: LWK NRW, IWR-Schätzung<br />
Leistung landwirtschaftl. Biogasanlagen NRW 2011 = 238 MWel<br />
Abbildung 4.17: Regionale Verteilung <strong>der</strong> elektrischen Leistung <strong>der</strong> landwirtschaftlichen<br />
Biogasanlagen <strong>in</strong> NRW im Jahr 2011 (Quelle: IWR, 2012, Daten: LWK NRW,<br />
eigene Berechnung, vorläufig)<br />
© IWR, 2011<br />
In Bezug auf die <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong>stallierte Leistung liegt im NRW-weiten Rank<strong>in</strong>g <strong>der</strong><br />
Kreis Borken (RB Münster) mit e<strong>in</strong>em Leistungsanteil von etwa 16 Prozent an<br />
55
erster Stelle. Darauf folgen die Kreise Ste<strong>in</strong>furt (RB Münster, 10 Prozent Leistungsanteil),<br />
Pa<strong>der</strong>born (RB Detmold, 9 Prozent), M<strong>in</strong>den (RB Detmold 7 Prozent)<br />
und Coesfeld (RB Münster, 7 Prozent) (Abbildung 4.18).<br />
Abbildung 4.18: Stand <strong>der</strong> Biogasnutzung (landwirtschaftlich) <strong>in</strong> NRW auf Kreisebene<br />
Ende 2011 (Quelle: IWR, 2012)<br />
56
Stromerzeugung aus biogenem Abfall<br />
Tabelle 4.8: Stromerzeugung aus dem biogenen Anteil des Abfalls <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: ITAD, IT.NRW, IWR, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Biogene Stromerzeugung <strong>in</strong> Müllverbrennungsanlagen<br />
Daten: ITAD, IWR IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung 16 MWe n.b. 16 MWe n.b. -<br />
Vorjahr<br />
NRW-Gesamtleistung 449 MWel 433 MWel 449 MWel 433 MWel + 3,7 %<br />
Stromproduktion aus biogenem<br />
Abfall<br />
Annahme:<br />
biogener Anteil im Abfall = 50 %<br />
1,11<br />
Mrd. kWh<br />
Biogene Stromerzeugung Abfall gesamt<br />
Stromproduktion<br />
Siedlungsabfall / Hausmüll<br />
Annahme:<br />
biogener Anteil im Abfall = 50 %<br />
ca. 1,18<br />
Mrd. kWh<br />
1,11<br />
Mrd. kWh<br />
1,18<br />
Mrd. kWh<br />
Daten: IWR, IT.NRW IWR-Referenzwerte<br />
- 5,9 %<br />
2011 1, 2 2010 2011 1, 2 2010 Veränd.<br />
1,33<br />
Mrd. kWh 2<br />
1 = Werte vorläufig, 2 = Vorjahreswert fortgeschrieben<br />
1,42<br />
Mrd. kWh<br />
1,33<br />
Mrd. kWh 2<br />
1,42<br />
Mrd. kWh<br />
Vorjahr<br />
- 6,3 %<br />
Biogene Stromerzeugung aus Abfall <strong>in</strong> Müllverbrennungsanlagen (MVA)<br />
Die Stromerzeugung <strong>in</strong> NRW aus Abfall ist im Jahr 2011 nach Daten <strong>der</strong> Interessensgeme<strong>in</strong>schaft<br />
<strong>der</strong> thermischen Abfallbehandlungsanlagen <strong>in</strong> Deutschland<br />
(ITAD e.V.) <strong>in</strong> den Müllverbrennungsanlagen <strong>der</strong> Mitgliedsunternehmen von 2,37<br />
Mrd. kWh auf 2,22 Mrd. kWh zurückgegangen [23]. Unter Anwendung des auch<br />
auf Bundesebene <strong>der</strong>zeit zugrunde gelegten biogenen Abfallanteils von 50 Prozent<br />
resultiert für 2011 e<strong>in</strong>e biogene Stromproduktion aus Müll von etwa 1,1 Mrd.<br />
kWh. Obwohl die Leistung <strong>der</strong> 16 MVA <strong>in</strong> NRW 2011 von 433 MWel bed<strong>in</strong>gt<br />
durch e<strong>in</strong>e Anlagenerweiterung um 4 Prozent auf 449 MWel angestiegen ist, wurde<br />
damit 2011 gegenüber 2010 etwa 6 Prozent weniger Strom aus biogenem Abfall<br />
produziert (2010 = 1,18 Mrd. kWh). Ursache für den Rückgang <strong>der</strong> Stromproduktion<br />
<strong>in</strong> 2011 s<strong>in</strong>d nach ITAD-Angaben, Stillstandzeiten, die aus dem Anlagenumbau<br />
resultierten sowie sonstige betriebsbed<strong>in</strong>gte Unterbrechungen durch Anlagenwartungen<br />
bzw. Störungen [25].<br />
Biogene Gesamt-Stromerzeugung aus Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfall) <strong>in</strong> NRW<br />
Die Stromerzeugung aus Hausmüll bzw. Siedlungsabfällen lag nach den Daten<br />
von IT.NRW 2011 mit 2,67 Mrd. kWh um etwa 0,5 Mrd. kWh über dem ITAD-<br />
Gesamtwert [26]. Bei e<strong>in</strong>em biogenen Anteil von 50 Prozent beläuft sich die bio-<br />
57
gene Gesamtstromerzeugung aus Abfall im Jahr 2011 damit auf etwa 1,33 Mrd.<br />
kWh. Als Referenzwert für das Jahr 2011 wird auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Daten von<br />
ITAD und IT.NRW für die biogene Stromerzeugung aus Abfall e<strong>in</strong> Gesamtwert<br />
(ITAD + Differenzanteil IT.NRW) von 1,33 Mrd. kWh angenommen (1,11 Mrd.<br />
kWh + 0,22 Mrd. kWh). 2<br />
Stromerzeugung aus Klärgas<br />
Tabelle 4.9: Stromerzeugung aus Klärgas <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(elektrische Nutzung) (Quelle: IWR, 2012, Daten: IT.NRW, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung<br />
/ Schätzung)<br />
Daten: IT.NRW IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung n. b. n.b. n.b. n.b. -<br />
NRW-Gesamtleistung n.b. n.b. n.b. n.b. -<br />
Stromproduktion aus<br />
Klärgas<br />
1 = Werte vorläufig<br />
0,32<br />
Mrd. kWh<br />
0,28<br />
Mrd. kWh<br />
0,32<br />
Mrd. kWh<br />
0,28<br />
Mrd. kWh<br />
Vorjahr<br />
+ 14,3 %<br />
Die Stromerzeugung aus Klärgas ist 2011 gegenüber 2010 von etwa 280 Mio.<br />
kWh auf 320 Mio. kWh gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das e<strong>in</strong>er<br />
Steigerung um etwa 14 Prozent [27], [28] (Tabelle 4.9).<br />
NRW-Marktentwicklung Klärgas abgeschlossen – kaum neue Anlagen<br />
Nach Angaben von IT.NRW ist <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> NRW-Stromproduktion aus Klärgas<br />
im Jahr 2011 zum<strong>in</strong>dest teilweise auf e<strong>in</strong>e im Vergleich zu 2010 höhere Fallzahl<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong> die Auswertung e<strong>in</strong>gehenden Kläranlagen zurückzuführen. Während<br />
es <strong>in</strong> den Jahren 2010 und 2009 noch rd. 180 NRW-Kläranlagen waren, von denen<br />
für die NRW-Klärgasstatistik Daten gemeldet wurden, konnten im Jahr 2011<br />
aufgrund neuer Meldungen <strong>in</strong>sgesamt 208 Kläranlagen berücksichtigt werden<br />
[27], [28]. Das entspricht e<strong>in</strong>er Steigerung von immerh<strong>in</strong> 14 Prozent. Inwiefern<br />
sich unter den Erstmeldungen auch neu <strong>in</strong> Betrieb genommene Anlagen bef<strong>in</strong>den,<br />
lässt sich aus den Daten nicht ableiten. Gleichwohl ist mit Blick auf Deutschland<br />
und NRW davon auszugehen, dass die Marktentwicklung unter den gegenwärtigen<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen weitgehend abgeschlossen ist und neue Anlagen<br />
nur <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gem Umfang <strong>in</strong>stalliert werden. E<strong>in</strong>e signifikante Marktentwicklung ist<br />
<strong>der</strong>zeit nicht zu erwarten. Die verbleibenden Potenziale liegen vor allem bei<br />
2 Die aus dem Vergleich zwischen IT.NRW- (rd. 1,33 Mrd. kWh) und ITAD-Daten (rd. 1,1 Mrd. kWh) resultierende Differenz von<br />
etwa 0,2 Mrd. kWh ist nach den vorliegenden Informationen auf Unterschiede im Erhebungskreis zwischen IT.NRW- und ITAD-<br />
Statistik zurückzuführen.<br />
58
Kle<strong>in</strong>anlagen und <strong>der</strong> Remotorisierung, d.h. dem Austausch alter Motoren durch<br />
neue Masch<strong>in</strong>en.<br />
Gleichwohl könnten nach Analysen <strong>der</strong> Deutschen Vere<strong>in</strong>igung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e.V. (DWA) mit neuen Techniken weitere Potenziale<br />
erschlossen werden. Je nach e<strong>in</strong>gesetzter Motorentechnik (übliche Motorentechnik<br />
mit 32 Prozent bzw. mo<strong>der</strong>ne Motoren mit 40 Prozent Wirkungsgrad) rechnet<br />
die DWA mit zusätzlichen Strompotenzialen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Bandbreite von 0,7 bis 2,1<br />
Mrd. kWh.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Produktion von bislang 1 TWh Klärgasstrom <strong>in</strong> Deutschland resultiert<br />
dann e<strong>in</strong>e Gesamtstrommenge von ca. 1,7 bis 3,1 Mrd. kWh. Im Fall e<strong>in</strong>er flächendeckenden<br />
Umstellung auf Brennstoffzellen mit e<strong>in</strong>em elektrischen Wirkungsgrad<br />
von 50 Prozent liegt das theoretische Gesamtpotenzial <strong>in</strong> Deutschland<br />
laut DWA-Studie bei 3,9 Mrd. kWh [29]. Brennstoffzellen an Kläranlagen werden<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis bislang jedoch erst an wenigen Standorten e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Stromerzeugung aus Deponiegas<br />
Tabelle 4.10: Stromerzeugung aus Deponiegas <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr<br />
2012 (elektrische Nutzung)<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: LANUV NRW, BNetzA, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Daten: LANUV NRW,<br />
BNetzA, IWR<br />
IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung n.b. n.b. n.b. n.b. -<br />
NRW-Gesamtleistung<br />
Stromproduktion aus<br />
Deponiegas<br />
Annahme: typische Volllaststundenwerte<br />
1 = Werte vorläufig<br />
ca. 40 - 60<br />
MWel<br />
0,12 – 0,24<br />
Mrd. kWh<br />
ca. 40 - 60<br />
MWel<br />
0,16 – 0,27<br />
Mrd. kWh<br />
Vorjahr<br />
50 MWel 50 MWel +/- 0 %<br />
0,18<br />
Mrd. kWh<br />
0,22<br />
Mrd. kWh<br />
- 18,2 %<br />
Die Nutzung von Deponiegas ist angesichts e<strong>in</strong>es fortschreitenden Ausgasungsprozesses<br />
<strong>der</strong> Deponiekörper <strong>in</strong> NRW deutlich rückläufig. Auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> zur<br />
Verfügung stehenden Daten wird im Rahmen des vorliegenden Gutachtens für<br />
NRW für 2010 und 2011 e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>stallierte Leistung zwischen 40 bis 60 MWel zugrunde<br />
gelegt [3], [30].<br />
Unter Berücksichtigung e<strong>in</strong>es oberen und unteren Volllaststundenwertes, die sich<br />
aus <strong>der</strong> Gasversorgung <strong>der</strong> Anlagen ergeben, wird für 2011 e<strong>in</strong>e jährliche Stromerzeugung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Bandbreite von 120 bis 240 Mio. kWh ermittelt (2010: 160 bis<br />
270 Mio. kWh). Als IWR-Referenzwert wird e<strong>in</strong>e mittlere Stromerzeugung von<br />
180 Mio. kWh festgelegt (Tabelle 4.10).<br />
59
NRW-Entwicklung – abnehmende Stromerzeugung und kle<strong>in</strong>ere Anlagen<br />
Die seit 2005 geltenden gesetzlichen Vorgaben zum Deponierungsverbot für<br />
nicht vorbehandelten Siedlungsabfall haben dazu geführt, dass den Deponien<br />
seitdem ke<strong>in</strong> neues organisches und damit methanbildendes Substrat mehr zugeführt<br />
wird. Die Folge ist e<strong>in</strong> sukzessives Ausgasen <strong>der</strong> Deponiekörper und e<strong>in</strong>e<br />
kont<strong>in</strong>uierlich ger<strong>in</strong>ger werdende Menge an energetisch nutzbarem Deponiegas.<br />
Der Deponiegasmarkt ist daher mittlerweile <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Degressionsphase e<strong>in</strong>geschwenkt.<br />
Aus Sicht von Branchenexperten kann beim Deponiegas e<strong>in</strong>e Halbwertzeit von<br />
etwa 5 bis 7 Jahren angenommen werden. D.h. alle 5 bis 7 Jahre erfolgt e<strong>in</strong>e<br />
Halbierung <strong>der</strong> verbleibenden Deponiegasrestmengen [31]. Neue, noch nicht genutzte<br />
Marktpotenziale resultieren daher <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie aus dem Austausch von<br />
Bestands-BHKW gegen kle<strong>in</strong>ere Anlagen (Downsiz<strong>in</strong>g). Das führt dazu, dass<br />
Standorte länger genutzt werden können, allerd<strong>in</strong>gs nehmen <strong>in</strong>stallierte Leistung<br />
und Stromerzeugung dabei weiter ab. Die Angabe über die <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen <strong>in</strong>stallierte Deponiegasleistung liegt nach den vorliegenden Daten zwischen<br />
40 und 60 MWel [3], [30]. Als IWR-Referenzwert wird für 2011 e<strong>in</strong>e Leistung<br />
von 50 MWel angenommen.<br />
Stromerzeugung aus flüssiger Biomasse<br />
Tabelle 4.11: Stromerzeugung aus flüssiger Biomasse <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im<br />
Jahr 2012 (elektrische Nutzung)<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IT.NRW, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Daten: IT.NRW IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung n.b. n.b. n.b. n.b. -<br />
NRW-Gesamtleistung n.b. n.b. n.b. n.b. -<br />
Stromproduktion aus<br />
flüssiger Biomasse<br />
1 = Werte vorläufig<br />
0,14<br />
Mrd. kWh<br />
0,34<br />
Mrd. kWh<br />
0,14<br />
Mrd. kWh<br />
0,34<br />
Mrd. kWh<br />
Vorjahr<br />
- 59,8 %<br />
Die Stromerzeugung aus flüssiger Biomasse ist ausgehend von den Statistiken<br />
über die Stromerzeugung von IT.NRW im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr<br />
um etwa 60 Prozent auf etwa 140 Mio. kWh e<strong>in</strong>gebrochen (2010: rd. 340 Mio.<br />
kWh) (Tabelle 4.11) [32].<br />
NRW-Marktentwicklung flüssige Biomasse mit deutlichem Rückgang<br />
Hauptgrund für den extremen Rückgang <strong>der</strong> Stromproduktion aus flüssiger Biomasse<br />
<strong>in</strong> NRW ist das hohe Preisniveau für Pflanzenöl. Der Anteil <strong>der</strong> Anlagen,<br />
die nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können, ist <strong>in</strong> den letzten Jahren<br />
60
deutlich gestiegen. Aus Sicht von Betreibern kommt 2011 h<strong>in</strong>zu, dass seit Anfang<br />
des Jahres die EEG-Vergütung für Pflanzenölstrom an den E<strong>in</strong>satz von Rohstoffen<br />
gebunden ist, die als nachhaltig zertifiziert s<strong>in</strong>d. In <strong>der</strong> Folge rüsten die Betreiber<br />
ihre Anlagen z.T. auf an<strong>der</strong>e Brennstoffe wie Biomethan, Erdgas o<strong>der</strong><br />
Heizöl um. Zum Teil werden die Anlagen auch stillgelegt o<strong>der</strong> vorübergehend<br />
außer Betrieb genommen. Nach e<strong>in</strong>er Analyse des Deutschen BiomasseForschungsZentrums<br />
(DBFZ) ist die Leistung <strong>der</strong> Pflanzenöl BHKW alle<strong>in</strong> im Jahr<br />
2011 (ca. 1.400 Anlagen, rd. 300 MWel) um über 60 Prozent auf etwa 560 Anlagen<br />
mit e<strong>in</strong>er Leistung von etwa 100 MWel zurückgegangen [33].<br />
Über die Entwicklung des NRW-Anlagenbestandes liegen ke<strong>in</strong>e Daten vor. Aufgrund<br />
<strong>der</strong> rückläufigen Entwicklung <strong>der</strong> Stromerzeugung aus flüssiger Biomasse<br />
<strong>in</strong> NRW ist aber davon auszugehen, dass die Entwicklung wie auf Bundesebene<br />
e<strong>in</strong>en deutlichen Rückgang aufweist.<br />
61
4.2.2.3 Stromerzeugung aus Photovoltaik und Marktentwicklung<br />
Zum Potenzial <strong>der</strong> PV-Nutzung <strong>in</strong> NRW<br />
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
(LANUV) führt im Auftrag des M<strong>in</strong>isteriums für Klimaschutz, Umwelt, Natur- und<br />
Verbraucherschutz e<strong>in</strong>e Studie durch, <strong>in</strong> <strong>der</strong> u.a. das NRW-Potenzial zur Stromerzeugung<br />
aus Photovoltaikanlagen analysiert wird. Ziel <strong>der</strong> Studie ist es, neben<br />
<strong>der</strong> Erhebung <strong>der</strong> Potenziale, Grundlagen für die regionalen und kommunalen<br />
Planungsebenen im Land bereitzustellen. Methodisch werden dabei stellvertretend<br />
24 repräsentative Modellregionen zugrunde gelegt, <strong>in</strong> denen das Potenzial<br />
für die Stromerzeugung aus Photovoltaik-Aufdachanlagen ermittelt und anschließend<br />
auf NRW übertragen wird. <strong>Zur</strong> Ermittlung <strong>der</strong> Potenziale dienen hochaufgelöste<br />
Laserscandaten und detaillierte Strahlungssimulationen. Für die Ermittlung<br />
<strong>der</strong> Photovoltaik-Freiflächenstandorte wurden die nach dem EEG för<strong>der</strong>ungsfähigen<br />
Flächen <strong>in</strong> NRW betrachtet.<br />
Stand Ende 2011 s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> NRW rd. 2.850 MWp PV-Leistung <strong>in</strong>stalliert, deutschlandweit<br />
wird die <strong>in</strong>stallierte Photovoltaikkapazität im Jahr 2012 die Marke von<br />
30.000 MWp überschreiten. Die Bundesregierung hat im Frühjahr festgelegt, dass<br />
ab e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>stallierten Leistung von 52.000 MWp für weitere Neuanlagen ke<strong>in</strong>e<br />
Vergütung nach dem EEG mehr erfolgen wird. Dies bedeutet, dass <strong>in</strong>sgesamt<br />
noch rd. 22.000 MWp unter EEG-Bed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> Deutschland realisiert werden<br />
können.<br />
Stromerzeugung und Marktentwicklung PV<br />
Tabelle 4.12: Photovoltaiknutzung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Daten: BNetzA, IWR IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung 851 MWp 901 MWp 851 MWp 901 MWp - 5,5 %<br />
NRW-Gesamtleistung<br />
Stromproduktion<br />
Annahme: Bandbreite anlagentypischer<br />
Produktionsfaktoren <strong>in</strong> kWh /<br />
kW p, unterjähriger Betriebszeitraum<br />
bei Zubau berücksichtigt<br />
1 = Werte vorläufig<br />
ca. 2.850<br />
MWp<br />
2,06 – 2,30<br />
Mrd. kWh<br />
ca. 2.000<br />
MWp<br />
1,16 – 1,24<br />
Mrd. kWh<br />
2.850 MWp 2.000 MWp + 42,5 %<br />
2,18<br />
Mrd. kWh<br />
1,20<br />
Mrd. kWh<br />
+ 81,7 %<br />
Im Jahr 2011 ist die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen im Vergleich zum Vorjahr (2010: 1,2 Mrd. kWh) um etwa 82 Prozent<br />
auf rd. 2,2 Mrd. kWh angestiegen. Die Steigerung <strong>der</strong> Stromerzeugung resultiert<br />
vor allem aus dem massiven Anlagenzubau <strong>in</strong> den Jahren 2010 und 2011. Die<br />
Berechnung <strong>der</strong> PV-Stromerzeugung erfolgt anhand <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Leistung<br />
Ende 2011 (rd. 2.850 MWp) mittels anlagenspezifischer Produktionsfaktoren (Er-<br />
62
trag pro kWp). Während <strong>der</strong> Zubau 2011 zur Berücksichtigung des unterjährigen<br />
Betriebszeitraums nur zur Hälfte <strong>in</strong> die Berechnung e<strong>in</strong>fließt, produzierten die <strong>in</strong><br />
2010 zugebauten Anlagen erstmals ganzjährig Strom (Tabelle 4.12, Abbildung<br />
4.19).<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
[MW] [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Abbildung 4.19: Entwicklung <strong>der</strong> PV-Gesamtleistung und Stromerzeugung <strong>in</strong> NRW<br />
(2002 - 2011) (Quelle: IWR, 2012, Daten: BSW, Solar Verlag, BNetzA, IWR, 2011 vor-<br />
läufig)<br />
Leistung [MW] Strom [Mrd. kWh]<br />
Quelle: IWR, Daten: BSW, Solar Verlag, BNetzA, IWR / eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
NRW-Markt erreicht 2011 nicht ganz Niveau des Vorjahres<br />
Der Markt für Photovoltaikanlagen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen hat im Jahr 2011 nicht<br />
ganz das Niveau des Vorjahres erreicht. Während bundesweit 2011 mit e<strong>in</strong>em<br />
Zubau von rd. 7.500 MWp e<strong>in</strong> neuer Rekord aufgestellt wurde, liegt die neu <strong>in</strong>stallierte<br />
Leistung <strong>in</strong> NRW mit rd. 850 MWp unter dem Vorjahreswert von rd. 900<br />
MWp. Das entspricht e<strong>in</strong>em Rückgang um rd. 6 Prozent. Angesichts des Marktbooms<br />
aus dem Jahr 2010 hatte die Bundesregierung im Jahr 2011 mehrmals<br />
die Vergütung für PV-Anlagen gesenkt. Im Vorfeld <strong>der</strong> Vergütungssenkung zum<br />
Jahresanfang 2012 kam es zum Jahresende 2011 zu Vorzieheffekten, die für<br />
den neuen Zubaurekord sorgten. Vor allem die kont<strong>in</strong>uierliche Kostendegression<br />
von PV-Systemen als Folge <strong>der</strong> globalen Überkapazitäten <strong>in</strong>duziert auf Investorenseite<br />
e<strong>in</strong>e hohe Nachfrage.<br />
Gemessen an dem von <strong>der</strong> Bundesregierung im EEG 2012 anvisierten jährlichen<br />
Zubaukorridor von 2.500 bis 3.000 MWp würde die Beschränkung <strong>der</strong> Vergütung<br />
bis auf e<strong>in</strong>e Kapazität von 52.000 MWp e<strong>in</strong> Ende <strong>der</strong> bisherigen EEG-<br />
Vergütungsmodalitäten für Neuanlagen um das Jahr 2020 bedeuten. In den letzten<br />
fünf Jahren (2007 – 2011) lag <strong>der</strong> Anlagenneubau auf Bundesebene zwischen<br />
1.300 und 7.500 MW.<br />
2,4<br />
2,0<br />
1,6<br />
1,2<br />
0,8<br />
0,4<br />
0,0<br />
© IWR, 2012<br />
63
1.000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
PV-Leistung [MW]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: BSW, Solar Verlag, BNetzA, IWR / eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.20: NRW-Marktentwicklung Photovoltaik: Die jährlich neu <strong>in</strong>stallierte PV-<br />
Leistung (2002 – 2011) (Quelle: IWR, 2012, Daten: BSW, Solar Verlag, BNetzA,<br />
IWR, 2011 vorläufig)<br />
Abbildung 4.21: Die 2011 <strong>in</strong> den Bundeslän<strong>der</strong>n neu <strong>in</strong>stallierte Photovoltaikleistung<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: BNetzA, eigene Berechnung, 2011 vorläufig)<br />
© IWR, 2012<br />
64
Im bundesweiten Vergleich s<strong>in</strong>d die Anteile am Zubau stärker zwischen den<br />
Bundeslän<strong>der</strong>n verteilt als noch im Vorjahr. Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen behauptet dabei<br />
den dritten Platz im Rank<strong>in</strong>g mit e<strong>in</strong>em Anteil am deutschlandweiten Zubau von<br />
rd. 11 Prozent. Bayern führt das Zubaurank<strong>in</strong>g zwar weiterh<strong>in</strong> an, vere<strong>in</strong>igt mit<br />
e<strong>in</strong>er Leistung von rd. 1.700 MW aber nur noch rd. 23 Prozent des Zubaus auf<br />
sich, nachdem <strong>der</strong> Anteil im Vorjahr noch bei rd. 33 Prozent gelegen hatte. An<br />
die zweite Position rückt Brandenburg mit e<strong>in</strong>em Anteil von rd. 13 Prozent (rd.<br />
980 MWp), Baden-Württemberg fällt mit e<strong>in</strong>em Anteil von rd. 11 Prozent (rd. 840<br />
MWp) h<strong>in</strong>ter NRW auf Rang vier zurück. Am Ende des Rank<strong>in</strong>g stehen das Saarland<br />
und die Stadtstaaten Berl<strong>in</strong>, Bremen und Hamburg (Abbildung 4.21).<br />
PV-Nutzung <strong>in</strong> NRW auf Kreisebene<br />
Abbildung 4.22: Stand des Photovoltaikausbaus <strong>in</strong> NRW auf Kreisebene Ende 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Innerhalb von Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ist die Nutzung <strong>der</strong> Photovoltaik vor allem auf<br />
die eher ländlich geprägten Regionen konzentriert. Abbildung 4.22 zeigt die Verteilung<br />
<strong>der</strong> bis Ende 2011 <strong>in</strong>stallierten PV-Leistung <strong>in</strong> NRW auf Kreisebene. Ins-<br />
65
eson<strong>der</strong>e die Kreise <strong>in</strong> den Regierungsbezirken Münster und Detmold erweisen<br />
sich dabei als regionale Zentren <strong>der</strong> PV-Nutzung. Mit Blick auf die gesamte <strong>in</strong>stallierte<br />
Leistung von rd. 2.850 MWp führt <strong>der</strong> Kreis Borken das Rank<strong>in</strong>g <strong>in</strong>nerhalb<br />
von NRW vor dem Kreis Ste<strong>in</strong>furt und dem Kreis Kleve an. Auch im Jahr<br />
2011 fand <strong>der</strong> größte Zubau im Kreis Borken statt, gefolgt von den Kreisen Kleve<br />
und Ste<strong>in</strong>furt. Im südlichen Teil von Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen s<strong>in</strong>d dagegen deutlich<br />
weniger PV-Anlagen <strong>in</strong>stalliert. Gleiches gilt für die urban-geprägten Kreise <strong>der</strong><br />
Rhe<strong>in</strong>-Ruhr-Region.<br />
66
4.2.2.4 Stromerzeugung aus Wasserkraft und Marktentwicklung<br />
Tabelle 4.13: Wasserkraft <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: Büro für Wasserkraft NRW, IWR, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung<br />
/ Schätzung)<br />
Daten: Büro für Wasserkraft,<br />
IWR<br />
IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung 2,12 MW 0,07 MW 2,12 MW 0,07 MW + 2.929 %<br />
NRW-Gesamtleistung ca.190 MW ca.188 MW 190 MW 188 MW + 1,1 %<br />
Wasserstromproduktion<br />
NRW (ohne Pumpwasser)<br />
1 = Werte vorläufig<br />
0,50<br />
Mrd. kWh<br />
0,57<br />
Mrd. kWh<br />
0,50<br />
Mrd. kWh<br />
0,57<br />
Mrd. kWh<br />
- 12,3 %<br />
Die Stromproduktion aus Wasserkraft ist <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
rückläufig. Mit <strong>in</strong>sgesamt rd. 500 Mio. kWh Wasserkraftstrom s<strong>in</strong>kt <strong>der</strong> Wert gegenüber<br />
dem Vorjahr um rd. 12 Prozent (2010: 570 Mio. kWh) (Tabelle 4.13).<br />
Grund für den Rückgang ist <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong>e vergleichsweise ger<strong>in</strong>ge Nie<strong>der</strong>schlagsmenge,<br />
die zu e<strong>in</strong>em deutlich ger<strong>in</strong>geren Wasserangebot als im Vorjahr<br />
2010 geführt hat. Die Wasserkraft-Stromerzeugung bewegt sich seit Beg<strong>in</strong>n des<br />
Monitor<strong>in</strong>gs im Jahr 2002 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Bandbreite von 460 - 580 Mio. kWh, <strong>der</strong> gemittelte<br />
Wert <strong>in</strong> den letzten 10 Jahren liegt bei rd. 520 Mio. kWh. Damit bef<strong>in</strong>det sich<br />
die NRW-Stromproduktion für 2011 zwar <strong>in</strong>nerhalb dieser Spanne, liegt aber<br />
deutlich unter dem Durchschnitt (Abbildung 4.23).<br />
280<br />
240<br />
200<br />
160<br />
120<br />
80<br />
40<br />
0<br />
[MW] [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Abbildung 4.23: Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Gesamtleistung und Stromerzeugung im<br />
Bereich Wasserkraft <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012, Daten: BDEW, Büro für Was-<br />
serkraft / eigene Berechnung)<br />
Leistung [MW] Strom [Mrd. kWh]<br />
Quelle: IWR, Daten: BDEW, Wagner, Büro für Wasserkraft / eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
© IWR, 2012<br />
67
Die Ermittlung <strong>der</strong> NRW-Stromerzeugung erfolgt mittels Abschätzung auf <strong>der</strong> Basis<br />
von NRW-spezifischen Regionalfaktoren. Die Grundlage dafür bilden zwei<br />
Publikationen, <strong>in</strong> denen u.a. die bundeslandspezifische Stromproduktion aus<br />
Wasserkraft beleuchtet wird (Tabelle 4.13, Abbildung 4.23) [34], [35]. Mit den Angaben<br />
zur Stromproduktion aus Wasserkraft <strong>in</strong> Deutschland im Jahr 2011 ist unter<br />
diesen Annahmen die Bestimmung <strong>der</strong> regionalen Erzeugung <strong>in</strong> NRW möglich.<br />
Bei e<strong>in</strong>er bundesweiten Wasserkraft-Stromproduktion von 18,7 Mrd. kWh im<br />
Jahr 2011 ergibt sich für die NRW-Erzeugung e<strong>in</strong>e Bandbreite von 440 bis 560<br />
Mio. kWh. Der resultierende Mittelwert von 500 Mio. kWh wird als IWR-<br />
Referenzwert für das Jahr 2011 festgelegt (Abbildung 4.23).<br />
Repower<strong>in</strong>g: Höchster Zubau seit über 10 Jahren<br />
Der Wasserkraft-Markt weist sowohl <strong>in</strong> NRW als auch im Bundesgebiet vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergrund des hohen Ausbaugrades und aufwändiger Genehmigungsverfahren<br />
e<strong>in</strong> niedriges Niveau auf. Dies gilt neben dem Zubau neuer Anlagen auch für die<br />
Reaktivierung von Wasserkraftstandorten. Deutlich wird dies anhand <strong>der</strong> Betrachtung<br />
des technischen Potenzials <strong>in</strong> Deutschland. So gehen Branchenexperten<br />
davon aus, dass das technisch nutzbare Potenzial zur Stromerzeugung aus<br />
Wasserkraft bei rd. 26 Mrd. kWh im Jahr liegt [35]. In den letzten Jahren erreichte<br />
die bundesweite Stromproduktion aus Wasser e<strong>in</strong>en Wert von bis zu 21,2 Mrd.<br />
kWh, das entspricht bereits e<strong>in</strong>em Nutzungsgrad von rd. 80 Prozent.<br />
In NRW übersteigt <strong>der</strong> Zubau an Wasserkraftanlagen 2011 mit e<strong>in</strong>er Kapazität<br />
von rd. 2,1 MW erstmals seit Beg<strong>in</strong>n des Monitor<strong>in</strong>gs im Jahr 2002 die 2-MW-<br />
Marke (Abbildung 4.24). Zuvor bewegte sich <strong>der</strong> jährliche Zubau <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bandbreite<br />
von rd. 25 kW bis 1,4 MW. Der hohe Zubau im Jahr 2011 resultiert vor allem<br />
aus <strong>der</strong> Repower<strong>in</strong>gmaßnahme am Wasserkraftwerk Westhofen 2 <strong>in</strong> Schwerte-<br />
Westhofen. Die Anlage mit Turb<strong>in</strong>enpumpen ist im letzten Jahr u.a. mit dem Ziel<br />
<strong>der</strong> Steigerung <strong>der</strong> Stromerzeugung aufgerüstet worden. Im Zuge des Umbaus<br />
wurden zwei neue Turb<strong>in</strong>en mit e<strong>in</strong>er Leistung von rd. 1,2 MW <strong>in</strong>stalliert.<br />
2,4<br />
2,0<br />
1,6<br />
1,2<br />
0,8<br />
0,4<br />
0,0<br />
Leistung Wasserkraftanlagen [MW]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
Quelle: IWR, Daten: Büro für Wasserkraft / eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.24: Inbetriebnahme von Wasserkraftanlagen <strong>in</strong> NRW (2002 bis 2011)<br />
© IWR, 2012<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: Büro für Wasserkraft, eigene Berechnung, 2011 vorläufig)<br />
68
4.2.2.5 Stromerzeugung aus Grubengas<br />
Tabelle 4.14: Grubengas <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(elektrische Nutzung) (Quelle: IWR, 2012, Daten: Bezirksregierung Arnsberg)<br />
Daten: Bezreg. Arnsberg IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung 3 MWel - 17 MWel 3 MWel - 17 MWel -<br />
Vorjahr<br />
NRW-Gesamtleistung 186 MWel 183 MWel 186 MWel 183 MWel + 1,6 %<br />
Stromproduktion aus Grubengas<br />
1 = Werte vorläufig<br />
ca. 0,71<br />
Mrd. kWh<br />
ca. 0,81<br />
Mrd. kWh<br />
ca. 0,71<br />
Mrd. kWh<br />
0,81<br />
Mrd. kWh<br />
- 12,3 %<br />
Trotz <strong>der</strong> weitestgehend konstanten <strong>in</strong>stallierten Leistung von knapp 190 MWel ist<br />
die Stromproduktion aus Grubengas 2011 <strong>in</strong> NRW weiter gesunken. Für 2011<br />
ergibt sich e<strong>in</strong> Wert von rd. 0,7 Mrd. kWh, gegenüber dem Vorjahr ist dies e<strong>in</strong><br />
Rückgang um rd. 12 Prozent. Damit setzt sich <strong>der</strong> Trend <strong>der</strong> vergangenen Jahre<br />
fort (Abbildung 4.25). Angesichts dieser Entwicklung bestätigt sich die E<strong>in</strong>schätzung,<br />
dass das Maximum <strong>der</strong> Grubengas-Stromerzeugung <strong>in</strong> NRW bereits <strong>in</strong> den<br />
Jahren 2005 und 2007 mit rd. 1,1 Mrd. kWh erreicht wurde.<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
[MW] [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: Bezirksregierung Arnsberg, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.25: Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Gesamtleistung und Stromerzeugung im<br />
Bereich Grubengas <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012, Daten: Bezirksregierung Arns-<br />
berg, 2011 vorläufig)<br />
Leistung [MW] Strom [Mrd. kWh]<br />
Die s<strong>in</strong>kende Stromerzeugung aus Grubengasanlagen <strong>in</strong> NRW resultiert v.a. aus<br />
<strong>der</strong> abnehmenden Menge des zur Verfügung stehenden Grubengases. Sowohl<br />
im aktiven als auch im stillgelegten Bergbau ist das Aufkommen im Jahr 2011<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
© IWR, 2012<br />
69
weiter zurückgegangen. In den bereits stillgelegten Gruben ist <strong>der</strong> Rückgang u.a.<br />
auf den Anstieg des Grundwasserspiegels durch Anpassungsmaßnahmen des<br />
Grubenwasserspiegels zurückzuführen [36]. Im aktiven Bergbau wirken sich die<br />
Zechenschließungen unmittelbar auf die zur Verfügung stehende Grubengasmenge<br />
aus. Der IWR-Referenzwert für die Stromerzeugung aus Grubengas wird<br />
für das Jahr 2011 auf 710 Mio. kWh festgelegt (Tabelle 4.14, Abbildung 4.25).<br />
Grubengas-Leistung nimmt 2011 um 3 MW zu<br />
Nachdem die Stromerzeugung aus Grubengas 2000 im Rahmen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes<br />
(EEG) vergütungsfähig wurde, hat sich <strong>in</strong> den Folgejahren<br />
e<strong>in</strong> dynamischer Markt entwickelt. Die eigentliche Marktentwicklungsphase,<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> e<strong>in</strong> Großteil des Zubaus <strong>in</strong> NRW erfolgte, erstreckt sich auf die Jahre 2002<br />
bis 2004. Seitdem stagniert <strong>der</strong> Ausbau, 2006 und 2010 kam es per Saldo sogar<br />
zu e<strong>in</strong>em Rückgang <strong>der</strong> elektrischen Grubengasleistung (Abbildung 4.26).<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
-10,0<br />
-20,0<br />
-30,0<br />
Zubau Leistung Grubengasanlagen [MW]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: Bezirksregierung Arnsberg / eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.26: Entwicklung <strong>der</strong> jährlich neu <strong>in</strong>stallierten Leistung von Grubengas-<br />
BHKW <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012, Daten: Bezirksregierung Arnsberg, eigene Be-<br />
rechnung, 2011 vorläufig)<br />
© IWR, 2012<br />
Die Stagnation, die <strong>in</strong> den letzten Jahren beim Anlagenbestand zu beobachten<br />
ist, lässt sich auf e<strong>in</strong>e weitgehende Ausnutzung <strong>der</strong> Potenziale und rückläufige<br />
Grubengasmengen zurückführen. Nach Ansicht von Experten bestehen daher<br />
nur noch im Bereich <strong>der</strong> Kle<strong>in</strong>anlagen nennenswerte Zubaupotenziale. Für die<br />
Erschließung weiterer Standorte bedeutet dies allerd<strong>in</strong>gs ansteigende Kosten.<br />
Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Grubengas-Statistik <strong>der</strong> Bezirksregierung Arnsberg erfassten Anlagen<br />
weisen 2011 <strong>in</strong> Summe e<strong>in</strong>e elektrische Leistung von rd. 186 MWel auf [37]. Dies<br />
entspricht gegenüber 2010 e<strong>in</strong>er Steigerung um rd. 3 MWel. Ursache für den Anlagenzubau<br />
ist <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie das Bestreben <strong>der</strong> Anlagenbetreiber, durch die Bestückung<br />
weiterer Standorte mit BHKW-Modulen möglichst viel Grubengas energetisch<br />
zu nutzen. Das führt zwar zu e<strong>in</strong>er Diversifizierung <strong>der</strong> Standorte, aufgrund<br />
<strong>der</strong> zurückgehenden Grubengasmengen aber nicht mehr zu e<strong>in</strong>er Erhöhung<br />
<strong>der</strong> Gesamtstromerzeugung [36].<br />
70
4.2.3 Regenerative Wärmeerzeugung <strong>in</strong> NRW<br />
Im Jahr 2011 hat die regenerative Bereitstellung (ohne Grubengas) von Nutzenergie<br />
<strong>in</strong> NRW um etwa 6 Prozent auf rd. 11,1 Mrd. kWh (2010: 10,4 Mrd.<br />
kWh, 7 Prozent) zugelegt. Unter zusätzlicher E<strong>in</strong>beziehung <strong>der</strong> genutzten Wärmemengen<br />
aus Grubengas <strong>in</strong> Höhe von 0,11 Mrd. kWh (2010: 0,12 Mrd. kWh)<br />
resultiert im Segment Klimaschutz e<strong>in</strong>e Gesamtwärmemenge von 11,2 Mrd. kWh.<br />
In <strong>der</strong> Kategorie <strong>der</strong> für das Jahr 2011 erstmalig betrachteten Bereitstellung von<br />
Endenergie <strong>in</strong> NRW ergibt sich im Bereich <strong>der</strong> regenerativen Wärmebereitstellung<br />
e<strong>in</strong>e Gesamterzeugung von etwa 17,7 Mrd. kWh. Auf Bundesebene lag die<br />
Wärmebereitstellung (Endenergie) bei <strong>in</strong>sgesamt 143,5 Mrd. kWh. Der NRW-<br />
Anteil erreicht damit e<strong>in</strong>en Wert von etwa 12 Prozent (Tabelle 4.15).<br />
Tabelle 4.15: Regenerative Wärmeerzeugung <strong>in</strong> NRW – Nutz- und Endenergieanteile<br />
im Jahr 2011 (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Nutz- und Endenergie-Referenzwerte auf<br />
Basis von StaBA, IT.NRW, AGEE-Stat, BAFA, Bezreg. Arnsberg, BWP, DBFZ, FNR, ITAD, IWR, LWK<br />
NRW, MKULNV, z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Bioenergie<br />
Biomasse fest (HKW und HW)<br />
Biomasse fest<br />
(Holzheizungen / E<strong>in</strong>zelfeuerstätten)<br />
Biogas<br />
biogener Abfall<br />
flüssige Biomasse<br />
Klärgas<br />
Deponiegas<br />
Nutzenergie<br />
[Mrd. kWh]<br />
9,45<br />
1,70<br />
4,1<br />
0,83<br />
2,3<br />
0,33<br />
0,16<br />
0,03<br />
2011 1) Anteil Endenergie<br />
Bund<br />
Anteil [%] Endenergie<br />
[Mrd. kWh]<br />
85,5 15,99<br />
4,64<br />
6,48<br />
1,52<br />
2,3<br />
0,69<br />
0,31<br />
0,05<br />
Anteil [%] [%]<br />
90,5 12,2<br />
Geoenergie 1,09 9,9 1,1 6,2 18,4<br />
Solarthermie 0,51 4,6 0,57 3,2 10,2<br />
Summe Wärme regenerativ 11,05 100,0 17,66 100,0 12,3<br />
Grubengas 0,11 0,44 n.b.<br />
Summe Wärme Klimaschutz 11,16 18,10 n.b.<br />
1 = Werte vorläufig<br />
Die Entwicklung <strong>der</strong> regenerativ erzeugten Nutzwärmemengen bzw. Wärme im<br />
Segment Klimaschutz (<strong>in</strong>kl. Grubengas) seit 2002 weist per Saldo e<strong>in</strong> solides<br />
Wachstum auf. Innerhalb <strong>der</strong> Zeitreihe fallen die vergleichsweise hohen Wachstumsraten<br />
<strong>in</strong> den Jahren 2005 und 2008 auf (Abbildung 4.27). Diese s<strong>in</strong>d auf Erweiterungen<br />
des statistischen Erhebungskreises zurückzuführen:<br />
� Seit dem Jahr 2005 werden Statistiken über die regenerative Wärmeerzeugung<br />
aus biogenem Abfall e<strong>in</strong>bezogen.<br />
� Ab dem Jahr 2008 wird zudem die regenerative Wärme aus E<strong>in</strong>zelfeuerstätten<br />
wie Kam<strong>in</strong>en und Kam<strong>in</strong>öfen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Statistik berücksichtigt.<br />
� Für das Jahr 2011 wurde zudem die Wärmebereitstellung aus Deponie-<br />
und Klärgas sowie flüssiger Biomasse erstmals abgeschätzt.<br />
71
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Abbildung 4.27: Entwicklung <strong>der</strong> regenerativen Wärmeerzeugung (Nutzenergie) und <strong>der</strong><br />
Wärmeerzeugung im Bereich Klimaschutz (<strong>in</strong>kl. Grubengas) <strong>in</strong> NRW<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
4.2.3.1 Wärmeerzeugung aus Biomasse und Marktentwicklung<br />
Nutzwärmeerzeugung <strong>in</strong> Biomasseheiz(kraft)werken<br />
Tabelle 4.16: Biomasseheiz(kraft)werke <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(thermische Nutzung)<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: FNR, IWR, DBFZ, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Daten: FNR, IWR, DBFZ IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung 9 MWth 0 MWth 9 MWth 0 MWth -<br />
Vorjahr<br />
NRW-Gesamtleistung ca. 550 MWth ca. 540 MWth 550 MWth 540 MWth + 1,9 %<br />
Wärmeerzeugung<br />
Annahme: typische Volllaststundenwerte<br />
1 = Werte vorläufig<br />
Wärmeerzeugung (Nutzenergie) [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
Wärme reg. m<strong>in</strong>/max Wärme (<strong>in</strong>kl. Grubengas)<br />
n.b. n.b. 1,70<br />
Mrd. kWh<br />
1,63<br />
Mrd. kWh<br />
© IWR, 2012<br />
+ 4,3 %<br />
Bed<strong>in</strong>gt durch die Inbetriebnahme e<strong>in</strong>es neuen Biomasseheiz(kraft)werkes im<br />
Regierungsbezirk Düsseldorf hat die Wärmeerzeugung <strong>in</strong> NRW <strong>in</strong> diesem Segment<br />
im Jahr 2011 leicht zugenommen. Insgesamt erreichte die Nutzwärmeerzeugung<br />
aus Biomasseheiz(kraft)werken <strong>in</strong> NRW e<strong>in</strong>en IWR-Referenzwert von<br />
etwa 1,70 Mrd. kWh (Vorjahr 2010: 1,63 Mrd. kWh). Dieser resultiert ausgehend<br />
von e<strong>in</strong>er NRW-Gesamtleistung von rd. 550 MWth unter Annahme typischer Jahresvolllaststundenwerte<br />
(Tabelle 4.16). Wie die Stromerzeugung aus Biomasse,<br />
so spiegelt auch die Zeitreihe <strong>der</strong> Wärmeerzeugung (2002 – 2011) e<strong>in</strong>e enge<br />
Korrelation zwischen Erzeugung und <strong>in</strong>stallierter Leistung und e<strong>in</strong>e Entkopplung<br />
von witterungsklimatologischen Faktoren wi<strong>der</strong> (Abbildung 4.28).<br />
72
800<br />
640<br />
480<br />
320<br />
160<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Leistung [MWth] Wärme [Mrd. kWh]<br />
Quelle: IWR, Daten: FNR, IWR, DBFZ / eigene Berechnung / Schätzung: IWR * = vorläufig<br />
Abbildung 4.28: Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Gesamtleistung und Wärmeerzeugung im<br />
Bereich Biomasseheiz(kraft)werke <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012, Daten: FNR,<br />
IWR, DBFZ, eigene Berechnung, Schätzung, 2011 vorläufig)<br />
NRW-Marktentwicklung Biomasseheiz(kraft)werke mit ger<strong>in</strong>ger Dynamik<br />
Der Anlagenzubau im Bereich <strong>der</strong> Biomasseheiz(kraft)werke weist e<strong>in</strong>e hohe<br />
Volatilität auf. Der Schwerpunkt des Zubaus an thermischer Leistung erfolgte bis<br />
zum Jahr 2006. Seitdem s<strong>in</strong>d die Neubauaktivitäten deutlich zurückgegangen,<br />
<strong>in</strong>sgesamt ersche<strong>in</strong>t <strong>der</strong> Markt gesättigt (Abbildung 4.29).<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
[MW th] [Mrd. kWh]<br />
Leistung Biomasseheiz(kraft)werke [MW th]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten (vorläufig): FNR, IWR, DBFZ, eigene Berechnung / Schätzung, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.29: Entwicklung <strong>der</strong> jährlich <strong>in</strong>stallierten thermischen Leistung im Bereich<br />
Biomasseheiz(kraft)werke <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012, Daten: FNR, IWR, DBFZ,<br />
eigene Berechnung, Schätzung, 2011 vorläufig)<br />
2,0<br />
1,6<br />
1,2<br />
0,8<br />
0,4<br />
0,0<br />
© IWR, 2012<br />
© IWR, 2012<br />
73
Der größte Anlagenzubau entfällt nach den vorliegenden Statistiken mit e<strong>in</strong>er neu<br />
<strong>in</strong>stallierten Leistung von etwa 200 MWth auf das Jahr 2004. Nachdem für das<br />
Jahr 2010 ke<strong>in</strong>e Inbetriebnahmen zu verzeichnen waren, wurde für 2011 wie<strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong> neuer Kraftwerksstandort mit e<strong>in</strong>er thermischen Leistung von 9 MWth ermittelt.<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Anteil [%]<br />
Arnsberg Detmold Köln Münster Düsseldorf<br />
Thermische NRW‐Gesamtleistung Biomasseheiz(kraft)werke 2011 = 550 MW th*<br />
Quelle: IWR, Daten: FNR, IWR, DBFZ, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.30: Regionale Verteilung <strong>der</strong> thermischen Leistung im Bereich Biomasseheiz(kraft)werke<br />
<strong>in</strong> NRW im Jahr 2011(Quelle: IWR, 2012, Daten: FNR, IWR,<br />
DBFZ, eigene Berechnung, Schätzung, 2011 vorläufig)<br />
© IWR, 2012<br />
Trotz <strong>der</strong> Neu<strong>in</strong>betriebnahme e<strong>in</strong>es Biomasseheiz(kraft)werkes im Jahr 2011<br />
rangiert <strong>der</strong> Regierungsbezirk Düsseldorf bezogen auf die thermische NRW-<br />
Gesamtleistung (550 MWth) mit e<strong>in</strong>em Anteil von 5 Prozent auf dem h<strong>in</strong>teren<br />
Platz. Die größten Leistungsanteile entfallen auf Arnsberg (rd. 50 Prozent) und<br />
Detmold (rd. 30 Prozent) (Abbildung 4.30).<br />
74
Nutzwärmeerzeugung <strong>in</strong> Holzheizungen gemäß Holzabsatzför<strong>der</strong>richtl<strong>in</strong>ie<br />
bzw. Marktanreizprogramm<br />
Tabelle 4.17: Biomassefeuerungen gemäß Holzabsatzför<strong>der</strong>richtl<strong>in</strong>ie bzw. MAP-<br />
Programm <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: BAFA, IWR, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Daten: BAFA, IWR IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung ca. 41 MWth 66,1 MWth 40 MWth 66 MWth - 39,4 %<br />
NRW-Gesamtleistung ca. 690 MWth ca. 650 MWth 690 MWth 650 MWth + 6,2 %<br />
Wärmeerzeugung<br />
Annahme: typische Volllaststundenwerte<br />
1 = Werte vorläufig<br />
1.000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
n.b. n.b. 1,40<br />
Mrd. kWh<br />
1,30<br />
Mrd. kWh<br />
[MW th] [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Leistung [MWth] Wärme [Mrd. kWh]<br />
Quelle: IWR, Daten: MKULNV, BAFA, IWR / eigene Berechnung / Schätzung: IWR * = vorläufig<br />
+ 7,7 %<br />
Abbildung 4.31: Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Gesamtleistung und Wärmeerzeugung im<br />
Bereich Biomassefeuerungen <strong>in</strong> NRW gemäß Hafö bzw. MAP (Quelle:<br />
IWR, 2012, Daten: MKULNV, BAFA, IWR, eigene Berechnung, 2011 vorläufig)<br />
Im Jahr 2011 erreichte die nutzbare Wärmeerzeugung aus Biomassefeuerungsanlagen,<br />
die nach den Kriterien des ehemaligen NRW-Programms <strong>der</strong> Holzabsatzför<strong>der</strong>richtl<strong>in</strong>ie<br />
(Hafö) bzw. dem Marktanreizprogramm (MAP) des Bundes errichtet<br />
wurden, e<strong>in</strong>en Referenzwert von etwa 1,4 Mrd. kWh (Vorjahr 2010: 1,3<br />
Mrd. kWh). Diese Größenordnung ergibt sich auf <strong>der</strong> Grundlage e<strong>in</strong>er NRW-<br />
Gesamtleistung von 690 MWth (2010: rd. 650 MWth) unter Zugrundelegung e<strong>in</strong>es<br />
anlagentypischen Volllaststundenwertes pro Jahr (Tabelle 4.17, Abbildung 4.31).<br />
In erster L<strong>in</strong>ie handelt es sich bei den betrachteten Anlagen um Pellet- und<br />
Hackschnitzelanlagen.<br />
NRW-Marktentwicklung 2011 – Dynamik lässt weiter nach<br />
2,0<br />
1,8<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
© IWR, 2012<br />
75
Die För<strong>der</strong>programme auf Bundes- bzw. Landesebene waren bislang e<strong>in</strong>e zentrale<br />
Stütze für die Marktentwicklung im Bereich Biomasseheizungen / Holzfeuerungen.<br />
Unter <strong>der</strong> Prämisse, dass <strong>der</strong> NRW-Markt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit weitgehend<br />
e<strong>in</strong>em För<strong>der</strong>markt entsprochen hat, wird die Marktentwicklung für den Zeitraum<br />
bis 2010 bislang über die Statistiken zur landesspezifische Holzabsatzför<strong>der</strong>richtl<strong>in</strong>ie<br />
bzw. das beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle<br />
(BAFA) angesiedelte Marktanreizprogramm (MAP) dargestellt. Da die Bedeutung<br />
des MAP für den Gesamtmarkt deutlich zurückgeht, wird für das Jahr 2011 <strong>der</strong><br />
NRW-Zubauwert <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Leistung unter E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es NRWspezifischen<br />
Regionalwertes berechnet. Diesem Ansatz liegt die Annahme zugrunde,<br />
dass sich die bundeslän<strong>der</strong>spezifische Regionalverteilung im MAP auch<br />
auf den Gesamtmarkt übertragen lässt. Insgesamt werden auf dieser Basis rd.<br />
1.930 Anlagen mit e<strong>in</strong>er Gesamtleistung von etwa 41 MWth ermittelt, die <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
im Jahr 2011 neu errichtet wurden (Abbildung 4.32).<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Leistung Biomasseheizungen Hafö/MAP [MW th]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten (vorläufig): MKULNV, BAFA, IWR, eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 4.32: NRW-Marktentwicklung im Segment Biomassefeuerungen gemäß Hafö<br />
/ MAP: Die jährlich <strong>in</strong>stallierte thermische Leistung (2002 – 2011)<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: MKULNV, BAFA, IWR, eigene Berechnung, 2011 vorläufig)<br />
Seit dem Boomjahr 2009 hat die Marktentwicklung im Bereich Holzheizungen<br />
deutlich an Dynamik verloren. Grund für den Rückgang ist die auf Bundes- und<br />
NRW-Ebene zu beobachtende Schwächephase des regenerativen Wärmemarktes.<br />
Neben stark schwankenden Energiepreisen ist e<strong>in</strong>e unstetige Entwicklung<br />
<strong>der</strong> flankierenden För<strong>der</strong>programme e<strong>in</strong> Grund für die rückläufige Marktentwicklung.<br />
Im Jahr 2011 ist für NRW gegenüber dem Vorjahr 2010 mit e<strong>in</strong>em Zubau<br />
von rd. 40 MWth (2010: rd. 66 MWth) e<strong>in</strong> weiterer Marktrückgang um etwa 40 Prozent<br />
zu verzeichnen. 3<br />
3 Neben den zuvor genannten Faktoren ist dabei auch zu berücksichtigen, dass durch die s<strong>in</strong>kende Bedeutung des MAP für<br />
den Gesamtmarkt, die bundeslandspezifische Ermittlung von Marktdaten um e<strong>in</strong>e Schätzkomponente erweitert wurde.<br />
76
In <strong>der</strong> regionalen Differenzierung nach Bundeslän<strong>der</strong>n zeigt sich nach <strong>der</strong> MAP-<br />
Statistik, dass die größten Märkte für Holzfeuerungen anteilig auch im Jahr 2011<br />
<strong>in</strong> den beiden südlichen Bundeslän<strong>der</strong>n Bayern und Baden-Württemberg liegen.<br />
Demnach rangiert Bayern mit knapp 40 Prozent vor Baden-Württemberg mit ca.<br />
20 Prozent. NRW erreicht mit etwa 9 Prozent den dritten Platz. Darauf folgen<br />
Hessen mit 7 Prozent und Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz mit rd. 6 Prozent (Abbildung 4.33).<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Anteil [%]<br />
Quelle: IWR, Daten (vorläufig): BAFA<br />
BY BW NRW HE RP NI TH SN SH Sonstige<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 4.33: Bundesland-Verteilung <strong>der</strong> im Marktanreizprogramm 2011 geför<strong>der</strong>ten<br />
Biomassefeuerungen (Quelle: IWR, 2012, Daten: BAFA, 2011 vorläufig)<br />
77
Nutzwärmeerzeugung <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfeuerstätten<br />
Tabelle 4.18: Wärmeerzeugung aus Biomasse <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfeuerstätten <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: MKULNV NRW / Schätzung)<br />
Daten: MKULNV NRW IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung n.b. n.b. n.b. n.b. -<br />
NRW-Gesamtleistung n.b. n.b. n.b. n.b. -<br />
Wärmeerzeugung aus<br />
Biomasse <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfeuerstätten<br />
1 = Werte vorläufig<br />
n.b. n.b. 2,7<br />
Mrd. kWh<br />
2,7<br />
Mrd. kWh<br />
Vorjahr<br />
+/- 0 %<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Studie wird zur Ermittlung des Nutzwärmeanteils<br />
von E<strong>in</strong>zelfeuerstätten (Kam<strong>in</strong>- und Kachelöfen, Heizkam<strong>in</strong>e etc.) auch für 2011<br />
<strong>der</strong> für die Vorjahre verwendete Schätzansatz herangezogen. Zentrale Berechnungsgrößen<br />
<strong>in</strong> diesem Ansatz s<strong>in</strong>d <strong>der</strong> Wald-Scheitholzverbrauch privater<br />
Haushalte, <strong>der</strong> Anlagenwirkungsgrad und <strong>der</strong> Primärenergiegehalt von Holzbrennstoffen.<br />
Als Basis für den Wald-Scheitholzverbrauch von Privathaushalten<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen werden die Ergebnisse e<strong>in</strong>er aktuellen Untersuchung des<br />
Zentrums für Holzwirtschaft <strong>der</strong> Universität Hamburg für das Betrachtungsjahr<br />
2010 herangezogen [38]. Demnach lag <strong>der</strong> Wald-Scheitholzverbrauch <strong>in</strong> NRW<br />
mit 1,8 Mio. Fm 2010 <strong>in</strong> etwa auf dem Niveau des Jahres 2007. Unter <strong>der</strong> Annahme,<br />
dass <strong>der</strong> Wald-Scheitholzverbrauch auch 2011 konstant war (1,8 Mio.<br />
Fm), ergibt sich nach dem Schätzansatz für die bereitgestellte Nutzenergie durch<br />
E<strong>in</strong>zelfeuerstätten e<strong>in</strong>e Größenordnung von etwa 2,7 Mrd. kWh (Tabelle 4.18).<br />
78
Nutzwärmebereitstellung aus Biogas und Marktentwicklung <strong>in</strong> NRW<br />
Tabelle 4.19: Biogas <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(thermische Nutzung) (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, eigene Berechnung)<br />
Landwirtschaftliche Biogasanlagen<br />
Wärmeerzeugung aus<br />
Biogas<br />
Daten: LWK NRW IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
ca. 0,78<br />
Mrd. kWh<br />
Industrielle / kommunale Biogasanlagen<br />
Wärmeerzeugung aus<br />
Biogas<br />
ca. 0,54<br />
Mrd. kWh<br />
0,78<br />
Mrd. kWh<br />
0,54<br />
Mrd. kWh<br />
Daten: Witzenhausen, IWR IWR-Referenzwerte<br />
Vorjahr<br />
+ 44,4 %<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
ca. 0,05<br />
Mrd. kWh<br />
n.b. 0,05<br />
Mrd. kWh<br />
Biogas gesamt (landwirtschaftliche und <strong>in</strong>dustrielle / kommunale Biogasanlagen<br />
Wärmeerzeugung aus<br />
Biogas<br />
1 = Werte vorläufig<br />
Vorjahr<br />
n.b. -<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
ca. 0,83<br />
Mrd. kWh<br />
ca. 0,54<br />
Mrd. kWh<br />
0,83<br />
Mrd. kWh<br />
0,54<br />
Mrd. kWh<br />
Vorjahr<br />
+ 53,7 %<br />
Angaben über die Wärmeerzeugung im Bereich <strong>der</strong> landwirtschaftlichen Biogasanlagen<br />
<strong>in</strong> NRW im Jahr 2011 werden rechnerisch auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Biogasanlagen-Betreiberdatenbank<br />
<strong>der</strong> Landwirtschaftskammer NRW ermittelt (Tabelle<br />
4.19). Zusätzlich werden die Wärmemengen für den Bereich <strong>der</strong> <strong>in</strong>dustriellen und<br />
kommunalen Bioabfallvergärungsanlagen unter Zugrundelegung typischer Volllaststundenangaben<br />
ermittelt.<br />
Im Segment <strong>der</strong> landwirtschaftlichen Biogasanlagen ist nach Angaben <strong>der</strong> Landwirtschaftskammer<br />
davon auszugehen, dass im Jahr 2011 von rd. 75 Prozent <strong>der</strong><br />
erfassten Biogasanlagen die entstehende Wärme genutzt wird. Insgesamt wurden<br />
wie<strong>der</strong>um 52 Prozent <strong>der</strong> von diesen Anlagen bereitgestellten Wärme verwendet.<br />
Ausgehend von e<strong>in</strong>er theoretischen Stromproduktion <strong>der</strong> landwirtschaftlichen<br />
Biogasanlagen von rd. 1,83 Mrd. kWh und <strong>der</strong> im Mittel zu beobachtenden<br />
Stromkennzahl resultiert größenordnungsmäßig e<strong>in</strong>e genutzte Wärmemenge von<br />
etwa 780 Mio. kWh (IWR-Referenzwert) [23]. Zusammen mit <strong>der</strong> zusätzlich im<br />
Bereich <strong>der</strong> kommunalen und <strong>in</strong>dustriellen Bioabfallvergärungsanlagen anfallenden<br />
Nutzwärmemenge <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung von etwa 54 Mio. kWh ergibt sich<br />
e<strong>in</strong>e Gesamtwärmemenge aus Biogas von etwa 830 Mio. kWh.<br />
79
Nutzwärmebereitstellung aus biogenem Abfall<br />
Tabelle 4.20: Biogener Abfall <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(exportierte Wärmemenge)<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: ITAD, IWR, IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Daten: ITAD, IWR IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Zubau <strong>in</strong>st. Leistung n.b. n.b. n.b. n.b. +/- 0 %<br />
NRW-Gesamtleistung n.b. n.b. n.b. n.b. +/- 0 %<br />
Wärmeerzeugung aus<br />
biogenem Abfall<br />
Annahme:<br />
biogener Anteil im Abfall = 50 %<br />
1 = Werte vorläufig<br />
ca. 2,29<br />
Mrd. kWh<br />
ca. 2,36<br />
Mrd. kWh<br />
2,30<br />
Mrd. kWh<br />
2,40<br />
Mrd. kWh<br />
- 4,2 %<br />
Die als Fernwärme o<strong>der</strong> Prozesswärme exportierte Wärmemenge <strong>der</strong> NRW-<br />
Müllverbrennungsanlagen erreichte nach Angaben <strong>der</strong> Interessensgeme<strong>in</strong>schaft<br />
<strong>der</strong> thermischen Abfallbehandlungsanlagen <strong>in</strong> Deutschland (ITAD e.V.) im Jahr<br />
2011 <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e Größenordnung von 4,58 Mrd. kWh (2010: 4,73 Mrd. kWh)<br />
[24]. Unter Zugrundelegung des auch im Stromsektor angewendeten 50 Prozent-<br />
Anteils für biogenen Abfall liegt die als Referenzwert angenommene biogene<br />
Wärmemenge bei rd. 2,3 Mrd. kWh (Tabelle 4.20). Im Vergleich zum Vorjahr<br />
2010 ergibt sich damit e<strong>in</strong> Rückgang um etwa 4 Prozent (rd. 2,4 Mrd. kWh). Nach<br />
ITAD-E<strong>in</strong>schätzung ist <strong>der</strong> Rückgang auch auf die vergleichsweise milden W<strong>in</strong>termonate<br />
des vergangenen Jahres zurückzuführen [24].<br />
Marktentwicklung Müllverbrennungsanlagen<br />
Bis auf e<strong>in</strong>e Anlagenerweiterung im Jahr 2011 weist die Entwicklung im Bereich<br />
<strong>der</strong> von <strong>der</strong> ITAD erfassten Müllverbrennungsanlagen <strong>in</strong> den letzten Jahren ke<strong>in</strong>e<br />
Dynamik auf. Insgesamt umfasst <strong>der</strong> Bestand <strong>in</strong> NRW im Jahr 2011 wie <strong>in</strong> den<br />
Vorjahren <strong>in</strong>sgesamt 16 Anlagen. Angaben über die thermische Leistung <strong>der</strong> Anlagen<br />
s<strong>in</strong>d nicht bekannt.<br />
80
Nutzwärmeerzeugung aus Deponie- und Klärgas sowie flüssiger Biomasse<br />
<strong>Zur</strong> Vervollständigung <strong>der</strong> Statistiken im Wärmesektor werden im Rahmen <strong>der</strong><br />
vorliegenden Studie erstmals auch Daten für die Wärmebereitstellung <strong>in</strong> den<br />
Kategorien Klär- und Deponiegas sowie flüssige Biomasse über e<strong>in</strong>en<br />
Schätzansatz ermittelt. Bei <strong>der</strong> Deponie- und Klärgasnutzung werden dazu unter<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> erzeugten Strommenge, typischer Volllaststundenwerte,<br />
Nutzungsgrade und Annahmen zur <strong>in</strong>stallierten Leistung die bereitgestellten<br />
Nutzenergiemengen abgeschätzt. Bei <strong>der</strong> flüssigen Biomassenutzung wird die<br />
bereitgestellte Nutzenergie über die bei Referenzanlagen zu beobachtenden<br />
Verhältniszahlen zwischen Stromerzeugung und Wärmebereitstellung berechnet<br />
(Tabelle 4.21).<br />
Tabelle 4.21: Nutzwärmeerzeugung <strong>in</strong> den Bereichen Klär- und Deponiegas sowie<br />
flüssige Biomasse <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IT.NRW, IWR, IWR-Referenzwerte, eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Daten: IWR IWR-Referenzwerte<br />
Nutzwärme 2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Deponiegas n.b. n.b. 0,03 n.b. -<br />
Klärgas n.b. n.b. 0,16 n.b. -<br />
Flüssige Biomasse n.b. n.b. 0,33 n.b. -<br />
1 = Werte vorläufig<br />
Vorjahr<br />
81
4.2.3.2 Solarthermische Wärmeerzeugung und Marktentwicklung<br />
Nutzwärmeerzeugung aus Solarthermie erstmals über 500 Mio. kWh<br />
Tabelle 4.22: Solarthermie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: BAFA, IWR, IWR-Referenzwerte, z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Daten: BAFA, IWR IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Zubau Kollektorfläche 158.000 m 2 118.000 m 2 158.000 m 2 118.000 m 2 + 33,9 %<br />
NRW-Gesamtkollektorfläche<br />
(<strong>in</strong>kl. Absorber + sonst. Anlagen)<br />
Wärmeerzeugung<br />
Annahme: anlagentypische Produktionsfaktoren<br />
<strong>in</strong> kWh / m 2 Kollektorfläche<br />
1 = Werte vorläufig<br />
rd. 1,43 Mio.<br />
m 2<br />
0,46 – 0,56<br />
Mrd. kWh<br />
rd. 1,27 Mio.<br />
m 2<br />
0,41 – 0,49<br />
Mrd. kWh<br />
1,43 Mio. m 2 1,27 Mio. m 2 + 12,6 %<br />
0,51<br />
Mrd. kWh<br />
0,45<br />
Mrd. kWh<br />
+ 13,3 %<br />
Im Jahr 2011 wurde die NRW-Gesamtkollektorfläche um etwa 160.000 m 2 auf rd.<br />
1,41 Mio. m 2 ausgebaut. Bei anlagentypischen Produktionsfaktoren (Ertrag pro<br />
m 2 Kollektorfläche) ergibt sich für das Jahr 2011 e<strong>in</strong>e Ertragsbandbreite zwischen<br />
etwa 450 und 550 Mio. kWh. Zusätzlich werden <strong>in</strong> NRW durch Absorber (rd.<br />
17.000 m 2 ) etwa 5 Mio. kWh Solarwärme erzeugt. Die Gesamtwärmemenge aus<br />
Solarthermieanlagen <strong>in</strong> NRW erreicht damit e<strong>in</strong>e Größenordnung zwischen 460<br />
und 560 Mio. kWh. Für die solarthermisch erzeugte Wärme im Jahr 2011 wird auf<br />
dieser Basis e<strong>in</strong> IWR-Referenzwert von 510 Mio. kWh festgelegt (2010: 450 Mio.<br />
kWh) (Tabelle 4.22, Abbildung 4.34).<br />
1.800<br />
1.500<br />
1.200<br />
900<br />
600<br />
300<br />
0<br />
Kollektorfläche [Tsd. m 2 ] [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
Kollektorfläche [Tsd. m2] Wärme [Mrd. kWh]<br />
Quelle: IWR, Daten (* = vorläufig): Bezreg. Arnsberg, BAFA, IWR / eigene Berechnung<br />
Abbildung 4.34: Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten / geför<strong>der</strong>ten Gesamtkollektorfläche und<br />
Wärmeerzeugung im Bereich Solarthermie NT <strong>in</strong> NRW<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: Bezirksreg. Arnsberg, BAFA, IWR, eigene Berechnung, 2011<br />
vorläufig)<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
© IWR, 2012<br />
82
Solarthermiemarkt zieht 2011 wie<strong>der</strong> an – Bedeutung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung rückläufig<br />
Die Bedeutung von För<strong>der</strong>programmen auf Bundes- und Landesebene für den<br />
Solarthermiemarkt hat <strong>in</strong> den letzten Jahren abgenommen. 2011 wurden <strong>in</strong><br />
Deutschland Solarthermieanlagen mit e<strong>in</strong>er Gesamtkollektorfläche von rd.<br />
480.000 m 2 (rd. 336 MWth) über das Marktanreizprogramm (MAP) des Bundes<br />
geför<strong>der</strong>t. Davon entfallen rd. 61.000 m 2 auf NRW, was e<strong>in</strong>em Anteil von knapp<br />
13 Prozent entspricht.<br />
Insgesamt wurden <strong>in</strong> Deutschland nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft<br />
(BSW Solar) sowie des Bundes<strong>in</strong>dustrieverbandes Deutschland Haus-,<br />
Energie- und Umwelttechnik (BDH) 2011 Solarthermieanlagen mit e<strong>in</strong>er Gesamtkapazität<br />
von 1,27 Mio. m 2 (rd. 890 MWth) neu <strong>in</strong>stalliert. Im Vorjahresvergleich<br />
(rd. 1,15 Mio. m 2 Kollektorfläche) ergibt sich damit 2011 auf Bundesebene e<strong>in</strong><br />
Marktwachstum von etwa 10 Prozent. <strong>Zur</strong>ückzuführen ist die positive Marktentwicklung<br />
nach Angaben von Branchenteilnehmern <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie auf die stark<br />
gestiegenen Energiepreise.<br />
Unter <strong>der</strong> Annahme, dass sich <strong>der</strong> aus <strong>der</strong> MAP-För<strong>der</strong>ung für 2011 resultierende<br />
NRW-Anteil auch auf die bundesweit <strong>in</strong>stallierte Solarthermieleistung übertragen<br />
lässt, erreicht die neu <strong>in</strong>stallierte Kollektorfläche <strong>in</strong> NRW im Jahr 2011 etwa<br />
158.000 m 2 . Gegenüber dem Vorjahr 2010 entspricht das e<strong>in</strong>em Wachstum von<br />
etwa 34 Prozent (Abbildung 4.35). In Summe wird unter den dargestellten Annahmen<br />
Ende 2011 e<strong>in</strong>e NRW-Gesamtkollektorfläche von etwa 1,43 Mio. m 2 ermittelt<br />
(2010: 1,27 Mio. m 2 ).<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Kollektorfläche [Tsd. m 2 ]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten (vorläufig): Bezreg. Arnsberg, BAFA, eig. Berechnung<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 4.35: NRW-Marktentwicklung Solarthermie: Die jährlich neu <strong>in</strong>stallierte, bewilligte<br />
bzw. geför<strong>der</strong>te Kollektorfläche <strong>in</strong> den Jahren 2002 – 2011)<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: Bezirksreg. Arnsberg, BAFA, eigene Berechnung, 2011 vorläufig)<br />
83
4.2.3.3 Geothermische Nutzwärmeerzeugung und Marktentwicklung<br />
Tabelle 4.23: Oberflächennahe Geoenergie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: BWP, BMU, IWR, IWR-Referenzwerte, z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
Wärmepumpen (WP)<br />
gesamt<br />
Deutschland<br />
Daten: BWP, BMU, IWR<br />
NRW<br />
IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Zubau rd. 66.000 rd. 65.600 11.540 rd. 11.480 + 0,5 %<br />
Gesamtzahl n.b. n.b. - - -<br />
Wärmeerzeugung n.b. n.b. - - -<br />
Heizungs-WP 2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Zubau rd. 57.000 rd. 57.200 rd. 10.000 rd. 10.000 +/- 0 %<br />
Gesamtzahl 484.000 rd. 427.000 84.700 rd. 74.700 + 13,4 %<br />
Heizwärmemenge<br />
Annahme: typische Anlagengrößen<br />
und Volllaststunden<br />
davon Wärme regenerativ<br />
8,8 Mrd. kWh.<br />
6,0 Mrd. kWh<br />
7,8 Mrd. kWh<br />
5,3 Mrd. kWh<br />
1,6 Mrd. kWh<br />
1,1 Mrd. kWh<br />
1,4 Mrd. kWh<br />
1,0 Mrd. kWh<br />
+ 14,3 %<br />
+ 10,0 %<br />
Stand Warmwasser-WP 2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Zubau rd. 8.900 rd. 8.400 rd. 1.540 rd. 1.450 + 6,2 %<br />
Gesamtzahl n.b. n.b. - - -<br />
Wärmeerzeugung n.b. n.b. - - -<br />
1 = Werte vorläufig<br />
Die Ermittlung des Wärmepumpen-Bestandes und <strong>der</strong> Marktentwicklung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
erfolgt auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Bundeswerte sowie NRW-spezifischer<br />
Regionalfaktoren. Im Jahr 2011 ergibt sich unter diesen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen im<br />
Segment <strong>der</strong> schwerpunktmäßig betrachteten Heizungswärmepumpen e<strong>in</strong> Gesamtbestand<br />
von fast 85.000 Anlagen. Bei e<strong>in</strong>em ganzjährigen Betrieb <strong>der</strong> Anlagen<br />
liegt die theoretische Gesamtwärmeerzeugung <strong>der</strong> Anlagen im Mittel bei etwa<br />
1,59 Mrd. kWh (2010: 1,39 Mrd. kWh). Dieser Wärmemengenwert umfasst<br />
sowohl den regenerativ erzeugten Wärmeanteil sowie die Wärmemenge, die auf<br />
die Zufuhr von Hilfsenergie (Strom) zurückgeht. Zwecks Vergleichbarkeit mit den<br />
für Deutschland veröffentlichten Gesamtdaten wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> vorliegenden Studie die<br />
regenerativ erzeugte Wärmemenge neben <strong>der</strong> Gesamtwärmemenge separat<br />
ausgewiesen und <strong>in</strong> die regenerative Bilanzierung aufgenommen. <strong>Zur</strong> Ermittlung<br />
<strong>der</strong> auf die Bereitstellung von Hilfsenergie (Strom) zurückzuführenden Wärme-<br />
84
mengen, werden für den NRW-Bestand Jahresarbeitszahlen unterstellt, wie sie<br />
auch auf Bundesebene angenommen werden [39], [40]. Unter diesen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
wird für 2011 e<strong>in</strong>e mittlere regenerative Wärmemenge von 1,1 Mrd.<br />
kWh (2010: rd. 1 Mrd. kWh) berechnet. Im Jahresvergleich ergibt sich für die regenerative<br />
Wärme damit im Segment <strong>der</strong> Heizungswärmepumpen auf NRW-<br />
Ebene e<strong>in</strong> Wachstum von etwa 10 Prozent (Tabelle 4.23, Abbildung 4.36). 4<br />
90.000<br />
80.000<br />
70.000<br />
60.000<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
0<br />
[Anlagenzahl] [Mrd. kWh]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
Anlagenzahl Wärme gesamt [Mrd. kWh] Wärme regenerativ [Mrd. kWh]<br />
Quelle: IWR, Daten (* = vorläufig): BWP, TZWL, IWR / eigene Berechnung / Schätzung: IWR<br />
Abbildung 4.36: Entwicklung <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Anlagenzahlen und Wärmeerzeugung im<br />
Bereich Heizungs-Wärmepumpen / Wärmepumpen <strong>in</strong> Wohnungslüftungsgeräten<br />
<strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012,Daten: BWP, TZWL, IWR, eigene Be-<br />
rechnung, 2011 vorläufig)<br />
Wärmepumpenmarkt 2011 – steigende Energiepreise stützen Marktentwicklung<br />
Im Jahr 2011 wurden <strong>in</strong> Deutschland etwa 57.000 Heizungswärmepumpen abgesetzt.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr 2010 (rd. 51.000 Anlagen) entspricht das e<strong>in</strong>em<br />
Zuwachs von knapp 12 Prozent. Unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>der</strong> gut 8.900 ausschließlich<br />
zur Warmwassererwärmung genutzten Brauchwasserwärmpumpen, die 2011<br />
verkauft wurden, ergibt sich e<strong>in</strong> Gesamtabsatz von rd. 66.000 Wärmepumpen<br />
(2010: rd. 60.000 Anlagen, davon 51.000 Heizungswärmepumpen, 8.400<br />
Brauchwasserwärmepumpen) [41], [42]. Ursächlich zurückzuführen ist das<br />
Wachstum des Wärmepumpensektors nach Angaben von Branchenvertretern<br />
2011 vor allem auf e<strong>in</strong>en anhaltenden Boom bei Luft-/Wasserwärmepumpen.<br />
Während die Absatzzahlen bei Erdwärmepumpen 2011 nur unwesentlich höher<br />
lagen als 2010, ergibt sich bei Luft-Wärmepumpen e<strong>in</strong> Marktwachstum von fast<br />
22 Prozent.<br />
Der NRW-spezifische Wärmepumpenanteil wird unter Verwendung von NRW-<br />
Regionalfaktoren über den bundesweiten Gesamtbestand Ende 2011 bzw. den<br />
4 Das Segment <strong>der</strong> Brauchwasser-Wärmepumpen ist <strong>in</strong> den Wärmemengendaten nicht enthalten, da für diese Systeme ke<strong>in</strong>e<br />
Zeitreihendaten auf Bundes- und Landesebene vorliegen. NRW-Anlagen aus dieser Kategorie gehen daher bislang auch nicht<br />
<strong>in</strong> die NRW-Wärmebilanz mit e<strong>in</strong>.<br />
1,8<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
© IWR, 2012<br />
85
Jahreszubau 2011 bestimmt [43], [44]. Dabei ergibt sich e<strong>in</strong> mittlerer NRW-<br />
Gesamtbestand von rd. 85.000 Anlagen bzw. e<strong>in</strong> Zubau von etwa 10.000 Anlagen.<br />
Abbildung 4.37 zeigt e<strong>in</strong>en Überblick über die Entwicklung des Wärmepumpenzubaus<br />
<strong>in</strong> NRW im Zeitraum 2002 – 2011 (ohne Warmwasserwärmepumpen).<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
Anlagenzahl<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: BWP, TZWL, eigene Berechnung, * = vorläufig<br />
Abbildung 4.37: NRW-Marktentwicklung Wärmepumpen: Die jährlich neu <strong>in</strong>stallierten<br />
Anlagen <strong>in</strong> den Jahren 2002 – 2011 (Quelle: IWR, 2012, Daten: BWP, TWZL,<br />
eigene Berechnung / Schätzung, 2011 vorläufig)<br />
© IWR, 2012<br />
86
4.2.3.4 Nutzwärmebereitstellung aus Grubengas<br />
Tabelle 4.24: Grubengas <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr 2011<br />
(thermische Nutzung)<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: Bezirksregierung Arnsberg)<br />
Wärmeerzeugung aus<br />
Grubengas<br />
1 = Werte vorläufig<br />
Daten: Bezreg. Arnsberg IWR-Referenzwerte<br />
2011 1 2010 2011 1 2010 Veränd.<br />
ca. 0,11<br />
Mrd. kWh<br />
ca. 0,12<br />
Mrd. kWh<br />
0,11<br />
Mrd. kWh<br />
0,12<br />
Mrd. kWh<br />
Vorjahr<br />
- 8,3 %<br />
An den NRW-Grubengasstandorten beläuft sich die Wärmeabgabe im Jahr 2011<br />
auf etwa 110 Mio. kWh. Im Vergleich zu 2010 (120 Mio. kWh) entspricht das e<strong>in</strong>em<br />
Rückgang von 8 Prozent (Tabelle 4.24) [37]. Damit setzt sich wie bei <strong>der</strong><br />
Stromerzeugung aus Grubengas <strong>der</strong> rückläufige Trend weiter fort. Um die bei <strong>der</strong><br />
Grubengasverstromung anfallende Wärme nutzen zu können, s<strong>in</strong>d entsprechende<br />
Leitungs<strong>in</strong>frastrukturen und Abnahmekonzepte erfor<strong>der</strong>lich. Aufgrund <strong>der</strong> Dezentralität<br />
<strong>der</strong> Grubengasstandorte und vor Ort fehlen<strong>der</strong> Abnehmer kann die anfallende<br />
Wärme <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen nur zum Teil genutzt werden. H<strong>in</strong>sichtlich<br />
<strong>der</strong> Infrastrukturausstattung s<strong>in</strong>d die Grubengasstandorte im Saarland besser<br />
gestellt. Hier können die Nutzer des Grubengases auf e<strong>in</strong> historisch gewachsenes<br />
Leitungsnetz zurückgreifen, über das die e<strong>in</strong>zelnen Standorte mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
vernetzt s<strong>in</strong>d (Abbildung 4.38). Dadurch ist es e<strong>in</strong>facher möglich, Grubengas dem<br />
Bedarf entsprechend zentral energetisch zu verwerten und die anfallende Wärme<br />
besser zu nutzen und gezielter abzugeben (Abbildung 4.38).<br />
Abbildung 4.38: Das Grubengasnetz im Saarland (Quelle: STEAG AG, Stand: Oktober 2011)<br />
87
4.2.4 Regenerative Treibstoffproduktion <strong>in</strong> NRW<br />
Die regenerative Treibstoffproduktion <strong>in</strong> NRW f<strong>in</strong>det im Jahr 2011 nur noch im<br />
Biodiesel-Sektor statt, die Produktion von Bioethanol (Absolutierung 5 ) wurde dagegen<br />
e<strong>in</strong>gestellt (Tabelle 4.25). Für die Hersteller von Biodiesel bleibt die Beimischung<br />
<strong>der</strong> zentrale Absatzweg, da <strong>der</strong> Vertrieb von Biodiesel als Re<strong>in</strong>kraftstoff<br />
(B 100) <strong>in</strong> NRW wie auch <strong>in</strong> Deutschland im Jahr 2011 weiter rückläufig ist.<br />
Tabelle 4.25: Biogene Treibstoffproduktion <strong>in</strong> NRW 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
2011 1 2010 Veränd. Vorjahr<br />
Biodiesel ca. 352.000 t ca. 378.000 t - 6,9 %<br />
Pflanzenöl n.b. n.b. -<br />
Bioethanol - - -<br />
Gesamt ca. 352.000t ca. 378.000 t - 6,9 %<br />
1 = Werte vorläufig<br />
NRW-Biodieselproduktion fällt weiter<br />
Die Produktion von Biodiesel <strong>in</strong> NRW ist 2011 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 7<br />
Prozent auf rd. 350.000 t gesunken (2010: rd. 380.000 t). Der <strong>in</strong> den Vorjahren<br />
zu beobachtende Abwärtstrend setzt sich somit weiter fort (Tabelle 4.25). Nachdem<br />
sich 2010 noch e<strong>in</strong>e Stabilisierung des Produktionsniveaus andeutete, hat<br />
sich <strong>der</strong> Rückgang <strong>der</strong> Produktion 2011 wie<strong>der</strong> verstärkt (Abbildung 4.39).<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
Biodieselproduktion [t]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Abbildung 4.39: Entwicklung <strong>der</strong> Biodieselproduktion <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012)<br />
© IWR, 2012<br />
5 Absolutierung bezeichnet die absolute Re<strong>in</strong>igung e<strong>in</strong>es Lösungsmittels (Bioethanol) auf e<strong>in</strong>en Re<strong>in</strong>heitsgrad von 100 Prozent.<br />
Im Fall des Bioethanols bedeutet Absolutierung die Entnahme des noch vorhandenen Wassers.<br />
88
In Deutschland ist die Produktion von Biodiesel im Jahr 2011 nicht weiter zurückgegangen.<br />
Die bundesweit hergestellte Biodieselmenge erreicht 2011 wie im Vorjahr<br />
e<strong>in</strong>en Wert von rd. 2,8 Mio. t. Aufgrund des Produktionsrückgangs <strong>in</strong> NRW<br />
s<strong>in</strong>kt <strong>der</strong> NRW-Anteil an <strong>der</strong> bundesweiten Produktion damit von rd. 13,5 Prozent<br />
(2010) auf rd. 12,5 Prozent (2011).<br />
Biodieselbranche leidet unter schwierigen Marktbed<strong>in</strong>gungen<br />
Die Produktionskapazitäten für Biodiesel <strong>in</strong> Deutschland s<strong>in</strong>d nach <strong>der</strong> Stagnation<br />
<strong>der</strong> Vorjahre im Jahr 2011 erstmals zurückgegangen. Dabei wurden teilweise<br />
bereits nicht mehr <strong>in</strong> Betrieb bef<strong>in</strong>dliche Anlagen stillgelegt. In NRW s<strong>in</strong>kt die gesamte<br />
Produktionskapazität von rd. 705.000 t auf rd. 585.000 t (- 17 Prozent). Im<br />
gesamten Bundesgebiet fällt <strong>der</strong> Rückgang mit e<strong>in</strong>em M<strong>in</strong>us von rd. 29 Prozent<br />
auf rd. 3,6 Mio. t noch deutlicher aus (2010: rd. 5 Mio. t). Der NRW-Anteil an den<br />
Produktionskapazitäten <strong>in</strong> Deutschland liegt damit 2011 bei knapp 20 Prozent<br />
(Tabelle 4.26).<br />
Tabelle 4.26: Entwicklung <strong>der</strong> Biodieselproduktionskapazitäten <strong>in</strong> NRW und<br />
Deutschland (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, UFOP, eigene Erhebung)<br />
Jahreszubau / Erweiterung<br />
Produktionskapazitäten [t]<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
2011 1 2010 2009 2008 2007<br />
-120.000 0 0 0 120.000<br />
NRW-Standorte gesamt 4 5 5 5 5<br />
Produktionskapazität gesamt [t] 585.000 2 ca. 705.000 2 ca. 700.000 705.000 705.000<br />
Jahreszubau / Erweiterung<br />
Produktionskapazitäten [t]<br />
Deutschland<br />
2011 1 2010 2009 2008 2007<br />
-1.445.000 - - rd. 270.000 817.000<br />
Produktionskapazität gesamt [t] ca. 3.550.000 2 ca. 5.000.000 ca. 5.000.000 5.000.000 4.732.500<br />
1 = Werte vorläufig, 2= Produktionskapazitäten z.T. nicht mehr <strong>in</strong> Betrieb<br />
Bezogen auf die produzierte Menge erreichen die NRW-Hersteller 2011 e<strong>in</strong>en<br />
Auslastungsgrad von rd. 60 Prozent. Insbeson<strong>der</strong>e das nahezu vollständige Erliegen<br />
des Marktes für Biodiesel <strong>in</strong> Re<strong>in</strong>form belastet die Branche deutschlandweit<br />
und <strong>in</strong> NRW. So wurden <strong>in</strong> Deutschland nach knapp 300.000 t im Jahr 2010<br />
im letzten Jahr nur noch knapp 100.000 t Biodiesel abgesetzt. Dagegen bleibt<br />
<strong>der</strong> Markt für die Beimischung von Biodiesel <strong>in</strong> Deutschland mit etwa 2,3 Mio. t<br />
stabil, so dass sich e<strong>in</strong> gesamter Biodieselabsatz von etwa 2,4 Mio. t ergibt. Der<br />
vor dem Zusammenbruch des B100-Marktes an rd. 270 NRW-Tankstellen angebotene<br />
Biodiesel bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> NRW nur noch sporadisch im Angebot.<br />
89
Zudem gilt seit Jahresbeg<strong>in</strong>n 2011 <strong>in</strong> Deutschland die Nachhaltigkeitsverordnung<br />
für Biotreibstoffe. Biodieselproduzenten, die auf Basis von pflanzlichen Ölen produzieren<br />
(Raps-Methyl-Ester), stehen dadurch vor verschärften Produktionsbed<strong>in</strong>gungen.<br />
So ist nun <strong>der</strong> Nachweis zu erbr<strong>in</strong>gen, dass bei <strong>der</strong> Produktion von<br />
Biodiesel gegenüber fossilen Brennstoffen CO2-Emissionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung<br />
von m<strong>in</strong>destens 35 Prozent e<strong>in</strong>gespart werden. Diese Vorgabe betrifft den<br />
gesamten Produktionsprozess vom Pflanzenanbau, über Düngung und Ernte bis<br />
h<strong>in</strong> zur Verarbeitung. Hersteller von Biodiesel auf Basis von Altspeisefetten können<br />
diesen Nachweis leichter führen, da Produktionsstufen wie Pflanzenanbau,<br />
Düngung und Ernte nicht <strong>in</strong> die Bilanzierung mit e<strong>in</strong>fließen. NRW-Hersteller, die<br />
abfallbasierten Biodiesel anbieten, blicken dabei auch auf e<strong>in</strong>e bessere Geschäftslage<br />
2011 zurück als die Anbieter von Biodiesel auf Rapsbasis.<br />
Bioethanol-Produktion <strong>in</strong> NRW e<strong>in</strong>gestellt<br />
Der <strong>in</strong> NRW ansässige Hersteller für Bioethanol (Absolutierung) hat die Produktion<br />
<strong>in</strong> NRW im Jahr 2011 e<strong>in</strong>gestellt. Grund für die Stilllegung <strong>der</strong> Anlage mit e<strong>in</strong>er<br />
Kapazität von 60.000 t/Jahr ist die mangelnde Wirtschaftlichkeit. Deutschlandweit<br />
s<strong>in</strong>d nach dem Wegfall <strong>der</strong> Anlage <strong>in</strong> NRW 13 Produktionsstätten mit e<strong>in</strong>er<br />
Gesamtkapazität von rd. 925.000 t/Jahr <strong>in</strong> Betrieb.<br />
In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bieten von den knapp 3.000 Tankstellen rd. 40 den Bioethanol-Kraftstoff<br />
E85 an. Nach e<strong>in</strong>er schwierigen Markte<strong>in</strong>führungsphase von<br />
E10 zu Beg<strong>in</strong>n des Jahres 2011 gehört dieser Treibstoff <strong>in</strong> NRW mittlerweile flächendeckend<br />
zum Portfolio <strong>der</strong> Tankstellenbetreiber. Bis Mitte des Jahres haben<br />
e<strong>in</strong>er Umfrage von TNS Infratest zufolge deutschlandweit rd. e<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong><br />
Haushalte mit e<strong>in</strong>em Benz<strong>in</strong>-Pkw schon e<strong>in</strong>mal Super E10 getankt. Die <strong>Zur</strong>ückhaltung<br />
<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Haushalte wird zumeist mit technischen Bedenken begründet<br />
[45].<br />
Tabelle 4.27 gibt e<strong>in</strong>en zusammenfassenden Überblick über den Status quo des<br />
regenerativen Treibstoffmarktes <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.<br />
Tabelle 4.27: Der regenerative Treibstoffsektor <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>in</strong> den<br />
Jahren 2011 / 2010 im Überblick (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, eigene Erhebung)<br />
regenerativer Treibstoffsektor<br />
NRW<br />
Produktion Kapazitäten<br />
2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr.<br />
2011 1 2010 Veränd.<br />
Vorjahr<br />
Biodieselproduktion ca. 352.000 t ca. 378.000 t - 6,9 % ca. 600.000 t ca. 700.000 t - 14,3 %<br />
Pflanzenölproduktion n.b. n.b. - n.b. n.b. -<br />
Bioethanol ca. 0 t ca. 0 t - ca. 0 t ca. 60.000 t - 100 %<br />
Gesamt ca. 352.000 t ca. 378.000 t - 6,9 % ca. 600.000 t ca. 765.000 t - 21,6 %<br />
1 = Werte vorläufig<br />
90
4.2.5 Status quo: EE-Ausbautrends <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Überblick<br />
Tabelle 4.28: Gesamtüberblick: Trends Marktentwicklung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
im Jahr 2011 (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Stromerzeugung 2011<br />
Reg. Technik Kapazität Energieerzeugung Bemerkung<br />
W<strong>in</strong>denergie<br />
Biomasseheiz(kraft)werke<br />
Biogas<br />
Deponiegas<br />
Klärgas<br />
biog. Abfall<br />
flüssige Biomasse<br />
Photovoltaik<br />
Wasserkraft<br />
Grubengas<br />
Wärmebereitstellung 2011<br />
gutes W<strong>in</strong>djahr 2011<br />
Marktstagnation<br />
dynamischer Markt<br />
Rückgang Deponiegas<br />
Marktstagnation<br />
Marktstagnation<br />
Markte<strong>in</strong>bruch: Rohstoffpreise,<br />
Nachhaltigkeitsverordnung<br />
Boom PV-Markt<br />
Ger<strong>in</strong>ges Marktvolumen,<br />
schwaches Wasserjahr<br />
Rückgang Grubengas<br />
Reg. Technik Kapazität Energieerzeugung Bemerkung<br />
Biomasseheiz(kraft)werke<br />
Holzheizungen<br />
(Hafö, MAP)<br />
E<strong>in</strong>zelfeuerstätten<br />
Biogas<br />
biog. Abfall<br />
Klärgas<br />
Deponiegas<br />
flüssige Biomasse<br />
Solarthermie<br />
Geothermie<br />
Grubengas<br />
Biogene Treibstoffproduktion 2011<br />
Reg. Technik Kapazität Treibstofferzeugung Bemerkung<br />
Biodiesel<br />
Bioethanol<br />
ger<strong>in</strong>ge Marktdynamik<br />
ger<strong>in</strong>ge Marktdynamik<br />
ger<strong>in</strong>ge Marktdynamik<br />
dynamischer Markt<br />
Marktstagnation<br />
Marktstagnation<br />
Rückgang Deponiegas<br />
Markte<strong>in</strong>bruch: Rohstoffpreise,<br />
Nachhaltigkeitsverordnung<br />
stabilisierter Markt<br />
stabiler Markt<br />
Rückgang Grubengas<br />
Produktionsrückgang<br />
Produktion e<strong>in</strong>gestellt<br />
91
4.3 CO2-Emissionen und Klimaschutz<br />
4.3.1 Klimaschutz auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene<br />
4.3.1.1 Entwicklung <strong>der</strong> weltweiten CO2-Emissionen 2011<br />
2011 hat sich <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> weltweiten CO2-Emissionen nach dem zwischenzeitlichen<br />
Rückgang <strong>in</strong>folge <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 aufgrund<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong>ternationalen wirtschaftlichen Erholung auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene<br />
weiter fortgesetzt. Weltweit haben die Emissionen um knapp 3 Prozent auf 34,0<br />
Mrd. t CO2 zugenommen (2010: rd. 33,2 Mrd. t CO2). Gegenüber dem ursprünglichen<br />
Kyoto-Basiswert für die Emissions-Reduktion aus dem Jahr 1990 legten die<br />
globalen CO2-Emissionen um fast 50 Prozent zu. Der Anstieg <strong>der</strong> CO2-<br />
Emissionen korrespondiert mit <strong>der</strong> stabileren <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> Weltwirtschaft, wobei vor<br />
allem <strong>in</strong> Schwellenlän<strong>der</strong>n wie Ch<strong>in</strong>a o<strong>der</strong> Indien hohe Zuwächse zu verzeichnen<br />
s<strong>in</strong>d. Asien und <strong>der</strong> mittlere Osten weisen <strong>in</strong> <strong>der</strong> regionalen Differenzierung im<br />
Jahr 2011 dementsprechend den höchsten prozentualen CO2-Anstieg im Vergleich<br />
zum Vorjahr auf, gefolgt von Südamerika und Afrika.<br />
Größter CO2-Emittent ist Ch<strong>in</strong>a, dessen CO2-Ausstoß 2011 um rd. 7 Prozent auf<br />
rd. 8,9 Mrd. t angestiegen ist. Auf dem zweiten Rang liegen mit 6 Mrd. t (- 2 Prozent)<br />
die USA, vor Indien mit 1,8 Mrd. t (+ 5,0 Prozent), Russland mit 1,7 Mrd. t (-<br />
1,5 Prozent) und Japan mit 1,3 Mrd. t (+ 0,2 Prozent). In Deutschland s<strong>in</strong>d die<br />
Emissionen 2011, begünstigt durch e<strong>in</strong>e milde Witterung, um etwa 3 Prozent auf<br />
0,8 Mrd. t gesunken [4]. Damit rangiert Deutschland h<strong>in</strong>ter Japan auf dem sechsten<br />
Rang unter den weltweit größten CO2-Emittenten (Tabelle 4.29).<br />
Tabelle 4.29: Top 10-Län<strong>der</strong> nach CO2-Emissionen im Jahr 2011 und 2010<br />
(Quelle: IWR 2012, Daten: BP, BMWi)<br />
Land 2011 CO2 [Mio. t] 2010 CO2 [Mio. t] 1990 CO2 [Mio. t] Reale Än<strong>der</strong>ung<br />
1990 – 2011 [%]<br />
Welt 33.992 33.158 22.682 + 49,9<br />
1. Ch<strong>in</strong>a 8.876 8.333 2.452 + 262,0<br />
2. USA 6.027 6.145 5.461 + 10,4<br />
3. Indien 1.787 1.708 626 + 185,5<br />
4. Russland 1.674 1.700 2.369 - 29,3<br />
5. Japan 1.311 1.308 1.179 + 11,2<br />
6. Deutschland 804 828 1.029 - 21,9<br />
7. Südkorea 739 716 257 + 187,5<br />
8. Kanada 628 605 485 + 29,5<br />
9. Saudi Arabien 609 563 242 + 151,7<br />
10. Iran 598 558 199 + 200,5<br />
92
4.3.1.2 Internationaler und nationaler Klimaschutz – Stand und Instrumente<br />
Im Jahr 2011 ist die <strong>in</strong>ternationale Staatengeme<strong>in</strong>schaft bei den Bemühungen<br />
um den <strong>in</strong>ternationalen Klimaschutz auf <strong>der</strong> Stelle getreten. Die 17. UN-<br />
Klimakonferenz im südafrikanischen Durban ist im Dezember 2011 ohne e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>igung<br />
auf e<strong>in</strong> Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll zu Ende gegangen.<br />
Zwar haben die Vertragsstaaten e<strong>in</strong>e Fortsetzung des Abkommens mit neuen<br />
Klimazielen vere<strong>in</strong>bart. E<strong>in</strong> neues verb<strong>in</strong>dliches Abkommen für alle Staaten soll<br />
demnach bis 2015 ausgehandelt werden. Dieses Abkommen, an dem diesmal<br />
auch Ch<strong>in</strong>a und die USA teilnehmen wollen, soll jedoch erst 2020 <strong>in</strong> Kraft treten.<br />
In Bonn wurde im Vorfeld <strong>der</strong> nächsten Klimakonferenz <strong>in</strong> Rio (Dezember 2012)<br />
im Mai 2012 <strong>der</strong> Verhandlungsprozess für das neue Abkommen auf den Weg<br />
gebracht und e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>igung über e<strong>in</strong>e grobe Verhandlungsagenda ausgehandelt.<br />
Es bestehen jedoch im H<strong>in</strong>blick auf künftige Reduktionsziele zwischen den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Län<strong>der</strong>gruppen weiter Differenzen. Klimaschützer for<strong>der</strong>n von <strong>der</strong> EU,<br />
dass sie ihr 20 Prozent-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsziel erhöht und sich Ende des Jahres auf e<strong>in</strong><br />
30 Prozent-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsziel bis zum Jahr 2020 verpflichtet. Nur so könne Druck<br />
auf Industriestaaten ausgeübt werden, die sich Zielvorgaben zur Emissionsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
gegenüber bislang verweigert haben.<br />
Innerhalb <strong>der</strong> EU hatten sich die Mitgliedsstaaten bereits Ende 2008 auf e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tegrierte<br />
Energie- und Klimaschutz-Strategie verständigt. Die Treibhausgasemissionen<br />
sollen demzufolge bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent gesenkt werden.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus stellten die Staaten e<strong>in</strong> M<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsziel von 30 Prozent für den<br />
Fall <strong>in</strong> Aussicht, dass es e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternationale E<strong>in</strong>igung auf e<strong>in</strong> Klimaschutzregime<br />
gibt. Zuvor wurde <strong>in</strong> Europa bereits das Emissionshandelssystem als zentrales<br />
Klimaschutz<strong>in</strong>strument umgesetzt. Zum Start <strong>der</strong> zweiten Handelsperiode im<br />
Jahr 2008 lagen die Preise für CO2-Emissionsberechtigungen am Spotmarkt <strong>der</strong><br />
EEX bei rd. 22 Euro / t. Seitdem haben die Preise jedoch deutlich nachgegeben.<br />
Ende August 2012 lagen sie nur noch bei rd. 8 Euro / t (Abbildung 4.40).<br />
Abbildung 4.40: Preisentwicklung <strong>der</strong> CO2-Emissionsberechtigungen am Spotmarkt <strong>der</strong><br />
EEX <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Handelsperiode von 2008 bis 2012<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: EEX)<br />
93
Die deutsche Bundesregierung hat durch die E<strong>in</strong>führung des Energie- und Klimaschutzprogramms<br />
bereits <strong>in</strong> den Jahren 2007 und 2009 die Verabschiedung<br />
verschiedener gesetzlicher Regelungen vorbereitet, um die CO2-Emissionen bis<br />
zum Jahr 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 zu senken.<br />
Die NRW-Landesregierung hat im Juni 2011 erstmalig <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong> Klimaschutzgesetz<br />
mit verb<strong>in</strong>dlichen Klimaschutzzielen beschlossen. 6 Demnach sollen<br />
die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 25 Prozent und bis 2050 um<br />
m<strong>in</strong>destens 80 Prozent gesenkt werden. Die konkreten Maßnahmen zur Erreichung<br />
<strong>der</strong> Klimaschutzziele werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em separaten Klimaschutzplan festgeschrieben.<br />
Anfang Oktober 2011 hat das Kab<strong>in</strong>ett zusätzlich das Klimaschutz-<br />
StartProgramm beschlossen und damit bereits vor <strong>der</strong> Fertigstellung des Klimaschutzplans<br />
wichtige Klimaschutz-Maßnahmen auf den Weg gebracht.<br />
Angesichts weiter steigen<strong>der</strong> CO2-Emissionen und dem Dissens <strong>der</strong> Staaten zur<br />
Verabschiedung e<strong>in</strong>es Abkommens mit verb<strong>in</strong>dlichen CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ungszielen,<br />
steht die Fortschreibung des Kyoto-Protokolls mit den Unterzeichnerstaaten<br />
<strong>der</strong>zeit zur Debatte. So verkündete z.B. Kanada als e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> größten CO2-<br />
Emittenten bereits das Ausscheiden aus dem Kyoto-Prozess. Klimaschutz<strong>in</strong>strumente,<br />
die wie Kyoto auf die Beschränkung und Sanktionierung von Emissionen<br />
setzen, dom<strong>in</strong>ieren zwar die <strong>in</strong>ternationale Debatte, bieten jedoch kaum Ansätze<br />
für die E<strong>in</strong>igung auf e<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternational verb<strong>in</strong>dliches Abkommen. Alternativ könnte<br />
e<strong>in</strong> Modell, bei dem die CO2-Staaten nicht an den Pranger gestellt werden, son<strong>der</strong>n<br />
die CO2-Reduzierungen e<strong>in</strong>es Landes verursachergerecht an Investitionen<br />
<strong>in</strong> CO2-freie Energietechniken gekoppelt werden, den Stillstand beenden.<br />
Der CERINA-Plan (CO2 Emissions and Renewable Investment Action Plan)<br />
ist e<strong>in</strong> Beispiel für e<strong>in</strong>en <strong>der</strong>artigen Ansatz. Er basiert auf <strong>der</strong> Grundlage, dass<br />
sich die erfor<strong>der</strong>lichen EE-Investitionen e<strong>in</strong>es Landes nach <strong>der</strong> Höhe des jeweiligen<br />
CO2-Ausstoßes richten. Das bedeutet, je höher die CO2-Emissionen e<strong>in</strong>es<br />
Landes s<strong>in</strong>d, umso höher s<strong>in</strong>d auch die erfor<strong>der</strong>lichen Investitionen <strong>in</strong> regenerative<br />
Energietechniken. Anhand <strong>der</strong> CO2-Emissionen können so für jedes Land die<br />
spezifischen Investitionen <strong>in</strong> EE-Techniken bestimmt werden. Nach Berechnungen<br />
des IWR s<strong>in</strong>d zur Stabilisierung <strong>der</strong> globalen CO2-Emissionen jährliche Investitionen<br />
zwischen 500 und 600 Mrd. Euro notwendig. Dem stehen 2011 global<br />
reale EE-Investitionen von 170 Mrd. Euro (2010: 140 Mrd. Euro) gegenüber. Im<br />
Vergleich zu den bestehenden CO2-Begrenzungs-Modellen bietet <strong>der</strong> Ansatz auf<br />
<strong>der</strong> Basis von CO2-abhängigen Investitionen den Staaten die Wahlmöglichkeit,<br />
die Emissionen zu senken o<strong>der</strong> die EE-Investitionen zu erhöhen. Die Belastung<br />
für Län<strong>der</strong> mit ger<strong>in</strong>gem CO2-Ausstoß fällt zudem deutlich niedriger aus als für<br />
Län<strong>der</strong> mit hohen Emissionen [47].<br />
E<strong>in</strong> weiteres Beispiel für Klimaschutz<strong>in</strong>itiativen ist das von US-Präsident Obama<br />
<strong>in</strong>s Leben gerufene Major Economies Forum (MEF) bzw. das darauf aufbauende<br />
Clean Energy M<strong>in</strong>isterial (CEM). Ziel ist es, durch Technologie-<br />
Kooperationen und Jo<strong>in</strong>t Ventures zu e<strong>in</strong>er schnelleren Verbreitung von EE-<br />
Technologien und kohlenstoffarmer Technik beizutragen. Neben den G8-Staaten<br />
nehmen die wichtigsten Schwellenlän<strong>der</strong> daran teil [48], [49].<br />
6 Aufgrund <strong>der</strong> Auflösung des Landtages und den folgenden Neuwahlen wurde <strong>der</strong> Entwurf des Klimaschutzgesetzes NRW<br />
Ende Juni 2012 erneut von <strong>der</strong> Landesregierung <strong>in</strong> den Landtag e<strong>in</strong>gebracht (Landtags-Drucksache 16/127).<br />
94
4.3.1.3 Zum <strong>in</strong>ternationalen Stand von CDM- und JI-Projekten<br />
Im Rahmen des Kyoto-Protokolls können Industriestaaten durch die sog. Flexiblen<br />
Mechanismen ihre Verpflichtungen zur Emissionsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung nachkommen.<br />
Die Anzahl <strong>der</strong> weltweit registrierten und damit nach dem Kyoto-Protokoll freigegebenen<br />
Clean Development Mechanism (CDM)-Vorhaben im Bereich erneuerbare<br />
Energien / Deponie- und Grubengas, die Industriestaaten <strong>in</strong> Entwicklungslän<strong>der</strong>n<br />
durchführen, umfasste Ende 2011 über 2.700 Vorhaben (Tabelle 4.30).<br />
Tabelle 4.30: Verteilung <strong>der</strong> registrierten CDM-Projekte nach regenerativen Energiesparten<br />
(Quelle: IWR 2012, Daten: UNFCCC / Risø, 2012)<br />
2011 2010 Än<strong>der</strong>ung zum Vorjahr<br />
[abs.] [%] [abs.] [%] [%]<br />
Wasserkraft 1.114 40,9 801 42,3 + 39,1<br />
W<strong>in</strong>denergie 870 31,9 515 27,2 + 68,9<br />
Bioenergie 399 14,6 318 16,8 + 25,5<br />
Deponiegas 217 8,0 179 9,5 + 21,2<br />
Solar 60 2,2 30 1,6 + 100,0<br />
Grubengas 53 1,9 37 1,9 + 43,2<br />
Geothermie 12 0,4 11 0,6 + 9,1<br />
Gezeitenenergie 1 0,04 1 0,1 +/- 0,0<br />
Gesamt 2.726 100,0 1.892 100,0 + 44,1<br />
Jo<strong>in</strong>t Implementation (JI)-Projekte s<strong>in</strong>d Vorhaben, die zwischen Industriestaaten<br />
abgewickelt werden. Das Portfolio <strong>der</strong> registrierten JI-Vorhaben umfasste <strong>in</strong><br />
den Bereichen erneuerbare Energien / Deponie- und Grubengas Ende 2011<br />
weltweit rd. 160 Projekte (Tabelle 4.31).<br />
Tabelle 4.31: Verteilung <strong>der</strong> registrierten JI-Projekte nach regenerativen Energiesparten<br />
(Quelle: IWR 2012, Daten: UNFCCC / Risø, 2012)<br />
2011 2010 Än<strong>der</strong>ung zum Vorjahr<br />
[abs.] [%] [abs.] [%] [%]<br />
Deponiegas 63 39,4 50 43,5 + 26,0<br />
Biomasse 34 21,3 20 17,4 + 70,0<br />
W<strong>in</strong>denergie 27 16,9 18 15,7 + 50,0<br />
Wasserkraft 17 10,6 13 11,3 + 30,8<br />
Grubengas 14 8,8 11 9,5 + 27,3<br />
Geothermie 5 3,1 3 2,6 + 66,7<br />
Gesamt 160 100,0 115 100,0 + 39,1<br />
95
4.3.2 NRW-Klimaschutzziele vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>in</strong>ternationaler und nationaler<br />
Vorgaben<br />
4.3.3 Entwicklung <strong>der</strong> CO2-Emissionen <strong>in</strong> NRW<br />
Die dargestellten NRW-CO2-Emissionsdaten spiegeln die von IT.NRW im Rahmen<br />
<strong>der</strong> Energie- und CO2-Bilanzen veröffentlichten Angaben bzw. darauf basierenden<br />
IWR-Berechnungen wi<strong>der</strong>. Derzeit s<strong>in</strong>d die Ausgangsdaten bis zum Betrachtungsjahr<br />
2009 publiziert (Stand: September 2012) [50]. In <strong>der</strong> CO2-<br />
Bilanzierung werden von IT.NRW ausschließlich die bei <strong>der</strong> Verbrennung fossiler<br />
Energieträger freiwerdenden energiebed<strong>in</strong>gten Emissionen betrachtet. Die auf<br />
<strong>in</strong>dustrielle Prozesse zurückzuführenden CO2-Mengen werden nicht berücksichtigt.<br />
7 Die landesspezifischen CO2-Emissionen werden als Quellen- bzw. Verursacherbilanz<br />
ausgewiesen. Def<strong>in</strong>itionsgemäß bildet die Quellenbilanz die Summe<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong> NRW freigewordenen CO2-Emissionen ab. Dabei werden auch Emissionen<br />
berücksichtigt, die z.B. bei <strong>der</strong> Erzeugung von Strom entstehen, <strong>der</strong> aus<br />
NRW exportiert wird. In <strong>der</strong> Verursacherbilanz werden dagegen verbrauchergruppenspezifisch<br />
die mit dem Energieverbrauch verbundenen CO2-Emissionen<br />
erfasst.<br />
CO2-Emissionen <strong>in</strong> NRW nach Quellenbilanz<br />
Tabelle 4.32: Entwicklung <strong>der</strong> energiebed<strong>in</strong>gten CO2-Emissionen <strong>in</strong> NRW nach<br />
Energieträgern (Quellenbilanz) (Quelle: IWR 2012, Daten: IT.NRW)<br />
Energieträger<br />
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 1990<br />
Ste<strong>in</strong>kohlen 55,4 64,2 74,2 69,8 62,4 67,9 74,7 74,8 79,3 81,0 ... 91,2<br />
Braunkohlen 84,4 88,2 94,3 89,2 91,2 96,2 93,5 94,3 89,6 85,7 ... 87,7<br />
M<strong>in</strong>eralöle 57,4 58,2 55,1 60,9 62,3 63,6 63,5 64 66,6 64,8 ... 66,4<br />
Gase 58,8 71,2 62,8 64,8 63,9 60,6 62,8 59,8 60,8 60,5 ... 53,4<br />
Sonstige 4,7 4,4 3,2 2,5 2,8 3,3 1,3 2,5 3,6 2,0 ... 0,4<br />
Insgesamt 1 260,7 286,2 289,6 287,1 282,6 291,6 295,9 295,3 300,0 294,0 ... 299,0<br />
1 = Rundungsdifferenzen möglich<br />
Verän<strong>der</strong>ung gegenüber 1990 <strong>in</strong> %<br />
- 12,8 - 4,3 - 3,2 - 4,0 - 5,5 - 2,5 - 1,0 - 1,2 0,3 - 1,7 … X<br />
Nach <strong>der</strong> Quellenbilanz wurden 2009 <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 261 Mio. t CO2<br />
emittiert, 2008 lagen die Emissionen mit 286 Mio. t deutlich höher. <strong>Zur</strong>ückzuführen<br />
ist <strong>der</strong> Rückgang <strong>der</strong> Emissionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung von 8,8 Prozent<br />
vor allem auf die F<strong>in</strong>anz- und Wirtschaftskrise. Im Vergleich zum Kyoto-Basisjahr<br />
1990 liegt <strong>der</strong> Rückgang <strong>der</strong> CO2-Emissionen 2009 bei etwa 13 Prozent.<br />
7 Auf Emissionen im Zusammenhang mit den Industrieprozessen (u.a. Kalk- und Zement<strong>in</strong>dustrie) entfielen 2009 nach<br />
Angaben von IT.NRW etwa 2,0 Prozent <strong>der</strong> gesamten CO2-Emissionen <strong>in</strong> NRW<br />
96
Den höchsten Anteil an den CO2-Emissionen im Land weist bei <strong>der</strong> Differenzierung<br />
nach Energieträgern die Braunkohle mit 84,4 Mio. t CO2 (32,4 Prozent) auf.<br />
Beson<strong>der</strong>s auffällig gegenüber dem Vorjahr 2008 ist <strong>der</strong> konjunkturell bed<strong>in</strong>gte<br />
E<strong>in</strong>bruch bei <strong>der</strong> Ste<strong>in</strong>kohle um 13,7 Prozent auf 55,4 Mio. t (2008: 64,2 Mio. t)<br />
und bei den Gasen um 17,4 Prozent auf 58,8 Mio. t (2008: 71,2 Mio. t). Im Zuge<br />
<strong>der</strong> anziehenden Konjunktur s<strong>in</strong>d für 2010 <strong>in</strong> Summe wie<strong>der</strong> höhere CO2-<br />
Emissionen zu erwarten (Tabelle 4.32).<br />
Bei <strong>der</strong> Betrachtung nach Emittentensektoren wird deutlich, dass von den rd. 261<br />
Mio. t CO2 mit etwa 158 Mio. t CO2 (rd. 61 Prozent) <strong>der</strong> Großteil auf den Umwandlungsbereich<br />
entfällt. Davon macht wie<strong>der</strong>um die Stromerzeugung mit 142<br />
Mio. t etwa 90 Prozent aus. Im Vergleich zum Vorjahr 2008 ergibt sich bei <strong>der</strong><br />
Stromerzeugung (2008: 161,4 Mio. t) aufgrund <strong>der</strong> schwachen konjunkturellen<br />
Entwicklung allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong> relativ deutlicher E<strong>in</strong>bruch von ca. 12,2 Prozent. Bei<br />
den Endenergieverbrauchern liegt die Industrie (sonstiger Bergbau und Verarbeitendes<br />
Gewerbe) mit 32 Mio. t CO2 im Jahr 2009 h<strong>in</strong>ter dem Verkehrssektor (rd.<br />
34,4 Mio. t) und den Haushalten mit 35,7 Mio. t auf dem dritten Rang.<br />
In Abbildung 4.41 ist die sektorale Entwicklung <strong>der</strong> prozentualen Abweichung <strong>der</strong><br />
CO2-Emissionen <strong>in</strong> NRW gemäß Quellenbilanz für den Zeitraum 2001 bis 2009<br />
gegenüber dem Basisjahr 1990 dargestellt.<br />
Tabelle 4.33: Entwicklung <strong>der</strong> energiebed<strong>in</strong>gten CO2-Emissionen <strong>in</strong> NRW nach<br />
Emittentensektoren (Quellenbilanz) (Quelle: IWR 2012, Daten: IT.NRW)<br />
Emissionen<br />
gesamt 1<br />
Umwandlungsbereich<br />
1<br />
davon<br />
Stromerzeugung<br />
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 1990<br />
Mio. t CO2<br />
260,7 286,2 289,6 287,1 282,6 291,6 295,9 295,3 300,0 294,0 ... 299,0<br />
158,2 176,0 186,7 178,9 177,4 180,5 182,1 174,3 173,4 166,5 164,0<br />
141,7 161,4 172,9 166,1 160,3 167,3 165,5 159,7 159,5 153,9 ... 150,9<br />
Fernwärme 1,7 2,1 2,2 1,4 1,8 3,1 6,1 6,8 5,9 4,3 ... 4,5<br />
Sonstige<br />
Emittenten<br />
Endenergieverbraucher<br />
1<br />
davon<br />
Sonstiger<br />
Bergbau,<br />
Verarb.<br />
Gewerbe<br />
14,8 12,5 11,6 11,4 15,3 10,0 10,5 7,9 8,0 8,3 ... 8,7<br />
Mio. t CO2<br />
102,5 110,1 102,9 108,3 105,2 111,2 113,7 121,0 126,6 127,5 ... 135,0<br />
32,3 38,5 38,1 34,9 33,5 40,3 41,6 44,6 43,8 46,8 … 61,1<br />
Verkehr 34,4 33,1 34,2 34,5 35,0 36,7 35,7 37,2 37,5 38,8 … 35,5<br />
Haushalte,<br />
GHD, übrig.<br />
Verbraucher<br />
1 = Rundungsdifferenzen möglich<br />
35,7 38,5 30,6 38,9 36,7 34,1 36,4 39,2 45,3 41,9 … 38,4<br />
97
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
-40<br />
-50<br />
Abbildung 4.41: Jährliche prozentuale Abweichung <strong>der</strong> CO2-Emissionen <strong>in</strong> NRW (Quellenbilanz)<br />
vom Basisjahr 1990 (1990 = 0) <strong>in</strong> den verschiedenen Sektoren<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IT.NRW)<br />
CO2-Emissionen nach Verursacherbilanz<br />
Tabelle 4.34: Entwicklung <strong>der</strong> energiebed<strong>in</strong>gten CO2-Emissionen <strong>in</strong> NRW nach<br />
Sektoren (Verursacherbilanz) (Quelle: IWR 2012, Daten: IT.NRW)<br />
Emittentensektoren<br />
Verarbeitendes<br />
Gewerbe, Gew<strong>in</strong>nung<br />
von Ste<strong>in</strong>en u.<br />
Erden [Mio. t]<br />
Verän<strong>der</strong>ung gegenüber<br />
1990 [%]<br />
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 1990<br />
87,3 98,5 100,3 91,8 96,9 103,1 100,6 99,9 99,9 102,9 ... 125,8<br />
-30,6 -21,7 -20,2 -26,6 -23 -18 -20 -20,6 -20,6 -18,2 ... X<br />
Verkehr [Mio. t] 35,4 34,0 35,5 35,8 37,4 38 37,2 38,7 39,1 41,6 ... 37,2<br />
Verän<strong>der</strong>ung gegenüber<br />
1990 [%]<br />
Haushalte, Gewerbe,<br />
Handel, Dienstleistungen<br />
u. übrige<br />
Verbraucher [Mio. t]<br />
Verän<strong>der</strong>ung gegenüber<br />
1990 [%]<br />
-4,8 -8,5 -4,6 -3,8 0,5 2,2 0 4 5,1 11,8 ... X<br />
69,1 87,6 74,4 83,1 79,6 81 80,4 86,8 86,9 81,4 ... 79,8<br />
-13,4 +9,7 -6,8 4,1 -0,3 1,5 0,8 8,8 8,9 2,0 ... X<br />
Insgesamt [Mio. t] 1 191,8 220,1 210,2 210,8 213,9 222,1 218,1 225,4 225,9 225,9 ... 242,8<br />
Verän<strong>der</strong>ung gegenüber<br />
1990 [%]<br />
Anteil [%]<br />
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009<br />
Quelle: IWR, Daten: IT.NRW, eigene Berechnung<br />
1 = Rundungsdifferenzen möglich<br />
Haushalte, GHD<br />
Industrie<br />
Verkehr<br />
Umwandlung<br />
© IWR, 2012<br />
-21,0 -9,4 -13,4 -13,2 -8,5 -10,2 -7,2 -7 -7 -7 ... X<br />
98
Nach <strong>der</strong> Verursacherbilanz, d.h. <strong>der</strong> verbrauchsabhängigen Betrachtung, erreichten<br />
die CO2-Emissionen 2009 e<strong>in</strong>en Gesamtwert von 192 Mio. t (Tabelle<br />
4.34). Gegenüber dem Basisjahr 1990 s<strong>in</strong>d die Emissionen damit um etwa 21<br />
Prozent, im Vergleich zum Vorjahr 2008 (220,1 Mio. t CO2) um fast 13 Prozent<br />
gesunken.<br />
Auch bei <strong>der</strong> Verursacherbilanz spiegeln sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Statistik die konjunkturellen<br />
Folgen <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzkrise wi<strong>der</strong>, so dass <strong>der</strong> aktuelle Rückgang zum<strong>in</strong>dest z.T.<br />
temporär se<strong>in</strong> dürfte. Größter CO2-Emittent ist 2009 mit rd. 88 Mio. t CO2 <strong>der</strong> Industriesektor<br />
(Verarbeitendes Gewerbe, Gew<strong>in</strong>nung von Ste<strong>in</strong>en u. Erden). Darauf<br />
folgt <strong>der</strong> Bereich GHD, Haushalte und übrige Verbraucher mit knapp 69 Mio.<br />
t CO2 vor dem Verkehrssektor mit rd. 35 Mio. t CO2. Damit konnten <strong>in</strong> allen Bereichen<br />
die Emissionen gegenüber dem Bezugsjahr 1990 gesenkt werden, am<br />
stärksten war die Emissionse<strong>in</strong>sparung 2009 mit etwa 30 Prozent im Industriesektor.<br />
4.3.4 Beitrag regenerativer Energien zum Klimaschutz <strong>in</strong> NRW<br />
4.3.4.1 NRW-Klimaschutz: EE-Beitrag zur CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
Tabelle 4.35: CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung durch die Nutzung regenerativer Energien und<br />
Grubengas <strong>in</strong> NRW im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR-Referenzwerte z.T. eig. Berechnung / Schätzung)<br />
2011 1 2010<br />
Menge [Mio. t] Menge [Mio. t]<br />
regenerative Energien 14,3 10,8<br />
Grubengas 2 3,3 3,8<br />
Klimaschutz gesamt 17,6 14,6<br />
1 = Werte vorläufig, 2 = Bezirksregierung Arnsberg / DMT<br />
Im Jahr 2011 erreicht die CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung durch die Nutzung erneuerbarer Energien<br />
<strong>in</strong> NRW (Strom, Wärme und Treibstoffe) etwa 14,3 Mio. t (2010: 10,8 Mio. t).<br />
Der im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Beitrag erneuerbarer Energien zum<br />
Klimaschutz ist vor allem auf e<strong>in</strong>e deutlich höhere W<strong>in</strong>dstromproduktion, den<br />
boomenden PV-Sektor sowie den vergleichsweise hohen Zubau im Bereich Biogas<br />
im Jahr 2011 zurückzuführen.<br />
Die zusätzliche Emissionsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung (CO2-Äquivalente), die auf die Nutzung von<br />
Grubengas zurückzuführen ist, geht 2011 angesichts rückläufiger Grubengasmengen<br />
um 7 Prozent zurück und erreicht ca. 3,3 Mio. t (2010: 3,8 Mio. t, 2009:<br />
4,1 Mio. t). Wegen des weiterh<strong>in</strong> zu erwartenden Rückgangs <strong>der</strong> verstromten<br />
Grubengasmengen ist davon auszugehen, dass <strong>der</strong> Maximalbeitrag <strong>der</strong> Grubengasnutzung<br />
zum Klimaschutz bereits erreicht wurde und <strong>in</strong> den nächsten Jahren<br />
e<strong>in</strong> weiterer Rückgang e<strong>in</strong>tritt.<br />
Insgesamt liegt <strong>der</strong> Beitrag zur Emissionsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>in</strong> NRW 2011 im Bereich<br />
Klimaschutz (regenerative Energien und Grubengas) bei 17,6 Mio. t CO2 (2010:<br />
99
14,6 Mio. t). Damit hat sich <strong>der</strong> CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsbeitrag von regenerativen Energien<br />
und Grubengas verglichen mit dem Wert für 2010 um etwa 21 Prozent erhöht<br />
(Tabelle 4.35, Abbildung 4.42).<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
CO 2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung [Mio. t]<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 4.42: Entwicklung <strong>der</strong> CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung durch regenerative Energien und Grubengas<br />
<strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012)<br />
100
4.4 Stand Netzausbau, Speichertechniken und Elektromobilität<br />
4.4.1 Status quo des Netzausbaus und Perspektiven <strong>in</strong> NRW<br />
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG)<br />
Von Bedeutung für den weiteren Ausbau des Stromnetzes <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen auf <strong>der</strong> Höchstspannungsebene s<strong>in</strong>d die im Energieleitungsausbaugesetz<br />
(EnLAG) erfassten bundeslandübergreifenden Netzausbauvorhaben. Insgesamt<br />
verlaufen von den 24 bis 2020 geplanten EnLAG-Projekten mit e<strong>in</strong>er Gesamttrassenlänge<br />
von etwa 1.800 km zehn Vorhaben mit 428 km ganz o<strong>der</strong> abschnittsweise<br />
durch NRW (Abbildung 4.43).<br />
Abbildung 4.43: Stand <strong>der</strong> vordr<strong>in</strong>glichen Stromtrassen gemäß Energieleitungsausbaugesetz<br />
<strong>in</strong> NRW (Quelle: BNetzA, Kartenausschnitt, Stand: 01. August 2012)<br />
101
Charakteristisch für e<strong>in</strong>en Großteil <strong>der</strong> EnLAG-Projekte <strong>in</strong> Deutschland und NRW<br />
ist, dass die neuen 380 kV-Leitungen überwiegend <strong>in</strong> den bestehenden 220-kV-<br />
Trassen errichtetet werden sollen. Vollständig neue Trassenplanungen s<strong>in</strong>d daher<br />
nach dem jetzigen Planungsstand i.d.R. nicht zu erwarten. Nach Angaben<br />
des Übertragungsnetzbetreibers Amprion s<strong>in</strong>d von den bislang rd. 400 km Trassenlänge<br />
<strong>in</strong> NRW nach dem aktuellen Planungsstand lediglich 5 km als tatsächlicher<br />
Neubau mit neuer Trassenführung e<strong>in</strong>zustufen [5]. Die durch NRW verlaufenden<br />
EnLAG-Projekte erstrecken sich fast ausschließlich <strong>in</strong> Nord-Süd-<br />
Richtung. Damit steht <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Transport <strong>der</strong> <strong>in</strong> Zukunft voraussichtlich<br />
stark ansteigenden Strommengen aus Offshore-W<strong>in</strong>denergieanlagen <strong>in</strong> die Lastzentren<br />
<strong>in</strong> Süd- und Westdeutschland im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> Leistungsvorhaben.<br />
Von den zehn EnLAG-Vorhaben wurde bislang nur das Projekt Bergkamen -<br />
Gerste<strong>in</strong>werk (8 km) realisiert (Stand: August 2012). Bei e<strong>in</strong>em weiteren Projekt<br />
ist <strong>der</strong> Planfeststellungs-Prozess abgeschlossen, so dass mit dem Bau begonnen<br />
werden konnte. Für die meisten an<strong>der</strong>en Projekte <strong>in</strong> NRW ist aufgrund <strong>der</strong> langwierigen<br />
Planverfahren erst mittel- bis langfristig von e<strong>in</strong>er Umsetzung auszugehen.<br />
Bei sechs <strong>der</strong> zehn NRW betreffenden EnLAG-Projekte liegt <strong>der</strong> anvisierte<br />
Fertigstellungsterm<strong>in</strong> daher zwischen 2016 und 2018 (Tabelle 4.36) [51].<br />
Tabelle 4.36: Stand des EnLAG-Netzausbaus <strong>in</strong> NRW<br />
EnLAG<br />
-Nr.<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: BNetzA, Stand: August 2012 [23])<br />
Leitungsvorhaben<br />
nach EnLAG<br />
Trassenlänge<br />
<strong>in</strong> NRW [km]<br />
Geplante<br />
Fertigstellung<br />
Status (August 2012)<br />
7 Bergkamen – Gerste<strong>in</strong>werk 8 2009 realisiert<br />
18 Lüstr<strong>in</strong>gen – Westerkappeln 6 2013 im Planfeststellungsverfahren<br />
/ planfestgestellt<br />
2 Gan<strong>der</strong>kesee – Wehrendorf 2 2014 im Planfeststellungsverfahren<br />
17 Gütersloh – Bechterdissen 31 2014 planfestgestellt / <strong>in</strong> Bau<br />
5 Diele – Nie<strong>der</strong>rhe<strong>in</strong> 84 2016 <strong>in</strong> Planung<br />
13 Nie<strong>der</strong>rhe<strong>in</strong> / Wesel -<br />
Landesgrenze NL<br />
30 2016 im Planfeststellungsverfahren<br />
15 Osterrath – Weißenturm 100 2016 im Planfeststellungsverfahren<br />
14 Nie<strong>der</strong>rhe<strong>in</strong> - Utfort – Osterath 42 2017 im Raumordnungs- / Planfeststellungsverfahren<br />
16 Wehrendorf – Gütersloh 27 2017 <strong>in</strong> Planung<br />
19 Kruckel – Dauersberg 98 2018 im Planfeststellungsverfahren<br />
Netzentwicklungsplan Strom 2012<br />
Auf <strong>der</strong> Basis des von <strong>der</strong> Bundesnetzagentur Ende 2011 genehmigten Szenariorahmens<br />
für den Stromnetzausbau haben die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)<br />
im Mai e<strong>in</strong>en ersten Entwurf für den Netzentwicklungsplan Strom 2012 vorgelegt.<br />
Dar<strong>in</strong> wird aus Sicht <strong>der</strong> ÜNB <strong>in</strong> 4 Szenarien <strong>der</strong> Netzausbaubedarf im Höchstspannungsnetz<br />
bis zum Jahr 2022 bzw. 2032 vor dem H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>er sicheren<br />
und zuverlässigen Stromversorgung aufgezeigt. Die Öffentlichkeit hatte vom 30.<br />
Mai bis zum 10. Juli 2012 die Gelegenheit, sich zu dem Entwurf im Rahmen e<strong>in</strong>er<br />
102
Konsultationsphase zu äußern. Das überarbeitete Ergebnis haben die ÜNB im<br />
August 2012 <strong>der</strong> Bundesnetzagentur vorgelegt. Seit dem 06. September 2012<br />
läuft e<strong>in</strong>e zweite öffentliche Konsultationsphase, Stellungnahmen können noch<br />
bis zum 02. November 2012 abgegeben werden. Kernbestandteil des NEP 2012<br />
s<strong>in</strong>d 4 Nord-Süd-Korridore (A bis D), <strong>in</strong> denen sich die Anfangs- und Endpunkte<br />
künftig wichtiger Stromtrassen bef<strong>in</strong>den. Insgesamt s<strong>in</strong>d je nach Szenario bis zu<br />
knapp 50 Leitungsprojekte mit Maßnahmen im Bereich Neubau, Ausbau und<br />
Netzverstärkung geplant. Die genauen Trassenverläufe dieser Maßnahmen s<strong>in</strong>d<br />
noch nicht Bestandteil des Plans bzw. stehen noch nicht fest. Durch NRW verlaufen<br />
die Korridore A und B. Sie haben <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie das Ziel, die Übertragungskapazitäten<br />
zwischen Nie<strong>der</strong>sachsen, dem Rhe<strong>in</strong>land und Baden-Württemberg<br />
zu verbessern (Abbildung 4.44). Anfor<strong>der</strong>ungen für den Netzausbau <strong>in</strong> NRW ergeben<br />
sich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für den zweiten Betrachtungszeitraum (2022 – 2032), <strong>in</strong><br />
denen die Übertragungskapazitäten <strong>in</strong> jedem Korridor von 2 GW (2022) je nach<br />
Szenario auf bis zu 6 GW (2032) erweitert werden sollen.<br />
Abbildung 4.44: Netzentwicklungsplan, Szenario B 2022, nur mit Ergebnismaßnahmen,<br />
ohne Startnetz (Quelle: BNetzA, Kartenausschnitt, Stand: 29. August 2012)<br />
103
NRW: Erdkabel als Alternative zu Freileitungen<br />
Die nordrhe<strong>in</strong>-westfälische Landesregierung strebt <strong>in</strong> ihrem Koalitionsvertrag e<strong>in</strong>e<br />
Novellierung des EnLAG an. Danach soll es zusätzliche Pilotstrecken für Erdkabelleitungen<br />
<strong>in</strong> NRW geben, um die Akzeptanz <strong>der</strong> Bürger beim Netzausbau zu<br />
verbessern. Bislang s<strong>in</strong>d bundesweit vier Pilotstrecken auf Basis dieser Technologie<br />
<strong>in</strong> Planung, e<strong>in</strong>e davon <strong>in</strong> NRW. Für das 3,3 km lange Teilstück auf <strong>der</strong><br />
Strecke Diele-Nie<strong>der</strong>rhe<strong>in</strong>, das <strong>in</strong> Erdkabelbauweise verlegt werden soll, hat <strong>der</strong><br />
zuständige Übertragungsnetzbetreiber Amprion die Planfeststellung beantragt<br />
(Stand: Juni 2012).<br />
104
4.4.2 Status quo Speichertechniken und Planungen <strong>in</strong> NRW<br />
Zum aktuellen Bedarf von Stromspeichern<br />
E<strong>in</strong> weiterer Bauste<strong>in</strong> zur Integration von Erneuerbaren Energien <strong>in</strong> den Strommarkt<br />
ist die (Weiter-)Entwicklung und <strong>der</strong> Bau von zusätzlichen Speicherkapazitäten.<br />
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Strom zu speichern (bspw. Wasserspeicher,<br />
Druckluftspeicher, Wärmespeicher, chemische Speicher). Darüber h<strong>in</strong>aus<br />
können <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>telligenten Stromnetz auch Elektroautos als Zwischenspeicher<br />
für überschüssige Strommengen genutzt werden.<br />
Beim <strong>der</strong>zeitigen Ausbaustand erneuerbarer Energien <strong>in</strong> Deutschland kommt<br />
dem konkreten Aufbau neuer Speicherkapazitäten <strong>der</strong>zeit noch ke<strong>in</strong>e unmittelbare<br />
zentrale Bedeutung zu. Das belegt exemplarisch z.B. das gemittelte Lastprofil<br />
<strong>der</strong> Stromerzeugung <strong>in</strong> Deutschland im Juni 2012. Erkennbar wird <strong>in</strong> Abbildung<br />
4.45, dass die Stromproduktion aus Photovoltaik (gelb) dem Tagesgang entsprechend<br />
parallel mit dem Strombedarf von Privathaushalten, Industrie und Gewerbe<br />
bis auf e<strong>in</strong> Maximum zur Mittagszeit zunimmt. PV-Anlagen können also zeitlich<br />
die zusätzliche Stromnachfrage am Tage abdecken, sodass kaum Bedarf<br />
besteht, weitere konventionelle Spitzenlastkraftwerke zuzuschalten. Weil nachmittags<br />
und abends die Stromnachfrage zeitgleich mit <strong>der</strong> PV-Leistung s<strong>in</strong>kt,<br />
müssen auch dann ke<strong>in</strong>e zusätzlichen Kraftwerke ans Netz gehen.<br />
Bedarf zum Ausbau <strong>der</strong> Speicherkapazitäten <strong>in</strong> Deutschland dürfte sich ergeben,<br />
wenn die am Netz bef<strong>in</strong>dliche regenerative Kraftwerksleistung dauerhaft <strong>in</strong> das<br />
Niveau <strong>der</strong> Grundlast (35.000 MW) reicht und gleichzeitig die kurzfristige Regelbarkeit<br />
von Grundlastkraftwerken (noch) nicht gegeben ist.<br />
60.000<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
Leistung [MW]<br />
20.000<br />
00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, Amprion, TenneT TSO, Transnet BW, 50 Hertz<br />
konv. W<strong>in</strong>d Solar<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 4.45: Mittleres Lastprofil <strong>der</strong> Stromerzeugung <strong>in</strong> Deutschland im Juni 2012<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, Amprion, TenneT TSO, Transnet BW, 50 Hertz)<br />
105
Status quo Pumpspeicherkraftwerke<br />
Während sich die meisten neuen Speichertechniken <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em frühen Entwicklungsstadium<br />
bef<strong>in</strong>den und damit im größeren Maße noch nicht o<strong>der</strong> nur bed<strong>in</strong>gt<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis e<strong>in</strong>setzbar s<strong>in</strong>d, stellen Pumpspeicherkraftwerke <strong>der</strong>zeit die national<br />
am weitesten verbreitete Option zur großtechnischen Speicherung von Strom<br />
dar. Insgesamt liegt die Kapazität <strong>der</strong> <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong>stallierten Pumpspeicherkraftwerke<br />
bei etwa 6.700 MW. Die höchste Leistung weisen dabei Baden-<br />
Württemberg (rd. 2.000 MW), Thür<strong>in</strong>gen (1.500 MW) und Sachsen (1.300 MW)<br />
auf.<br />
Die Leistung <strong>der</strong> NRW-Pumpspeicherkraftwerke liegt <strong>in</strong>sgesamt bei 300 MW<br />
(Koepchenwerk Herdecke: 150 MW, Rönckhausen: 140 MW, Sorpetalsperre: 10<br />
MW). NRW belegt im bundesweiten Vergleich damit <strong>der</strong>zeit den sechsten Rang<br />
(Abbildung 4.46).<br />
2.500<br />
2.250<br />
2.000<br />
1.750<br />
1.500<br />
1.250<br />
1.000<br />
750<br />
500<br />
250<br />
0<br />
Kapazitäten [MW]<br />
BW TH SN HE BY NRW NDS HH SAH<br />
Quelle: IWR, Daten: Trianel (Stand Download: Juli 2012)<br />
Abbildung 4.46: Kapazitäten von Pumpspeicherkraftwerken <strong>in</strong> den Bundeslän<strong>der</strong>n (Quel-<br />
le: IWR, 2012, Daten: Trianel, Datenstand: Juli 2012)<br />
Perspektiven von Speichersystemen <strong>in</strong> NRW<br />
© IWR, 2012<br />
Um die Anfor<strong>der</strong>ungen an den Ausbau von Speicherkapazitäten im Rahmen des<br />
weiteren Ausbaus erneuerbarer Energien zu decken, laufen <strong>der</strong>zeit Planungen<br />
für den Bau weiterer Pumpspeicherkraftwerke <strong>in</strong> NRW.<br />
Von dem Energieversorger Trianel s<strong>in</strong>d Pläne zum Bau von Pumpspeicherkraftwerken<br />
an zwei Standorten <strong>in</strong> NRW bekannt. Das geplante Pumpspeicherkraftwerk<br />
„Nethe“ auf dem Gebiet <strong>der</strong> Städte Beverungen und Höxter soll über e<strong>in</strong>e<br />
Leistung von 390 MW bei e<strong>in</strong>em Speichervolumen von rd. 4,2 Mio. Kubikmeter<br />
Wasser verfügen. Die Inbetriebnahme ist für 2020 geplant. Nach Fertigstellung<br />
könnte das Speicherkraftwerk mit e<strong>in</strong>er Fallhöhe von über 220 m bis zu 6 Stunden<br />
im Dauervolllastbetrieb laufen und etwa 2,3 Mio. kWh Strom erzeugen.<br />
106
Das Pumpspeicherkraftwerk „Rur“ an <strong>der</strong> Rurtalsperre <strong>der</strong> Städteregion Aachen<br />
ist für e<strong>in</strong>e Leistung von 640 MW ausgelegt, bei e<strong>in</strong>em Speichervolumen von 7,6<br />
Mio. Kubikmeter Wasser. Damit wäre das Kraftwerk das viertgrößte se<strong>in</strong>er Art <strong>in</strong><br />
Deutschland. Das Investitionsvolumen liegt bei rd. 700 Mio. Euro. Die Anlage<br />
„Rur“ soll nach <strong>der</strong> Inbetriebnahme bei e<strong>in</strong>er Fallhöhe von 240 m ebenfalls bis zu<br />
6 Stunden im Dauervolllastbetrieb laufen können und <strong>in</strong> diesem Zeitfenster etwa<br />
3,8 Mio. kWh Strom erzeugen (Tabelle 4.37).<br />
Tabelle 4.37: Eckdaten bestehen<strong>der</strong> und geplanter Pumpspeicherkraftwerk <strong>in</strong><br />
NRW (Quelle: IWR, 2012, Daten: RWE, Trianel, Stand: Juni 2012)<br />
Standort Leistung [MW] Speichervolumen Wasser<br />
[Mio. m 3 ]<br />
Fallhöhe [m] Status<br />
Koepchenwerk, Herdecke 150 1,53 165 <strong>in</strong> Betrieb<br />
Rönckhausen 140 1,0 266 <strong>in</strong> Betrieb<br />
Sorpetalsperre 10 67<br />
(Stauraum Talsperre)<br />
Gesamt Bestand 300 - -<br />
Pumpspeicherkraftwerk<br />
„Nethe“<br />
Pumpspeicherkraftwerk<br />
„Rur“<br />
56 <strong>in</strong> Betrieb<br />
390 4,2 220 geplant<br />
640 7,6 240 geplant<br />
Gesamt Planungen 1.030 - -<br />
Zusätzliches Potenzial: Pumpspeicherkraftwerke unter Tage<br />
Die Landesregierung prüft darüber h<strong>in</strong>aus die Entwicklung und Realisierung von<br />
Unterflur-Pumpspeicherwerken (UPW) <strong>in</strong> stillgelegten Bergwerken. Wissenschaftler<br />
e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är besetzten Forschungsteams mit Vertreten <strong>der</strong> Universität<br />
Duisburg-Essen (UDE), <strong>der</strong> Ruhr-Universität Bochum (RUB), <strong>der</strong> RAG<br />
Deutsche Ste<strong>in</strong>kohle AG sowie des Mercator Research Center Ruhr (MERCUR)<br />
und weiterer Partner untersuchen dazu das Potenzial und die technische Machbarkeit<br />
von Unterflur-Pumpspeicherwerken <strong>in</strong> NRW. Dabei sollen die Höhenunterschiede<br />
zwischen e<strong>in</strong>em oberirdischen Speicherbecken und untertage verfügbaren<br />
Speicherflächen genutzt werden, die durch die Schachtsysteme des Ste<strong>in</strong>kohlenbergbaus<br />
<strong>in</strong> NRW entstanden s<strong>in</strong>d. Da extrem große Fallhöhen von 1.000<br />
bis 1.800 m genutzt werden können, ist es möglich, die Anlagen relativ kle<strong>in</strong> zu<br />
dimensionieren. E<strong>in</strong>e große Herausfor<strong>der</strong>ung stellt aus technischer Sicht aufgrund<br />
<strong>der</strong> Größe allerd<strong>in</strong>gs noch die Installation des Generators unter Tage dar.<br />
Diskutiert wird die Errichtung von UPW auch im Zusammenhang mit dem Braunkohletagebau.<br />
Konkrete UPW-Projekte s<strong>in</strong>d <strong>der</strong>zeit noch nicht geplant, da sich<br />
die technische Entwicklung noch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em frühen Stadium bef<strong>in</strong>det. Nach <strong>der</strong> Potenzialuntersuchung<br />
des Projektkonsortiums ist davon auszugehen, dass sich e<strong>in</strong><br />
Potenzial mit e<strong>in</strong>er Gesamtleistung von 800 bis 1.000 MW <strong>in</strong> NRW ergibt [52].<br />
Derzeit laufen die Planungen für die Durchführung e<strong>in</strong>es Pilotprojektes. Aus Sicht<br />
<strong>der</strong> RAG ist es vorgesehen, die Entwicklung für den Bau von Unterflur-<br />
Pumpspeicherwerken unabhängig vom Standort (NRW o<strong>der</strong> Saarland) <strong>in</strong> den<br />
nächsten drei Jahren abzuschließen [6].<br />
107
4.4.3 Elektromobilität<br />
Status quo und Perspektiven auf Bundesebene<br />
Grundlage für die Initiierung und Entwicklung des Marktes für Elektromobilität <strong>in</strong><br />
Deutschland ist <strong>der</strong> 2009 von <strong>der</strong> Bundesregierung verabschiedete „Nationale<br />
Entwicklungsplan Elektromobilität“ (NEPE). Ziel des Plans ist es, die Forschung<br />
und Entwicklung sowie die Markte<strong>in</strong>führung von Elektrofahrzeugen auf nationaler<br />
Ebene zur forcieren. Im Jahr 2010 wurde die Nationale Plattform Elektromobilität<br />
(NPE) gegründet. Das Expertengremium berät die Bundesregierung zum Thema<br />
Elektromobilität. In sieben Arbeitsgruppen (u.a. Antriebstechnik, Batterietechnologie<br />
sowie Lade<strong>in</strong>frastruktur und Netz<strong>in</strong>tegration) sollen die wichtigsten Themengebiete<br />
<strong>der</strong> Elektromobilität bearbeitet und geeignete Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
für ihren Ausbau entwickelt werden. Die Bundesregierung plant mit m<strong>in</strong>destens<br />
e<strong>in</strong>er Million Elektrofahrzeuge bis 2020, bis 2030 soll <strong>der</strong> Bestand auf sechs Millionen<br />
Fahrzeuge <strong>in</strong> Deutschland ausgebaut werden.<br />
Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes lag die Zahl <strong>der</strong> zugelassenen Fahrzeuge<br />
Anfang 2012 bundesweit bei 4.541 Elektroautos. Gegenüber dem Vorjahr<br />
ergibt sich damit zwar e<strong>in</strong>e Steigerung um 97 Prozent. Insgesamt bleibt <strong>der</strong> Bestand<br />
von Elektrofahrzeugen allerd<strong>in</strong>gs noch weit unter <strong>der</strong> Zielmarke. Die Nationale<br />
Plattform Elektromobilität hält unter den <strong>der</strong>zeitigen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
bis 2020 den Ausbau auf bis zu 600.000 Fahrzeuge für realistischer [45]. Wesentliche<br />
Ursachen für die langsam verlaufende Marktentwicklung s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e fehlende<br />
Versorgungs<strong>in</strong>frastruktur, e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Reichweite <strong>der</strong> Autos und vor allem<br />
die <strong>der</strong>zeit im Vergleich zu klassischen Pkw noch deutlich höheren Kosten.<br />
Status quo, Zielsetzungen und Perspektiven <strong>in</strong> NRW<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Quelle: IWR, Daten: Kraftfahrtbundesamt<br />
Bestand Elektrofahrzeuge<br />
Anfang 2012 Anfang 2011<br />
Abbildung 4.47: Bestand an zugelassenen Elektrofahrzeugen nach Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: Kraftfahrtbundesamt)<br />
© IWR, 2012<br />
Ziel beim Thema Elektromobilität <strong>in</strong> NRW ist es, dass im Jahr 2020 bis zu<br />
250.000 Elektroautos zugelassen s<strong>in</strong>d. Anfang 2011 lag die Zahl <strong>der</strong> zugelassenen<br />
Elektrofahrzeuge <strong>in</strong> NRW bei 500 Fahrzeugen. Bis Anfang 2012 wurden wei-<br />
108
tere rd. 330 Fahrzeuge zugelassen, so dass sich e<strong>in</strong> Gesamtbestand von 830<br />
Elektrofahrzeugen ergibt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das e<strong>in</strong>em Zuwachs<br />
von etwa 66 Prozent. Im bundesweiten Vergleich liegt NRW damit h<strong>in</strong>ter Bayern<br />
(928 Fahrzeuge) und vor Baden-Württemberg (763), Nie<strong>der</strong>sachsen (436) und<br />
Hessen (412) auf dem zweiten Rang (Abbildung 4.47).<br />
E<strong>in</strong> weiteres wichtiges Ziel <strong>der</strong> NRW-Ausbaustrategie unter <strong>in</strong>dustriepolitischen<br />
Gesichtspunkten ist es, dass e<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong> benötigten Komponenten auch <strong>in</strong><br />
NRW produziert wird. Langfristig wird angestrebt, NRW zu e<strong>in</strong>em zentralen Innovations-<br />
und Produktionsstandort für Elektromobilität zu machen.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> Arbeitsgruppen <strong>der</strong> Nationalen Plattform Elektromobilität<br />
liegen die FuE-Schwerpunkte <strong>in</strong> NRW <strong>der</strong>zeit auf den Bereichen Batterietechnik,<br />
Fahrzeugtechnik sowie Infrastruktur und Netze. Für jeden Sektor wurde e<strong>in</strong><br />
eigenes NRW-Kompetenzzentrum gegründet:<br />
� Kompetenzzentrum „Batterie“ <strong>in</strong> Münster<br />
- Münster Electrochemical Energy Technology (MEET)<br />
� Kompetenzzentrum „Fahrzeugtechnik“ <strong>in</strong> Aachen<br />
� Kompetenzzentrum „Infrastruktur & Netze“ am Standort Dortmund<br />
- Technologie- und Prüfplattform für e<strong>in</strong> Kompetenzzentrum für <strong>in</strong>teroperable<br />
Elektromobilität, Infrastruktur und Netze (TIE-IN)<br />
Zusätzlich zu den technischen Bereichen sollen <strong>in</strong> NRW die wirtschaftlichen und<br />
stadtplanerischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen sowie Aspekte <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> zukünftigen<br />
Verkehrsträger stärker <strong>in</strong> den Blickpunkt rücken.<br />
Erkenntnisse über den praktischen E<strong>in</strong>satz von Elektromobilen liefert das Projekt<br />
„Modellregion Rhe<strong>in</strong>-Ruhr“. Im Rahmen <strong>der</strong> 2011 beendeten ersten Phase des<br />
Feldtests wurden acht verschiedene Projekte durchgeführt. Etwa 200 Fahrzeuge<br />
aus unterschiedlichen Bereichen waren im E<strong>in</strong>satz, um e<strong>in</strong> breites Spektrum an<br />
Themen abzudecken. Ziel war es, das Nutzerverhalten und die Anfor<strong>der</strong>ungen an<br />
den Elektroantrieb zu analysieren und zu testen. Seit 2012 läuft die zweite Phase<br />
des Projektes. Sie setzt auf den bisherigen Ergebnissen des ersten Feldtests an.<br />
Bislang fiel <strong>der</strong> Startschuss für zwei weitere Projekte, weitere sollen folgen<br />
(Stand: Juli 2012).<br />
109
4.5 Ziele und Maßnahmen <strong>der</strong> NRW-Landesregierung im Bereich<br />
Energie & Umwelt<br />
Die Landesregierung hat sich das zentrale Klimaschutzziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bis 2020 um m<strong>in</strong>destens 25 Prozent<br />
und bis zum Jahr 2050 um m<strong>in</strong>destens 80 Prozent im Vergleich zum Basisjahr<br />
1990 zu reduzieren. Mit dem erstmals im Jahr 2011 <strong>in</strong> den Landtag e<strong>in</strong>gebrachten<br />
Klimaschutzgesetz soll dieses Ziel gesetzlich verankert und e<strong>in</strong> rechtlicher<br />
Rahmen für die Ableitung und Umsetzung von Emissionsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />
geschaffen werden [1]. Aufgrund <strong>der</strong> Parlamentsauflösung im Frühjahr 2012<br />
musste das Gesetz im Juni erneut <strong>in</strong> den Landtag e<strong>in</strong>gebracht werden.<br />
Die zeitliche, sektorale und regionale Konkretisierung <strong>der</strong> Maßnahmen zur Erreichung<br />
<strong>der</strong> Klimaschutzziele erfolgt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em begleitenden Klimaschutzplan, <strong>der</strong><br />
im Laufe des Jahres 2012 erstellt wird und alle 5 Jahre fortgeschrieben werden<br />
soll. Um die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen, soll <strong>der</strong> Klimaschutzplan <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em frühzeitig angelegten Dialog- und Beteiligungsverfahren erarbeitet und anschließend<br />
vom Landtag beschlossen werden. Zuständig für die E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong><br />
Klimaschutzziele und die Umsetzung <strong>der</strong> Maßnahmen des Klimaschutzplans ist<br />
e<strong>in</strong> fünfköpfiger Klimaschutzrat, <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Folge bei <strong>der</strong> Weiterentwicklung des<br />
Klimaschutzplans e<strong>in</strong>e beratende Rolle e<strong>in</strong>nimmt. Zu den weiteren Klimaschutzzielen<br />
neben <strong>der</strong> Verr<strong>in</strong>gerung <strong>der</strong> Treibhausgasemissionen zählen die Steigerung<br />
des Ressourcenschutzes, die Ressourcen- und Energieeffizienz, Energiee<strong>in</strong>sparungen,<br />
<strong>der</strong> Ausbau Erneuerbarer Energien und die Begrenzung <strong>der</strong> negativen<br />
Folgen des Klimawandels.<br />
Im Vorfeld <strong>der</strong> Erstellung des Klimaschutzplans wurde im Oktober 2011 das KlimaschutzStartProgramm<br />
beschlossen, <strong>in</strong> dem zentrale Klimaschutzmaßnahmen<br />
auf 10 Themenfel<strong>der</strong>n aufgeführt werden. Die Landesregierung hat sich das Ziel<br />
gesetzt, die Maßnahmen dieses Programms bis Ende 2012 auf den Weg zu br<strong>in</strong>gen.<br />
Im Bereich erneuerbare Energien stehen dabei u.a. <strong>der</strong> Ausbau des W<strong>in</strong>denergieanteils<br />
an <strong>der</strong> NRW-Stromversorgung bis 2020 auf 15 Prozent durch Instrumente<br />
wie e<strong>in</strong>en novellierten W<strong>in</strong>denergieerlass, e<strong>in</strong>en speziellen Leitfaden<br />
für die W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong> Waldgebieten sowie e<strong>in</strong>e Repower<strong>in</strong>g-Initiative im<br />
Fokus. Weitere EE-Maßnahmen s<strong>in</strong>d die Initiierung des Informations- und Beratungszentrums<br />
„EnergieDialog.NRW“ sowie die Erstellung von kommunalen Potenzialstudien<br />
zu den verschiedenen regenerativen Energieträgern. Tabelle 4.38<br />
gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die von <strong>der</strong> Landesregierung im Rahmen des KlimaschutzStartProgramms<br />
beschlossenen Themenfel<strong>der</strong> und E<strong>in</strong>zelmaßnahmen.<br />
110
Tabelle 4.38: Maßnahmen im Rahmen des KlimaschutzStartProgramms <strong>der</strong><br />
NRW-Landesregierung (Quelle: IWR, 2012, Daten: Landesregierung NRW)<br />
Themenfeld E<strong>in</strong>zelmaßnahme<br />
1. Vor Ort aktiv: Klimaschutzpaket<br />
für Kommmunen<br />
2. Klimaschützend Bauen und<br />
Wohnen<br />
3. Energie sparen – Geld sparen –<br />
Klima schützen. Stromspar<strong>in</strong>itative<br />
für e<strong>in</strong>kommensschwache<br />
Haushalte<br />
4. Impulse für die KWK<br />
5. Verbraucher<strong>in</strong>nen und<br />
Verbraucher im Blick –<br />
Startschuss für die persönliche<br />
Energiewende<br />
6. Frischer W<strong>in</strong>d für NRW –<br />
Ausbau <strong>der</strong> W<strong>in</strong>dkraft för<strong>der</strong>n<br />
7. Immer besser werden: Energieund<br />
Ressourceneffizienz <strong>in</strong><br />
Unternehmen<br />
8. Vernetzen für die Speicher und<br />
Netze<br />
9. Klimaschutz als<br />
Zukunfts<strong>in</strong>vestition – auch <strong>in</strong><br />
f<strong>in</strong>anzschwachen Kommunen<br />
10. Mit gutem Beispiel vorangehen:<br />
Erste Schritte auf dem Weg zur<br />
klimaneutralen<br />
Landesverwaltung<br />
� Beratung / Mediation erneuerbare Energien (EnergieDialog.NRW)<br />
� Ausbildung zum kommunalen „Klimaschutzmanager“<br />
� Landes-För<strong>der</strong>programm zur Umsetzung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen<br />
� Tools zur Erstellung kommunaler Klimaschutzkonzepte (u.a. Potenzialstudie<br />
für regenerative Energien)<br />
� „Klima-Netzwerker“ für die Regionen Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens<br />
� Wohnraumför<strong>der</strong>ungsprogramm – Bereitstellung von 200 Mio.<br />
Euro zur Verbesserung <strong>der</strong> Energieeffizienz<br />
� Ausweitung <strong>der</strong> aufsuchenden Energieberatung<br />
� Pilotprojekte zur För<strong>der</strong>ung energiesparen<strong>der</strong> Geräte <strong>in</strong> Kooperation<br />
mit Energieversorgern<br />
� Landesweite Machbarkeitsstudie zur För<strong>der</strong>ung energiesparen<strong>der</strong><br />
Haushaltsgeräte <strong>in</strong> NRW<br />
� KWK als Brückentechnologie: Steigerung des KWK-Anteils an <strong>der</strong><br />
Stromerzeugung auf über 25 %<br />
� Auflegung e<strong>in</strong>es mehrjährigen 250 Mio. Euro-För<strong>der</strong>programms<br />
� Informations- und Öffentlichkeitskampagne <strong>der</strong> Verbraucherzentrale<br />
im Bereich <strong>der</strong> privaten Haushalte zu Themen wie E<strong>in</strong>satz<br />
von erneuerbaren Energien, richtiges Heizen und Lüften etc.<br />
Maßnahmen zum Ausbau des Anteils <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergienutzung auf 15<br />
% an Stromversorgung bis 2020 durch:<br />
� Überarbeitung des W<strong>in</strong>denergieerlasses<br />
� Leitfaden W<strong>in</strong>denergie im Wald<br />
� Repower<strong>in</strong>g-Initiative<br />
Erschließung von Energieeffizienz-Potenzialen durch<br />
� NRW.Bank.Effizienzkredit<br />
� Energiemanagement: Ausweitung des Pilotprojektes mod.EEM<br />
� Aufbau e<strong>in</strong>es virtuellen Instituts zum Thema Netze<br />
� Stärkung <strong>der</strong> Themenfel<strong>der</strong> „Speicher“ und „Netze“ bei <strong>der</strong> EnergieAgentur.NRW<br />
� Erleichterung von Investitionen <strong>in</strong> langfristig wirtschaftlichen Klimaschutz<br />
für Kommunen durch spezifische Maßnahmen wie Än<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>deordnung o<strong>der</strong> das Gesetz zur Umsetzung<br />
des „Stärkungspaktes Stadtf<strong>in</strong>anzen“<br />
� Datenerfassung – Erstellung e<strong>in</strong>er zentralen Übersicht zum Energieverbrauch<br />
<strong>der</strong> Landesgebäude<br />
� Umstellung auf Ökostrom<br />
� Verb<strong>in</strong>dliche Umsetzung des Energiespar-Erlasses<br />
� Energieeffizienzkampagne MissionE <strong>in</strong> Landesm<strong>in</strong>isterien<br />
� Klimaneutrale Veranstaltungen<br />
111
4.5.1 Zum Stand <strong>der</strong> Maßnahmen-Umsetzung<br />
Ausbau <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
E<strong>in</strong> zentraler Bauste<strong>in</strong> des KlimaschutzStartProgramms ist <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. Nach den Zielsetzungen <strong>der</strong> Landesregierung<br />
soll <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergie an <strong>der</strong> Stromversorgung bis zum<br />
Jahr 2020 auf 15 Prozent steigen. Wichtige Maßnahmen zur Erreichung dieses<br />
Ziels s<strong>in</strong>d:<br />
� die Überarbeitung des W<strong>in</strong>denergieerlasses<br />
� die Unterstützung <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergienutzung <strong>in</strong> Waldgebieten durch e<strong>in</strong>en<br />
entsprechenden Leitfaden sowie<br />
� die Initiierung e<strong>in</strong>er Repower<strong>in</strong>g-Initiative zur Verbesserung <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
im Bereich Repower<strong>in</strong>g<br />
W<strong>in</strong>denergieerlass NRW<br />
Am 11. Juni 2011 ist <strong>der</strong> neue Erlass für die Planung und Genehmigung von<br />
W<strong>in</strong>denergieanlagen ("W<strong>in</strong>denergieerlass") <strong>in</strong> Kraft getreten [20]. Der Erlass stellt<br />
e<strong>in</strong>e grundlegende Überarbeitung <strong>der</strong> unter <strong>der</strong> Vorgängerregierung verabschiedeten<br />
Fassung aus dem Jahr 2005 dar. Ziel des neuen Erlasses ist es, für Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
zu sorgen, die mit Blick auf das 15-Prozent-W<strong>in</strong>denergieziel<br />
<strong>der</strong> Landesregierung auf <strong>der</strong> Grundlage des gegebenen umwelt-, planungs- und<br />
genehmigungsrechtlichen Rahmens e<strong>in</strong>en schnellen aber umwelt- und naturverträglichen<br />
Ausbau <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergie ermöglichen. Der Schwerpunkt <strong>der</strong> Überarbeitung<br />
liegt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auf dem Abbau von planungsrechtlichen Hürden für<br />
Investoren und Betreiber. So wurden z.B. die faktisch mit dem alten Erlass e<strong>in</strong>geführte<br />
Höhenbeschränkung auf 100 m sowie die Abstandsvorgaben zur Wohnbebauung<br />
aufgehoben. Im Zuge <strong>der</strong> Abwägung hat die Kommune nunmehr auch<br />
zu berücksichtigen, dass durch Festsetzungen die Wirtschaftlichkeit von WEA-<br />
Vorhaben bee<strong>in</strong>trächtigt werden kann (vgl. Kap. 4.2.2.1, S. 48).<br />
Leitfaden W<strong>in</strong>denergie im Wald<br />
Im Zuge <strong>der</strong> Novellierung des W<strong>in</strong>denergieerlasses wurde das seit 2005 bestehende<br />
Tabu aufgehoben, W<strong>in</strong>dkraftanlagen auf Waldflächen zu errichten. Vor<br />
diesem H<strong>in</strong>tergrund hat das Umwelt- und Klimaschutzm<strong>in</strong>isterium NRW im April<br />
2012 e<strong>in</strong>en Leitfaden zur „W<strong>in</strong>denergie im Wald" veröffentlicht [21], [22].<br />
Ziel <strong>der</strong> Planungshilfe ist es, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Regionen mit e<strong>in</strong>em hohen Waldflächenanteil,<br />
die vorhandenen W<strong>in</strong>denergiepotenziale unter Berücksichtigung<br />
von Aspekten wie dem Natur- und Artenschutz besser zu nutzen. Für die W<strong>in</strong>denergienutzung<br />
<strong>in</strong> Betracht kommen nach dem Leitfaden Waldflächen, die aus<br />
naturschutzfachlicher Sicht weniger wertvoll s<strong>in</strong>d (z.B. W<strong>in</strong>dwurfflächen / Kyrillschadensflächen).<br />
Wertvolle Waldflächen werden dagegen i.d.R. von <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergienutzung ausgeklammert.<br />
Der Leitfaden soll auf <strong>der</strong> Basis von Praxiserfahrungen weiterentwickelt<br />
und verbessert werden. Dazu ist e<strong>in</strong> regelmäßiges Monitor<strong>in</strong>g vorgesehen.<br />
112
Repower<strong>in</strong>g-Initiative<br />
Neben dem Anlagenneubau an neuen Standorten stellt <strong>der</strong> Austausch alter<br />
W<strong>in</strong>dkraftanlagen durch leistungsfähigere Neuanlagen (Repower<strong>in</strong>g) e<strong>in</strong>e Option<br />
dar, um die Ausbauziele im W<strong>in</strong>denergiesektor zu erreichen. Die NRW-<br />
Landesregierung hat e<strong>in</strong>e Repower<strong>in</strong>g-Initiative gegründet, die dazu beitragen<br />
soll, dass die Repower<strong>in</strong>g-Potenziale <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen optimal erschlossen<br />
werden können. Auf <strong>der</strong> Agenda <strong>der</strong> Initiative stehen u.a. die Unterstützung von<br />
Kommunen bei <strong>der</strong> Umsetzung von Repower<strong>in</strong>g-Projekten, die Identifizierung<br />
von Problemkreisen und Lösungsansätzen und die Mo<strong>der</strong>ation des Repower<strong>in</strong>g-<br />
Prozesses. E<strong>in</strong> wichtiger Bauste<strong>in</strong> <strong>der</strong> Inititative ist darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong><br />
Repower<strong>in</strong>g-Kataster mit Daten <strong>der</strong> Repower<strong>in</strong>g-Projekte <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen,<br />
das <strong>der</strong>zeit aufgebaut wird.<br />
EnergieDialog.NRW – Informations- und Beratungsplattform<br />
Für e<strong>in</strong>en verstärkten Informationsaustausch zwischen den beteiligten Akteuren<br />
hat das Klimaschutzm<strong>in</strong>isterium mit dem EnergieDialog.NRW e<strong>in</strong>e Informationsund<br />
Beratungsplattform für Erneuerbare Energien <strong>in</strong> NRW e<strong>in</strong>gerichtet<br />
(www.energiedialog.nrw.de). Neben Informations- und Beratungsdienstleistungen<br />
zu allen Themengebieten rund um die Erneuerbaren Energien bildet die Schlichtung<br />
möglicher Streitfälle, beispielsweise im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren,<br />
e<strong>in</strong>en zentralen Aspekt des EnergieDialog.NRW. Die<br />
Schlichtungsgespräche f<strong>in</strong>den beim Internationalen Wirtschaftsforum Regenerative<br />
Energien (IWR) statt. Die bisherigen Erfahrungen aus den bereits durchgeführten<br />
Gesprächen zeigen, dass auch bei schwierigen Sachverhalten Konsenslösungen<br />
gefunden und gangbare Wege aufgezeigt werden konnten.<br />
durchgeführt<br />
Potenzialstudien Erneuerbare Energiegn<br />
Das KlimaschutzStartProgramm sieht neben den Informationsdienstleistungen<br />
weitere Maßnahmen für e<strong>in</strong>en aktiveren Klimaschutz vor Ort vor. Dazu gehört die<br />
Unterstützung bei <strong>der</strong> Erstellung kommunaler Klimaschutzkonzepte durch Potenzialstudien<br />
für die jeweiligen EE-Bereiche. Die Potenzialstudien sollen Auskunft<br />
darüber geben, an welchen Orten sich bestimmte regenerative Energieerzeugungsformen<br />
beson<strong>der</strong>s gut eignen. Es ist vorgesehen, die Ergebnisse <strong>der</strong> Potenzialstudien<br />
im Fach<strong>in</strong>formationssystem „Energieatlas Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen“ im<br />
Internet zu veröffentlichen. So wird es für Kommunen möglich, die Informationen<br />
für Planungszwecke zu nutzen. Die Potenzialstudien für W<strong>in</strong>d- und Solarenergie<br />
wurden bereits fertiggestellt und veröffentlicht bzw. stehen kurz vor <strong>der</strong> Veröffentlichung<br />
(Stand: Oktober 2012). Weitere Potenzialuntersuchungen, bspw. zur Bioenergienutzung,<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Arbeit (vgl. Kap. 4.2.2.1, S. 42 und Kap. 4.2.2.3, S. 62.).<br />
Netze und Speicher<br />
Zwei wichtige Bauste<strong>in</strong>e <strong>der</strong> zukünftigen Energieversorgung s<strong>in</strong>d <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong><br />
Stromnetze und die Entwicklung von effizienten Speichertechnologien. Im Rahmen<br />
des Netzausbaus kommt NRW dabei e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>s wichtige Rolle zu, da<br />
113
zahlreiche <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeit als notwendig e<strong>in</strong>gestuften Netzausbaumaßnahmen Netzabschnitte<br />
betreffen, die durch das Bundesland verlaufen (siehe Energieleitungsausbaugesetz<br />
– EnLAG). Außerdem werden <strong>in</strong>nerhalb dieser Projekte neue<br />
Transporttechnologien (Hochspannungs-Erdkabel) getestet. Die Landesregierung<br />
will daher <strong>in</strong>nerhalb ihres KlimaschutzStartProgramms die Themenfel<strong>der</strong><br />
Speicher und Netze verstärkt berücksichtigen und stärker vernetzen. Dazu soll<br />
unter an<strong>der</strong>em e<strong>in</strong> virtuelles Netzwerk zum Thema Netze, bestehend aus Hochschulen<br />
und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> NRW, aufgebaut werden. Darüber h<strong>in</strong>aus<br />
sollen die beiden Themenfel<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> EnergieAgentur.NRW verstärkt auf<br />
die Agenda treten.<br />
114
5 Wirtschafts-, Standort- und Strukturanalyse: Unternehmen<br />
und Märkte<br />
5.1 Regenerative Kernmärkte Internationale und nationale<br />
Trends<br />
5.1.1 Markt: Margendruck im W<strong>in</strong>denergie- und PV-Markt nimmt zu<br />
Die weltweiten Märkte für regenerative Energietechniken verzeichnen auch im<br />
Jahr 2011 den teilweise schwierigen konjunkturellen Bed<strong>in</strong>gungen zum Trotz e<strong>in</strong><br />
Wachstum. Weltweit wurden rd. 170 Mrd. Euro <strong>in</strong> regenerative Anlagentechnik<br />
<strong>in</strong>vestiert, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies e<strong>in</strong>er Steigerung um rd. 21<br />
Prozent (2010: rd. 140 Mrd. Euro). Zentrale Wachstumstreiber im globalen EE-<br />
Markt s<strong>in</strong>d dabei auch weiterh<strong>in</strong> die W<strong>in</strong>d- und die Solarenergiesparte. Jedoch<br />
haben vor allem die <strong>in</strong> diesen Märkten tätigen Unternehmen mit f<strong>in</strong>anziellen und<br />
konjunkturellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Gründe dafür s<strong>in</strong>d neben <strong>der</strong><br />
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung e<strong>in</strong> verschärfter Wettbewerb, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en entsprechenden<br />
Preis- und Margendruck für die Herstellerunternehmen zur Folge<br />
hat.<br />
Die schwierige Situation <strong>der</strong> Unternehmen spiegelt sich im weltweiten Aktien<strong>in</strong>dex<br />
für erneuerbare Energien RENIXX World (Renewable Energy Industrial Index)<br />
wi<strong>der</strong>. Dabei hat sich die Gewichtung <strong>der</strong> Unternehmen <strong>in</strong>nerhalb des regenerativen<br />
Industrie-Index <strong>in</strong> den letzten Jahren deutlich verschoben. Während im<br />
Jahr 2007 von den 30 im RENIXX gelisteten Unternehmen noch acht aus<br />
Deutschland stammten, s<strong>in</strong>d es aktuell nur noch vier. Demgegenüber ist die Anzahl<br />
ch<strong>in</strong>esischer Unternehmen im Index von fünf im Jahr 2007 auf zehn im Jahr<br />
2012 gestiegen (Tabelle 5.1).<br />
Tabelle 5.1: Herkunft <strong>der</strong> RENIXX-Unternehmen 2012 und 2007<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, Stand September 2012)<br />
2012 2007<br />
Rang Land Anzahl Unternehmen Land Anzahl Unternehmen<br />
1 Ch<strong>in</strong>a 10 USA 9<br />
2 USA 7 Deutschland 8<br />
3 Deutschland 4 Ch<strong>in</strong>a 5<br />
4 Rest Europa 6 Rest Europa 5<br />
5 übrige Län<strong>der</strong> 3 übrige Län<strong>der</strong> 3<br />
Gesamt 30 Gesamt 30<br />
Das Börsenjahr 2011 ist für die Aktien von Unternehmen aus dem Segment regenerative<br />
Energien sehr schwach verlaufen. Der RENIXX hat das Jahr mit e<strong>in</strong>em<br />
deutlichen Kursverlust beendet und notiert zum Jahresschluss mit 241,28<br />
115
Punkten um 54,4 Prozent niedriger als Ende 2010 (529,63). Bereits 2010 hatte<br />
<strong>der</strong> RENIXX 29,3 Prozent verloren. (Abbildung 5.1)<br />
Mit Verlusten zwischen 60 und 80 Prozent zählten 2011 <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die ch<strong>in</strong>esischen<br />
W<strong>in</strong>d- und Solarunternehmen zu den größten Verlierern. Auch die im<br />
RENIXX vertretenen deutschen Unternehmen wie Nordex (W<strong>in</strong>denergieanlagen,<br />
-28,3 Prozent), SMA Solar Technology (PV-Wechselrichter, -39,3 Prozent), SolarWorld<br />
(PV-Zellen und -Module, -56,5 Prozent) und Centrotherm (PV-<br />
Produktions-Technologie, -63,6 Prozent) mussten hohe Verluste h<strong>in</strong>nehmen.<br />
Besser verlief die Kursentwicklung <strong>der</strong> im RENIXX gelisteten Versorgungsunternehmen.<br />
Im Jahr 2012 hat <strong>der</strong> RENIXX nach e<strong>in</strong>er leichten Erholung im Januar<br />
den Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Ende September notierte das regenerative<br />
Börsenbarometer bei 173,72 Punkten. Damit hat <strong>der</strong> RENIXX im Jahr 2012 bislang<br />
um weitere 28 Prozent nachgegeben (Abbildung 5.1).<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
Indexwert<br />
(Stand 03.01.2005 ≙ 100)<br />
0<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Daten: IWR, MSCI Inc<br />
RENIXX ® World<br />
MSCI World<br />
RENIXX-Stand<br />
(absolut <strong>in</strong> Punkten)<br />
Abbildung 5.1: Verlauf <strong>der</strong> Aktien<strong>in</strong>dizes RENIXX ® World und MSCI World im Zeitraum<br />
2005 bis Ende September 2012 (Quelle: IWR, 2012)<br />
An<strong>der</strong>s als beim RENIXX World für die Regenerative <strong>Energiewirtschaft</strong> ist im<br />
Jahr 2011 die Entwicklung des MSCI World für die globale Gesamtwirtschaft verlaufen.<br />
Nach se<strong>in</strong>em Tiefpunkt, den <strong>der</strong> Index <strong>in</strong>folge <strong>der</strong> globalen Wirtschaftsund<br />
F<strong>in</strong>anzkrise im März 2009 markiert hatte, ist <strong>der</strong> MSCI World auf e<strong>in</strong>en<br />
Wachstumspfad e<strong>in</strong>geschwenkt, <strong>der</strong> bis zur Verschärfung <strong>der</strong> Schuldenkrise im<br />
Euroraum angedauert hat. Im weiteren Verlauf des Jahres 2011 hat <strong>der</strong> Index<br />
zwar ger<strong>in</strong>gfügig abgegeben, hat aber <strong>in</strong> etwa das Niveau des Jahres 2010 gehalten.<br />
Auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> ersten Jahreshälfte 2012 hat sich dieser Entwicklungstrend<br />
fortgesetzt (Abbildung 5.1).<br />
Die Ursachen für die schwache Performance des RENIXX World liegen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Entwicklung <strong>der</strong> Unternehmen im vergangenen Jahr. Die Unternehmen haben<br />
damit zu kämpfen, dass bereits seit geraumer Zeit allgeme<strong>in</strong>e sowie spartenspezifische<br />
Wachstumsfaktoren fehlen, zudem bremsen makroökonomische Faktoren<br />
mögliche Wachstumsansätze umgehend wie<strong>der</strong> ab. We<strong>der</strong> vom <strong>in</strong>ternationalen<br />
Klimaschutz noch von steigenden Ölpreisen gehen <strong>der</strong>zeit Wachstumsschübe<br />
für die Regenerative <strong>Energiewirtschaft</strong> aus. Auch <strong>der</strong> Impulseffekt nach <strong>der</strong><br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
© IWR, 2012<br />
116
Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 war <strong>in</strong>nerhalb weniger Monate<br />
vollständig verpufft. Zudem sehen sich die Unternehmen aus <strong>der</strong> Photovoltaikund<br />
die W<strong>in</strong>denergiebranche Überkapazitäten und e<strong>in</strong>em Verfall <strong>der</strong> Anlagenund<br />
Produktpreise gegenüber. Parallel dazu s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> vielen Län<strong>der</strong>n die Vergütungen<br />
für die regenerative Energieerzeugung reduziert worden, was den Druck auf<br />
die Margen <strong>der</strong> Unternehmen zusätzlich erhöht.<br />
Insgesamt erreichten die Umsätze <strong>der</strong> im RENIXX gelisteten Unternehmen im<br />
Jahr 2011 e<strong>in</strong>e Höhe von rd. 42,87 Mrd. Euro (2010: rd. 42,2 Mrd. Euro). Dennoch<br />
können nur wenige davon auch e<strong>in</strong> positives EBIT, bzw. Gew<strong>in</strong>ne aufweisen.<br />
Zusammengenommen wiesen die 30 im RENIXX gelisteten Unternehmen<br />
im vergangenen Geschäftsjahr Verluste von rd. 540 Mio. Euro aus. Im Vorjahr<br />
hatten noch die Firmen noch Gew<strong>in</strong>ne <strong>in</strong> Höhe von rd. 6,1 Mrd. Euro erzielen<br />
können (Tabelle 5.2).<br />
Tabelle 5.2: Umsätze und Gew<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> 10 umsatzstärksten RENIXX-<br />
Unternehmen 2011 und 2010<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Rang Unternehmen Land Umsatz<br />
[Mrd. Euro]<br />
1. Vestas 1<br />
2. Suzlon 1<br />
3. Gamesa 1<br />
4. Enel Green Power 2<br />
2011 2010<br />
Ergebnis<br />
[Mrd. Euro]<br />
Umsatz<br />
[Mrd. Euro]<br />
Ergebnis<br />
[Mrd. Euro]<br />
Dänemark 5,84 -0,06 6,92 0,31<br />
Indien 3,10 0,17 2,83 0,06<br />
Spanien 3,03 0,13 2,76 0,12<br />
Italien 2,54 0,91 2,18 0,79<br />
5. Suntech Power 2 Ch<strong>in</strong>a 2,43 -0,49 2,17 0,15<br />
6. First Solar 2 USA 2,14 -0,05 1,92 0,56<br />
7. Ch<strong>in</strong>a Longyuan 3 Ch<strong>in</strong>a 1,98 0,44 1,61 0,36<br />
8. Y<strong>in</strong>gli Green 2 Ch<strong>in</strong>a 1,80 -0,33 1,42 0,32<br />
9. SunPower 2 USA 1,79 -0,40 1,66 0,10<br />
10. Renewable Energy Corp. 1 Norwegen 1,72 -1,23 1,77 0,13<br />
Summe 30 RENIXX-Firmen 42,76 -0,54 42,23 6,10<br />
Gew<strong>in</strong>nzahlen <strong>in</strong> 1 = EBIT, 2 = Operat<strong>in</strong>g <strong>in</strong>come, 3 = Profit before taxation, alle Werte <strong>in</strong> Euro umgerechnet<br />
Auch auf lange Sicht spiegeln die Umsatz- und Gew<strong>in</strong>nzahlen <strong>der</strong> Unternehmen<br />
die Entwicklung <strong>der</strong> regenerativen Branche wi<strong>der</strong>. So hat beispielsweise <strong>der</strong><br />
deutsche Solarkonzern SolarWorld im Jahr 2006 e<strong>in</strong>en Umsatz von 515 Mio. Euro<br />
erwirtschaftet, das EBIT betrug damals rd. 181 Mio. Euro. Im Jahr 2011 erzielte<br />
SolarWorld e<strong>in</strong>en Umsatz von rd. 1 Mrd. Euro, das EBIT rutschte mit 233 Mio.<br />
Euro <strong>in</strong>s M<strong>in</strong>us.<br />
Ähnlich stellt sich die Entwicklung bei dem dänischen Marktführer für W<strong>in</strong>denergieanlagen,<br />
Vestas dar. Im Jahr 2005 lag <strong>der</strong> Umsatz des Unternehmens bei rd.<br />
4,2 Mrd. Euro. Das EBIT betrug damals 204 Mio. Euro. Im Jahr 2011 erreichte<br />
117
<strong>der</strong> Umsatz e<strong>in</strong>e Höhe von rd. 5,8 Mrd. Euro, das EBIT dagegen wurde vom Unternehmen<br />
mit m<strong>in</strong>us 60 Mio. Euro ausgewiesen.<br />
Weltweit waren Ende 2011 etwa 140 börsennotierte Unternehmen registriert, die<br />
im Bereich regenerative Energien mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes erzielen.<br />
Dazu gehörten 2011 noch vier Unternehmen mit Hauptsitz <strong>in</strong> NRW. Neben <strong>der</strong> im<br />
RENIXX vertretenen SolarWorld AG (Bonn) gehören zu dieser Gruppe Biogas<br />
Nord (Biogas, Bielefeld), 2G Bio-Energietechnik (Biogas, Ahaus), Petrotec (Biodieselherstellung,<br />
Borken-Burlo). 8<br />
Ch<strong>in</strong>a verän<strong>der</strong>t Wettbewerbssituation für Unternehmen<br />
Der globale Wettbewerb wird vor allem <strong>in</strong> den letzten Jahren zu e<strong>in</strong>em großen<br />
Teil durch die Entwicklungen <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a bestimmt. So hat <strong>der</strong> Markte<strong>in</strong>tritt verschiedener<br />
ch<strong>in</strong>esischer Unternehmen den Wettbewerbsdruck für die Unternehmen<br />
deutlich verschärft. Die ch<strong>in</strong>esischen Unternehmen werden dabei von <strong>der</strong><br />
Regierung explizit beim Aufbau von Industriekapazitäten <strong>in</strong> verschiedenen Sparten<br />
unterstützt, vor allem <strong>in</strong> den Sektoren, die als Zukunftsbranchen bewertet<br />
werden. Im W<strong>in</strong>denergiesektor fokussiert sich die Regierungsstrategie auf den<br />
Aufbau und die Abschottung e<strong>in</strong>es Inlandsmarktes, <strong>der</strong> vor allem für <strong>in</strong>ländische<br />
Unternehmen Absatzchancen bieten soll, so dass diese konkurrenzfähig werden.<br />
Für ausländische Unternehmen ist <strong>der</strong> Marktzugang stark erschwert.<br />
Im PV-Sektor setzen die ch<strong>in</strong>esischen Unternehmen bislang vor allem auf die<br />
Produktion von Solarzellen- und Modulen für den Auslandsmarkt. Die dadurch<br />
ausgelöste Konkurrenz um Marktanteile hat die Kostenentwicklung vorangetrieben<br />
und zu teilweise deutlichen Preissenkungen geführt. Dies hat <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Absatzmärkten e<strong>in</strong>en starken Zubau begünstigt, wovon die Unternehmen mit<br />
hohen Umsätzen profitieren konnten. Um die hohen Zubauraten und die Kosten<br />
für die Solarstrom-Vergütungen zu drücken, senkten viele Staaten ihre Vergütungen<br />
für den produzierten PV-Strom. Der bestehende Druck auf die Margen <strong>der</strong><br />
Unternehmen konnte jedoch nur durch die hohen Umsätze ausgeglichen werden,<br />
so dass <strong>der</strong> Großteil <strong>der</strong> PV-Unternehmen zuletzt rote Zahlen schrieben. Vor allem<br />
<strong>in</strong> Deutschland g<strong>in</strong>gen zudem mehrere Unternehmen <strong>in</strong> die Insolvenz und<br />
auch die ch<strong>in</strong>esischen Unternehmen können <strong>der</strong>zeit kaum Gew<strong>in</strong>ne erwirtschaften.<br />
Die ch<strong>in</strong>esische Regierung strebt daher den Aufbau e<strong>in</strong>es eigenen PV-<br />
Marktes an, um für die heimischen Unternehmen entsprechende Absatzmärkte<br />
zu schaffen. Die Entwicklungen am PV-Markt und die Kürzungen <strong>der</strong> Vergütungen<br />
<strong>in</strong> Europa sorgen somit für e<strong>in</strong>en Ausbau <strong>der</strong> PV-Nutzung <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a und das<br />
Entstehen e<strong>in</strong>es neuen Kernmarktes für PV-Technik.<br />
8 In NRW s<strong>in</strong>d neben den genannten vier Unternehmen weitere börsennotierte Unternehmen mit Aktivitäten im Geschäftsfeld<br />
regenerative Energien ansässig. Da sie bei erneuerbaren Energien e<strong>in</strong>en Umsatzanteil von unter 50 Prozent aufweisen, werden<br />
sie nicht dem engeren Kreis <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> zugerechnet.<br />
118
5.1.1.1 Erneuerbare Energien: Weltweite Markttrends im Jahr 2011 und<br />
Ausblick 2012<br />
W<strong>in</strong>denergie<br />
Der globale W<strong>in</strong>denergiemarkt hat sich im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr<br />
wie<strong>der</strong> stabilisiert. Weltweit erreichte <strong>der</strong> Zubau rd. 41.000 MW und übertrifft somit<br />
erstmals die Marke von 40.000 MW (Zubau 2010: ca. 38.000 MW) (Abbildung<br />
5.2). Das globale Marktvolumen erreicht vor diesem H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>e Größenordnung<br />
zwischen 40 und 44 Mrd. Euro. Vor allem <strong>in</strong> den sog. „emerg<strong>in</strong>g markets“<br />
konzentriert sich zunehmend das <strong>in</strong>ternationale Marktgeschehen. Nach e<strong>in</strong>em<br />
Zubau von rd. 19.000 MW im Jahr 2010 führt Ch<strong>in</strong>a das Zubau-Rank<strong>in</strong>g<br />
2011 mit rd. 18.000 MW neu <strong>in</strong>stallierter Leistung weiterh<strong>in</strong> deutlich vor den USA<br />
mit rd. 6.800 MW (2010: rd. 5.000 MW) an. Darauf folgen Indien mit e<strong>in</strong>em Zubau<br />
von etwa 3.000 MW und auf Rang vier Deutschland mit rd. 2.000 MW. Die weltweit<br />
<strong>in</strong>stallierte WEA-Gesamtleistung ist bis Ende 2011 auf rd. 238.000 MW angestiegen.<br />
Tabelle 5.3: Top 5-W<strong>in</strong>denergiemärkte 2011 und 2000<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, GWEC, WPM)<br />
2011 2000<br />
Rang Land Leistung [MW] Anteil [%] Land Leistung [MW] Anteil [%]<br />
1 Ch<strong>in</strong>a 18.000 rd. 44 Deutschland 1.700 rd. 40<br />
2 USA 6.800 rd. 17 Spanien 800 rd. 19<br />
3 Indien 3.000 rd. 7 Dänemark 600 rd. 14<br />
4 Deutschland 2.100 rd. 5 Italien 400 rd. 9<br />
5 Großbritannien 1.300 rd. 3 Indien 200 rd. 5<br />
Gesamt ca. 41.000 100 Gesamt ca. 4.300 100<br />
Für die heimischen Hersteller von W<strong>in</strong>denergieanlagen war das Jahr 2011 e<strong>in</strong><br />
ambivalentes Jahr. Zwar ist auf dem Inlandsmarkt gegenüber dem Vorjahr mit e<strong>in</strong>em<br />
Zubau von etwa 2.000 MW (2010: rd. 1.550 MW) wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Wachstum zu<br />
verzeichnen. Allerd<strong>in</strong>gs f<strong>in</strong>det <strong>der</strong> Großteil des weltweiten Zubaus <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a, den<br />
USA und Indien statt. Vor allem im Leitmarkt Ch<strong>in</strong>a bieten sich den Unternehmen<br />
aus Europa dabei kaum Chancen am Markt teilzunehmen, sodass die Hersteller<br />
kaum Wachstum verzeichnen und z.T. <strong>in</strong> die Verlustzone gerutscht s<strong>in</strong>d. Daran<br />
konnte auch die leichte Erholung auf dem US-Markt nichts än<strong>der</strong>n. Vielmehr sahen<br />
sich die Unternehmen wie im Vorjahr e<strong>in</strong>em Marktumfeld mit e<strong>in</strong>em sich verschärfenden<br />
Wettbewerb und hohem Preisdruck gegenüber.<br />
119
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
<strong>in</strong>stallierte Leistung [MW]<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, WPM, GWEC * = vorläufig<br />
Abbildung 5.2: Entwicklung <strong>der</strong> weltweit jährlich <strong>in</strong>stallierten WEA-Leistung (Quelle: IWR,<br />
2012, Daten: IWR, WPM, GWEC, EWEA)<br />
Zudem mussten sich die W<strong>in</strong>denergieanlagenhersteller auch 2011 noch mit zurückhaltenden<br />
Investoren und den verschärften Bed<strong>in</strong>gungen <strong>der</strong> Banken zur<br />
Kreditvergabe ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzen. So s<strong>in</strong>d die Kredithürden <strong>in</strong> Deutschland,<br />
stellvertretend und als Maßstab für die Entwicklung von F<strong>in</strong>anzierungen im <strong>in</strong>ternationalen<br />
Umfeld, zum Jahresende 2011 wie<strong>der</strong> leicht angestiegen. Für große<br />
und mittlere Unternehmen bessert sich die Situation seitdem, die Kredithürden<br />
wurden <strong>in</strong> 2012 niedriger (Abbildung 5.3).<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Angaben restriktive Kreditvergabe [%]<br />
Abbildung 5.3: Kredithürden im Verarbeitenden Gewerbe nach Unternehmensgröße<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: ifo Institut)<br />
© IWR, 2012<br />
0<br />
Jun 03 Mar 06 Nov 08 Mai 09 Nov 09 Mai 10 Nov 10 Mai 11 Nov 11 Mai 12<br />
Quelle: IWR, Daten: ifo Institut<br />
große Unternehmen mittlere Unternehmen kle<strong>in</strong>e Unternehmen<br />
© IWR, 2012<br />
Dennoch bleiben die F<strong>in</strong>anzmärkte vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> Eurokrise volatil. Mit<br />
Blick auf die Perspektiven zeigt sich die Branche jedoch optimistisch und geht vor<br />
120
allem <strong>in</strong> Europa von e<strong>in</strong>er deutlichen Marktbelebung aus, während <strong>in</strong> Asien vorerst<br />
nicht mit weiterem Wachstum gerechnet wird. Für den US-Markt erwarten<br />
die Hersteller wegen des voraussichtlichen Endes <strong>der</strong> Production Tax Credits<br />
zum Jahresende 2012 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Folge e<strong>in</strong>e deutliche Abkühlung des Marktgeschehens.<br />
Photovoltaik<br />
Das globale Marktvolumen im Photovoltaiksektor hat sich im Jahr 2011 mit e<strong>in</strong>em<br />
neuen Zubaurekord deutlich erhöht. Der weltweite Zubau erreichte rd. 29,7<br />
GWp, im Vergleich zum Zubau 2010 von rd. 16,6 GWp ist dies e<strong>in</strong>e Steigerung<br />
um fast 80 Prozent (Abbildung 5.4).<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
<strong>in</strong>stallierte Leistung [MW]<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
Quelle: IWR, Daten: EPIA, BNetzA, Solarbuzz, BMU, IWR, * = vorläufig<br />
Abbildung 5.4: Entwicklung <strong>der</strong> weltweit jährlich <strong>in</strong>stallierten PV-Leistung (Quelle: IWR,<br />
2012, Daten: EPIA, BNetzA, Solarbuzz, BMU, IWR)<br />
Deutschland wurde dabei trotz e<strong>in</strong>es Zubaus von 7.500 GWp (2010: 7.400 MWp)<br />
als größter Markt für Photovoltaik-Technik von Italien mit e<strong>in</strong>em Zubau von rd.<br />
9,3 GWp (2010: rd. 2,3 GWp) abgelöst. Drittgrößter PV-Markt 2011 war Ch<strong>in</strong>a mit<br />
rd. 2,2 GWp vor den USA mit rd. 1,9 GWp und Frankreich mit rd. 1,7 GWp.<br />
Tabelle 5.4: Top 5-PV-Märkte 2011 und 2000<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, BNetzA, EPIA, IEA)<br />
2011 2000<br />
© IWR, 2012<br />
Rang Land Leistung [MW] Anteil [%] Land Leistung [MW] Anteil [%]<br />
1 Italien 9.300 rd. 31 Japan 112 rd. 40<br />
2 Deutschland 7.500 rd. 25 Deutschland 40 rd. 14<br />
3 Ch<strong>in</strong>a 2.200 rd. 7 USA 22 rd. 8<br />
4 USA 1.900 rd. 6 Australien 4 rd. 1<br />
5 Frankreich 1.700 rd. 6 Nie<strong>der</strong>lande 4 rd. 1<br />
Gesamt 29.700 100 Gesamt 280 100<br />
121
Wie schon im Vorjahr führte auch 2011 <strong>der</strong> Kostendruck <strong>in</strong> <strong>der</strong> Branche zu deutlichen<br />
Preissenkungen und e<strong>in</strong>em Anstieg <strong>der</strong> Nachfrage. Im bisherigen Leitmarkt<br />
Deutschland kam es sowohl zur Jahresmitte, als auch zum Jahresende<br />
durch die Kürzungen im Rahmen <strong>der</strong> EEG-Vergütung zu Vorzieheffekten. Neben<br />
Deutschland haben auch an<strong>der</strong>e europäische Staaten die Vergütungen für Solarstrom<br />
reduziert. Insgesamt bestehen <strong>der</strong>zeit <strong>in</strong> m<strong>in</strong>destens 34 Län<strong>der</strong>n weltweit<br />
nationale ökonomische Programme (E<strong>in</strong>speisevergütungen etc.) zur Unterstützung<br />
des Aufbaus von PV-Kapazitäten [53]. Vor allem Japan setzt nach dem<br />
angekündigten Ausstieg aus <strong>der</strong> Kernenergie mittlerweile auf Photovoltaik. So<br />
hat das Land mit rd. 40 Cent pro kWh die weltweit höchste Solarstrom-Vergütung<br />
e<strong>in</strong>geführt, um e<strong>in</strong>en deutlichen Zubau zu ermöglichen.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeit bestehenden globalen Überkapazitäten s<strong>in</strong>ken<br />
die Kosten für PV-Systeme weiter deutlich. Seit 1991 s<strong>in</strong>d die Kosten pro kW um<br />
bisher fast 90 Prozent gefallen (Abbildung 5.5). Für die PV-Hersteller verschärft<br />
diese Entwicklung den Wettbewerb auf den Märkten weiter. Um den ch<strong>in</strong>esischen<br />
PV-Unternehmen zusätzliche Absatzmärkte zu erschließen und die Exportabhängigkeit<br />
abzuschwächen, hat die ch<strong>in</strong>esische Regierung e<strong>in</strong> neues Vergütungssystem<br />
für PV-Anlagen e<strong>in</strong>geführt und das nationale Ausbauziel auf<br />
21.000 MW bis 2015 erhöht. Gleichzeitig hat Ch<strong>in</strong>a im Rahmen des letzten 5-<br />
Jahresplans die Solarbranche als strategisch bedeutsamen Industriezweig identifiziert.<br />
Im Zuge <strong>der</strong> negativen F<strong>in</strong>anzmeldungen und Insolvenzgerüchte über ch<strong>in</strong>esische<br />
Hersteller wird regelmäßig auf die Absicht <strong>der</strong> ch<strong>in</strong>esischen Regierung<br />
verwiesen, bestimmte Unternehmen zur Not staatlich aufzufangen, selbst wenn<br />
sie am Kapitalmarkt ke<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzierung mehr erhalten würden. Dadurch werden<br />
die ch<strong>in</strong>esischen Unternehmen aus Branchensicht im Gegensatz zu den durch<br />
F<strong>in</strong>anzierungsschwierigkeiten belasteten Wettbewerbern <strong>in</strong> die <strong>Lage</strong> versetzt, ihre<br />
Produkte weiterh<strong>in</strong> auch unter Herstellungskosten auf dem Weltmarkt anzubieten.<br />
Kosten [Euro/kW p]<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012<br />
Quelle: IWR, Daten: Photon, IWR<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 5.5: Entwicklung <strong>der</strong> System-Kosten für PV-Anlagen 1991 bis 2011 (Quelle:<br />
IWR, 2012, Daten: Photon, IWR)<br />
122
Das US-Handelsm<strong>in</strong>isterium (Department of Commerce), hat Antidump<strong>in</strong>gzölle<br />
für importierte Solarprodukte aus Ch<strong>in</strong>a verhängt. Auf diese Weise sollen Exportsubventionen<br />
und Dump<strong>in</strong>gpreise künftig unterbunden werden. Die Zölle gelten<br />
für Solarstrommodule auf Basis von kristall<strong>in</strong>en Siliziumzellen aus Ch<strong>in</strong>a [54].<br />
Das endgültige Urteil über die Antisubventions- und Antidump<strong>in</strong>gzölle wird für<br />
November erwartet. Ende Juli 2012 hat zudem <strong>der</strong> deutsche Solarkonzern SolarWorld<br />
zusammen mit weiteren europäischen PV-Herstellern e<strong>in</strong>e Klage gegen<br />
Konkurrenten aus Ch<strong>in</strong>a bei <strong>der</strong> EU e<strong>in</strong>gereicht. Die europäischen Unternehmen<br />
werfen den Ch<strong>in</strong>esen vor, sie würden ihre Module mit Hilfe günstiger Kredite <strong>der</strong><br />
Regierung zu Dump<strong>in</strong>gpreisen auf den europäischen Markt br<strong>in</strong>gen [55].<br />
Solarthermische Kraftwerke<br />
Die solarthermische Kraftwerks-Technologie (CSP) wird bereits seit dem Beg<strong>in</strong>n<br />
<strong>der</strong> 1980er Jahre zur Stromproduktion e<strong>in</strong>gesetzt. Nach e<strong>in</strong>er etwa zehnjährigen<br />
Initialisierungsphase ist die Marktentwicklung u.a. aufgrund niedriger Ölpreise<br />
zum Erliegen gekommen. Zu dem Zeitpunkt lag die weltweit <strong>in</strong>stallierte<br />
Gesamtkapazität 1990 bei etwa 370 MW (Abbildung 5.6). Ab 2007 setzte dann<br />
vor dem H<strong>in</strong>tergrund politischer Initiativen <strong>in</strong> Spanien und den USA e<strong>in</strong>e deutliche<br />
Marktbelebung e<strong>in</strong>. Seitdem hat sich die <strong>in</strong>stallierte Leistung mehr als vervierfacht.<br />
Im Jahr 2011 wurden CSP-Anlagen mit e<strong>in</strong>er Leistung von ca. 480 MW <strong>in</strong><br />
Betrieb genommen, die Gesamtleistung erreichte damit etwa 1.700 MW.<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
Gesamt-Leistung [MW]<br />
0<br />
0<br />
1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011*<br />
Zubau (<strong>in</strong> MW) Gesamte <strong>in</strong>stallierte Leistung (<strong>in</strong> MW)<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, CSP Today, Greenpeace, Protermo Solar, Abengoa, NREL, * = vorläufig<br />
Abbildung 5.6: Entwicklung <strong>der</strong> weltweit jährlich <strong>in</strong>stallierten Leistung und kumulierten<br />
Leistung von Solarthermischen Kraftwerken (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR,<br />
CSP Today, Greenpeace, Protermo Solar, Abengoa)<br />
Leistung Zubau [MW]<br />
Leitmärkte für die CSP-Branche s<strong>in</strong>d <strong>der</strong>zeit vor allem Spanien und die USA. Hier<br />
s<strong>in</strong>d <strong>der</strong>zeit Vorhaben mit e<strong>in</strong>er Leistung von etwa 1.120 MW (Spanien) bzw. 780<br />
MW (USA) <strong>in</strong> Bau. Weitere 780 MW bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Spanien <strong>in</strong> <strong>der</strong> Planung, <strong>in</strong><br />
den USA s<strong>in</strong>d Vorhaben mit etwa 2.270 MW <strong>in</strong> <strong>der</strong> Planungsphase. Neben diesen<br />
beiden Nationen bef<strong>in</strong>den sich auch <strong>in</strong> Australien, Ch<strong>in</strong>a und Indien Projekte<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
© IWR, 2012<br />
123
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung von 80 MW im Bau und 900 MW <strong>in</strong> Planung (Abbildung<br />
5.7). Über große Potenziale verfügt zudem die MENA-Region. Aufgrund <strong>der</strong> politischen<br />
Umwälzungen <strong>in</strong> Nordafrika und dem Nahen Osten konnten jedoch bisher<br />
nur wenige Vorhaben umgesetzt werden. Zudem stellt die F<strong>in</strong>anzierung von<br />
CSP-Projekten e<strong>in</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ung für die Vertragspartner dar. Für e<strong>in</strong>e 25<br />
MW Anlage ist z.B. e<strong>in</strong>e Investitionssumme zwischen 120 bis 150 Mio. Euro e<strong>in</strong>zuplanen.<br />
Insolvenzen, wie die <strong>der</strong> auf die Projektierung und Realisierung spezialisierten<br />
Solar Millennium AG könnten <strong>in</strong> dem ohneh<strong>in</strong> angespannten F<strong>in</strong>anzierungsumfeld<br />
zu weiterer <strong>Zur</strong>ückhaltung bei künftigen Investitionen führen.<br />
Abbildung 5.7: Weltweit geplante CSP-Leistung (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, Greenpeace,<br />
Abengoa Solar, CSP today)<br />
Bioenergie / Biotreibstoffe<br />
Der Biogasmarkt wurde auch im Jahr 2011 vom Inlandsmarkt geprägt. Daneben<br />
versuchen die Unternehmen <strong>der</strong> Branche neue Kernmärkte zu erschließen, vor<br />
allem <strong>in</strong>nerhalb des OECD-Raums (Großbritannien, Frankreich, Österreich, Italien,<br />
Beneluxlän<strong>der</strong>). Des Weiteren liegt für viele Unternehmen e<strong>in</strong> neuer<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Auslandstätigkeit <strong>in</strong> Osteuropa. Der globale Biotreibstoffmarkt<br />
hat sich 2011 ambivalent gezeigt. So blieb die globale Bioethanol-Produktion<br />
stabil bei rd. 68 Mio. Tonnen, während die Biodiesel-Produktion leicht auf rd. 19<br />
Mio. t anstieg. Die Leitmärkte liegen weiter <strong>in</strong> den USA (rd. 43 Mio. t Bioethanol;<br />
rd. 3 Mio. t Biodiesel) und Brasilien (rd. 17 Mio. t Bioethanol; rd. 2 Mio. t Biodiesel),<br />
wobei vor allem im Biodiesel-Sektor auch <strong>der</strong> EU-Markt e<strong>in</strong>e große Rolle<br />
spielt.<br />
124
5.1.2 Deutschland: Geschäftsklima <strong>in</strong> den Unternehmen<br />
Der Geschäftsklima-Index (GKI) <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> hat nach<br />
se<strong>in</strong>em bisherigen Tiefststand im Dezember 2010 von 81 Punkten <strong>in</strong> den ersten<br />
vier Monaten des Jahres 2011 zunächst wie<strong>der</strong> bis auf e<strong>in</strong> Niveau von 98,8<br />
Punkten zugelegt. Der weitere Verlauf des regenerativen Stimmungsbarometers<br />
im Jahr 2011 ist dann durch e<strong>in</strong>e volatile Seitwärtsbewegung gekennzeichnet<br />
(Abbildung 5.8).<br />
Abbildung 5.8: Verlauf von IWR-Geschäftsklima-Index <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong><br />
und ifo-Index im von Januar 2007 bis September 2012 (Quelle:<br />
IWR, 2012)<br />
Nach e<strong>in</strong>em leichten Rückgang <strong>in</strong> den Monaten Mai und Juni konnte <strong>der</strong> Index im<br />
Juli aufgrund von Hoffnungen auf e<strong>in</strong>e verbesserte Geschäftslage zum 2. Halbjahr<br />
zunächst zulegen. Diese Erwartungen haben sich bis zum September 2011<br />
jedoch nicht bestätigt, sodass sich die Branchenstimmung, befeuert durch Euro-<br />
Krise und Turbulenzen an den Kapitalmärkten, wie<strong>der</strong> verschlechtert hat. Se<strong>in</strong>en<br />
Jahrestiefststand erreicht <strong>der</strong> Geschäftsklima<strong>in</strong>dex im Dezember 2011. Trotz <strong>der</strong><br />
politischen Krisen <strong>in</strong> den ölreichen Regionen des Nahen Ostens und Nordafrikas<br />
sowie dem Fukushima-Effekt nach <strong>der</strong> Atomkatastrophe <strong>in</strong> Japan blieb <strong>der</strong> Industrie-Index<br />
im Jahr 2011 wegen unsicherer politischer Rahmenbed<strong>in</strong>gungen,<br />
F<strong>in</strong>anzierungsschwierigkeiten sowie des hohen Preisdrucks im PV- und W<strong>in</strong>denergie-Sektor<br />
deutlich unter den bisherigen Höchstständen. Auch im Jahr 2012<br />
hat sich die E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Firmen <strong>der</strong> Regenerativbranche nicht nachhaltig<br />
gebessert. Insbeson<strong>der</strong>e die Unternehmen <strong>der</strong> Solar<strong>in</strong>dustrie haben unter <strong>der</strong> zu<br />
Anfang des Jahres erneut aufgekommenen Diskussion über e<strong>in</strong>e zusätzliche<br />
Kürzung <strong>der</strong> EEG-Vergütung für Solarstrom <strong>in</strong> Deutschland gelitten. Insolvenzen<br />
bedeuten<strong>der</strong> Solarunternehmen haben zudem die F<strong>in</strong>anzierungsschwierigkeiten<br />
<strong>der</strong> Branche offenbart. Auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergiebranche werden die Unternehmen<br />
mit Überkapazitäten und e<strong>in</strong>em anhaltenden Druck auf die Margen konfrontiert.<br />
Im Zuge <strong>der</strong> anhaltenden Schuldenkrise im Euro-Raum trübt sich ab Mai<br />
2012 auch das Stimmungsbild <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesamtwirtschaft e<strong>in</strong>.<br />
125
5.2 Zum Industriestandort NRW<br />
5.2.1 Regenerative Industriestruktur am Standort NRW<br />
Die Analyse <strong>der</strong> regenerativen Industriestruktur <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen umfasst<br />
<strong>in</strong>dustrie- und gewerbeseitig rd. 210 wichtige Unternehmen aus dem <strong>in</strong>sgesamt<br />
3.600 Firmen umfassenden IWR-Unternehmenskataster. Darunter s<strong>in</strong>d vielfach<br />
Unternehmen, die <strong>in</strong> ihren jeweiligen Sparten zu den <strong>in</strong>ternationalen Playern gezählt<br />
werden können. E<strong>in</strong> Großteil ist nach dem IWR-Analyseraster <strong>der</strong> Kategorie<br />
I (Produzenten von Komplettanlagen) zuzuordnen, die übrigen Unternehmen gehören<br />
zur Kategorie II (Dienstleister) (Abbildung 5.9) [3].<br />
Abbildung 5.9: Bewertungsschema auf <strong>der</strong> Grundlage des IWR-Klassifizierungs- und<br />
Zerlegungsansatzes für regenerative Anlagentechniken (Kategorie I)<br />
(Quelle: IWR, 2007)<br />
Zusammen mit den NRW-Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen, die an <strong>der</strong><br />
Schnittstelle zwischen Industrie und Forschung stehen, kommt diesen Unternehmen<br />
e<strong>in</strong>e hohe Bedeutung als Innovations- und Kompetenzträger für die Weiterentwicklung<br />
des regenerativen Industrie-Standortes NRW zu (vgl. Kap. 6.3).<br />
Der Vergleich <strong>der</strong> Standortstrukturen gegenüber dem Vorjahr zeigt, dass sich<br />
e<strong>in</strong>zelne Verschiebungen bed<strong>in</strong>gt durch Unternehmens<strong>in</strong>solvenzen bzw. Standortverlagerungen<br />
sowie e<strong>in</strong>ige Neuzugänge <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bilanz ergeben haben. Dennoch<br />
bleiben großflächige Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Industriestruktur aus, so dass<br />
sich die rd. 210 wichtigen NRW-Betriebe wie im Vorjahr auf rd. 170 Industriebetriebe<br />
und rd. 40 Dienstleister verteilen (Abbildung 5.10).<br />
Mit Blick auf die Verteilung <strong>der</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ansässigen Unternehmen<br />
nach Energiesparten ergeben sich ebenfalls nur vere<strong>in</strong>zelte Verän<strong>der</strong>ungen. Wie<br />
im Vorjahr stellt weiterh<strong>in</strong> <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergiesektor die größte Zahl <strong>der</strong> ansässigen<br />
Industrieunternehmen (rd. 25 Prozent), vor den Sektoren oberflächennahe Geothermie<br />
(rd. 14 Prozent) und Brennstoffzellen (rd. 11 Prozent). Ebenfalls stark<br />
vertreten s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> die Bereich Photovoltaik (rd. 10 Prozent) und Biogas (rd.<br />
9 Prozent).<br />
126
Abbildung 5.10: Industrie- und Dienstleistungsstandorte für regenerative Anlagentechniken<br />
<strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012, Datengrundlage: Unternehmensumfrage, -<br />
<strong>in</strong>formationen <strong>der</strong> Hauptkategorie I und II, Peer-Review-Gespräche)<br />
Im W<strong>in</strong>denergiesektor s<strong>in</strong>d es weiterh<strong>in</strong> die Zulieferunternehmen, die <strong>in</strong> NRW<br />
den <strong>in</strong>dustriellen Kern <strong>der</strong> Unternehmen bilden. Die ansässigen Getriebehersteller<br />
zählen z.T. zu den weltweit führenden Unternehmen <strong>der</strong> Branche. Aber auch<br />
Unternehmen, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Herstellung von Kupplungen, <strong>Lage</strong>rn, Bremsen und<br />
Gussteilen tätig s<strong>in</strong>d, halten Ihre Marktposition. Insgesamt setzten die W<strong>in</strong>dunternehmen<br />
auf e<strong>in</strong>en Ausbau <strong>der</strong> Produktionskapazitäten, dabei gew<strong>in</strong>nt vor allem<br />
<strong>der</strong> Offshore-Sektor sukzessive an Bedeutung für die Unternehmen.<br />
Demgegenüber durchlebt die PV-Industrie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ebenso wie im<br />
gesamten Bundesgebiet e<strong>in</strong>e ausgeprägte Konsolidierungsphase, die vor allem<br />
Herstellerunternehmen hart trifft. Ursächlich dafür ist <strong>der</strong> hohe Kostendruck, aufgrund<br />
<strong>in</strong>ternationaler Überkapazitäten und die stagnierende Zahl <strong>der</strong> Staaten, die<br />
auf Photovoltaik setzen. Auch <strong>in</strong> NRW mussten bereits erste Unternehmen Insolvenz<br />
anmelden, Hersteller begegnen <strong>der</strong> Krise u.a. mit Kurzarbeit. Mit <strong>der</strong> SolarWorld<br />
AG hat <strong>in</strong> Bonn e<strong>in</strong>es <strong>der</strong> weltweit größten Solarunternehmen se<strong>in</strong>en<br />
Hauptsitz <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.<br />
127
Die <strong>in</strong> NRW ansässigen Anbieter von Biogas-Komplettanlagen und BHKW-<br />
Technologie zählen weiterh<strong>in</strong> zu den wichtigen Unternehmen <strong>der</strong> Branche. Auch<br />
die NRW-Zulieferunternehmen s<strong>in</strong>d gut im Markt positioniert. Insgesamt bauen<br />
die Unternehmen im Bioenergiesektor ihre Produktionskapazitäten <strong>in</strong> NRW mit<br />
dem Ziel aus, die Auslandsaktivitäten zu erweitern und neue Märkte zu erschließen.<br />
Vor allem Osteuropa rückt dabei <strong>in</strong> den Fokus <strong>der</strong> Unternehmen.<br />
Der Standort NRW ist im Sektor Solarthermie NT vor allem im Bereich <strong>der</strong> Kollektorfertigung<br />
gut positioniert. E<strong>in</strong>ige <strong>in</strong>ternational bedeutende Hersteller haben<br />
ihren Sitz <strong>in</strong> NRW, daneben s<strong>in</strong>d im Bereich <strong>der</strong> Herstellung von Solar-<br />
Regelungen sowie bei solarthermischen Beschichtungen weitere Unternehmen<br />
<strong>der</strong> Branche mit e<strong>in</strong>em Produktionsstandort <strong>in</strong> NRW vertreten.<br />
Im Geothermiesektor s<strong>in</strong>d am Standort NRW vor allem Unternehmen auf dem<br />
Gebiet <strong>der</strong> oberflächennahen Geothermie bei <strong>der</strong> Produktion von Wärmepumpen<br />
von Bedeutung. Ebenfalls ansässig s<strong>in</strong>d Hersteller von Erdwärmesonden / Erdkollektoren<br />
sowie Bohrgerätehersteller. Die Unternehmen können ihre Position <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em aktuell ruhigen Marktumfeld behaupten.<br />
Im Sektor Tiefengeothermie ist im Bereich Kraftwerksbau e<strong>in</strong> Baukonzern als<br />
Generalunternehmer aktiv, zudem haben bedeutende Anbieter von Kühltechnologie<br />
für Kraftwerke sowie Hersteller von Bohrequipment e<strong>in</strong>en Standort <strong>in</strong> NRW.<br />
Vor allem durch den Ausbau des Internationalen Geothermiezentrums (GZB) <strong>in</strong><br />
Bochum und die angekündigte Kooperation mit <strong>der</strong> Industrie könnte <strong>der</strong> Standort<br />
NRW <strong>in</strong> Zukunft weiter profitieren.<br />
In NRW s<strong>in</strong>d zudem Unternehmen auf den noch jungen Märkten für Solarthermische<br />
Kraftwerke (CSP) bzw. Brennstoffzellen und Wasserstoff gut aufgestellt.<br />
Der Wasserstoffspezialist Air Liquide hat <strong>in</strong> Düsseldorf die erste öffentliche Wasserstofftankstelle<br />
für Pkw <strong>in</strong> NRW eröffnet [56]. Auch die ansässigen Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g-Unternehmen<br />
von CSP-Kraftwerken s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>ternational von Bedeutung.<br />
5.2.2 Arbeitsplatz- und Umsatzentwicklung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und<br />
Systembau <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Im vorliegenden Bericht werden zur Analyse <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Beschäftigung<br />
und Umsätze <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW zwei verschiedene<br />
Ansätze e<strong>in</strong>bezogen.<br />
� Umfrage-Ansatz „Regenerativer Anlagen- und Systembau“<br />
� Modellrechnung „Beschäftigung <strong>in</strong> den Bundeslän<strong>der</strong>n“<br />
Die Basis zur Ermittlung <strong>der</strong> <strong>in</strong>dustriewirtschaftlichen Effekte <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong><br />
<strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW bildet e<strong>in</strong>e Umfrage zur Analyse <strong>der</strong> Beschäftigungs-<br />
und Umsatzentwicklung. Dazu werden unter den 3.600 Betrieben (2010:<br />
3.500) des IWR-Unternehmenskatasters <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> die<br />
realen Arbeitsplätze und Umsätze im Anlagen- und Systembau erhoben (Bottom-<br />
Up-Ansatz). Beschäftigungseffekte <strong>in</strong> den Bereichen Betrieb und Wartung sowie<br />
Bereitstellung von Brenn- und Kraftstoffen werden aus statistisch-methodischen<br />
Gründen bislang nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Untersuchung erfasst. Für diese Größen können<br />
über den NRW-Anlagenbestand nur re<strong>in</strong> rechnerisch Äquivalente ermittelt werden<br />
(Top-Down-Ansatz). Dabei ist dann wie<strong>der</strong>um unklar, ob die Beschäftigungseffekte<br />
tatsächlich Firmen mit Sitz <strong>in</strong> NRW zugeschrieben werden können.<br />
128
Um die Bereiche Betrieb und Wartung sowie Kraftstoffe mit abzubilden, werden<br />
ergänzend zu den IWR-Zahlen die Ergebnisse e<strong>in</strong>er Modellrechnung von GWS<br />
und ZSW gegenübergestellt. Dabei stellen die Beschäftigungszahlen, die aus <strong>der</strong><br />
Umfrage resultieren, die Untergrenze <strong>der</strong> Beschäftigung dar, während die Beschäftigungsäquivalente,<br />
die im Rahmen <strong>der</strong> Modellrechnung ermittelt werden,<br />
eher die Obergrenze abbilden.<br />
5.2.2.1 Beschäftigung und Umsatz im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und<br />
Systembau<br />
Die Dynamik bei <strong>der</strong> Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung bei den 3.600 Unternehmen<br />
des <strong>Regenerativen</strong> Anlagen und Systembaus hat im Jahr 2011 zwar<br />
nachgelassen, ist aber <strong>in</strong>sgesamt noch positiv. Während die Beschäftigung gegenüber<br />
2010 um rd. 7 Prozent (2010: rd. 10 Prozent) zugelegt hat, ist bei den<br />
Umsätzen e<strong>in</strong> Wachstum von knapp 5 Prozent (2010 rd. 20 Prozent) zu verzeichnen<br />
(Abbildung 5.11).<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
Arbeitsplätze Umsätze [Mrd. Euro]<br />
10<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, * = vorläufig<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 5.11: Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen-<br />
und Systembau <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR, 2012)<br />
Auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Erhebung unter den Unternehmen erreicht die Beschäftigung<br />
<strong>in</strong> NRW im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau Ende 2011 rd. 28.200<br />
Mitarbeiter (Vorjahr 2010: rd. 26.500 Beschäftigte). Trotz <strong>der</strong> z.T. angespannten<br />
Geschäftslage aufgrund von <strong>in</strong>ternationalen E<strong>in</strong>flussfaktoren wie Marktverschiebungen,<br />
Margenrückgängen und Überkapazitäten haben die NRW-Unternehmen<br />
damit per Saldo auch 2011 ke<strong>in</strong>e Beschäftigungsverluste verbucht (Tabelle 5.5).<br />
Im energiespartenspezifischen Vergleich zeigt sich, dass vor allem auf dem<br />
KWK-, W<strong>in</strong>d- und Bioenergiesektor e<strong>in</strong> Beschäftigungswachstum zu verzeichnen<br />
ist. In <strong>der</strong> W<strong>in</strong>d<strong>in</strong>dustrie hat dazu offensichtlich u.a. das auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene<br />
an Fahrt gew<strong>in</strong>nende Offshore-Segment beigetragen. Im Bereich Bioenergie profitieren<br />
<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Biogas-Unternehmen, die 2011 bed<strong>in</strong>gt durch Vorzieheffek-<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*<br />
129
te <strong>in</strong>folge <strong>der</strong> seit 2012 greifenden EEG-Novelle e<strong>in</strong>e hohe Nachfrage verzeichnet<br />
haben. Der Zubau-Boom auf dem PV-Sektor kommt <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Unternehmen<br />
des Installationshandwerks, Händlern sowie Planern und Projektierern<br />
zu Gute. Schwieriger ist dagegen die wirtschaftliche Situation <strong>der</strong> PV-Hersteller-<br />
Industrie. Hier sehen sich die Unternehmen verstärkt mit <strong>der</strong> Konkurrenz aus<br />
Asien, vor allem aus Ch<strong>in</strong>a, konfrontiert.<br />
Die meisten Arbeitsplätze entfallen mit über 8.000 Beschäftigten auf die W<strong>in</strong>d<strong>in</strong>dustrie.<br />
Darauf folgen Unternehmen des Solarenergiesektors (rd. 7.900 Arbeitsplätze),<br />
vor Betrieben des Bioenergiesegmentes (knapp 3.900 Beschäftigte).<br />
Tabelle 5.5: Die NRW-Beschäftigung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, eigene Erhebung)<br />
Energiesparte 2011 1 2010 2009 2008<br />
W<strong>in</strong>denergie 8.151 7.229 6.559 6.315<br />
Solarenergie<br />
(Photovoltaik, Solarthermie<br />
und Solararchitektur)<br />
7.894 7.626 6.677 5.497<br />
Bioenergie 3.846 3.575 3.418 3.472<br />
Querschnitts-Dienstleister<br />
(W<strong>in</strong>d, Solar, Wasser, Bio etc.)<br />
Sonstige<br />
Installationsbetriebe<br />
2.449 2.351 2.267 2.471<br />
2.430 2.391 2.014 1.697<br />
Geoenergie 1.617 1.544 1.362 1.063<br />
Brennstoffzelle 866 875 943 1.080<br />
KWK 805 709 693 670<br />
Wasserkraft 163 168 161 163<br />
Gesamt 2 28.220 26.470 24.090 22.430<br />
1= vorläufige Daten, 2 = gerundet<br />
Relativ stabil und <strong>in</strong> etwa auf Vorjahresniveau ist das Beschäftigungsaufkommen<br />
bei den energiespartenübergreifend tätigen Dienstleistungsunternehmen (rd.<br />
2.450 Arbeitsplätze) sowie den <strong>in</strong> verschiedenen regenerativen Teilsparten tätigen<br />
Installationsbetrieben (rd. 2.400 Beschäftigte).<br />
Parallel mit <strong>der</strong> Beschäftigung steigen auch die Umsätze <strong>der</strong> NRW-Unternehmen<br />
des <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembaus. Bezogen auf die Grundgesamtheit<br />
<strong>der</strong> 3.600 Unternehmen ist e<strong>in</strong> Umsatzwachstum um knapp 5 Prozent auf<br />
etwa 8,7 Mrd. Euro zu verzeichnen (Vorjahr 2010: 8,3 Mrd. Euro) (Tabelle 5.6).<br />
Gestützt durch die anhaltend hohe Nachfrage nach PV-Technik rangiert <strong>der</strong> Solarenergiesektor<br />
mit rd. 4,1 Mrd. Euro auch 2011 <strong>in</strong> Bezug auf die Umsätze auf<br />
dem ersten Rang. Im Vergleich zum Vorjahr 2010 ist <strong>der</strong> Umsatz bed<strong>in</strong>gt durch<br />
den hohen Margendruck auf dem PV-Sektor damit allerd<strong>in</strong>gs leicht rückläufig. An<br />
zweiter Stelle liegen die Unternehmen des W<strong>in</strong>denergiesektors (rd. 2,1 Mrd. Euro)<br />
mit deutlichem Abstand vor <strong>der</strong> Bioenergiebranche. Hier konnten die Unter-<br />
130
nehmen dank <strong>der</strong> bundesweit guten Konjunktur des Biogassektors im Jahr 2011<br />
erstmals e<strong>in</strong>en Umsatz von mehr als 1 Mrd. Euro erzielen.<br />
Bei den Betrieben des Installationshandwerks (rd. 430 Mio. Euro) sowie den<br />
energiespartenübergreifend tätigen Dienstleistern (rd. 380 Mio. Euro) verbleiben<br />
die Umsätze <strong>in</strong> etwa auf Vorjahresniveau (Tabelle 5.6).<br />
Tabelle 5.6: Die NRW-Umsätze im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR, eigene Erhebung)<br />
Angaben <strong>in</strong> Mio. Euro<br />
Energiesparten 2011 1 2010 2009 2008<br />
Solarenergie<br />
(Photovoltaik, Solarthermie<br />
und Solararchitektur)<br />
4.069,5 4.147,0 3.158,4 2.523,9<br />
W<strong>in</strong>denergie 2.083,5 1.947,4 1.898 1.957,9<br />
Bioenergie 1.180,7 960,8 712,6 882,4<br />
Sonstige<br />
Installationsbetriebe<br />
Querschnitts-Dienstleister<br />
(W<strong>in</strong>d, Solar, Wasser, Bio etc.)<br />
433,4 443,7 399,2 368,5<br />
378,4 364,5 329,4 431,8<br />
Geoenergie 278,9 223,8 204,0 180,3<br />
KWK 249,2 216,1 193,9 214,8<br />
Brennstoffzelle 18,1 16,3 21,8 14,2<br />
Wasserkraft 16,0 16,9 15 15,1<br />
Gesamt 2 8.708 8.337 6.932 6.589<br />
1= vorläufige Daten, 2 = gerundet<br />
131
5.2.2.2 Bus<strong>in</strong>ess as usual-Szenario - Beschäftigung im Anlagen- und<br />
Systembau<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
0<br />
Gesamtbeschäftigung Anlagen- und Systembau<br />
Abbildung 5.12: Entwicklung <strong>der</strong> Gesamtbeschäftigung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und<br />
Systembau gemäß „Bus<strong>in</strong>ess as usual Szenario“ von 2005 bis 2020<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Beschäftigung 2011<br />
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019<br />
© IWR, 2012<br />
Das IWR hat im Jahr 2009 vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> Zielsetzung <strong>der</strong> ehemaligen<br />
NRW-Landesregierung, die Beschäftigung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau<br />
bis zum Jahr 2020 auf 40.000 Arbeitsplätze zu erhöhen, e<strong>in</strong> „Bus<strong>in</strong>ess as<br />
usual Szenario“ entwickelt. Der Ansatz beschreibt die mögliche Entwicklung <strong>der</strong><br />
Beschäftigung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau bis zum Jahr 2020<br />
unter <strong>der</strong> Annahme, dass ke<strong>in</strong>e zusätzlichen <strong>in</strong>dustriepolitischen Steuerungsmaßnahmen<br />
ergriffen werden. Die Fortschreibung <strong>der</strong> ursprünglich bis zum Jahr<br />
2008 ermittelten Beschäftigungsentwicklung führt zu <strong>der</strong> <strong>in</strong> Abbildung 5.12 dargestellten<br />
Spanne. Demnach würde die Beschäftigung im Jahr 2020 zwischen<br />
etwa 30.000 bis 45.000 Beschäftigten liegen.<br />
Diese Bandbreite ergibt sich aufgrund von ökonomischen Faktoren, die sich nur<br />
schwer abschätzen lassen, die Beschäftigung aber bee<strong>in</strong>trächtigen können. Dazu<br />
gehören z.B. Skaleneffekte o<strong>der</strong> die Verlagerung von Arbeitsplätzen <strong>in</strong> das<br />
Ausland. Der für das Jahr 2011 im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und Systembau ermittelte<br />
Beschäftigungswert von 28.200 Arbeitsplätzen liegt im Trendkanal <strong>der</strong> im<br />
Szenario 2008 dargestellten Beschäftigungsbandbreite.<br />
5.2.2.3 Exkurs: Modellierungsansätze „Beschäftigungseffekte erneuerbarer<br />
Energien auf Bundes- und Landesebene“<br />
Im Auftrag des Bundesumweltm<strong>in</strong>isteriums (BMU) werden bereits seit längerer<br />
Zeit durch e<strong>in</strong> Projektkonsortium von DLR, DIW, ZSW etc. die potenziellen Beschäftigungseffekte<br />
erneuerbarer Energien auf Bundesebene auf rechnerischem<br />
Wege ermittelt. Zusätzlich wurden jüngst im Auftrag des BMU ausgehend von<br />
den Bundesergebnissen jetzt auch die potenziellen Beschäftigungseffekte er-<br />
132
neuerbarer Energien <strong>in</strong> den Bundeslän<strong>der</strong>n abgeleitet. Die Analyse <strong>der</strong> Beschäftigungseffekte<br />
erfolgt <strong>in</strong> beiden Fällen durch e<strong>in</strong>en modelltheoretischen Verfahrensansatz<br />
(Input-Output-Analyse). Im Ergebnis werden auf <strong>der</strong> Datenbasis von<br />
e<strong>in</strong>gesetzten Vorprodukten und Produktionsfaktoren <strong>in</strong> Abhängigkeit von den<br />
produzierten Gütermengen für den jeweiligen Wirtschaftszweig die potenziellen<br />
Beschäftigungseffekte auf den e<strong>in</strong>zelnen Wertschöpfungsstufen regenerativer<br />
Energiesysteme rechnerisch abgebildet. Die Modellierung <strong>der</strong> Beschäftigungseffekte<br />
für die Bundeslän<strong>der</strong> erfolgt ausgehend von den Bundeszahlen unter zusätzlicher<br />
E<strong>in</strong>beziehung von regionalspezifischen Annahmen und Indikatoren. In<br />
beiden Analyseansätzen (Bund und Län<strong>der</strong>) wird differenziert zwischen Beschäftigungseffekten,<br />
die durch den Bau neuer Anlagen (Herstellung und Installation),<br />
Betrieb und Wartung sowie die Bereitstellung von Brenn- und Kraftstoffen entstehen<br />
[7].<br />
In <strong>der</strong> Studie „<strong>Zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong>“ ermittelt das IWR<br />
seit mehreren Jahren die Beschäftigung und die Umsätze <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong><br />
Energiebranche mittels e<strong>in</strong>es Erhebungsansatzes. Per Umfrage unter den NRW-<br />
Firmen werden die entsprechenden Kennzahlen von den ansässigen NRW-<br />
Unternehmen erhoben. Dabei werden explizit die Daten zu den Arbeitsplätzen<br />
und Umsätzen ermittelt, die real dem Wirtschaftszweig erneuerbare Energien zuzuordnen<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Die auf diesem Weg ermittelten Daten bilden die Untergrenze <strong>der</strong> realen Beschäftigung<br />
ab, da nicht sämtliche Unternehmen befragt werden können. Demgegenüber<br />
bietet die BMU-Modellrechnung den Vorteil, dass dort sämtliche rechnerisch<br />
möglichen Beschäftigungseffekte abgeschätzt werden. Da auf <strong>der</strong> Faktorenebene<br />
gerechnet wird, ergeben sich jedoch ke<strong>in</strong>e Arbeitsplatzzahlen, son<strong>der</strong>n<br />
Beschäftigungsäquivalente, die die obere Grenze <strong>der</strong> realen Beschäftigung abbilden.<br />
Die auf diese Weise bestimmte Bruttobeschäftigung übersteigt die per<br />
Umfrage erhobenen Beschäftigungszahlen naturgemäß.<br />
Modellergebnisse: Beschäftigungseffekte <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Insgesamt erreichen die Beschäftigungseffekte erneuerbarer Energien auf <strong>der</strong><br />
Basis von Beschäftigungsäquivalenten <strong>in</strong> Deutschland nach dem BMU-<br />
Modellansatz im Jahr 2011 rechnerisch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung von 372.000.<br />
Davon entfällt <strong>der</strong> größte Anteil (rd. 242.000) auf den Bereich „Investitionen <strong>in</strong><br />
neue Anlagen“. Für den Bereich „Betrieb und Wartung“ ergibt sich e<strong>in</strong>e Größenordnung<br />
von 75.800 und für die „Brenn- und Kraftstoffbereitstellung“ e<strong>in</strong> Wert von<br />
54.200. Ausgehend von <strong>der</strong> rechnerisch ermittelten BMU-Bundeszahl werden die<br />
NRW-Zahlen erneut modelliert und aus <strong>der</strong> Gesamtzahl abgeleitet.<br />
Für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Projektionsuntersuchung auf <strong>der</strong> Bundesland-Ebene<br />
Beschäftigungsäquivalente von rd. 36.000 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorie „Investitionen<br />
<strong>in</strong> neue Anlagen“, rd. 11.000 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorie „Betrieb und Wartung“ sowie<br />
Effekte von rd. 7.000 im Bereich Bereitstellung von „Brenn- und Kraftstoffen“ ermittelt.<br />
In Summe ergeben sich auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> BMU-Studie potenzielle<br />
NRW-Brutto-Beschäftigungseffekte von rd. 54.000.<br />
Im Unterschied und zur Abgrenzung <strong>der</strong> o.g. Modellierungsergebnisse erfolgt im<br />
Rahmen dieser Studie aus methodisch-erhebungstechnischen Gründen bisher<br />
e<strong>in</strong>e Befragung <strong>der</strong> NRW-Unternehmen ausschließlich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorie Anlagenund<br />
Systembau. Hier ergibt sich nach <strong>der</strong> IWR-Untersuchung mit etwa 28.000<br />
133
Beschäftigten im Vergleich zur BMU-Modellierung (Beschäftigungsäquivalente:<br />
36.000) e<strong>in</strong> um etwa 20 Prozent niedrigerer Wert. E<strong>in</strong> Grund für diese Differenz<br />
dürfte dar<strong>in</strong> zu sehen se<strong>in</strong>, dass die als Bruttobeschäftigung rechnerisch ermittelten<br />
Größen <strong>in</strong> Form von Arbeitsplatzäquivalenten die statistische Obergrenze für<br />
die Beschäftigung abbilden und die realen Zahlen eher überzeichnen. Die Zahlen<br />
für die Nettobeschäftigung, die per Umfrage erhoben wurden, liegen dagegen darunter<br />
und stellen die Untergrenze <strong>der</strong> NRW-Beschäftigung dar. Insbeson<strong>der</strong>e im<br />
Bereich kle<strong>in</strong>teiliger Vorprodukte für e<strong>in</strong>zelne Zulieferunternehmen ist es im<br />
Rahmen <strong>der</strong> IWR-Erhebung unter den NRW-Unternehmen schwierig, im Detail<br />
nachzuhalten, für welche Endprodukte die Zulieferunternehmen auftragsgemäß<br />
liefern. Somit ist auch e<strong>in</strong>e Zuordnung von Arbeitsplätzen auf den EE-Bereich<br />
nicht immer möglich. Zudem ist es für den Datenvergleich relevant, dass die<br />
IWR-Zahlen potenzielle Beschäftigungseffekte <strong>in</strong> den Bereichen „Betrieb und<br />
Wartung“ bzw. „Brenn- und Kraftstoffbereitstellung“ bisher nicht enthalten.<br />
5.2.2.4 Exkurs: Aspekte kommunaler Wertschöpfung durch erneuerbare<br />
Energien <strong>in</strong> NRW<br />
Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat im Auftrag des Landes<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen e<strong>in</strong>e Studie zur kommunalen Wertschöpfung aus erneuerbaren<br />
Energien <strong>in</strong> NRW durchgeführt [57]. Der Fokus <strong>der</strong> Untersuchung<br />
liegt dabei auf dem Vergleich zweier Modellkommunen. So wird <strong>der</strong> Kreis Ste<strong>in</strong>furt<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Studie als kommunale Gebietskörperschaft für e<strong>in</strong>e ländlich<br />
geprägte Struktur herangezogen, als Vertreter e<strong>in</strong>er urbaneren Struktur wird die<br />
Stadt Bochum betrachtet. Als Grundkriterium werden jedoch beide Gebietskörperschaften<br />
als EE-Vorreiter-Gebiete e<strong>in</strong>gestuft, d.h. dass möglichst viele EE-<br />
Wertschöpfungsketten abgebildet werden können.<br />
In den ausgewählten Regionen wird dann anhand e<strong>in</strong>es vom IÖW im Jahr 2010<br />
entwickelten Modells die kommunale Wertschöpfung an den verschiedenen Stufen<br />
<strong>der</strong> jeweils vorhandenen Wertschöpfungsketten ermittelt.<br />
Diese Untersuchung erfolgt zum e<strong>in</strong>en für das Bezugsjahr 2011, darüber h<strong>in</strong>aus<br />
werden Szenarien für die weitere Entwicklung an den Standorten bis zum Jahr<br />
2020 und 2050 entworfen.<br />
Im Ergebnis ergeben sich für den Kreis Ste<strong>in</strong>furt kommunale Wertschöpfungsund<br />
Beschäftigungseffekte durch erneuerbare Energien <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung<br />
von 46,2 Mio. Euro und 834 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2011. Bis zum Jahr<br />
2020 steigt die kommunale Wertschöpfung dem Szenario zufolge auf 107,6 Mio.<br />
Euro und bis 2050 auf 143,7 Mio. Euro. Parallel nimmt die Anzahl <strong>der</strong> Vollzeitäquivalente<br />
im Kreis Ste<strong>in</strong>furt von 834 im Jahr 2011 auf 1.391 <strong>in</strong> 2020 und 1.788<br />
<strong>in</strong> 2050 zu.<br />
In <strong>der</strong> Stadt Bochum erreichen die kommunalen Wertschöpfungseffekte durch<br />
erneuerbare Energien im Jahr 2011 Werte von 19,2 Mio. Euro und 318 Vollzeitstellen.<br />
Im Szenario bis 2020 steigt die kommunale Wertschöpfung auf 22,4 Mio.<br />
Euro und bis 2050 auf 31,7 Mio. Euro. Die Zahl <strong>der</strong> EE-Vollzeitäquivalente steigt<br />
demnach auf 359 <strong>in</strong> 2020 und 407 <strong>in</strong> 2050.<br />
Im Vergleich zeigt sich, dass die unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen<br />
<strong>in</strong> den Kommunen entsprechend angepasste Strategien zur Folge haben.<br />
Während <strong>in</strong> <strong>der</strong> ländlichen Umgebung des Landkreises Ste<strong>in</strong>furt vor allem <strong>der</strong><br />
134
Betrieb von Biogas-, Photovoltaik- und W<strong>in</strong>denergieanlagen e<strong>in</strong>e große Rolle für<br />
die Wertschöpfung vor Ort spielt, ist im urban geprägten Bochum <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
die Produktion von regenerativen Anlagen und Komponenten e<strong>in</strong> treiben<strong>der</strong> Faktor.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund dieser Ergebnisse kommt die Studie zu dem Fazit, dass<br />
sowohl <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> regenerativen Energieerzeugung als auch die Ansiedlung<br />
von produzierenden Unternehmen entscheidend für die Etablierung kommunaler<br />
Wertschöpfungseffekte und die Entstehung von Arbeitsplätzen vor Ort s<strong>in</strong>d.<br />
135
5.2.3 <strong>Zur</strong> konjunkturellen Situation <strong>der</strong> NRW-Unternehmen des <strong>Regenerativen</strong><br />
Anlagen- und Systembaus 2011 und 2012 – Zentrale Entwicklungen<br />
und Trends<br />
Die konjunkturelle Situation <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> im Jahr 2011<br />
wird von den <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ansässigen Unternehmen rückblickend sehr<br />
positiv beurteilt. Zum Umfragezeitpunkt (März/April 2012) stufen die Unternehmen<br />
die Geschäftslage für 2011 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Retrospektive deutlich besser e<strong>in</strong> als die<br />
im Jahr 2010. Jedoch wird die Entwicklung im eigenen Geschäftsbereich weiterh<strong>in</strong><br />
schwächer e<strong>in</strong>gestuft, als die Entwicklung <strong>der</strong> Gesamtwirtschaft. Dies ist neben<br />
weiterh<strong>in</strong> bestehenden F<strong>in</strong>anzierungsschwierigkeiten <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auf den<br />
verschärften Wettbewerb <strong>in</strong> verschiedenen Sparten sowie auf die Auswirkungen<br />
<strong>der</strong> politischen Diskussionen rund um das EEG-Vergütungssystem und die Energiewende<br />
zurückzuführen. Mit Blick auf die regenerativen Teilsparten ergeben<br />
sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bewertung <strong>der</strong> Geschäftslage 2011 teilweise deutliche Unterschiede<br />
(Abbildung 5.13).<br />
Die positiven E<strong>in</strong>schätzungen <strong>der</strong> Unternehmen stehen dabei zunächst im Wi<strong>der</strong>spruch<br />
zur aktuellen Entwicklung <strong>der</strong> Branche. So häufen sich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
im PV-Bereich die Insolvenz-Meldungen. Allerd<strong>in</strong>gs haben 2011 auf dem PV-<br />
Sektor vor allem Vorzieheffekte im Vorfeld <strong>der</strong> EEG-Anpassung dazu geführt,<br />
dass <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Planungsunternehmen und das Handwerk das Jahr positiv<br />
abschließen konnten. Für 2012 bricht die Bewertung <strong>der</strong> Geschäftslage im<br />
PV-Sektor dann deutlich e<strong>in</strong>. Auch bei den Biogasfirmen wirken sich 2011 die<br />
EEG-<strong>in</strong>duzierten Vorzieheffekte positiv auf die Geschäftslage aus. Auf dem<br />
W<strong>in</strong>denergiesektor profitieren die NRW-Unternehmen, die im Kern zu den Zulieferern<br />
zu zählen s<strong>in</strong>d, von <strong>der</strong> besseren Auftragsentwicklung <strong>in</strong> Deutschland und<br />
Europa.<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Anteile [%]<br />
W<strong>in</strong>d Thermie Geo Bio KWK PV Wasser<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, eigene Erhebung („ke<strong>in</strong>e Angabe“ nicht berücksichtigt)<br />
Abbildung 5.13: Geschäftslage <strong>der</strong> NRW-Unternehmen nach regenerativen Teilsparten<br />
im Jahr 2011 (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> anhaltenden Diskussionen um steigende Strompreise<br />
und EEG-Vergütungen wird die Geschäftslage im Jahr 2012 durch die Unternehmen<br />
deutlich schwächer bewertet.<br />
gut<br />
befriedigend<br />
schlecht<br />
© IWR, 2012<br />
136
W<strong>in</strong>denergie: NRW-Zuliefer<strong>in</strong>dustrie profitiert von stärkerem Europa-Markt<br />
Der NRW-W<strong>in</strong>denergiesektor weist im Jahr 2011 e<strong>in</strong>e grundsätzlich positive Entwicklung<br />
auf. So ist die Beschäftigung <strong>in</strong> den Unternehmen um rd. 13 Prozent auf<br />
knapp 8.200 Mitarbeiter gestiegen (2010: 7.200), während die Umsätze <strong>der</strong> Unternehmen<br />
um knapp 7 Prozent auf rd. 2,1 Mrd. angewachsen s<strong>in</strong>d (2010: 1,95<br />
Mrd. Euro). Die Geschäftslage des Jahres 2011 beurteilen dabei rd. zwei Drittel<br />
<strong>der</strong> befragten Unternehmen rückblickend positiv. Mit Blick auf die weitere Entwicklung<br />
im Jahr 2012 wird die <strong>Lage</strong> von den Unternehmen zum Umfragezeitpunkt<br />
zwar positiv e<strong>in</strong>gestuft, auf Jahressicht rechnen die meisten Unternehmen<br />
jedoch mit e<strong>in</strong>er Stagnation. Dabei spielt vor allem die sich abzeichnende Marktbelebung<br />
<strong>in</strong> Deutschland und Europa e<strong>in</strong>e Rolle.<br />
Solarenergie: PV-Branche getragen durch Vorzieheffekte, Markte<strong>in</strong>bruch <strong>in</strong><br />
2012 erwartet - Solarthermie-Markt stagniert<br />
Die Solarbranche hat e<strong>in</strong> turbulentes Jahr 2011 h<strong>in</strong>ter sich. Die Unternehmen des<br />
NRW-Photovoltaiksektors bewerten die Geschäftslage des Jahres 2011 zu rd.<br />
zwei Dritteln positiv, im Solarthermie-Sektor wird die Entwicklung deutlich<br />
schlechter beurteilt. Im Solarwärmebereich wirkte sich 2011 <strong>der</strong> Markte<strong>in</strong>bruch<br />
aus dem Vorjahr noch aus, obwohl das Bundesumweltm<strong>in</strong>isterium noch die Konditionen<br />
im Marktanreizprogramm verbessert hatte. Die PV-Unternehmen profitierten<br />
vor allem von den Vorzieheffekten zum Jahresende, die aus <strong>der</strong> anstehenden<br />
Kürzung <strong>der</strong> EEG-Vergütungen resultierten. Zu kämpfen hat die Branche<br />
allerd<strong>in</strong>gs mit starkem Preis- und Margendruck, was sich auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Entwicklung<br />
<strong>der</strong> Umsätze nie<strong>der</strong>schlägt. So s<strong>in</strong>ken die Umsätze <strong>in</strong> <strong>der</strong> NRW-Solarbranche<br />
2011 um rd. 2 Prozent auf knapp 4,07 Mrd. Euro (2010: 4,15 Mrd. Euro). Die Zahl<br />
<strong>der</strong> Beschäftigten steigt dagegen um rd. 3,5 Prozent auf rd. 7.900 an (2010:<br />
7.600). Mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung rechnen im PV-Sektor rd.<br />
zwei Drittel <strong>der</strong> Unternehmen mit e<strong>in</strong>er schlechteren Geschäftslage im Jahr 2012,<br />
im Solarthermie-Sektor wird überwiegend e<strong>in</strong>e Stagnation erwartet.<br />
Bioenergiebranche wächst 2011 durch Biogasvorzieheffekte – Rückgang <strong>in</strong><br />
2012 erwartet<br />
Die Bioenergie-Unternehmen <strong>in</strong> NRW beurteilen die Geschäftslage des vergangenen<br />
Jahres mehrheitlich positiv, zum Umfragezeitpunkt trübt sich dieses Bild<br />
jedoch bereits e<strong>in</strong>. Auch für den Rest des Jahres rechnet rd. die Hälfte <strong>der</strong> Unternehmen<br />
mit e<strong>in</strong>er Stagnation <strong>der</strong> Geschäftslage. Beson<strong>der</strong>e Wachstumsimpulse<br />
s<strong>in</strong>d auch vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> aufkommenden Tank-Teller-Diskussion<br />
<strong>der</strong>zeit nicht zu erkennen. Im Biogassektor hatten die Unternehmen im Jahr 2011<br />
zudem von Vorzieheffekten profitiert, 2012 verläuft dagegen für die Unternehmen<br />
deutlich schlechter. Die Beschäftigung im NRW-Bioenergiesektor stieg im Jahr<br />
2011 auf rd. 3.850 Mitarbeiter an (2010: rd. 3.600), während die Umsätze e<strong>in</strong><br />
deutliches Plus von rd. 23 Prozent aufweisen und auf 1,2 Mrd. Euro klettern.<br />
Geothermiesektor mit stagnieren<strong>der</strong> Geschäftslage<br />
Die Unternehmen des NRW-Geothermiesektors beurteilen die Geschäftslage für<br />
2011 verhalten positiv, zum Umfragezeitpunkt zeigt sich bereits e<strong>in</strong>e Stagnation<br />
bei <strong>der</strong> konjunkturellen Entwicklung. Auf Jahressicht sehen die Firmen ebenfalls<br />
e<strong>in</strong>e gleichbleibende Geschäftslage. 2011 stieg die Beschäftigung um rd. 5 Pro-<br />
137
zent auf rd. 1.600 Personen (2010: 1.550), die Umsätze s<strong>in</strong>d um rd. 25 Prozent<br />
auf rd. 280 Mio. Euro (2010: 220 Mio. Euro) gestiegen.<br />
5.2.4 Status quo - Industriestruktur und Konjunktur nach Sparten<br />
5.2.4.1 W<strong>in</strong>denergie<br />
Tabelle 5.7: NRW-Industriestruktur und Konjunktur im Bereich W<strong>in</strong>denergie<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Konjunktur und <strong>in</strong>dustriewirtschaftliche Effekte<br />
� International: Weltmarkt mit Zubau von rd. 41.000 MW erstmals über 40.000<br />
Stand<br />
MW-Marke (2010: 38.000 MW), Ch<strong>in</strong>a an <strong>der</strong> Spitze (18.000 MW) vor den<br />
USA (6.800 MW), Marktvolumen zwischen 40 und 44 Mrd. Euro<br />
� National / NRW: Ausbau <strong>in</strong> Deutschland steigt um etwa e<strong>in</strong> Drittel auf 2.000<br />
MW (<strong>in</strong>ternational auf Platz 4); Markt erholt sich vom schwächeren Jahr<br />
2010<br />
� Europäischer Offshore-Markt zieht an, Nationaler Offshore-Markt 2011 nur<br />
mit ger<strong>in</strong>gem Zubau, Unsicherheiten über Netzanschluss verzögern Projekte<br />
� nationaler Repower<strong>in</strong>g-Markt hat 2011 an Bedeutung gewonnen, Anteil<br />
jedoch weiterh<strong>in</strong> sehr ger<strong>in</strong>g<br />
� International: F<strong>in</strong>anzierungsschwierigkeiten aufgrund volatiler F<strong>in</strong>anzmärkte<br />
Perspektiven<br />
durch die Eurokrise, <strong>in</strong> Europa dennoch Marktbelebung erwartet, <strong>in</strong> den USA<br />
Vorzieheffekte durch auslaufende Production Tax Credits (PTC)<br />
� National: stabiler Aufwärtstrend für 2012 erwartet<br />
� Offshore: starker Ausbau für 2012 <strong>in</strong> Europa erwartet, Ähnliche Entwicklungen<br />
für Deutschland <strong>in</strong> den Folgejahren zu erwarten<br />
� konjunkturelle Perspektiven für 2012 positiv<br />
� NRW-Beschäftigung im W<strong>in</strong>dsektor steigt um rd. 13 % auf etwa 8.200 Mitar-<br />
Beschäftigung und<br />
beiter<br />
Umsatz <strong>in</strong> NRW<br />
� Umsatz <strong>der</strong> NRW-W<strong>in</strong>dfirmen nimmt um etwa 7 % auf knapp 2,1 Mrd. Euro<br />
zu<br />
Struktur des Industriestandortes<br />
NRW-Hersteller<strong>in</strong>dustrie<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> NRW<br />
Dienstleister <strong>in</strong> NRW<br />
� wenig Hersteller<strong>in</strong>dustrie<br />
� NRW-Industrieunternehmen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorie I des IWR-Analyserasters v.a.<br />
<strong>in</strong> folgenden Bereichen aktiv:<br />
- Getriebebau,<br />
- Kupplungen,<br />
- (Wälz-)<strong>Lage</strong>r,<br />
- Gussteile,<br />
- Rotorblattkomponenten,<br />
- Bremsen,<br />
- Mess- und Kontrolltechnik,<br />
- WEA-Türme,<br />
- Fundamente und Gründungen<br />
� NRW-Getriebebauer gehören zur Gruppe <strong>der</strong> globalen Player, gute Marktposition<br />
<strong>der</strong> Unternehmen bei Kupplungen, <strong>Lage</strong>rn, Bremsen und Gussteilen<br />
� wichtige Dienstleistungsunternehmen aus dem Projektierungs- und Servicesektor<br />
(<strong>in</strong>ternationale Aktivitäten) <strong>in</strong> NRW ansässig<br />
138
Tabelle 5.7: NRW-Industriestruktur und Konjunktur im Bereich W<strong>in</strong>denergie<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
NRW-Player<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Getriebe: W<strong>in</strong>ergy (Voerde), Bosch Rexroth (Witten), Jahnel-Kestermann<br />
(Bochum), Eickhoff (Bochum), Rickmeier (Balve), Moventas (Wuppertal)<br />
� Kupplungen: KTR (Rhe<strong>in</strong>e), Flen<strong>der</strong> (Bocholt-Mussum)<br />
� <strong>Lage</strong>r: Rothe Erde (Dortmund / Lippstadt), Schaeffler (FAG) (Wuppertal)<br />
� Gussteile: Babcock Gießerei (Oberhausen), Siempelkamp (Krefeld), Friedrich<br />
Wilhelms-Hütte Eisenguss (Mülheim a. d. Ruhr), Kappel (D<strong>in</strong>slaken)<br />
� Rotorblattkomponenten: Saertex (Saerbeck), Momentive Specialty Chemicals<br />
(Duisburg), Kümpers (Rhe<strong>in</strong>e), Bosch Rexroth (Witten), Moog (Unna)<br />
� Bremsen: Hann<strong>in</strong>g und Kahl (Oerl<strong>in</strong>ghausen), Beckmann Volmer (Rhe<strong>in</strong>e)<br />
� Dienstleister: BBB Umwelttechnik (Gelsenkirchen), eviag (Duisburg)<br />
� Sonstige: nkt cables (Köln)<br />
� Weitere Internationalisierung durch Aufbau <strong>in</strong>ternationaler Produktionsstandorte<br />
� Vere<strong>in</strong>zelte Übernahmen durch nationale und <strong>in</strong>ternationale Unternehmen<br />
� NRW weiterh<strong>in</strong> wichtiger Standort im Bereich <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergie-Zuliefer<strong>in</strong>dustrie<br />
(v.a. WEA-Antriebstechnik, d.h. Getriebe, Kupplungen etc.)<br />
� Offshore-Branche zunehmend auch <strong>in</strong> NRW von Bedeutung (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
bei den Zulieferern<br />
139
5.2.4.2 Bioenergie<br />
Tabelle 5.8: NRW-Industriestruktur und Konjunktur <strong>in</strong> den verschiedenen Bereichen<br />
des Bioenergiesektors (Quelle: IWR, 2012)<br />
Konjunktur nach Sektoren<br />
Stand Biogas<br />
Perspektiven Biogas<br />
Stand Biomasse-HKW<br />
Perspektiven<br />
Biomasse-HKW<br />
Stand Biomasseheizungen<br />
Perspektiven<br />
Biomasseheizungen<br />
Beschäftigung und<br />
Umsatz <strong>in</strong> NRW Bioenergie<br />
gesamt<br />
� International: Auslandsmarkt noch im Aufbau, Osteuropa rückt <strong>in</strong> den Blickpunkt<br />
� National / NRW: Rekordzuwachs <strong>in</strong> 2011: 1.300 Anlagen mit 550 MWel;<br />
Rekor<strong>der</strong>gebnisse auch für Unternehmen; NRW-Unternehmen auf neuen<br />
Märkten aktiv (<strong>in</strong>sb. nach Osteuropa)<br />
� Geschäftslage <strong>der</strong> NRW-Unternehmen <strong>in</strong> 2011 zufriedenstellend (Bioenergie<br />
gesamt)<br />
� International: Auslandsmärkte vor allem <strong>in</strong> West- und Mitteleuropa, Perspektivmärkte<br />
<strong>in</strong> Osteuropa<br />
� National / NRW: Vorzieheffekte <strong>in</strong> 2011, Marktrückgang aufgrund schlechterer<br />
rechtlicher Rahmenbed<strong>in</strong>gungen durch EEG 2012 erwartet; Biogas-<br />
E<strong>in</strong>speisung: Schleppende Entwicklung beim Ausbau <strong>der</strong> Direkte<strong>in</strong>speisung<br />
� Repower<strong>in</strong>g und Gasspeicher gew<strong>in</strong>nen an Bedeutung<br />
� International: Auslandsmärkte legen mo<strong>der</strong>at zu, US-Markt führend<br />
� National / NRW: mo<strong>der</strong>ater Zubau, Markt zieht <strong>in</strong> 2011 leicht an<br />
� Geschäftslage <strong>der</strong> NRW-Unternehmen <strong>in</strong> 2011 zufriedenstellend (Bioenergie<br />
gesamt)<br />
� International: Trend geht zu Co-Feuerung von Biomasse <strong>in</strong> Kohlekraftwerken<br />
zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, Biomasse-HKW erwächst<br />
dadurch Nutzungskonkurrenz<br />
� National / NRW: Zubau nur noch <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en und mittleren Anlagenklassen<br />
erwartet, Brennstoffkosten bremsen weitere Marktentwicklung<br />
� konjunkturelle Perspektiven <strong>der</strong> NRW-Unternehmen <strong>in</strong>sgesamt verhalten,<br />
Export-Perspektiven werden positiver beurteilt (Bioenergie gesamt)<br />
� International: Deutschland im Bereich <strong>der</strong> Pelletproduktion <strong>in</strong> <strong>der</strong> Spitzengruppe<br />
� National / NRW: Anzahl <strong>der</strong> Pelletheizungen steigt auf rd. 155.000 (Vorjahr:<br />
140.000)<br />
� International: ke<strong>in</strong>e erkennbaren Marktimpulse<br />
� National / NRW: deutliches Wachstum bei den Pelletheizungen 2012 erwartet;<br />
Erhöhte För<strong>der</strong>ung im Rahmen des Marktanreizprogramms belebt die<br />
Branche<br />
� NRW-Beschäftigung im Bioenergiesektor 2011 bei fast 3.850 Beschäftigten<br />
(2010: rd. 3.600)<br />
� Umsatzsteigerung mit e<strong>in</strong>em Plus von rd. 23 % auf rd. 1,2 Mrd. Euro (2009:<br />
ca. 960 Mio. Euro)<br />
Struktur des Industriestandortes und Branchen-Entwicklung <strong>in</strong> NRW<br />
Biogas Hersteller<strong>in</strong>dustrie<br />
<strong>in</strong> NRW<br />
� NRW-Anbieter von schlüsselfertigen Komplettanlagen und Blockheizkraftwerken<br />
zählen im Biogassektor zu den wichtigen Unternehmen <strong>der</strong> Branche<br />
140
Tabelle 5.8: NRW-Industriestruktur und Konjunktur <strong>in</strong> den verschiedenen Bereichen<br />
des Bioenergiesektors (Quelle: IWR, 2012)<br />
Biogas Zuliefer<strong>in</strong>dustrie<br />
<strong>in</strong> NRW<br />
Biogas Dienstleister<br />
<strong>in</strong> NRW<br />
NRW-Player Biogas<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung Biogas<br />
Biomasse-HKW<br />
Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW<br />
Biomasse-HKW<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW<br />
Biomasse-HKW<br />
Dienstleister <strong>in</strong> NRW<br />
Biomasse-HKW<br />
NRW-Player<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung<br />
Biomasse-HKW<br />
Biomasseheizungen<br />
Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW<br />
� NRW-Unternehmen s<strong>in</strong>d schwerpunktmäßig <strong>in</strong> folgenden Bereichen aktiv:<br />
- Rühr- und För<strong>der</strong>technik<br />
- Regelungen / Schaltanlagen<br />
- Biogas-Speicher<br />
- Biogas-BHKW<br />
- Biogasaufbereitung<br />
- Gärreststoff-Behandlung<br />
� Dienstleistungs-Unternehmen im Bereich Planung und Projektierung<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Komplettanlagen: Biogas Nord (Bielefeld), PlanET Biogastechnik (Vreden)<br />
� Biogas BHKW: Pro2 Anlagentechnik (Willich), 2G Bio-Energietechnik (Heek),<br />
ETW Energietechnik (Moers)<br />
� Biogasaufbereitung: Siloxa Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g (Essen), Schmack Carbotech (Essen)<br />
� Internationalisierung <strong>der</strong> Biogas-Komplettanbieter setzt sich fort; Neugründungen<br />
von Tochtergesellschaften im Ausland<br />
� Neue Märkte <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Osteuropa (Tschechien, Polen)<br />
� Kapazitätserweiterungen <strong>in</strong> NRW<br />
� Gutes Geschäftsjahr für Biogas-Unternehmen <strong>in</strong> NRW<br />
� Schwerpunkt Komplettanlagenhersteller mittlerer Größe<br />
� Aktivitäten Zuliefer<strong>in</strong>dustrie für zentrale Komponenten <strong>in</strong> NRW ger<strong>in</strong>g<br />
� Hersteller von Trocknungsanlagen<br />
� Dienstleister überwiegend im Bereich Planung und Projektierung aktiv<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Komplettanlagen (Anlagen mittlerer Größe): WVT - Wirtschaftliche Verbrennungs-Technik<br />
(Overath-Untereschbach), Nolt<strong>in</strong>g Holzfeuerungstechnik<br />
(Detmold), Polzenith (Schloß Holte-Stukenbrock)<br />
� Trocknungsanlagen: Büttner Gesellschaft für Trocknungs- und Umwelttechnik<br />
mbH (Krefeld)<br />
� Dienstleistungen (Gesamtplanung Kesseltechnologie): Standardkessel<br />
Baumgarte (Duisburg, Bereich Kesseltechnologie bei Großanlagen)<br />
� Stabile Geschäftsentwicklung <strong>in</strong> 2011<br />
� e<strong>in</strong> Heizkesselhersteller <strong>in</strong> NRW ansässig<br />
141
Tabelle 5.8: NRW-Industriestruktur und Konjunktur <strong>in</strong> den verschiedenen Bereichen<br />
des Bioenergiesektors (Quelle: IWR, 2012)<br />
Biomasseheizungen<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW<br />
Biomassezheizungen<br />
Dienstleister <strong>in</strong> NRW<br />
Biomasseheizungen<br />
NRW-Player<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung<br />
Biomasseheizungen<br />
� NRW-Industrieunternehmen aus dem Produzierenden Gewerbe s<strong>in</strong>d<br />
schwerpunktmäßig <strong>in</strong> folgenden Bereichen aktiv:<br />
- Gussteile (u.a. Roste)<br />
- Abgassysteme<br />
- Pelletpressen<br />
� Biomasseheizungs-Anlagen werden überwiegend von Handwerksbetrieben<br />
geplant und <strong>in</strong>stalliert<br />
� Ke<strong>in</strong>e Player aus NRW bekannt<br />
� ger<strong>in</strong>ge <strong>in</strong>dustrielle Anlagenproduktion <strong>in</strong> NRW<br />
142
5.2.4.3 Solarenergie<br />
Tabelle 5.9: NRW-Industriestruktur und Konjunktur <strong>in</strong> den verschiedenen Bereichen<br />
des Solarenergiesektors (Quelle: IWR, 2012)<br />
Konjunktur nach Sektoren<br />
Stand Photovoltaik<br />
Perspektiven<br />
Photovoltaik<br />
Stand<br />
Solarthermie NT<br />
Perspektiven<br />
Solarthermie NT<br />
Stand<br />
Solarthermische<br />
Kraftwerke<br />
Perspektiven<br />
Solarthermische<br />
Kraftwerke<br />
Beschäftigung und<br />
Umsatz <strong>in</strong> NRW Solarenergie<br />
gesamt<br />
Struktur des Industriestandortes<br />
� International: Weltmarkt erreicht mit 29,7 GWp neuen Zubaurekord (2010:<br />
16,6 GWp), Deutschland (7,5 GWp) wird von Italien (9,3 GWp) an <strong>der</strong> Spitze<br />
abgelöst<br />
� National / NRW: PV-Zubau erreicht 2011 Rekordwert von 7.500 MW (2010:<br />
7.400 MW), Markt ist erneut von Vorzieheffekte durch För<strong>der</strong>kürzung bee<strong>in</strong>flusst,<br />
weiterh<strong>in</strong> Druck auf Preise und Margen<br />
� Konsolidierungswelle erreicht deutsche Solarbranche<br />
� International: Asiatische PV-Hersteller setzen Märkte unter Druck; Überkapazitäten<br />
führen <strong>in</strong>ternational zu vermehrten Insolvenzen und Übernahmen,<br />
Anpassung <strong>der</strong> Vergütungen für Solarstrom <strong>in</strong> vielen europäischen Län<strong>der</strong>n<br />
(u.a. Griechenland, Spanien, Italien)<br />
� National / NRW: PV-Branche unter großem Preisdruck, Konsolidierungsphase<br />
<strong>in</strong> Deutschland schreitet voran, Auswirkungen EEG-Deckel (52 GWp)<br />
noch nicht absehbar<br />
� konjunkturelle Perspektiven <strong>der</strong> NRW-Unternehmen eher negativ<br />
� International: weltweiter Zubau erreicht 2011 rd. 50.000 MWth, Leitmarkt<br />
weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a, Kernmärkte <strong>in</strong> Europa s<strong>in</strong>d Deutschland und Türkei<br />
� National / NRW: Absatzmarkt ist 2011 um 11 Prozent gestiegen; 149.000<br />
neue Anlagen mit 1,27 Mio. m² Kollektorfläche wurden <strong>in</strong>stalliert<br />
� International: Ch<strong>in</strong>a bleibt Leitmarkt, ke<strong>in</strong>e Impulse für neue Absatzmärkte<br />
� National / NRW: Marktwachstum auf für 2012 erwartet, MAP-Bed<strong>in</strong>gungen<br />
für Solarthermie-Anlagen verbessert<br />
� konjunkturelle Perspektiven <strong>der</strong> NRW-Firmen sowohl für den Gesamtmarkt<br />
als auch für das Auslandsgeschäft befriedigend<br />
Solarthermische Kraftwerke<br />
� International: Zubau 2011 bei rd. 480 MW (Vorjahr: 520 MW), Gesamtleistung<br />
bei 1.700 MW<br />
� National / NRW: ger<strong>in</strong>ge Aktivitäten <strong>in</strong> Deutschland (suboptimale solarklimatische<br />
Bed<strong>in</strong>gungen), weniger (Komponenten-)Hersteller, <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Forschungsaktivitäten<br />
� International: zahlreiche Projekte <strong>in</strong> den Kernmärkten Spanien und USA <strong>in</strong><br />
Bau und Planung, Perspektiv-Märkte <strong>in</strong> MENA-Staaten; PV-Anlagen zunehmend<br />
günstigere Alternative<br />
� konjunkturelle Perspektiven <strong>der</strong> NRW-Unternehmen positiv<br />
� Mitarbeiterzahl <strong>in</strong> NRW steigt 2011 um rd. 3,5 % auf rd. 7.900<br />
� Umsatz <strong>der</strong> NRW-Solarbranche-Branche s<strong>in</strong>kt 2011 um rd. 2 % auf 4,07<br />
Mrd. Euro<br />
143
Tabelle 5.9: NRW-Industriestruktur und Konjunktur <strong>in</strong> den verschiedenen Bereichen<br />
des Solarenergiesektors (Quelle: IWR, 2012)<br />
Photovoltaik<br />
Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW<br />
Photovoltaik<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW<br />
Photovoltaik<br />
Dienstleister aus<br />
NRW<br />
Photovoltaik NRW-<br />
Player<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung<br />
Photovoltaik<br />
Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW Solarthermie NT<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW Solarthermie NT<br />
Dienstleister <strong>in</strong> NRW<br />
Solarthermie NT<br />
NRW-Player Solarthermie<br />
NT<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung<br />
Solarthermie NT<br />
� Schwerpunkte <strong>der</strong> PV-Hersteller<strong>in</strong>dustrie bei kristall<strong>in</strong>en Zellen und Modulen<br />
� Zulieferunternehmen aus NRW <strong>in</strong> folgenden Bereichen aktiv:<br />
- Wechselrichter<br />
- Ausrüster<strong>in</strong>dustrie Modulproduktion<br />
� Kle<strong>in</strong>anlagen: SHK-Handwerksbetriebe<br />
� Großanlagen: spezialisierte Planungs- und Projektierungsunternehmen<br />
� Modulzertifizierung<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Solarzellen: Solland (Aachen / Heerlen), Scheuten / ARISE (Gelsenkirchen)<br />
� Solarmodule: Scheuten (Gelsenkirchen)<br />
� Wechselrichter: Kostal (Hagen)<br />
� Herstellungsprozess: NPC-Meier (Bocholt)<br />
� Dienstleistungen: TÜV Rhe<strong>in</strong>land Group (Modulzertifizierung, Köln)<br />
� Konsolidierungsphase <strong>der</strong> PV-Branche hat NRW erreicht<br />
� Insolvenzen, Fusionen und Übernahmen häufen sich<br />
� Unternehmen begegnen Kostendruck u.a. mit Kurzarbeit etc.<br />
� <strong>in</strong>ternational bedeutende Hersteller <strong>in</strong> NRW ansässig<br />
� NRW-Zulieferunternehmen <strong>in</strong> Kategorie I des IWR-Analyserasters schwerpunktmäßig<br />
<strong>in</strong> folgenden Bereichen aktiv:<br />
- Beschichtungen<br />
- Regelungen<br />
- Speicher<br />
� Dienstleistungen (Planung und Errichtung, Service, Wartung) vor allem<br />
durch das SHK-Baugewerbe abgedeckt<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Kollektoren: Bosch Solarthermie (Wettr<strong>in</strong>gen), Schüco (Bielefeld), Vaillant<br />
(Gelsenkirchen)<br />
� Beschichtungen: Alanod-Solar (Ennepetal)<br />
� Regelungen: Resol (Hatt<strong>in</strong>gen), Sorel (Sprockhövel)<br />
� Speicher: Reflex W<strong>in</strong>kelmann (Ahlen), Carl Capito (Neuenkirchen), Degen<br />
(Ahlen-Dolberg)<br />
� Thermosyphon: Bosch Solarthermie (Wettr<strong>in</strong>gen), Schüco (Bielefeld)<br />
� NRW bleibt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e bei Kollektorproduktion wichtiger Standort für den<br />
Solarthermiemarkt<br />
Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> � Unternehmen aus dem Kraftwerksbau mit Sitz <strong>in</strong> NRW<br />
NRW Solarthermische<br />
Kraftwerke<br />
144
Tabelle 5.9: NRW-Industriestruktur und Konjunktur <strong>in</strong> den verschiedenen Bereichen<br />
des Solarenergiesektors (Quelle: IWR, 2012)<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW Solarthermische<br />
Kraftwerke<br />
Dienstleister <strong>in</strong> NRW<br />
Solarthermische<br />
Kraftwerke<br />
NRW-Player SolarthermischeKraftwerke<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung SolarthermischeKraftwerke<br />
� NRW-Industrieunternehmen <strong>in</strong> Kategorie I des IWR-Analyserasters schwerpunktmäßig<br />
<strong>in</strong> folgenden Bereichen aktiv:<br />
- Kraftwerksbau<br />
- Spiegel<br />
- Turb<strong>in</strong>e<br />
- Wärmeträger<br />
� Projektierer und Planer mit hoher <strong>in</strong>ternationaler Bedeutung<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Spiegel: Sa<strong>in</strong>t Goba<strong>in</strong> (Aachen)<br />
� Turb<strong>in</strong>en: MAN Diesel & Turbo (Oberhausen)<br />
� Dienstleitungen / Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g: Flagsol GmbH (Köln)<br />
� Internationales Marktwachstum <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Spanien und den USA<br />
� NRW-Unternehmen <strong>in</strong> guter Ausgangsposition<br />
145
5.2.4.4 Oberflächennahe Geothermie und Tiefengeothermie<br />
Tabelle 5.10: NRW-Industriestruktur und Konjunktur im Bereich Geothermie<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Konjunktur nach Sektoren<br />
Oberflächennahe<br />
Geothermie Stand<br />
Oberflächennahe<br />
Geothermie Perspektiven<br />
Tiefengeothermie<br />
Stand<br />
Tiefengeothermie<br />
Perspektiven<br />
Beschäftigung und<br />
Umsatz <strong>in</strong> NRW<br />
Geothermie gesamt<br />
Struktur des Industriestandortes<br />
Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW Oberflächennahe<br />
Geothermie<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW Oberflächennahe<br />
Geothermie<br />
Dienstleister <strong>in</strong> NRW<br />
Oberflächennahe<br />
Geothermie<br />
Oberflächennahe Geothermie<br />
� International: Wärmepumpenmarkt wächst weiter, Schwerpunkte liegen <strong>in</strong><br />
Europa (vor allem Skand<strong>in</strong>avien)<br />
� National / NRW: Zubau <strong>in</strong> Deutschland steigt <strong>in</strong> 2011 auf rd. 57.000 Anlagen<br />
(+11,8 Prozent) (Heizungswärmepumpen), Luft-Wasser-Wärmepumpen dom<strong>in</strong>ieren<br />
den Markt<br />
� NRW-Unternehmen mit durchschnittlicher Geschäftslage <strong>in</strong> 2011<br />
� International: Exportperspektiven <strong>der</strong> NRW-Unternehmen positiv<br />
� National / NRW: Verbesserte För<strong>der</strong>bed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> Deutschland im Rahmen<br />
des MAP<br />
� Weltweit <strong>in</strong>stallierte geothermische elektrische Leistung im Jahr 2011 bei rd.<br />
11.200 MW (Zubau 2011 rd. 136 MW), größter Zubau <strong>in</strong> den USA, Island<br />
und Nicaragua; <strong>in</strong> Deutschland bislang primär Pilotprojekte<br />
� National/NRW: 19 Anlagen mit e<strong>in</strong>er Leistung von 185 MW <strong>in</strong> Deutschland<br />
(davon 5 Anlagen zur Stromerzeugung mit 7,3 MW elektrischer Leistung);<br />
weitere 20 Anlagen im Bau (2 <strong>in</strong> NRW) und 74 <strong>in</strong> Planung (4 <strong>in</strong> NRW)<br />
� International: Weltweit wird stärkeres Marktwachstum vor allem <strong>in</strong> geothermischen<br />
Kernregionen erwartet<br />
� National / NRW: Überwiegende Zahl <strong>der</strong> geplanten Projekte <strong>in</strong> Bayern und<br />
Baden-Württemberg<br />
� NRW-Beschäftigung 2010 steigt um rd. 5 % auf rd. 1.600 Personen (2010:<br />
rd. 1.550)<br />
� Umsätze nehmen 2011 um rd. 25 % auf rd. 280 Mio. Euro zu<br />
� wichtige Wärmepumpenhersteller s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> NRW ansässig<br />
� Hersteller im Bereich Kollektoren und Sonden<br />
� Bohrgerätehersteller national führend<br />
� Zahlreiche Dienstleister im Baugewerbe, etwa 20 Unternehmen im Bereich<br />
Bohrdienstleistungen aktiv<br />
146
Tabelle 5.10: NRW-Industriestruktur und Konjunktur im Bereich Geothermie<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
NRW-Player Oberflächennahe<br />
Geothermie<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung Oberflächennahe<br />
Geothermie<br />
Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW Tiefengeothermie<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW Tiefengeothermie<br />
Dienstleister <strong>in</strong> NRW<br />
Tiefengeothermie<br />
NRW-Player Tiefengeothermie<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung Tiefengeothermie<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Wärmepumpen: Waterkotte (Herne), Hautec (Bedburg-Hau), Vaillant (Gelsenkirchen)<br />
� Erdkollektoren und -sonden: Teramex (Herne), Hautec (Bedburg-Hau) und<br />
MGS Europe (Erkelenz)<br />
� NRW-Herstellerkapazitäten gut positioniert<br />
� NRW-Unternehmen national mit starker Position auf dem Gebiet <strong>der</strong> Bohrtechnologie<br />
� Unternehmen des Bausektors als Generalunternehmer im Kraftwerksbau<br />
aktiv<br />
� NRW-Industrieunternehmen <strong>in</strong> Kategorie I des IWR-Analyserasters schwerpunktmäßig<br />
<strong>in</strong> folgenden Bereichen aktiv:<br />
- Kühltechnik<br />
- Pumpen<br />
- Wärmetauscher<br />
- Bohrequipment<br />
� Unternehmen im Dienstleistungssektor v.a. <strong>in</strong> den Bereichen Bereitstellung<br />
von Bohrequipment, Durchführung von Bohrungen und Exploration tätig<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Kraftwerksbau: HOCHTIEF Construction AG - Energy Europe (Köln)<br />
� Kühltechnologie: SPX Cool<strong>in</strong>g Technologies (Rat<strong>in</strong>gen), Mumme Cool<strong>in</strong>g<br />
Tower (Wesel), Balcke Dürr GmbH (Rat<strong>in</strong>gen)<br />
� Bohrequipment: WIRTH Masch<strong>in</strong>en- und Bohrgeräte-Fabrik GmbH (Erkelenz)<br />
� Bedeutung von Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Bereich Tiefengeothermie bislang<br />
eher im mittleren Feld<br />
� Forschungsstandort erfährt durch den laufenden Ausbau des Internationalen<br />
Geothermiezentrums steigende Bedeutung, <strong>in</strong>ternationale Kontakte werden<br />
ausgebaut, <strong>in</strong>dustrielle Effekte s<strong>in</strong>d künftig zu erwarten<br />
147
5.2.4.5 Wasserkraft<br />
Tabelle 5.11: NRW-Industriestruktur und Konjunktur im Bereich Wasserkraft<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Konjunktur<br />
Stand<br />
Perspektiven<br />
� International: Kernmärkte für Wasserkraftprojekte liegen <strong>in</strong> Asien, Südamerika,<br />
Osteuropa und Afrika, Großprojekte durch etablierte Anlagenbauer,<br />
NRW-Marktanteile ger<strong>in</strong>g<br />
� National / NRW: In erster L<strong>in</strong>ie Kle<strong>in</strong>wasserkraftnutzung, <strong>in</strong> NRW Zubaurekord,<br />
NRW-Unternehmen mit positiver Geschäftslage<br />
� International: Exportgeschäft ohne Impulse<br />
� National / NRW: NRW-Unternehmen erwarten stagnierende Entwicklung<br />
Industriewirtschaftliche Effekte<br />
Beschäftigung und<br />
� Beschäftigung 2011 s<strong>in</strong>kt um rd. 3 % auf ca. 160 Personen, Umsätze gehen<br />
Umsatz <strong>in</strong> NRW<br />
um rd. 5 % auf 16 Mio. Euro zurück<br />
Struktur des Industriestandortes<br />
Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> � Die NRW-Hersteller von Wasserkraftanlagen s<strong>in</strong>d verstärkt im Bereich <strong>der</strong><br />
NRW<br />
Kle<strong>in</strong>stanlagen und Kle<strong>in</strong>anlagen aktiv<br />
- Turb<strong>in</strong>e, Wasserrad<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> � Die NRW-Zulieferunternehmen decken <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie folgende Bereiche ab<br />
NRW<br />
- Wehr, Stauwerk<br />
- Re<strong>in</strong>igungssysteme (Rechen etc.)<br />
Dienstleister <strong>in</strong> NRW � Dienstleister im Bereich Anlagenplanung <strong>in</strong> NRW ansässig<br />
NRW-Player<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Kle<strong>in</strong>anlagen bis 7 MW: B. Maier Wasserkraft (Bielefeld)<br />
� Wehr, Stauwerk: Klewa-Wasserbautechnik (Bielefeld), Strabag (Köln, Staudammbau<br />
Großprojekte), Hochtief (Essen, Abt. <strong>in</strong> Köln, Staudammbau<br />
Großprojekte)<br />
� Re<strong>in</strong>igungssysteme (Rechen etc.): Klewa-Wasserbautechnik (Bielefeld)<br />
� Dienstleistungen: Ingenieurbüro Floecksmühle (Aachen), Korfmann<br />
Lufttechnik (Witten)<br />
� <strong>der</strong>zeit bundesweit und <strong>in</strong> NRW kaum Entwicklungstendenzen vorhanden<br />
� weitere Entwicklung des Marktes v.a. durch hohe Regelungsdichte bee<strong>in</strong>trächtigt<br />
148
5.2.4.6 Brennstoffzelle<br />
Tabelle 5.12: NRW-Industriestruktur und <strong>Lage</strong> im Bereich Brennstoffzelle<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Konjunktur<br />
� International: Markt bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Pionierphase mit ersten Anwendungen<br />
Stand<br />
<strong>in</strong> Serienreife, Schwerpunkte 2011 im FuE-Bereich<br />
� National / NRW: Pionierstadium mit FuE-Schwerpunkt, vere<strong>in</strong>zelt Serienreife,<br />
<strong>der</strong>zeit nur ger<strong>in</strong>ge Marktentwicklung erkennbar<br />
� Kraftstoff Wasserstoff: Hersteller wollen 2015 <strong>in</strong> Serie gehen<br />
Perspektiven<br />
� 50 % <strong>der</strong> NRW-Brennstoffzellen-Unternehmen wollen ihre Aktivitäten erweitern,<br />
NRW weiter bedeutendste BZ-Region <strong>in</strong> Deutschland<br />
Industriewirtschaftliche Effekte<br />
� Beschäftigung im NRW-Brennstoffzellensektor s<strong>in</strong>kt 2011 leicht um etwa 1 %<br />
Beschäftigung und<br />
auf rd. 870 Arbeitsplätze (2010: 880)<br />
Umsatz <strong>in</strong> NRW<br />
� Umsätze nehmen um rd. 11 % auf rd. 18 Mio. Euro (2010: rd. 16 Mio.) zu<br />
Struktur des Industriestandortes<br />
Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> � Hersteller<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> den Bereichen mobile und stationäre Anwendungen<br />
NRW<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
NRW<br />
Dienstleister <strong>in</strong> NRW<br />
NRW-Player<br />
Branchen- / NRW-<br />
Entwicklung<br />
� NRW-Industrieunternehmen <strong>in</strong> Kategorie I des IWR-Analyserasters schwerpunktmäßig<br />
<strong>in</strong> folgenden Bereichen aktiv:<br />
- Stacks<br />
- Bipolarplatten<br />
- Reformer<br />
- Ventiltechnik<br />
- Leitungstechnik<br />
- Wechselrichter / Regler<br />
- Pumpen und Dichtungen<br />
- Verdichter, Speicher<br />
- Wasserstofferzeugung<br />
� Dynetek Europe zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden<br />
Hersteller von leichten Speichern<br />
� Gräbener Masch<strong>in</strong>entechnik GmbH hat als weltweit erstes Unternehmen<br />
Serienfertigung für Bipolarplatten aufgenommen<br />
� ger<strong>in</strong>ge Zahl von Dienstleistern auf Grund <strong>der</strong> frühen Marktphase<br />
Player aus NRW (Auswahl)<br />
� Komplettanlagen / Stacks: HyPower (Herten), Vaillant (Remscheid), CFCL<br />
(He<strong>in</strong>sberg)<br />
� Bipolarplatten: Gräbener Masch<strong>in</strong>entechnik GmbH & Co. KG (Netphen)<br />
� Speicher: Dynetek Europe GmbH (Rat<strong>in</strong>gen)<br />
� Wasserstoffproduktion: Air Liquide (Düsseldorf)<br />
� <strong>in</strong> nahezu allen Bereichen <strong>der</strong> Brennstoffzellenproduktion s<strong>in</strong>d Hersteller<br />
ansässig, Serienproduktion existiert jedoch bislang nur <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Teilbereichen<br />
� starke Forschung mit <strong>in</strong>ternationalem Gewicht <strong>in</strong> NRW<br />
� Errichtung <strong>der</strong> ersten öffentlichen Wasserstofftankstelle für Pkw (u.a. Air<br />
Liquide)<br />
149
5.3 Exkurs: Entwicklungen auf den Märkten für Ökostrom und<br />
Energieeffizienzdienstleistungen<br />
5.3.1 EEG-Strom- und freier Ökostrommarkt<br />
Der Markt für Ökostrom <strong>in</strong> Deutschland besteht <strong>der</strong>zeit aus zwei Teilmärkten:<br />
� EEG-Strommarkt<br />
� freier Ökostrommarkt<br />
5.3.1.1 EEG-Strommarkt<br />
Bundesweit wurden 2011 rd. 123 Mrd. kWh Ökostrom erzeugt. Davon entfällt mit<br />
rd. 91 Mrd. kWh <strong>der</strong> Großteil auf Strom, <strong>der</strong> gemäß EEG vergütet wurde. EEGvergüteter<br />
Strom wurde wegen <strong>der</strong> aktuellen gesetzlichen Regelung (Doppelvermarktungsverbot)<br />
bis Ende 2011 ausschließlich über die Strombörse gehandelt.<br />
Dadurch wird <strong>der</strong> regenerativ erzeugte Strom zu herkunftslosem Graustrom. Die<br />
Vermarktung des EEG-Stroms erfolgt nach dem Fondspr<strong>in</strong>zip. Dabei werden die<br />
Verkaufserlöse an <strong>der</strong> Börse mit den Vergütungs- und Prämienzahlungen an die<br />
EEG-Anlagenbetreiber bilanziert. Diese Differenzkosten fließen neben weiteren<br />
Faktoren <strong>in</strong> die EEG-Umlage e<strong>in</strong> und s<strong>in</strong>d von den nicht privilegierten Letztverbrauchern<br />
zu tragen.<br />
Im Jahr 2012 ist das EEG mit Inkrafttreten <strong>der</strong> Novellierung am Jahresanfang um<br />
die Variante <strong>der</strong> Direktvermarktung über die Marktprämie (§ 33b / § 33g EEG,<br />
Marktprämienmodell) erweitert worden. An<strong>der</strong>s als die Direktvermarktung im<br />
Rahmen des Grünstromprivilegs (§ 33b / 39 EEG) o<strong>der</strong> die sonstige Direktvermarktung<br />
(§ 33b EEG) ist dieser Vermarktungsweg umlagerelevant und erweitert<br />
den EEG-Strommarkt daher ab 2012 um e<strong>in</strong> weiteres Marktsegment (Abbildung<br />
5.14).<br />
© IWR, 2012<br />
Das EEG-Umlagekonto<br />
+ -<br />
Erlös durch Verkauf des vergüteten<br />
EEG-Stroms an <strong>der</strong> Börse<br />
EEG-Umlage<br />
Direkte Vergütungszahlungen an die<br />
Anlagenbetreiber<br />
neu EEG 2012: Prämienzahlungen<br />
an die Anlagenbetreiber im<br />
Marktprämienmodell<br />
Saldo: � 0<br />
Abbildung 5.14: Pr<strong>in</strong>zip des EEG-Umlagemechanismus im EEG 2012 (Quelle: IWR, 2012)<br />
150
Im Kern be<strong>in</strong>haltet das Markprämienmodell die Option, Strom aus EEG-Anlagen<br />
direkt an Großabnehmer bzw. an <strong>der</strong> Strombörse zu vermarkten. Der Anlagenbetreiber<br />
erhält bei diesem Vermarktungsweg neben dem Strompreis zusätzlich die<br />
Marktprämie. Diese ist def<strong>in</strong>iert als Differenz zwischen dem gemäß EEG vorgesehenen<br />
technologiespezifischen Vergütungssatz und dem mittleren Börsenstrompreis<br />
des jeweiligen Handelsmonats. Zusätzlich erhalten die Betreiber e<strong>in</strong>e<br />
sog. Managementprämie, die den Vermarktungsaufwand und das -risiko kompensieren<br />
soll. Bislang wird Strom, <strong>der</strong> im Rahmen dieser Option vertrieben wird,<br />
nach Angaben von Branchenteilnehmern größtenteils über die Strombörse vermarktet,<br />
kann aber grundsätzlich auch an Großabnehmer vertrieben werden.<br />
In den letzten Jahren ist die EEG-Umlage kont<strong>in</strong>uierlich gestiegen. Während sie<br />
2011 noch bei 3,53 Cent pro kWh lag, waren es 2012 3,59 Cent pro kWh. Am 15.<br />
Oktober 2012 haben die ÜNB die aktuellen Prognosedaten für die EEG-Umlage<br />
2013 veröffentlicht. Demnach erfolgt 2013 e<strong>in</strong> Anstieg <strong>der</strong> Umlage um etwa 50<br />
Prozent auf 5,277 Cent pro kWh [58].<br />
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die EEG-Umlage 2013<br />
Vergütungszahlungen an die Betreiber<br />
Durch den anhaltenden Ausbau <strong>der</strong> regenerativen Erzeugungskapazitäten steigen<br />
auch die Vergütungszahlungen an die Betreiber. Im Jahr 2011 wurden etwa<br />
91 Mrd. kWh EEG-Strom mit etwa 16,4 Mrd. Euro vergütet. Für das Jahr 2012 ist<br />
zu erwarten, dass die EEG-Strommenge auf über 100 Mrd. kWh zunimmt, was<br />
dazu führt, dass die EEG-Umlage entsprechend steigt.<br />
Zunehmende EE-E<strong>in</strong>speisung senkt die Strompreise an <strong>der</strong> Börse<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Jahresmittel Börsen-Strompreis (Base- & Peakload) [Cent/kWh]<br />
2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *<br />
Baseload ct/kWh Peakload ct/kWh <strong>in</strong>kl.WE Peakload ct/kWh ohne WE<br />
Quelle: IWR, Daten: EEX, eigene Berechnung. * = unterjährig (Feb.-Dez 2005 / Jan-Sep 2012)<br />
Abbildung 5.15: Durchschnittliche jährliche Strompreise (Base- und Peakload) <strong>in</strong><br />
Deutschland von 2005 bis 2012 (Quelle: IWR, 2012, Daten: EEX)<br />
© IWR, 2012<br />
151
Die EEG-Vermarktungserlöse und damit die EEG-E<strong>in</strong>nahmeseite (2011: 4,9 Cent<br />
/ kWh) werden vor allem durch den mittleren Börsenpreis am Spotmarkt für<br />
Grundlaststrom (2011: 5,1 Cent / kWh) bestimmt. Da die Börsenstrompreise <strong>in</strong><br />
diesem Marktsegment von Januar bis September 2012 bereits auf 4,3 Cent /<br />
kWh gefallen s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>kt auch <strong>der</strong> mittlere EEG-Vermarktungserlös <strong>in</strong> diesem<br />
Jahr auf schätzungsweise 4,1 Cent / kWh (Abbildung 5.15). Aus dem rückläufigen<br />
Börsenstrompreis resultieren im Vergleich zu 2011 EEG-E<strong>in</strong>nahmeverluste,<br />
die sich am Ende auf e<strong>in</strong>e Größenordnung von 1 Mrd. Euro belaufen können und<br />
sich steigernd auf die EEG-Umlage auswirken. Im Gegenzug profitieren die<br />
Letztverbraucher kaum von den Strompreissenkungen, die günstigen Börsenstrompreise<br />
erweisen sich bislang <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für Strome<strong>in</strong>käufer und die Industrie<br />
als vorteilhaft.<br />
Zusätzliche Befreiung von Industriebetrieben von <strong>der</strong> EEG-Umlage<br />
Ab dem Jahr 2013 wird die Befreiungsgrenze von <strong>der</strong> EEG-Umlage für energie<strong>in</strong>tensive<br />
Industriebetriebe von e<strong>in</strong>em Jahresstromverbrauch von 10 GWh pro Jahr<br />
auf 1 GWh pro Jahr gesenkt. Dadurch wird die Stromverbrauchsmenge, die von<br />
<strong>der</strong> Umlage befreit ist, um voraussichtlich etwa 17 Mrd. kWh zunehmen. Für die<br />
nicht-privilegierten Letztverbraucher steigt die EEG-Umlage dadurch weiter an.<br />
EEG-Konto zum Bilanzstichtag im M<strong>in</strong>us<br />
In die EEG-Umlage für das Folgejahr geht auch <strong>der</strong> EEG-Kontostand zum Bilanzstichtag<br />
Ende September e<strong>in</strong>. Basis für den Kontostand ist die Prognose <strong>der</strong><br />
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) aus dem Vorjahr. Wenn aus dem Saldo zwischen<br />
Prognose und tatsächlicher E<strong>in</strong>speisung e<strong>in</strong> Vergütungsplus des Kontos<br />
resultiert, so wirkt das umlagesenkend. Umgekehrt sorgt e<strong>in</strong> negativer Kontostand<br />
für e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong> EEG-Umlage. Derzeit steht das EEG-Konto mit rd.<br />
2,6 Mrd. Euro im M<strong>in</strong>us (Stand: Ende September 2012), prognostiziert hatten die<br />
ÜNB im vergangenen Jahr e<strong>in</strong> Plus von 114 Mio. Euro. Alle<strong>in</strong>e durch den Ausgleichsbedarf<br />
des Kontos wird sich die EEG-Umlage ab 2013 nach den Prognosedaten<br />
<strong>der</strong> ÜNB ab 2013 um 0,67 Cent pro kWh erhöhen [58].<br />
Liquiditätsreserve<br />
Die Übertragungsnetzbetreiber können e<strong>in</strong>e Liquiditätsreserve bilden, um e<strong>in</strong>e<br />
Unterdeckung zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n. Basis für die Ermittlung e<strong>in</strong>es Referenzwertes s<strong>in</strong>d<br />
die Vergütungszahlungen abzüglich <strong>der</strong> Verkaufserlöse. Größenordnungsmäßig<br />
können die ÜNB bis zu 10 Prozent des Referenzwertes als Liquiditätsreserve ansetzen.<br />
E<strong>in</strong>e Steigerung <strong>der</strong> Reserve erhöht die Umlage, e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung m<strong>in</strong><strong>der</strong>t<br />
die EEG-Umlage. Wegen <strong>der</strong> s<strong>in</strong>kenden Börsenstrompreise und <strong>der</strong> steigenden<br />
EEG-Strommengen heben die ÜNB die Liquiditätsreserve im Jahr 2013<br />
von drei Prozent auf 10 Prozent an, was sich ebenfalls umlagesteigernd auswirkt<br />
und die EEG-Umlage um 0,42 Cent pro kWh erhöht [58].<br />
152
5.3.1.2 Freier Ökostrommarkt<br />
Herkunft des frei handelbaren Ökostroms – hoher Importanteil<br />
Auf dem freien Ökostrommarkt kann EE-Strom gehandelt werden, <strong>der</strong> <strong>in</strong><br />
Deutschland erzeugt und nicht nach dem EEG vergütet wird, sowie Strom, <strong>der</strong> <strong>in</strong><br />
EE-Anlagen im Ausland produziert und im Rahmen von Herkunftsnachweisen<br />
importiert wird.<br />
Von den <strong>in</strong>sgesamt im Jahr 2011 <strong>in</strong> Deutschland erzeugten rd. 123 Mrd. kWh<br />
EE-Strom stammen rd. 32 Mrd. kWh Strom aus Anlagen, die nicht unter die EEG-<br />
Vergütung gefallen s<strong>in</strong>d und damit am freien Ökostrommarkt gehandelt werden<br />
konnten. Dieser Strom wird erzeugt von<br />
� Anlagen, die im Rahmen des EEG nicht för<strong>der</strong>fähig s<strong>in</strong>d (z.B. große Wasserkraftwerke),<br />
o<strong>der</strong><br />
� EEG-Anlagen, <strong>der</strong>en Strom ganzjährig direkt vermarktet wurde [59].<br />
Zusätzlich s<strong>in</strong>d im Jahr 2011 über Herkunftsnachweise (u.a. RECS-Zertifikate) rd.<br />
36 Mrd. kWh EE-Strom importiert worden. Zusammen mit den 32 Mrd. kWh deutschem<br />
EE-Strom, <strong>der</strong> außerhalb des EEG vermarktet wird, ergibt sich auf dem<br />
deutschen Markt e<strong>in</strong>e freie EE-Gesamtstrommenge von knapp 70 Mrd. kWh.<br />
Vermarktung von freiem Ökostrom – Marktanteil von speziellen<br />
Ökostromantarifen <strong>in</strong> Deutschland ger<strong>in</strong>g<br />
E<strong>in</strong> Teil des auf dem freien Ökostrommarkt verfügbaren EE-Stroms wird <strong>der</strong>zeit<br />
<strong>in</strong> Deutschland im Rahmen von speziellen Ökostromtarifen angeboten. Auf diese<br />
Weise wird u.a. aus dem Ausland über Herkunftsnachweise bezogener Strom<br />
(z.B. Strom aus norwegischen Wasserkraftanlagen) vermarktet sowie Strom, <strong>der</strong><br />
<strong>in</strong> nicht unter das EEG fallenden deutschen Erzeugungsanlagen erzeugt wurde.<br />
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Versorgungsunternehmen <strong>in</strong> Deutschland<br />
im Jahr 2011 m<strong>in</strong>destens rd. 21 Mrd. kWh EE-Strom über Ökostromangebote<br />
an ihre Kunden geliefert haben [60]. Re<strong>in</strong> rechnerisch verbleibt damit bei e<strong>in</strong>er<br />
frei handelbaren Strommenge von rd. 70 Mrd. kWh e<strong>in</strong>e Restmenge von knapp<br />
50 TWh (rd. 70 Prozent), die nicht über spezielle Ökostromangebote, son<strong>der</strong>n alternative<br />
Vertriebswege vermarktet wird.<br />
Tabelle 5.13: Frei handelbarer Ökostrom <strong>in</strong> Deutschland im Jahr 2011<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: ÜNB, Öko-Institut / AIB, E&M, eigene Berechnung)<br />
Herkunft frei handelbarer EE-Strom 2011<br />
TWh<br />
Erzeugung Deutschland (außerhalb EEG-Vergütung) rd. 32 Mrd. kWh<br />
Erzeugung Ausland (Herkunftsnachweise) rd. 36 Mrd. kWh<br />
Gesamt rd. 68 Mrd. kWh<br />
davon Vermarktung über Ökostromtarife rd. 21 Mrd. kWh<br />
davon sonstige Vermarktung rd. 47 Mrd. kWh<br />
153
Freier Ökostrommarkt: Geschäftslage und Perspektiven von<br />
Ökostromangeboten <strong>in</strong> Deutschland und Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Insgesamt haben die Energieversorgungsunternehmen <strong>in</strong> Deutschland 2011 im<br />
Rahmen von spezifischen Ökostromtarifen etwa 21 Mrd. kWh umweltfreundlichen<br />
Strom aus dem In- und Ausland an etwa 4,2 Mio. Privat- und Gewerbekunden<br />
geliefert. Gegenüber dem Vorjahr (rd. 16 Mrd. kWh, 3,2 Mio. Kunden) entspricht<br />
das vom Absatzvolumen und von <strong>der</strong> Kundenzahl her e<strong>in</strong>em Wachstum von jeweils<br />
etwa 30 Prozent. Gleichwohl hatte die Branche nach <strong>der</strong> Reaktorkatastrophe<br />
von Fukushima und dem darauf folgenden Nachfrageboom für 2011 ursprünglich<br />
noch mit e<strong>in</strong>em deutlich stärkeren Marktwachstum gerechnet [60].<br />
Mittlerweile ist die Marktdynamik wie<strong>der</strong> deutlich abgeebbt.<br />
Als Belastungsfaktor für den Ökostromtarifmarkt <strong>in</strong> Deutschland erweist sich die<br />
bei Stromkunden z.T. vorherrschende Haltung, dass mit <strong>der</strong> von <strong>der</strong> Bundesregierung<br />
e<strong>in</strong>geläuteten Energiewende ohneh<strong>in</strong> schon <strong>der</strong> Weg für e<strong>in</strong>en Umbau<br />
des Energiesystems zu mehr Nachhaltigkeit beschritten wurde. Zusätzliche eigene<br />
Aktivitäten wie z.B. <strong>der</strong> Bezug von Ökostrom anstelle des herkömmlichen<br />
Stromangebotes geraten daher oft <strong>in</strong> den H<strong>in</strong>tergrund. H<strong>in</strong>zu kommen die Mehrkosten,<br />
die den Kunden für den Bezug von Ökostrom entstehen.<br />
Ökostromangebote <strong>der</strong> NRW-EVU – Nachfrage 2011 durchwachsen, kaum Dynamik<br />
erkennbar<br />
Außerdem, so zeigt die im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Studie unter den NRW-EVU<br />
durchgeführte Umfrage zum Thema Ökostrom und Energieeffizienz, besteht bei<br />
den Stromkunden nach wie vor e<strong>in</strong>e gewisse Trägheit, den Stromanbieter auch<br />
tatsächlich zu wechseln. Insgesamt s<strong>in</strong>d die NRW-EVU mit <strong>der</strong> Geschäftslage im<br />
Segment Ökostrom deutlich unzufriedener als mit ihrer Gesamtgeschäftslage im<br />
Stromsektor. Rückblickend bewerten trotz e<strong>in</strong>er gewissen Marktdynamisierung<br />
<strong>in</strong>folge des Atomunfalls <strong>in</strong> Japan lediglich 20 Prozent ihre <strong>Lage</strong> im Geschäftsfeld<br />
Ökostrom im Jahr 2011 als gut. Für rd. 36 Prozent war die Situation zufriedenstellend.<br />
Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Umfrage im Frühjahr 2012 hat sich an <strong>der</strong> grundsätzlichen<br />
E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Geschäftslage im Bereich Ökostrom nichts geän<strong>der</strong>t.<br />
Da <strong>der</strong> EEG-Strommarkt den freien Ökostrommarkt <strong>der</strong>zeit auch <strong>in</strong> NRW weitgehend<br />
verdrängt, erwarten die NRW-EVU im H<strong>in</strong>blick auf die weitere Entwicklung<br />
ihrer Ökostromangebote ke<strong>in</strong>e grundsätzliche Än<strong>der</strong>ung ihrer konjunkturellen Situation.<br />
Perspektivisch gehen nur 20 Prozent <strong>der</strong> EVU davon aus, dass sich die<br />
<strong>Lage</strong> für ihre Ökostromprodukte auf Jahressicht verbessert. Der Großteil <strong>der</strong><br />
EVU rechnet mit e<strong>in</strong>er Stagnation. Von e<strong>in</strong>er weiteren Ankurbelung des Marktes<br />
durch die Intensivierung von Market<strong>in</strong>gmaßnahmen sieht <strong>der</strong> Großteil <strong>der</strong> NRW-<br />
Unternehmen <strong>der</strong>zeit ab. Lediglich 12 Prozent <strong>der</strong> EVU wollen ihren Market<strong>in</strong>gaufwand<br />
2012 gegenüber 2011 erhöhen.<br />
Mittelfristig gehen die meisten Unternehmen jedoch offensichtlich davon aus,<br />
dass sich <strong>der</strong> Markt für Ökostromangebote beleben lässt. Immerh<strong>in</strong> knapp 80<br />
Prozent <strong>der</strong> Unternehmen mit Ökostromangeboten geben an, dass sie ihre wirtschaftlichen<br />
Aktivitäten erweitern wollen.<br />
154
Transparenz von Ökostromangeboten – Stromquellen und Zertifizierung<br />
Erschwert wird <strong>der</strong> Wechsel des Stromanbieters bzw. Tarifs z.T. auch durch e<strong>in</strong>e<br />
mangelnde Transparenz im H<strong>in</strong>blick auf den tatsächlichen Umweltnutzen von<br />
speziellen Ökostromtarifen. Die im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Studie durchgeführte<br />
Analyse <strong>der</strong> von den NRW-EVU angebotenen Ökostromtarife zeigt, dass etwa<br />
20 Prozent <strong>der</strong> Angebote auf den Internetseiten <strong>der</strong> EVU ke<strong>in</strong>e Informationen<br />
über die regenerativen Energieträger enthalten.<br />
In etwa 15 Prozent <strong>der</strong> Fälle s<strong>in</strong>d die Angaben unkonkret, d.h. es f<strong>in</strong>det ke<strong>in</strong>e<br />
nähere Spezifizierung <strong>der</strong> regenerativen Quellen statt. Im Übrigen ist davon auszugehen,<br />
dass es sich bei rd. 50 Prozent um re<strong>in</strong>e Ökostromangebote aus Wasserkraft<br />
handelt. Der Rest entfällt größtenteils auf Tarifprodukte, die aus e<strong>in</strong>em<br />
Mix verschiedener Energiequellen bestehen (Wasserkraft, W<strong>in</strong>denergie, Photovoltaik,<br />
Bioenergie etc.).<br />
Breite Zertifikate-Palette erschwert Vergleichbarkeit <strong>der</strong> Ökostromangebote<br />
Mit 73 Prozent weist <strong>der</strong> Großteil <strong>der</strong> Ökostromangebote e<strong>in</strong>e Zertifizierung auf.<br />
Die Bedeutung für den Umweltnutzen des Zertifikats erschließt sich dem Verbraucher<br />
dadurch allerd<strong>in</strong>gs nicht, da die Ökostromtarife nach wie vor nach verschiedenen<br />
Kriterien zertifiziert s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>heitlichung <strong>der</strong> Zertifikate, wie sie z.B. über e<strong>in</strong> mit dem Blauen Engel<br />
vergleichbares Label diskutiert wird, hat noch nicht stattgefunden, so dass weiterh<strong>in</strong><br />
verschiedene Zertifikate nebene<strong>in</strong>an<strong>der</strong> existieren. Für den Verbraucher<br />
wird daher nicht transparent, welche Ökostromangebote im H<strong>in</strong>blick auf den weiteren<br />
Ausbau erneuerbarer Energien zu den effektivsten gehören (Abbildung<br />
5.16).<br />
1%<br />
28%<br />
11%<br />
14%<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR-Internetrecherche<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 5.16: Ökostromangebote <strong>in</strong> NRW: Häufigkeit <strong>der</strong> gewählten Zertifizierungsarten<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
46%<br />
TÜV<br />
Grüner Strom Label<br />
ok-power Label<br />
Sonstige<br />
ke<strong>in</strong>e Zertifizierung<br />
155
Stand zum Herkunftsnachweisregister<br />
Derzeit wird auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> EU-Richtl<strong>in</strong>ie 2009/28/EG gemäß Artikel 15<br />
<strong>der</strong> Richtl<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong> elektronisches Herkunftsnachweisregister<br />
(HKNR) für Strom aus erneuerbaren Energiequellen aufgebaut. Ziel des HKNR<br />
ist es, die Qualität von Ökostromangeboten zu erhöhen, <strong>in</strong>dem e<strong>in</strong>e transparente<br />
Ökostromkennzeichnung sichergestellt wird und so <strong>der</strong> Verbraucherschutz erhöht<br />
wird. Über das HKNR werden die Strommengen erfasst, die auf dem freien<br />
Ökostrommarkt gehandelt werden können. Auf Deutschland bezogen handelt es<br />
sich dabei um<br />
� Strom, <strong>der</strong> aus Anlagen stammt, die nicht dem EEG unterliegen,<br />
� Strom aus EEG-Anlagen, <strong>der</strong> nach dem Grünstromprivileg vermarktet wird,<br />
und<br />
� Strom aus EEG-Anlagen, <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Direktvermarktung ohne Marktprämie<br />
vermarktet wurde.<br />
E<strong>in</strong>e Registrierung für das Herkunftsnachweisregister ist für die Produzenten von<br />
Ökostrom gemäß obiger Kriterien nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA)<br />
voraussichtlich ab Ende Oktober / Anfang November 2012 möglich. Der vollständige<br />
Start für das Register sowie die erstmalige Ausstellung von Herkunftsnachweisen<br />
erfolgt voraussichtlich ab Anfang 2013. Bei dem Herkunftsnachweisregister<br />
handelt es sich um e<strong>in</strong> Produktionskataster. Erfasst werden Parameter wie<br />
<strong>der</strong> Standort <strong>der</strong> Anlage, Art des verwendeten Energieträgers sowie <strong>der</strong> Erzeugungszeitraum<br />
(i.d.R. Kalen<strong>der</strong>monat, kürzere s<strong>in</strong>d Zeiträume möglich). Die Ausstellung<br />
von Herkunftsnachweisen erfolgt für Strommengen von 1 MWh. Die Herkunftsnachweise<br />
werden beim Verkauf übertragen und nach <strong>der</strong> Verwendung<br />
entwertet [61], [62]. Im Unterschied zu den umstrittenen RECS-Zertifikaten soll<br />
künftig ke<strong>in</strong>e Doppelerfassung von Strommengen mehr möglich se<strong>in</strong>. Das Herkunftsnachweisregister<br />
löst ab 2013 <strong>in</strong> Deutschland das System <strong>der</strong> RECS-<br />
Zertifikate ab. Mit dem HKNR wird gemäß EU-Richtl<strong>in</strong>ie zwar e<strong>in</strong> europaweites<br />
e<strong>in</strong>heitliches System geschaffen. Da es sich um e<strong>in</strong> Produktionskataster handelt,<br />
werden auch künftig Zertifikate wie das o.k. power label o<strong>der</strong> Grüner Strom Label<br />
vermutlich nicht vom Markt verschw<strong>in</strong>den.<br />
156
5.3.2 Regenerative Bürgerenergieanlagen - Energiegenossenschaften<br />
<strong>Zur</strong> Realisierung von regionalen Erneuerbare Energien-Projekten schließen sich<br />
vermehrt Bürger <strong>in</strong> Energiegenossenschaften zusammen. Energiegenossenschaften<br />
bieten die Möglichkeit e<strong>in</strong>er breiten demokratischen Bürgerbeteiligung<br />
beim EE-Ausbau. Damit stellen sie e<strong>in</strong>e typische Organisationsform für die Umsetzung<br />
von sog. „Bürgerenergieprojekten“ dar. Interessierte können im Rahmen<br />
von Energiegenossenschaften durch den Erwerb von Anteilen zu ger<strong>in</strong>gen Beträgen<br />
an den Projekten partizipieren und mitverdienen. In den vergangenen 5<br />
Jahren wurden <strong>in</strong> Deutschland rd. 300 neue Genossenschaften im Bereich Erneuerbare<br />
Energien gegründet [63].<br />
Entwicklung und Verteilung <strong>der</strong> Energiegenossenschaften <strong>in</strong> NRW<br />
Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Recherche (Juni 2012) konnten <strong>in</strong>sgesamt 56 Energiegenossenschaften<br />
ermittelt werden, die mit ihrem Sitz <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen registriert<br />
s<strong>in</strong>d und hier EE-Projekte umsetzen. Die meisten <strong>der</strong> Energiegenossenschaften<br />
wurden <strong>in</strong> den Jahren 2009 und 2010 (jeweils 17) gegründet. Mit 12 Neugründungen<br />
war die Zahl 2011 rückläufig. In den ersten Monaten des Jahres 2012<br />
wurden drei Neugründungen e<strong>in</strong>getragen (Stand: Juni 2012) (Abbildung 5.17).<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Neugründungen Energiegenossenschaften <strong>in</strong> NRW *<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Gesamt: 56 (davon 2 x Gründungsjahr nicht bekannt, 1 x 1999)<br />
* ohne Elektrizitätsgenossenschaften und Sonstige (eG <strong>in</strong>sgesamt: 71), Stand: Juni 2012<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 5.17: Neugründungen von Energiegenossenschaften im Bereich erneuerbare<br />
Energien <strong>in</strong> NRW nach Jahren (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen NRW-Energiegenossenschaften setzten i.d.R. mehr als e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnes<br />
regeneratives Energieprojekt um. Von den 56 nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Energiegenossenschaften<br />
wurden <strong>in</strong> Summe bislang rd. 260 EE-Projekte realisiert.<br />
Aus energiespartenspezifischer Sicht überwiegen dabei mit 257 Projekten Vorhaben<br />
des Solarenergiesektors, die damit auf e<strong>in</strong>en Anteil von rd. 98 Prozent<br />
kommen. Der Rest entfällt auf Bioenergie- (3 Vorhaben) und W<strong>in</strong>denergieprojekte<br />
(2 Vorhaben). Die Gesamtleistung <strong>der</strong> bislang realisierten Projekte aus den<br />
Genossenschaften liegt bei rd. 45 MW. Die größte Kapazität weisen dabei die<br />
beiden W<strong>in</strong>denergieprojekte mit e<strong>in</strong>er Gesamtkapazität von rd. 30 MW (67 Pro-<br />
157
zent) auf. Darauf folgen die Solarstromprojekte mit e<strong>in</strong>er Gesamtleistung von 13<br />
MW (29 Prozent) und Bioenergie mit rd. 2 MW (4 Prozent).<br />
Beteiligungsmöglichkeiten<br />
Je nach Projekt variiert die Höhe <strong>der</strong> Beteiligungsbeiträge. Die M<strong>in</strong>destbeteiligung<br />
für die meisten Projekte liegt zwischen 500 und 1.000 Euro je Anteilssche<strong>in</strong>.<br />
Bei e<strong>in</strong>igen kle<strong>in</strong>eren PV-Projekten s<strong>in</strong>d auch Beteiligungen mit M<strong>in</strong>destbeiträgen<br />
von 100 bzw. 250 Euro möglich. Die Bandbreite <strong>der</strong> Maximalbeteiligungen ist<br />
deutlich größer. Sie liegt im Durchschnitt bei 15.000 Euro, reicht jedoch von<br />
1.000 bis maximal 50.000 Euro. Die Höhe <strong>der</strong> Beteiligungsbeiträge ist dabei relativ<br />
unabhängig von <strong>der</strong> Art des EE-Projektes (W<strong>in</strong>d-, Solar- o<strong>der</strong> Bioenergie).<br />
Bio- und W<strong>in</strong>denergieprojekte weisen i.d.R. deutlich höhere Gesamt<strong>in</strong>vestitionsvolum<strong>in</strong>a<br />
auf, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> Beteiligung pro Genossenschaftsmitglied gibt es<br />
dennoch kaum energiespartenspezifische Unterschiede.<br />
E<strong>in</strong>ige (Solar-)Genossenschaften beschränken sich nicht auf e<strong>in</strong> Vorhaben, son<strong>der</strong>n<br />
errichten mehrere PV-Anlagen. Pro Projekt liegt das Investitionsvolumen<br />
dieser Vorhaben zwischen 15.000 Euro und bis zu 500.000 Euro, so dass sich<br />
bei e<strong>in</strong>zelnen Solar-Genossenschaften e<strong>in</strong> Gesamt<strong>in</strong>vestitionsvolumen <strong>in</strong> Millionenhöhe<br />
ergibt.<br />
Verteilung <strong>der</strong> Energiegenossenschaften nach Regierungsbezirken<br />
Die regionale Differenzierung <strong>der</strong> 56 Energiegenossenschaften <strong>in</strong> NRW weist<br />
große Unterschiede auf. Auf den Regierungsbezirk Münster entfallen mit rd. 27<br />
Prozent die meisten Energiegenossenschaften, vor Detmold mit 23 Prozent. Die<br />
niedrigste Zahl wird für den Regierungsbezirk Düsseldorf ermittelt (rd. 14 Prozent).<br />
E<strong>in</strong> etwas an<strong>der</strong>es regionales Muster ergibt sich bei <strong>der</strong> Verteilung <strong>der</strong> <strong>in</strong>sgesamt<br />
rd. 270 bislang von den Energiegenossenschaften umgesetzten Projekte.<br />
Vorne liegen wie<strong>der</strong> Detmold (rd. 27 Prozent) und Münster (26 Prozent), auf<br />
Rang drei folgt jedoch Düsseldorf mit 58 Projekten vor Köln (37 Projekte) und<br />
Arnsberg (29 Projekte) (Tabelle 5.14).<br />
Tabelle 5.14: Energiegenossenschaften <strong>in</strong> NRW nach Regierungsbezirken<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: Geme<strong>in</strong>sames Registerportal <strong>der</strong> Län<strong>der</strong>, eigene Berechnung)<br />
Genossenschaften EE-Projekte<br />
Zahl Anteil [%] Zahl Anteil [%]<br />
Münster 15 26,8 68 26,0<br />
Detmold 13 23,2 70 26,7<br />
Köln 10 17,9 37 14,1<br />
Arnsberg 10 17,9 29 11,1<br />
Düsseldorf 8 14,3 58 22,1<br />
Gesamt 56 100,0 262 100,<br />
158
Aufgrund e<strong>in</strong>er relativ hohen Leistung <strong>der</strong> beiden W<strong>in</strong>denergie-<br />
Genossenschaften mit e<strong>in</strong>er Kapazität von etwa 30 MW steht Detmold auch bei<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Gesamtleistung mit rd. 32,5 MW an <strong>der</strong> Spitze (73 Prozent). Dah<strong>in</strong>ter<br />
folgt Münster mit e<strong>in</strong>er Kapazität von rd. 5,4 MW (12,2 Prozent), vor Düsseldorf<br />
mit rd. 3,4 MW (7,5 Prozent) (Abbildung 5.18).<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR-Internetrecherche<br />
Abbildung 5.18: Regionalverteilung <strong>der</strong> über Energiegenossenschaften <strong>in</strong> NRW bis Juni<br />
2012 errichteten EE-Gesamtleistung <strong>in</strong> MW (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Größenstruktur <strong>der</strong> Solarstromprojekte<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
4,4%<br />
3,5%<br />
7,5%<br />
72,6%<br />
Anteile PV-Projektgrößen [%]<br />
12,2%<br />
Gesamtleistung<br />
Energiegenossenschaften <strong>in</strong> NRW:<br />
rd. 45 MW el<br />
Münster<br />
Detmold<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 5.19: Verteilung <strong>der</strong> Projektgrößen <strong>der</strong> NRW-Energiegenossenschaften im<br />
Bereich Photovoltaik (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Bei den energiespartenspezifisch schwerpunktbildenden PV-Projekten handelt es<br />
sich überwiegend um Dachanlagen auf öffentlichen Gebäuden (Rathäusern,<br />
Köln<br />
Arnsberg<br />
Düsseldorf<br />
bis 20 kW >20-40 kW >40-60 kW >60-80 kW >80-100 kW >100 kW<br />
Leistung [kW]<br />
© IWR, 2012<br />
159
Schulen, Turnhallen und Hallenbä<strong>der</strong>). Freiflächenanlagen wurden dagegen nur<br />
selten realisiert. Für <strong>in</strong>sgesamt 247 <strong>der</strong> 257 von den Energiegenossenschaften<br />
durchgeführten PV-Projekte konnten die genauen Projektangaben zur Leistung<br />
ermittelt werden. Demnach weisen rd. 38 Prozent <strong>der</strong> Solarstromvorhaben e<strong>in</strong>en<br />
Leistungsbereich zwischen 20 und 40 kW auf, gefolgt von kle<strong>in</strong>eren Anlagen unter<br />
20 kW (22 Prozent) (Abbildung 5.19).<br />
Regionalverteilung <strong>der</strong> Solarstrompojekte<br />
Bei den bislang realisierten Solargenossenschaften mit e<strong>in</strong>er Gesamtleistung von<br />
13,2 MW liegt <strong>der</strong> Regierungsbezirk Münster mit e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>stallierten Kapazität von<br />
rd. 4,4 MW (34 Prozent) an <strong>der</strong> Spitze. Darauf folgenden Düsseldorf mit 3,4 MW<br />
(25 Prozent) und Detmold mit 2,6 MW (20 Prozent) (Abbildung 5.20).<br />
19,9%<br />
11,8%<br />
9,1%<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR-Internetrecherche<br />
25,5%<br />
33,8%<br />
PV‐Leistung <strong>der</strong> NRW‐<br />
Energiegenossenschaften:<br />
rd. 13,2 MW el<br />
Münster<br />
Düsseldorf<br />
Detmold<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 5.20: Regionale Verteilung <strong>der</strong> von den NRW-Energiegenossenschaften bislang<br />
errichteten PV-Leistung (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Köln<br />
Arnsberg<br />
160
5.3.3 Aktivitäten <strong>der</strong> NRW-EVU im Bereich Energieeffizienz<br />
Dienstleistungsangebot Energieeffizienz im Aufbau<br />
Die seit Mai 2006 geltende EU-Richtl<strong>in</strong>ie „Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen“<br />
(EDL-Richtl<strong>in</strong>ie, 2006/32/EG) ist über das im November 2010 <strong>in</strong> Kraft<br />
getretene Gesetz über Energiedienstleistungen und an<strong>der</strong>er Energieeffizienzmaßnahmen<br />
(EDL-G) <strong>in</strong> nationales Recht überführt worden [64]. Richtl<strong>in</strong>ie und<br />
Gesetz zielen darauf ab, die Endenergieeffizienz durch Effizienzmaßnahmen<br />
deutlich zu erhöhen. Der Rat <strong>der</strong> Europäischen Union hat e<strong>in</strong>e Novellierung <strong>der</strong><br />
EU-Energieeffizienz-Richtl<strong>in</strong>ie Anfang Oktober 2012 angenommen [65]. Die neue<br />
Richtl<strong>in</strong>ie soll nunmehr Ende November <strong>in</strong> Kraft treten. Durch die Novelle soll sichergestellt<br />
werden, dass das EU-Ziel, 20 Prozent Primärenergie bis zum Jahr<br />
2020 e<strong>in</strong>zusparen, erreicht werden kann [66]. Im H<strong>in</strong>blick auf die Realisierung<br />
von E<strong>in</strong>sparpotenzialen kommt <strong>der</strong> Versorgungsbranche die Aufgabe zu, über<br />
den Aufbau e<strong>in</strong>es Angebotes an Energiedienstleistungen dazu beizutragen, die<br />
angestrebten E<strong>in</strong>sparpotenziale zu erschließen. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund werden<br />
auch die NRW-Energieunternehmen aktiv.<br />
Das zeigt die Umfrage unter den NRW-EVU, die im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Studie zum Thema Ökostrom und Energieeffizienz durchgeführt wurde. Für e<strong>in</strong>en<br />
Großteil <strong>der</strong> NRW-EVU zählen Energieeffizienzdienstleistungen im Bereich von<br />
Haushalts- und Gewerbekunden mittlerweile fest zum Angebot. Dabei liegt <strong>der</strong><br />
Fokus bei Privat- und Gewerbekunden auf Beratungsdienstleistungen und<br />
Contract<strong>in</strong>gangeboten. Sowohl im Privatkundensegment als auch bei den Gewerbekunden<br />
bieten ca. 80 Prozent <strong>der</strong> NRW-Energieunternehmen Dienstleistungen<br />
<strong>in</strong> diesen beiden Bereichen an (Abbildung 5.21).<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Anteile [%]<br />
Haushaltskunden Gewerbe-/Industriekunden<br />
Quelle: IWR, Daten: IWR, eigene Erhebung<br />
Abbildung 5.21: Angebotshäufigkeit von Energieeffizienzmaßnahmen <strong>der</strong> NRW-EVU<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Beratungen<br />
Contract<strong>in</strong>g<br />
För<strong>der</strong>maßnahmen<br />
sonst. Dienstleist.<br />
© IWR, 2012<br />
161
För<strong>der</strong>angebot <strong>der</strong> NRW-EVU bei Energieeffizienz und erneuerbaren<br />
Energien<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Studie werden das Angebot <strong>der</strong> nordrhe<strong>in</strong>westfälischen<br />
Energieversorgungsunternehmen im Bereich Energieeffizienz sowie<br />
ergänzend die angebotenen För<strong>der</strong>programme im Bereich Energieeffizienz<br />
und erneuerbare Energien statistisch ausgewertet.<br />
Grundlage für den Überblick über das För<strong>der</strong>angebot <strong>der</strong> NRW-EVU im Bereich<br />
Energieeffizienz und erneuerbare Energien ist e<strong>in</strong>e Übersicht <strong>der</strong> EnergieAgentur.NRW<br />
(Datenstand: Februar 2012) [67]. Die Auswertung dieser Übersicht<br />
zeigt, dass die Themenbereiche Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei<br />
den NRW-EVU weiter ausgebaut werden und an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen. Insgesamt<br />
werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>angebote 465 Maßnahmen von 90<br />
NRW-EVU berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr (Stand: Februar 2011) hat<br />
damit die Zahl <strong>der</strong> erfassten EVU um 11 Prozent zugenommen, das Angebot an<br />
För<strong>der</strong>maßnahmen ist sogar um 27 Prozent gestiegen (Vorjahr: 365 Maßnahmen,<br />
81 Energieunternehmen) (Tabelle 5.15).<br />
Tabelle 5.15: För<strong>der</strong>maßnahmen <strong>der</strong> NRW-EVU im Bereich Energieeffizienz und<br />
regenerative Energien (Quelle: IWR, 2012, Datengrundlage: EnergieAgentur.NRW / eig.<br />
Berechnung)<br />
Kategorie Anzahl 2012 Anzahl 2011 Veränd. Vorjahr<br />
Betrachtete EVU 90 81 + 11,1 %<br />
Betrachtete För<strong>der</strong>maßnahmen absolut 465 365 + 27,4 %<br />
Spanne <strong>der</strong> pro EVU angebotenen<br />
För<strong>der</strong>maßnahmen<br />
1 bis 16 1 bis 17 -<br />
Die För<strong>der</strong>angebote <strong>der</strong> NRW-EVU s<strong>in</strong>d strukturell so ausgelegt, dass sie e<strong>in</strong>erseits<br />
den Kunden e<strong>in</strong>en Nutzen br<strong>in</strong>gen. Gleichzeitig profitieren aber i.d.R. auch<br />
die EVU unter ökonomischen Gesichtspunkten, da die Angebote an die Nutzung<br />
<strong>der</strong> von den EVU angebotenen Energieträger gekoppelt s<strong>in</strong>d. Dazu zählen z.B.<br />
Maßnahmen, die den Erdgas- o<strong>der</strong> Stromabsatz <strong>der</strong> Unternehmen unterstützen.<br />
Somit ergeben sich zwei Perspektiven, unter denen die För<strong>der</strong>programme <strong>der</strong><br />
NRW-EVU analysiert werden können:<br />
Perspektive: För<strong>der</strong>maßnahmen aus Nutzersicht<br />
Von den <strong>in</strong>sgesamt 465 angebotenen För<strong>der</strong>maßnahmen <strong>der</strong> EVU kann mit 424<br />
Angeboten (2011: 342 Angebote) <strong>der</strong> Großteil e<strong>in</strong>deutig e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> drei Kategorien<br />
Strom, Wärme bzw. Treibstoffe zugeordnet werden. D.h. dem Kunden entsteht<br />
durch die Maßnahmen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>der</strong> drei Teilbereiche e<strong>in</strong> Nutzen. Der Schwerpunkt<br />
<strong>der</strong> angebotenen Maßnahmen liegt dabei auf <strong>der</strong> Wärmenutzung, auf die<br />
aus Nutzersicht rd. 61 Prozent aller Angebote entfallen. Geför<strong>der</strong>t wird z.B. die<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung / Erneuerung von Heizungen über Gas-Brennwert-Thermen o<strong>der</strong><br />
Wärmepumpen. 37 Angebote, d.h. rd. 8 Prozent <strong>der</strong> Maßnahmen (Vorjahr: 19<br />
Angebote, 5 Prozent), gelten für den Strom- und Wärmebereich und lassen sich<br />
162
daher zwei Kategorien zuordnen. Dabei handelt es sich um För<strong>der</strong>maßnahmen<br />
aus dem Segment Kraft-Wärme-Kopplung.<br />
Perspektive: För<strong>der</strong>maßnahmen aus EVU-Sicht<br />
Aus dem Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> Energieversorger unterstützen rd. 55 Prozent <strong>der</strong> Maßnahmen<br />
den Absatz von Erdgas (2011: knapp 60 Prozent), stromabsatzför<strong>der</strong>nd<br />
s<strong>in</strong>d rd. 30 Prozent <strong>der</strong> Maßnahmen. In diese Kategorie fallen z.B. Angebote, die<br />
den E<strong>in</strong>satz effizienter Haushaltsgeräte för<strong>der</strong>n und Maßnahmen im Bereich<br />
Elektromobilität. Auf das Segment erneuerbare Energien, das aus Versorgersicht<br />
nur bed<strong>in</strong>gt mit e<strong>in</strong>em zusätzlichen Absatz von Energie verbunden ist, entfallen<br />
lediglich 9 Prozent <strong>der</strong> Angebote. Weitere 7 Prozent <strong>der</strong> Maßnahmen tangieren<br />
För<strong>der</strong>fälle, die den Absatz von Fernwärme unterstützen.<br />
Fazit: EVU-För<strong>der</strong>ungen stützen vor allem den Erdgasabsatz - Bedeutung von<br />
regenerativen För<strong>der</strong>angeboten h<strong>in</strong>kt h<strong>in</strong>terher<br />
In <strong>der</strong> graphischen Verknüpfung <strong>der</strong> beiden Blickw<strong>in</strong>kel (Nutzer / EVU) wird deutlich,<br />
dass aus EVU-Sicht <strong>der</strong> Fokus auf Maßnahmen gelegt wird, die dazu beitragen,<br />
den Erdgasabsatz des Unternehmens zu unterstützen. Der EVU-Kunde profitiert<br />
dabei <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie im Bereich <strong>der</strong> Wärmeversorgung, z.B. durch die Unterstützung<br />
beim Austausch <strong>der</strong> Heizungsanlage o<strong>der</strong> die Umstellung auf e<strong>in</strong><br />
Erdgasfahrzeug. För<strong>der</strong>maßnahmen im Bereich regenerative Energien (z.B. PV-<br />
Anlagen o<strong>der</strong> Solarthermieanlagen) rangieren <strong>in</strong> ihrer Bedeutung deutlich h<strong>in</strong>ter<br />
Angeboten im Bereich Wärme und Strom (Abbildung 5.22).<br />
Abbildung 5.22: Blickw<strong>in</strong>kel-Matrix: Überblick über die För<strong>der</strong>angebote <strong>der</strong> NRW-EVU<br />
zu Energieeffizienz und regenerativen Energien (Quelle: IWR, 2012, Daten-<br />
grundlage: EnergieAgentur.NRW)<br />
163
5.4 <strong>Zur</strong> Bedeutung von Industrie und Forschung am Standort<br />
NRW<br />
Die regenerative Bedeutungsmatrix (Abbildung 5.23) verdeutlicht die Bedeutung<br />
des regenerativen Industrie- und Forschungsstandorts NRW über die Landesgrenzen<br />
h<strong>in</strong>aus. Die Matrix fußt auf den Erkenntnissen, die im Rahmen <strong>der</strong> Auswertung<br />
des regenerativen Industrie- und Forschungskatasters NRW (<strong>in</strong>kl. Umfragen),<br />
<strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen, <strong>der</strong> Untersuchung<br />
<strong>der</strong> Wertschöpfungskette sowie <strong>der</strong> jeweiligen Marktausprägung gewonnen<br />
wurden. Im Vergleich zum Vorjahr 2011 ergeben sich vor dem H<strong>in</strong>tergrund<br />
<strong>der</strong> Standort- und Strukturuntersuchung ke<strong>in</strong>e sichtbaren Än<strong>der</strong>ungen.<br />
Dies gilt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im H<strong>in</strong>blick auf die regionale Bedeutung <strong>der</strong> NRW-<br />
Industrieunternehmen. Demgegenüber schreitet im Forschungsbereich <strong>der</strong> Aufbau<br />
von Kapazitäten voran, was e<strong>in</strong>e entsprechende Stärkung <strong>der</strong> überregionalen<br />
Bedeutung mit sich br<strong>in</strong>gt. Vor allem im Bereich <strong>der</strong> oberflächennahen bzw.<br />
Tiefengeothermie ist mit dem voranschreitenden Ausbau des Internationalen Geothermiezentrums<br />
<strong>in</strong> Bochum (<strong>in</strong>kl. Test<strong>in</strong>frastrukturen) e<strong>in</strong>e Bedeutungszunahme<br />
zu erwarten. Der Aufbau <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung am Standort bef<strong>in</strong>det sich jedoch<br />
noch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em f<strong>in</strong>alen Realisierungsstadium, so dass die entsprechenden Wirkungen<br />
noch nicht greifbar s<strong>in</strong>d. Dies dürfte sich mit Abschluss <strong>der</strong> Arbeiten än<strong>der</strong>n,<br />
so dass die überregionale Bedeutung <strong>der</strong> Forschungsaktivitäten im Bereich<br />
<strong>der</strong> oberflächennahen Geothermie und Tiefengeothermie am Standort NRW <strong>in</strong><br />
den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Im Bioenergiebereich f<strong>in</strong>det aktuell<br />
e<strong>in</strong> Ausbau <strong>der</strong> Produktionskapazitäten <strong>in</strong> NRW statt. Dies könnte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zukunft<br />
entsprechende Impulse setzen, die die <strong>in</strong>dustrielle Bedeutung des Standortes für<br />
die Branche aufwerten.<br />
Forschung<br />
hoch<br />
mittel<br />
niedrig<br />
Solarthermische<br />
Kraftwerke<br />
Wasserkraft,<br />
Holzheizungen<br />
niedrig<br />
Brennstoffzelle<br />
Photovoltaik, Biogas,<br />
Tiefengeothermie,<br />
oberflächennahe<br />
Geothermie<br />
Biomasseheiz-<br />
(kraft)werke<br />
mittel<br />
W<strong>in</strong>denergie<br />
Solarthermie NT<br />
Industrie<br />
© IWR, 2012<br />
Abbildung 5.23: IWR-Matrix zur E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> überregionalen Standortbedeutung<br />
von Forschung und Industrie im Bereich regenerative Energien <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
hoch<br />
164
6 Wissenschaft und Forschung – Regenerative Forschungsaktivitäten<br />
<strong>in</strong> NRW<br />
6.1 Zum regenerativen Forschungsstandort NRW<br />
Die Basis für die Analyse des Forschungsstandortes NRW ist das NRW-<br />
Forschungskataster Regenerative Energien, das aktuell rd. 135 Forschungse<strong>in</strong>richtungen<br />
umfasst. Davon entfällt mit 120 E<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Großteil (rd. 89<br />
Prozent) auf Hochschule<strong>in</strong>richtungen (Institute, Fachbereiche) an Fachhochschulen<br />
und Universitäten, wobei die Universitätse<strong>in</strong>richtungen mit e<strong>in</strong>em Anteil von<br />
72 Prozent deutlich stärker vertreten s<strong>in</strong>d als Fachhochschul<strong>in</strong>stitute. Bei 15 E<strong>in</strong>richtungen<br />
(11 Prozent) des Forschungskatasters handelt es sich um außeruniversitäre<br />
NRW-E<strong>in</strong>richtungen mit Forschungsaktivitäten im Bereich regenerative<br />
Energien. Die Hochschule<strong>in</strong>richtungen verteilen sich auf etwa 28 Hochschulstandorte<br />
<strong>in</strong> NRW, d.h. an e<strong>in</strong>igen Standorten bef<strong>in</strong>den sich mehrere Forschungse<strong>in</strong>richtungen.<br />
Zusammen mit den außeruniversitären Forschungse<strong>in</strong>richtungen<br />
ergeben sich <strong>der</strong>zeit 43 Standorte, an denen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
EE-Forschungse<strong>in</strong>richtungen ansässig s<strong>in</strong>d (Tabelle 6.1).<br />
Tabelle 6.1: Eckdaten des NRW-Forschungskatasters Regenerative Energien<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: NRW-Forschungskataster, Stand 2012)<br />
Forschungse<strong>in</strong>richtungen<br />
Hochschulen<br />
rd. 28<br />
davon Universitäten 46 %<br />
davon Fachhochschulen / Hochschulen 54 %<br />
außeruniversitäre Forschung<br />
(privatwirtschaftliche (Dienstleistungs-)Unternehmen sowie E<strong>in</strong>richtungen von<br />
Bund und Land o<strong>der</strong> öffentlich geför<strong>der</strong>te E<strong>in</strong>richtungen)<br />
Gesamt (Standorte)<br />
Institute / Fachbereiche / Forschungsgruppen <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong><br />
Hochschulen<br />
rd. 15<br />
rd. 43<br />
rd. 120<br />
davon Universitäten / Hochschulen 72 %<br />
davon Fachhochschulen 28 %<br />
Gesamt (E<strong>in</strong>richtungen / Institute)<br />
rd. 135<br />
Bioenergie bleibt Forschungsschwerpunkt an NRW-E<strong>in</strong>richtungen<br />
Inhaltlich liegt <strong>der</strong> Fokus <strong>der</strong> NRW-Forschungse<strong>in</strong>richtungen wie <strong>in</strong> den Vorjahren<br />
auf Forschungsthemen <strong>in</strong> den Bereichen Bio- und W<strong>in</strong>denergie sowie Photovoltaik.<br />
Etwa 37 Prozent <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungen forschen zum Thema Bioenergie. Darauf<br />
folgen die W<strong>in</strong>denergie- (31 Prozent) und PV-Forschung (30 Prozent). Gegenüber<br />
dem Vorjahr etwas abgefallen ist mit e<strong>in</strong>em Anteil von 25 Prozent (2010:<br />
28 Prozent) die Forschung im Segment Brennstoffzellen. Mit e<strong>in</strong>em Anstieg des<br />
Anteils von 11,8 Prozent <strong>in</strong> 2010 auf 14,2 Prozent im Jahr 2011 weist vor allem<br />
<strong>der</strong> Geothermiesektor im energiespartenspezifischen Vergleich e<strong>in</strong>e positive<br />
165
Entwicklung auf (Tabelle 6.2). Die meisten Forschungse<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>d außerdem<br />
<strong>in</strong> mehreren EE-Sparten aktiv, nur rd. 34 Prozent s<strong>in</strong>d auf e<strong>in</strong> Segment spezialisiert.<br />
Tabelle 6.2: Forschungsschwerpunkte im Bereich regenerative Energien an den<br />
Hochschulen <strong>in</strong> NRW (Quelle: IWR 2012, Daten: NRW-Forschungskataster, Stand: 2012)<br />
Regenerative Teilsparte Anteile 2011 [%] Anteile 2010 [%] Anteile 2009 [%] 1<br />
Bioenergie 36,7 35,3 35,0<br />
W<strong>in</strong>denergie 30,8 28,6 28,0<br />
Photovoltaik 30,0 31,9 31,0<br />
Brennstoffzelle 25,0 27,7 26,0<br />
Kraft-Wärme-Kopplung 20,8 20,2 22,0<br />
Elektromobilität 20,0 19,3 14,0<br />
Geoenergie 14,2 11,8 12,0<br />
Wasserkraft 14,2 13,4 14,0<br />
Solarthermie NT 13,3 11,8 12,0<br />
Solarthermische Kraftwerke 7,5 5,0 6,0<br />
Sonstige Bereiche (Energieeffizienz,<br />
CO2-arme Kraftwerkstechnik etc.)<br />
1 Doppelnennungen möglich<br />
Forschungsstruktur – Begleitstudien überwiegen<br />
43,3 45,4 57,0<br />
Auch im Jahr 2011 ist <strong>der</strong> Großteil <strong>der</strong> EE-Forschungsaktivitäten <strong>der</strong> NRW-<br />
Hochschule<strong>in</strong>richtungen nach dem IWR-Analyseraster zur Klassifizierung regenerativer<br />
Wirtschaft- und Forschungsaktivitäten <strong>der</strong> Kategorie Begleitstudien zuzuordnen.<br />
Etwa 73 Prozent <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>d hier aktiv. In den Kategorien<br />
Forschung und Entwicklung von „Komponenten“ und „Komplettanlagen“ s<strong>in</strong>d 50<br />
bzw. 30 Prozent <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong>volviert. Damit rangieren vor allem die aus<br />
dem Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> Wirtschaft wichtigen <strong>in</strong>dustriespezifischen Forschungskategorien<br />
deutlich h<strong>in</strong>ter <strong>der</strong> Kategorie Begleitprojekte und Studien (Tabelle 6.3).<br />
Tabelle 6.3: Forschungsschwerpunkte <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> verschiedenen Forschungskategorien<br />
an den NRW-Hochschulen<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: NRW-Forschungskataster, Stand: 2012)<br />
Anteile 2011 [%] 1 Anteile 2010 [%] 1 Anteile 2009 [%] 1<br />
Begleitprojekte und Studien 73,3 81,5 76,8<br />
Komponenten 50,0 52,9 50,9<br />
Energiespezifische Dienstleistungen 34,2 42,9 43,8<br />
Komplettanlagen 30,0 31,9 28,6<br />
Produktion 23,3 23,5 22,3<br />
166
Tabelle 6.3: Forschungsschwerpunkte <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> verschiedenen Forschungskategorien<br />
an den NRW-Hochschulen<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: NRW-Forschungskataster, Stand: 2012)<br />
1 = Doppelnennungen möglich<br />
167
Kont<strong>in</strong>uierliche EE-Forschung im Vor<strong>der</strong>grund – EE-Forschung mit hohem<br />
Stellenwert im Forschungsportfolio<br />
Für e<strong>in</strong>en Großteil <strong>der</strong> Forschungse<strong>in</strong>richtungen gehören Aktivitäten im Bereich<br />
<strong>der</strong> erneuerbaren Energien mittlerweile zu den Standardforschungsfel<strong>der</strong>n. Etwa<br />
70 Prozent <strong>der</strong> NRW-Forschungse<strong>in</strong>richtungen geben an, dass sie bereits seit<br />
mehreren Jahren kont<strong>in</strong>uierlich EE-Forschungsfragen bearbeiten. Gut e<strong>in</strong> Viertel<br />
ist dagegen nur projektbezogen aktiv. Die EE-Forschung hatte daher 2011 für rd.<br />
50 Prozent <strong>der</strong> Umfrageteilenehmer e<strong>in</strong>en hohen Stellenwert <strong>in</strong>nerhalb des Forschungsportfolios,<br />
lediglich 20 Prozent bezeichneten die Bedeutung als niedrig.<br />
Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Umfrage (März/April 2012) ist die Bedeutung <strong>der</strong> EE-<br />
Forschung weiter gestiegen. Immerh<strong>in</strong> 30 Prozent <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungen geben an,<br />
dass Forschungsthemen im Bereich erneuerbare Energien im Vergleich zum Vorjahr<br />
für die E<strong>in</strong>richtung an Bedeutung gewonnen haben. Niedriger ist <strong>der</strong> Stellenwert<br />
im Jahresvergleich dagegen nur für etwa 15 Prozent <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungen.<br />
Im Jahr 2011 war die Hälfte <strong>der</strong> Forschungse<strong>in</strong>richtungen mit <strong>der</strong> Projektlage im<br />
Bereich <strong>der</strong> EE-Forschung zufrieden, lediglich 15 Prozent <strong>der</strong> Institute bezeichneten<br />
die <strong>Lage</strong> als schlecht. Im Frühjahr 2012 hatte sich die <strong>Lage</strong> weiter verbessert,<br />
immerh<strong>in</strong> 60 Prozent stufen ihre Projektlage im Rahmen <strong>der</strong> Umfrage als<br />
gut e<strong>in</strong>.<br />
Patentaktivitäten <strong>der</strong> NRW-Hochschulen<br />
Patentanmeldungen können als Indikatorgröße mit herangezogen werden, um<br />
den Innovationsgrad von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen zu messen<br />
und die technologische Leistungsfähigkeit e<strong>in</strong>es Landes zu dokumentieren. Auf<br />
<strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Instituts- und E<strong>in</strong>richtungs-Angaben im Rahmen <strong>der</strong> Forschungsumfrage<br />
fällt auf, dass 2011 und 2010 auf nationaler und <strong>in</strong>ternationaler<br />
Ebene im Bereich erneuerbare Energien nur vergleichsweise ger<strong>in</strong>ge Aktivitäten<br />
bei Patentanmeldungen vorlagen. Demnach haben 2011 auf nationaler Ebene 15<br />
Prozent <strong>der</strong> Hochschul<strong>in</strong>stitute Patente angemeldet (2010: 5 Prozent), <strong>in</strong>ternationale<br />
Patente wurden 2011 von etwa 10 Prozent <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungen angemeldet<br />
(2010: ke<strong>in</strong>e Anmeldungen).<br />
Verhältnis Angewandte Forschung und Grundlagenforschung<br />
Nach den Angaben <strong>der</strong> Umfrageteilnehmer überwiegt bei den Forschungsfragestellungen<br />
im Bereich erneuerbare Energien die angewandte Forschung. Bei e<strong>in</strong>em<br />
Großteil <strong>der</strong> Umfrageteilnehmer (rd. 90 Prozent) liegt <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> angewandten<br />
Regenerativ-Forschung bei m<strong>in</strong>destens 50 Prozent. Lediglich e<strong>in</strong>e <strong>der</strong><br />
Forschungse<strong>in</strong>richtungen betreibt <strong>der</strong>zeit ausschließlich re<strong>in</strong>e Grundlagenforschung.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund dieser Anteilsverteilung wird die Bedeutung erkennbar,<br />
die e<strong>in</strong>er optimalen Vernetzung zwischen Forschungse<strong>in</strong>richtungen und<br />
Akteuren für e<strong>in</strong>en reibungslosen Forschungstransfer <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>in</strong> die Praxis<br />
zukommt.<br />
Interessant ist folglich die Antwort <strong>der</strong> Umfrageteilnehmer auf die Frage nach <strong>der</strong><br />
Bedeutung von Forschungskooperationen mit verschiedenen Partnern aus den<br />
Kategorien Industrie, Hochschule sowie außeruniversitäre E<strong>in</strong>richtungen. Im Vergleich<br />
zum Vorjahr zeigt sich, dass aus Sicht <strong>der</strong> Hochschulen den Forschungskooperationen<br />
mit <strong>der</strong> Industrie die höchste Bedeutung zukommt. Zum Zeitpunkt<br />
<strong>der</strong> Umfrage (März/April 2012) hat diese Form <strong>der</strong> Kooperation für etwa 70 Pro-<br />
168
zent <strong>der</strong> Umfrageteilnehmer den höchsten Stellenwert (Vorjahr 74 Prozent). <strong>Zur</strong>ückzuführen<br />
se<strong>in</strong> dürfte diese E<strong>in</strong>schätzung auch auf die hohe Bedeutung, die<br />
Drittmittelprojekte für die Hochschule<strong>in</strong>richtungen mittlerweile für den Forschungshaushalt<br />
haben. Rückläufig ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> aktuellen Umfrage dagegen <strong>der</strong><br />
Stellenwert von Kooperationen zwischen Hochschulen und außeruniversitären<br />
E<strong>in</strong>richtungen, <strong>der</strong> nur noch 15 Prozent <strong>der</strong> Hochschulen e<strong>in</strong>e hohe Bedeutung<br />
beimessen (Tabelle 6.4)<br />
Tabelle 6.4: Die Bewertung <strong>der</strong> Bedeutung von Forschungskooperationen mit<br />
Partnern aus Industrie, Forschung und Wissenschaft aus Sicht von<br />
NRW-Hochschule<strong>in</strong>richtungen (Quelle: IWR, 2012, Daten: Forschungsumfrage)<br />
Bedeutung<br />
Kooperation aus<br />
Hochschulsicht<br />
Hochschule / Industrie<br />
[%]<br />
Hochschule /<br />
Hochschulen<br />
[%]<br />
Hochschule / außeruniv.<br />
E<strong>in</strong>richtungen<br />
[%]<br />
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010<br />
hoch 70,0 73,7 53,2 20,0 25,0 57,4 15,0 28,9 36,2<br />
mittel 20,0 13,2 27,6 50,0 27,7 25,5 45,0 31,6 27,7<br />
niedrig 10,0 10,5 12,8 20,0 31,6 8,6 40,0 26,3 21,3<br />
k. Angabe 0,0 2,6 6,4 10,0 15,7 8,5 0,0 13,2 14,8<br />
Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Forschungsperspektive – Bedeutung regenerativer Forschung steigt weiter<br />
Mit <strong>der</strong> Umgestaltung des Energiesektors im Zuge <strong>der</strong> Energiewende und des<br />
kont<strong>in</strong>uierlichen Ausbaus <strong>der</strong> regenerativen Erzeugungskapazitäten gew<strong>in</strong>nen<br />
regenerative Forschungsthemen weiter an Bedeutung. In diesem Umfeld gehen<br />
rd. 60 Prozent <strong>der</strong> NRW-Forschungse<strong>in</strong>richtungen davon aus, dass die Aktivitäten<br />
im Bereich <strong>der</strong> EE-Forschung mittelfristig, d.h. auf Sicht von 2 bis 5 Jahren<br />
weiter ausgebaut werden. Die übrigen E<strong>in</strong>richtungen erwarten überwiegend e<strong>in</strong><br />
gleichbleibendes Niveau, von e<strong>in</strong>em Rückgang <strong>der</strong> EE-Forschung gehen lediglich<br />
5 Prozent aus.<br />
NRW-Forschungse<strong>in</strong>richtungen bei EE-Forschung thematisch breit<br />
aufgestellt – aktuelle Forschungsschwerpunkte<br />
Die E<strong>in</strong>richtungen des IWR-Forschungskatasters s<strong>in</strong>d thematisch sehr breit aufgestellt.<br />
Neben energiespartenspezifischen Forschungsfel<strong>der</strong>n <strong>in</strong> Bereichen wie<br />
z.B. W<strong>in</strong>denergie, Bioenergie o<strong>der</strong> Wasserkraft sowie Solarenergie stehen bei<br />
den Institutionen vermehrt die technische und wirtschaftliche Integration <strong>der</strong> Erneuerbaren<br />
Energien <strong>in</strong> das gesamte Energiesystem im Vor<strong>der</strong>grund. So ist e<strong>in</strong><br />
zentrales Forschungsgebiet die Netz<strong>in</strong>tegration <strong>der</strong> Erneuerbaren. Aktuelle Forschungsprojekte<br />
befassen sich dabei <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e mit den technischen Aspekten<br />
<strong>der</strong> Netzoptimierung, Netzplanung und dem Netzbetrieb. Außerdem stehen<br />
<strong>in</strong>telligente Netze (Smart Grids) immer mehr im Fokus <strong>der</strong> Forschung. E<strong>in</strong> weiterer<br />
Schwerpunkt bildet die durch Erneuerbare Energien hervorgerufene Heraus-<br />
169
for<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>er dezentralen Energieversorgung. Damit eng verbunden s<strong>in</strong>d die<br />
Forschungsaktivitäten im Bereich <strong>der</strong> (großtechnischen) Speichertechnologie. So<br />
forschen unter an<strong>der</strong>em mehrere Institute an <strong>der</strong> Möglichkeit <strong>der</strong> Nutzung ehemaliger<br />
Bergwerke als Standorte für Pumpspeicherkraftwerke unter Tage.<br />
In Bezug auf das gesamte Drittmittelvolumen <strong>der</strong> im Rahmen <strong>der</strong> Hochschulbefragung<br />
erfassten NRW-Forschungse<strong>in</strong>richtungen entfallen im Betrachtungsjahr<br />
2011 etwa 16 Prozent <strong>der</strong> Mittel auf EE-Forschungsprojekte. Das Volumen <strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong>zelnen Projekte erreicht 2011 e<strong>in</strong>e Größenordnung von 50.000 Euro bis zu 3<br />
Mio. Euro. Dabei variiert <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> EE-Mittel an <strong>der</strong> Gesamtsumme von<br />
Drittmitteln zwischen 5 und 60 Prozent. Die meisten Drittmittel im Jahr 2011 im<br />
EE-Bereich haben die an <strong>der</strong> Umfrage teilnehmenden Institute an <strong>der</strong> RWTH<br />
Aachen mit über 3 Mio. Euro e<strong>in</strong>geworben. Darauf folgen E<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Universitäten<br />
Duisburg-Essen, Bonn und Bochum sowie <strong>der</strong> FH Köln mit e<strong>in</strong>em<br />
Drittmittelvolumen zwischen 0,5 und etwa 1 Mio. Euro.<br />
Abbildung 6.1 gibt e<strong>in</strong>en Überblick über das breite Spektrum <strong>der</strong> zentralen Forschungsgebiete<br />
<strong>der</strong> NRW-Hochschul- und außeruniversitären E<strong>in</strong>richtungen im<br />
Bereich erneuerbare Energien.<br />
Abbildung 6.1: Hochschul-Forschungsstandorte regenerative Energien <strong>in</strong> NRW<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: Forschungsumfragen, Forschungs<strong>in</strong>formationen)<br />
170
6.2 Regenerative Energieforschung nach Sparten – Struktur<br />
und aktuelle Themengebiete<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> aktuellen Forschungsumfrage sowie die energiespartenspezifische<br />
Analyse <strong>der</strong> Forschungsstrukturen und Aktivitäten <strong>der</strong> NRW-Hochschulen<br />
und E<strong>in</strong>richtungen dokumentiert e<strong>in</strong> breites Spektrum <strong>der</strong> EE-Forschung <strong>in</strong> NRW.<br />
Tabelle 6.5 bis Tabelle 6.14 zeigen energiespartenspezifisch plakativ wichtige<br />
Strukturdaten auf und geben e<strong>in</strong>en komprimierten Überblick über den EE-<br />
Forschungsstandort Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.<br />
Speicher und Netze / Spartenübergreifende Forschung<br />
Tabelle 6.5: Struktur des Forschungsstandortes NRW – Speicher und Netze<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
W<strong>in</strong>denergie<br />
� Zahlreiche E<strong>in</strong>richtungen (u.a. an <strong>der</strong> RWTH Aachen, Uni Bochum, Uni<br />
Duisburg-Essen) <strong>in</strong> NRW befassen sich neben energiespartenspezifischen<br />
Forschungsfragen auch mit den Themen Netz<strong>in</strong>tegration erneuerbarer Energien<br />
sowie Speichertechnik<br />
� Netz- und System<strong>in</strong>tegration <strong>der</strong> Erneuerbaren Energien<br />
� Speichertechnologien<br />
� Netzplanung und Netzbetrieb<br />
� Smart Grids und Smart Meter<strong>in</strong>g<br />
� Dezentrale Energiesysteme / Inselsysteme<br />
� ganzheitliche Betrachtung von Energiesystemen<br />
� Zentrale Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtung im Bereich Batterieforschung<br />
und Speicher ist das MEET (Münster Electrochemical Energy Technology)<br />
am Fachbereich Chemie und Pharmazie <strong>der</strong> Uni Münster<br />
� an <strong>der</strong> Fakultät für Elektrotechnik und Netze an <strong>der</strong> TU Dortmund bef<strong>in</strong>det<br />
sich das Kompetenzzentrum Infrastruktur und Netze im Aufbau<br />
� an <strong>der</strong> RWTH Aachen s<strong>in</strong>d mit dem Institut für elektrische Anlagen und<br />
<strong>Energiewirtschaft</strong> (IAEW) und dem Institut für Hochspannungstechnik (IFHT)<br />
weitere Kompetenzen für Netztechnik, Elektromobilität und Speichertechnik<br />
angesiedelt<br />
Tabelle 6.6: Struktur des Forschungsstandortes NRW - Bereich W<strong>in</strong>denergie<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
� 35 E<strong>in</strong>richtungen an 13 Hochschulen und drei außeruniversitäre E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergieforschung aktiv<br />
� System<strong>in</strong>tegration<br />
� Repower<strong>in</strong>g<br />
� Überwachung und Monitor<strong>in</strong>g<br />
� Lifecycle Management / Lebensdauervorhersagen<br />
� Offshore: Netzanb<strong>in</strong>dung sowie bau- und umwelttechnische Aspekte<br />
� Technische Optimierung und Weiterentwicklung des WEA-Antriebsstrangs<br />
� Tragstrukturen (Gründung, Turm) und Fügetechnik<br />
� <strong>der</strong>zeit trotz leistungsfähiger Forschungse<strong>in</strong>richtungen noch ke<strong>in</strong>e Kompetenze<strong>in</strong>richtung<br />
<strong>in</strong> NRW<br />
171
Bioenergie<br />
Tabelle 6.7: Struktur des Forschungsstandortes NRW - Bereich Bioenergie<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
Solarenergie<br />
Forschung Bioenergie gesamt<br />
� Insgesamt f<strong>in</strong>det Bioenergie-/Biomasseforschung an 44 E<strong>in</strong>richtungen an<br />
etwa 20 Hochschulstandorten statt<br />
Biogasforschung (Anlagentechnik, Vergärung / Verbrennung &Substratanbau)<br />
� rd. 15 Hochschule<strong>in</strong>richtungen an acht Hochschulstandorten sowie zwei<br />
außeruniversitäre Institutionen im Bereich Biogasforschung aktiv<br />
Forschung feste Biomasse (Anlagentechnik, Verbrennung und Substratanbau)<br />
� Aktivitäten von 16 Hochschule<strong>in</strong>richtungen an 12 Standorten bekannt<br />
Forschungsfel<strong>der</strong> Biogas<br />
� System<strong>in</strong>tegration / Speicherung<br />
� Gasturb<strong>in</strong>en<br />
� Messtechnik<br />
� Optimierung<br />
� Fermentationstechnologie, Vergasung Kle<strong>in</strong>fermenter<br />
� Biogas im Erdgasnetz<br />
� Substrate für Biogasanlagen<br />
� Verfahrensbewertung von NawaRo-Biogasanlagen<br />
Forschungsfel<strong>der</strong> feste Biomasse<br />
� System<strong>in</strong>tegration / Speicherung<br />
� Biomasseverbrennung<br />
� Energiepflanzen<br />
� Pelletierung / Brikettierung<br />
� Prozessdatenanalyse und Messtechnik<br />
� Biosolare Reaktoren<br />
Biogas<br />
� zentrale Kompetenz- und Forschungse<strong>in</strong>richtungen: Fraunhofer UMSICHT<br />
und FH Münster, Campus Ste<strong>in</strong>furt; Fachbereich Energie - Gebäude - Umwelt<br />
feste Biomasse<br />
� Fraunhofer UMSICHT<br />
Tabelle 6.8: Struktur des Forschungsstandortes NRW - Bereich Photovoltaik<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
� 36 E<strong>in</strong>richtungen an 17 Hochschulen und 6 außeruniversitäre E<strong>in</strong>richtungen<br />
mit Forschungsaktivitäten bei PV bekannt<br />
� System<strong>in</strong>tegration und Speicherung<br />
� Erzeugung von nanoskaligen Funktionsmaterialien<br />
� PV-Hybridkollektoren<br />
� Herstellung selektiver Emitter für multikristall<strong>in</strong>e Silizium Solarzellen<br />
� Regelung von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen<br />
� Materialeigenschaften- und Entwicklung<br />
� Halbleiter- und Nanotechnologie<br />
� Qualitätsprüfung von PV-Anlagen; Test- und Qualifizierungs-Verfahren<br />
� zentrale Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtung: Labor- und Servicecenter<br />
Gelsenkirchen (LSC) des Fraunhofer ISE und IEK-5 am FZ Jülich sowie TÜV<br />
Rhe<strong>in</strong>land als <strong>in</strong>ternational bedeutende Test- und Zertifizierungse<strong>in</strong>richtung<br />
172
Tabelle 6.9: Struktur des Forschungsstandortes NRW - Bereich Solarthermie<br />
NT (Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
� 16 Hochschule<strong>in</strong>richtungen an zehn Hochschulstandorten und zwei außeruniversitäre<br />
E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Solarthermieforschung aktiv<br />
� Solare Kühlung<br />
� solare Prozesswärme<br />
� Speicherung<br />
� Haltbarkeit von Kollektoren<br />
� Qualitätsprüfung von solarthermischen Komponenten, Test- und Qualifizierungs-Verfahren<br />
� Zentrale Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtung: TÜV Rhe<strong>in</strong>land als <strong>in</strong>ternational<br />
bedeutende Test- und Zertifizierungse<strong>in</strong>richtung<br />
Tabelle 6.10: Struktur des Forschungsstandortes NRW - Bereich Solarthermische<br />
Kraftwerke (Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
Oberflächennahe Geothermie<br />
� neun Hochschule<strong>in</strong>richtungen an sieben Hochschulstandorten und drei<br />
außeruniversitäre Institute im Bereich <strong>der</strong> solarthermische Kraftwerksforschung<br />
aktiv<br />
� System<strong>in</strong>tegration und Speicherung<br />
� Solarthermische Kraftwerkssysteme<br />
� Systemsimulation<br />
� Speichertechniken<br />
� Receiverentwicklung<br />
� Dampfturb<strong>in</strong>en<br />
� Machbarkeitsstudien<br />
� zwei zentrale Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen mit <strong>in</strong>ternational<br />
hoher Bedeutung (DLR - Institut für technische Thermodynamik (ITT), Solar<strong>in</strong>stitut<br />
Jülich <strong>der</strong> FH Aachen) <strong>in</strong> NRW<br />
Tabelle 6.11: Struktur des Forschungsstandortes NRW - Bereich oberflächennahe<br />
Geothermie (Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
� <strong>in</strong> NRW forschen 14 Hochschule<strong>in</strong>richtungen an 10 Standorten und drei<br />
außeruniversitäre E<strong>in</strong>richtungen im Bereich oberflächennahe Geothermie<br />
� Hydrogeologie / Hydrochemie<br />
� Geothermische Heiz- und Kühlsysteme<br />
� Zentrale Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtung mit dem Internationalen<br />
Geothermiezentrum <strong>in</strong> Bochum <strong>in</strong> NRW ansässig, deckt Themenfel<strong>der</strong> aus<br />
oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie ab<br />
173
Tiefengeothermie<br />
Tabelle 6.12: Struktur des Forschungsstandortes NRW - Bereich Tiefengeothermie<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
Wasserkraft<br />
� 7 Hochschule<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> NRW an sechs Standorten forschen auf dem<br />
Gebiet <strong>der</strong> Tiefengeothermie<br />
� Hydrogeologie / Hydrochemie<br />
� Optimierung <strong>der</strong> Bohrtechnik (advanced drill<strong>in</strong>g)<br />
� Stromversorgung für die Bohrlochsensorik<br />
� energetische Versorgung von Großlebensräumen mit Geoenergie<br />
� Zentrale Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtung mit dem Internationalen<br />
Geothermiezentrum <strong>in</strong> Bochum <strong>in</strong> NRW ansässig, deckt Themenfel<strong>der</strong> aus<br />
oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie ab<br />
Tabelle 6.13: Struktur des Forschungsstandortes NRW - Bereich Wasserkraft<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
Brennstoffzelle<br />
� 17 Institutionen (Vorjahr: 16) an zehn Hochschulen <strong>in</strong> NRW bekannt, die im<br />
Bereich Wasserkraft aktiv s<strong>in</strong>d<br />
� Wirtschaftlichkeitsanalysen<br />
� Bau von Unterflur-Pumpspeicherwerken <strong>in</strong> Anlagen des Ste<strong>in</strong>- und Braunkohlebergbaus<br />
� Kle<strong>in</strong>wasserturb<strong>in</strong>en<br />
� Entspannungsturb<strong>in</strong>en<br />
� Fachbereich Wasserbau und Hydromechanik an <strong>der</strong> Universität Siegen<br />
(Bereich Kle<strong>in</strong>wasserkraft)<br />
Tabelle 6.14: Struktur des Forschungsstandortes NRW - Bereich Brennstoffzelle<br />
(Quelle: IWR, 2012)<br />
Struktur<br />
aktuelle Themengebiete<br />
& Schwerpunkte<br />
Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
� 30 E<strong>in</strong>richtungen an 13 Hochschulstandorten <strong>in</strong> NRW im Bereich Brennstoffzelle<br />
aktiv<br />
� Brennstoffzellensysteme und Komponenten (u.a. Membranbrennstoffzellen<br />
� Wasserstofferzeugung aus Biomasse<br />
� Nanomaterialien für energietechnische Anwendungen<br />
� zentrale Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>d die außeruniversitären<br />
E<strong>in</strong>richtungen ZBT (<strong>in</strong>kl. TAZ) <strong>in</strong> Duisburg sowie das Institut für Energieforschung<br />
IEK-3 am Forschungszentrum Jülich<br />
174
6.3 NRW-Kompetenze<strong>in</strong>richtungen – Strukturen und Aktivitäten<br />
Das Geschäft mit regenerativen Energietechniken ist <strong>in</strong> den letzten Jahren durch<br />
e<strong>in</strong>en zunehmenden Internationalisierungsgrad gekennzeichnet. Absatzmarkt<br />
und Forschungsmarkt driften zusehends ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund ist<br />
es für die Erschließung von neuen Märkten von großer Bedeutung, dass die Unternehmen<br />
an ihren zentralen Standorten neue Techniken und Produkte <strong>in</strong> enger<br />
Kooperation mit e<strong>in</strong>er leistungsfähigen Forschungslandschaft entwickeln können.<br />
Dabei kommt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e den Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong><br />
NRW e<strong>in</strong>e zentrale Rolle zu. Durch Bündelung von Forschungs- und Technologie-Know-how<br />
und die Ausstattung mit leistungsfähigen Test- und Prüfe<strong>in</strong>richtungen<br />
übernehmen sie e<strong>in</strong>e wichtige Brückenfunktion an <strong>der</strong> Schnittstelle zwischen<br />
Industrie und anwendungsnaher Forschung.<br />
Tabelle 6.15: Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> NRW – Bestehende<br />
Technische Ausstattung und Aktivitäten (Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Sparte E<strong>in</strong>richtung / [Schwerpunkt] Teste<strong>in</strong>r. Zertifizierung Normung Lizensierung<br />
Solarenergie Deutsches Zentrum für Luft und<br />
Raumfahrt (DLR)<br />
[Solartherm. Kraftwerke]<br />
+++ – – ++<br />
Solar-Institut Jülich<br />
[Solartherm. Kraftwerke]<br />
Fraunhofer ISE, Labor- und<br />
Servicecenter Gelsenkirchen<br />
[Photovoltaik]<br />
Inst. für Energie- und Klimaforschung,<br />
Photovoltaik (IEK-5) am FZ Jülich<br />
[PV-Dünnschichttechnologie]<br />
TÜV Rhe<strong>in</strong>land<br />
[Solarthermie NT, Photovoltaik]<br />
Bioenergie Fraunhofer UMSICHT<br />
[Bioenergie / Biogas / Biotreibstoffe]<br />
FH Münster / Standort Ste<strong>in</strong>furt<br />
[Biogas / Biotreibstoffe]<br />
Brennstoffzelle ZBT Duisburg<br />
[Brennstoffzellentechnik]<br />
Inst. für Energie- und Klimaforschung,<br />
Brennstoffzellen (IEK-3) am FZ Jülich<br />
[Brennstoffzellentechnik]<br />
Wasserkraft Uni Siegen, FB Wasserbau und<br />
Hydromechanik<br />
[Kle<strong>in</strong>wasserkraft]<br />
Geothermie Internationales Geothermiezentrum<br />
[Geothermie, im Aufbau]<br />
Netze / Infrastrukturen<br />
/<br />
Elektromobilität<br />
MEET (Münster Electrochemical Energy<br />
Technology)<br />
[Energiespeicher, Batterieforschung]<br />
Kompetenzzentrum für Elektromobilität,<br />
Infrastruktur & Netze (TIE-IN) (virtuell)<br />
[Netze, Elektromobilität, im Aufbau]<br />
Geschäftsstelle Elektromobilität (virtuell)<br />
[Fahrzeugtechnik, Elektromobilität]<br />
W<strong>in</strong>denergie Center for W<strong>in</strong>d Power Drives (CWD)<br />
[WEA-Antriebstechnik, im Aufbau]<br />
Kompetenzzentrum W<strong>in</strong>dkrafttechnik<br />
[W<strong>in</strong>denergie, geplant]<br />
+++ = sehr gut, ++ = gut, + = vorhanden, – = noch nicht vorhanden<br />
+++ – – +<br />
++ – – ++<br />
+++ + – –<br />
+++ +++ ++ +<br />
+++ + – ++<br />
++ – + –<br />
++ ++ + +<br />
+++ + – +<br />
+ – + –<br />
+ – – –<br />
++ – – –<br />
++ – – –<br />
++ – – –<br />
+ – – –<br />
– – – –<br />
175
Für e<strong>in</strong>e stärkere Vernetzung zwischen Forschung und Industrie bei EE-<br />
Techniken s<strong>in</strong>d <strong>der</strong> Auf- und Ausbau <strong>der</strong> bestehenden Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
und die Bündelung von Kompetenzen daher von zentraler Bedeutung.<br />
In NRW gibt es <strong>der</strong>zeit über alle regenerativen Teilsparten h<strong>in</strong>weg 11<br />
bestehende zentrale Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen. E<strong>in</strong> Kompetenzzentrum<br />
für WEA-Antriebstechnik bef<strong>in</strong>det sich <strong>der</strong>zeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Aufbauphase. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus bestehen weiterh<strong>in</strong> Pläne zur E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Kompetenzzentrums<br />
W<strong>in</strong>dkrafttechnik. Im Bereich Speicher- und Netztechnik sowie Elektromobilität<br />
befassen sich EE-spartenübergreifend drei weitere E<strong>in</strong>richtungen mit FuE-<br />
Aktivitäten. Bei zwei dieser E<strong>in</strong>richtungen handelt es sich um 2011 gegründete<br />
virtuelle Kompetenzzentren, die das Know-how und die vorhandenen Teste<strong>in</strong>richtungen<br />
verschiedener Hochschul<strong>in</strong>stitute bündeln und vernetzen. Außerdem existieren<br />
<strong>in</strong> NRW auf Hochschulebene umfangreiche Kompetenzen im Bereich Netztechnik,<br />
die noch nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em eigenen Zentrum gebündelt werden.<br />
Im Zuge des Monitor<strong>in</strong>gs werden für die vorliegende Studie die Entwicklungen<br />
<strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungen im Vergleich zum Vorjahr erfasst. Dabei zeigt sich, dass <strong>der</strong><br />
Ausbau <strong>der</strong> Kompetenzzentren mit unterschiedlicher Dynamik voranschreitet. In<br />
etlichen Fällen wurden <strong>der</strong> Mitarbeiterbestand und die technischen Test- und<br />
Prüfe<strong>in</strong>richtungen ausgebaut. In an<strong>der</strong>en Fällen bestehen bereits konkrete Pläne<br />
für den weiteren Ausbau <strong>der</strong> technischen Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen bzw. es wurde<br />
mit dem Bau bereits begonnen. Während beim Ausbau <strong>der</strong> Infrastrukturen<br />
und bei Beschäftigung Fortschritte zu verzeichnen s<strong>in</strong>d, ergeben sich nach dem<br />
Monitor<strong>in</strong>g <strong>in</strong> den für den <strong>in</strong>dustriellen Fertigungsprozess wichtigen Bereichen<br />
Zertifizierung, Normung und Lizensierung kaum Verän<strong>der</strong>ungen (Tabelle 6.15).<br />
Aktuelle Schwerpunkte beim Ausbau <strong>der</strong> technischen Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen<br />
liegen auf solarthermischen Kraftwerken, <strong>der</strong> Bioenergienutzung sowie Speichertechniken.<br />
So wurde z.B. am Solar<strong>in</strong>stitut Jülich (SIJ) e<strong>in</strong> Sandspeicher für solarthermische<br />
Kraftwerke errichtet. Zudem wurden die Infrastrukturen im Bereich solar<br />
erzeugter Brennstoffe mit e<strong>in</strong>em Motorenteststand für die Abgasanalyse erweitert.<br />
Am Fraunhofer UMSICHT Institut s<strong>in</strong>d im Geschäftsfeld Biogas neue Anlagen<br />
zur Gasanalytik errichtet worden. Im Geschäftsbereich Biokraftstoffe erfolgte<br />
e<strong>in</strong> Ausbau <strong>der</strong> Anlagen zur Veresterung, Destillation und Hydrierung. Am Internationalen<br />
Geothermiezentrum <strong>in</strong> Bochum steht die Aufbauphase kurz vor<br />
dem Abschluss, noch <strong>in</strong> 2012 soll <strong>der</strong> Bau des Geotechnikums sowie <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Labore, Teststände und technischen E<strong>in</strong>richtungen abgeschlossen<br />
werden [68]. Durch die überregionale Bedeutung dieser E<strong>in</strong>richtung ist mittel- bis<br />
langfristig e<strong>in</strong>e weitere Stärkung des Standortes NRW auf dem Geothermiesektor<br />
zu erwarten. Mit Blick auf das Thema Energiespeicherung geht <strong>der</strong> Ausbau des<br />
MEET (Münster Electrochemical Energy Technology) voran. Hier wurden E<strong>in</strong>richtungen<br />
für die Batterieforschung (Lithium-Ionen-Technologie) und die Materialwissenschaft<br />
zur elektrochemischen Energiespeicherung ausgebaut. Zudem<br />
wurde an <strong>der</strong> TU Dortmund mit dem Aufbau des Kompetenzzentrums für Elektromobilität,<br />
Infrastruktur und Netze (TIE-IN) begonnen und an <strong>der</strong> RWTH Aachen<br />
die Geschäftsstelle Elektromobilität eröffnet. Beide E<strong>in</strong>richtungen bündeln und<br />
vernetzen die Kompetenzen <strong>der</strong> Hochschulen <strong>in</strong> den jeweiligen Themengebieten.<br />
Die nachfolgenden Steckbriefe verdeutlichen die aktuellen Tätigkeitsschwerpunkte<br />
<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen E<strong>in</strong>richtungen und den Stand <strong>der</strong> Aktivitäten (Tabelle 6.16 bis<br />
Tabelle 6.28).<br />
176
6.3.1 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Bioenergie<br />
Tabelle 6.16: Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik<br />
UMSICHT (Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung außeruniversitäre Forschungse<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform eigenständiges Institut, das zur Fraunhofer-Gesellschaft gehört<br />
Gründungsjahr 1990<br />
Thematischer Ursprung angewandte und <strong>in</strong>dustrienahe Verfahrenstechnik<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie (Bio-)Energieanlagentechnik (u.a. Biogas), Biogasrepower<strong>in</strong>g /<br />
-aufbereitung, Nachwachsende Rohstoffe (Ersatzbrennstoffe),<br />
Power-to-Gas-Verfahren (Energiespeicherung), Gasanalyse,<br />
Biotreibstoffe<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung seit Gründung 1990<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung rd. 345 / 55 (Standort Oberhausen)<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Teste<strong>in</strong>richtungen im Labormaßstab, M<strong>in</strong>ibiogas-Anlagen,<br />
Erweiterte Teststände zur Gasanalytik<br />
Zertifizierung Aktivitäten vorhanden (Anlagenbetrieb)<br />
Lizensierung Aktivitäten vorhanden (Entschwefelung von Biogas)<br />
Normung Aktivitäten vorhanden (VDI-Richtl<strong>in</strong>ien)<br />
Tabelle 6.17: FH Münster - Laboratorium für Energieversorgung und <strong>Energiewirtschaft</strong><br />
(Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung Fachbereich FH Münster / Standort Ste<strong>in</strong>furt<br />
Organisationsform FH-Institut bzw. Laboratorium<br />
Gründungsjahr Laboratorium seit 1996<br />
Thematischer Ursprung Blockheizkraftwerke (Laboratorium)<br />
Abwasser und Siedlungswasserwirtschaft (Fachbereich)<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie im Zentrum BHKW-Technik, aber auch PV (Laboratorium)<br />
Biogas, Biotreibstoffe (Fachbereich)<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung seit 1996<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung rd. 34 (Fachbereich) / rd. 5 (Labor)<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Motorenteststand (Laboratorium)<br />
mobiles Analyselabor, Kle<strong>in</strong>stfermenter, Analysegeräte zur<br />
Potenzialbestimmung von Biogas<br />
Zertifizierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Lizensierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Normung Aktivitäten vorhanden<br />
177
6.3.2 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Solarenergie<br />
Tabelle 6.18: Institut für Energie- und Klimaforschung, Institutsbereich IEK-5 am<br />
Forschungszentrum Jülich, (Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung Forschungszentrum<br />
Organisationsform Institutsbereich des Instituts für Energie- und Klimaforschung<br />
am FZ Jülich (<strong>in</strong> <strong>der</strong> Helmholtz-Geme<strong>in</strong>schaft)<br />
Gründungsjahr IEK-5 (bis 2010 = IEF-5): 2000<br />
Thematischer Ursprung Atomforschung<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Photovoltaik<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung seit den 90er Jahren<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung rd. 800 (IEK gesamt) / 110 (IEK-5 / PV)<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Messgeräte zur Ermittlung des Wirkungsgrades sowie zur<br />
Messung <strong>der</strong> Quantenausbeute<br />
Mehrkammeranlage (6 Kammer-Depositionsanlage)<br />
Zertifizierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Lizensierung Aktivitäten vorhaben<br />
Normung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Tabelle 6.19: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Labor - und<br />
Servicecenter Gelsenkirchen (LSC), (Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung außeruniversitäre Forschungse<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform E<strong>in</strong>richtung <strong>der</strong> Fraunhofer-Gesellschaft<br />
Gründungsjahr 2000<br />
Thematischer Ursprung Photovoltaik<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Photovoltaik (Produktionsprozess)<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung 2000<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung rd. 20<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Produktionsequipment für kristall<strong>in</strong>e Siliziumtechnologie<br />
Produktionsequipment für amorphe und monokristall<strong>in</strong>e<br />
Dünnschichttechnologie<br />
Zertifizierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Lizensierung Aktivitäten vorhanden<br />
Normung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
178
Tabelle 6.20: Institut für Solarforschung am DLR - Bereich Solarforschung<br />
(Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung außeruniversitäre Forschungse<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform Institut am DLR (<strong>in</strong> <strong>der</strong> Helmholtz-Geme<strong>in</strong>schaft)<br />
Gründungsjahr 2011 (vorher Bereich Solarforschung am DLR-Institut für<br />
Technische Thermodynamik)<br />
Thematischer Ursprung Solarthermische Kraftwerke<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Solarthermische Kraftwerke<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung 2003 (Institut, Hauptabteilung seit 1979)<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung rd. 120 <strong>in</strong>sgesamt an den Standorten Köln, Stuttgart und<br />
Almería im Bereich Solarforschung, davon rd. 65 <strong>in</strong> Köln<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Test- und Qualifizierungszentrum für konzentrierende<br />
Solartechnik (QUARZ), Zugriff auf das Competence Center for<br />
Ceramic Materials and Thermal Storage Technologies <strong>in</strong><br />
Energy Research (CeraStorE), Sonnenofen (25 kW), Neu:<br />
Integration Solarturm Jülich, neuer Hochleistungsstrahler (200<br />
kW), Multifocusturm<br />
Zertifizierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Lizensierung Aktivitäten vorhanden<br />
Normierung Aktivitäten vorhanden<br />
Tabelle 6.21: Solar<strong>in</strong>stitut Jülich (SIJ), Fachhochschule Aachen (Quelle: IWR, 2012,<br />
eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung universitäre Forschungse<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform Institut an <strong>der</strong> Fachhochschule Aachen<br />
Gründungsjahr 1992<br />
Thematischer Ursprung Anwendungsorientierte Forschung <strong>in</strong> den Bereichen<br />
regenerative Energien und Energieeffizienz<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Solarforschung (u.a. solarthermische Kraftwerke, Solarthermie<br />
NT etc.)<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung 1992<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung 62<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Motorenteststand für solar erzeugte Brennstoffe,<br />
Sonnensimulation, Labore<strong>in</strong>richtungen, Zugang zum<br />
Solarturmkraftwerk Jülich<br />
Neu: thermischer Sand-Speicher, Teststand für Kollektoren<br />
Zertifizierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Lizensierung Aktivitäten vorhanden<br />
Normung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
179
Tabelle 6.22: TÜV Rhe<strong>in</strong>land (Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung Test- und Prüfe<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform Prüfdienstleister (Forschungsaktivitäten im Bereich<br />
Photovoltaik)<br />
Gründungsjahr 1872<br />
Thematischer Ursprung Sicherung von Produktionsanlagen / Dampfkesseln,<br />
Sicherheitsprüfungen<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Photovoltaik-Forschung: Analyse-, Mess- und Prüfverfahren für<br />
PV-Module, Analyse des Langzeitverhaltens von PV-Modulen<br />
Neu: <strong>in</strong>ternationales Langzeittestprojekt mit 30 verschiedenen<br />
PV-Modulen an weltweiten Standorten<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung 1979<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung 60 PV (Forschung und Zertifizierung) / 10 Solarthermie<br />
(Zertifizierung)<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Solar-Prüflabore (u.a. mit Sonnensimulatoren, spektralem<br />
Empf<strong>in</strong>dlichkeitsmessstand, begehbaren Klimakammern,<br />
Ammoniakkorrosionskammer, Salznebelkorrosionskammer)<br />
Neu: Kammer für homogene Schneelasten, Sonnensimulator<br />
für Blitzlicht<br />
Zertifizierung Aktivitäten vorhanden (Weltmarktführer PV)<br />
Lizensierung Aktivitäten vorhanden<br />
Normung Aktivitäten vorhanden (Mitarbeit <strong>in</strong> Normungsgremien)<br />
180
6.3.3 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Geothermie (oberflächennahe und tiefe<br />
Geothermie)<br />
Tabelle 6.23: Internationales Geothermiezentrum (GZB) (Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung Außeruniversitäre Forschungse<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform E<strong>in</strong>getragener Vere<strong>in</strong> / Verbundforschungse<strong>in</strong>richtung von<br />
Wissenschaft und Wirtschaft unter E<strong>in</strong>beziehung von<br />
Verwaltung und Politik<br />
Gründungsjahr 2003 (2005 öffentlich-rechtlicher Teil)<br />
Thematischer Ursprung Geothermie<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Geothermie (oberflächennahe und tiefe)<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung 2003<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung rd. 25 (<strong>in</strong>kl. Kooperationspartner rd. 45)<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen im Aufbau (Fertigstellung 2012 geplant): Geotechnikum, <strong>in</strong><br />
situ-Labor für Versuche unter produktionsnahen Bed<strong>in</strong>gungen,<br />
Teste<strong>in</strong>richtung für Bohrtechnik bis 1.000 bzw. 5.000 m Tiefe,<br />
verschiedene Labore (u.a. Bohrtechnologie, Bauphysik,<br />
Geotechnik, Reservoirstimulationstechnik, Mechatronik etc.),<br />
Energetikum für Wärmpumpen und geothermische<br />
Versorgungstechnik<br />
Neu <strong>in</strong> Planung: Labor zur Simulation und numerischen<br />
Modellierung<br />
Zertifizierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Lizensierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Normung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
181
6.3.4 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Brennstoffzellen<br />
Tabelle 6.24: Institut für Energie- und Klimaforschung, Institutsbereich IEK-3 am<br />
Forschungszentrum Jülich, (Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung außeruniversitäre Forschungse<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform Institut am FZ Jülich (<strong>in</strong> <strong>der</strong> Helmholtz-Geme<strong>in</strong>schaft)<br />
Gründungsjahr 1953 (Gesellschaft zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> "Kernphysikalischen<br />
Forschung e.V." (GFKF)<br />
Thematischer Ursprung Kernforschung<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Brennstoffzellentechnik/CCS-Technik<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung seit den 90er Jahren<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung rd. 120 (gesamtes Institut) / 110 Brennstoffzellen<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen HGF Brennstoffzellen-Analytiklabor, elektrochemische Labore<br />
zur Brennstoffzellen-Charakterisierung, Brennstoffzellen-<br />
Teststände, Brennstoffzellentestproduktion, Tanklager für<br />
Mitteldestillate, Technikum für DMFC und PEMFC-Zellen<br />
Neu: Laborbereich zur Zell- und Stackcharakterisierung<br />
Zertifizierung Aktivitäten vorhanden<br />
Lizensierung Aktivitäten vorhanden<br />
Normung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Tabelle 6.25: Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT), Test- und Assemblierungszentrum<br />
(TAZ) (Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung außeruniversitäre Forschungse<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform eigenständige GmbH<br />
Gründungsjahr 2001<br />
Thematischer Ursprung Brennstoffzelle<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Brennstoffzelle<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung 2001 (1995 Gesamthochschule Duisburg)<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung rd. 100 (gesamte E<strong>in</strong>richtung bzw. EE-Forschung)<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Masch<strong>in</strong>enpark (Kunststoff und Kohlenstoff-Mischer),<br />
Prüfstände: Zellen, Charakterisierungsmethode,<br />
Dichtheitsprüfung, Assemblierungsl<strong>in</strong>ie mit Roboter (Prof. Witt),<br />
BHKW-Tests<br />
Neu: Elektrolyseteststand, Batterieteststand<br />
Zertifizierung Aktivitäten vorhanden<br />
Lizensierung Aktivitäten vorhanden<br />
Normung Aktivitäten vorhanden<br />
182
6.3.5 Kompetenze<strong>in</strong>richtungen Batterietechnik, Speicherung und Elektromobilität<br />
Tabelle 6.26: MEET (Münster Electrochemical Energy Technology)<br />
(Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung Batterieforschungszentrum <strong>der</strong> Westfälischen Wilhelms-<br />
Universität Münster<br />
Organisationsform E<strong>in</strong>richtung <strong>der</strong> Westfälischen Wilhelms-Universität Münster<br />
Gründungsjahr 2009<br />
Thematischer Ursprung Stiftungsprofessur „Angewandte Energiespeicherung“<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Batterieforschung<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung 2009<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung 120 / 100<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Labore, Techikum mit Trocken- und Re<strong>in</strong>raum zur<br />
Zellherstellung, exzellente Synthese- und<br />
Analytike<strong>in</strong>richtungen, Zyklisiergeräte<br />
Zertifizierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Lizensierung Aktivitäten vorhanden<br />
Normung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Tabelle 6.27: Kompetenzzentrum für Elektromobilität, Infrastruktur und Netze<br />
(TIE-IN) (Quelle: IWR, 2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung Universitäre Forschungse<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform E<strong>in</strong>richtung <strong>der</strong> Technischen Universität Dortmund (virtuelles<br />
Kompetenzzentrum)<br />
Gründungsjahr 2011<br />
Thematischer Ursprung Energiesysteme, <strong>Energiewirtschaft</strong> und Energieeffizienz<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Transport und Verteilnetze, Mess- und<br />
Automatisierungssysteme, EE-Integration <strong>in</strong> Elektrizitätsmarkt<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung 2011<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung 15 / 15<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Mess- und Prüfstände für Lade<strong>in</strong>frastruktur, Mess- und<br />
Prüfstände für Netztechnik, EMV-Messlabor<br />
Zertifizierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Lizensierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Normung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
183
Tabelle 6.28: Geschäftsstelle Elektromobilität an <strong>der</strong> RWTH Aachen (Quelle: IWR,<br />
2012, eigene Erhebung)<br />
Art <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung Universitäre Forschungse<strong>in</strong>richtung<br />
Organisationsform Geschäftsstelle, E<strong>in</strong>richtung an <strong>der</strong> RWTH Aachen (virtuelles<br />
Kompetenzzentrum)<br />
Gründungsjahr 2011<br />
Thematischer Ursprung E<strong>in</strong>gerichtet zur Bündelung und Koord<strong>in</strong>ierung <strong>der</strong><br />
Hochschulkompetenzen auf den Themengebieten<br />
Elektromobilität und Fahrzeugtechnik<br />
Aktuelle FuE-Bereiche Energie Forschungsthemen im Bereich Fahrzeugtechnik und<br />
Elektromobiilität<br />
Beg<strong>in</strong>n EE-Forschung 2011<br />
Mitarbeiter gesamt / EE-Forschung 7 / 7<br />
Technische E<strong>in</strong>richtungen Fahrzeughallen, Fahrzeugrollenprüfstande, Teststrecke,<br />
Motorenprüfstände, Chemielabore, Batterieprüfstände,<br />
Hochspannungsprüfstände, Automatisierte Lade- und<br />
Entladeprüfstände, Halbleiter-Prüfstände, Re<strong>in</strong>räume,<br />
Fertigungsanlagen für Prototypen<br />
Zertifizierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Lizensierung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
Normung ke<strong>in</strong>e Aktivitäten<br />
184
7 Bildung: Aus- und Weiterbildung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong><br />
<strong>Energiewirtschaft</strong><br />
7.1 Regeneratives Studiengang-Angebot <strong>in</strong> NRW<br />
7.1.1 Strukturen <strong>der</strong> regenerativen Hochschulausbildung im Überblick<br />
Mit dem Ausbau <strong>der</strong> Nutzung regenerativer Energiequellen steigt <strong>in</strong>ternational<br />
und national <strong>der</strong> Bedarf an qualifizierten Fachkräften an. Dies gilt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
für technisch und ökonomisch ausgebildete Ingenieure. Die Hochschulen auf <strong>in</strong>ternationaler<br />
und nationaler Ebene reagieren auf die steigende Nachfrage durch<br />
die Erweiterung des Angebots an Studiengängen sowie sonstigen Ausbildungsangeboten,<br />
z.B. im Rahmen von Sommeruniversitäten. Bei den EE-<br />
Studiengängen verfolgen die Hochschulen zwei unterschiedliche Ansätze:<br />
� Klassische Studiengänge: EE-Schwerpunktergänzung<br />
� Neue Spezial-Studiengänge zu erneuerbaren Energien<br />
In Deutschland gibt es spezifische EE-Studiengänge <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im Themenfeld<br />
<strong>der</strong> Offshore-W<strong>in</strong>denergie. So bietet die FH Kiel ab dem W<strong>in</strong>tersemester<br />
2012/2013 den Bachelorstudiengang „Offshore-Anlagentechnik“ an. Im selben<br />
Semester startet auch das berufsbegleitende und weiterbildende Offshore-<br />
W<strong>in</strong>dstudium, das vom Zentrum für W<strong>in</strong>denergieforschung (ForW<strong>in</strong>d) und <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>denergie-Agentur (wab) entwickelt wurde.<br />
Neben landesgebundenen Studiengängen kooperieren bereits e<strong>in</strong>ige Hochschulen<br />
<strong>in</strong> Europa auf dem Gebiet erneuerbare Energien und bieten geme<strong>in</strong>sam spezielle<br />
Masterstudiengänge an. Studenten können die i.d.R. als Masterstudiengang<br />
ausgelegten Angebote dann an mehreren Hochschulen im In- und Ausland<br />
studieren und von den jeweiligen Kompetenzen <strong>der</strong> Hochschulen profitieren. E<strong>in</strong><br />
Beispiel ist <strong>der</strong> Studiengang „European W<strong>in</strong>d Energy Master“, <strong>der</strong> geme<strong>in</strong>sam<br />
von <strong>der</strong> Delft University of Technology (Nie<strong>der</strong>lande), <strong>der</strong> Technical University of<br />
Denmark (Dänemark), <strong>der</strong> Norwegian University of Science and Technology<br />
(Norwegen) und dem Zentrum für W<strong>in</strong>denergieforschung <strong>der</strong> Universität Oldenburg<br />
ab dem W<strong>in</strong>tersemester 2012/2013 angeboten wird. E<strong>in</strong> vergleichbarer Ansatz<br />
liegt auch dem <strong>in</strong>ternationalen Masterstudiengang „European Master <strong>in</strong> Renewable<br />
Energy“ zugrunde. Auch hier erfolgen die e<strong>in</strong>zelnen Ausbildungsphasen<br />
je nach Spezialisierungsrichtung <strong>der</strong> Studenten an mehreren Hochschulen <strong>in</strong><br />
verschiedenen europäischen Län<strong>der</strong>n.<br />
7.1.2 Regenerative Studiengänge an den Hochschulen <strong>in</strong> NRW<br />
Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2011 über die Recherche mit 56 Studiengängen<br />
etwa 47 Prozent mehr Angebote an NRW-Hochschulen ermittelt (2011: 38<br />
Studiengänge). Überwiegend handelt es dabei um klassische Studiengänge<br />
(Elektrotechnik, Masch<strong>in</strong>enbau etc.), die um regenerative Studienmodule ergänzt<br />
werden. Es bef<strong>in</strong>den sich unter den 56 Studiengängen lediglich drei Angebote, <strong>in</strong><br />
denen ausschließlich e<strong>in</strong>e Spezialisierung auf regenerative Energien erfolgt. Zudem<br />
zeigt sich e<strong>in</strong>e unterschiedliche Verteilung <strong>der</strong> Abschlüsse <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
185
Studiengänge zwischen Universitäten und Fachhochschulen. Während Universitäten<br />
mehr regenerative Studiengänge mit Masterabschluss anbieten, dom<strong>in</strong>ieren<br />
bei den Fachhochschulen die Bachelorangebote (Tabelle 7.1).<br />
Tabelle 7.1: Studiengänge im Bereich erneuerbare Energien <strong>in</strong> NRW<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Abschluss Kategorie Studiengänge Universitäten Fachhochschulen<br />
Bachelor Grundständiger Studiengang mit <strong>der</strong><br />
Möglichkeit <strong>der</strong> Schwerpunktwahl im EE-<br />
Bereich<br />
6 26<br />
Eigenständiger EE-Studiengang 0 2<br />
Master Grundständiger Studiengang mit <strong>der</strong><br />
Möglichkeit <strong>der</strong> Schwerpunktwahl im EE-<br />
Bereich<br />
11 10<br />
Eigenständiger EE-Studiengang 0 1<br />
Gesamt 17 39<br />
Die dom<strong>in</strong>ierenden Fachbereiche mit regenerativen Inhalten an den NRW-<br />
Hochschulen s<strong>in</strong>d Elektrotechnik (30 Prozent), Wirtschafts<strong>in</strong>genieurwesen / Wirtschaftswissenschaften<br />
(29 Prozent) und Masch<strong>in</strong>enbau (23 Prozent) (Tabelle<br />
7.2).<br />
Tabelle 7.2: Studiengänge im Bereich erneuerbare Energien <strong>in</strong> NRW nach Fachbereichen<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Fachrichtung 2012<br />
absolut<br />
2012<br />
Anteil <strong>in</strong> [%]<br />
2011<br />
absolut<br />
2011<br />
Anteil <strong>in</strong> [%]<br />
Elektrotechnik 17 30,4 12 31,6<br />
Wirtschafts<strong>in</strong>genieurwesen /<br />
Wirtschaftswissenschaften<br />
16 28,6 12 31,6<br />
Masch<strong>in</strong>enbau 13 23,2 7 18,4<br />
Bau<strong>in</strong>genieurwesen 5 8,9 4 10,5<br />
Sonstige (Agrarwissenschaften, Informatik,<br />
Architektur)<br />
5 8,9 3 7,9<br />
Gesamt 56 100,0 38 100,0<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf die energiespartenspezifische Differenzierung liegen Studiengänge<br />
mit Schwerpunktmodulen zur Solarenergie (34 Prozent), W<strong>in</strong>denergie (18<br />
Prozent) und Bioenergie (14 Prozent) vorne. E<strong>in</strong> weiteres zentrales Studiengebiet<br />
ist <strong>der</strong> Bereich <strong>der</strong> Energieeffizienz, auf das ebenso e<strong>in</strong> Anteil von etwa 14 Prozent<br />
entfällt.<br />
186
Rund 14 Prozent <strong>der</strong> Studiengänge bieten spezifische Schwerpunktmodule zu<br />
diesem Thema. Über 70 Prozent <strong>der</strong> angebotenen Studiengänge be<strong>in</strong>halten zudem<br />
e<strong>in</strong> Modul, das sich allgeme<strong>in</strong>er mit regenerativen Fragestellungen befasst<br />
(Tabelle 7.3).<br />
Tabelle 7.3: Regenerative Studiengänge – Häufigkeit <strong>der</strong> EE-Studienmodule<br />
(Quelle: IWR, 2012, Daten: IWR)<br />
Studienschwerpunkte 2012 1 Studienschwerpunkte 2011 1<br />
absolut Anteil [%] absolut Anteil [%]<br />
Solar 19 34,0 12 31,6<br />
W<strong>in</strong>d 10 17,9 9 23,7<br />
Bio 8 14,3 6 15,8<br />
Energieeffizienz 8 14,3 5 13,2<br />
Klima und Umwelt 7 12,5 6 15,8<br />
Geoenergie 5 9,0 4 10,5<br />
Speichertechnologien 5 9,0 4 10,5<br />
Brennstoffzelle 3 5,4 3 2,6<br />
Wasser 2 3,6 2 5,3<br />
Elektromobilität 2 3,6 2 2,6<br />
Sonstige 6 10,7 5 13,2<br />
Allgeme<strong>in</strong>es EE-Modul 40 71,4 20 52,6<br />
1 = Mehrfachnennungen möglich<br />
Die Hochschulen <strong>in</strong> NRW verzeichnen <strong>in</strong> den letzten Semestern überwiegend<br />
deutliche Zuwächse bei den Bewerberzahlen. Gründe dafür s<strong>in</strong>d unter an<strong>der</strong>em<br />
doppelte Abiturjahrgänge (Nie<strong>der</strong>sachsen, ab 2013 auch Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen)<br />
sowie wegfallende Studiengebühren <strong>in</strong> NRW. Dieser Trend zeigt sich auch bei<br />
den Studiengängen im Bereich erneuerbare Energien. Insbeson<strong>der</strong>e bei den<br />
neueren EE-Spezialstudiengängen, die erst <strong>in</strong> den letzten Jahren e<strong>in</strong>geführt wurden,<br />
steigen die Bewerberzahlen nach Hochschulangaben deutlich an. Bei den<br />
klassischen Studiengängen mit EE-Modulen, wie beispielsweise Masch<strong>in</strong>enbau<br />
o<strong>der</strong> Elektrotechnik, s<strong>in</strong>d die Bewerbungen 2012 zwar wie im Vorjahr relativ konstant,<br />
<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Studiengänge ist jedoch e<strong>in</strong>e deutliche Verschiebung zugunsten<br />
<strong>der</strong> regenerativen Schwerpunkte erkennbar.<br />
187
7.2 Betriebliche Aus- und Weiterbildung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen-<br />
und Systembau <strong>in</strong> NRW<br />
Neben <strong>der</strong> Hochschulausbildung bildet die betriebliche Aus- und Weiterbildung <strong>in</strong><br />
Industrie und Handwerk e<strong>in</strong>en weiteren wichtigen Pfad für die Ausbildung von<br />
Fachkräften mit regenerativem Know-how. Grundsätzlich kann bei <strong>der</strong> betrieblichen<br />
Bildung zwischen zwei Ausbildungswegen unterschieden werden:<br />
� Klassische Ausbildung mit Modul im Bereich regenerative Energien<br />
� Spezieller regenerativer Ausbildungsberuf<br />
Wie bei <strong>der</strong> Hochschulausbildung, so hat die Untersuchung betrieblicher Aus-<br />
und Weiterbildungsangebote gezeigt, dass Auszubildende i.d.R. zunächst e<strong>in</strong>e<br />
klassische Ausbildung absolvieren. Zu typischen Ausbildungsberufen auf dem<br />
EE-Sektor gehören Elektroniker, Anlagenmechaniker, Fertigungsmechaniker,<br />
Mechatroniker o<strong>der</strong> auch Fach<strong>in</strong>formatiker. Zum Teil s<strong>in</strong>d spezielle regenerative<br />
Module bereits Bestandteil dieser Ausbildungsberufe. Um sich auf den Bereich<br />
erneuerbare Energie zu spezialisieren, müssen Interessenten nach <strong>der</strong> Ausbildung<br />
ergänzend Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu EE-spezifischen Fragestellungen<br />
absolvieren.<br />
Regenerative Weiterbildungsangebote <strong>in</strong> NRW<br />
Auf NRW-Ebene wird von verschiedenen E<strong>in</strong>richtungen bei regenerativen Energiethemen<br />
e<strong>in</strong> umfangreiches Weiterbildungs-Portfolio angeboten. Für den vorliegenden<br />
Endbericht wurden die Sem<strong>in</strong>arangebote ausgewertet, die im Weiterbildungsportal<br />
<strong>der</strong> EnergieAgentur.NRW (http://www.wissensportal-energie.de)<br />
im Bereich regenerative Energien erfasst s<strong>in</strong>d. 9 Anbieter dieser Angebote s<strong>in</strong>d<br />
E<strong>in</strong>richtungen wie Volkshochschulen, Verbraucherzentralen, Handwerkskammern<br />
sowie Bildungszentren und Akademien des Baugewerbes, des Handwerks<br />
und des Ingenieurwesens.<br />
Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erhebung im Juli 2012 hat sich das <strong>in</strong> <strong>der</strong> Datenbank erfasste<br />
Angebot gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verän<strong>der</strong>t. Insgesamt werden<br />
71 Angebote ermittelt, die dem Themengebiet erneuerbare Energien zugeordnet<br />
werden können (Vorjahr 65 Angebote, + 9 Prozent).<br />
Hauptzielgruppe <strong>der</strong> Maßnahmen s<strong>in</strong>d Handwerker aus den Bereichen Baugewerbe,<br />
Elektro<strong>in</strong>stallation, SHK und Dachdecker. Insgesamt entfallen auf diese<br />
Gruppe über 60 Prozent <strong>der</strong> Angebote. Dienstleister wie z.B. Fachplaner, Energieberater,<br />
Energiemanager, Umweltbeauftrage o<strong>der</strong> Architekten bilden mit über<br />
40 Prozent e<strong>in</strong>en weiteren Zielgruppenschwerpunkt. Vergleichsweise ger<strong>in</strong>g ist<br />
dagegen <strong>der</strong> Anteil an Maßnahmen, die sich an Mitarbeiter aus dem <strong>in</strong>dustriellen<br />
Sektor (rd. 11 Prozent) richten (Tabelle 7.4).<br />
9 Dabei s<strong>in</strong>d die Übergänge zwischen Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien z.T. fließend. Die<br />
dargestelllten Ergebnisse zum Weiterbildungsangebot <strong>in</strong> NRW basieren auf <strong>der</strong> Analyse des Sem<strong>in</strong>arangebotes mit<br />
Schwerpunkten im Bereich erneuerbare Energien. Angebote aus Segmenten wie ökologischer / energieeffizienter Hausbau,<br />
Bauphysik o<strong>der</strong> energetische Sanierung, die den Bereich erneuerbare Energien laut Sem<strong>in</strong>arbeschreibung nur unspezifisch<br />
o<strong>der</strong> gar nicht behandeln, werden dagegen nicht bei <strong>der</strong> Auswertung berücksichtigt.<br />
188
Tabelle 7.4: Zielgruppen <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildungsangebote im Bereich erneuerbare<br />
Energien <strong>in</strong> NRW<br />
(Quelle: IWR, 2012, Datengrundlage: EnergieAgentur.NRW, eigene Berechnung)<br />
Zielgruppe Anteil [%] 1<br />
Handwerk 66,2<br />
Dienstleister 42,3<br />
Endverbraucher 15,5<br />
Industrie / Gewerbe 11,3<br />
1 = Mehrfachkategorisierung möglich<br />
Der <strong>in</strong>haltliche Schwerpunkt <strong>der</strong> angebotenen Maßnahmen liegt auf <strong>der</strong> Solarenergie.<br />
Aspekte aus dem Bereich Photovoltaik werden <strong>in</strong> etwa 51 Prozent <strong>der</strong><br />
Fälle abgedeckt, die Solarthermie kommt auf 44 Prozent. E<strong>in</strong>en weiteren<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildungsangebote bilden die Themenfel<strong>der</strong><br />
Erdwärme (Geothermie / Wärmepumpen, rd. 18 Prozent) und Bioenergie (rd. 13<br />
Prozent). Know-how aus den Bereichen W<strong>in</strong>denergie und Wasserkraft wird nur<br />
von e<strong>in</strong>em relativ ger<strong>in</strong>gen Anteil <strong>der</strong> Angebote behandelt, bei <strong>der</strong> W<strong>in</strong>denergie <strong>in</strong><br />
rd. 7 Prozent, bei <strong>der</strong> Wasserkraft <strong>in</strong> rd. 6 Prozent <strong>der</strong> Fälle.<br />
Vor Ort-Sem<strong>in</strong>are und Schulungen häufigste Weiterbildungsform<br />
H<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Veranstaltungsform <strong>der</strong> Weiterbildungsmaßnahmen ergeben sich<br />
im Vergleich zum Vorjahr nur ger<strong>in</strong>ge Verän<strong>der</strong>ungen. Mit über 50 Prozent bilden<br />
Vor-Ort Sem<strong>in</strong>are bzw. Schulungen den Schwerpunkt (Vorjahr 2011: rd. 47 Prozent).<br />
Auf Lehrgänge entfallen etwa 38 Prozent (Vorjahr 2011: 40,5 Prozent).<br />
Angebote von <strong>in</strong>ternetgestützten Onl<strong>in</strong>e-Sem<strong>in</strong>aren und Blended Learn<strong>in</strong>g Kursen<br />
(Komb<strong>in</strong>ation aus Vor-Ort-Schulungen und E-Learn<strong>in</strong>g) s<strong>in</strong>d mit 7 Prozent<br />
bzw. rd. 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig (Tabelle 7.5).<br />
Tabelle 7.5: Struktur <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildungsangebote im Bereich erneuerbare<br />
Energien <strong>in</strong> NRW<br />
(Quelle: IWR, 2012, Datengrundlage: EnergieAgentur.NRW, eigene Berechnung)<br />
Sem<strong>in</strong>arform Anteil 2012 [%] Anteil 2011 [%]<br />
Sem<strong>in</strong>ar / Schulung 53,6 46,8<br />
Lehrgang 38,0 40,5<br />
Onl<strong>in</strong>e-Sem<strong>in</strong>ar / Web Based Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g (WBT) 7,0 10,6<br />
Blended Learn<strong>in</strong>g (Präsenz + Onl<strong>in</strong>e-Sem<strong>in</strong>ar) 1,4 2,1<br />
Gesamt 100,0 100,0<br />
189
Zertifikate häufigste Nachweiskategorie für Maßnahmenteilnahme<br />
Ähnlich wie im Vorjahr bildet die Vergabe von Zertifikaten mit 30 Prozent die<br />
wichtigste Form zum Abschlussnachweis des Sem<strong>in</strong>arbesuchs. Zum Teil beschränkt<br />
sich <strong>der</strong> Teilnahmenachweis bei den Weiterbildungsangeboten aber<br />
auch auf e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong>e Teilnahmebesche<strong>in</strong>igung (rd. 20 Prozent) o<strong>der</strong> es wird ke<strong>in</strong>e<br />
Besche<strong>in</strong>igung ausgegeben (rd. 30 Prozent).<br />
190
8 Fazit und Ausblick<br />
Die Grundlage <strong>der</strong> Studie „<strong>Zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong>“ bildet<br />
<strong>der</strong> ganzheitliche 4-Sektoren-Systemansatz des IWR mit den vier strategischen<br />
Analysefel<strong>der</strong>n<br />
� Energie & Umwelt<br />
� Wirtschaft<br />
� Wissenschaft & Forschung sowie<br />
� Bildung.<br />
Auf dieser Basis ist es möglich, die vier o.g. strategisch bedeutsamen Teilbereiche<br />
<strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> auf Bundeslandebene systematisch zu<br />
analysieren. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können vor dem H<strong>in</strong>tergrund<br />
<strong>der</strong> Landesziele und <strong>der</strong> vom Bund beschlossenen Energiewende für e<strong>in</strong>e Weiterentwicklung<br />
von politischen Handlungsoptionen sowie <strong>der</strong> Formulierung spezifischer<br />
Zielsysteme herangezogen werden.<br />
Kernziel des vorliegenden Teil 1 <strong>der</strong> Studie ist e<strong>in</strong> Monitor<strong>in</strong>g <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong><br />
<strong>Energiewirtschaft</strong> sowie die Analyse und E<strong>in</strong>ordnung <strong>der</strong> statistischen Ergebnisse<br />
<strong>in</strong> Bezug auf die Entwicklungstrends am regenerativen Industrie- und Forschungsstandort<br />
NRW. Damit liegen wesentliche Voraussetzungen und Grundlagen<br />
vor, um gezielt Handlungsoptionen für die systematische Weiterentwicklung<br />
und Stärkung <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> NRW abzuleiten. Die möglichen<br />
Handlungsoptionen werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em separaten zweiten Teilbericht dargestellt.<br />
Die dar<strong>in</strong> aufgeführten Maßnahmen und <strong>der</strong> Fortschrittsstand basieren auf<br />
Optionen, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Studie „<strong>Zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong><br />
NRW 2010“ entwickelt und veröffentlicht wurden [3]. Aktuelle Trendentwicklungen<br />
werden dabei berücksichtigt. Derzeit erarbeitet die NRW-Landesregierung den<br />
NRW-Klimaschutzplan, <strong>der</strong> zahlreiche Maßnahmen im Bereich <strong>der</strong> erneuerbaren<br />
Energien enthält.<br />
Kern-Ergebnisse im Überblick<br />
1. Energie & Umwelt<br />
Beitrag regenerativer Energien zur CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung nimmt weiter zu<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die regenerative Stromerzeugung ist mit 23 Prozent im Jahr 2011<br />
gegenüber dem Vorjahr deutlich auf <strong>in</strong>sgesamt etwa 13 Mrd. kWh gestiegen<br />
(2010: rd. 10,5 Mrd. kWh). Die größten Anteile entfallen auf die Stromerzeugung<br />
aus Bioenergie (rd. 5,1 Mrd. kWh) und W<strong>in</strong>denergie (rd. 5,2 Mrd. kWh), die zusammen<br />
etwa 80 Prozent des EE-Stroms ausmachen. Im Jahresvergleich können<br />
vor allem die Stromerzeugung aus Photovoltaik (+ 82 Prozent), Biogas (+ 41<br />
Prozent) sowie aus W<strong>in</strong>denergie (+ 31 Prozent) zulegen. Während bei <strong>der</strong> PV-<br />
und Biogas-Nutzung <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Kapazitätseffekte für das Wachstum sorgen,<br />
geht <strong>der</strong> Zuwachs bei <strong>der</strong> W<strong>in</strong>dstromerzeugung auf e<strong>in</strong> vergleichsweise gutes<br />
W<strong>in</strong>djahr zurück.<br />
191
Bei zusätzlicher E<strong>in</strong>beziehung <strong>der</strong> Stromerzeugung aus Grubengas <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung<br />
von etwa 0,7 Mrd. kWh (2010: rd. 0,8 Mrd. kWh) erreicht die Stromerzeugung<br />
im Segment Klimaschutz 2011 rd. 13,6 Mrd. kWh (2010: rd. 11,3 Mrd.<br />
kWh). Im Vergleich NRW zum Bund ergibt sich bezogen auf die bundesweite EE-<br />
Stromerzeugung (2011: rd. 123 Mrd. kWh) e<strong>in</strong> NRW-Anteil von fast 11 Prozent.<br />
Bei <strong>der</strong> regenerativen Wärmeerzeugung wird <strong>in</strong> Anlehnung an die Bundesmethodik<br />
neben <strong>der</strong> Nutzwärmeerzeugung e<strong>in</strong>e Abschätzung des Endenergieanteils<br />
vorgenommen. Dadurch wird e<strong>in</strong> direkter Vergleich zwischen den NRW- und<br />
Bundeswerten möglich. Bei <strong>der</strong> genutzten regenerativen Wärme (ohne Grubengas)<br />
ist <strong>in</strong> NRW 2011 im Vergleich zu 2010 e<strong>in</strong> mo<strong>der</strong>ates Wachstum von etwa 6<br />
Prozent auf 11,1 kWh zu verzeichnen (2010: rd. 10,4 Mrd. kWh). Wichtigste regenerative<br />
Energiequelle ist die Bioenergie, auf die 2011 mit ca. 9,5 Mrd. kWh<br />
e<strong>in</strong> Anteil von etwa 86 Prozent entfällt (2010: rd. 8,6 Mrd. kWh). Unter E<strong>in</strong>beziehung<br />
<strong>der</strong> Wärme aus Grubengasanlagen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung von 0,1 Mrd.<br />
kWh (2010: rd. 0,1 Mrd. kWh) resultiert im Bereich Klimaschutz <strong>in</strong> NRW e<strong>in</strong>e<br />
Wärmemenge von etwa 11,2 Mrd. kWh (2010: rd. 10,5 Mrd. kWh). Bei e<strong>in</strong>er endenergetischen<br />
Betrachtungsweise erhöht sich die regenerative Wärmemenge<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorie <strong>der</strong> Bioenergie. In Summe werden für die Endenergie<br />
17,7 TWh regenerative Wärme ermittelt. Bezogen auf die Wärmebereitstellung<br />
aus Endenergie auf Bundesebene von 143,5 TWh entfällt damit 2011 bei<br />
<strong>der</strong> regenerativen Wärme e<strong>in</strong> Anteil von etwa 12 Prozent auf NRW.<br />
Auf dem biogenen Treibstoffsektor hat sich im Jahr 2011 <strong>der</strong> Rückgang <strong>der</strong> Produktion<br />
von Biotreibstoffen fortgesetzt. Mit 350.000 t wurden rd. 7 Prozent weniger<br />
Biodiesel produziert als 2010 (rd. 378.000 t). Die Erzeugung von Bioethanol<br />
<strong>in</strong> NRW (Absolutierung) wurde aus wirtschaftlichen Überlegungen e<strong>in</strong>gestellt.<br />
Erneuerbare Energien (<strong>in</strong>kl. Grubengas) tragen <strong>in</strong> NRW 2011 <strong>in</strong>sgesamt zu e<strong>in</strong>er<br />
CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung von fast 18 Mio. t bei (2010: rd. 14,6 Mio. t). Gegenüber dem<br />
Vorjahr 2010 ist <strong>der</strong> Klimaschutzeffekt damit <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e aufgrund <strong>der</strong> im Jahresvergleich<br />
höheren EE-Stromproduktion um etwa 21 Prozent gestiegen.<br />
Energiewende – Netzausbau und Speicher <strong>in</strong> NRW am Anfang<br />
Die Umsetzung <strong>der</strong> nach <strong>der</strong> Atomkatastrophe von Fukushima von <strong>der</strong> Bundesregierung<br />
beschlossenen Energiewende hat sich zu e<strong>in</strong>em energiepolitischen<br />
Zentralthema entwickelt, das für kontroverse Diskussionen sorgt. Kritisiert werden<br />
vor allem e<strong>in</strong> hoher Netzausbaubedarf und die damit verbundenen Kosten<br />
sowie steigende Strompreise <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>es wachsenden Stromanteils aus erneuerbaren<br />
Energien. In <strong>der</strong> differenzierten Betrachtung zeigt sich beim Thema<br />
Netzausbau, dass es sich bei e<strong>in</strong>em Großteil <strong>der</strong> nach dem Energieleitungsausbaugesetz<br />
(EnLAG) geplanten Stromtrassen nicht um e<strong>in</strong>en Neubauvorhaben mit<br />
neuer Trassenführung, son<strong>der</strong>n um Netzerweiterungen <strong>in</strong> bestehenden Trassen<br />
handelt. Auch im H<strong>in</strong>blick auf die zu erwartenden Netzausbaukosten ist nach den<br />
vorliegenden Informationen davon auszugehen, dass die von den Übertragungsnetzbetreibern<br />
(ÜNB) bislang veröffentlichten Zahlen auch Kostenpositionen enthalten,<br />
die ohneh<strong>in</strong> im Rahmen des normalen Netzbetriebs anfallen würden.<br />
Für Unmut sorgt aktuell die Entwicklung <strong>der</strong> im Rahmen des Erneuerbare-<br />
Energien-Gesetzes (EEG) von den nicht privilegierten Letztverbrauchern über<br />
den Strompreis zu entrichtende EEG-Umlage. Hier kommt es nach den jetzt von<br />
den ÜNB vorgelegten Prognosedaten aufgrund <strong>der</strong> B<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> Umlage an ver-<br />
192
schiedene E<strong>in</strong>flussparameter 2013 zu e<strong>in</strong>em deutlichen Anstieg von 3,59 Cent<br />
pro kWh auf 5,277 Cent pro kWh.<br />
In Deutschland und Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bef<strong>in</strong>det sich die Umsetzung <strong>der</strong> zentralen<br />
Energiewendepunkte noch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em frühen Stadium. Im H<strong>in</strong>blick auf den<br />
Netzausbau <strong>in</strong> NRW ist nach dem <strong>der</strong>zeitigen Stand davon auszugehen, dass<br />
von den <strong>in</strong>sgesamt 24 als prioritär e<strong>in</strong>gestuften EnLAG-Projekten mit e<strong>in</strong>er Trassenlänge<br />
von rd. 1.800 km <strong>in</strong>sgesamt 10 Vorhaben mit e<strong>in</strong>er Trassenlänge von<br />
rd. 430 km durch NRW verlaufen. Davon wurde bislang e<strong>in</strong> Vorhaben (8 km) realisiert.<br />
Der Großteil <strong>der</strong> Projekte bef<strong>in</strong>det sich noch im Planverfahren.<br />
Die Umsetzung <strong>der</strong> Energiewende erfor<strong>der</strong>t mit zunehmendem Ausbau <strong>der</strong> regenerativen<br />
Erzeugungskapazitäten mittelfristig auch den Ausbau von Speicherkapazitäten.<br />
Nach dem <strong>der</strong>zeitigen Entwicklungsstand kommen für die großtechnische<br />
Speicherung vor allem Pumpspeicherkraftwerke <strong>in</strong> Betracht. NRW verfügt<br />
über drei Pumpspeicherkraftwerke mit e<strong>in</strong>er Speicherkapazität von 300 MW.<br />
Derzeit werden zwei weitere Pumpspeicherkraftwerke mit e<strong>in</strong>er Gesamtleistung<br />
von etwa 1.000 MW geplant. Zusätzlich zu den Pumpspeicherkraftwerken mit e<strong>in</strong>er<br />
Gesamtleistung von dann knapp 1.350 MW will die Landesregierung die Entwicklung<br />
und Realisierung von sog. Unterflur-Pumpspeicherwerken (UPW) <strong>in</strong><br />
stillgelegten Bergwerken voranbr<strong>in</strong>gen. NRW verfügt hier als Bergbaustandort<br />
über entsprechende Potenziale. Derzeit werden das Potenzial (ca. 800 bis 1.000<br />
MW) und die technische Machbarkeit wissenschaftlich untersucht.<br />
2. Wirtschaft – Beschäftigung und Umsatz dank PV-Konjunktur weiter<br />
auf Expansionskurs - Rückgang <strong>in</strong> 2012 erwartet<br />
Die Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung im <strong>Regenerativen</strong> Anlagen- und<br />
Systembau war auch im Jahr 2011 trotz <strong>der</strong> <strong>in</strong> Teilbereichen angespannten <strong>Lage</strong><br />
noch positiv. Im Jahr 2011 hat die Beschäftigung bei den <strong>in</strong>sgesamt rd. 3.600<br />
NRW-Unternehmen des IWR-Unternehmenskatasters 2011 um rd. 7 Prozent auf<br />
etwa 28.200 Beschäftigte zugenommen (2010: rd. 26.500). Die Umsätze im <strong>Regenerativen</strong><br />
Anlagen- und Systembau <strong>in</strong> NRW s<strong>in</strong>d im Betrachtungszeitraum um<br />
knapp 5 Prozent auf rd. 8,7 Mrd. Euro (2010: 8,3 Mrd. Euro) gestiegen. Für 2012<br />
ist nach <strong>der</strong> aktuellen Indikatorenlage bei <strong>der</strong> Beschäftigung und den Umsätzen<br />
<strong>der</strong> NRW-Unternehmen allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong> deutlicher Rückgang zu erwarten.<br />
In den Beschäftigungszahlen s<strong>in</strong>d aus methodischen Gründen die Effekte im Bereich<br />
„Betrieb & Wartung“ sowie Bereitstellung von „Brenn- und Kraftstoffen“ nicht<br />
enthalten. Nach e<strong>in</strong>er neuen Modellrechnung des Bundesumweltm<strong>in</strong>isteriums<br />
ergibt sich für diese Bereiche e<strong>in</strong>e rechnerisch ermittelte Bruttobeschäftigung von<br />
rd. 11.000 bzw. 7.000 Beschäftigungsäquivalenten. Für den regenerativen Anlagen-<br />
und Systembau wurden <strong>in</strong> dem Modellansatz Arbeitsplatzäquivalente <strong>in</strong> Höhe<br />
von rd. 36.000 ermittelt. Diese Zahlen stellen die Obergrenze <strong>der</strong> NRW-<br />
Beschäftigung dar, während die per IWR-Umfrage erhobenen Daten als Untergrenze<br />
anzusehen s<strong>in</strong>d.<br />
193
3. Wissenschaft & Forschung – Energiewende kommt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Forschung<br />
an<br />
Im Jahr 2011 hat die Bedeutung regenerativer Forschungsaktivitäten <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
NRW-Forschungslandschaft weiter zugenommen. Mittlerweile umfasst das NRW-<br />
Forschungskataster 135 NRW-Forschungse<strong>in</strong>richtungen (2010: 125), von denen<br />
bekannt ist, dass Aktivitäten bei erneuerbaren Energien vorliegen. Der Großteil<br />
davon entfällt auf 120 Hochschule<strong>in</strong>richtungen (2010: 110 E<strong>in</strong>richtungen) an rd.<br />
25 Standorten. Des Weiteren f<strong>in</strong>det EE-Forschung <strong>in</strong> NRW an 15 außeruniversitären<br />
E<strong>in</strong>richtungen statt. Unter thematischen Gesichtspunkten zeigt sich, dass<br />
neben klassischen energieträgerspezifischen Fragestellungen im Zuge <strong>der</strong> Energiewende<br />
die Forschungsaktivitäten zur Speichertechnik sowie die bessere System<strong>in</strong>tegration<br />
erneuerbarer Energien an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen.<br />
Angesichts <strong>der</strong> nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Aktivitäten im Bereich <strong>der</strong> Bündelung<br />
und Optimierung von Forschungskapazitäten ist <strong>der</strong> systematische Ausbau<br />
<strong>der</strong> NRW-E<strong>in</strong>richtungen von großer Bedeutung zur Sicherung <strong>der</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />
im nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Vergleich.<br />
Diesbezüglich weist die Entwicklung <strong>der</strong> 11 bestehenden zentralen NRW-<br />
Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen im Bereich regenerative Energien im<br />
letzten Jahr <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>en positiven Verlauf und e<strong>in</strong>en Wachstumstrend auf.<br />
Etliche E<strong>in</strong>richtungen konnten ihren Personalbestand im EE-Bereich ausbauen.<br />
Zudem wurde an e<strong>in</strong>igen Instituten die technische Infrastruktur an Test- und Prüfe<strong>in</strong>richtungen<br />
erweitert. Ausgebaut wurden u.a. Motorenteststände und Strukturen<br />
zur Brennstoffanalytik. E<strong>in</strong>en hohen Stellenwert hat zudem die Erweiterung<br />
<strong>der</strong> Kapazitäten im Bereich <strong>der</strong> Batterieteststände. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> für<br />
die Energiewende wichtigen Fragestellungen Netzausbau und Netz<strong>in</strong>tegration<br />
sowie Elektromobilität wurde <strong>der</strong> Bestand an Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen<br />
um E<strong>in</strong>richtungen an <strong>der</strong> TU Dortmund und <strong>der</strong> RWTH Aachen erweitert.<br />
An <strong>der</strong> RWTH-Aachen wird <strong>der</strong>zeit des Weiteren e<strong>in</strong> neues W<strong>in</strong>denergie-<br />
Kompetenzzentrum mit e<strong>in</strong>em Schwerpunkt <strong>in</strong> <strong>der</strong> WEA-Antriebstechnik aufgebaut.<br />
4. Bildung – Klassische Studiengänge Schwerpunkte <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
akademischen Ausbildung<br />
Auf dem Gebiet <strong>der</strong> akademischen Ausbildung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> NRW 56 Studiengänge<br />
bekannt, <strong>in</strong> denen Inhalte zum Thema erneuerbare Energien vermittelt werden<br />
(2010: 38 Studiengänge). Dabei überwiegen mit etwa 95 Prozent klassische Studiengänge,<br />
bei denen EE-Inhalte <strong>in</strong> spezifischen Studienmodulen angeboten<br />
werden. Nur 5 Prozent <strong>der</strong> Studienangebote s<strong>in</strong>d speziell zum Thema erneuerbare<br />
Energien konzipiert. H<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> verschiedenen Fachbereiche besteht an<br />
den NRW-Hochschulen das größte Angebot mit EE-Inhalten bei Studiengängen<br />
aus den Bereichen Masch<strong>in</strong>enbau, Wirtschaftswissenschaften und Elektrotechnik.<br />
Bei den betrieblichen Ausbildungsberufen setzt sich <strong>der</strong> bisherige Entwicklungstrend<br />
fort, d.h. erneuerbare Energien werden <strong>in</strong> Industrie und Handwerk bislang<br />
nur ansatzweise thematisiert. E<strong>in</strong>e gezielte Wissensvermittlung bei EE-Themen<br />
erfolgt meistens erst über Weiterbildungsmaßnahmen. Mit rd. 70 Maßnahmen<br />
194
ewegt sich das Angebotsportfolio zur gezielten Vermittlung von EE-Know-how <strong>in</strong><br />
NRW <strong>der</strong>zeit etwas über dem Niveau des Vorjahres. Im Fokus <strong>der</strong> Angebote stehen<br />
Handwerker und Dienstleister wie Fachplaner, Energieberater o<strong>der</strong> Architekten.<br />
Aus thematischer Sicht liegt <strong>der</strong> Fokus auf den Bereichen Solarenergie sowie<br />
Erdwärme und Bioenergie.<br />
Gesamtfazit und Ausblick<br />
Die Nutzung erneuerbarer Energien wurde 2011 <strong>in</strong> NRW weiter ausgebaut. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
im Stromsektor ist e<strong>in</strong> deutliches Wachstum um über 20 Prozent zu<br />
verzeichnen. Hauptwachstumstreiber s<strong>in</strong>d die Stromerzeugung aus W<strong>in</strong>denergie,<br />
Photovoltaik und Biogas. Vor allem angesichts <strong>der</strong> positiven Entwicklung auf dem<br />
Stromsektor steigt auch <strong>der</strong> Beitrag erneuerbarer Energien zur CO2-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
deutlich um 21 Prozent an.<br />
Für die „grüne Industrie“ <strong>in</strong> NRW war das Jahr 2011 wirtschaftlich zwar noch positiv.<br />
Vorzieheffekte haben vor allem auf dem Solarenergie- und Biogassektor zu<br />
e<strong>in</strong>er Sicherung des Status quo bzw. zu e<strong>in</strong>em Ausbau bei <strong>der</strong> Beschäftigungsund<br />
Umsatzentwicklung beigetragen. Für 2012 zeichnet sich jedoch wegen <strong>der</strong><br />
unsicheren politischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen (EEG 2012) und <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en<br />
wirtschaftlichen Entwicklung e<strong>in</strong>e drastische konjunkturelle Abkühlung ab.<br />
Auf Seiten <strong>der</strong> Forschung s<strong>in</strong>d im Vergleich zum Vorjahr ke<strong>in</strong>e großen Verän<strong>der</strong>ungen<br />
erkennbar. Insgesamt wurden die Forschungsaktivitäten sowie die zentralen<br />
Forschungs- und Kompetenze<strong>in</strong>richtungen aber weiter ausgebaut. An den<br />
Hochschul<strong>in</strong>stituten setzt sich <strong>der</strong> Trend zur Drittmittelforschung fort. Vor diesem<br />
H<strong>in</strong>tergrund wächst die Bedeutung von Kooperationen zwischen Hochschul<strong>in</strong>stituten<br />
und <strong>der</strong> Industrie.<br />
Auf dem Bildungssektor ist im Bereich <strong>der</strong> akademischen Ausbildung im Vergleich<br />
zum Vorjahr bei <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Studiengänge mit regenerativen Themen e<strong>in</strong>e<br />
deutliche Steigerung zu verzeichnen. Bei <strong>der</strong> betrieblichen EE-Ausbildung<br />
überwiegt weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e klassische Basisausbildung. Regenerative Fragestellungen<br />
werden <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie über Aus- und Weiterbildungsangebote vermittelt. Im<br />
Vergleich zum Vorjahr ist das Angebot an betrieblichen Aus- und Weiterbildungsangeboten<br />
<strong>in</strong> etwa konstant geblieben.<br />
Münster, im Oktober 2012<br />
Internationales Wirtschaftsforum<br />
Regenerative Energien (IWR)<br />
Soester Str. 13, D-48155 Münster<br />
Telefon: +49 251 / 23 946-0; Telefax: +49 251 / 23 946-10<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@iwr-<strong>in</strong>stitut.de<br />
Internet: http://www.iwr-<strong>in</strong>stitut.de/<br />
195
9 Marktbee<strong>in</strong>flussende Gesetze, Richtl<strong>in</strong>ien, Verordnungen<br />
und Programme <strong>in</strong> Deutschland und <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
EU<br />
9.1 Nationale Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
9.1.1 Gesetze<br />
Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien<br />
(Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 01.01.2009<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 17.08.2012<br />
� EEG regelt Abnahme und Vergütung von Regenerativstrom durch Netzbetreiber<br />
� Anteil erneuerbarer Energien an <strong>der</strong> gesamten Stromversorgung soll bis<br />
2020 m<strong>in</strong>d. 35 %, bis 2030 m<strong>in</strong>d. 50 %, bis 2040 m<strong>in</strong>d. 65 %, bis 2050 m<strong>in</strong>d.<br />
80 % betragen<br />
� Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> PV-Vergütungssätze durch das Gesetz zur Än<strong>der</strong>ung des<br />
Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie vom 17.08.2012<br />
Gesetz für die Erhaltung, die Mo<strong>der</strong>nisierung und den Ausbau <strong>der</strong> Kraft-<br />
Wärme-Kopplung (KWK-Gesetz)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom und Wärme<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 01.04.2002<br />
� Letzte Neufassung (Novelle KWK-Gesetz): 01.01.2009<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 12.07.2012<br />
� Erhöhung <strong>der</strong> Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
Deutschland auf 25 % bis 2020<br />
� verpflichtet Stromnetzbetreiber zu Netz-Anschluss von KWK-Anlagen und<br />
Vergütung des erzeugten Stromes<br />
196
Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung – (<strong>Energiewirtschaft</strong>sgesetz<br />
- EnWG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom und Wärme<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 29.04.1998<br />
� Inkrafttreten <strong>der</strong> letzten Neufassung: 01.04.2012<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ungen: 16.01.2012<br />
� möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und<br />
umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>heit mit<br />
Elektrizität und Gas<br />
� Regulierung <strong>der</strong> Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze für e<strong>in</strong>en wirksamen<br />
und unverfälschten Wettbewerb<br />
� Offenlegung des Strommixes<br />
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Wärme<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 01.01.2009<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 22.12.2011<br />
� Schonung fossiler Ressourcen, Unabhängigkeit von Energieimporten, nachhaltige<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Energieversorgung, Weiterentwicklung <strong>der</strong> Technologien<br />
zur Erzeugung von Wärme und Kälte aus Erneuerbaren Energien<br />
� Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für<br />
Wärme und Kälte bis 2020 auf 14 %<br />
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 26.08.2009<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 07.03.2011 (§5)<br />
� Planungs- und Genehmigungsverfahren für 24 vordr<strong>in</strong>gliche Leitungsbauvorhaben<br />
im Höchstspannungs-Übertragungsnetz (380 kV) werden beschleunigt<br />
� im Rahmen von vier Pilotprojekten Tests <strong>der</strong> Erdverkabelung von 380kV-<br />
Leitungen. Auf 110kV-Ebene werden Erdkabel nach Wirtschaftlichkeitskriterien<br />
gestattet<br />
� Ferner werden Regelungen zur Verstärkung und Optimierung bestehen<strong>der</strong><br />
Leitungen sowie zum E<strong>in</strong>satz neuer Technologien wie <strong>der</strong> Hochspannungs-<br />
Gleichstromübertragung (HGU) im Netz getroffen<br />
197
Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus <strong>der</strong> Höchstspannungsnetze<br />
(EGEnLAG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 26.08.2009<br />
� Straffung <strong>der</strong> Planungs- und Genehmigungsverfahren: Bedarfsplan für vordr<strong>in</strong>gliche<br />
Leitungsbauvorhaben<br />
� Verkürzung des Rechtswegs auf e<strong>in</strong>e Instanz bei Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts<br />
� E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Planfeststellungsverfahrens für Leitungen zur Netzanb<strong>in</strong>dung<br />
von Offshore-W<strong>in</strong>dkraftanlagen<br />
Erstes Gesetz zur Än<strong>der</strong>ung schifffahrtsrechtlicher Vorschriften (1.<br />
SchifffRÄndG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom<br />
� W<strong>in</strong>d<br />
� Inkrafttreten: 30.07.2011<br />
� Vere<strong>in</strong>fachung und Beschleunigung <strong>der</strong> Genehmigungsverfahren für W<strong>in</strong>dkraftanlagen<br />
und stromführende Kabel<br />
Gesetz über Energiedienstleistungen und an<strong>der</strong>e Energieeffizienzmaßnahmen<br />
(EDL-G)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom, Wärme<br />
� Spartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 12.11.2010<br />
� Vorgaben <strong>der</strong> EU-Energiedienstleistungs-Richtl<strong>in</strong>ie (EDL-Richtl<strong>in</strong>ie) aus dem<br />
Jahr 2006 wird für Akteure auf dem deutschen Energiedienstleistungsmarkt<br />
verb<strong>in</strong>dlich<br />
� Energieversorger müssen Endkunden über Energiedienstleistungen, Energieaudits,<br />
-beratungen o<strong>der</strong> -effizienzmaßnahmen <strong>in</strong>formieren<br />
� Öffentliche Institutionen werden verpflichtet, e<strong>in</strong>e Vorbildfunktion bei <strong>der</strong><br />
Verbesserung <strong>der</strong> Energieeffizienz e<strong>in</strong>zunehmen und entsprechende Projekte<br />
umzusetzen<br />
198
Gesetz zur Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Biokraftstoffen (BioKraftFÄndG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Treibstoffe<br />
� Biomasse<br />
� Inkrafttreten: 21.07.2009<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 18.08.2009<br />
� bislang geltende Biokraftstoffquoten werden rückwirkend zum 01.01.2009<br />
von 6,25 auf 5,25 kal. % gesenkt und von 2010 bis 2014 bei e<strong>in</strong>em M<strong>in</strong>destanteil<br />
von 6,25 % e<strong>in</strong>gefroren<br />
� ab 2015 werden die festgelegten kalorischen M<strong>in</strong>destanteile durch e<strong>in</strong>e<br />
Klimaschutzquote ersetzt. Demnach soll die Reduzierung <strong>der</strong> Treibhausgasemissionen<br />
durch Biokraftstoffe 3 % ab 2015, 4,5 % ab 2017 und 7 % ab<br />
2020 betragen<br />
Gesetz zur Demonstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung,<br />
zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid<br />
(KSpGEG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom und Wärme<br />
� Fossile Energieträger<br />
� Inkrafttreten: 24.08.2012<br />
� Vorantreiben von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur<br />
dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid <strong>in</strong> tiefen geologischen Geste<strong>in</strong>sschichten<br />
(dient Umsetzung <strong>der</strong> Richtl<strong>in</strong>ie 2009/31/EG)<br />
� Regelung <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen an die Erkundung und Speicherung, die Haftung<br />
des Betreibers, den Schutz von Betroffenen und die langfristige Nachsorge<br />
bei CCS-Projekten<br />
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Wärme und Treibstoffe<br />
� Biomasse<br />
� Inkrafttreten: 22.03.1974<br />
� Inkrafttreten <strong>der</strong> letzten Neufassung: 26.09.2002<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 27.06.2012<br />
� dient Schutz und Vorbeugung vor schädlichen Umwelte<strong>in</strong>wirkungen (Luftverschmutzung,<br />
Lärm, Erschütterungen etc.) gegenüber dem Menschen und<br />
se<strong>in</strong>er Umwelt<br />
� BImSchG enthält Vorschriften zur Genehmigung und zum Betrieb von Anlagen<br />
� es gibt 39 Verordnungen (BImSchV), <strong>in</strong> denen BImSchG-Regelungen für<br />
e<strong>in</strong>zelne Bereiche konkretisiert werden, z.T. Relevanz <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit Errichtung<br />
und Betrieb von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien (z.B.<br />
1. BImSchV, 4. BImSchV, 30. BImSchV o<strong>der</strong> 36. BImSchV)<br />
199
Energiesteuergesetz (EnergieStG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Treibstoffe<br />
� Biomasse<br />
Stromsteuergesetz (StromStG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Inkrafttreten: 01.08.2006<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 01.03.2011<br />
� Besteuerung fossiler und nachwachsen<strong>der</strong> Energiestoffe<br />
� EnergieStG hat M<strong>in</strong>eralölsteuergesetz abgelöst; <strong>der</strong> Gesetzgeber hat damit<br />
u.a. auch die Europäische Energiesteuerrichtl<strong>in</strong>ie vom 27.10.2003 <strong>in</strong> deutsches<br />
Recht umgesetzt<br />
� die Befreiung biogener Treibstoffe wie Biodiesel und Bioethanol von M<strong>in</strong>eralölsteuer<br />
endete mit dem Inkrafttreten des EnergieStG<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 01.04.1999 (im Rahmen des Gesetzes zum E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die<br />
ökologische Steuerreform e<strong>in</strong>geführt)<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 01.03.2011 ( §9)<br />
� ursprüngliche Zielsetzung: Senkung des Energieverbrauchs durch Verteuerung<br />
von Energie und Erhöhung <strong>der</strong> Nachfrage nach stromsparenden Produkten/Produktionsverfahren<br />
� u.a. regenerativ erzeugter Strom ist stromsteuerbefreit, wenn er aus e<strong>in</strong>em<br />
nur mit Regenerativstrom gespeisten Netz entnommen wird<br />
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz - EnVKG<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 17.05.2012<br />
� Energieeffizienz erhöhen<br />
� farbige Effizienzskala für weitere energieverbrauchsrelevante Produkte<br />
200
Biokraftstoffquotengesetz (BioKraftQuG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Treibstoffe<br />
� Biomasse<br />
� Inkrafttreten: 01.01.2007<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 16.07.2007<br />
� verpflichtet M<strong>in</strong>eralölwirtschaft zu Beimischungsquoten<br />
� Än<strong>der</strong>ung 2009 durch Gesetz zur Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Biokraftstoffen:<br />
Beimischung 2009 bei 5,25 %, 2010-2014: konstant bei 6,25 %<br />
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Emissionshandel<br />
� Inkrafttreten: 15.07.2004<br />
� TEHG-Novelle 2011: 28.07.2011<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 22.12.2011<br />
� Ziel: Aufbau e<strong>in</strong>es harmonisierten Systems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten<br />
(setzt die Regelungen <strong>der</strong> EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
2003/87/EG <strong>in</strong> deutsches Recht um)<br />
� Regelt u.a. die Zuteilung von Emissionsrechten für die 3. Periode des europäischen<br />
Emissionshandels (2013-2020) <strong>in</strong> Deutschland<br />
� Ab 2013 weicht die kostenlose Zuteilung <strong>der</strong> Zertifikate sukzessive <strong>der</strong> Versteigerung<br />
zu Marktpreisen<br />
Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan für Treibhausgas-<br />
Emissionsberechtigungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zuteilungsperiode 2008 bis 2012<br />
(Zuteilungsgesetz 2012 – ZuG 2012)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Emissionshandel<br />
� Inkrafttreten: 11.08.2007<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 28.07.2011(§ 2, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11, § 15, § 16, §<br />
17, § 18, § 19, § 20, § 22, § 23, Anhang 1, Anhang 2, Anhang 4)<br />
� zuteilungsfähige Menge an Emissionsberechtigungen wird def<strong>in</strong>iert<br />
� Festlegung von Regeln und Mengen <strong>der</strong> Zuteilung sowie nationaler Emissionsziele<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Sektoren (Industrie, <strong>Energiewirtschaft</strong>, Verkehr etc.) für<br />
zweite Handelsperiode<br />
201
Gesetzentwurf zur För<strong>der</strong>ung des Klimaschutzes <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Landesgesetz<br />
� Strom, Wärme, Treibstoffe<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Entwurf vom 26.06.2012<br />
� Reduktion <strong>der</strong> Treibhausgasemissionen <strong>in</strong> NRW bis 2020 um m<strong>in</strong>. 25 %, bis<br />
2050 um m<strong>in</strong>. 80 % im Vergleich zu 1990<br />
� Ressourcenschutz, Ressourcen- und Energieeffizienz, Energiee<strong>in</strong>sparung,<br />
Ausbau Erneuerbarer Energien<br />
Gesetzentwurf e<strong>in</strong>es Dritten Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher<br />
Vorschriften<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesgesetz<br />
� Strom<br />
� W<strong>in</strong>d<br />
� Gesetzentwurf vom 29.08.2012<br />
� Klärung <strong>der</strong> Offshore-Haftungsfrage<br />
� ÜBN sollen jährlich e<strong>in</strong>en Offshore-Netzentwicklungsplan vorstellen, <strong>der</strong><br />
anschließend von <strong>der</strong> Bundesnetzagentur geprüft wird<br />
� ÜBN erhalten Entschädigung bei fehlendem Netzanschluss<br />
202
9.1.2 Verordnungen<br />
Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse<br />
(BiomasseV)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesverordnung<br />
� Strom<br />
� Biomasse<br />
� Inkrafttreten: 28.06.2001<br />
� Inkrafttreten <strong>der</strong> letzten Neufassung: 01.01.2012<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 24.02.2012<br />
� regelt vor dem H<strong>in</strong>tergrund des EEG die Kategorisierung von Biomasse-<br />
Brennstoffen und die Verfahren, die zur Stromerzeugung aus Biomasse e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden können<br />
� Def<strong>in</strong>ition von Umweltanfor<strong>der</strong>ungen für biogene Stromerzeugung<br />
Verordnung Systemdienstleistungen durch W<strong>in</strong>denergieanlagen (SDL-<br />
W<strong>in</strong>dV)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesverordnung<br />
� Strom<br />
� W<strong>in</strong>d<br />
� Inkrafttreten: 11.07.2009<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 28.07.2011<br />
� Festlegung <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen, die an W<strong>in</strong>denergieanlagen gestellt werden,<br />
um e<strong>in</strong>e EEG-Vergütung zu erhalten.<br />
� Erhöhung von Sicherheit und Stabilität <strong>der</strong> Stromnetze und Vorantreiben <strong>der</strong><br />
technischen Entwicklung, um so die Weichen für den weiteren Ausbau <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>denergie zu stellen<br />
� Bonus für Anlagen, die vor dem 01.01.2009 <strong>in</strong> Betrieb genommen wurden,<br />
wenn sie u. a. bestimmte Anfor<strong>der</strong>ungen an die Spannungshaltung im Netzfehlerfall<br />
am Netzverknüpfungspunkt erfüllen, für Betreiber von W<strong>in</strong>denergieanlagen,<br />
die nach dem 01.04. 2011 <strong>in</strong> Betrieb gehen gelten weitergehende<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten EEG- Ausgleichsmechanismus<br />
(AusglMechV)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesverordnung<br />
� Strom<br />
� Übergreifend<br />
� Inkrafttreten: 01.01.2010<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 17.08.2012<br />
� ÜBN dürfen EEG-Strom nur am vortägigen o<strong>der</strong> untertägigen Spotmarkt<br />
e<strong>in</strong>er Strombörse vermarkten<br />
� Die Differenz zwischen dem Verkaufserlös und den an die Anlagenbetreibenden<br />
zuzahlenden Vergütungen kann von den ÜBN als EEG-Umlage an<br />
die Stromvertriebsunternehmen weitergegeben werden<br />
203
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesverordnung<br />
� Strom<br />
� Biomasse<br />
� Inkrafttreten: 24.08.2009<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung : 22.12.2011<br />
� Regelung <strong>der</strong> Nachhaltigkeitsanfor<strong>der</strong>ungen für flüssige Biomasse (z.B.<br />
Rapsöl, Palmöl, Sojaöl), die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)<br />
vergütet wird<br />
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesverordnung<br />
� Treibstoffe<br />
� Biomasse<br />
� Inkrafttreten: 30.09.2009<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 22.12.2011<br />
Energiee<strong>in</strong>sparverordnung (EnEV)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� M<strong>in</strong>destanteil an Biokraftstoffen<br />
� nachhaltige Herstellung von Biokraftstoffen<br />
� Biokraftstoffe müssen e<strong>in</strong> Treibhausgas-M<strong>in</strong><strong>der</strong>ungspotenzial von m<strong>in</strong>. 35 %<br />
aufweisen, bis 2017 m<strong>in</strong> 50 %, bis 2018 m<strong>in</strong> 60 %<br />
� Bundesverordnung<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 01.10.2007<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 29.04.2009<br />
� EnEV-Ziel: Reduzierung des Primärenergiebedarfs von Gebäuden<br />
� EnEV beschränkt sich nicht auf Dämmwirkung <strong>der</strong> Gebäudehülle, zusätzlich<br />
werden Heizungs-, Belüftungs- und Warmwasserbereitungsanlagen berücksichtigt<br />
� Novelle 2009: Erhöhung <strong>der</strong> energetischen Anfor<strong>der</strong>ungen an Dämmung<br />
und Jahresprimärenergiebedarf um 30 %; Erweiterung e<strong>in</strong>zelner Nachrüstpflichten<br />
und Nachtrag Bestimmungen für die Nachrüstung von Altheizungssystemen<br />
204
Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-<br />
Emissionsberechtigungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zuteilungsperiode 2008 bis 2012<br />
(Zuteilungsverordnung 2012 – ZuV 2012)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesverordnung<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Emissionshandel<br />
� Inkrafttreten: 18.08.2007<br />
� konkretisiert das ZuG 2012<br />
� letzte Än<strong>der</strong>ung: 28.07.2011 (§ 1, § 3, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 14, § 15, §<br />
17, § 19, § 20, § 21, Anhang 4)<br />
� für Handelsperiode 2008 – 2012 wurde am 28.06.2006 die Datenerhebungsverordnung<br />
2012 – DEV 2012 beschlossen, um erfor<strong>der</strong>liche Zuteilungsmenge<br />
zu ermitteln<br />
� zusammen mit ZuG 2012 liegt Basis für Verteilung von Emissionsberechtigungen<br />
<strong>in</strong> zweiter Handelsperiode 2008 – 2012 vor<br />
Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-<br />
Emissionsberechtigungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Handelsperiode 2013 bis 2020<br />
(Zuteilungsverordnung 2020 – ZuV 2020)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Bundesverordnung<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Emissionshandel<br />
� Inkrafttreten: 30.09.2012<br />
� Rechtsgrundlagen für die Zuteilung von kostenlosen Emissionszertifikaten<br />
für Anlagenbetreiber<br />
Verordnung über Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren Energien<br />
(Herkunftsnachweisverordnung HkNV)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
Bundesgesetz<br />
Strom<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 9.12.2011<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 17.08.2012<br />
� E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Herkunftsnachweisregisters<br />
� Transparenz über Energiemix des Energieversorgers<br />
205
Verordnung zum Schutz von Übertragungsnetzen (ÜNetzSchV)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
Bundesgesetz<br />
Strom<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 11.01.2012<br />
� Umsetzung <strong>der</strong> Europäischen Richtl<strong>in</strong>ie über die Ermittlung und Ausweisung<br />
europäischer kritischer Infrastrukturen und die Bewertung <strong>der</strong> Notwendigkeit,<br />
ihren Schutz zu verbessern<br />
Verordnung über Anlagen seewärts <strong>der</strong> Begrenzung des deutschen Küstenmeeres<br />
(Seeanlagenverordnung - SeeAnlV)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
Bundesgesetz<br />
Strom<br />
� W<strong>in</strong>d<br />
� Inkrafttreten: 01.02.1997<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 15.01.2012<br />
� Erleichterung <strong>der</strong> Errichtung und des Betriebs von Offshore-Anlagen<br />
206
9.1.3 Programme<br />
Marktanreizprogramm des Bundes zur „För<strong>der</strong>ung von Maßnahmen zur<br />
Nutzung erneuerbarer Energien“ (MAP)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� För<strong>der</strong>programm des Bundes /<br />
� Wärme<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� 01.09.1999<br />
� letzte Richtl<strong>in</strong>ienanpassung: 15.03.2011<br />
� zentrales Ziel <strong>der</strong> aktuellen Richtl<strong>in</strong>ie ist <strong>der</strong> Ausbau regenerativer Energien<br />
im Wärmemarkt<br />
� Die För<strong>der</strong>ung erfolgt durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle<br />
(BAFA).<br />
� Am 15. März 2011 s<strong>in</strong>d neue För<strong>der</strong>richtl<strong>in</strong>ien mit Konditionsverbesserungen<br />
für das Marktanreizprogramm <strong>in</strong> Kraft getreten (z.B. für Solarkollektoren zur<br />
komb<strong>in</strong>ierten Warmwasserbereitung und Raumheizung von 90 auf 120 Euro/m²),<br />
jedoch gelten die verbesserten Konditionen bis Jahresende<br />
„progres.nrw“ – "Rationelle Energieverwendung, Regenerative Energien<br />
und Energiesparen"<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� För<strong>der</strong>programm des Landes NRW<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 20.02.2007<br />
� Nachfolger des REN-För<strong>der</strong>programms<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung 14.11.2008<br />
� Beschleunigung von breiter Markte<strong>in</strong>führung regenerativer und rationeller<br />
Energietechniken, um Beitrag zum Klimaschutz zu leisten: geför<strong>der</strong>t werden<br />
Maßnahmen wie z.B. thermische Solaranlagen, Biomasse-, Biogas- und<br />
Rapsölanlagen, Wasserkraftanlagen etc.<br />
KlimaschutzStartProgramm des Landes NRW<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� För<strong>der</strong>programm des Landes NRW<br />
� Strom, Wärme und Treib-<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� am 01.10.2011 vom Landeskab<strong>in</strong>ett beschlossen<br />
� För<strong>der</strong>gel<strong>der</strong> für energetische Gebäudesanierung und das Impuls-Programm<br />
„Kraft-Wärme-Kopplung“<br />
� Stromspar<strong>in</strong>itiative für e<strong>in</strong>kommensschwache Haushalte<br />
� Selbstverpflichtungen <strong>der</strong> Landesregierung und Kommunen<br />
207
Nationaler Allokationsplan 2008 - 2012 (NAP II)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Allokationsplan des Bundes<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Emissionshandel<br />
� am 28.06.2006 vom Bundeskab<strong>in</strong>ett beschlossen<br />
� am 30.06.2006 an die EU-Kommission zur Notifizierung übermittelt<br />
� sieht Reduzierung <strong>in</strong>dustrieller Emissionen von 1,25 % und seitens <strong>der</strong><br />
Energieerzeuger von 15 % vor; beteiligte Unternehmen müssen von 2008 –<br />
2012 <strong>in</strong>sgesamt 15 Mio. t CO2 jährlich e<strong>in</strong>sparen<br />
� Ab 2013 gibt es statt nationaler Allokationspläne e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Obergrenze,<br />
die für alle EU-Staaten gleich ist: 1.970 Mio. Tonnen CO2 (soll jährlich<br />
um 1,74 % s<strong>in</strong>ken); Obergrenze 2020: 1.720 Mio. Tonnen CO2; Ab 2013<br />
müssen sich 95 Prozent <strong>der</strong> Unternehmen <strong>der</strong> europäischen Industrie (Ausstoß<br />
> 10.000 Tonnen CO2/Jahr) am Emissionshandel beteiligen<br />
208
9.2 Europäische Union<br />
9.2.1 Richtl<strong>in</strong>ien<br />
EU-Richtl<strong>in</strong>ie zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Nutzung von Energie aus erneuerbaren<br />
Quellen und zur Än<strong>der</strong>ung und anschließenden Aufhebung <strong>der</strong> Richtl<strong>in</strong>ien<br />
2001/77/EG und 2003/30/EG (RL 2009/28/EG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 23.04.2009<br />
� letzte Än<strong>der</strong>ung: 01.04.2010<br />
� Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien (Strom, Wärme, Treibstoffe)<br />
am Gesamtenergieverbrauch <strong>der</strong> EU bis 2020 auf 20 %<br />
� Richtl<strong>in</strong>ie enthält nationale Richtziele, Deutschland muss lt. Richtl<strong>in</strong>ie den<br />
Regenerativ-Anteil bis zum Jahr 2020 auf 18 % erhöhen<br />
EU-Richtl<strong>in</strong>ie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden<br />
(RL 2010/31/EU)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
� Strom und Wärme<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 08.07.2010<br />
� dient im S<strong>in</strong>ne des Umwelt- und Ressourcenschutzes <strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong><br />
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und stellt Anfor<strong>der</strong>ungen an Niedrigenergiestandards<br />
und Energieausweise<br />
� betrifft <strong>in</strong> Deutschland die EnEV (Umsetzung bis Anfang 2012)<br />
209
EU-Richtl<strong>in</strong>ie zum CO2-Zertifikatehandel (RL 2003/87/EG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Emissionshandel<br />
� Inkrafttreten: 26.10.2003<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 23.04.2009 (durch RL 2009/29/EG)<br />
� Aufbau e<strong>in</strong>es Systems für den Handel mit CO2-Zertifikaten, durch Richtl<strong>in</strong>ie<br />
wurde 2005 <strong>der</strong> Zertifikatehandel <strong>in</strong> den damals 15 EU-Mitgliedsstaaten verb<strong>in</strong>dlich<br />
e<strong>in</strong>geführt<br />
� Emissionshandel soll als flexibles Instrument zum Erreichen nationaler und<br />
<strong>in</strong>ternationaler CO2-Reduktionsziele beitragen, für 1. Handelsperiode<br />
(01/2005 bis 12/2007) müssen m<strong>in</strong>d. 95 % <strong>der</strong> Zertifikate, für die 2. Periode<br />
(01/2008 bis 12/2012) m<strong>in</strong>d. 90 % <strong>der</strong> Zertifikate kostenlos vergeben werden,<br />
nationale Zuteilungspläne s<strong>in</strong>d durch Kommission zu genehmigen<br />
� Luftverkehr wird <strong>in</strong> das System des Treibhausgas-Zertifikatehandels mit<br />
e<strong>in</strong>bezogen<br />
� Übergangsvorschriften bis 2020 (gem. Beschluss 2011/278/EU): 2013 80 %<br />
kostenlose Zertifikate, 2020 30 % kostenlose Zertifikate<br />
EU-Richtl<strong>in</strong>ie zur Restrukturierung <strong>der</strong> Vorschriften zur Besteuerung von<br />
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (RL 2003/96/EG)<br />
Typ<br />
� EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� Strom<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 31.10.2003<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung am 01.05.2004<br />
� E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>destbesteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem<br />
Strom<br />
� Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energien / KWK<br />
EU-Richtl<strong>in</strong>ie zur För<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>er am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-<br />
Wärme-Kopplung (RL 2004/8/EG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
� Strom und Wärme<br />
� KWK<br />
� Inkrafttreten: 21.02.2004<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung am 20.04.2009<br />
� Wird voraussichtlich Ende 2012 durch den Vorschlag für für e<strong>in</strong>e EU-<br />
Richtl<strong>in</strong>ie zur Energieeffizienz abgelöst (s.u.)<br />
� Ausbau <strong>der</strong> Kraft-Wärme-Kopplung<br />
� Rahmen zur För<strong>der</strong>ung und Entwicklung e<strong>in</strong>er effizienten, am Nutzwärmebedarf<br />
orientierten und auf Primärenergiee<strong>in</strong>sparung ausgerichteten Kraft-<br />
Wärme-Kopplung (Wärme und Strom) soll geschaffen werden<br />
210
EU-Richtl<strong>in</strong>ie über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen<br />
(RL 2006/32/EG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
� Strom, Wärme und Treibstoffe<br />
� Energieeffizienz<br />
� Inkrafttreten: 17.05.2006<br />
� Letzte Än<strong>der</strong>ung: 11.12.2008<br />
� wird voraussichtlich Ende 2012 durch den Vorschlag für für e<strong>in</strong>e EU-<br />
Richtl<strong>in</strong>ie zur Energieeffizienz abgelöst (s.u.)<br />
� Ziel: Senkung des Energieverbrauchs <strong>in</strong> EU <strong>in</strong> 9 Jahren um 9 %<br />
� Richtl<strong>in</strong>ie verpflichtet Mitgliedsstaaten, nationale Energieeffizienz-<br />
Aktionspläne (EEAP) zu erarbeiten, aus denen hervorgeht, wie Ziel <strong>der</strong> jährlichen<br />
Energieverbrauchs-Reduzierung erreicht werden kann<br />
Vorschlag für e<strong>in</strong>e EU-Richtl<strong>in</strong>ie zur Energieeffizienz und zur Aufhebung<br />
<strong>der</strong> Richtl<strong>in</strong>ie 2004/8/EG und 2006/32/EG<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
� Strom und Wärme<br />
� KWK, Energieeffizienz<br />
� Vorschlag vom 26.06.2012<br />
� Inkrafttreten voraussichtlich Ende 2012<br />
� Festlegung verb<strong>in</strong>dlicher Ziele zur Senkung des Energieverbrauchs bis 2020<br />
� E<strong>in</strong>führung von Energieeffizienzverpflichtungssystemen<br />
� Sanierung von jährlich 3 % <strong>der</strong> öffentlichen Gebäude <strong>der</strong> Zentralregierungen<br />
Richtl<strong>in</strong>ie über Industrieemissionen (<strong>in</strong>tegrierte Vermeidung und Verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Umweltverschmutzung) (RL 2010/75/EU)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
� Strom und Wärme<br />
� Bioenergie<br />
� Inkrafttreten: 06.01.2011<br />
� Zusammenfassung und Novellierung <strong>der</strong> bisher geltenden Richtl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong>tegrierte<br />
Vermeidung und Verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Umweltverschmutzung, Abfallverbrennungsrichtl<strong>in</strong>ie,<br />
Richtl<strong>in</strong>ie für Großfeuerungsanlagen, Lösemittelrichtl<strong>in</strong>ie<br />
und Titandioxidrichtl<strong>in</strong>ie<br />
� verb<strong>in</strong>dliche Vorgabe <strong>der</strong> Emissionswerte für <strong>in</strong>dustrielle Anlagen (u.a. Biomassekraftwerke)<br />
211
Richtl<strong>in</strong>ie über die geologische Speicherung von Kohlendioxid<br />
(2009/31/EG)<br />
Typ<br />
Geltungsbereich<br />
Energiesparte<br />
Inkrafttreten / letzte<br />
Aktualisierung<br />
Zielvorgabe / Inhalte<br />
� EU-Richtl<strong>in</strong>ie<br />
� Strom, Wärme, Treibstoffe<br />
� Energiespartenübergreifend<br />
� Inkrafttreten: 25.06.2009<br />
� Schafft e<strong>in</strong>en rechtlichen Rahmen für die umweltverträgliche geologische<br />
Speicherung von Kohlendioxid (CO2), um zur Bekämpfung des Klimawandels<br />
beizutragen<br />
212
10 Literaturverzeichnis<br />
[1] Landesregierung NRW (2012): Gesetz zur För<strong>der</strong>ung des Klimaschutzes <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen. Gesetzentwurf <strong>der</strong> Landesregierung vom 26.06.2012<br />
[2] NRWSPD, Bündnis 90 / Die Grünen (2012): Koalitionsvertrag 2012 - 2017:<br />
Verantwortung für e<strong>in</strong> starkes NRW - Mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> die Zukunft gestalten<br />
[3] Allnoch, N.; Bertram, F.; Kle<strong>in</strong>manns, B.; Landeck, Chr.; Pochert, O.; Schlusemann, R.<br />
(2011): <strong>Zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> <strong>Regenerativen</strong> <strong>Energiewirtschaft</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 2010.<br />
Studie im Auftrag des M<strong>in</strong>isteriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturund<br />
Verbraucherschutz (MKULNV)<br />
[4] Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) (2012): Berechnung<br />
CO2-Emissionen nach Län<strong>der</strong>n<br />
[5] Amprion GmbH (2012): mündliche Mitteilung Dr. Preuß vom 11. Juli 2012<br />
[6] Handelsblatt (2012): Pumpspeicher s<strong>in</strong>d richtig <strong>in</strong>teressant. Interview mit RAG-Chef<br />
Tönjes vom 29. Juni 2012. Abgerufen unter: www.handelsblatt.com am 16. Juli 2012<br />
[7] Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) mbH und Zentrum für<br />
Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) (2012):<br />
[8]<br />
Erneuerbar beschäftigt <strong>in</strong> den Bundeslän<strong>der</strong>n! Bericht zur daten- und modellgestützten<br />
Abschätzung <strong>der</strong> aktuellen Bruttobeschäftigung <strong>in</strong> den Bundeslän<strong>der</strong>n.<br />
British Petroleum (BP) (2012): Statistical Review of World Energy, June 2012,<br />
Abgerufen unter: www.bp.com/statisticalreview 24. Juli 2012<br />
[9] Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (2012): Weniger Öl: För<strong>der</strong>ung<br />
aus <strong>der</strong> Nordsee fällt 2011 auf tiefsten Stand seit 30 Jahren. Pressemitteilung<br />
vom 08. September 2012, Abgerufen unter: www.iwrpressedienst.de am 01.10.2012<br />
[10] Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (2012): Monatsreport Regenerative<br />
<strong>Energiewirtschaft</strong>, 10/2012, S. 4, ISSN 1867-3279<br />
[11] U.S. Energy Information Adm<strong>in</strong>istration (EIA) (2012): International Energy Statistics,<br />
Teilbereich Electricity, Abgerufen unter: www.eia.gov am 24. Juli 2012<br />
[12] 50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Tennet TSO GmbH, Transnet BW<br />
GmbH (2012): Entwurf des Netzentwicklungsplans 2012. Abgerufen unter:<br />
www.netzentwicklungsplan.de/content/netzentwicklungsplan-2012 am 20. Juli 2012<br />
[13] TenneT TSO GmbH (2012): Übertragungsnetzbetreiber legen ersten deutschen<br />
Netzentwicklungsplan für das kommende Jahrzehnt vor, Pressemitteilung vom 30. Mai<br />
2012<br />
[14] 50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Tennet TSO GmbH, Transnet BW<br />
GmbH (2012): Neue Netze für neue Energien. Der NEP 2012: Erläuterungen und<br />
Überblick <strong>der</strong> Ergebnisse. Infopaper. Abgerufen unter: www.netzentwicklungsplan.de<br />
am 16. Juli 2012<br />
[15] AGEE-Stat / BMU (2012): Zeitreihen zur Entwicklung <strong>der</strong> erneuerbaren Energien <strong>in</strong><br />
Deutschland. Excel-Tabellensammlung, Datenstand: Juli 2012, Abgerufen unter:<br />
www.erneuerbare-energien.de am 21. September 2012<br />
[16] Bundesverband <strong>der</strong> deutschen Bioethanolwirtschaft (2012): Super E10: Akzeptanz und<br />
Wahrnehmung – Umfrageergebnis 2012, Pressemitteilung vom 18. Juni 2012,<br />
Abgerufen unter: www.bdbe.de/presse/presse<strong>in</strong>formationen/?entry=295 am 20. Juli<br />
2012<br />
[17] Kasper, M. (2012): Potenzialanalyse W<strong>in</strong>denergie Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. Fachtagung<br />
Erneuerbare Energien <strong>in</strong> <strong>der</strong> Landschaft am 20. März 2012, Vortragsmanuskript<br />
Abgerufen unter: www.kortemeier-brokmann.de am 03. September 2012<br />
213
[18] Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (2012): Informationen zum<br />
Energieatlas NRW, Abgerufen unter: www.lanuv.nrw.de am 03. September 2012<br />
[19] Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (2012): Informationen zur<br />
W<strong>in</strong>dpotenzialstudie NRW, E-Mail-Mitteilung vom 24. September 2012<br />
[20] M<strong>in</strong>isterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz<br />
des Landes Nordrhe<strong>in</strong>, M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und<br />
Verkehr des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen und Staatskanzlei des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen (2011): Erlass für die Planung und Genehmigung von W<strong>in</strong>denergieanlagen<br />
und H<strong>in</strong>weise für die Zielsetzung und Anwendung vom 11. Juli 2011<br />
[21] M<strong>in</strong>isterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz<br />
des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (2012): M<strong>in</strong>ister Remmel: „Beschleunigte<br />
Energiewende – made <strong>in</strong> NRW“ - M<strong>in</strong>isterium veröffentlich Leitfaden zu „W<strong>in</strong>denergie<br />
im Wald“ – Analyse über Nutzung von Staatswald für W<strong>in</strong>denergie-Anlagen vorgestellt.<br />
Pressemitteilung vom 29. März 2012<br />
[22] M<strong>in</strong>isterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz<br />
des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (2012): Leitfaden Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für<br />
W<strong>in</strong>denergieanlagen auf Waldflächen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
[23] Dahlhoff, A. (2012): Biogas <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen – Auswertung <strong>der</strong> Biogasanlagen-<br />
Betreiberdatenbank <strong>der</strong> Landwirtschaftskammer NRW, Stand: 20.03.2012<br />
[24] AG Klimaschutz und Abfallwirtschaft <strong>der</strong> Verbände ITAD und VKS im VKW (2012):<br />
Statistik über die Stromerzeugung und Wärmeabgabe von Müllverbrennungsanlagen <strong>in</strong><br />
NRW im Jahr 2011, E-Mail Mitteilung vom 04. September 2012<br />
[25] AG Klimaschutz und Abfallwirtschaft <strong>der</strong> Verbände ITAD und VKS im VKW (2012):<br />
mdl. Mitteilung durch Herrn Tre<strong>der</strong> vom 11. September 2012<br />
[26] Landesbetrieb Information und Technik Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (IT.NRW) (2012):<br />
Kraftwerke <strong>der</strong> Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Stromerzeugungsanlagen im<br />
Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe – Anlagen mit e<strong>in</strong>er Brutto-Enpassleistung<br />
elektrisch, von 1 MW und mehr. Tabelle 4: Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung nach<br />
Energieträgern – Berichtsjahr: 2011<br />
[27] Landesbetrieb Information und Technik Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (IT.NRW) (2012):<br />
Erhebung über die Gew<strong>in</strong>nung, Verwendung und Abgabe von Klärgas, Berichtsjahr:<br />
2011, E-Mail-Mitteilung vom 03. September 2012<br />
[28] Landesbetrieb Information und Technik Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (IT.NRW) (2011):<br />
Erhebung über die Gew<strong>in</strong>nung, Verwendung und Abgabe von Klärgas, Berichtsjahr:<br />
2011, E-Mail-Mitteilung vom 26. Mai 2011<br />
[29] Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) (2010):<br />
Energiepotenziale <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Wasserwirtschaft – Schwerpunkt Abwasser.<br />
[30] Bundesnetzagentur (BNetzA) (2012): Anlagenbezogene Daten <strong>der</strong> EEG-<br />
Jahresabrechnung 2010. Auszug-BNetzA-Datenbank vom 18.01.2012<br />
[31] Rettenberger, G. (2010): E-Mail-Mitteilung durch Prof. Rettenberg, FH Trier vom 14.<br />
Februar 2010<br />
[32] Landesbetrieb Information und Technik Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (IT.NRW) (2012):<br />
Erhebung über die Strome<strong>in</strong>speisung bei Netzbetreibern. Tabelle 1.3:<br />
Strome<strong>in</strong>speisung aus erneuerbaren Energien <strong>in</strong>sgesamt. Berichtsjahr 2011<br />
[33] Deutsches BiomasseForschungsZentrum (DBFZ) (2012): Monitor<strong>in</strong>g zur Wirkung des<br />
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auf die Entwicklung <strong>der</strong> Stromerzeugung aus<br />
Biomasse. Endbericht zur EEG-Periode 2009 bis 2011, März 2012<br />
[34] An<strong>der</strong>er, P.; Dumont, U.; Kolf, R. (2007): Das Wasserkraftpotenzial <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen. In: Wasser und Abfall, H. 7 - 8, S. 16 - 20<br />
214
[35] Wagner, E.; R<strong>in</strong>delhardt, U. (2008): Stromgew<strong>in</strong>nung aus regenerativer Wasserkraft <strong>in</strong><br />
Deutschland – Potenzialanalyse. In: Elektrizitätswirtschaft, Jg. 107, Heft 1 -2, S. 78 –<br />
81<br />
[36] Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 8, Bergbau und Energie (2012): mdl. Mitteilung<br />
durch Herrn Weiss vom 26. September 2012<br />
[37] Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 8, Bergbau und Energie (2012): Statistische<br />
Daten zum Stand <strong>der</strong> Grubengasnutzung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen Ende 2011, E-Mail-<br />
Mitteilung vom 02. September 2012<br />
[38] Universität Hamburg, Zentrum Holzwirtschaft (2012): Energieholzverwendung <strong>in</strong><br />
privaten Haushalten 2010, Marktvolumen und verwendete Holzsortimente,<br />
Abschlussbericht, Mai 2012<br />
[39] Bundesverband Wärmepumpe (2011): BWP-Branchenstudie 2011 – Szenarien und<br />
politische Handlungsempfehlungen. Daten zum Wärmepumpenmarkt 2010 und<br />
Prognosen bis 2030<br />
[40] Geothermiezentrum Bochum (GZB) (2010): Analyse des deutschen<br />
Wärmepumpenmarktes. Bestandsaufnahme und Trends. Gutachten im Autrag des<br />
Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).<br />
[41] Bundesverband Wärmepumpe (2012): Branchenstatistik 2011: Wärmepumpen-Absatz<br />
steigt 2011 um 11,8 % gegenüber Vorjahr. Pressemitteilung vom 26. Januar 2012<br />
[42] Bundesverband Wärmepumpe (2011): Branchenstatistik 2010: Wärmepumpen-<br />
Abstazzahlen für 2010: Der Markt konsolidiert sich. Pressemitteilung vom 27. Januar<br />
2011<br />
[43] Landes<strong>in</strong>itiative Zukunftsenergien NRW (Hrsg.) (2003): Studie – Markt für<br />
Wärmepumpen <strong>in</strong> Deutschland und NRW – Strukturen und Entwicklungsmöglichkeiten.<br />
Untersuchung im Auftrag <strong>der</strong> Energieagentur NRW<br />
[44] Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. (2006): Immer mehr Deutsche heizen mit<br />
kostenloser Umweltwärme – Pressemitteilung.<br />
[45] Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) (2012): Umfrage: Je<strong>der</strong><br />
dritte Benz<strong>in</strong>-Autofahrer hat schon E10 getankt. IWR-News:<br />
http://www.iwr.de/news.php?id=21361 vom 18. Juni 2012<br />
[46] Nationale Plattform Elektromobilität (2012): Fortschrittsbericht <strong>der</strong> Nationalen Plattform<br />
Elektromobilität (3. Bericht)<br />
[47] Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) (2012): Webseite zum<br />
CERINA-Plan, http://www.cer<strong>in</strong>a.org<br />
[48] Major Economies Forum (2011): Infos zum MEF - Webseite des Major Economies<br />
Forum, http://www.majoreconomiesforum.org<br />
[49] Clean Energy M<strong>in</strong>isterial (2011): Infos zum CEM – Webseite des Clean Energy<br />
M<strong>in</strong>isterial, http://www.cleanenergym<strong>in</strong>isterial.org<br />
[50] Landesbetrieb Information und Technik Nordrhe<strong>in</strong> Westfalen (IT.NRW) (2011):<br />
Statistische Berichte – Energiebilanz und CO2-Bilanz <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 2009<br />
[51] Bundesnetzagentur (2012): Stand zum Netzausbau <strong>der</strong> Vorhaben gemäß<br />
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG). Abgerufen unter: www.netzausbau.de am 05.<br />
Oktober 2012<br />
[52] Niemann, A. (2012): Stand und Status quo <strong>der</strong> Untersuchung von Potenzialen für die<br />
Errichtung von Unterflur-Pumpspeicherwerken <strong>in</strong> NRW, Mdl. Mitteilung vom 05.<br />
Oktober 2012<br />
[53] IEA (2012): Policies and Measures Databases. Abgerufen am 08.10.2012<br />
http://www.iea.org/textbase/pm/?mode=re<br />
215
[54] Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) (2012): USA<br />
beschließen Antidump<strong>in</strong>gzölle auf ch<strong>in</strong>esische Solarprodukte von bis zu 250 Prozent,<br />
IWR-News: www.iwr.de/news.php?id=21184 vom 18. Mai 2012<br />
[55] Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) (2012): SolarWorld<br />
reicht Klage gegen ch<strong>in</strong>esische Konkurrenten <strong>in</strong> Brüssel e<strong>in</strong>, IWR-News:<br />
www.iwr.de/news.php?id=21648 vom 26. Juli 2012<br />
[56] Air Liquide Deutschland GmbH (2012): Air Liquide eröffnet erste öffentliche<br />
Wasserstofftankstelle für Pkw <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. Auftakt für weitere Infrastruktur-<br />
Aktivitäten <strong>der</strong> Clean Energy Partnership <strong>in</strong> NRW. Pressemitteilung vom 04.<br />
September 2012<br />
[57] Bernd Hirschl u.a. (2012): Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien <strong>in</strong><br />
zwei Modellkommunen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. Endbericht, Im Auftrag des Landes<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen vertreten durch das M<strong>in</strong>isterium für Klimaschutz, Umwelt,<br />
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Berl<strong>in</strong>.<br />
[58] 50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Tennet TSO GmbH, Transnet BW<br />
GmbH (2012): Prognose <strong>der</strong> EEG-Umlage 2013 nach AusglMechV - Prognosekonzept<br />
und Berechnung <strong>der</strong> ÜNB (Stand: 15. Oktober 2012). Abgerufen unter http://www.eegkwk.net<br />
am 15. Oktober 2012<br />
[59] BDEW Bundesverband <strong>der</strong> Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (2012): Erneuerbare<br />
Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken (2011) Anlagen, <strong>in</strong>stallierte Leistung,<br />
Stromerzeugung, EEG-Vergütungssummen, Markt<strong>in</strong>tegration <strong>der</strong> erneuerbaren<br />
Energien und regionale Verteilung <strong>der</strong> EEG-<strong>in</strong>duzierten Zahlungsströme (Stand: 23.<br />
Januar 2012). Abruf unter http://www.bdew.de am 08. Oktober 2012<br />
[60] Köpke, R. (2012): Ökostrom/Ökogas: E<strong>in</strong> Rekord unter den Erwartungen. In. Energie &<br />
Management, 15. Juli 2012, S. 9 – 11<br />
[61] Umweltbundesamt (2012): Informationen zum Herkunftsnachweisregister. Abgerufen<br />
unter http://www.umweltbundesamt.de vom 19. September 2012<br />
[62] Umweltbundesamt (2012): mdl. Mitteilung durch H. Marty vom 19. September 2012<br />
[63] Klaus Novy-Institut (2012): Genossenschaftliche Unterstützungsstrukturen für e<strong>in</strong>e<br />
sozialräumlich orientierte <strong>Energiewirtschaft</strong>. Machbarkeitsstudie. Untersuchung im<br />
Auftrag des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.<br />
[64] Europäische Kommission (2006): Richtl<strong>in</strong>ie 2006/32/EG des europäischen Parlaments<br />
und des Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und<br />
Energiedienstleistungen und zur Aufhebung <strong>der</strong> Richtl<strong>in</strong>ie 93/76/EWG des Rates<br />
[65] Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) (2012): EU:<br />
Energieeffizienz-Richtl<strong>in</strong>ie kommt, IWR-News: www.iwr.de/news.php?id=22178<br />
[66] Europäische Kommission (2012): Vorschlag des europäischen Parlaments und des<br />
Rates zur Energieeffizienz und zur Aufhebung <strong>der</strong> Richtl<strong>in</strong>ien 2004/8/EG und<br />
2006/32/EG EU-Richtl<strong>in</strong>ienentwurf 2012 vom 22. Juni 2012<br />
[67] EnergieAgentur.NRW (2012): För<strong>der</strong>programme <strong>der</strong> Energieversorgungsunternehmen<br />
<strong>in</strong> NRW im Jahr 2012. PDF-Datei, Datenstand Februar 2012<br />
[68] Internationales Geothermiezentrum (GZB) (2012): mdl. Mitteilung durch Herrn Born<br />
vom 04. Juli 2012<br />
216
11 Abkürzungsverzeichnis<br />
Verzeichnis <strong>der</strong> verwendeten Abkürzungen<br />
AGEE-Stat Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik<br />
B100 Biodiesel <strong>in</strong> Re<strong>in</strong>form (100 Prozent)<br />
BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle<br />
BDEW Bundesverband <strong>der</strong> Energie- und Wasserwirtschaft e. V.<br />
BDH Bundes<strong>in</strong>dustrieverbandes Deutschland Haus-, Energie- und<br />
Umwelttechnik<br />
BHKW Blockheizkraftwerk<br />
BMU Bundesm<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
BMWi Bundesm<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft und Technologie<br />
BNetzA Bundesnetzagentur<br />
BP British Petrol, M<strong>in</strong>eralölkonzern<br />
BSW Bundesverband Solarwirtschaft<br />
BWP Bundesverband Wärmepumpe e.V.<br />
CCS Carbon Capture and Storage<br />
CDM Clean Development Mechanism<br />
CEM Clean Energy M<strong>in</strong>isterial<br />
CeraStorE Competence Center for Ceramic Materials and Thermal Storage<br />
Technologies <strong>in</strong> Energy Research<br />
CERINA CO2 Emissions and Renewable Investment Action Plan<br />
CFCL Ceramic Fuel Cells Ltd.<br />
CO2<br />
Kohlendioxid<br />
CSP Concentrat<strong>in</strong>g Solar Power (solarthermische Kraftwerke)<br />
DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum<br />
DEA Danish Energy Agency<br />
DECC Department of Energy and Climate Change<br />
DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V.<br />
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.<br />
DMFC Direct Methanol Fuel Cell<br />
DWA Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall<br />
e.V.<br />
EBIT earn<strong>in</strong>gs before <strong>in</strong>terest and taxes<br />
EDL-G Gesetz über Energiedienstleistungen und an<strong>der</strong>er<br />
Energieeffizienzmaßnahmen<br />
EE erneuerbare Energien<br />
EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />
EEWärmeG Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz<br />
EEX European Energy Exchange<br />
EnLAG Energieleitungsausbaugesetz<br />
EPIA European Photovoltaic Industry Association<br />
217
Verzeichnis <strong>der</strong> verwendeten Abkürzungen<br />
EU Europäische Union<br />
EVU Energieversorgungsunternehmen<br />
FB Fachbereich<br />
FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.<br />
Fraunhofer ISE Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme<br />
FuE Forschung und Entwicklung<br />
GB Great Brita<strong>in</strong><br />
GFKF Gesellschaft zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kernphysikalischen Forschung<br />
e.V.<br />
GHD Gewerbe, Handel, Dienstleistungen<br />
GKI Geschäftsklima-Index<br />
GW Gigawatt<br />
GWEC Global W<strong>in</strong>d Energy Council<br />
GWp<br />
Gigawatt peak<br />
GWS Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH<br />
GZB GeothermieZentrum Bochum<br />
H2<br />
Wasserstoff<br />
Hafö Holzabsatzför<strong>der</strong>richtl<strong>in</strong>ie<br />
HGF Helmholtzgeme<strong>in</strong>schaft Deutscher Großforschungse<strong>in</strong>richtungen<br />
HKNR Herkunftsnachweisregister<br />
HKW/HW Heizkraftwerk/Heizwerk<br />
IAEW Institut für elektrische Anlagen und <strong>Energiewirtschaft</strong><br />
IEK Institut für Energie- und Klimaforschung<br />
IFHT Institut für Hochspannungstechnik<br />
IÖW Institut für ökologische Wirtschaftsforschung<br />
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change<br />
IT.NRW Information und Technik NRW<br />
ITAD e.V. Interessensgeme<strong>in</strong>schaft <strong>der</strong> thermischen<br />
Abfallbehandlungsanlagen <strong>in</strong> Deutschland e.V.<br />
ITT Institut für Technische Thermodynamik<br />
JI Jo<strong>in</strong>t Implementation<br />
kWh Kilowattstunde<br />
KWKG / KWK-Gesetz Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz<br />
LANUV NRW Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
LANUV NRW Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz<br />
LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie<br />
LSC Labor- und Servicecenter Gelsenkirchen<br />
LWK NRW Landwirtschaftskammer NRW<br />
MAP Marktanreizprogramm<br />
MEET Münster Electorchemical Energy Technology<br />
218
Verzeichnis <strong>der</strong> verwendeten Abkürzungen<br />
MEF Major Economies Forum on Energy and Climate Change<br />
MENA Middle East and North Africa (Staaten des Nahen Ostens und<br />
Nordafrikas)<br />
MERCUR Mercator Research Center Ruhr<br />
MKULNV M<strong>in</strong>isterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und<br />
Verbraucherschutz des Landes NRW<br />
MSCI World Internationaler Aktien<strong>in</strong>dex<br />
Mtoe million tons of oil equivalent<br />
Mtoe Mio. Tonnen Öläquivalente<br />
MVA Müllverbrennungsanlage<br />
MW Megawatt<br />
MWel<br />
MWp<br />
MWth<br />
Megawatt elektrisch<br />
Meagwatt peak<br />
Megawatt thermisch<br />
NAP Nationaler Allokationsplan<br />
NaWaRo Nachwachsende Rohstoffe<br />
NEP 2012 Netzentwicklungsplan 2012<br />
NEPE Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität<br />
NLfB Nie<strong>der</strong>sächsisches Landesamt für Bodenforschung<br />
NlOG NL Oil and Gas Portal<br />
NPD (NW) Norwegian Petroleum Directorate<br />
NPE Nationale Plattform Elektromobilität<br />
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development<br />
PEMFC polymer Electrolyte fuel cells<br />
PV Photovoltaik<br />
QUARZ Test- und Qualifizierungszentrum für konzentrierende Solartechnik<br />
am DLR<br />
RAG RAG Deutsche Ste<strong>in</strong>kohle AG<br />
RB Regierungsbezirk<br />
RECS Renewable Energy Certificates System<br />
RECS Renewable Energy Certificate System<br />
RENIXX World Renewable Energy Industrial Index (regenerativer Aktien<strong>in</strong>dex)<br />
RUB Ruhr-Universität Bochum<br />
RWTH Rhe<strong>in</strong>isch-Westfälische Technische Hochschule Aachen<br />
SHK Sanitär, Heizung, Klima<br />
SIJ Solar<strong>in</strong>stitut Jülich<br />
SIJ Solar<strong>in</strong>stitut Jülich<br />
Solarthermie NT Nie<strong>der</strong>temperatur Solarthermie<br />
TAZ Test-, Applikations- und Assemblierungs-Zentrum<br />
TIE-IN Kompetenzzentrum für <strong>in</strong>teroperable Elektromobilität, Infrastruktur<br />
und Netze<br />
219
Verzeichnis <strong>der</strong> verwendeten Abkürzungen<br />
TZWL Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V.<br />
UBA Umweltbundesamt<br />
UDE Universität Duisburg-Essen<br />
UFOP Union zur För<strong>der</strong>ung von Öl- und Prote<strong>in</strong>pflanzen e.V.<br />
UK United K<strong>in</strong>gdom<br />
UMSICHT Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik<br />
ÜNB Übertragungsnetzbetreiber<br />
UPW Unterflur-Pumpspeicherwerken<br />
wab W<strong>in</strong>denergie-Agentur<br />
WBT Web Based Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />
WEA W<strong>in</strong>denergieanlage<br />
WPM W<strong>in</strong>d Power Monthly<br />
ZBT Zentrum für BrennstoffzellenTechnik<br />
ZSW Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-<br />
Württemberg<br />
220