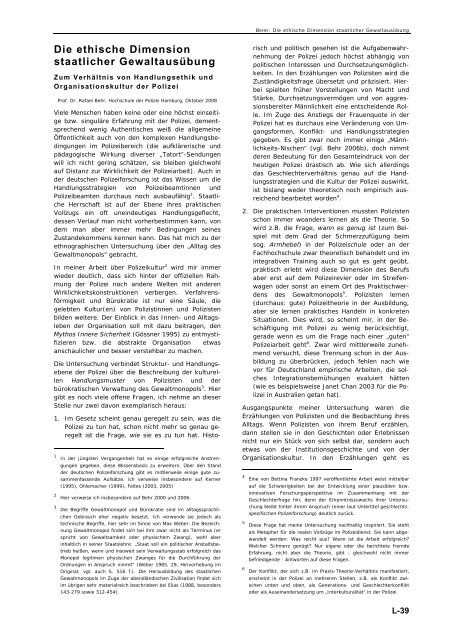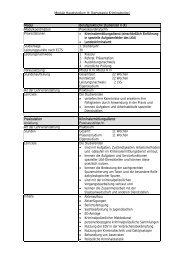Die ethische Dimension staatlicher Gewaltausübung
Die ethische Dimension staatlicher Gewaltausübung
Die ethische Dimension staatlicher Gewaltausübung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
BEHR: <strong>Die</strong> <strong>ethische</strong> <strong>Dimension</strong> <strong>staatlicher</strong> <strong>Gewaltausübung</strong>In der Gegenüberstellung der beiden hier vorgestelltenKulturen in der Polizei wird deutlich, dass dieLeitbilder der Polizeikultur zum einen der Selbstverständigungder Polizeiführung, zum anderen alsKommunikationsangebot mit der Öffentlichkeit dienen.Dagegen richten sich die Handlungsmuster der CopCulture ausschließlich an die (vornehmlich statusniedrigen)Mitglieder der eigenen Organisation, sie schöpftihre Wirkung überwiegend aus den internen (subkulturellen)Werten.Polizeikultur und Polizistenkultur sind nicht direkt zuvergleichen. Gleichwohl haben sie einige Berührungspunkte:• In beiden geht es auf der Makroebene um Fragender Ethik bzw. der Legitimation der Institution Sicherheitund Ordnung,• auf der Mesoebene geht es in beiden Kulturen umdas Verhältnis der Polizisten untereinander undum das Selbstverständnis der Organisation,• auf der Mikroebene geht es beiden um die Beziehungdes Einzelnen zu seiner Aufgabe.<strong>Die</strong>se gemeinsamen Relevanzebenen werden jedochunterschiedlich ausgefüllt:• Auf der Institutionsebene vermitteln Leitbilderuniverselle Werte und eine offensive, demokratischdurchdrungene Beziehung zur Öffentlichkeit.Dagegen grenzen sich Handlungsmuster geradevon dieser Grenzüberschreitung ab, sie führen einenAbwehrdiskurs, keinen Verständigungsdiskurs.• Auf der Organisationsebene fällt bei den Leitbildernder positive und offensive Charakter auf, hierstehen Innovation, partnerschaftliche Kommunikationund wohlwollende (interdisziplinäre) Zusammenarbeitim Vordergrund. <strong>Die</strong> Handlungsmusterlegen dagegen nahe, sich nicht „in die Kartenschauen zu lassen“ und dafür zu sorgen, dass dieGrenze zwischen dem verlässlichen sozialen Nahraumund dem „Rest der Welt“ sicher bleibt.ner Mensch kreiert, der gerne mit anderen Menschenvorurteilsfrei zusammenkommt. <strong>Die</strong> Handlungsmusterlegen nahe, die Klientel distanziertund skeptisch zu betrachten, sich nicht naiv zuzeigen und sich vor der Gegenseite, so gut esgeht, zu schützen.Handlungsmuster und Leitbilder stehen jeweils alsGrenzhüter zweier Grundverständnisse bzw. zweierHandlungslogiken in der Polizei. Sie bewerten diePolizei(arbeit) von zwei unterschiedlichen Perspektivenaus und kommen deshalb zu ziemlich disparatenBewertungen der sozialen Wirklichkeit und der polizeilichenAufgabe: Während sich Leitbilder danachrichten, was politisch gewünscht und dementsprechendkorrekt ist, orientieren sich die Handlungsmustereher nach den praktischen Erfahrungen derPolizisten und den von ihnen definierten Erfolgskriterien.<strong>Die</strong> Hauptkritik an den Leitbildern der Polizeikulturdürfte darin liegen, dass Polizisten ihren Beruf mit derdort nahegelegten Grundhaltung nicht ausübenkönnten, zumindest nicht in den gesellschaftlichprekären Handlungsfeldern. Nun schöpfen Leitbilderihre visionäre Kraft nicht aus dem Aspekt der konkretenZielvorgabe in dem Sinn, dass dieses Ziel realerreicht werden sollte, sondern sie sind ein Idealtypus10 , der so in der Wirklichkeit nicht vorfindbar istund dessen Verwirklichung auch nicht intendiert ist.<strong>Die</strong>se Kluft zwischen Realität und Vision ist bislangnoch nicht glaubwürdig geschlossen, was durchauszur Sprachlosigkeit zwischen „Basis“ und „Überbau“ inder Polizei beitragen dürfte.Etwas polemisch zugespitzt ist der Unterschied zwischenLeitbildern und Handlungsmustern etwa so zubenennen: Leitbilder können publiziert werden, abernicht das polizeiliche Handeln anleiten. Handlungsmusterdagegen leiten das polizeiliche Handeln an,können aber nicht publiziert werden.Innerhalb der Polizistenkultur gibt es für mich wahrnehmbarnoch einmal zwei Antagonisten der Polizeipraxis:der „Schutzmann“ und der „Widerstandsbeamte“.Der Schutzmann kann Übergriffe undandere Fehler in der Polizei nicht verhindern, der• Auf der Handlungsebene wird von den Leitbildernein freundlicher, unvoreingenommener, diplomatischversierter, kommunikativer und ausgeglichealsTatsachen aufgefasst und als solche behandelt. Man spielt einLustspiel, in dem man gleichzeitig als Akteur und Regisseur auftritt,Straßentheater im Polizeirevier sozusagen. Wie gesagt, ich kennesolche Inszenierungen, die mit etwas Spott und Ironie auskamen, dieniemanden wirklich verletzen wollen und die auf eine direkte Beschämungoder Degradierung verzichteten. Es gab und gibt aberauch Inszenierungen, in denen das „Opfer“ noch zusätzlich zurBelustigung der Belegschaft beitragen muss, z.B. in dem er denOberkörper frei machen muss, sich im Kreis drehen, eine Sonnenbrilleaufsetzen, ein Lied singen oder andere Dinge tun muss. Auch hierist oft wenig Boshaftigkeit zu spüren, wohl aber die Sicherheit, dassman mit dem Klienten machen kann, was man will. Manchmal rennendann die Kollegen aus dem Zimmer, weil sie das Lachen nicht mehrunterdrücken können und machen sich auf der Wache lustig über denKlienten. Wenn ein Mensch zum bloßen Gegenstand der Belustigunganderer wird, d.h. zum Spielball für andere, ist nach meinem Dafürhaltenseine Würde verletzt. Sicher könnte man einwenden, dasspassiert in jeder Dorfgemeinschaft auch, die mit dem sog. „Dorftrottel“oft rohe Späße machen, ohne dass man ein Grundrecht tangiertsähe. Aber in diesem Fall spielt sich die Szenerie in einem „Hinterzimmerdes Gewaltmonopols“ ab, der Klient ist im Schutzbereich,aber auch im Verantwortungsbereich der Polizei und damit der besonderenFürsorge des Staates ausgesetzt.10Mit dem Begriff der „idealtypischen Konstruktionen“ beschreibt MaxWeber ein Modell, das darstellt, „wie ein bestimmt geartetes, menschlichesHandeln ablaufen w ü r d e , w e n n es streng zweckrational,durch Irrtum und Affekte ungestört, und w e n n es fernerganz eindeutig nur an seinem Zweck (...) orientiert wäre. Das realeHandeln verläuft nur in seltenen Fällen (...) und auch dann nurannäherungsweise so, wie im Idealtypus konstruiert“ (Weber 1985,4; Hervorhebung im Original). In seinem Aufsatz „<strong>Die</strong> ‘Objektivität’sozialwissenschaftlicher Erkenntnis“ findet sich folgende Beschreibungdes Idealtypus: „Er wird gewonnen durch einseitige Steigerungeines oder einiger Gesichtspunkte und durchZusammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dortweniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen,die sich jenen herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einemin sich einheitlichen Gedankengebilde. In seiner begrifflichen Reinheitist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirischvorfindbar.... Er ist ein Gedankenbild, welches nicht die historischeWirklichkeit oder gar die ‘eigentliche’ Wirklichkeit ist, welches nochviel weniger dazu da ist, als ein Schema zu dienen, in welches dieWirklichkeit als Exemplar eingeordnet werden sollte, sondern welchesdie Bedeutung eines rein idealen Grenzbegriffs hat, an welchemdie Wirklichkeit zur Verdeutlichung bestimmter bedeutsamerBestandteile ihres empirischen Gehaltes gemessen, mit dem sieverglichen wird“ (Weber 1956, 186-262, Zitate S. 235 und 238 f.).L-42
BEHR: <strong>Die</strong> <strong>ethische</strong> <strong>Dimension</strong> <strong>staatlicher</strong> <strong>Gewaltausübung</strong>Widerstandsbeamte ist nicht für alle Übergriffe verantwortlich.Übergriffe fasse ich auf als überindividuelle,gleichwohl kleinräumige „Fehlinterpretationen“polizeilicher Aufgabenstellung.Der „Schutzmann“ als Prototyp reflektierterGewaltsamkeitDer Idealtypus des „Schutzmanns“ 11 verbindet Polizeikulturund Cop Culture auf pragmatische Weise. Ichsehe diesen Typus auch im Zentrum einer zivilgesellschaftlichen„Bürgerpolizei“, obwohl oder gerade weiler nur für den Alltag taugt, nicht für die prekärenGroßereignisse.Das Geschlecht des „Schutzmann“ ist immer nochmännlich, es kommen aber mehr und mehr „Schutzfrauen“in die Nähe dieses Idealtypus. Beide beziehensich affirmativ auf den Schutz der (mehr oder wenigerkonkreten) Gemeinde. Der Schutzmann verteidigtnicht primär die Rechtsordnung, den Bestand desStaates oder kämpft für eine gerechte, aber abstrakteSache, sondern hat seinen genuinen Bezug in derlokalen (Wohn-) Gemeinde. Das Lokale bildet dennormativen Rahmen seiner Arbeit. Er kümmert sichnicht in erster Linie um seine Karriere, sondern suchtnach sozialer Geborgenheit. Er ist der etwas biedere,auf jeden Fall unprätentiöse Teil der Polizei. Er setztsich von der harten Männlichkeit der street copsdadurch ab, als für ihn der Auftrag als Friedensstifterin Alltagssituationen wichtig ist.Der Schutzmann bezieht sich auf andere Werte als derKrieger, das Alter spielt dabei ein wichtige Rolle. Ganzjunge Schutzmänner gibt es nicht. Dazu gehört eineKompetenz, die sich über Praxis und Lebenserfahrunggleichermaßen vermittelt und die über einen längerenZeitraum angesammelt wurde, und zwar in einemHandlungsfeld, in dem er noch Kontakt zur Gemeindehat, das kann als Ermittlungsbeamter im Tagdiensteines Polizeireviers sein.Der älter gewordene Polizist, der als Sachbearbeiter inder Personalstelle des Polizeipräsidiums beschäftigtist, kann sich hingegen nur noch im weiteren Wortsinnals Schutzmann bezeichnen, da er seine früherePraxiserfahrung kaum noch beruflich umsetzen kann.Der junge Polizist ist in erster Linie Novize, und dortentweder Krieger oder unauffälliger Aufsteiger. Derjunge Leitungsbeamte ist Manager oder Bürokrat,keiner von ihnen ist Schutzmann. Alle können sichgleichwohl auf eine Tradition berufen, in der Schutz-Männlichkeiten produziert und gepflegt werden. Indiesem weiten Verständnis kann jeder von sich sagen,er sei Schutzmann. Distinktiv wirkt das Merkmal erstdurch die reale Tätigkeit, also durch Handeln, nichtdurch kollektive Zugehörigkeit (der Sachbearbeiter istkein Schutzmann, er partizipiert allenfalls an derweitverbreiteten Verwendung des Wortes) 12 .Schutzmänner können älter gewordene Krieger sein,deren Lust an der unmittelbaren Körperpräsentationgeringer geworden und in abgekühlte Erfahrungübergegangen ist, die vielleicht weiser geworden sind(sie sagen dann meistens, dass sie heute ruhigerseien als früher). Es müssen aber nie ausgesprocheneKrieger-Männlichkeiten gewesen sein. Auch derweniger kampfbetonte junge Mann reift heran, ersammelt Erfahrungen, die ihm den Status einesSchutzmanns geben können.<strong>Die</strong> Auseinandersetzung mit der Rolle der Polizei ingesellschaftlichen Konflikten ist für ihn nicht einfach.Er kann sich nicht mit allen Aufgaben und Tätigkeitender Polizei identifizieren und muss sich manchmalargumentative Nischen suchen, um seine Integritätund Loyalität auf eine nicht all zu harte Probe zustellen.Wertekonflikte löst er häufig durch prozedurale Rationalität:Ausschlaggebend ist der Gesetzesvollzug,persönliche Motive haben dabei keine Rolle zu spielen13 . Wer sich diese Formel nicht zu eigen machenkann, weil sie seinen Gerechtigkeitsvorstellungenzuwiderläuft, muss entweder rebellieren, sich entziehenoder seine Kompromissbildung aushalten. <strong>Die</strong>Verschiebung normativer Konflikte auf Verfahrensfragenist ein für bürokratische Herrschaft konstitutivesMerkmal. Zwischen den Polen Unterwerfung undWiderstand liegt für viele eine mehr oder wenigergroße Bandbreite von individuellen Bewältigungsstrategien14 .Der Schutzmann ist erklärtermaßen kein Pazifist.Gewalt als Ressource kennt er wohl und setzt sie ein,z.B. wenn er empfindlich getroffen wird oder auserzieherischen Gründen. Wichtig für ihn ist, dass erdabei über den Dingen steht, sich nicht in die Spiralevon Provokations- und Beleidigungsritualen verstrickenlässt, und dass er weiß, was er wann machenmuss. <strong>Die</strong>se Erfahrung des Praktikers ist nicht unbe-1213Der Schutzmann steht im Statusgefüge der Polizei ziemlich weitunten und ist in seinem Zuständigkeitsradius stark begrenzt.Gleichwohl nennen sich viele Polizisten Schutzmänner, sie meinendies aber nicht als Funktionsbeschreibung, sondern als Affirmationihres Berufsstandes: sie wollen tatsächlich schützen. <strong>Die</strong>s betrifftgerade diejenigen, die später in Führungspositionen übergewechseltsind, denn sie zeigen mit dieser Selbstzuschreibung, dass sie bodenständiggeblieben sind, und dass sie weder zu Managern nochzu Bürokraten wurden.<strong>Die</strong>ses Muster ist bezeichnend für den polizeilichen Umgang mitgesellschaftlichen Konflikten. <strong>Die</strong> Organisation wacht vor allem überdie Einhaltung der Verfahren. Das gedankliche Gegenstück wäre die„intentionale Rationalität“, die eher an den Inhalten, an den Begründungenund an den Diskursstrategien der Beteiligten ansetzenwürde. Ein Polizist mit „intentionaler Rationalität“ stellt sich dieFrage: warum will oder muss ich etwas tun? Der Kollege mit prozeduralerRationalität fragt hingegen: wie mache ich es (rechtlich)richtig?11In früheren Arbeiten bin ich von Männlichkeitsmustern als Koordina-14Ein gestandener „PHM“ (Polizeihauptmeister) mit mehrerentensystem für eine Erklärung der Polizei ausgegangen, die ich allerdingsauch als heuristische Modelle, nicht als Beschreibung einerreal vorfindbaren Eigenschaft verstanden habe. Dabei ist es auchheute noch geblieben: ich nutze das Bild des „Schutzmanns“ alsIdealtypus im Sinne Max Webers, man kann auch idealtypischeKonstruktion sagen, nicht Charaktertypologie.Jahrzehnten Berufserfahrung erwähnte in einem Interview die Praktikenzur Reduzierung von Einsatzstress beim Bau der Startbahn-West. Es sei üblich gewesen, dass jeder in der <strong>Die</strong>nstschicht imUmlaufverfahren nach einigen Wochen <strong>Die</strong>nst auch einige Zeit„krank“ machte. Er nannte dies seinen privaten Widerstand gegendie Startbahn „mit dem gelben Zettel“.L-43
BEHR: <strong>Die</strong> <strong>ethische</strong> <strong>Dimension</strong> <strong>staatlicher</strong> <strong>Gewaltausübung</strong>dingt in Übereinstimmung zu bringen mit der Theorieder <strong>Die</strong>nstvorgesetzten oder mit den Vorschriften desGesetzes. Es ist ein praxiserprobtes Wissen, das sichdurch eigene und kommunizierte Erfahrung speist. Erschlägt nicht blindlings zu, nicht aus Aggressivitätoder im Affekt, sondern an Vaters statt, erzieherisch.So legitimiert er seine Gewaltsamkeit.Der Schutzmann packt zu, wenn Gefahr droht, er hatpragmatische Lösungen, wenn etwas aus dem Lotgeraten ist, er hat nicht nur das Herz am rechtenFleck, sondern auch die Beherztheit, seine HändeeinzusetzenMan kann den Schutzmann als einen pragmatischdenkenden, nicht zum Fanatismus neigenden, in derRegel wertkonservativen Menschen beschreiben, derdurch die Praxis der Polizeiarbeit geprägt ist. <strong>Die</strong>hegemonialen Handlungsmuster (z.B. sich aufeinanderverlassen zu müssen) hat er internalisiert, er kannsie aber auch für sich nutzen. Vorgesetzte sind dannein Problem, wenn sie – im Gegensatz zu ihm – nichtmit offenen Karten spielen und ihn wegen seinerGeradlinigkeit ausgrenzen wollen.Souverän fühlt er sich in Situationen, die er selbstbeeinflussen kann, in denen er den Verlauf der Interaktion(mit)bestimmen kann. Im geschlossenenEinsatz dagegen fühlt er sich als ausführendes Organreduziert, er möchte nicht für etwas verheizt werden,was er nicht überblicken kann 15 .Sein Konflikthandeln zentriert er um den Aspekt desÜberzeugens (vielleicht auch des Überredens), er willProbleme vernünftig (d.h. pragmatisch) lösen, was dieEinsicht beim Konfliktgegner einschließt. Seiner Rolleals Verwalter des Gewaltmonopols ist er sich durchausbewusst, er stellt sein Gewalthandeln in einen höherenSinnzusammenhang. Er hat eine für ihn schlüssigeund ausreichend genaue Vorstellung davon, wann erGewalt in welcher Form einsetzt und unterscheidetdies von entgrenzter Gewalt. Auf diese Weise gelingtes ihm, sein eigenes Handeln zu legitimieren, ohnedas Handeln der Polizei als Organisation (z.B. beimFlughafenausbau) politisch rechtfertigen zu müssen.Er identifiziert sich nicht immer mit der Gesamtorga-15Deshalb taugten bzw. taugen die im sog. „Besonderen Sicherheits-und Ordnungsdienst“ (BSOD),auch eingesetzten sog. „Alarm-Hundertschaften“ oder auch „Einzeldienst-Hundertschaften“ für dengeschlossenen Einsatz nur bedingt: Hier werden im Notfall Beamtedes Einzeldienstes zu einer Einsatzeinheit zusammengefasst, d.h.von den Polizeirevieren abgezogen. Nun sind aber die meisten derdort versammelten Individualisten auf das unmittelbare und schnelleAusführen von Befehlen nicht vorbereitet, sondern bringen auchin diesen Gruppen ihre individuellen Haltungen, Problemlösungenund Erfahrungen ein, nicht immer zur Freude und vollkommendenZufriedenheit des Einsatzleiters. Andererseits, und davon konnte ichmich beim Uni-Streik 2004 an der Frankfurter Universität nochselbst überzeugen, wirken die (meist älteren und meist auch nichtmehr sportlich so durchtrainierten) Einzeldienstbeamten, die z.B.einen Eingang zu einem Gebäude abriegeln sollen, auch auf dasstudentische Protestpublikum erfolgreich deeskalierend. Sie ließensich auch durch die hitzigsten Parolen nicht mehr aus der Ruhebringen und mancher Jungaktivist hat sich an diesen „älteren Herren“erfolglos zu profilieren versucht. Einer der Einzeldienstkollegen(den ich noch persönlich von früher kannte), meinte im breitestenHessisch: „Ei, die Buube, die werrn aach emol ruischer“. Er meintedamit allerdings noch nicht mal die Studierenden, sondern seineKollegen einer Wiesbadener Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit,die auf der anderen Seite des Gebäudes eingesetzt war.nisation, sondern mit seinem engeren Arbeitsbereich,mit seinem direkten Tätigkeitszusammenhang.Im Konflikt unter Privatpersonen, zu dem er gerufenwird, ist der Schutzmann in erster Linie Schiedsmann.Er hört sich (immer wieder) die Parteien an, entscheidetnach seinem Ermessen und versucht dafür dieEinsicht beider Parteien zu bekommen. Allerdings ister weder Friedenstaube noch Geduldsmensch. Er hatein Augenmaß dafür, wann die Zeit des Redens undwann die Zeit des Handelns ist. Findet er für seinVorgehen keine Zustimmung, kann er durchaus alleRegister des polizeilichen Maßnahmenkatalogs ziehen16 .Der Schutzmann ist eine Nischen-Männlichkeit. Erkennt die Mechanismen des bürokratischen Apparates,hat gelernt, sich in ihm einzurichten, er haterkannt, dass er nicht viel verändern kann. Er weißauch, wie er die Strukturen für seine eigenen Zielenutzen kann. Der Schutzmann erscheint als Mann, der(die Gemeinde) schützt, der oft auch aus dieserGemeinde kommt und/oder sich zu ihr bekennt, deraber gleichzeitig einer Organisation angehört, die derGemeinde deutlich entrückt ist. Er verkörpert diekonservativen Werte des Erhalts einer gemeindlichenOrdnung und steht gleichzeitig vor der Aufgabe, sichim Apparat einzurichten, die bürokratischen Vorgabenzu beachten. Neben der aktiven Form des Schützens,so eine zweite Lesart, lebt dieser Männlichkeitstypusaber selbst im Schutz der Normalität. <strong>Die</strong>se muss ersich manchmal konstruieren, und er muss dafürKompromisse eingehen. Er lebt aber vor allem imSchutz der Strukturen, die eine gewisse Unauffälligkeitvoraussetzen und dafür einen sicheren Platz inder Organisation anbieten. Der Schutzmann ist nichtnur ein Mann, der schützt, sondern auch ein geschützterMann. <strong>Die</strong>ser Männlichkeitstypus arbeitet imweniger spektakulären Alltag des Gewaltmonopols.Dabei hat er durchaus eine Vorstellung von derBedrohung dieses Friedens. Er fühlt sich für denFrieden in dieser Gemeinde (seinem Revier) zuständig,nicht für die Verbrecherjagd.Der Schutzmann tut im Ergebnis Dinge, die verfahrenskonform,korrekt (legitim) und rechtlich legalsind, er bestätigt damit die Werte der Polizeikulturund des first code. Er begründet sie aber nicht notwendigerweisebürokratisch.So setzt der Schutzmann beispielweise gegen dasJagdfieber vieler junger Kollegen seine Routine undseine Erfahrung ein, nicht aber die Polizeidienstvorschrift.Bei einer Verfolgung eines flüchtigen Pkwdurch eine Innenstadt mahnt er den jungen Fahrer,nicht zu viel zu riskieren. Er handelt damit ganz imSinne der Verwaltungsvorschrift, die stets die Verhältnismäßigkeitim Auge hat. Aber er begründet es16Eine Episode aus vergangenen Tagen: Mir imponierte mein erster„Bärenführer“ (etwa um 1980) in einem Frankfurter Innenstadtrevierdann am meisten, wenn wir zu „Ruhestörendem Lärm“ gerufenwurden. Er wusste immer, was wir zu tun hatten – ich lag mit meinerEinschätzung oft daneben. Er konnte jovial sein, streng ermahnenund wieder gehen, freundlich ermahnen und wieder gehen,sofort die Musikanlage mitnehmen oder Verstärkung rufen, weil erwusste, dass wir das alleine nicht schaffen würden. Er tat das ausseiner „Schutzmannserfahrung“ heraus. Er hat mir nie sagen können(oder wollen), warum er wann was tat.L-44
BEHR: <strong>Die</strong> <strong>ethische</strong> <strong>Dimension</strong> <strong>staatlicher</strong> <strong>Gewaltausübung</strong>damit, dass ihm seine eigene Gesundheit mehr wertsei als alles andere. Oder er setzt seine Erfahrung einund sagt: „Wenn Du einen Unfall baust, schreibst DuDich dumm und dämlich“. Er kann das sagen, weil ergenügend Erfahrungen gemacht hat. Und wenn ernoch engagiert ist, fügt er hinzu: „Irgendwann gehtder uns schon ins Netz“ 17 .Man kann durchaus sagen, dass der „Schutzmann“erfolgreich zwischen Cop Culture und Polizeikulturvermittelt bzw. den gemeinsamen Nenner zwischenbeiden am besten auslotet. Er beherrscht den „first“und den „second code“ gleichermaßen, identifiziertsich mit beiden aber nur partiell.Aggressive Männlichkeit 18 bereitet sich und anderendann Schwierigkeiten, wenn sie den Kontext verlässt,in dem Aggressivität noch erlaubt bzw. funktionalerforderlich ist. Das halte ich für das grundlegendeDilemma der Polizeiarbeit: <strong>Die</strong> Gewaltanwendung iststrukturell und funktional erforderlich, darf aber denengen Legalitätsrahmen nicht verlassen. Sie ist imBerufshandeln auch immer präsent, wenn auch nichtimmer manifest. Polizeibeamte und –beamtinnenmüssen jederzeit gewaltfähig, dürfen aber nichtpermanent gewaltbereit sein. Wird die Gewaltförmigkeitvon ihnen habitualisiert, d.h. in Handlungsgewohnheitenüberführt, dann wird die Gewalt Teil desProblems der Polizei und nicht Teil der Lösung. Beimsog. „Widerstandsbeamten“ findet man dieses Problempersonalisiert. Er ist sozusagen das idealtypischeGegenstück zum reflektierten Praktiker.Der „Widerstandsbeamte“ als Prototyp prekärerGewaltaffinitätJeder Polizist/jede Polizistin weiß, was damit gemeintist, wenn man von einem Widerstandsbeamtenspricht, obwohl dieser Begriff weder in Gesetzestextennoch in offiziellen Verlautbarungen der Polizei e-xistiert 19 . Er ist in der Schriftkultur der Polizei nichtexistent und nicht zitierfähig 20 . Gleichzeitig ist es für171819Es gibt im übrigen eine ganze Reihe von Redewendungen, die dievielen kleinen und großen Kränkungen (ein Pkw flüchtet, weil dasFahrzeug mehr PS als der <strong>Die</strong>nstwagen und der Fahrer mehr Todesverachtunghat als die Polizeibeamten) bearbeiten: „<strong>Die</strong>seSchlacht haben wir verloren, aber noch nicht den Krieg“, „Irgendwannkriegen wir sie alle“, „<strong>Die</strong> Netze sind gespannt“, „Der stirbtauch nicht im Bett, wenn er so weiter macht“ etc. – es würde sichdurchaus lohnen, solche Alltagsregeln einmal zu sammeln und zusystematisieren. Ich glaube, sie stehen im <strong>Die</strong>nste einer kollektivenÖkonomie der Arbeitskraft und der Arbeitsmoral. Selbstredendwürden wir solche Alltagsweisheiten nicht in der Polizeikultur finden.In der Tat gibt es viele Geschichten und Erlebnisse mit „Widerstandsbeamten“,hingegen scheint es den Typus der „Widerstandsbeamtin“nicht zu geben.Im Gegensatz zum „Schutzmann“ ist die Bezeichnung „Widerstandsbeamter“keine auf ein ganzes Handlungsrepertoire ausgerichteteZuschreibung, sondern betrifft vielmehr einehervorstechende Eigenschaft, die zudem sehr stark situativ gerahmtist. Auch der sog. Widerstandbeamte führt eine hilflose ältere Dameüber die Straße und bringt orientierungslose Verwirrte wieder insAltersheim zurück. Aber seine distinktive „Eigenschaft“ ist seineüberdurchschnittliche Gewaltaffinität, die sich in sein Berufshandelneingewoben hat.die erfolgreiche Bewältigung der Polizeipraxis elementarwichtig zu wissen, was damit gemeint ist und wieman mit so Bezeichneten am besten umgeht (bzw.wie man sie umgeht). Der „Widerstandsbeamte“handelt gegenüber den falschen Leuten in den falschenSituationen mit falschen Mitteln. Er neigtschneller als andere dazu, Gewalt anzuwenden, wasfür die Streifenpartner/innen durchaus unangenehmeFolgen haben kann. <strong>Die</strong> müssen ihn unterstützen oderdecken, sich für das gemeinsame Handeln rechtfertigen,als Zeuge oder Mitangeklagter auftreten etc. Dasist für die Streifenpartner mit Risiken, Gefährdungenund Lästigkeiten verbunden (Gesundheitsgefährdung,Verstrickung in Vorwürfe und Untersuchungen, Anfertigenvon dienstlichen Erklärungen, evtl. disziplinareVorermittlungen und Karrierebehinderung etc.).Gleichzeitig, und das ist das Kuriose, erzeugt dieserTypus eine gewissen Faszination, weil in den Geschichtendes Polizeialltags, die er zuhauf bestückt,nicht die Konfliktbeteiligung im Vordergrund steht,sondern die Bewältigung von Gefahrensituationen.Gleichzeitig repräsentiert der Widerstandsbeamte denTypus des Polizisten, der seine eigene Situationsdefinitionauch gegen Widerstand durchsetzt. <strong>Die</strong>s ist MaxWebers Definition von Macht (Weber 1985, 28). DerWiderstandsbeamte handelt zwar unangemessen,aber machtvoll. Er bestimmt, wer den richtigen Tontrifft und wer sich zu fügen hat. <strong>Die</strong>se Machtdemonstrationist es wohl, die oft im Kollegenkreis Respekterfährt, allerdings in der Regel nur unter den statusnahenKollegen.Ich würde sagen, der Typus des „Widerstandsbeamten“spielt deshalb in Polizistenkreisen eine ambivalenteRolle (Ablehnung und Bewunderung), weil erauch intern Dominanzverhalten zeigt, weil er mächtigauftritt und weil er damit Angst oder Respekt erzeugt.Sich explizit gegen ihn zu stellen ist oft deshalbunmöglich, weil er die Gruppenbefindlichkeiten kenntund sie gegen Kritik auch mobilisieren kann. Oftmalsist der Widerstandsbeamte ein nicht gerade beliebter,aber dennoch einflussreicher Kollege. Im übrigenverkörpert er, institutionstheoretisch gedacht, auchden unangepassten, geradezu „archaischen Krieger“,der unumschränkte Machtfülle für sich beanspruchtund sich weder dem rechtlich geforderten Verhältnismäßigkeitsprinzipunterwirft noch dem Grundsatz desinstitutionell gewünschten Smart-Policing folgt. Der„Widerstandsbeamte“ ist deshalb problematisch, weiler nicht sorgfältig genug unterscheidet. Er siehttendenziell alle Personen, mit denen er dienstlich zutun hat, eindimensional als „seinem Entscheiden undHandeln Unterworfene“ und behandelt entsprechendjede Form der Abweichung von dieser Vorstellung alsUnbotmäßigkeit und Insubordination. Der Widerstandsbeamtehandelt stets rigoros, nicht nur gegenüberPersonen mit geringer Definitionsmacht, er gerätdabei manchmal an den Falschen und dann wird seinHandeln öffentlich und aktenkundig.20Das stimmt seit einiger Zeit nicht mehr ganz: Bei „Google“erscheint unter dem Suchbegriff „Widerstandsbeamter“ in Wikipediaunter „Phänomenologie“ des Tatbestands „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“(§ 113 StGB) ein Hinweis auf den Typus desWiderstandsbeamten sowie auch auf das Wechselverhältnis derAnzeigen wegen Körperverletzung im Amt und der Widerstandsanzeigen.„Wikipedia“ ist aber eine elektronische und eine nicht amtlicheQuelle.L-45
BEHR: <strong>Die</strong> <strong>ethische</strong> <strong>Dimension</strong> <strong>staatlicher</strong> <strong>Gewaltausübung</strong>Strukturen – Kulturen - Dispositionen: DerUmgang mit Gewalt als Organisationsproblem<strong>Die</strong> Frage, ob aggressive Handlungsbereitschaften inder Polizei selbst erst erzeugt oder lediglich kultiviertoder ausgenützt werden, ist nicht eindeutig zu beantworten.Bei der Variationsbreite der real existierendenPersönlichkeitstypen ist jedoch eine lineare Beziehungzwischen aggressiver Männlichkeit und Polizei sichernicht anzunehmen. Andererseits vollzieht sich eineEntwicklung hin zu pazifizierteren Ausdrucksformenvon Männlichkeit ebenfalls nicht ungebrochen. Dennimmerhin bilden sich innerhalb einer allgemeinenTendenz zu größerer Gewaltsublimierung in der Polizeiauch subkulturelle Praxen heraus, die in bestimmtenOrganisationsteilen zu einer besonderen Betonungvon Disziplin und Krieger-Männlichkeit führen, wie icham Beispiel einer BFE gezeigt habe (vgl. Behr 2006b).<strong>Die</strong>s geschieht nicht notwendig im militärischautoritärenStil, sondern durchaus mit hedonistischenZügen, sozusagen als libidinös besetzte Härtedemonstration.Dabei darf man aber nicht vergessen,dass diese Männlichkeit anstrengend und riskant ist,es erfordert täglich einige Überwindung, um dem Bilddes überlegenen, respektive des harten Mannesgerecht zu werden, und es birgt im Übrigen Risikender Selbstbeschädigung. Und man darf nicht vergessen,dass diese expressive Darstellung von gewaltbereiterMännlichkeit von vielen Männern (und denmeisten Frauen) persönlich nicht praktiziert oder dochnur fallweise angedeutet wird.Neben den Konkurrenzen und Disparitäten zeigen sichauch Elemente einer gemeinsamen Entwicklung vonCop Culture und Polizeikultur sowie mögliche Wandlungenim Alltag der Polizei.Leitbilder gewinnen trotz aller Kritik an Bedeutungunter dem Gesichtspunkt der alternativen Handlungsorientierung,als Angebot zum Abrücken von traditionellenHandlungsmustern bzw. von den hegemonialenMännlichkeitsmodellen. Wahrscheinlich ist diesesAngebot für den ein oder anderen (besonders: lebensälteren)Beamten, der schon einige Jahre strapaziösen<strong>Die</strong>nst hinter sich hat und auchlebensgeschichtlich nicht (mehr) an reiner Körperpräsentationinteressiert ist, attraktiver als für ausgesprochene(junge) Krieger-Männlichkeiten. Im übrigenliegt ein Gewinn auch darin, dass die Leitbilddebattedie Diskussion um tatsächliche Werte im Polizeidienstweiter gebracht hat. So entstanden z.T. alternativeLeitbilder bzw. solche, die wesentlich kleinräumigerund konkreter die Belange einer <strong>Die</strong>nststelle getroffenhaben.Es liegt insgesamt nahe zu vermuten, dass street copsvon den neuen Leitbildern mittelbar partizipieren,denn wenn sie auch nicht als Handlungsanweisungendienen, so bieten sie sich doch als Kommunikationsangebotdarüber an, was als sinnvolles Handeln in derPolizei zu gelten habe. Auf diese Weise könnte durchausdas Verhaltensrepertoire der Polizei erweitertbzw. fortentwickelt werden.Zunächst scheinen jedoch bestimmte situative undorganisatorische Elemente die traditionelle CopCulture zu bestätigen: <strong>Die</strong> Wirkung subkulturellerNormen auf polizeiliche Handlungen wird um sowahrscheinlicher, je mehr die Arbeitszusammenhängedie Anwendung dieser Regeln nahe legen oder mindestenszulassen. Solche Arbeitszusammenhänge sindetwa die folgenden:• <strong>Die</strong> Auftragsgestaltung in bestimmten Großstadtmilieus(z.B. Einsätze im Rotlichtmilieu), in Konfliktbezirken,bei länger anhaltenden Grosseinsätzen(z.B. Castor-Transporte) macht ein Anwachsensubkultureller Normen wahrscheinlich,weil man die Umgebung als feindlich wahrzunehmenbeginnt.• In Organisationsteilen, in denen es zu einerKonzentration von jungen und/oder statusniedrigenMännern kommt, ist die Entwicklung abweichenderNormen (unter dem Eindruck eineraggressiven Männlichkeitskultur) wahrscheinlicherals in Gruppen, die nach Status, Alter und Geschlechtgemischt sind.• Des Weiteren spielt der Einfluss der umgebendenPeers eine wichtige Rolle: Abschottung gegenüberder Außenwelt fördert die Entwicklung eines eigenensecond code, der von dem offiziellen first codedes Rechts z.T. erheblich abweicht.• Schließlich kommt es ganz wesentlich auf die Artund Weise des Kontakts und der Kommunikationzwischen Basis und Führung an, ob sich eine eigeneSubkultur entwickelt, die gegen die Regeln derOrganisation arbeitet, oder ob die Leitung am Alltagsdiskursder street cops teilnimmt (und von ihnenernst genommen wird).Strukturelle bzw. organisatorische Veränderungenkönnen aber auch Handlungspraxen positiv beeinflussen.Insbesondere die veränderten Einstellungsbedingungen,die durch die Erhöhung der Frauenquotebedingte Auflösung reiner Männerbünde, das Fachhochschulstudiumam Beginn der Berufslaufbahnsowie die damit verbundene Abkehr von (ihrerseitsdie Entwicklung von Partikularnormen begünstigende)Gemeinschaftsunterkünften könnten sich günstig füreine Annäherung von Cop Culture und Polizeikulturerweisen. Inwieweit Leitbilder die Kultur der Organisationverändern, wird davon abhängen, ob sie eingebundenwerden in einen größeren (undkontinuierlichen) Prozess der Organisationsentwicklungoder ob es sich um eine singuläre Kampagnehandelt.Letztlich bleibt nicht viel anderes übrig, als sich mitden kulturellen Mustern der street cops noch stärkerauseinander zu setzen, sie ernst zu nehmen und nochgenauer zu studieren. Dann könnten sie in Beziehunggesetzt werden mit den Leitbildern der Polizeikultur.Wenn über beide (fach)öffentliche Diskurse stattfänden,würden Polizisten frühzeitig auf die Disparitätenund Konkurrenzen zwischen Theorie und Praxisaufmerksam und müssten sich nicht individuell undmit eigenem Risiko den Weg durch die Berufskarrierebahnen. Sie wären wahrscheinlich weniger verführbarfür die Routinen des Alltags und könnten andererseitsoffener mit neuen Angeboten umgehen, von denen siesich jetzt von den alten Hasen noch sagen lassenmüssen, dass sie in der Praxis sowieso nicht funktionieren.L-46
BEHR: <strong>Die</strong> <strong>ethische</strong> <strong>Dimension</strong> <strong>staatlicher</strong> <strong>Gewaltausübung</strong>Literatur:Ackermann, Carl A. (1896): Polizei und Polizeimoral, StuttgartAhlf, Ernst-Heinrich (2000): Ethik im Polizeimanagement(BKA-Forschungsreihe), 2. Auflage, WiesbadenBeese, <strong>Die</strong>ter (1996): Polizeiliche Berufsethik, in: Kniesel,M./E. Kube/M. Murck (1996) (Hg.) S. 1005-1033Beese, <strong>Die</strong>ter (2000): Studienbuch Ethik, Hilden/Rhld.(Verlag Deutsche Polizeiliteratur)Behr, Rafael (2000a): Cop Culture - Der Alltag des Gewaltmonopols.Männlichkeit, Handlungsmuster und Kultur in derPolizei, Opladen (zugl. Dissertation Universität Frankfurt1999)Behr, Rafael (2006): Polizeikultur. Routinen – Rituale –Reflexionen. Bausteine zu einer Theorie der Praxis derPolizei, WiesbadenBehr, Rafael (2006b): Besser als andere. BF-Einheiten undder Organisationswandel der Polizei – ein Werkstattberichtaus der Polizeikulturforschung, in: Christe-Zeyse, Jochen(Hg.): <strong>Die</strong> Polizei zwischen Stabilität und Veränderung.Ansichten einer Organisation, Frankfurt/M., S. 49-69Behr, Rafael (2007): „<strong>Die</strong> Besten gehören zu uns – aber wirwissen nicht, wer sie sind“. Veränderungen von Organisationskulturund Personalmanagement der Polizei im Zeitaltergesellschaftlicher Pluralisierung – Bericht aus einem Forschungsprojektzur Integration von Migranten in die Polizei,in: Möllers, Martin H.W./ Robert Chr. Van Oyen (Hrsg.):Jahrbuch öffentliche Sicherheit 2006/2007, S. 291-314Honig, Michael-Sebastian (1992): Verhäuslichte Gewalt.Sozialer Konflikt, wissenschaftliche Konstrukte, Alltagswissen,Handlungssituationen. Eine Explorativstudie überGewalthandeln von Familien, FrankfurtKniesel, M./ E. Kube/ M. Murck (1996) (Hg.): Handbuch fürFührungskräfte der Polizei, LübeckMicewski, Edwin R. (1997): Grenzen der Gewalt – Grenzender Gewaltlosigkeit; Wien (Peter Lang), als PDF-Dateiherunterzuladen unter:www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/05_gdg_01_mice.pdf,Zugriff am 25.5.06Ohlemacher, Th. (1999): Empirische Polizeiforschung in derBundesrepublik Deutschland - Versuch einer Bestandsaufnahme-, Hannover (Kriminologisches ForschungsinstitutNiedersachsen, Forschungsberichte Nr. 75, Eigendruck)Schütz, A. (1974): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt -Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Frankfurt/M.(zuerst Wien 1932)Steinert, Heinz (1989): Subkultur und gesellschaftlicheDifferenzierung, in: Haller, Max et al. (1989) (Hg.): Kulturund Gesellschaft. Verhandlungen des 24. deutschen Soziologentages,des 11. österreichischen Soziologentages unddes 8. Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft fürSoziologie in Zürich 1988, Frankfurt/M., S. 614-626Weber, M. (1956): <strong>Die</strong> „Objektivität“ sozialwissenschaftlicherErkenntnis, in: ders.: Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen,Politik, Stuttgart, S. 186-262 (zuerst 1904)Weber, M. (1985): Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Auflage(Studienausgabe), TübingenWinter, M. (1998): Politikum Polizei, MünsterBergh, Ernst van den (1926): Polizei und Volk. SeelischeZusammenhänge, Berlin, Bd.1Chan, Janet B.L. (2003): Fair Cop. Learning the Art ofPolicing, Toronto u.a. (University of Toronto Press)Feltes, Thomas (2003): Frischer Wind und Aufbruch zu neuenUfern. Was gibt es neues zur Polizeiforschung und zurPolizeiwissenschaft? In: http://www.polizei-newsletter.de/pdf/Frischer%20Wind%20und%20Aufbruch%20zu%20neuen%20Ufern.pdfFeltes, Thomas/Maurice Punch (2005): Good People, DirtyWork? Wie die Polizei die Wissenschaft und Wissenschaftlerdie Polizei erleben und wie sich Polizeiwissenschaft entwickelt,in: MschrKrim 88.Jg. Heft 1 – 2005, S. 26-45Franke, Siegfried (1991): Berufsethik für die Polizei, RegensburgFranke, Siegfried (2004): Polizeiethik : Handbuch für Diskursund Praxis , Stuttgart u.a.Franzke, B. (1997). Was Polizisten über Polizistinnen denken:ein Beitrag zur geschlechterspezifischen Polizeiforschung,BielefeldGeertz, C. (1987): Dichte Beschreibung, Frankfurt/M.Gössner, R. (1995) (Hg.): Mythos Sicherheit. Der hilfloseSchrei nach dem starken Staat, Baden-BadenKerner, H.-J. (1995): Empirische Polizeiforschung in Deutschland,in: Kühne, H.-H./K. Miyazawa (1995) (Hg.), S. 221-253Hess, H./S. Scheerer(1997): Was ist Kriminalität? Skizzeeiner konstruktivistischen Kriminalitätstheorie, in: KriminologischesJournal 2/97, S. 83-155L-47
BEHR: <strong>Die</strong> <strong>ethische</strong> <strong>Dimension</strong> <strong>staatlicher</strong> <strong>Gewaltausübung</strong>L-48