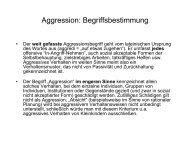Auf dem Weg zur Einheit des Wissens - Michael Schmidt-Salomon
Auf dem Weg zur Einheit des Wissens - Michael Schmidt-Salomon
Auf dem Weg zur Einheit des Wissens - Michael Schmidt-Salomon
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
weit später erst sich entwickelnden Forschungsrichtungenevolutionäre Erkenntnistheorie,moderne Ethologie (Tierverhaltensforschung)sowie Evolutionspsychologie.In<strong>dem</strong> Darwin bereits im Titel auf die geschlechtlicheZuchtwahl, also das Prinzip dersexuellen Selektion hinwies, machte er klar,dass das Überleben <strong>des</strong> Erbmaterials einesIndividuums in den nachfolgenden Generationenkeineswegs allein davon abhängig ist, obes sich gegen Fressfeinde durchsetzen oderFeinden entfliehen kann. Min<strong>des</strong>tens ebensobedeutsam ist es, ob das paarungsbereiteIndividuum potentiellen Sexualpartnern attraktiverscheint. Damit wurde der „Kampf umsDasein“ gewissermaßen um den „Kampf derGeschlechter“ ergänzt. 8 Darwin erkannte, dassnur das Prinzip der sexuellen Selektion erklärenkonnte, warum sich Pfauenmännchen mitprächtigen Federn schmücken, obwohl dieswertvolle Ressourcen verschlingt und auch beider Flucht vor Feinden überaus hinderlich ist.Der hier aufscheinende Gegensatz zwischenden Prinzipien der sexuellen Selektion (also<strong>dem</strong> „genetischen Überleben der Attraktivsten“)und der natürlichen Selektion (<strong>dem</strong> „genetischenÜberleben der Bestangepassten“)sollte einigen Generationen von Evolutionstheoretikernnoch arge Kopfschmerzen bereiten.Ich werde darauf <strong>zur</strong>ückkommen.Fest steht: Als Charles Darwin am 19. April1882 starb, war die von ihm maßgeblich geprägteEvolutionstheorie im Bereich der Naturwissenschaftenbereits weitgehend anerkannt.Dennoch wies die Theorie zu diesemZeitpunkt noch zahlreiche Lücken und Irrtümerauf. Zwar hatte Darwin mit der Theorie dernatürlichen und sexuellen Selektion einen Mechanismusentdeckt, der ohne den LamarckschenVervollkommnungsdrang auskam, dochan <strong>dem</strong> Grundprinzip eines zwar unbeabsichtigten,aber dennoch realen Fortschritts in derEvolution hielt Darwin ebenso fest wie an LamarcksIdee einer Vererbung erworbener Eigenschaften.1.3 Die dritte Phase: Neodarwinismus undSynthetische EvolutionstheorieDie These von der Vererbung erworbener Eigenschaftenwurde Ende <strong>des</strong> 19. Jahrhundertserstmals durch den deutschen Biologen AugustWeismann anhand zahlreicher Versucheempirisch widerlegt. Mit ihm beginnt die Phase<strong>des</strong> sog. „Neodarwinismus“, die vor allemdurch die Integration der Erkenntnisse derGenetik in die Evolutionstheorie gekennzeichnetist. 9 Weismann war es auch, der erkannte,dass die genetische Rekombination, also dieDurchmischung väterlicher und mütterlicherErbanlagen während der Fortpflanzung, eineder wichtigsten Quellen für die Entstehung vonVariabilität ist, d.h. für die Ausprägung unterschiedlicherEigenschaften bei zweigeschlechtlichentstandenen Individuen.Weismanns Arbeiten bildeten später, in den1930er bis 1950er Jahren, die Grundlage fürdie Entwicklung der sog. „Synthetischen Evolutionstheorie“,die maßgeblich durch JulianHuxley, <strong>dem</strong> Enkel <strong>des</strong> Darwin-MitstreitersThomas Huxley, Theodosius Dobzhansky undErnst Mayr geprägt wurde. Mit Hilfe der „SynthetischenEvolutionstheorie“, deren Name vonJulian Huxleys Buch „Evolution: The modernSynthesis“ (1942) herrührte, wurde eine Vereinheitlichungder Evolutionstheorie erreicht.Durch den Einbezug vieler wissenschaftlicherTeildisziplinen entwickelten Huxley & Co. eingroßes einheitliches Theoriegebäude, das imGrunde bis zum heutigen Tag bestehengeblieben ist. Wenn wir heute von der modernenEvolutionstheorie sprechen, so beziehenwir uns in der Regel weniger auf die TheorieDarwins als auf die Ergebnisse der SynthetischenEvolutionisten in der Mitte <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts.10Doch auch mit der Synthetischen Evolutionstheorie,die durch die Entdeckung der DNAdurch Watson und Crick 1953 bestätigt wurde,ist die Evolution der Evolutionstheorie nichtabgeschlossen. In den 1970er Jahren trat dieEvolutionstheorie in eine neue Phase. Maßgeblichdaran beteiligt war der Zoologe EdwardO. Wilson, der 1975 sein monumentales Buch„Sociobiology: The New Synthesis“ veröffentlichte.Die Reminiszenz an Huxleys Grundlagenwerkvon 1942 war sicherlich alles andereals Zufall. Wilson war von Anfang an fest davonüberzeugt, dass die Soziobiologie für dieWeiterentwicklung der Evolutionstheorie ähnlichbedeutsam sei wie Huxleys historischeSynthese – und er sollte damit Recht behalten.1.4 Die vierte Phase: Neue SynthetischeEvolutionstheorie / SoziobiologieDas besondere Kennzeichen der Soziobiologieist es, dass sie das Verhalten von Lebewesen(Menschen und anderen Tieren) nicht nur inGruppenzusammenhängen untersucht (daherder Begriff Soziobiologie), sondern dass siediese Beobachtungen konsequent evolutionsbiologischauf der Grundlage der modernenGenetik, der Ökologie und der Populationsbiologieanalysiert. Während klassische Verhaltensforscher(Ethologen) wie Konrad Lorenzdas altruistische Verhalten von Lebewesen nurdurch einen Rückgriff auf idealistische Spekulationen,nämlich die Unterstellung eines angeborenen„Arterhaltungstriebes“, „erklären“3
Halten wir fest: Die Soziobiologie ist mittlerweilezu einem integralen Bestandteil der Evolutionstheoriegeworden. Sie hat zu zahlreichenfruchtbaren Forschungsansätzen geführt undihre grundlegenden Hypothesen wurden immerwieder auf eindrucksvolle Weise empirischbestätigt. An ihrem prinzipiellen wissenschaftlichenWert (nicht an einzelnen Detailaussagen!)kann kaum noch ein Zweifel bestehen.Der besondere Reiz der Soziobiologie bzw. derneo-neodarwinistischen Theorie besteht sicherlichin ihrer wissenschaftlichen Eleganz.In<strong>dem</strong> sie den evolutionären Prozess konsequentauf die Wirkungen <strong>des</strong> Eigennutzprinzips<strong>zur</strong>ückführt, kann sie auf spekulative Annahmen(wie das biologisch unbegründete Konzeptder Arterhaltung, aber auch die empirischkaum haltbare Idee eines evolutionären Fortschrittsautomatismus21 ) verzichten. Insofernstellt die Soziobiologie die bislang konsequentesteFortführung <strong>des</strong> Darwinschen Gedankengebäu<strong>des</strong>dar, weshalb es durchaus zulässigerscheint, sie mit Wilson als die „neue evolutionäreSynthese“ zu begreifen.Phase Vertreter Kennzeichen1. PhaseFrühe EvolutionstheorieLamarckismusJean-Baptiste de Lamarck• Wandlung der Arten durch Vererbungerworbener Eigenschaften• Inhärenter Vervollkommnungsdrang2. PhaseKlass. DarwinismusCharles DarwinAlfred Russell WallaceThomas HuxleyErnst Haeckel• Natürliche und sexuelle Selektion• Zufall und Notwendigkeit• Variabilität aufgrund von Mutationenund Vererbung erworbener Eigenschaften• Unterstellung eines evolutionärenFortschritssautomatismus3. PhaseNeodarwinismus /Synthetische EvolutionstheorieAugust WeismannJulian HuxleyTheodosius DobzhanskyErnst MayrKonrad Lorenz• Vereinheitlichung der Theorie unterbesonderer Berücksichtigung der Ergebnisseder modernen Genetik• Variabilität aufgrund der Rekombination<strong>des</strong> Erbmaterials und durch Mutationen4. PhaseNeo-Neodarwinismus /Neue Synthetische Evolutionstheorie/SoziobiologieWilliam HamiltonEdward O. WilsonRichard DawkinsStephen J. GouldWolfgang WicklerChristian VogelFranz WuketitsEckart VolandVolker Sommeretc.• Weitere Vereinheitlichung der Theoriedurch die konsequente Berücksichtigung<strong>des</strong> Eigennutzprinzips• Spieltheoretische Erklärung <strong>des</strong> Altruismus• <strong>Auf</strong>deckung der Prinzipien der sexuellenSelektion• Widerlegung <strong>des</strong> Konzepts der Arterhaltung• <strong>Auf</strong>hebung der Idee <strong>des</strong> evolutionärenFortschrittsautomatismusTabelle: Die Evolution der Evolutionstheorie im Überblick5
2. Irrwege, Missverständnisse und Katastrophen:Evolutionstheorie und der Fluch<strong>des</strong> BiologismusGroße Ideen laden, wie wir aus bitterer Erfahrungwissen, leider allzu häufig zu großemMissbrauch ein. Darwins Evolutionstheoriebildet in dieser Hinsicht wahrlich keine Ausnahme.Ich werde versuchen, in diesem Kapiteldie fatalen Irrwege und Missverständnissezu skizzieren, die die Evolutionstheorie in ihrerGeschichte begleiteten und die auch heutenoch Nachwirkungen zeigen. Fassen möchteich diese Irrwege und Missverständnisse unter<strong>dem</strong> Stichwort „Biologismus“, wobei ich zwischeneinem theoretischen und einem normativenBiologismus unterscheide. Zunächst einekurze Erläuterung der Begriffe:• Der Begriff „theoretischer Biologismus“kennzeichnet all jene Weltdeutungsmuster,die menschliche Verhaltensweisenoder gesellschaftliche Zusammenhängewesentlich über biologischeGesetzmäßigkeiten zu erklären versuchen,ohne dabei die Besonderheitender menschlichen Spezies (insbesonderedie Bedeutung kultureller Faktoren)in angemessener Weise zu berücksichtigen.• In Abgrenzung dazu umfasst der Begriff„normativer Biologismus“ all jeneIdeologien, die aus der Beschreibungbiologischer Ist-Zustände unreflektiertmoralische und/oder politische Sollenssätzeableiten. Diese unreflektierteAbleitung <strong>des</strong> Sein-Sollenden aus <strong>dem</strong>Seienden wurde in der philosophischenDebatte zu Recht als „naturalistischerFehlschluss“ kritisiert.Theoretischer und normativer Biologismusmüssen nicht unbedingt „Hand in Hand“ gehen,sind jedoch in der Vergangenheit meistals „Kombipack“ aufgetreten, wie die nachfolgendeAnalyse der normativen BiologismenSozialdarwinismus, Rassismus und Eugenikzeigen wird.2.1 „Das Recht <strong>des</strong> Stärkeren“: SozialdarwinismusDer Sozialdarwinismus ist eine Form <strong>des</strong> normativenBiologismus, die Darwins Lehre, insbesonderedie Rede vom „Kampf ums Dasein“und <strong>dem</strong> „Überleben der Tauglichsten“ als<strong>Auf</strong>forderung zum <strong>Auf</strong>bau entsprechendergesellschaftlicher Verhältnisse missversteht(Stichwort: „Recht <strong>des</strong> Stärkeren“). In der Vergangenheitgalt es als besondere Spezialitätder Sozialdarwinisten, die Bereitschaft zumFühren von Kriegen als „immanenten Wesenszug<strong>des</strong> Menschen“ zu begreifen und die Beziehungenzwischen Staaten und Völkern als„Kampf um Lebensraum“ zu deuten. Gegenwärtigscheint ein anderes sozialdarwinistischesArgumentationsmuster bedeutsamer zusein, nämlich die Rechtfertigung sozialer Ungleichheitunter Hinweis auf das universellgültige Eigennutzprinzip.Was ist <strong>dem</strong> entgegenzuhalten? Zunächsteinmal ist dieses Argument ethisch schlechtbegründet, weil es – wie jede Form <strong>des</strong> normativenBiologismus – auf einem „naturalistischenFehlschluss“ beruht. Aus einem unterstellten„empirischen Sein“ lässt sich nun einmal kein„Seinsollen“ ableiten. 22 Wir können unsereethischen Werte daher nicht unreflektiert ausunserer Naturerkenntnis „heraus<strong>des</strong>tillieren“.Aber das ist noch nicht alles: Auch empirischbetrachtet, steht das sozialdarwinistische Argumentauf überaus schwachen Füßen, dennes gründet nicht auf einer soliden wissenschaftlichenErkenntnis, sondern auf einerFehlannahme <strong>des</strong> theoretischen Biologismus.Eigennutz bedeutet nämlich in der Natur keineswegsbloß das Durchsetzen eigener Interessenauf Kosten anderer, sondern, wie wirbereits gesehen haben, auch die Bereitschaft<strong>zur</strong> Kooperation, zum Teilen von Ressourcen.Betrachten wir zu<strong>dem</strong> noch die Besonderheitender menschlichen Spezies, so wird dassozialdarwinistische Argument <strong>zur</strong> Rechtfertigungsozialer Ungleichheit vollends obsolet.Wenn den Menschen nämlich eine Eigenschaftin ganz besonderer Weise auszeichnet, so istes seine ausgeprägte Fähigkeit <strong>zur</strong> emotionalenPerspektivübernahme. Als Menschen könnenwir emotional nachempfinden, was anderein Notlagen durchmachen müssen, wir leiden,buchstäblich mit ihnen mit. Und dies hat weitreichendeKonsequenzen: Wir müssen nämlichsolidarisches Handeln aus Mitleid als ein fürMenschen typisches, eigennütziges Verhaltensmusterinterpretieren.Wer dies bezweifelt, sollte sich vor Augen führen,dass bereits die Fähigkeit, mitleiden zukönnen, ein Produkt eigennütziger evolutionärerÜberlebensstrategien ist. Die stete Zunahme<strong>des</strong> Gehirnwachstums, die im Verlauf derhominiden Entwicklung beobachtet werdenkann, ist nämlich vor allem darauf <strong>zur</strong>ückzuführen,dass die Träger komplexerer Gehirnewegen ihrer höheren sozialen Intelligenz Vor-6
teile gegenüber einfacher strukturierten Artgenossenbesaßen. Warum? Weil die Fähigkeit,die vielschichtigen Rollendifferenzierungeninnerhalb einer sozialen Gruppe zu durchschauenund für sich nutzbar machen zu können,einen entscheidenden Überlebensvorteilbedeutete. Das evolutionär gewachsene Empathievermögenwar die Voraussetzung fürerfolgreiches Lügen, Betrügen, Kooperierenund Intrigen-Spinnen und schuf – quasi alsNebenwirkung – die Basis für ein durch Mitleid(und Mitfreude!) motiviertes altruistisches Verhalten.23Weiß man darum, welch große BedeutungMitleid und Mitfreude für das emotionale Erlebenvon Homo sapiens haben – ein Faktum,das sich hirnphysiologisch mittlerweile anhandder Aktivität sog. „Spiegelneuronen“ 24 nachweisenlässt –, so wundert man sich nicht darüber,dass viele sozialwissenschaftliche Untersuchungeneinen signifikanten Zusammenhangvon sozialer Gleichheit und subjektivemWohlempfinden festgestellt haben. 25 Vor diesemHintergrund kann man <strong>dem</strong> großen EvolutionsbiologenStephen J. Gould nur zustimmen,wenn er schreibt, dass der Mensch dasbiologische Potential besitzt, ein besonders„kluges und freundliches Tier“ 26 zu sein.Gewiss: Es müssen spezifische Bedingungenerfüllt sein, damit sich dieses Potential gesellschaftlichentfalten kann. Die konsequenteLeugnung dieser Möglichkeit durch theoretischeund normative Biologisten zeigt jedoch,wie undifferenziert (auch im biologischen Sinne!)ihr Bild von Homo sapiens ist.2.2 Die „Hierarchie der Völker“: RassismusDie Einteilung der Menschheit in vermeintlich„nieder- und höherwertige Rassen“ ist ein uraltesPhänomen der Kulturgeschichte. Mit derfrühen Evolutionstheorie schien endlich einseriöser wissenschaftlicher Beleg für diesesVorurteil vorzuliegen. Zwar machte die Theorieklar, dass auch alle sog. „Kulturmenschen“ von„primitiveren Urformen“ abstammen, dochkonnte zugleich der Eindruck entstehen, dasssich einige Teile der Menschheit evolutionärweiterentwickelt hätten, während andere aufeiner früheren Stufe der Entwicklung stehengeblieben seien. 27 Ernst Haeckels „Hierarchieder Völker“, die wir vor allem in seinem 1905erschienen Buch „Die Lebenswunder“ findenkönnen, ist ein typisches Beispiel dieser Denkungsart.Insbesondere vor <strong>dem</strong> Hintergrund<strong>des</strong> „arischen Rassenwahns“, der nur wenigeJahrzehnte später die Welt erschütterte, erscheintuns Heutigen nicht nur die vermeintlichwissenschaftlich begründete Stufenleiter vom„niederen Wilden“ zum „höheren Kulturvolk“erschreckend, sondern auch Haeckels unverblümtgeäußerte Überzeugung, der „Lebenswert“der „niederen Wilden“ gleiche etwa <strong>dem</strong>der „Menschenaffen“. Von einer solchen Wertungist es nur ein kleiner Schritt hin <strong>zur</strong> „Rassenhygiene-Politik“der Nationalsozialisten, diesich Haeckels Ansichten zum Thema gerne zuNutzen machten. 28Dass der „Rassismus“ mit einer humanistischenEthik nicht zu vereinbaren ist, sollteevident sein. Er ist aber auch theoretisch (vorallem aufgrund der Ergebnisse der synthetischen,molekularbiologisch fundierten Evolutionstheorie,von der Haeckel selbstverständlichnoch keine Ahnung haben konnte), nicht mehraufrechtzuerhalten. Es ist schlichtweg unsinnig,von bestimmten Körpereigenschaften wieder Hautfarbe auf andere Eigenschaften derMenschen (beispielsweise ihre intellektuellenFähigkeiten) zu schließen. Zahlreiche wissenschaftlicheUntersuchungen führten zu <strong>dem</strong>nicht unerwarteten Ergebnis, dass die genetischenund phänotypischen Unterschiede innerhalbeiner sog. „Rasse“ größer sind als dieUnterschiede zwischen den „Rassen“. 29 Diesist einer der Gründe dafür, warum in der modernenwissenschaftlichen Forschung 30 (undglücklicherweise auch in der politischen Debatte31 ) der Begriff „Rasse“ mittlerweile aufgegebenwurde.2.3 „Zucht und Ordnung“:Klassische Eugenik und moderner „DNA-Fundamentalismus“Der Begriff „Eugenik“ wurde 1883 von FrancisGalton, einem Vetter Darwins, geprägt. Galtonverstand unter Eugenik ein angeblich wissenschaftlichbegründetes, sozialpolitisches Konzept,das darauf abzielte, durch „gute Zucht“den Anteil positiv bewerteter Erbanlagen in derBevölkerung zu vergrößern bzw. den Anteilnegativ bewerteter Erbanlagen zu vermindern.Dies sollte ermöglicht werden durch die Begünstigungder Fortpflanzung „Erbgesunder“(siehe beispielsweise das Projekt „Lebensborn“in der Nazizeit) sowie das konsequenteVerhindern der Fortpflanzung „Erbkranker“(Programme <strong>zur</strong> Empfängnisverhütung, Sterilisationetc.). Begründet wurde die Notwendigkeiteiner solchen „künstlichen Zuchtwahl“durch das <strong>Weg</strong>fallen natürlicher Selektionsmechanismenim Zuge <strong>des</strong> Zivilisationsprozesses.Durch die damit angeblich verbundene „Verhaustierung<strong>des</strong> Menschen“, fürchtete man,drohe eine schleichende Schädigung <strong>des</strong>Genpools, der man nur mittels staatlicherZucht-Maßnahmen („Rassehygiene“) entgegentretenkönne.7
Wie schlecht das Konzept <strong>des</strong> genetischenDeterminismus wissenschaftlich begründet ist,zeigen nicht zuletzt die Ergebnisse der modernenMolekularbiologie – und hier insbesonderedie Erforschung der sog. „epigenetischen“Prozesse. Mittlerweile wissen wir mehr überdiese „Gen-Schalter“, die verantwortlich dafürsind, dass bestimmte Teile <strong>des</strong> genetischenErbco<strong>des</strong> ausgelesen werden und anderewiederum nicht. Anders als der genetischeCode, der in der Regel ein Leben lang unverändertbleibt, sind die epigenetischen Programmeim höchsten Maße variabel. Sie erfüllengewissermaßen eine Mittlerfunktion zwischengenetischer Anlage und äußerer Umwelt,in<strong>dem</strong> sie hochsensibel auf die Signalereagieren, die vom Gehirn in Folge von Umwelteinflüssenund individuellen Erfahrungenausgesendet werden. Nimmt man diese Forschungsergebnisse<strong>zur</strong> Kenntnis, so ist esevident, dass die deterministische Vorstellung,Gene würden unbeeindruckt von äußeren Faktorendas Leben bestimmen, falsch ist. Richtigist vielmehr: Gene steuern nicht nur den Organismus,sondern werden gleichzeitig von diesemauf der Basis lebensweltlicher Erfahrungen(kulturelle Faktoren!) gesteuert. 33 Wir solltendaher das Konzept <strong>des</strong> genetischen Determinismus,welches den eugenischen, DNAfundamentalistischenVorstellungen zugrundeliegt, aufgeben und uns statt<strong>des</strong>sen mit deralternativen Idee der „biologischen Potentialität“34 anfreunden.Das heißt: Wir sollten davon ausgehen, dassuns das Erbgut (im Regelfall) einen recht breitenRahmen vorgibt, innerhalb <strong>des</strong>sen wir unsals Individuen wie als Spezies kulturell bewegenkönnen. Innerhalb dieses Rahmens existierenkeine unaufhebbaren Verhaltensvorschriften,sondern allenfalls Verhaltensvorschläge,die bestimmte Verhaltensweisen nahelegen, jedoch keineswegs erzwingen, dassdiese auch tatsächlich auftreten müssen. Außerhalbdieses Rahmens gibt es schlichtwegkein menschliches Verhalten. Selbstverständlichkann auch Homo sapiens Naturgesetzenicht überschreiten…Die korrekte Wahrnehmung <strong>des</strong> biologischvorgegebenen Rahmens ist von entscheidenderBedeutung. Ignorieren wir die Breite diesesRahmens, so laufen wir geradewegs in dieSackgasse <strong>des</strong> Biologismus, ignorieren wirhingegen, dass dieser biologische Rahmenüberhaupt existiert, so landen wir ebensoschnell auf <strong>dem</strong> Abstellgleis <strong>des</strong> Kulturismus.Beide Denkungsarten verfehlen ihr Ziel undbehindern, wie wir gleich noch sehen werden,den <strong>Weg</strong> zu einer „<strong>Einheit</strong> <strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>“.3. Jenseits von Biologismus und Kulturismus:Evolutionärer Humanismus und die„<strong>Einheit</strong> <strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>“Als Edward O. Wilson 1998 das Buch „Die<strong>Einheit</strong> <strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>“ veröffentlichte, transportierteer – leider ohne in irgendeiner Form daraufhinzuweisen – Haeckels 1899 publizierteGedanken zu einer einheitlichen, monistischenPhilosophie in die Jetztzeit. In gewisser Weisekann man Wilsons „<strong>Einheit</strong> <strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>“ alseine Fortsetzung <strong>des</strong> Haeckelschen „Welträtsel“-Buchsbegreifen. Wie schon Haeckel amEnde <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts, versuchte Wilsonam Ende <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts den falschenDualismus von Natur und Kultur, Körper undGeist, Materie und Idee aufzuheben. Auchwenn man gewiss nicht alle Urteile Wilsonsteilen muss – einige seiner Urteile zeigen deutlich,dass er sich mit den Problemen der Sozial-und Geisteswissenschaften nur sehr oberflächlichbeschäftigt hat –, sehe ich kein einzigeseinleuchten<strong>des</strong> Argument, das <strong>dem</strong> vonWilson vorgetragenen Projekt einer „<strong>Einheit</strong><strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>“ prinzipiell entgegenstehen würde.In der Tat scheint die Zeit gekommen zu sein,in der es möglich sein sollte, den tiefen Grabenzu überwinden, der zwischen den Naturwissenschafteneinerseits und den Geistes- undSozialwissenschaften andererseits entstandenist. Durch die in den letzten Jahren vorangetriebenewissenschaftliche Entzauberung <strong>des</strong>Körper-Geist-Dualismus ist die entscheidendeBarriere, die die Vereinheitlichung <strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>traditionell behinderte, bereits aus <strong>dem</strong><strong>Weg</strong> geräumt. Was nun ansteht (und was beispielsweiseauf <strong>dem</strong> Gebiet der Hirn- und Bewusstseinsforschungschon heute vorbildlichpraktiziert wird), ist der Versuch eines gemeinsamenBrückenbaus über den Graben hinweg,an <strong>dem</strong> sich nicht nur Naturwissenschaftler,sondern auch Sozial- und Geisteswissenschaftlermit ihrem jeweils spezifischen Knowhowbeteiligen sollten.Von einem derartigen „transdisziplinären Brückenbau“könnten im Übrigen beide <strong>Wissens</strong>chaftskulturenprofitieren: Eine naturalistischeGrundierung der Sozial- und Geisteswissenschaftenwürde verhindern, dass sich diese inempirisch haltlosen, konstruktivistischen Spekulationenergehen (Stichwort „eleganter Unsinn“).35 Eine geistes- bzw. sozialwissenschaftlicheDurchdringung der Naturwissenschaftenkönnte im Gegenzug <strong>dem</strong> bei Naturwissenschaftlernhäufig anzutreffenden „naiven Positivismus“entgegenwirken, der <strong>zur</strong> Folge hat,dass viele Naturwissenschaftler weitgehendignorieren, dass auch ihre Erkenntnisse imsozialen Setting „fabriziert“ werden 36 und somit9
sowohl gesellschaftliche Voraussetzungen alsauch gesellschaftliche Konsequenzen haben.3.1 Die Gefahr <strong>des</strong> kulturistischen FehlschlussesIch bin überzeugt, dass der transdisziplinäreBrückenbau hin zu einer „<strong>Einheit</strong> <strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>“gelingen kann, wenn wir uns künftig weder vonbiologistischen noch von kulturistischen Engführungender Argumentation leiten lassen. Daich im letzten Teil meiner Ausführungen bereitsauf den „Biologismus“ eingegangen bin, will ichmich nachfolgend kurz mit <strong>dem</strong> oftmals verdrängtenPhänomen <strong>des</strong> „Kulturismus“ beschäftigen.• Ich fasse unter <strong>dem</strong> Begriff „theoretischerKulturismus“ all jene Weltdeutungsmuster,die menschliche Verhaltensweisenoder gesellschaftliche Zusammenhängewesentlich über kulturelleFaktoren zu erklären versuchen,ohne dabei die fundamentalen biologischenGesetzmäßigkeiten (die Erkenntnisseder Evolutionsbiologie, derGenetik und Hirnforschung etc.) in angemessenerWeise zu berücksichtigen.• Der „normative Kulturismus“ zeichnetsich dadurch aus, dass er aus solchenkulturistischen Interpretationen politischeSollenssätze ableitet. Normativkulturistisch sind beispielsweise gesellschaftspolitischeProgramme, dieden Menschen (als Spezies wie als Individuum)als „beliebig formbar“ begreifen(also die biologischen Eigenartenunserer Spezies und auch die biologischenUnterschiede zwischen denIndividuen, etwa unterschiedliche Begabungen,unzulässig ausblenden).Normativer Kulturismus zeigt sich auchin der diffamierenden Abwehr gegenüberwissenschaftlichen Erkenntnissen,die <strong>dem</strong> vorherrschenden weltanschaulichenIdeologiesystem widersprechen.(Beispiele für diese Denkungsart<strong>des</strong> „Es kann nicht sein, wasnicht sein darf“ sind u.a. die Ablehnung<strong>des</strong> kopernikanischen Weltbil<strong>des</strong> oderder Evolutionstheorie durch die Offenbarungsreligionenoder die zeitweiseVerbannung der Relativitätstheorie aus<strong>dem</strong> Kanon der marxistischleninistischen<strong>Wissens</strong>chaften.)Wenn der „naturalistische Fehlschluss“ mitgutem Recht als unzulässig kritisiert wird, somuss man das Gleiche auch im Falle <strong>des</strong> „kulturistischenFehlschlusses“ tun. Schließlichsind beide Fehlschlüsse hochgradig miteinanderverwandt, ihr Unterschied liegt allein in derUmkehrung der logischen Fehlleistung: Bestehtder „naturalistische Fehlschluss“ darin,dass aus einem (unterstellten) „Sein“ ein „Sollen“abgeleitet wird, so wird im Falle <strong>des</strong> „kulturistischenFehlschlusses“ aus einem „Sollen“abgeleitet, was als adäquate Beschreibung<strong>des</strong> „Seins“ zu gelten hat.Kulturistische Fehlschlüsse haben die Naturwissenschaftendurch ihre ganze Geschichtehindurch begleitet. Traurigerweise sind sielängst nicht ausgestorben, sondern feiern geradegegenwärtig eine große Renaissance. Sowerden etwa Soziobiologen dafür angegriffen,dass sie „Vergewaltigung“ und „Kindstötung“als genetisch eigennützige, evolutionäre Überlebensstrategienbeschreiben. Dass die Forschermit derartigen Analysen keineswegsVergewaltigung und Kindstötung ethisch legitimierenwollen, übersehen Kulturisten ebensogerne wie die Tatsache, dass gerade durch die<strong>Auf</strong>deckung solcher biologischer Grundmusterdie Chancen steigen, dass wir wirksamerekulturelle Gegenmaßnahmen ergreifen können,um derartig unerwünschte Verhaltensweiseneinzudämmen.Naturalistischer Fehlschluss:SEIN → SOLLEN„Was (empirisch) ist,soll auch (normativ) sein!“„Was nicht (empirisch) ist,darf auch (normativ) nicht sein!“Kulturistischer Fehlschluss:SOLLEN → SEIN„Es kann nicht (empirisch) sein,was (normativ) nicht sein darf!“„Es muss (empirisch) sein,was (normativ) sein soll!“Selbstverständlich: Nicht nur Soziobiologenwurden <strong>zur</strong> Zielscheibe kulturistischer Angriffe.Insbesondere jene Hirnforscher, die die „heiligeKuh der Geisteswissenschaft“, die Willensfreiheitsidee,antasteten, sahen sich ähnlichenAttacken ausgesetzt. Man konnte es Singer,Roth & Co. offenbar nicht verzeihen, dass sieForschungsergebnisse präsentierten, die deremphatischen Rede vom sog. „freien Willen“10
diversen „linken Organen“ 42 , ist auch dieser mit<strong>dem</strong> evolutionären Humanismus nicht zu vereinbaren– schon allein <strong>des</strong>halb nicht, weil einebiologistische Beschreibung wissenschaftlichenKriterien heute nicht mehr genügen kann.Pointiert formuliert: Biologismus ist Ausdruck„schlechter Biologie“. Wer biologistisch argumentiert,der argumentiert nur unvollkommenbiologisch, da er verkennt, dass kulturelle Faktorenerwiesenermaßen (epigenetische Prozesse!)eine ungeheure Bedeutung für dieFunktionsweise <strong>des</strong> menschlichen Organismushaben. Im Falle <strong>des</strong> Kulturismus verhält essich ganz ähnlich: Eine sozial- oder geisteswissenschaftlicheBeschreibung menschlicherEigenschaften oder Aktivitäten, die deren biologischeFundamente ignoriert, ist Ausdruckschlechter Sozial- oder Geisteswissenschaft.Wer kulturistisch argumentiert, kommt am Endezu falschen Schlüssen, da er verkennt,dass die menschliche Kultur nichts weiter istals eine spezifische Ausdrucksform der Natur.Unter der Perspektive <strong>des</strong> „vernetzten Wissen“wird deutlich, dass Biologismus und Kulturismuseinander verstärkende Wahrnehmungsverzerrungensind. Beide leiden unter <strong>dem</strong>gleichen Defizit, nämlich einer weitgehendenIgnoranz gegenüber der unaufhebbaren Verwobenheitvon Natur und Kultur. In<strong>dem</strong> derevolutionäre Humanismus sich deutlich jenseitsvon Biologismus und Kulturismus positioniert,stellt er sich entschieden hinter das Projekteiner „<strong>Einheit</strong> <strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>“. In gewisserWeise geht er über dieses ambitionierte wissenschaftlich-philosophischeProjekt nochhinaus, denn er strebt neben einer Vereinheitlichung<strong>des</strong> <strong>Wissens</strong> zusätzlich eine Vernetzung(keine Gleichsetzung!) von wissenschaftlicherTheorie und ethisch-politischer Praxisan. Die moderne Synthese <strong>des</strong> „evolutionärenHumanismus“ erstreckt sich also nicht nur aufden Bereich <strong>des</strong> Denkens, sondern auch aufden Bereich <strong>des</strong> Handelns.3.3 CodaIch gebe zu: Obiges mag unbescheiden klingen.Um diesen Eindruck zum Abschluss dochnoch etwas zu mildern, seien einige relativierendeAnmerkungen hinzugefügt:Selbstverständlich (wer wollte dies bestreiten?)sind wir von einer „<strong>Einheit</strong> <strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>“ (geschweigedenn: von einer „<strong>Einheit</strong> <strong>des</strong> Denkensund Handelns“) noch immer meilenweitentfernt. Der von C.P.Snow beschriebeneGraben zwischen den „zwei Kulturen“, nämlichder naturwissenschaftlichen und der geisteswissenschaftlichenTradition, ist – trotz derheute weit günstigeren Datenlage - längst nochnicht geschlossen. 43 Auch eine allseits befriedigendeLösung der sog. „Welträtsel“, die Haeckelim Übereifer bereits vor hundert Jahrenentdeckt zu haben glaubte, ist noch nicht inSicht. Wir wissen heute zwar vieles genauer,als es Haeckel Ende <strong>des</strong> 19. Jahrhundertswissen konnte, und so manche Lösung scheintzumin<strong>des</strong>t im Ansatz (wenn auch nicht im Detail)durchaus geglückt zu sein, doch gibt eszahlreiche Phänomene, vor denen wir immernoch ziemlich ratlos dastehen.Ein gutes Beispiel hierfür ist Haeckels „drittesWelträtsel“, die Entstehung <strong>des</strong> Lebens. Zwarkönnen wir mittlerweile experimentell nachvollziehen,auf welche Weise vor Jahrmilliardenaus anorganischen Substanzen organischeentstanden sind 44 , doch wie sich aus diesenorganischen Substanzen letztlich die erstenLebensformen entwickelten und somit das„Prinzip Eigennutz“ in die Welt Einzug hielt, istkeineswegs vollständig geklärt. 45 Trotz allerbedeutenden Erfolge steckt die <strong>Wissens</strong>chaftnoch immer in den Kinderschuhen, viele Phänomenesind unerforscht und manch großesGeheimnis der Natur werden wir wahrscheinlichniemals lüften können.Doch sollten wir <strong>des</strong>halb keineswegs verzagenund schon gar nicht die Leistungen vorangegangenerForschergenerationen gering schätzen.Fest steht: Ernst Haeckels „monistischePhilosophie“ 46 wies trotz ihrer zeitbedingtenFehler und auch trotz all der schrecklichenKatastrophen, die der normative Biologismusim 20. Jahrhundert auslösen sollte, in vielenPunkten sehr wohl in die richtige Richtung. Wirwären <strong>des</strong>halb gut beraten, den 100. Geburtstag<strong>des</strong> Deutschen Monistenbun<strong>des</strong> 47 , derden Hintergrund der hier vorgestellten Überlegungenbildet 48 , zum Anlass zu nehmen, dievielfältigen produktiven Impulse, welche vomMonismus ausgingen, kritisch 49 wieder aufzugreifenund für das 21. Jahrhundert fruchtbarzu machen. 50 Hierfür müssten wir den Monismussowohl von seinem biologistischen Ballastbefreien als auch gegen kulturistische Ressentimentsverteidigen. Dies wäre nicht nur einwertvoller Beitrag <strong>zur</strong> Rehabilitierung einereinst höchst vitalen, durch die Nazityranneiabrupt abgewürgten Kulturströmung, sondernmehr noch: ein wichtiger Schritt hin <strong>zur</strong> „<strong>Einheit</strong><strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>“ sowie <strong>zur</strong> Entwicklung einersoliden, philosophisch wie wissenschaftlichentragfähigen Theorie <strong>des</strong> Humanismus…12
Anmerkungen1 Haeckel, Ernst: Die Welträtsel. GemeinverständlicheStudien über Monistische Philosophie.Bonn 1899.2 Wilson, Edward O.: Die <strong>Einheit</strong> <strong>des</strong> <strong>Wissens</strong>.Berlin 1998.3 Vgl. hierzu u.a. Wuketits, Franz M.: Darwinund der Darwinismus. München 2005, S.51ff.4Eine deutsche Ausgabe dieses Biologie-Klassikers erschien unlängst im Harri DeutschVerlag, Lamarck, Jean-Baptiste de: ZoologischePhilosophie. Frankfurt/M. 2002.5 Zwar gibt es neuerdings empirische Befunde,die auf eine epigenetische Vererbung erworbenerEigenschaften schließen lassen, dochsind diese weder hinlänglich gesichert, nochkönnte man über sie die Entstehung neuerArten erklären.6 Darwin, Charles: Über die Entstehung derArten durch natürliche Zuchtwahl oder dieErhaltung der begünstigten Rassen im Kampfeum's Dasein. Nach der letzten englischenAusgabe wiederholt durchgesehen von J. VictorCarus, 9. <strong>Auf</strong>lage, Stuttgart 1899, S. 5657 Von besonderer Bedeutung ist hier HuxleysBuch "Evidence as to Man's Place in Nature"(1863), Deutsche Ausgabe: Zeugnisse für dieStellung <strong>des</strong> Menschen in der Natur. Stuttgart1970. Haeckel hatte sich ebenfalls bereits1863 in Vorträgen eindeutig zum Thema geäußert.Seine große Monographie „Anthropogenieoder Entwicklungsgeschichte <strong>des</strong> Menschen“erschien jedoch erst 1874.8 Vgl. hierzu u.a. das Vorwort von Josef H.Reichholf zu Darwin, Charles: Die Abstammung<strong>des</strong> Menschen. Frankfurt/M. 2005.9 Vgl. hierzu u.a. Kutschera, Ulrich: Evolutionsbiologie.Eine allgemeine Einführung. Berlin2001, S.31f.10 Vgl. Kutschera 2001, S. 32ff.11 Siehe beispielsweise Lorenz, Konrad: Dassogenannte Böse – Zur Naturgeschichte derAggression. Wien 1963.12 Dawkins’ Bestseller „The Selfish Gene“ erschienerstmals 1976 und wurde 1989 nocheinmal grundlegend überarbeitet. Die deutscheAusgabe wurde im Rowohlt-Verlag publiziert.13 Nicht ohne Grund zählt Hamiltons 1964 erschienener,zweiteiliger Beitrag „The geneticalevolution of social behavior“ im „Journal forTheoretical Biology“ zu den meist zitiertesten<strong>Auf</strong>sätzen der gesamten biologischen Fachliteratur.14 Vgl. hierzu u.a. Voland, Eckart: Grundrissder Soziobiologie. Heidelberg 2000, S. 5f.15 Vgl. u.a. Gould, Stephen J.: Darwin nachDarwin. Naturgeschichtliche Reflexionen.Frankfurt/M. 1984, S.195ff.16 Gould 1984, S.223.17 Vgl. u. a. Sigmund, Karl: Spielpläne. Zufall,Chaos und die Strategien der Evolution. Hamburg1999; Axelrod, Robert: Die Evolution derKooperation. München 1997.18 Zum Thema „Infantizid“ siehe u.a. Voland2000, S.59ff. und 182ff.19 Vgl. Uhl, Matthias; Voland, Eckart: Angeberhaben mehr vom Leben. Heidelberg 2002.20 Ich verweise in diesem Zusammenhang aufdie entsprechende Literatur, vor allem Voland2000, sowie (weniger ausführlich, aber alsEinführung gut geeignet) Wuketits, Franz M.:Was ist Soziobiologie? München 2001.21 Vgl. vor allem Gould: Stephen J.: IllusionFortschritt. Die vielfältigen <strong>Weg</strong>e der Evolution.Frankfurt/M. 1998; sowie Wuketits, Franz M.:Naturkatastrophe Mensch. Evolution ohneFortschritt. Düsseldorf 1998.22 Vgl. hierzu <strong>Schmidt</strong>-<strong>Salomon</strong>, <strong>Michael</strong>: Manifest<strong>des</strong> evolutionären Humanismus. Plädoyerfür eine zeitgemäße Leitkultur. Aschaffenburg2005, S.93ff.23 Nebenbei: Dass wir eher zu Mitleid als zuMitfreude tendieren, ist ebenfalls über denEigennutz begründet. Warum? Weil, wie schonLudwig Marcuse pointiert feststellte, „im Mit-Leid die Freude dabei ist, dass wir nur teilzunehmenbrauchen; in der Mit-Freude hingegendas Leid, dass wir nur teilnehmen dürfen“.(Marcuse, Ludwig: Argumente und Rezepte.Ein Wörterbuch für Zeitgenossen. Zürich 1973,S. 84)24 Diese „Spiegelneuronen“ werden bei derBeobachtung Anderer aktiv, sie simulierengewissermaßen die hirnphysiologischen Vorgänge,die stattfinden würden, wenn das Individuumvon der beobachteten Aktion selbstbetroffen wäre. 1996 wurde die Existenz derSpiegelneuronen erstmalig von <strong>dem</strong> italienischenHirnforscher Giacomo Rizzolatti beiPrimaten nachgewiesen. Forscher von derUniversity of California in Los Angeles belegtenspäter deren Arbeitsweise auch immenschlichen Gehirn. Sie zeigten u. a. auf,dass sensorische Zellen im Gehirn, die auf13
Schmerzsignale reagieren, auch dann „feuerten“,wenn Menschen bloß ansehen mussten,dass eine andere Person mit einer Nadel gepiekstwurde. <strong>Auf</strong> der Grundlage dieser Faktenhat der Neurowissenschaftler Vilayanur Ramachandrandie Spiegelneuronen als „Empathie-Zellen“ bezeichnet und ihre Existenz als wesentlicheVoraussetzung für die Entwicklungmenschlicher Ethik und Kultur beschrieben(vgl. zu diesem Themenkomplex u.a.: Bauer,Joachim: Warum ich fühle, was du fühlst. IntuitiveKommunikation und das Geheimnis derSpiegelneurone. Hamburg 2005).25 Vgl. u.a. Klein, Stefan: Die Glücksformel –oder: Wie die guten Gefühle entstehen. Reinbek2002, S. 260ff26 Gould 1984, S.220f.27 Diese Vorstellungen können natürlich nurunter der Voraussetzung als theoretisch stimmigerscheinen, dass man von der LamarckschenThese der „Vererbung erworbener Eigenschaften“ausgeht. Denn nur dann wäre estheoretisch denkbar, dass sich die verschiedenen„Völker“ in der verhältnismäßig kurzenSpanne der kulturellen Evolution in signifikanterWeise genetisch voneinander weg entwickelthätten. Dieses Konstrukt wurde aberschon von den Verfechtern der SynthetischenEvolutionstheorie als grundlegend falsch abgewiesen.28 Vgl. u.a. Wuketits, Franz M.: Eine kurzeKulturgeschichte der Biologie. Darmstadt 1998,S. 114ff.29 Vgl. u.a. Stephen Jay Gould: Der falschvermessene Mensch. Birkhäuser, Basel 1983,Suhrkamp, Stuttgart 2002.30 Vgl. u.a. Cavalli-Sforza, Luca und Francesco:Verschieden und doch gleich. Ein Genetikerentzieht <strong>dem</strong> Rassismus die Grundlage.München 1996.31 Vgl. beispielsweise die „UNESCO-Erklärunggegen den ‚Rasse’-Begriff“ (verabschiedet imVorfeld der UNESCO-Konferenz „Gegen Rassismus,Gewalt und Diskriminierung“ 1995.)32 Über die überspitze Darstellung Robin Bakers(beispielsweise in „Krieg der Spermien“(Bergisch Gladbach 1999)) mag man nochhumorvoll hinwegsehen. Dies gilt jedoch nichtfür die von konservativ-ideologischen, mitunteroffen rassistischen Vorurteilen getragenenStudien von Arthur Jensen oder RichardHerrnstein und Charles Murray („The Bell Curve“),die u.a. von Stephen J. Gould und RichardLewontin zu Recht scharf kritisiert wurden.Allerdings: So berechtigt die Kritik an denkonservativen Hardlinern Jensen & Co. auchist, so wäre es doch unsinnig, sie auf die Soziobiologieauszudehnen, da diese sehr wohl mit<strong>dem</strong> Gouldschen Konzept einer „biologischenPotentialität“ zu vereinbaren ist. Leider gab esin dieser Hinsicht (durchaus auch provoziertdurch Lewontin und Gould) einige gravierendeMissverständnisse.33 Vgl. u.a. Bauer, Joachim: Das Gedächtnis<strong>des</strong> Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstileunsere Gene steuern. München 2004.34 Vgl. Gould 1984, S. 211ff.35 Vgl. Sokal, Alan / Bricmont, Jean: EleganterUnsinn. Wie die Denker der Postmoderne die<strong>Wissens</strong>chaften missbrauchen. München1999.36 Vgl. u.a. Knorr-Cetina, Karin: Die Fabrikationvon Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft.Frankfurt/M. 2001.37 Vgl. hierzu <strong>Schmidt</strong>-<strong>Salomon</strong>, <strong>Michael</strong>: Vonder illusorischen <strong>zur</strong> realen Freiheit. AutonomeHumanität jenseits von Schuld und Sühne. In:Liessmann, Konrrad Paul (Hrsg.): Die Freiheit<strong>des</strong> Denkens. Wien 2007.38 Habermas, Jürgen: Zwischen Naturalismusund Religion. Philosophische <strong>Auf</strong>sätze. Frankfurt2005.39 Vgl. beispielsweise Nida-Rümelin, Julian:Humanismus als Leitkultur. München 2006, S.30ff.40 Vgl. <strong>Schmidt</strong>-<strong>Salomon</strong> 2005.41Huxley, Julian: Die Grundgedanken <strong>des</strong>evolutionären Humanismus. In: Huxley, Julian(Hrsg.): Der evolutionäre Humanismus. ZehnEssays über die Leitgedanken und Probleme.München 1964.42 Manche Vertreter der „dogmatischen Linken“haben – durchaus nicht unerwartet – gegendas „Manifest <strong>des</strong> evolutionären Humanismus“den Biologismus-Vorwurf erhoben. Sie begingendabei den Fehler, die berechtigte scharfeKritik am Sozialdarwinismus bzw. an philosophischenFehlinterpretationen der Soziobiologiein grotesker Weise zu übergeneralisieren.In dieser Lesart musste der „evolutionäre Humanismus“zu einer „brutalen Herrschaftsideologie“mutieren. Offensichtlich genügten beieinigen „linken Kritikern“ schon „verdächtigeStichworte“ wie „Evolution“, „Eigennutz“ oder„Tierrechte“ bzw. die Zitation „umstrittenerAutoren“ wie Richard Dawkins oder Peter Sin-14
ger, um heftigste Aversionsreflexe auszulösen.Nach der Devise „Stimmung statt Argumente“verzichteten sie auf eine differenzierte Analyse,ja, sie unternahmen nicht einmal den Versuch,„Biologismus“ theoretisch zu fassen unddamit ihren Vorwurf zu begründen. Ich hoffe,dass die hier vorgelegten Anmerkungen zuBiologismus und Kulturismus zumin<strong>des</strong>t voneinigen dieser Kritiker wahrgenommen werden.43 siehe Snow, C.P.: Die zwei Kulturen. In:Kreuzer, Helmut (Hrsg.): Die zwei Kulturen.Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz.München 1987.44 Von großer Bedeutung sind in diesem Zusammenhangdie berühmten Experimente <strong>des</strong>amerikanischen Biochemikers Slanley L. Millerin den 1950er Jahren.45 Es gibt hierzu zweifellos interessante Hypothesen,die in Teilen auch experimentell bestätigtwurden. Eine vollständige Erklärung <strong>des</strong>Phänomens müsste es aber gewährleisten,„Leben“ im Labor zu erzeugen. Dies ist bislangkeinem Forscher gelungen.46 Vgl. Haeckel 1899.47 Der Deutsche Monistenbund, der maßgeblichdurch die Gedanken Haeckels beeinflusstwurde,. wurde 1906 in Jena gegründet undentwickelte sich schnell zu einem der größtenfreidenkerischen Verbände Europas. 1933wurde der Bund von den Nationalsozialistenaufgelöst. 1946 erfolgte die Neugründung als„Freigeistige Aktion - Deutscher Monistenbund“.Allerdings konnte der Monismus niewieder die Bedeutung erlangen, den er imVorfeld der Nazityrannei hatte.48 Der vorliegende Artikel folgt einem Vortrag<strong>des</strong> Verfassers auf <strong>dem</strong> Kolloquium „Der ‚Gegenpapst’löste die ‚Welträtsel` - MonismusEvolutionstheorie und Humanismus“, das vonder Humanistischen Aka<strong>dem</strong>ie Berlin im März2006 anlässlich <strong>des</strong> 100. Geburtstages <strong>des</strong>Deutschen Monistenbun<strong>des</strong> veranstaltet wurde.49 Leider wirkte der Monismus nicht nur in progressiver(beispielsweise libertärsozialistischer)Weise, sondern hatte auchunverkennbar reaktionäre (nationalistische,rassistische) Tendenzen. Zu<strong>dem</strong> ist zu beachten,dass nur ein Teil <strong>des</strong> monistischen Weltbil<strong>des</strong>Haeckels wissenschaftlich begründetwar. Gerade seine späteren Werke enthaltenreichlich esoterisches Gedankengut.50 In gewissem Sinne lässt sich das von derGiordano Bruno Stiftung verfolgte Projekt einer„Förderung <strong>des</strong> evolutionären Humanismus“als eine kritische Wiederaufnahme der monistischenDenktradition begreifen. Dass sichder Verfasser und auch die Stiftung dabei vonallen biologistischen, nationalistischen, esoterischenAspekten <strong>des</strong> traditionellen Monismusin aller Deutlichkeit distanzieren, sollte, sohoffe ich, spätestens nach der Lektüre <strong>des</strong>vorliegenden Artikels klar geworden sein.Der vorliegende Text ist in leicht veränderterForm als Band 1 der „Schriftenreihe derGiordano Bruno Stiftung“ (ISBN 978-3-86569-200-9) erschienen. Wer aus derSchrift zitieren möchte, sollte auf die gedruckteFassung <strong>zur</strong>ückgreifen.15