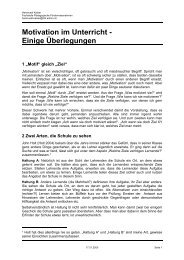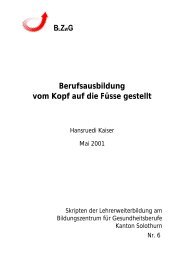Ausführlicher als pdf - hrkll.ch
Ausführlicher als pdf - hrkll.ch
Ausführlicher als pdf - hrkll.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt: Beispiel Kö<strong>ch</strong>esammenfliessen. Au<strong>ch</strong> diese Entwicklung ist ni<strong>ch</strong>t untypis<strong>ch</strong>: Man<strong>ch</strong>mal sind Traditioneneinfa<strong>ch</strong> zu stark, <strong>als</strong> dass sie einfa<strong>ch</strong> so überwunden werden könnten.4 Die Bes<strong>ch</strong>reibung der SituationenDie Bes<strong>ch</strong>reibung der Situationen spielte si<strong>ch</strong> etwas anders ab, <strong>als</strong> im Leitfaden vorges<strong>ch</strong>lagen.Im Wesentli<strong>ch</strong>en ges<strong>ch</strong>ah sie direkt über die Erstellung der Lernumgebungen, d.h. eswurden keine Bes<strong>ch</strong>reibungen im der Form Konkreter Kompetenzen erstellt.Die Lernumgebungen, die im Laufe dieses Prozesses entstanden sind, halten si<strong>ch</strong> im Wesentli<strong>ch</strong>enan den im Leitfaden vorges<strong>ch</strong>lagenen Aufbau. Sie können alle vonhttp://www.hotelgastro.<strong>ch</strong>/download.cfm?ID_n=250 heruntergeladen werden. Sie finden si<strong>ch</strong>auf der unteren Hälfte der Seite. Dort findet man au<strong>ch</strong> zu jeder Lernumgebung eine didaktis<strong>ch</strong>eKurzanleitung.Der Ablauf war so, dass i<strong>ch</strong> mir jede Situation genau s<strong>ch</strong>ildern liess und kritis<strong>ch</strong> immer wiederna<strong>ch</strong>fragte, ob denn nun wirkli<strong>ch</strong> in der alltägli<strong>ch</strong>en Praxis so vorgegangen wird. Aufgrunddieser S<strong>ch</strong>ilderungen, die i<strong>ch</strong> mir sti<strong>ch</strong>wortartig notierte, erstelle i<strong>ch</strong> Entwürfe für Lernumgebungenzu den einzelnen Situationen. Diese Entwürfe dienten dann <strong>als</strong> Grundlage,um die einzelnen Situationen, die notwendigen Ressourcen, die angestrebte Kompetenz etc.dur<strong>ch</strong>zudiskutieren.Parallel zu dieser Arbeit fertigte i<strong>ch</strong> zu jeder Situation au<strong>ch</strong> eine didaktis<strong>ch</strong>e Kurzanleitungan, die jeweils au<strong>ch</strong> eine Bes<strong>ch</strong>reibung der Situation und der damit verbundenen zentralenmathematis<strong>ch</strong>en Herausforderungen und Werkzeuge enthält.Dieses Vorgehen ergab si<strong>ch</strong>, da von Anfang an geplant war, zu jeder Situation eine Lernumgebungzu entwickeln. Es erwies si<strong>ch</strong> <strong>als</strong> äusserst fru<strong>ch</strong>tbar, d.h. die Situationen konntenanhand der Entwürfe zu den Lernumgebungen sehr ans<strong>ch</strong>auli<strong>ch</strong>e und zielgeri<strong>ch</strong>tet diskutiertwerden. Jeder Entwurf dur<strong>ch</strong>lief drei bis vier Revisionszyklen in deren Verlauf si<strong>ch</strong> immerklarer herausbildete, was in der jeweiligen Situation im berufli<strong>ch</strong>en Alltag tatsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> ges<strong>ch</strong>iehtund wie dieses Ges<strong>ch</strong>ehen mathematis<strong>ch</strong>/re<strong>ch</strong>neris<strong>ch</strong> unterstützt werden kann.5 Die Situationsbes<strong>ch</strong>reibungenIm Folgenden sind lei<strong>ch</strong>t ergänzt die jeweiligen Auss<strong>ch</strong>nitte aus den didaktis<strong>ch</strong>en Kurzanleitungenzusammengestellt, in denen die Situationen bes<strong>ch</strong>reiben werden. Die vollständigendidaktis<strong>ch</strong>en Kurzanleitungen können vonhttp://www.hotelgastro.<strong>ch</strong>/download.cfm?ID_n=250 heruntergeladen werden. Sie finden si<strong>ch</strong>auf der unteren Hälfte der Seite.A. ZeitmanagementIm Prinzip geht es beim Zeitmanagement um eine Prozessplanung – eine unter Umständenhö<strong>ch</strong>st komplexe und mathematis<strong>ch</strong> anspru<strong>ch</strong>svolle Angelegenheit. Dafür gilt es den Lernendeneinfa<strong>ch</strong>e, praxistaugli<strong>ch</strong>e Werkzeuge in die Hand zu geben.Im Prinzip spielen folgende Aspekte der Situation eine Rolle:A. Die Dauer jedes einzelnen S<strong>ch</strong>rittes in Vorbereitung, Zubereitung und Fertigung/Anri<strong>ch</strong>tenB. Die Vorhandenen Ressourcen (Personen, Geräte), aus denen si<strong>ch</strong> ergibt, wel<strong>ch</strong>eS<strong>ch</strong>ritte parallel bzw. ni<strong>ch</strong>t parallel ausgeführt werden könnenC. Die Abhängigkeit einzelner S<strong>ch</strong>ritte von anderen, vorher zu erledigenden S<strong>ch</strong>rittenD. Die einzuhaltenden zeitli<strong>ch</strong>en Fixpunkte (S<strong>ch</strong>ickzeiten)Ohne übermässigen Aufwand lassen si<strong>ch</strong> die vers<strong>ch</strong>iedenen Aspekte mit folgendem dreis<strong>ch</strong>rittigemVerfahren berücksi<strong>ch</strong>tigen:www.<strong>hrkll</strong>.<strong>ch</strong> 4 16.05.2013
Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt: Beispiel Kö<strong>ch</strong>eI. Mehr oder weniger präzise Abs<strong>ch</strong>ätzung der Dauer der einzelnen S<strong>ch</strong>ritte (A).II. Intuitives Aneinanderreihen der S<strong>ch</strong>ritte rückwärts, ausgehend von den gegebenenFixpunkten und unter Berücksi<strong>ch</strong>tigung der vorhandenen Abhängigkeiten (B, C,D).III. Gedankli<strong>ch</strong>es Dur<strong>ch</strong>spielen des Prozesses, testen auf übersehene Abhängigkeiten,allenfalls Reserven einbauen oder zu grosszügige Zeitspannen kürzen.Im praktis<strong>ch</strong>en Alltag wird dieser Dreis<strong>ch</strong>ritt oft ohne grossen Aufwand und bei einiger Routinesogar im Kopf ablaufen können. In komplexeren Situationen, wie ein Bankett oder dieAbs<strong>ch</strong>lussprüfung, kann eine s<strong>ch</strong>riftli<strong>ch</strong>e bzw. graphis<strong>ch</strong>e Planung sinnvoll sein.Die Lernumgebung bietet daher zwei Werkzeuge an: Eine einfa<strong>ch</strong>e tabellaris<strong>ch</strong>e Planung(oben re<strong>ch</strong>ts) und eine graphis<strong>ch</strong>e Darstellung (Mitte). Grundsätzli<strong>ch</strong> wäre für die meistenFälle die einfa<strong>ch</strong>e Tabelle das Werkzeug der Wahl. Graphis<strong>ch</strong> ist aber selbstverständli<strong>ch</strong> dieandere Darstellung attraktiver und so dominiert sie ein biss<strong>ch</strong>en zu Unre<strong>ch</strong>t das Bild.Die eigentli<strong>ch</strong>e Herausforderung der Situation ist weniger der S<strong>ch</strong>ritt II oben (das Aneinanderreihender benötigten Zeiten), sondern das Abs<strong>ch</strong>ätzen das einzelnen Zeit. Die Lernumgebungwidmet daher diesem Punkt au<strong>ch</strong> viel Platz. Links werden typis<strong>ch</strong>e Zeiten thematisiert,re<strong>ch</strong>ts werden diese Dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittszeiten dann eher wieder problematisiert. Dies entspri<strong>ch</strong>tder Idee, dass die Lernenden in die Situation eintau<strong>ch</strong>en und anhand von „harten“Fakten die Instrumente erproben sollen, bevor dann die Grenzen und Unsi<strong>ch</strong>erheiten desganzen Vorgehens thematisiert werden.B. Rezeptangaben umre<strong>ch</strong>nenDie Situation ist vermutli<strong>ch</strong> den meisten Lernenden vertraut.Das traditionell in der S<strong>ch</strong>ule für das Umre<strong>ch</strong>nen von Rezepten behandelte mathematis<strong>ch</strong>eWerkzeug ist der Dreisatz. Die Fors<strong>ch</strong>ung zeigt nun aber, dass erfahrene Personen in derPraxis kaum je Dreisatzre<strong>ch</strong>nungen einsetzen. Ihr bevorzugtes Instrument ist viel mehr dieOperation mit zwei parallelen Skalen. Nehmen wir an, in einem Rezept für 10 Personen werden800 Gramm Zucker verlangt. Es soll für 25 Personen geko<strong>ch</strong>t werden.Personen Zucker g5 40010 80020 1’60025 2’000Ausgangspunkt ist das Zahlenpaar 10/800. Eine Verdopplung führt zu 20/1'600. Es fehlenno<strong>ch</strong> 5 Personen, was die Hälfte von 10/800 ist (5/400), so dass si<strong>ch</strong> <strong>als</strong> Resultat das Paar25/2'000 ergibt.Gegenüber dem Dreisatz hat dieses Verfahren unter anderem den Vorteil, dass es viel wenigeranfällig auf grobe Fehler ist. Die ungefähre Grössenordnung bleibt die ganze Zeit imBlickfeld und es entstehen keine s<strong>ch</strong>wer interpretierbaren Zwis<strong>ch</strong>enresultate. Das Verfahrenkann au<strong>ch</strong> sehr gut eingesetzt werden, um die Korrektheit eines mit me<strong>ch</strong>anis<strong>ch</strong>en Hilfsmitteln(Tas<strong>ch</strong>enre<strong>ch</strong>ner, Kalkulationssoftware) errei<strong>ch</strong>ten Resultates abzus<strong>ch</strong>ätzen.Entspre<strong>ch</strong>end wird hier <strong>als</strong> Hauptinstrument eine tabellaris<strong>ch</strong>e Darstellung angeboten (re<strong>ch</strong>tsoben). Zwei Beispiele regen an, diese zu erproben. Am flexibelsten sind die Lernenden,wenn sie die entspre<strong>ch</strong>enden Umre<strong>ch</strong>nungen im Kopf übers<strong>ch</strong>lagen können. Die linke Seitewww.<strong>hrkll</strong>.<strong>ch</strong> 5 16.05.2013
Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt: Beispiel Kö<strong>ch</strong>eregt an, das zu probieren und au<strong>ch</strong> si<strong>ch</strong> selbst mit einfa<strong>ch</strong>eren und s<strong>ch</strong>wierigeren Aufgabenherauszufordern.C. Verlustre<strong>ch</strong>nungWährend der Verarbeitung von Rohstoffen treten über vers<strong>ch</strong>iedene Stufen hinweg Gewi<strong>ch</strong>tsverlusteauf (Rüstverlust, Garverlust, etc.). Die dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittli<strong>ch</strong>en Gewi<strong>ch</strong>tsverlustesind bekannt und können entspre<strong>ch</strong>enden Tabellen entnommen werden (z.B. Pauli).Re<strong>ch</strong>neris<strong>ch</strong> liegt die S<strong>ch</strong>wierigkeit darin, dass Verluste auf dem Weg vom Ausgangsproduktzum Endprodukt entstehen. Ist die Menge des Ausgangsproduktes gegeben, kann manlei<strong>ch</strong>t die Menge des Endproduktes bere<strong>ch</strong>nen. Praktis<strong>ch</strong> muss aber genau in die umgekehrteRi<strong>ch</strong>tung gere<strong>ch</strong>net werden: Die (gewüns<strong>ch</strong>te) Menge des Endproduktes ist gegeben,gesu<strong>ch</strong>t wird die benötigte Menge des Ausgangsproduktes.Zwis<strong>ch</strong>en dem Prozentsatz, der verloren geht, und dem Prozentsatz, der dazuges<strong>ch</strong>lagenwerden muss, besteht kein einfa<strong>ch</strong>er, intuitiv na<strong>ch</strong>vollziehbarer Zusammenhang. Beträgt derVerlust z.B. 1/3, dann muss 1/2 mehr vom Ausgangsprodukt – oder 1,5mal die gewüns<strong>ch</strong>teEndmenge – bereitgestellt werden.Einfa<strong>ch</strong>er zu handhaben werden die Bere<strong>ch</strong>nungen, wenn die relevanten Angaben ni<strong>ch</strong>t <strong>als</strong>Verlustprozente sondern <strong>als</strong> Vielfa<strong>ch</strong>e vorliegen. Dies gilt umso mehr, wenn die Verlustemehrerer Arbeitss<strong>ch</strong>ritte hintereinander berücksi<strong>ch</strong>tigt werden müssen. Wie gross der Gesamtverlustist, wenn zuerst 15 % Rüstverlust und dann 30 % Garverlust berücksi<strong>ch</strong>tigt werdenmüssen, ist intuitiv s<strong>ch</strong>wer zu erkennen. Entspre<strong>ch</strong>end s<strong>ch</strong>wierig ist es, eigene Re<strong>ch</strong>nungsfehlerzu entdecken. Kennt man aber die beiden Vielfa<strong>ch</strong>en (1,18 und 1,43) so lässtsi<strong>ch</strong> das kombinierte Vielfa<strong>ch</strong>e, das Produkt der beiden Grössen (1,68), do<strong>ch</strong> ungefähr abs<strong>ch</strong>ätzen.Da in der Fa<strong>ch</strong>literatur Verlustprozente und ni<strong>ch</strong>t Vielfa<strong>ch</strong>e publiziert werden, ist die linkeSeite erst einmal der Umformung von Verlustprozenten in Vielfa<strong>ch</strong>e gewidmet. Idealerweisestellt si<strong>ch</strong> bei dieser Arbeit jeder und jede der Lernenden eine persönli<strong>ch</strong>e Tabelle zusammen,wel<strong>ch</strong>e sie in Zukunft einsetzen kann. Als eigentli<strong>ch</strong>es Hauptinstrument werden dannre<strong>ch</strong>ts eine Proportionalitätstabellen angeboten, bei denen ausgehend von einer Ankerzeile(beispielsweise 1000g/1180g bei den Karotten) dur<strong>ch</strong> Verdoppeln, Halbieren etc. die Wertegefunden werden können, die benötigt werden.D. Gefässe wählenZentrale Fragestellung ist, wie man die Menge einer Masse (für eine Mousse, für eine Terrine)mit den zur Verfügung stehenden Formen in Übereinstimmung bringt. Diese Frage kannsi<strong>ch</strong> in der einen – von der Form zur Masse – wie au<strong>ch</strong> in der anderen Ri<strong>ch</strong>tung stellen.A. Von der Form zur Masse: Es soll eine oder mehrere Terrinenformen mit einem Fassungsvermögenvon je 1 Liter gefüllt werden. Wie muss das vorliegende Rezept angepasstwerden?B. Von der Masse zur Form: Ausgehend von einem vorhandenen Rezept sollen 25 Portioneneines Himbeermousse hergestellt werden. Es stehen Timbalförm<strong>ch</strong>en zu 1 Deziliterund zu 1,5 Deziliter zur Verfügung. Wel<strong>ch</strong>e Förm<strong>ch</strong>en eignen si<strong>ch</strong>? (Und wie muss mandie Masse allenfalls anpassen, damit die Förm<strong>ch</strong>en vollständig gefüllt werden?)Beide Situationen haben eine enge Beziehung zu der Situation „Rezepte umre<strong>ch</strong>nen“. Hiersteht das Umre<strong>ch</strong>nen aufgrund des Verhältnisses Anzahl Formen, die si<strong>ch</strong> mit dem Grundrezeptfüllen lassen zur angestrebten Anzahl Formen im Zentrum. Dort ist es das VerhältnisPortionenzahl des Grundrezeptes zur angestrebten Portionenzahl.Im Wesentli<strong>ch</strong>en müssen drei vers<strong>ch</strong>iedene Umre<strong>ch</strong>nungsvorgänge flexibel kombiniert werden:www.<strong>hrkll</strong>.<strong>ch</strong> 6 16.05.2013
Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt: Beispiel Kö<strong>ch</strong>e1. Wie viel Volumen ergibt das vorhandene Rezept?2. Wie viele Förm<strong>ch</strong>en lassen si<strong>ch</strong> mit dem vorhandenen Rezept füllen? (evtl. mehrere vers<strong>ch</strong>iedenFörm<strong>ch</strong>engrössen dur<strong>ch</strong>spielen)3. Rezept umre<strong>ch</strong>nen (anstatt von 10 Personen auf 25 Personen von 10 Förm<strong>ch</strong>en auf 25Förm<strong>ch</strong>en).Volumen des vorhandenen RezeptesEine relativ geradlinige Umre<strong>ch</strong>nung von Gewi<strong>ch</strong>t in Volumen für die einzelnen Zutaten. Ambesten verwendet man dabei von Anfang an eine einheitli<strong>ch</strong>e Masseinheit für alle Volumen.Um si<strong>ch</strong> die Arbeit zu vereinfa<strong>ch</strong>en, kann man Zutaten weglassen, die kaum einen Beitragleisten. Je na<strong>ch</strong> Verarbeitungsprozess muss das Volumen angepasst werden. Am übersi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>stenerfolgt die Zusammenstellung in einer kleinen TabelleWie viele Förm<strong>ch</strong>en füllt das vorhandene RezeptIst das Volumen des Rezeptes bekannt, kann man si<strong>ch</strong> überlegen, wie viele Förm<strong>ch</strong>en si<strong>ch</strong>damit füllen lassen. Je na<strong>ch</strong> Aufgabenstellung ist es dabei nötig, vers<strong>ch</strong>iedene Förm<strong>ch</strong>engrössendur<strong>ch</strong>zuspielen. Au<strong>ch</strong> hier hilft eine übersi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Tabelle.Rezeptangaben umre<strong>ch</strong>nenIst einmal bekannt, wie viele Förm<strong>ch</strong>en der angestrebten Grösse si<strong>ch</strong> mit dem vorhandenenRezept füllen lassen, kann das Rezept genau glei<strong>ch</strong> wie beim „Rezept umre<strong>ch</strong>nen“ umgere<strong>ch</strong>netwerden. Der einzige Unters<strong>ch</strong>ied besteht darin, dass ni<strong>ch</strong>t von 10 Personen auf 25Personen, sondern z.B. von 15 Förm<strong>ch</strong>en auf 25 Förm<strong>ch</strong>en umgere<strong>ch</strong>net wird.Die Lernumgebung widmet si<strong>ch</strong> von links na<strong>ch</strong> re<strong>ch</strong>ts jedem dieser drei S<strong>ch</strong>ritte. Au<strong>ch</strong> hierwird jedes Mal <strong>als</strong> Werkzeug eine einfa<strong>ch</strong>e tabellaris<strong>ch</strong>e Darstellung angeboten. Die Beispielrezepteregen dann an, das Ganze zusammenzusetzen. Wi<strong>ch</strong>tig ist au<strong>ch</strong> hier, dass dieMögli<strong>ch</strong>keiten und Grenzen sol<strong>ch</strong>er Bere<strong>ch</strong>nungen kritis<strong>ch</strong> diskutiert werden. Der Kastenunten in der Mitte regt mit Fragen wie „Wie genau sind die Umre<strong>ch</strong>nungen von Gramm inDeziliter eigentli<strong>ch</strong>?“ dazu an.E. PreiskalkulationAuf der Stufe EFZ (eidgenössis<strong>ch</strong>es Fähigkeitszeugnis) müssen die Lernenden keine konkretenPreiskalkulationen dur<strong>ch</strong>führen. Dies ist ein Thema der höheren Fa<strong>ch</strong>bildung. Wi<strong>ch</strong>tigist hingegen, dass sie eine Vorstellung davon haben, wel<strong>ch</strong>e Kosten anfallen. Ebenfallswi<strong>ch</strong>tig ist, dass sie ein Gefühl dafür haben, in wel<strong>ch</strong>em Verhältnis diese Kosten zu den Warenkostenstehen, die für sie ja am unmittelbarsten wahrnehmbar sind.Grundgerüst, um über die anfallenden Kosten na<strong>ch</strong>zudenken, bildet eine Grundmenge vonBegriffen sowie die Zusammenhänge zwis<strong>ch</strong>en diesen Begriffen. In dieses Gerüst fügt si<strong>ch</strong>eine wi<strong>ch</strong>tige Grössenbeziehung ein, das Verhältnis von Basisverkaufspreis/Basisumsatz zuWarenkosten.Zentral sind in dieser Lernumgebung vor allem die Explorationsaufgaben unten re<strong>ch</strong>ts. DieLernenden sollen anhand von realen Daten aus ihren Betrieben sehen, wie si<strong>ch</strong> die Kosteneffektiv zusammensetzen und wel<strong>ch</strong>e Bandbreite mögli<strong>ch</strong>er Betriebsmodelle es gibt.F. Optimierungsmögli<strong>ch</strong>keitenAu<strong>ch</strong> hier gilt, dass auf der Stufe EFZ die Lernenden keine konkreten Optimierungsaufgabendur<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen müssen. Wissen sollten sie aber, dass in der Prozesskette an vers<strong>ch</strong>iedenenStellen Kosten anfallen und dass die Reduktion der Kosten bei einem Prozesss<strong>ch</strong>ritt oftMehrkosten bei einem anderen Prozesss<strong>ch</strong>ritt zur Folge hat.www.<strong>hrkll</strong>.<strong>ch</strong> 7 16.05.2013
Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt: Beispiel Kö<strong>ch</strong>eZentrales Instrument zum Dur<strong>ch</strong>denken der vers<strong>ch</strong>iedenen Zusammenhänge ist die graphis<strong>ch</strong>eDarstellung mehrerer paralleler Herstellungsprozesse mit demselben Ziel. Die Lernendenkönnen sol<strong>ch</strong>e Darstellungen zum Verglei<strong>ch</strong> beliebiger Herstellungsprozesse nutzen.Au<strong>ch</strong> hier ist es wi<strong>ch</strong>tig, dass die Lernenden anhand von Explorationsaufgaben (unten Mitte)si<strong>ch</strong> in die Thematik hineindenken. Die Auseinandersetzung mit den Lohnkosten hat vor allemaus Platzgründen hier ihren Platz gefunden. Sie kann aber genauso gut im Zusammenhangmit der Lernumgebung Preiskalkulation angegangen werden.G. WarenkostenDie Warenkosten haben eine Art S<strong>ch</strong>arnierfunktion. Einerseits hängen sie von den Resultatender Situationen „Rezepte umre<strong>ch</strong>nen“ bzw. „Formen bere<strong>ch</strong>nen“, „Optimieren“ sowieVerlustre<strong>ch</strong>nung“ ab. Andererseits bilden sie die Basis für eine grobe „Preiskalkulation“.Zentrales Instrument zur Bere<strong>ch</strong>nung der Warenkosten ist eine übersi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e tabellaris<strong>ch</strong>eDarstellung. Die Spalten der Tabelle entspre<strong>ch</strong>en von links na<strong>ch</strong> re<strong>ch</strong>ts einem mögli<strong>ch</strong>enBere<strong>ch</strong>nungsablauf, bei dem na<strong>ch</strong> und na<strong>ch</strong> Resultate und Überlegungen – vor allem aus„Verlustre<strong>ch</strong>nung“ und „Rezepte umre<strong>ch</strong>nen“ – einfliessen.Wegen der angespro<strong>ch</strong>enen S<strong>ch</strong>arnierfunktion ist die Bere<strong>ch</strong>nung der Warenkosten ist einebeliebte Prüfungsaufgabe für die Abs<strong>ch</strong>lussprüfung. Um bei der Prüfung den Lernendenni<strong>ch</strong>t unnötige Stolpersteine in den Weg zu legen, werden entspre<strong>ch</strong>ende Aufgaben an derPrüfung in derselben tabellaris<strong>ch</strong>en Form wie auf der Lernumgebung präsentiert.Die Lernumgebung ma<strong>ch</strong>t explizit, dass alle Lernumgebungen zueinander in vers<strong>ch</strong>iedenenZusammenhängen stehen. Sie stellt damit Vernetzungen her, so wie es der Grundidee derganzen Ausbildung entspri<strong>ch</strong>t, die ja weg vom Fä<strong>ch</strong>erdenken hin zu einer Prozessbetra<strong>ch</strong>tunggehen wollte.6 Kritis<strong>ch</strong>es Na<strong>ch</strong>fragenMeine Rolle im ganzen Prozess war die eines informierten Laien, wel<strong>ch</strong>er nie etwas <strong>als</strong> gegebenhinnimmt, sondern immer wieder kritis<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong>fragt, ob sol<strong>ch</strong>e Situationen im berufli<strong>ch</strong>enAlltag überhaupt vorkommen, ob im berufli<strong>ch</strong>en Alltag wirkli<strong>ch</strong> so gere<strong>ch</strong>net wird undob si<strong>ch</strong> gewisse traditionellen Bere<strong>ch</strong>nungsvorgänge ni<strong>ch</strong>t vereinfa<strong>ch</strong>en lassen.Wie s<strong>ch</strong>on erwähnt (vgl. Abs<strong>ch</strong>nitt 3) führte dieses kritis<strong>ch</strong>e Na<strong>ch</strong>fragen meinerseits einmaldazu, dass zwei der Situationen zwar auf der Liste belassen wurden, dass aber die Lernzieleangepasst wurden. Bei Preiskalkulation und Optimierungsmögli<strong>ch</strong>keiten geht es ni<strong>ch</strong>t darum,dass die Lernenden entspre<strong>ch</strong>ende Bere<strong>ch</strong>nungen selbstständig ausführen können, sondernnur darum, dass sie gewisse Zusammenhänge na<strong>ch</strong>vollziehen können.Im Übrigen hatte mein Insistieren an vers<strong>ch</strong>iedenen Stellen zur Folge, dass die traditionell inden Lehrbü<strong>ch</strong>ern verwendeten Verfahren dur<strong>ch</strong> praxisnähere Vorgehensweisen ersetzt wurden.Drei Beispiele aus drei Situationen:Volumen bere<strong>ch</strong>nenTraditionell wurde diese Situation zum Anlass genommen, die Formeln zur Volumenbere<strong>ch</strong>nungvers<strong>ch</strong>iedenster Körper zu repetieren. Na<strong>ch</strong>fragen ergaben, dass selbstverständli<strong>ch</strong> imrealen Berufsalltag niemand sol<strong>ch</strong>e Volumenbere<strong>ch</strong>nungen dur<strong>ch</strong>führt. Normmalerweise istbekannt, wie gross das Volumen der einzelnen Formen ist. Man verfügt über einen Satz 1 dlFormen und weiss das au<strong>ch</strong>. Und sollte man einmal eine Form mit unbekanntem Volumeneinsetzen, dann gilt das nun in der Lernumgebung aufgenommene Verfahren: Mit Wasserauffüllen und dann die Wassermenge in einem Massbe<strong>ch</strong>er messen. Dieses Verfahren findetsi<strong>ch</strong> nun <strong>als</strong> Anregung in der Mitte von Gefässe wählen.www.<strong>hrkll</strong>.<strong>ch</strong> 8 16.05.2013
Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt: Beispiel Kö<strong>ch</strong>eRezeptangaben umre<strong>ch</strong>nen: Tabelle statt DreisatzDas Umre<strong>ch</strong>nen der Angaben eines Rezeptes von 10 Personen auf 25 Personen wurde bishertraditionell mit Hilfe eines der vielen Re<strong>ch</strong>enverfahren angegangen, die für sol<strong>ch</strong>e Umre<strong>ch</strong>nungenerfunden wurden („Bru<strong>ch</strong>stri<strong>ch</strong>-Verfahren“, „T-Balken“, „Re<strong>ch</strong>enkreuz“ etc.) Re<strong>ch</strong>enverfahrendieser Art sind aber sehr fehleranfällig. Im praktis<strong>ch</strong>en Alltag sind oft Proportionalitätstabellenhandli<strong>ch</strong>er. Als Werkzeug wird den Lernenden in dieser Situation deshalbvorges<strong>ch</strong>lagen, mit sol<strong>ch</strong>en Tabellen zu arbeiten und wenn mögli<strong>ch</strong> und sinnvoll die Resultatedur<strong>ch</strong> einfa<strong>ch</strong>es Verdoppeln und Halbieren abzuleiten.Verlustre<strong>ch</strong>nung: Vielfa<strong>ch</strong>e statt VerlusteDas, was im traditionellen Lehrmittel unter Verlustre<strong>ch</strong>nung behandelt wurde, deckt prinzipiellzwei vers<strong>ch</strong>iedene Situationen ab: a) Es ist eine bestimmte Menge Rohstoffe, wie etwaKarotten, vorhanden. Wie viele Standardportionen gedämpfter Karotten lassen si<strong>ch</strong> damitzubereiten? b) Es sollen eine bestimmte Anzahl Standardportionen Karotten zubereitet werden.Wie viele Kilogramm Karotten muss man einkaufen/bestellen?Die Diskussion ergab, dass im berufli<strong>ch</strong>en Alltag praktis<strong>ch</strong> nur die zweite dieser Situationenvorkommt. Es wurde daher bes<strong>ch</strong>lossen, au<strong>ch</strong> nur diese aufzunehmen. Um entspre<strong>ch</strong>endeBere<strong>ch</strong>nungen dur<strong>ch</strong>zuführen benötigt man Angaben darüber, wie viel Gewi<strong>ch</strong>t etwa typis<strong>ch</strong>erweisebeim S<strong>ch</strong>älen von Karotten verloren geht. Diese Werte sind bekannt und in mehroder weniger umfangrei<strong>ch</strong>en Tabellen publiziert. Allerdings sind diese Angaben in der Formvon Verlustprozenten eigentli<strong>ch</strong> auf die erste der beiden Situationen abgestimmt und müssenfür die Situation b) erst umgeformt werden.Für die zweite Situation wären Angaben <strong>als</strong> Vielfa<strong>ch</strong>e nützli<strong>ch</strong>er, im Sinne von „für 1 kg ges<strong>ch</strong>älteKarotten werden 1.19 kg unges<strong>ch</strong>älte Karotten benötigt“. Es wurde bes<strong>ch</strong>lossen,konsequent mit sol<strong>ch</strong>en Vielfa<strong>ch</strong>en zu re<strong>ch</strong>nen (vgl. die Bes<strong>ch</strong>reibung der Situation Verlustre<strong>ch</strong>nungim Abs<strong>ch</strong>nitt 5 oben). Aktuell setzt das no<strong>ch</strong> voraus, dass die Lernenden die publiziertenVerlustprozente in Vielfa<strong>ch</strong>e umre<strong>ch</strong>nen. Wüns<strong>ch</strong>bar wäre natürli<strong>ch</strong>, dass in Zukunftdirekt die Vielfa<strong>ch</strong>en publiziert werden.7 ImplementierungDie Entwicklung der Lernumgebungen ging in einem ho<strong>ch</strong> motivierten kleinen Team zügigvoran und konnte in gut einem halben Jahr abges<strong>ch</strong>lossen werden. Länger dauern wird dieImplementierung der neuen Ideen im S<strong>ch</strong>ulalltag. Da es keine Mögli<strong>ch</strong>keit gibt, den Lehrendenvorzus<strong>ch</strong>reiben, wie sie den Unterri<strong>ch</strong>t im Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen gestalten sollen, kann dies nurüber Anregungen und Hilfestellungen erfolgen. Günstig wirkt si<strong>ch</strong> dabei aus, dass die bes<strong>ch</strong>lossenemassive Reduktion der Anzahl Lektionen von 140 auf 40 Lektionen die Lehrendenzwingt, ihren Unterri<strong>ch</strong>t zu überdenken.S<strong>ch</strong>ulungDie Ideen hinter „Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse“ stellen viele Gewohnheiten in Aufbauund Ablauf des Unterri<strong>ch</strong>ts in Frage. Um diesen Ideen zum Dur<strong>ch</strong>bru<strong>ch</strong> zu verhelfen,wäre eine intensive Auseinandersetzung der Lehrenden mit Konzepten und Lehrmaterialnotwendig. Realistis<strong>ch</strong>erweise ist die Zeit, wel<strong>ch</strong>e einzelne Lehrpersonen darauf verwendenkönnen, bes<strong>ch</strong>ränkt, da das Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen nur einen kleinen Bru<strong>ch</strong>teil ihrer Aufgaben ausma<strong>ch</strong>t.Die angestrebten 40 Lektionen stehen über 500 Lektionen zu anderen Aspekten gegenüber.Als eine Art Kickoff-Veranstaltung fanden ein halbes Jahr vor dem Beginn der ersten Ausbildungenna<strong>ch</strong> neuem Bildungsplan zwei Kurstage statt. Der grösste Teil der zwei Tage wardem Thema situations- bzw. prozessbezogene Didaktik allgemein gewidmet. Dabei wurdeneinerseits Anregungen zu grundlegenden didaktis<strong>ch</strong>en Szenarien vermittelt (Kaiser, 2008),www.<strong>hrkll</strong>.<strong>ch</strong> 9 16.05.2013
Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt: Beispiel Kö<strong>ch</strong>eandererseits präsentierten Lehrende ihren Kollegen bereits Beispiele ausgearbeiteter Unterri<strong>ch</strong>tssequenzen.Der Na<strong>ch</strong>mittag des zweiten Tages fokussierte dann spezifis<strong>ch</strong> auf das Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen. DerSituationsbezug im Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen wurde <strong>als</strong> logis<strong>ch</strong>e Folge des Situationsbezugs im übrigenUnterri<strong>ch</strong>t dargestellt. Es gab eine Einführung in einzelne Lernumgebungen, eine Einführungin einige spezielle Aspekte der Didaktik, Gruppenarbeiten um si<strong>ch</strong> mit dem Material vertrautzu ma<strong>ch</strong>en und einen Austaus<strong>ch</strong> über Chancen und Risiken des neuen Zugangs.LehrmaterialZentraler Punkt bei der Implementierung sind die sieben Lernumgebungen mit den dazu gehörendenKurzanleitungen. Sie werden via Internet kostenfrei <strong>als</strong> <strong>pdf</strong> Dateien zur Verfügunggestellt und können von den Lehrenden na<strong>ch</strong> Belieben genutzt werden.Es ist zu anzunehmen, dass eine beträ<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Zahl der Lehrenden zumindest einmal versu<strong>ch</strong>sweisedamit arbeiten wird, da für sie der Aufwand so kleiner ist, <strong>als</strong> wenn sie ihre bisherigenUnterlagen an die neuen Vorgaben anpassen.Wie oben bes<strong>ch</strong>rieben, wurden die Lernumgebungen ein halbes Jahr vor Beginn der Ausbildungenan einem Kurs vorgestellt. Effektiv war der Vorlauf aber grösser, da na<strong>ch</strong> dem neuenPlan Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen im eigentli<strong>ch</strong>en Sinn ist aber erst ab dem dritten Semester vorgesehen ist.D.h. die Lernumgebungen und die neue didaktis<strong>ch</strong>e Stossri<strong>ch</strong>tung wurden den Lehrendengut eineinhalb Jahre vor dem ersten Einsatz vorgestellt. Dies war einmal notwendig, um einegewisse Unruhe, die si<strong>ch</strong> aus der Reduktion der Lektionenzahl ergeben hatte, aufzufangen.Und dann erhielten die Lehrenden so ausrei<strong>ch</strong>end Zeit, si<strong>ch</strong> mit den neuen Ideen vertraut zuma<strong>ch</strong>en.8 Bisherige ErfahrungenErste ReaktionenDie Reaktion war an der Kickoff-Veranstaltung ausserordentli<strong>ch</strong> positiv. Viele der Teilnehmendenbegrüssten die Neuerungen ausdrückli<strong>ch</strong>, da sie das bisherige Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen <strong>als</strong>unbefriedigend erlebt hatten. Offene Kritik wurde kaum geäussert.Interessanterweise stiess die Situation „Zeitmanagement“ auf ein gewisses Unverständnis.Zwar bestritt niemand, dass es si<strong>ch</strong> dabei um eine relevante Situation handelt. Nur entspri<strong>ch</strong>tsie offensi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t der prototypis<strong>ch</strong>en Vorstellung von „Re<strong>ch</strong>nen“. Zudem war sie bisherni<strong>ch</strong>t Thema des Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nens.Early AdopterVers<strong>ch</strong>iedene Lehrende, darunter die drei Mittglieder der Projektgruppe, ma<strong>ch</strong>ten si<strong>ch</strong> sofortan die Umsetzung und sind na<strong>ch</strong> wie vor mit Begeisterung dabei. Es existiert no<strong>ch</strong> keinesystematis<strong>ch</strong>e Auswertung der Erfahrungen, aber einige interessante Punkte haben dieseEinsätze bereits zu Tage gebra<strong>ch</strong>t.Lernende selbst Beispiele kreieren lassenIn vers<strong>ch</strong>iedenen Lernumgebungen werden die Lernenden aufgefordert, für erste Übungensi<strong>ch</strong> selbst Beispiele auszudenken, oft mit der Aufforderung „Stelen Sie eine nützli<strong>ch</strong>e Tabellezusammen!“ Offenbar ist das für die Lernenden zumindest zu Beginn so ungewohnt, dasssie Mühe haben, Beispiele zu finden oder zu erfinden. Besser s<strong>ch</strong>eint es zu gehen, wennman ihnen zuerst ein paar Aufgaben vorgibt und sie erst dann bittet, weitere Beispiele selbstzu entwerfen. Viellei<strong>ch</strong>t wäre es sinnvoll, jede Lernumgebung no<strong>ch</strong> mit einem kleinen Aufga-www.<strong>hrkll</strong>.<strong>ch</strong> 10 16.05.2013
Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt: Beispiel Kö<strong>ch</strong>eProduktionsmethoden / Fis<strong>ch</strong>e und Meeresfrü<strong>ch</strong>tea) Zeigen Sie im Rahmen der Fis<strong>ch</strong>bestellung zwei Mögli<strong>ch</strong>keiten auf, wie Sie in Erfahrungbringen können, wel<strong>ch</strong>e Speisefis<strong>ch</strong>arten (Wildfang) aktuell <strong>als</strong> „gefährdet“ gelten.b) Ihr Fis<strong>ch</strong>händler bietet Ihnen an, den glei<strong>ch</strong>en Fis<strong>ch</strong> aus einer Fis<strong>ch</strong>zu<strong>ch</strong>t (Aquakultur) zubesorgen. Die intensive Aquakultur hat jedo<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> Na<strong>ch</strong>teile. Bes<strong>ch</strong>reiben Sie zwei davon.c) Nennen Sie zwei europäis<strong>ch</strong>e Länder, aus denen die S<strong>ch</strong>weiz fris<strong>ch</strong>e Miesmus<strong>ch</strong>eln importiert.Bere<strong>ch</strong>nen / Bruttogewi<strong>ch</strong>te für die BestellungSie benötigen pro Person pfannenfertig: 90 g Seezungenfilets und 30 g Riesenkrevetten.Wie lautet Ihre Bestellung für 55 Personen, wenn der Filetierverlust bei den Seezungen 55 %und der S<strong>ch</strong>älverlust bei den Riesenkrevetten15 % betragen? (Hinweis: Re<strong>ch</strong>energebnis auf1 Gramm genau runden, Bestellmenge auf die nä<strong>ch</strong>sten 100 g genau aufrunden.)Warenannahme / Qualitätskontrollea) Verdorbene Miesmus<strong>ch</strong>eln haben s<strong>ch</strong>on oft zu s<strong>ch</strong>weren Lebensmittelvergiftungen geführt.Woran erkennt man vor und na<strong>ch</strong> dem Dünsten, ob eine Miesmus<strong>ch</strong>el genusstaugli<strong>ch</strong>ist?b) Nebst der Bankettbestellung, wird no<strong>ch</strong> ganzer Zander und La<strong>ch</strong>s angeliefert. Bes<strong>ch</strong>reibenSie anhand der Bildsymbole, na<strong>ch</strong> wel<strong>ch</strong>en Merkmalen Sie die Fris<strong>ch</strong>equalität der Fis<strong>ch</strong>eprüfen.Vorbereitung / Zubereitung Fis<strong>ch</strong>fondSie müssen die Seezungen filetieren und aus den Gräten einen Fis<strong>ch</strong>fond zubereiten.a) Wel<strong>ch</strong>e vier Tätigkeiten müssen Sie vornehmen um pfannenfertige Filets zu erhalten?b) Bes<strong>ch</strong>reiben Sie in se<strong>ch</strong>s S<strong>ch</strong>ritten die Zubereitung des Fis<strong>ch</strong>fonds.Garmethode / Zubereitung Fis<strong>ch</strong>rahmsaucea) Aus dem Fis<strong>ch</strong>fond sollen 4 l Fis<strong>ch</strong>rahmsauce mit Safran hergestellt werden. ErgänzenSie die 6 fehlenden S<strong>ch</strong>ritte bei der Herstellung von Fis<strong>ch</strong>rahmsauce mit Safran.b) Die Sauce soll no<strong>ch</strong> mit dem eingeko<strong>ch</strong>ten Garfond der Seezungenfilets verstärkt werden.Wel<strong>ch</strong>e Garmethode wählen Sie für das Garen der Seezungenfilets?Ernährung / Gluten-Unverträgli<strong>ch</strong>keitDer Chef de Service meldet Ihnen, dass zwei Gäste an Gluten-Unverträgli<strong>ch</strong>keit (Zöliakie)leiden.a) Wel<strong>ch</strong>e Massnahmen treffen Sie bei der Sauce?b) Wel<strong>ch</strong>e Alternative haben Sie zu den Nudeln?Ko<strong>ch</strong>ges<strong>ch</strong>irr für Fis<strong>ch</strong>geri<strong>ch</strong>teIm Verlaufe der Zeit haben si<strong>ch</strong> zu den Garmethoden spezielle Ko<strong>ch</strong>ges<strong>ch</strong>irre herausgebildet.Führen Sie zu den aufgeführten Fis<strong>ch</strong>geri<strong>ch</strong>ten das entspre<strong>ch</strong>ende Ko<strong>ch</strong>ges<strong>ch</strong>irr/Ko<strong>ch</strong>gerätauf.Bere<strong>ch</strong>nen / Rezeptmengen und WarenkostenRe<strong>ch</strong>nen Sie das Nudeln-Rezept von 10 auf 55 Personen um und bestimmen Sie die Warenkosten.www.<strong>hrkll</strong>.<strong>ch</strong> 12 16.05.2013
Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt: Beispiel Kö<strong>ch</strong>eZutatenMenge für10 PersonenMenge für55 PersonenEinkaufspreis in CHFWarenkostenin CHFWeissmehl300 g…………….1.80 / kg…………….Vollei0,2 l…………….12.50 / Liter…………….Olivenöl0,04 l…………….12.50 / Liter…………….Kräuter, gemis<strong>ch</strong>tSpeisesalz (NudelteigundKo<strong>ch</strong>wasser)20 g22.50 / kg…………….40 g 0,22 kg 1.20 / kg…………….…………….Total Warenkosten für 55 Personen:…………….Bis es allerdings so weit war, wurden mehrere Varianten von Prüfungen produziert und warenintensive Diskussionen nötig. Eine Haupts<strong>ch</strong>wierigkeit war, dass im Rahmen der Umsetzungdes neuen Bildungsplanes zwei vers<strong>ch</strong>iedene Gruppen für das Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen und fürdie Prüfungen zuständig waren. Na<strong>ch</strong>dem si<strong>ch</strong> die Gruppe „Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>en“ gefunden hatte,musste <strong>als</strong>o <strong>als</strong> nä<strong>ch</strong>stes au<strong>ch</strong> die Gruppe „Prüfungen“ überzeugt werden.9 LiteraturKaiser, H. (2008). Berufli<strong>ch</strong>e Handlungssituationen ma<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>ule. Winterthur: EditionSwissmem.Kaiser, H. (2011). Fa<strong>ch</strong>re<strong>ch</strong>nen vom Kopf auf die Füsse gestellt – innovative Ansätze in derAusbildung zum Ko<strong>ch</strong>/ zur Kö<strong>ch</strong>in. In G. Niedermair (Ed.), Aktuelle Trends undZukunftsperspektiven berufli<strong>ch</strong>er Aus- und Weiterbildung (pp. 225-242). Linz:Trauner.www.<strong>hrkll</strong>.<strong>ch</strong> 13 16.05.2013