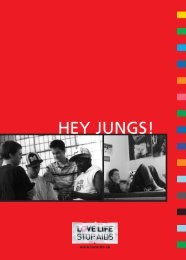Kindheit&Entw13 (pdf, 216KB) - Abteilung Entwicklungspsychologie
Kindheit&Entw13 (pdf, 216KB) - Abteilung Entwicklungspsychologie
Kindheit&Entw13 (pdf, 216KB) - Abteilung Entwicklungspsychologie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kindheit und Entwicklung, 22 (2), 105 – 112 Hogrefe Verlag, Göttingen 2013Stellt ein niedriges Selbstkonzepteinen Risikofaktor für Anpassungsproblemenach dem Schuleintritt dar?Patrizia Cimeli, Marianne Röthlisberger, Regula Neuenschwanderund Claudia M. RoebersInstitut für Psychologie der Universität BernZusammenfassung. Kinder im Vorschul- und frühen Grundschulalter schätzen sich sehr positiv ein. Man vermutet, dass ein hohesSelbstkonzept eine erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben begünstigt. Für diese junge Altersgruppe liegen jedoch erstwenige empirische Belege dazu vor. Ziel der vorliegenden prospektiven Längsschnittstudie war es zu überprüfen, ob ein niedrigesSelbstkonzept einen Risikofaktor für Anpassungsprobleme unmittelbar nach dem Schuleintritt darstellt. Dazu wurden die Entwicklungsverläufevon Kindern mit niedrigem Selbstkonzept (unterstes Terzil, n = 31) und Kindern mit hohem Selbstkonzept (n = 72)miteinander verglichen. Im Kindergarten unterschieden sich die beiden Gruppen weder in soziodemographischen noch in kognitivenMerkmalen. Nach dem Schuleintritt wiesen Kinder mit niedrigem Selbstkonzept jedoch sowohl sozial als auch leistungsmäßig eineschlechtere schulische Anpassung auf als Kinder mit hohem Selbstkonzept. Die Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer praktischenBedeutsamkeit diskutiert.Schlüsselwörter: Selbstkonzept, Schuleintritt, Risikofaktor, schulische AnpassungIs a low self-concept a risk factor for children’s poor adjustment in elementary school?Abstract. Preschool and early elementary school children often exhibit a positive self-perception. A high self-concept is thought topromote positive coping with developmental demands. However, empirical evidence for this young age group is scarce. The goal of thepresent prospective longitudinal study was to examine whether a low self-concept represents a risk factor for poor school adjustment. Forthis purpose, children with low self-concepts (lowest tercile, n = 31) were compared to children with high self-concepts (n = 72). Inkindergarten there were no group differences in sociodemographics or cognitive characteristics. However, results indicated that afterschool entry children with low self-concepts demonstrated poorer school adjustment than children with high self-concepts, in both thesocial and the achievement domains. The results are discussed in terms of their practical relevance.Key words: self-concept, school entry, risk factor, school adjustmentDie vorliegende Studie wurde finanziell von der Jacobs StiftungZürich (Projekt: Transition to School: Developmental Pathways toExecutive Control as a Function of Educational Experience) unterstützt.Wir danken den teilnehmenden Kindern, ihren Eltern und den Lehrpersonenund Schulleitungen für ihre Bereitschaft, an der Studie teilzunehmen.Ein großer Dank geht auch an unsere Projekt-MitarbeiterInnenfür ihre tatkräftige Unterstützung.Kinder im Vorschul- und frühen Grundschulalter schätzensich selber oft sehr positiv ein, das heißt sie verfügen überein hohes Selbstkonzept (z. B. Harter, 2012). Es wirdvermutet, dass diese hohe Selbsteinschätzung Teil einesnormativ-adaptiven Mechanismus ist, der Kindern eineoptimistische und unermüdliche Auseinandersetzung mitEntwicklungsaufgaben – wie sie typischerweise derSchuleintritt mit sich bringt – erleichtert (Bjorklund &Bering, 2002). Die entwicklungsförderliche Wirkungeines hohen Selbstkonzeptes und die entwicklungshinderlicheWirkung eines niedrigen Selbstkonzeptes konntefür Kinder ab der mittleren Grundschulzeit bereits empirischgezeigt werden (z.B. Helmke, 1992; siehe auchResilienzforschung von Werner, 2007). Inwiefern einhohes bzw. niedriges Selbstkonzept Kindern bei den Anforderungen,die durch den Schuleintritt entstehen, entwicklungsförderlichbzw. -hinderlich wirkt, wurde bisherkaum systematisch untersucht. Ziel der vorliegendenStudie war es deshalb, anhand einer Längsschnittstudie zuüberprüfen, ob ein niedriges Selbstkonzept im Kindergarteneinen Risikofaktor für Anpassungsprobleme nachdem Schuleintritt darstellt.Der Schuleintritt stellt einen frühen und wichtigenEntwicklungsübergang im Leben eines Kindes dar. DasKind sieht sich mit zentralen Entwicklungsaufgabenkonfrontiert, welche neben dem Erlernen der Kulturtechnikenauch ein angemessenes Leistungs- und Sozialverhaltenbeinhalten (z.B. Hasselhorn & Lohaus, 2007). Diepositive Bewältigung dieser alterstypischen Anforderungengilt als Voraussetzung für eine günstige EntwicklungDOI: 10.1026/0942-5403/a000106
106 Patrizia Cimeli, Marianne Röthlisberger, Regula Neuenschwander und Claudia M. Roebers(Havighurst, 1972) und zeigt sich nach dem Schuleintrittin einer erfolgreichen schulischen Anpassung (Luthar &Cichetti, 2000). Viele Kinder schaffen diese Anpassungproblemlos, für einzelne Kinder kann der Schuleintrittjedoch zu einem kritischen Lebensereignis werden (Renner,Martschinke, Munser-Kiefer & Steinmüller, 2011). Insolch potentiell belastenden Entwicklungsübergängenkommen Risiko- und Schutzfaktoren eine besondere Bedeutungzu (Petermann & Schmidt, 2006).Aus der entwicklungspsychologisch-klinischen Forschungsind einige Faktoren auf Seiten des Kindes bekannt,welche den Übergang vom Kindergarten in dieSchule begünstigen bzw. erschweren (z. B. Petermann,2008). Neben einflussreichen familiären Hintergrundvariablenwie dem sozioökonomischen Status und der fluidenIntelligenz als klassischem kognitiven Prädiktor fürschulische Leistungen hat sich auch die Selbstregulation(sog. Exekutive Funktionen) als entscheidend für einenerfolgreichen Übergang in die Schule erwiesen (z.B. Blair& Razza, 2007). Zusätzlich zu kognitiven und selbstregulatorischenFähigkeiten wird auch das Selbstkonzept alsPrädiktor für eine positive schulische Entwicklung diskutiert(z.B. Guay, Marsh & Boivin, 2003). Das Selbstkonzeptwird als deskriptive, kognitive Repräsentation dereigenen Fähigkeiten und Merkmale definiert (Harter,2012).Für Kinder im Vorschul- und frühen Grundschulaltergilt eine erhebliche Selbstüberschätzung als typischesMerkmal des Selbstkonzeptes (Mantzicopoulos, 2006;Nicholls, 1978; Verschueren, Doumen, & Buyse, 2012).Es gibt Hinweise, dass diese überoptimistische Selbstwahrnehmungdie ersten Schuljahre nach dem Schuleintrittdurch die Fokussierung auf intraindividuelle Vergleichezunächst noch anhält, bevor sie allmählich alsFolge zunehmender interindividueller Vergleiche zugunsteneines realistischeren Selbstbilds zurückgeht (Cimeli,Neuenschwander, Röthlisberger & Roebers, inpress; Mantzicopoulos, 2006). Bei Kindern in der Schuleintrittsphaseist ein überhöhtes Selbstkonzept folglich alsAusdruck einer normativen Entwicklung zu verstehen.Die theoretische Grundlage vieler empirischer Studienzum Selbstkonzept bildet das hierarchische, multidimensionaleModell von Shavelson, Hubner und Stanton(1976), wonach das allgemeine Selbstkonzept in die zweiBereiche – leistungsbezogenes, akademisches und nichtleistungsbezogenes(d.h. soziales, emotionales und körperliches)Selbstkonzept – unterteilt wird. Die hierarchische,ausdifferenzierte und stabile Struktur des Selbstbildet sich erst allmählich im Entwicklungsverlauf aus(z.B. Marsh & Ayotte, 2003). Bei jungen Kindern wirddas Selbstkonzept einerseits als relativ global und undifferenziert,gleichzeitig aber auch als situationsspezifischund instabil beschrieben (Harter, 2012).Es gibt empirische Hinweise, dass in diesem Alter dasSelbstkonzept zwei unterschiedliche Dimensionen (leistungsbezogenvs. nicht-leistungsbezogen) aufweist, diejedoch nicht unabhängig voneinander sind (Harter & Pike,1984). Das in der vorliegenden Untersuchung eingesetzteMessinstrument beinhaltet deshalb einen leistungsbezogenen(hier: vorakademisches Selbstkonzept) und einennicht-leistungsbezogenen Bereich (hier: soziales Selbstkonzeptder Gleichaltrigenbeziehungen). Mit Blick aufeine erfolgreiche schulische Anpassung scheinen diesebeiden Bereiche besonders wichtig zu sein (z.B. Renner etal., 2011).Da Kinder in der frühen bis mittleren Kindheit vorallem ein situationsspezifisches Selbstkonzept haben, sinddie dokumentierten mittleren Stabilitäten vom Kindergartenin die erste Klasse der Grundschule erwartungsgemäß(Helmke, 1991; Measelle, Ablow, Cowan &Cowan, 1998). Vor diesem Befundmuster scheint dieIdentifikation von Kindern mit einem niedrigen Selbstkonzeptbesonders entwicklungs- und gegebenenfallsauch interventionsrelevant (Verschueren, Marcoen &Buyck, 1998).Zusammenhänge zwischen Selbstkonzept und Außenkriterienfallen bei Kindern im Kindergarten- und frühenGrundschulalter relativ gering aus. Dies gilt sowohl fürKorrelationen zwischen dem leistungsbezogenen Selbstkonzeptund Leistungsmaßen wie Schulleistungstests bzw.Schulnoten (r = .12 – .20, vgl. Metaanalyse von Hansford &Hattie, 1982) wie auch für Korrelationen zwischen dem sozialenSelbstkonzept und sozialen Maßen wie Einschätzungender sozialen Kompetenz bzw. Gleichaltrigenakzeptanz(Measelle, 2005; Verschueren et al., 2012). Insgesamt gehtman heute von bidirektionalen Einflüssen zwischen Selbstkonzeptund entsprechenden Verhaltensmaßen aus (reciprocaleffects model, vgl. Marsh & Martin, 2011), wobei sich dierelative Gewichtung der gegenseitigen Beeinflussung imEntwicklungsverlauf möglicherweise verändert. So deutenempirische Befunde darauf hin, dass der sogenannte selfenhancement-Ansatzspezifisch während der Phase desSchuleintritts zum Tragen kommt (Kammermeyer & Martschinke,2006). Konkret konnte in einer Längsschnittsstudievon Verschueren, Buyck und Marcoen (2001) gezeigt werden,dass Vorschulkinder mit einem niedrigen Selbstkonzeptim Vergleich zu Kindern mit einem hohen Selbstkonzeptnach dem Schuleintritt über schlechtere sozioemotionaleKompetenzen verfügten. In einer zweiten Längsschnittstudiezeigte sich ein niedriges Selbstkonzept als prädiktiv fürschlechtere Leseleistung in den ersten drei Schuljahren(Chapman, Tunmer & Prochnow, 2000). Die Aussagekraftder beiden Studien wird aber dadurch beschränkt, dass nebendem Selbstkonzept nur wenige oder gar keine weiterenPrädiktoren frühen schulischen Erfolgs mit in die Analyseneingeschlossen wurden. Dies wäre wichtig, um den spezifischenEinfluss des Selbstkonzeptes auf die schulische Anpassungabschätzenzukönnen. Zusammenfassend lässt sichdennoch festhalten, dass sowohl theoretische wie auch einigewenige empirische Hinweise vorliegen, dass einem niedrigenSelbstkonzept in der Übergangsphase von vier bis acht
Niedriges Selbstkonzept als Risikofaktor 109Tabelle 1. Korrelationen zwischen den kindbezogenen Merkmalen zu Messzeitpunkt 1 (Kindergarten) und den Indikatorenfrüher schulischer Anpassung zu Messzeitpunkt 2 (1. Klasse), N total = 103Schuleintritt(LP/EL)SchulleistungenMathematik (LP/Test)SchulleistungenSchriftsprache(LP/Test)Leistungsverhaltenglobal: Lernfreude(LP/EL)Leistungsverhaltenspezifisch:Durchhaltevermögen(LP/EL)Sozialverhalten:SozialeAnpassung(LP)Generelles SK .17 + /.23*. .10/.23* .16/.19 + .21*/.17 + .21*/.15 .13Vorakademisches SK .19 + /.18 + .17/.25* .28*/.27* .22*/.17 + .22*/.13 .03Soziales SK .07/.20* -.03/.10 -.08/-.02 .09/.09 .10/.11 .21*Geschlecht -.31*/-.25* .01/.05 -.31*/-.22* -.32*/-.21* -.34**/.-.30* -.19 +Alter in Monaten .13/.26* .17 + /.13 .16/.22* .25*/.10 .29*/.04 .24*Sozioökonomischer -.06/-.01 .17/.26* -.08/.13 .08/-.11 -.08/-.13 -.09StatusFluide Intelligenz .32*/.14 .40**/.32* .31*/.39** .29*/.21* .19 + /.20* .08Exekutive Funktionen.32*/.33* .43**/.50** .35**/.53** .43**/.31* .49**/.25* .16Anmerkungen: SK = Selbstkonzept, LP = Einschätzung Lehrperson, EL = Einschätzung Eltern, Geschlecht: Negative Korrelationen bedeuten höhereWerte bei den Mädchen als bei den Jungen. + p < .10, *p < .05, **p < .001Tabelle 2. Vergleich der soziodemographischen und kognitivenMerkmale zwischen Kindern mitniedrigem Selbstkonzept (SK niedrig ) und Kindernmit altersentsprechend ausgeprägtemSelbstkonzept (SK norm ) zu Messzeitpunkt 1(Kindergarten), N total = 103SK niedrig SK norm Signifikanztest(F- bzw. c 2 -Wert)N 31 72 -Geschlecht (männlich,71 % 54 % c 2 (1) = 2.53, n.s.%)Alter in Monaten 79.5(3.6)80.1(3.7)F(1,103) = 0.63,n.s.SozioökonomischerStatus8.6 (3.7) 8.9 (3.3) F(1,91) = 0.08,n.s.Fluide Intelligenz 97.2(8.0)98.2(10.6)F(1,102) = 0.24,n.s.Exekutive Funktionen-0.11(0.6)0.05(0.8)F (1,73.8)= 1.24, n.s.Anmerkungen: Sozioökonomischer Status: Werte gemäß Wegener-PrestigeSkala, das heißt Aufsummierung der Prestigewerte beiderelterlicher Ausbildungen und des Prestigewerts der Berufsausübung mithöherer Einstufung; Fluide Intelligenz: IQ-Wert, Exekutiven Funktionen:Mittelwert der z-standardisierten Variablen dreier Aufgaben;a = F-Wert nach Welch inkl. angepasster Freiheitsgrade.wenn soziodemographische und kognitive Merkmale vonMZP 1 als Kovariaten in die Varianzanalyse einbezogenwurden, blieb dieses Befundmuster zugunsten derSK norm -Kinder weitgehend bestehen.Abschließend wurde untersucht, ob sich SK niedrig-Kindervon SK norm -Kindern hinsichtlich eingeleiteterFördermaßnahmen unterschieden. Unter den 14 Kindernder gesamten Stichprobe, welche mit einem Status alsSchüler/innen mit speziellem Förderbedarf eingeschultwurden, befanden sich anteilsmäßig mehr SK niedrig -Kinderals SK norm -Kinder, c 2 (1) = 3.05, p < .10. Was den Förderunterrichtbetraf, so wurden tendenziell mehr SK niedrig-Kinder(45 %) gefördert als dies bei den SK norm -Kindern(26 %) der Fall war, c 2 (1) = 3.32, p < .10.DiskussionDas Ziel dieser Längsschnittstudie war es, zu überprüfen,inwiefern ein altersuntypisch niedriges Selbstkonzept vonKindergartenkindern einen Risikofaktor für schulischeAnpassungsprobleme in der ersten Klasse darstellt. Dazuwurden zwei Gruppen von Kindern verglichen, die vordem Schuleintritt entweder ein niedriges Selbstkonzeptoder ein, diesem Alter entsprechendes, hohes Selbstkonzeptaufwiesen. Die zwei Gruppen unterschieden sich imKindergarten weder in kognitiven noch in soziodemographischenMerkmalen. Im Entwicklungsverlauf ergabensich jedoch nach dem Schuleintritt hinsichtlich derschulischen Anpassung signifikante Unterschiede. Kinder,welche am Ende des Kindergartens ein niedrigesSelbstkonzept hatten, wiesen in der ersten Klasse sowohlleistungsmäßig wie auch sozial schlechtere schulischeAnpassungswerte auf als Kinder, welche ein alterstypischausgeprägtes Selbstkonzept hatten.Die vorliegenden Ergebnisse lassen somit vermuten,dass ein niedriges Selbstkonzept tatsächlich als Risikofaktorfür Anpassungsprobleme nach dem Schuleintrittbezeichnet werden kann. Zu dieser Schlussfolgerung führtinsbesondere die Tatsache, dass sich die Kinder zu MZP 1im Kindergarten einzig in der Ausprägung des Selbstkonzeptesunterschieden (vgl. Tab. 2, FS 2), nicht aber inden Ausgangsvariablen Geschlecht, Alter, SÖS, FI undEF, welche sich zudem wie erwartet als weitgehend bedeutsamePrädiktoren schulischer Anpassung erwiesen(vgl. Tab. 1, FS 1). Die unterschiedlichen Entwicklungsverläufein der schulischen Anpassung (vgl. Tab. 3, FS 4)können aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Daten
110 Patrizia Cimeli, Marianne Röthlisberger, Regula Neuenschwander und Claudia M. RoebersTabelle 3. Vergleich verschiedener Indikatoren schulischer Anpassung zwischen Kindern mit niedrigem Selbstkonzept(SK niedrig ) und Kindern mit altersentsprechend ausgeprägtem Selbstkonzept (SK norm ) zu Messzeitpunkt 2 (1.Klasse), N total = 103SK niedrig(n = 31)SK norm(n = 72)Signifikanztest(F-Wert)SchuleintrittEinschätzung LP + 3.2 (0.9) 3.6 (0.7) F(1,45.5) a = 3.46, p < .10, h 2 p = .04Einschätzung EL* 3.5 (0.6) 3.8 (0.5) F(1,42.4) a = 6.61, p < .05, h 2 p = .08SchulleistungenMathematik (LP) 3.0 (0.8) 3.1 (0.8) F(1,99) = 0.70, n.s.Mathematik (Test)* -0.3 (0.7) 0.1 (0.9) F(1,101) = 4.04, p < .05, h 2 p = .04Schriftsprache (LP) + 2.8 (0.8) 3.1 (0.7) F(1,101) = 3.64, p < .10, h 2 p = .04Schriftsprache (Test)* -0.3 (0.8) 0.1 (0.9) F(1,101) = 4.28, p < .05, h 2 p = .04Leistungsverhalten(global und spezifisch)Lernfreude (LP) + 3.2 (0.6) 3.4 (0.5) F(1,101) = 2.80, p < .10, h 2 p = .03Lernfreude (EL)* 3.3 (0.4) 3.5 (0.5) F(1,99) = 4.10, p < .05, h 2 p = .04Durchhaltevermögen (LP)** 2.6 (0.8) 3.1 (0.8) F(1,101) = 7.26, p < .01, h 2 p = .07Durchhaltevermögen (EL)** 2.7 (0.4) 3.0 (0.5) F(1,99) = 7.30, p < .01, h 2 p = .07SozialverhaltenSoziale Anpassung (LP)* 3.1 (0.8) 3.5 (0.7) F(1,101) = 5.88, p < .05, h 2 p = .06Anmerkungen: a = F-Wert nach Welch inkl. angepasste Freiheitsgrade, h p 2 = partielles Eta-Quadrat (Effektstärke), LP = Einschätzung Lehrperson, EL =Einschätzung Eltern. + p < .10, *p < .05, **p < .01also einzig auf die Zugehörigkeit zu den Gruppen SK niedrigbzw. SK norm zurückgeführt werden. Wenn das Selbstkonzepthier im Gruppenvergleich einen spezifischen Beitragzur Erklärung früher schulischer Anpassung leisten kann,deutet dies auf eine wichtige Funktion des Selbstkonzeptesin Übergängen, wie hier vom Kindergarten in dieSchule, hin (vgl. Filipp, 2006).Offen bleibt, ob ein niedriges Selbstkonzept aucheinen praktisch relevanten Risikofaktor darstellt; inwiefernalso die Unterschiede in Bezug auf die schulischeAnpassungsleistung auch tatsächlich praktisch bedeutsamsind. Einerseits sprechen die kleinen Effekte, als welchedie gefundenen Unterschiede in der schulischen Anpassungnach Cohen (1969) kategorisiert werden, eher füreine geringe praktische Bedeutung. Andererseits ergebensich in unseren Daten durchaus Hinweise auf die praktischeRelevanz der Effekte. So wurden SK niedrig -Kinder inihrer schlechteren schulischen Anpassung durch unterschiedlicheQuellen (objektive Tests, Lehrpersonen undEltern) fast übereinstimmend erkannt, sie zeigten sich inunterschiedlichen Anpassungsbereichen (leistungsmäßigund sozial) auffällig und sie erhielten zudem tendenziellhäufiger spezielle Fördermaßnahmen als SK norm -Kinder.Die vorliegenden Befunde konnten somit unserer Meinungnach zeigen, dass auch sogenannte kleine Effekteeine praktische Bedeutung im (schulischen) Alltag habenkönnen.Weitere Hinweise auf die praktische Bedeutsamkeitder Effekte liefern die gefundenen Stabilitätswerte desSelbstkonzeptes von mittlerer Höhe (FS 3), wie sie ähnlichschon in anderen Studien gefunden wurden (z.B. Measelleet al., 1998). Eine mittlere Stabilität weist darauf hin,dass zwar die Möglichkeit zu Veränderungen im Selbstkonzeptgegeben ist, dass aber das Selbstkonzept keineswegsals ausschließlich situationsabhängig bezeichnetwerden kann (vgl. Harter, 2012). Zusätzlich muss beachtetwerden, dass diese mittleren Stabilitäten trotz eines Bezugsgruppenwechselsvom Kindergarten in die Schuleund eines Instruments zur Erhebung des Selbstkonzepteszustande kamen, welches gerade auf dem sozialen Vergleichmit der aktuellen Bezugsgruppe basiert (Gabriel,Kastens, Poloczek, Schoreit & Lipowsky, 2010). Betrachtetman nur die SK niedrig -Kinder, so besteht für beinahedie Hälfte dieser Kinder eine gewisse Gefahr der„Chronifizierung“ eines schlechten Selbstbilds im weiterenEntwicklungsverlauf. Im Sinne der praktischen Bedeutsamkeithandelt es sich möglicherweise bei dieserGruppe um Kinder, welche in dieser Übergangsituationkonkret einer Intervention bedürfen.Ziele zukünftiger Forschung sollten darin bestehen,die praktische Bedeutsamkeit der hier dokumentiertenEffekte zu verifizieren und Faktoren zu ermitteln, welchedie Entstehung eines niedrigen Selbstkonzptes begünstigen.Auch mögliche direkte und indirekte Mechanismenzwischen dem Selbstkonzept und Entwicklungsergebnissensollten weiterführend untersucht werden. Interessantwäre auch zu beobachten, wie sich Kinder mit niedrigemSelbstkonzept längerfristig entwickeln.
Niedriges Selbstkonzept als Risikofaktor 111Insgesamt erbrachte diese für den deutschsprachigenBildungsraum erste Längsschnittstudie Hinweise darauf,dass das Selbstkonzept einen wichtigen Beitrag zu einemgelungenen Start in die Schule leisten kann.LiteraturBjorklund, D. F. & Bering, J. M. (2002). The evolved child:Applying evolutionary developmental psychology to modernschooling. Learning and Individual Differences, 12,347–373.Blair, C. & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executivefunction, and false belief understanding to emergingmath and literacy ability in kindergarten. Child Development,78, 647–663.Brown, L., Sherbenou, R. J. & Johnson, S. K. (1997). TONI-3:Test of nonverbal intelligence: A language-free measure ofcognitive ability (3rd ed.). Austin: Pro-Ed.Chapman, J. W., Tunmer, W. E. & Prochnow, J. E. (2000). Earlyreading-related skills and performance, reading self-concept,and the development of academic self-concept: A longitudinalstudy. Journal of Educational Psychology, 92, 703–708.Cimeli, P., Neuenschwander, R., Röthlisberger, M. & Roebers,C. M. (2013). Das Selbstkonzept von Kindern in der Schuleingangsphase:Ausprägung und Struktur sowie Zusammenhängemit frühen kognitiven Leistungsindikatoren.Zeitschrift für <strong>Entwicklungspsychologie</strong> und PädagogischePsychologie, 45, 1-13.Cohen, J. (1969). Statistical power analysis for the behavioralsciences. New York: Academic Press.Filipp, S. H. (2006). Kommentar zum Themenschwerpunkt.Entwicklung von Fähigkeitsselbstkonzepten. Zeitschrift für<strong>Entwicklungspsychologie</strong> und Pädagogische Psychologie,20, 65–72.Gabriel, K., Kastens, C., Poloczek, S., Schoreit, E. & Lipowsky,F. (2010). Entwicklung des mathematischen Selbstkonzeptsim Anfangsunterricht. Der Einfluss des Klassenkontextes.Zeitschrift für Grundschulforschung, 3, 65 –82.Grob, A., Meyer, S. C. & Hagmann-von Arx, P. (2009). Intelligenceand Development Scales (IDS). Bern: Huber.Guay, F., Marsh, H. W. & Boivin, M. (2003). Academic selfconceptand academic achievement: Developmental perspectiveson their causal ordering. Journal of EducationalPsychology, 95, 124–136.Haffner, J., Baro, K., Parzer, P. & Resch, F. (2005). HeidelbergerRechentest – HRT 1–4: Erfassung mathematischer Basiskompetenzenim Grundschulalter. Göttingen: Hogrefe.Hansford, B. C. & Hattie, J. A. (1982). The relationsship betweenself and achievement/performance measures. Review ofEducational Research, 52, 123–142.Harter, S. (2012). The construction of the self: A developmentalperspective (Vol. 2). New York: Guilford Press.Harter, S. & Pike, R. (1984). The pictorial scale of perceivedcompetence and social acceptance for young children. ChildDevelopment, 55, 1969–1982.Hasselhorn, M. & Lohaus, A. (2007). Schuleintritt. In M. Hasselhorn& W. Schneider (Hrsg.), Handbuch der <strong>Entwicklungspsychologie</strong>.Göttingen: Hogrefe.Havighurst, R. J. (1972). Developmental tasks and education.New York: McKay.Helmke, A. (1991). Entwicklung des Fähigkeitsselbstbildes vomKindergarten bis zur dritten Klasse. In R. Pekrun & H. Fend(Hrsg.), Schule und Persönlichkeitsentwicklung – ein Resümeeder Längsschnittforschung. Stuttgart: Enke.Helmke, A. (1992). Selbstvertrauen und schulische Leistungen.Göttingen: Hogrefe.Kammermeyer, G. & Martschinke, S. (2006). SelbstkonzeptundLeistungsentwicklung in der Grundschule – Ergebnisseaus der KILIA-Studie. Empirische Pädagogik, 20, 245–259.Küspert, P. & Schneider, W. (1998). Würzburger Leise Leseprobe(WLLP). Göttingen: Hogrefe.Luthar, S. S. & Cichetti, D. (2000). The construct of resilience:Implications for interventions and social policies. DevelopmentalPsychopathology, 12, 857–885.Mantzicopoulos, P. (2006). Younger children’s changing selfconcept:Boys and girls from preschool through secondgrade. The Journal of Genetic Psychology, 167, 289–308.Marsh, H. W. & Ayotte, V. (2003). Do multiple dimensions ofself-concept become more differentiated with age? The differentialdistinctiveness hypothesis. Journal of EducationalPsychology, 95, 687–706.Marsh, H. W. & Martin, A. J. (2011). Academic self-concept andacademic achievement: Relations and causal ordering. BritishJournal of Educational Psychology, 81, 59–77.May, P. (2002). Hamburger Schreib-Probe (HSP) 1–9 (6. Aufl.).Hamburg: vpm.Measelle, J. R. (2005). Children’s self-perceptions as a linkbetween familiy relationship quality and social adaptation toschool. In P. A. Cowan, C. P. Cowan, J. C. Ablow, V. K.Johnson & J. R. Measelle (Eds.), The family context ofparenting in children’s adaptation to elementary school.New Jersey: Erlbaum.Measelle, J. R., Ablow, J. C., Cowan, P. A. & Cowan, C. P.(1998). Assessing young childrens’s view of their academic,social, and emotional lives: An evaluation of the self-perceptionscales of the Berkeley Puppet Interview. Child Development,69, 1556 –1576.Nicholls, J. G. (1978). The development of the concepts of effortand ability, perception of academic attainment, and the understandingthat difficult tasks require more ability. ChildDevelopment, 49, 800–814.Petermann, F. (2008). Editorial zum Themenschwerpunkt:Kompetenz- und Leistungsdiagnostik zum Schuleintritt.Psychologie in Erziehung und Unterricht, 55, 81 –83.Petermann, F. & Schmidt, M. H. (2006). Ressourcen – einGrundbegriff der Entwicklungspsychopathologie und <strong>Entwicklungspsychologie</strong>.Kindheit und Entwicklung, 15, 118–127.Piaget, J. (1960). The psychology of intelligence. Patterson:Littlefield-Adams.Renner, G., Martschinke, S., Munser-Kiefer, M. & Steinmüller,S. (2011). Diagnose und Förderung des Selbstkonzepts imAnfangsunterricht. In F. Hellmich (Hrsg.), Selbstkonzepte imGrundschulalter: Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogischeKonsequenzen. Stuttgart: Kohlhammer.Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Michel, E. & Roebers,C. M. (2010). Exekutive Funktionen: Zugrundeliegendekognitive Prozesse und deren Korrelate bei Kindern imspäten Vorschulalter. Zeitschrift für <strong>Entwicklungspsychologie</strong>und Pädagogische Psychologie, 42, 99–110.
112 Patrizia Cimeli, Marianne Röthlisberger, Regula Neuenschwander und Claudia M. RoebersShavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, G. C. (1976). Selfconcept:Validation of construct interpretation. Review ofEducational Research, 46, 407–441.Verschueren, K., Buyck, P. & Marcoen, A. (2001). Self-representationsand socioemotional competences in young children:A 3-year longitudinal study. Developmental Psychology,37, 126–134.Verschueren, K., Doumen, S. & Buyse, E. (2012). Relationshipswith mother, teacher, and peers: Unique and joint effects onyoung children‘s self-concept. Attachment & Human Development,14, 233–248.Verschueren, K., Marcoen, A. & Buyck, P. (1998). Five-yearold’sbehaviorally presented self-esteem: Relations to selfperceptionsand stability across a three-year period. TheJournal of Genetic Psychology, 159, 273–279.Wegener, B. (1988). Kritik des Prestiges. Opladen: WestdeutscherVerlag.Werner, E. E. (2007). Resilienz: Ein Überblick über internationaleLängsschnittstudien. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.),Was Kinder stärkt – Erziehung zwischen Risiko und Resilienz.München: Reinhardt.Dr. phil. Patrizia CimeliDr. phil. Regula NeuenschwanderDr. phil. Marianne RöthlisbergerProf. Dr. Claudia M. RoebersInstitut für Psychologie der Universität Bern<strong>Abteilung</strong> <strong>Entwicklungspsychologie</strong>Muesmattstrasse 453000 BernSchweizE-Mail: patrizia.cimeli@psy.unibe.ch