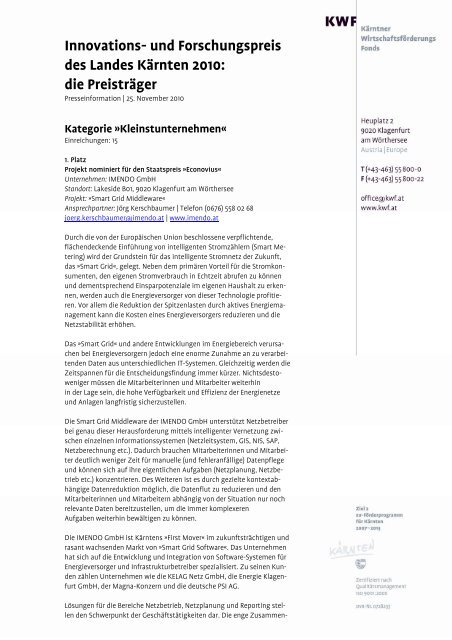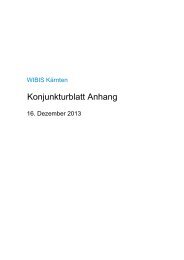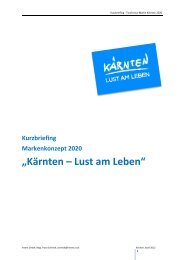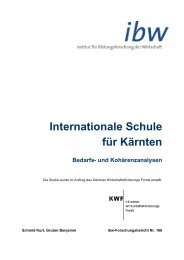Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten 2010 ... - KWF
Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten 2010 ... - KWF
Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten 2010 ... - KWF
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Innovations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forschungspreis</strong><br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> <strong>Kärnten</strong> <strong>2010</strong>:<br />
die Preisträger<br />
Presseinformation | 25. November <strong>2010</strong><br />
Kategorie »Kleinstunternehmen«<br />
Einreichungen: 15<br />
1. Platz<br />
Projekt nominiert für den Staatspreis »Econovius«<br />
Unternehmen: IMENDO GmbH<br />
Standort: Lakeside B01, 9020 Klagenfurt am Wörthersee<br />
Projekt: »Smart Grid Middleware«<br />
Ansprechpartner: Jörg Kerschbaumer | Telefon (0676) 558 02 68<br />
joerg.kerschbaumer@imendo.at | www.imendo.at<br />
Durch die von der Europäischen Union beschlossene verpflichtende,<br />
flächendeckende Einführung von intelligenten Stromzählern (Smart Metering)<br />
wird der Gr<strong>und</strong>stein für das intelligente Stromnetz der Zukunft,<br />
das »Smart Grid«, gelegt. Neben dem primären Vorteil für die Stromkonsumenten,<br />
den eigenen Stromverbrauch in Echtzeit abrufen zu können<br />
<strong>und</strong> dementsprechend Einsparpotenziale im eigenen Haushalt zu erkennen,<br />
werden auch die Energieversorger von dieser Technologie profitieren.<br />
Vor allem die Reduktion der Spitzenlasten durch aktives Energiemanagement<br />
kann die Kosten eines Energieversorgers reduzieren <strong>und</strong> die<br />
Netzstabilität erhöhen.<br />
Das »Smart Grid« <strong>und</strong> andere Entwicklungen im Energiebereich verursachen<br />
bei Energieversorgern jedoch eine enorme Zunahme an zu verarbeitenden<br />
Daten aus unterschiedlichen IT-Systemen. Gleichzeitig werden die<br />
Zeitspannen für die Entscheidungsfindung immer kürzer. Nichts<strong>des</strong>toweniger<br />
müssen die Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter weiterhin<br />
in der Lage sein, die hohe Verfügbarkeit <strong>und</strong> Effizienz der Energienetze<br />
<strong>und</strong> Anlagen langfristig sicherzustellen.<br />
Die Smart Grid Middleware der IMENDO GmbH unterstützt Netzbetreiber<br />
bei genau dieser Herausforderung mittels intelligenter Vernetzung zwischen<br />
einzelnen Informationssystemen (Netzleitsystem, GIS, NIS, SAP,<br />
Netzberechnung etc.). Dadurch brauchen Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
deutlich weniger Zeit für manuelle (<strong>und</strong> fehleranfällige) Datenpflege<br />
<strong>und</strong> können sich auf ihre eigentlichen Aufgaben (Netzplanung, Netzbetrieb<br />
etc.) konzentrieren. Des Weiteren ist es durch gezielte kontextabhängige<br />
Datenreduktion möglich, die Datenflut zu reduzieren <strong>und</strong> den<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeitern abhängig von der Situation nur noch<br />
relevante Daten bereitzustellen, um die immer komplexeren<br />
Aufgaben weiterhin bewältigen zu können.<br />
Die IMENDO GmbH ist <strong>Kärnten</strong>s »First Mover« im zukunftsträchtigen <strong>und</strong><br />
rasant wachsenden Markt von »Smart Grid Software«. Das Unternehmen<br />
hat sich auf die Entwicklung <strong>und</strong> Integration von Software-Systemen für<br />
Energieversorger <strong>und</strong> Infrastrukturbetreiber spezialisiert. Zu seinen K<strong>und</strong>en<br />
zählen Unternehmen wie die KELAG Netz GmbH, die Energie Klagenfurt<br />
GmbH, der Magna-Konzern <strong>und</strong> die deutsche PSI AG.<br />
Lösungen für die Bereiche Netzbetrieb, Netzplanung <strong>und</strong> Reporting stellen<br />
den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeiten dar. Die enge Zusammen-
arbeit mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, der Plattform »Smart<br />
Grids Austria«, der build! Gründerzentrum <strong>Kärnten</strong> GmbH <strong>und</strong> anderen<br />
Forschungseinrichtungen garantieren hierbei einen hohen <strong>Innovations</strong>faktor.<br />
2. Platz<br />
Unternehmen: Sauper Umweltdatentechnik GmbH<br />
Standort: Koschatstraße 131, 9020 Klagenfurt am Wörthersee<br />
Projekt: »MICARGE | Strom(tank)stellensystem samt Betriebsinfrastruktur«<br />
Ansprechpartner: DI Eckhard Sauper | Telefon (0463) 571 01<br />
office@sauper.at | www.sauper.at<br />
Das Thema Elektromobilität ist eine der größten Herausforderungen<br />
unserer hypermodernen Gesellschaft <strong>und</strong> verlangt nach einer vollkommen<br />
neuen Wertanalyse zur Findung einer ganzheitlichen Lösung. Energiewirtschaft,<br />
Automobilindustrie, Steckerhersteller sowie politische<br />
Kräfte müssen für eine Lösung kreative, innovative Strategien <strong>und</strong> Alternativen<br />
in ihre Entscheidungen einbeziehen.<br />
Die Firma Sauper Umweltdatentechnik GmbH aus Klagenfurt hat im<br />
Rahmen <strong>des</strong> angewandten Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsprojekts<br />
MICARGE (= Modular Intelligent CAR Charge System) nach genauer Wertanalyse<br />
ein neues, modernes Strom(tank)stellensystem für Elektrofahrzeuge<br />
für La<strong>des</strong>tröme bis 63 A <strong>und</strong> La<strong>des</strong>pannungen bis 380 V inklusive<br />
Betriebsinfrastruktur entwickelt. Zu den wichtigsten Entwicklungszielen<br />
zählten die größtmögliche Bedienungssicherheit, ein maximaler Witterungs-<br />
<strong>und</strong> Vandalismusschutz, ein integriertes Energiemanagementsystem<br />
sowie eine einfache Abrechnung. Auch ein spezielles Verfahren <strong>und</strong><br />
eine Internetplattform zur Abwicklung von Strombetankungen wurden<br />
konzipiert.<br />
Das System basiert auf einem weltweit völlig neuen Gr<strong>und</strong>konzept, bestehend<br />
aus einer einfachen, preisgünstigen Gr<strong>und</strong>einheit (Docking Station<br />
= Steckdose), einem Initialisierungstool (Mastermodul) <strong>und</strong> einem<br />
mobilen Usermodul (Stecker, intelligentes Ladekabel), in welchem die<br />
gesamte Schutz-, Mess- <strong>und</strong> Kommunikationselektronik untergebracht<br />
ist. Eine Hochstromsteckverbindung unter dem Namen ARHDC (= Application<br />
Related and Heavy Duty Connector) soll eine sichere <strong>und</strong> einfache<br />
Bedienung garantieren. Erfindungen im Rahmen <strong>des</strong> Projekts wurden<br />
national <strong>und</strong> international zum Patent angemeldet.<br />
Vorteile <strong>des</strong> neuen Tankstellenkonzepts ergeben sich in erster Linie aus<br />
den preisgünstigen »Tanksteckdosen«, die sowohl zu Hause als auch am<br />
Arbeitsplatz <strong>und</strong> an öffentlichen Plätzen installiert werden können. Derzeit<br />
laufen Feldversuche in mehreren B<strong>und</strong>esländern in Österreich.<br />
Das Projekt wird von der FFG | Österreichische Forschungsförderungs-<br />
gesellschaft mbH <strong>und</strong> dem <strong>KWF</strong> | Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds<br />
gefördert.<br />
3. Platz<br />
Unternehmen: MTA Messtechnik GmbH<br />
Standort: Handelsstraße 14 - 16, 9300 St. Veit an der Glan<br />
Projekt: »WCS | Water Control System«<br />
Ansprechpartner: Marko Taferner | Telefon (0664) 160 13 66<br />
office@mta-messtechnik.at | www.mta-messtechnik.at<br />
Die MTA Messtechnik GmbH ist ein Unternehmen, das sich
mit erdvergrabenen Leitungssystemen – vorzugsweise Wasserrohrnetzen<br />
<strong>und</strong> Kanalisationen – beschäftigt. Weitgehend unbeachtet liegt unter der<br />
Erde ein viele Milliarden Euro teures, weitverzweigtes Rohrnetz von Tausenden<br />
Kilometern Länge. Es muss laufend gewartet, verbessert <strong>und</strong><br />
erneuert werden, damit die Ansprüche an eine funktionierende Trinkwasserver-<br />
<strong>und</strong> Abwasserentsorgung zur Zufriedenheit der Abnehmer erfüllt<br />
werden.<br />
Die MTA Messtechnik GmbH sieht es als ihre unternehmerische Aufgabe,<br />
durch die Entwicklung neuer Geräte <strong>und</strong> besserer Verfahren zur wirtschaftlichen<br />
<strong>und</strong> technischen Optimierung dieser Infrastruktur beizutragen.<br />
Je schneller <strong>und</strong> genauer Schwachstellen – wie etwa Rohrgebrechen<br />
oder hydraulische Anomalien – entdeckt werden, umso besser kann der<br />
betriebliche Ablauf organisiert werden.<br />
Diese Überlegung hat zur Entwicklung <strong>des</strong> »WCS – Water Control System«<br />
geführt. Es ermöglicht an allen aussagefähigen Stellen eines Rohrnetzes,<br />
auch dort, wo es bisher nicht möglich war, Daten zu erfassen, zu speichern<br />
<strong>und</strong> zu analysieren. Das ist die Voraussetzung, um rasch zu reagieren,<br />
Kosten zu sparen <strong>und</strong> Schäden abzuwenden. Das WCS ist unabhängig<br />
von Stromversorgungen <strong>und</strong> Datenübertragungskabeln. Es ist für die<br />
rauen Anforderungen an den Einsatzstellen (Schächte, Brunnenstuben<br />
etc.) ausgelegt. Es kann acht Messwerte – analog oder digital – parallel<br />
aufnehmen <strong>und</strong> verarbeiten. Im Onlinemodus sind Betriebsabläufe<br />
schnell <strong>und</strong> effizient steuerbar. Die Daten werden über drahtlose Telefonverbindungen<br />
an einen Server geleitet. Dort sind sie über das Internet mit<br />
einem Passwort jederzeit verfügbar. Die Betriebsführung kann von jedem<br />
beliebigen Ort aus mit einem geeigneten Handy oder einem Computer in<br />
den betrieblichen Ablauf eingreifen. Es geht bis zur Ortung von Leckstellen<br />
mit einem internetfähigen Handy; dadurch können Wasserverluste<br />
gesenkt werden.<br />
Damit ist das WCS für Wasserwerke, die zu wenige Informationen über<br />
das Geschehen im Netz haben, eine kostengünstige Möglichkeit, ihren<br />
Informationsstand zu verbessern <strong>und</strong> die Betriebsführung zu optimieren.<br />
Die Bedeutung <strong>des</strong> WCS zeigt sich an dem großen Interesse, welches das<br />
System bereits in der ersten Phase der Markteinführung bei in- <strong>und</strong> ausländischen<br />
Anwendern geweckt hat.<br />
Kategorie »Klein- <strong>und</strong> Mittelunternehmen«<br />
Einreichungen: 11<br />
1. Platz<br />
Projekt nominiert für den »Staatspreis Innovation«<br />
Unternehmen: Ortner Reinraumtechnik GmbH<br />
Standort: Uferweg 7, 9500 Villach<br />
Projekt: »Multifunktionale Isolatoranlage mit H 2O 2-<br />
Moduldekontamination«<br />
Ansprechpartner: DI Roland Stampf<br />
Telefon (04242) 311 660-0<br />
roland.stampf@ortner-group.at | www.ortner-group.at<br />
Die Firma Ortner Reinraumtechnik GmbH ist als Geräte- <strong>und</strong> Anlagenhersteller<br />
für Reinraumanforderungen auf die Schaffung von reinen Umgebungen<br />
spezialisiert. Für ihre K<strong>und</strong>en im gesamten Life-Science-Bereich<br />
schafft die Firma reine <strong>und</strong> hochwertige Produktionsprozesse für sichere<br />
Endprodukte:
Eine Isolatoranlage ist für den Einsatz bei der Herstellung von Arzneimitteln<br />
<strong>und</strong> klinischen Prüfwaren konzipiert. Solche Anlagen sind oft für<br />
Betreiber <strong>und</strong> Anwender umständlich, teuer <strong>und</strong> unflexibel im täglichen<br />
Handling.<br />
Mit der multifunktionalen Isolatoranlage hat die Ortner Reinraumtechnik<br />
GmbH erstmals eine Anlage entwickelt, welche die Verarbeitung von<br />
pharmazeutischen <strong>und</strong> klinischen Produkten wesentlich vereinfacht. Die<br />
Entwicklungsingenieure haben sich über den gesamten Entstehungsprozess<br />
der Anlage hinweg besonders dem Thema »Quality by Design« verschrieben:<br />
In Zusammenarbeit <strong>und</strong> in Abstimmung mit Behörden, K<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> Wissenschafts- <strong>und</strong> Forschungspartnern wurde ein multidimensionaler<br />
Design Space kreiert.<br />
Die Anlage selbst bietet damit neben einer angedockten Gefriertrocknereinheit<br />
auch ein umfangreiches H 2O 2-Dekontaminationssystem.<br />
Sie wurde so konzipiert, dass selbst parallel laufende Produktions- <strong>und</strong><br />
Dekontaminationsprozesse jederzeit möglich sind. Zeit <strong>und</strong> Kosten für<br />
die aseptische Produktion können damit viel besser in Einklang gebracht<br />
werden. Nicht zu vergessen die Flexibilität im Einsatz: Durch schnelle <strong>und</strong><br />
einfache Umrüstprozesse innerhalb der Anlage ist ein kurzfristiger Wechsel<br />
von Produktionseinheiten für den K<strong>und</strong>en nunmehr möglich.<br />
Die Firma Ortner Reinraumtechnik GmbH liefert damit als europäisches<br />
Unternehmen einen Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in<br />
der Life-Science-Industrie.<br />
2. Platz<br />
Unternehmen: ESTEC Energiespartechnik Süd GmbH<br />
Standort: Wirtschaftspark 14, 9130 Poggersdorf<br />
Projekt: »OMEGA | Technologie für Sonnenkollektoren«<br />
Ansprechpartner: Roland Grubelnig | Telefon (0650) 403 20 92<br />
roland.grubelnig@rg-fertigungstechnik.at | www.estec-solar.at<br />
Primäre Tätigkeitsbereiche der ESTEC Energiespartechnik Süd GmbH sind<br />
die Herstellung <strong>und</strong> der Vertrieb von thermischen Solarsystemen, wobei<br />
sowohl die Sonnenkollektoren als auch das dazugehörige Befestigungsmaterial<br />
in der eigenen Fertigung produziert werden.<br />
Das Herzstück eines thermischen Sonnenkollektors ist der wasserfüh-<br />
rende, hochselektiv beschichtete Absorber. Als Schlüsselfaktor für die<br />
Produktion <strong>des</strong> Absorbers kann die Verbindungstechnologie <strong>des</strong> Absorberblechs<br />
mit dem wasserführenden Register gesehen werden. Es gilt<br />
hier, einerseits eine langlebige, robuste Verbindung herzustellen <strong>und</strong><br />
andererseits einen optimalen Wärmeübergang zwischen Absorberblech<br />
<strong>und</strong> Register zu erreichen.<br />
Durch den erstmaligen Einsatz <strong>des</strong> Druckprägeverfahrens in Kombination<br />
mit Omegablechen konnte eine neue Generation von Solarabsorbern<br />
entwickelt werden. Dabei werden die Registerrohre vom Omegablech<br />
umschlossen <strong>und</strong> dieses mit dem Absorberblech durch Druckprägung<br />
mechanisch verb<strong>und</strong>en. Der dadurch erhaltene Zusammenschluss zeichnet<br />
sich durch hohe Festigkeit <strong>und</strong> einen optimalen Wärmeübergang aus.<br />
Ein weiterer Vorteil resultiert aus der nicht starren Verbindung zwischen<br />
dem Register aus Kupfer <strong>und</strong> dem Absorberblech aus Aluminium. Beide<br />
Komponenten können sich trotz unterschiedlicher Wärmeausdehnung<br />
spannungsfrei bewegen. Das garantiert neben optischen Vorteilen<br />
auch eine sehr lange Lebensdauer.
Die Fertigungsanlage für diese Technologie, die in der zur Unternehmensgruppe<br />
gehörenden Maschinenbaufirma hergestellt wird, überzeugt<br />
besonders durch ihre Wirtschaftlichkeit in Bezug auf Anlage- <strong>und</strong> Betriebskosten.<br />
Besonderes Augenmerk wird auf eine störungsfreie Produktion<br />
gelegt. So gewährleistet die Anlage ein hervorragen<strong>des</strong> Maß an Prozesssicherheit.<br />
Um diese neue Technologie <strong>und</strong> ihre Vorteile auch anderen Produzenten<br />
zugänglich zu machen, werden nicht nur die Absorber, sondern auch die<br />
Fertigungsanlagen weltweit angeboten.<br />
3. Platz<br />
Unternehmen: T.I.P.S. Messtechnik GmbH<br />
Standort: Getreideweg 1, 9500 Villach<br />
Projekt: »TPR | T.I.P.S. Probe Refresher«<br />
Ansprechpartner: DI Dr. Martin Eberhart | Telefon (04242) 319 720-0<br />
m.eberhart@tips.co.at | www.tips.co.at<br />
Innovationen <strong>und</strong> Lösungen als Schwerpunkt <strong>und</strong> Unternehmensleitbild<br />
sollen unseren K<strong>und</strong>en die Sicherheit geben, gemeinsam mit uns stets<br />
am neuesten Stand der Technik zu sein. Die Philosophie der T.I.P.S. Messtechnik<br />
GmbH ist, unseren K<strong>und</strong>en Messgeräte <strong>und</strong> Mikrochip-<br />
Testinterfaces aus einer Hand anbieten zu können.<br />
Eine der Kernkompetenzen <strong>des</strong> Unternehmens liegt im Bereich Forschung<br />
<strong>und</strong> Entwicklung (F&E) mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von<br />
Messkonzepten <strong>und</strong> Verfahren für Mikrochipkontaktierungen. Durch die<br />
Kombination von angewandter Physik mit Elektronik, Feinmechanik <strong>und</strong><br />
Simulationen <strong>und</strong> die Kooperation mit Forschungseinrichtungen bieten<br />
wir unseren K<strong>und</strong>en ein maßgeschneidertes F&E-Konzept.<br />
Im Bereich der elektrischen Prüfung von Halbleiter-Mikrochips werden<br />
zur elektrischen Kontaktierung <strong>des</strong> »nackten«, sich noch im Halbleiter-<br />
Wafer befindenden Chips so genannte Nadelkarten eingesetzt. Feinste<br />
Wolframnadeln mit Drahtstärken von 100 bis 300 Mikrometern <strong>und</strong> definierter,<br />
halb-kugelförmiger Spitze mit Spitzendurchmessern im Bereich<br />
von 20 bis 150 Mikrometern stellen den elektrischen Kontakt zur Prüfspitze<br />
her.<br />
Der Mechanismus der Kontaktierung besteht im Andrücken der Prüfspitzen<br />
auf die entsprechenden Kontaktflächen (so genannte »Bond-Pads«)<br />
<strong>des</strong> Mikrochips. Dabei führen die Prüfspitzen eine gleitende Bewegung<br />
auf der metallischen Kontaktfläche aus <strong>und</strong> dringen wenige Mikrometer<br />
tief in die Kontaktfläche ein. Durch die hohe Anzahl von Kontaktierungen<br />
(mehrere h<strong>und</strong>erttausend) in der Serienprüfung verschleißen die Prüfspitzen<br />
<strong>und</strong> die ursprünglich halbkugelförmige Spitzenform wird abgeflacht.<br />
Dies führt letztendlich zu einer Verschlechterung der Kontakteigenschaften,<br />
weiters zur Vergrößerung der Kontaktfläche, wodurch die<br />
Nadelkarte schlussendlich unbrauchbar wird.<br />
Durch die Entwicklung eines Schleifverfahrens, das auf der Erfindung<br />
eines Schleifkopfes, eines Präzisionssensors zur Detektion der Nadelspitzen<br />
<strong>und</strong> der entsprechenden Bewegungsabläufe beruht, können verschlissene,<br />
abgeflachte Nadelspitzen so nachgeschliffen werden, dass<br />
sich wieder eine halbkugelförmige Kontaktspitze ergibt. Damit lässt<br />
sich die Lebensdauer einer Nadelkarte auf das bis zu Vierfache –<br />
verglichen mit einer nicht mit der Nadelschleifmaschine bearbeiteten –<br />
erhöhen.
Da es derzeit auf dem Weltmarkt kein dem TPR vergleichbares Produkt<br />
gibt, kann die T.I.P.S. Messtechnik GmbH damit zusätzliche Marktanteile<br />
auch im Kerngeschäft Mikrochipkontaktierungen generieren.<br />
Kategorie »Großunternehmen«<br />
Einreichungen: 14<br />
1. Platz<br />
Projekt nominiert für den »Staatspreis Innovation«<br />
Unternehmen: Lantiq A GmbH<br />
Standort: Siemensstraße 4, 9500 Villach<br />
Projekt: »MELT | Metallic Line Testing«<br />
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Gerhard Nössing | Telefon (04242) 9008-0<br />
gerhard.noessing@lantiq.com | www.lantiq.com<br />
Die Lantiq Gruppe bietet ihren K<strong>und</strong>en weltweit innovative Halbleiterlösungen<br />
für High-Speed-Netzwerke der nächsten Generation <strong>und</strong> digitale<br />
Heimnetzwerke an.<br />
Innerhalb der Lantiq Gruppe ist das österreichische Unternehmen für die<br />
Entwicklung, das Testen <strong>und</strong> die Applikationsunterstützung von speziellen<br />
analogen <strong>und</strong> gemischt analog-digitalen Funktionsmodulen bei Mikrochips<br />
verantwortlich.<br />
Zurzeit vollzieht sich ein Wandel bei Kommunikationssystemen. Anstatt<br />
analoge Sprachsignale <strong>und</strong> digitale Datensignale mittels einer Telefonleitung<br />
zu übertragen, geht man dazu über, alle Daten digital zu übertragen<br />
<strong>und</strong> die digitalen Sprachdaten erst im Endgerät (Modem) wieder in analoge<br />
Signale umzuwandeln. Zusätzlich werden auch verstärkt digitale<br />
Dienste wie zum Beispiel Fernsehen (IPTV) beziehungsweise Video on<br />
Demand angeboten.<br />
Der Wegfall der analogen Sprachübertragung nimmt den Netzbetreibern<br />
allerdings die Möglichkeit, die Leitung wie bisher zu testen. Jahrelange<br />
Versuche, eine sinnvolle Testabdeckung über Single Ended Line Testing<br />
(SELT) zu erreichen, waren erfolglos. Durch die verwendeten Übertrager<br />
bei DSL ist nämlich der Chipsatz galvanisch von der Leitung getrennt,<br />
wodurch wichtige Informationen der verwendeten Testsignale verloren<br />
gehen.<br />
Immer wieder wurde von den Netzbetreibern beim internationalen Standardisierungsgremium<br />
für Telekommunikation (ITU-T) die Forderung<br />
nach einer besseren Testabdeckung erhoben.<br />
Erst mit der Entwicklung <strong>des</strong> MELT-Chipsatzes von Lantiq konnte hier ein<br />
Durchbruch erzielt werden. Mit Metallic Line Testing (MELT) kann man<br />
direkt auf die Kupferleitung (»Metallic«) zugreifen <strong>und</strong> somit mehr Informationen<br />
über den Leitungszustand erhalten. So lässt sich zum Beispiel<br />
ermitteln, wie weit die Teilnehmerin oder der Teilnehmer von der Vermittlungsstelle<br />
entfernt ist, ob dort Endgeräte angeschlossen sind, ob eine<br />
Leitung unterbrochen ist, ob eine personengefährdende Spannung vorliegt<br />
<strong>und</strong> vieles mehr.<br />
Ein weiteres wichtiges Merkmal <strong>des</strong> MELT-Chipsatzes von Lantiq ist auch,<br />
dass die MELT-Messung parallel zum laufenden Betrieb (zum Beispiel TV-<br />
Empfang) stattfinden kann, ohne die Datenübertragung zu stören.<br />
Mit diesem Werkzeug ist es für die Netzwerkbetreiber möglich, die Qualität<br />
der DSL-Leitungen zu überprüfen <strong>und</strong> somit dem Endk<strong>und</strong>en eine
störungsfreie Leitung anzubieten. Die Bedeutung unserer MELT-Lösung<br />
ist wohl am besten daran zu sehen, dass es gelungen ist, sie innerhalb<br />
nur eines Jahres als ITU-T Standard (G.996.2) zu verabschieden.<br />
2. Platz<br />
Projekt nominiert für den »Staatspreis Innovation«<br />
Unternehmen: Treibacher Industrie AG<br />
Standort: Auer von Welsbach Straße 1, 9330 Althofen<br />
Projekt: »Umweltfre<strong>und</strong>licher Abgaskatalysator zur Entfernung von Luftschadstoffen<br />
aus Abgasen von Dieselmotoren«<br />
Ansprechpartner: Dr. Stefan Pirker | Telefon (04262) 505-0<br />
stefan.pirker@treibacher.com | www.treibacher.com<br />
Seit Jahrzehnten gehört die Treibacher Industrie AG zu den international<br />
führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Chemie <strong>und</strong> Metallurgie.<br />
Die Produktpalette reicht von Ferrolegierungen für die Stahl- <strong>und</strong> Gießereiindustrie<br />
über Pulver für die Hochleistungskeramik <strong>und</strong> Werkstoffe<br />
für die Hartmetallindustrie bis zu Feinchemikalien.<br />
Wichtiger Teil der Unternehmensziele ist es, die Umwelt intakt zu halten<br />
<strong>und</strong> nachhaltig zu schützen. Dies verfolgen wir nicht nur mit einer konsequenten<br />
Umweltpolitik, sondern auch durch neue Produktentwicklungen.<br />
Die Treibacher Industrie AG hat ein völlig neuartiges, umweltfre<strong>und</strong>liches<br />
<strong>und</strong> toxikologisch unbedenkliches Material, einen Vanadat-<br />
Katalysator, zur Entfernung von Stickoxiden aus Abgasen von Verbrennungsmotoren<br />
entwickelt. Dieses wird vorwiegend in Lkws (on-road),<br />
aber auch in Traktoren, Baumaschinen, Schiffen <strong>und</strong> Lokomotiven (offroad)<br />
eingesetzt. Das neu entwickelte Material – eine Kombination aus<br />
Seltenen Erden, Eisen <strong>und</strong> Vanadium – eignet sich zur Fertigung sowohl<br />
von beschichteten Abgaskatalysatoren als auch von Vollkatalysatoren.<br />
Der so genannte Vanadat-Katalysator ist ein hochtemperaturbeständiges<br />
Schlüsselprodukt, mit dem es gelingt, die drastisch gesenkten Grenzwerte<br />
für Stickoxide zukünftiger Abgasnormen (zum Beispiel EURO 6, Einführung<br />
2013/14) sowohl on-road als auch off-road zu erreichen.<br />
Mit dem Vanadat-Katalysator steht ein weltweit einzigartiges, toxikologisch<br />
unbedenkliches <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>liches Material in praktischer<br />
Erprobung, das die Konkurrenzfähigkeit dieser Katalysatorentechnologie<br />
für Dieselmotoren unter Beweis stellen soll. Es stellt eine deutliche Verbesserung<br />
zu den derzeit in Verwendung stehenden, nicht temperaturbeständigen<br />
<strong>und</strong> in verschiedenen Ländern als umweltbedenklich eingestuften<br />
Vanadin-Katalysatoren dar.<br />
3. Platz<br />
Unternehmen: SONNENKRAFT<br />
Standort: Industriepark, 9300 St. Veit an der Glan<br />
Projekt: »SKR500 | Der Sonnenkollektor der Zukunft«<br />
Ansprechpartner: DI (FH) Martin Wagner | Telefon (04212) 450 10-0<br />
martin.wagner@generalsolar.com | www.sonnenkraft.com<br />
SONNENKRAFT zählt zu Europas Marktführern im Bereich Solarenergie<br />
<strong>und</strong> ist Österreichs klare Nummer 1. Das Kerngeschäft <strong>des</strong> Unternehmens<br />
basiert auf dem Vertrieb von innovativen Produkten zur ökologisch erneuerbaren<br />
Heizenergiegewinnung durch die Kraft der Sonne. Seit der<br />
Gründung im Jahr 1993 hat sich SONNENKRAFT als der Spezialist bei Solarlösungen<br />
zum Marktführer in Österreich, Italien <strong>und</strong> Dänemark entwickelt.<br />
SONNENKRAFT verfügt über ein europaweites Vertriebsnetzwerk
<strong>und</strong> eigene Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien,<br />
Österreich, Dänemark, Portugal <strong>und</strong> der Schweiz. SONNENKRAFT ist<br />
Spezialist für Systemlösungen im Bereich Heizung/Warmwasser <strong>und</strong><br />
Brauchwassererwärmung.<br />
In den letzten zehn Jahren war der Sonnenkollektor SK500 das »Zugpferd«<br />
im Portfolio von SONNENKRAFT. Markt <strong>und</strong> Mitbewerb verlangten<br />
nach einer Innovation. Die Entwicklung <strong>und</strong> Realisierung <strong>des</strong> Produkts<br />
SKR500 ist von zentraler Bedeutung für SONNENKRAFT in Österreich <strong>und</strong><br />
europaweit. Der neue Kollektor gilt als absolute Sensation in der Solarbranche<br />
<strong>und</strong> als Aushängeschild für Innovation in Bezug auf Technik,<br />
Design <strong>und</strong> K<strong>und</strong>ennutzen.<br />
Die Entwicklung wurde in ausgezeichneter Kooperation mit dem Entwicklungspartner<br />
<strong>und</strong> Produktionsunternehmen GREENoneTEC durchgeführt,<br />
welches dafür die modernste Kollektorfertigungslinie der Welt errichtet<br />
hat. Insgesamt wurden dafür zehn neue Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
aufgenommen.<br />
Besondere Merkmale:<br />
• Einzigartiges, rahmenloses Design in Anlehnung an das iPhone von<br />
Apple (Glas reicht bis zum Kollektorrand)<br />
• 2,57 m² Bruttofläche, formschön, nur 38 kg<br />
• Absorber: Al/Cu, Mäander, vier Anschlüsse<br />
• Verfügbar als Hoch- <strong>und</strong> Querformatkollektor<br />
• Quick & Easy Befestigungssystem für alle gängigen Anwendungsbereiche,<br />
Montage mit nur einem Werkzeug<br />
• Exklusiver, werkzeugloser, hydraulischer Schnellverbinder<br />
• Tiefgezogene Aluminiumwanne mit integriertem Befestigungssystem<br />
• Montage in wenigen Minuten<br />
• Kollektor <strong>und</strong> Befestigung statisch ausgelegt gemäß DIN 1055 <strong>und</strong> EC<br />
1991<br />
• Verbesserte Leistungswerte<br />
• Selbstentleerung, exzellentes Stagnationsverhalten<br />
• Kosteneffizienz<br />
Sonderpreis »<strong>Innovations</strong>kultur«<br />
Einreichungen: 16 | 2. u. 3. Platz werden nicht vergeben!<br />
Unternehmen: Treibacher Industrie AG<br />
Standort: Auer von Welsbach Straße 1, 9330 Althofen<br />
Ansprechpartner: Dr. Stefan Pirker | Telefon (04262) 505-0<br />
stefan.pirker@treibacher.com | www.treibacher.com<br />
Innovation ist seit über h<strong>und</strong>ert Jahren ein wesentlicher Faktor für den<br />
Unternehmenserfolg der Treibacher Industrie AG. Die Systematik <strong>des</strong><br />
<strong>Innovations</strong>managements wurde über die Jahre kontinuierlich verbessert.<br />
Nur so kann die Treibacher Industrie AG mit einer Exportquote von über<br />
80 Prozent gegen Wettbewerber vor allem aus Asien <strong>und</strong> China auch<br />
weiterhin bestehen.<br />
Die Unternehmenskultur ist von der Idee bis zur Markteinführung eines<br />
Produkts auf Innovation ausgerichtet. Das unterstreicht auch der Leitsatz<br />
<strong>des</strong> Unternehmens: »Innovation ist unsere Tradition.« Ausgehend vom<br />
betrieblichen Vorschlagswesen in den 1970er-Jahren hat sich der <strong>Innovations</strong>prozess<br />
mit der Einführung <strong>des</strong> umfassenden Stage-Gate®-<br />
Prozesses im Unternehmen noch stärker institutionalisiert.
Am Standort Althofen kann auf Gr<strong>und</strong> <strong>des</strong> engen Zusammenwirkens von<br />
Markt- <strong>und</strong> Technologieentwicklung, Forschung <strong>und</strong> Entwicklung (F&E),<br />
Produktion, Produktmanagement <strong>und</strong> Verkauf sehr schnell auf K<strong>und</strong>enbedürfnisse<br />
reagiert werden. Zielgerichtete Ideengenerierung, nachfolgende<br />
Evaluierung, Selektion <strong>und</strong> Umsetzung in Projekten werden durch<br />
kurze Wege <strong>und</strong> schnelle Entscheidungen unterstützt <strong>und</strong> gefördert. Im<br />
<strong>Innovations</strong>prozess wird schon früh über die Einbeziehung von externen<br />
Partnern, wie Universitäten, Fachinstituten, Lieferanten <strong>und</strong> Leitk<strong>und</strong>en<br />
entschieden. Dabei wird auf hohe Qualität im Projektmanagement <strong>und</strong><br />
auf langfristige Partnerschaften mit den Beteiligten Wert gelegt. Kooperationen<br />
werden in gr<strong>und</strong>legenden Fragestellungen in den Scale-up-<br />
<strong>und</strong> Pilotierungsphasen bis hin zur Markteinführung durchgeführt.<br />
Das ambitionierte <strong>Innovations</strong>ziel der Treibacher Industrie AG –<br />
ein definierter Anteil am Gesamtdeckungsbeitrag, der durch neue Produkte,<br />
die nicht älter als fünf Jahre sind, erreicht wird – steht regelmäßig<br />
auf dem Prüfstand. Die Geschäftsleitung <strong>und</strong> die Mitarbeiterinnen <strong>und</strong><br />
Mitarbeiter verfolgen die Erreichung der Zielsetzung mit viel Engagement<br />
<strong>und</strong> stehen im ständigen Austausch miteinander.<br />
Allgemeine Informationen<br />
Geschichte<br />
Der »<strong>Innovations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forschungspreis</strong> <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> <strong>Kärnten</strong>« wird seit<br />
1991 jährlich verliehen.<br />
Abwicklung<br />
Für die Gesamtabwicklung zeichnet seit 2004 der <strong>KWF</strong> Kärntner Wirtschaftsförderungs<br />
Fonds verantwortlich.<br />
Ziel & Zweck<br />
Ständiges Forschen <strong>und</strong> Entwickeln sichert nicht nur die Konkurrenzfähigkeit<br />
<strong>und</strong> den Fortbestand eines Unternehmens, sondern auch den<br />
Wohlstand eines Lan<strong>des</strong>. Wie lebenslanges Lernen sollte auch ständiges<br />
Forschen & Entwickeln einen fixen Platz im Lebenszyklus eines Unternehmens<br />
einnehmen. Unabhängig von der Unternehmensgröße gilt es<br />
Forschungs- & Entwicklungsprojekte zu initiieren <strong>und</strong> umzusetzen.<br />
Mit maßgeschneiderten Förderprogrammen unterstützt der <strong>KWF</strong> die F&E-<br />
Aktivitäten der Kärntner Unternehmen. Im institutionellen Bereich werden<br />
universitäre <strong>und</strong> außeruniversitäre Forschungseinrichtungen initiiert<br />
<strong>und</strong> gefördert, um den Kärntner Unternehmen »Andockstationen« für<br />
Kooperationen zu bieten. Als Beispiele sind hier die CTR Carinthian Tech<br />
Research AG, die Lakeside-Labs GmbH <strong>und</strong> die Kompetenzzentrum Holz<br />
GmbH angeführt.<br />
Internationale Studien zeigen, dass ein Zusammenspiel von Unternehmen,<br />
öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> Forschungsinstitutionen bzw. innovativen<br />
Dienstleistungsbetrieben den optimalen Mix zur Standortstärkung<br />
darstellen.<br />
Das langfristige nationale Ziel lautet, die Forschungsquote auf drei Prozent<br />
<strong>des</strong> BIP anzuheben.<br />
Experten sind sich einig, dass im Zuge der Globalisierung Wachstum zu<br />
einem beträchtlichen Teil nur über F&E-Maßnahmen – einhergehend mit<br />
neuen Produkten, Verfahren <strong>und</strong> Dienstleistungen – zu erzielen sein wird.
Die Entwicklung der F&E-Quote <strong>Kärnten</strong>s gemessen an der regionalen<br />
Wirtschaftsleistung | Bruttoregionalprodukt (Quelle: Statistik Austria)<br />
zeigt ein erfreuliches Bild:<br />
• 1993: 0,42%<br />
• 1998: 1,08%<br />
• 2002: 1,81%<br />
• 2004: 2,11% (Platz 3 national)<br />
• 2006: 2,6% (Platz 3 national)<br />
• 2007: 2,4% (Platz 3 national)<br />
Auch die Teilnehmerzahlen (Einreicher »<strong>Innovations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forschungspreis</strong>«)<br />
haben sich gut entwickelt:<br />
• 2003: 15 Einreichungen<br />
• 2004: 29 Einreichungen<br />
• 2005: 43 Einreichungen<br />
• 2006: 36 Einreichungen<br />
• 2007: 35 Einreichungen<br />
• 2008: 29 Einreichungen<br />
• 2009: 38 Einreichungen<br />
• <strong>2010</strong>: 42 Einreichungen (Unternehmen) <strong>und</strong> 56 Bewertungen (14 Unternehmen<br />
haben zusätzlich beim Sonderpreis »<strong>Innovations</strong>kultur«<br />
eingereicht; zwei aus den 42 haben nur beim Sonderpreis eingereicht.)<br />
Die hohe Anzahl an Einreichungen <strong>2010</strong> ist <strong>des</strong>halb bemerkenswert, da es<br />
im Bereich »IKT | Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologien« im<br />
Frühjahr <strong>2010</strong> eine eigene Ausschreibung <strong>und</strong> Prämierung gab.<br />
»<strong>Kärnten</strong> 2020: Zukunft durch Innovation«:<br />
Die <strong>Kärnten</strong>-Strategie für Forschung, Technologieentwicklung <strong>und</strong> Innovation<br />
ist im Vorjahr in Buchform erschienen <strong>und</strong> ist ein Wegweiser, wo<br />
<strong>Kärnten</strong> im Jahr 2020 stehen möchte. Die Publikation ist auf www.kwf.at<br />
unter dem Menüpunkt »Service | Buchtipps« zum kostenfreien Download<br />
verfügbar.<br />
Dotierung IFP | <strong>Innovations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forschungspreis</strong> <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> <strong>Kärnten</strong><br />
<strong>2010</strong><br />
Der »<strong>Innovations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forschungspreis</strong> <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> <strong>Kärnten</strong>« ist die<br />
höchste Auszeichnung, die das Land in diesem Bereich vergibt <strong>und</strong> dementsprechend<br />
begehrt.<br />
Der Preis wird heuer in drei Kategorien <strong>und</strong> mit einem Sonderpreis vergeben:<br />
• Kategorie: Kleinstunternehmen<br />
• Kategorie: Klein- <strong>und</strong> Mittelunternehmen<br />
• Kategorie: Großunternehmen<br />
• Sonderpreis »<strong>Innovations</strong>kultur«<br />
Die Erstplatzierten erhalten jeweils:<br />
• € 10.000,–<br />
• Siegerskulptur: entworfen von Helmut <strong>und</strong> Nicole Schmid | Osaka<br />
(Japan), gefertigt von der HTL Wolfsberg<br />
• Preisträger-Logo zur Führung auf den Geschäftsdrucksorten<br />
Die Erst-, Zweit- <strong>und</strong> Drittplatzierten erhalten jeweils:<br />
• ORF-Spot | Dauer: ca. 2 Minuten | Ausstrahlung: »<strong>Kärnten</strong> heute« |<br />
danach Verwendung für eigene Werbezwecke<br />
• Gerahmte Urk<strong>und</strong>e<br />
• Hochwertige Preisträgertafel mit Projektbeschreibung & Foto <strong>des</strong><br />
Projektteams<br />
• Foto Firmenportrait
• Foto Dokumentation der Preisverleihungsveranstaltung<br />
Aus den insgesamt 10 Platzierten hat die Fachjury drei Unternehmen als<br />
Teilnehmer von <strong>Kärnten</strong> für den »Staatspreis für Innovation <strong>des</strong> BMWFJ |<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Wirtschaft, Familie <strong>und</strong> Jugend« nominiert.<br />
Die Juryentscheidung fiel <strong>2010</strong> auf folgende Betriebe:<br />
• Lantiq A GmbH<br />
• Treibacher Industrie AG<br />
• Ortner Reinraumtechnik GmbH<br />
Nominiert für die Teilnahme am KMU-Staatspreis »Econovius«:<br />
• Imendo GmbH<br />
Die fünf Erstgereihten der drei Kategorien <strong>und</strong> die Gewinnerin, der Gewinner<br />
<strong>des</strong> Sonderpreises dürfen sich zudem über eine Markt- <strong>und</strong> Technologierecherche<br />
der aws | Austria Wirtschaftsservice GmbH im Wert von<br />
je € 1.500,- freuen.<br />
Die Fachjury bestand aus folgenden Mitgliedern:<br />
• Dipl.-Ing. Christoph Adametz<br />
Technische Universität Graz<br />
• Wolfram Anderle<br />
aws | Austria Wirtschaftsservice GmbH<br />
• o.Univ.Prof.Dr.Dr.h.c. Heinrich C. Mayr<br />
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt<br />
• DI Fritz Ohler<br />
Technopolis Forschungs- <strong>und</strong> Beratungsges. mbH<br />
• Dr. Werner Scherf (Jurysprecher)<br />
CTR Carinthian Tech Research AG<br />
• Mag. Klaus Schnitzer<br />
FFG | Österr. Forschungsförderungsgesellschaft mbH<br />
Sprecher der Jury war der Technische Vorstand der CTR Carinthian Tech<br />
Research AG, Dr. Werner Scherf.<br />
Was wurde bewertet?<br />
Prämiert wurden Produkte, Verfahren <strong>und</strong> Dienstleistungen, die ein Unternehmen<br />
entwickelt <strong>und</strong> bereits auf den Markt gebracht hat.<br />
Es mussten zumin<strong>des</strong>t erste Erfahrungen über die Auswirkungen vorliegen.<br />
Der Firmensitz oder die Betriebsstätte, aus der die Innovation kam,<br />
muss sich in <strong>Kärnten</strong> befinden.<br />
Bewertungskriterien<br />
• Neuheit <strong>des</strong> Produkts, <strong>des</strong> Verfahrens oder der Dienstleistung<br />
• Schwierigkeit der Entwicklung<br />
• Nutzen der Innovation (für Anwender, K<strong>und</strong>en, Allgemeinheit)<br />
• Positive Auswirkungen auf die Umwelt (ökologische Vorteile)<br />
• Auswirkungen auf den Markt<br />
• Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg<br />
• Volkswirtschaftliche Effekte<br />
• Bedeutung <strong>des</strong> <strong>Innovations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forschungspreis</strong> für das Unternehmen<br />
selbst<br />
Bewertungskriterien Sonderpreis »<strong>Innovations</strong>kultur«<br />
• Darstellung der eigenen <strong>Innovations</strong>fähigkeit <strong>und</strong> –prozesse<br />
• Konkrete Maßnahmen für die Unterstützung der <strong>Innovations</strong>kraft von<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeitern<br />
• <strong>Innovations</strong>kommunikation <strong>und</strong> –management
• Einwirkungen von Forschungsinstitutionen<br />
Wie wurde bewertet?<br />
Je<strong>des</strong> der sechs Jurymitglieder bewertete unabhängig von den anderen<br />
die eingereichten Projekte nach einem Punktesystem <strong>und</strong> erstellte danach<br />
eine individuelle Rangliste.<br />
Mit dieser Rangliste gingen die Jurymitglieder in die gemeinsame Jurysitzung,<br />
in der die endgültige Reihung festgelegt wurde.<br />
Anhand der Gesamtpunkteanzahl wurden die Sieger <strong>und</strong> die Gereihten<br />
ermittelt. Die ersten drei Kriterien, »Neuheit«, »Schwierigkeit« <strong>und</strong> »Nutzen«,<br />
haben in der Regel eine höhere Gewichtung.<br />
Rückfragehinweis<br />
Mag. Jürgen Kopeinig<br />
T (0463) 55 800-31<br />
M 0664_83 993 31<br />
kopeinig@kwf.at<br />
Fritz Lange<br />
T (0463) 55 800-37<br />
M 0664_83 993 37<br />
lange@kwf.at<br />
Fotobezug (kostenfrei)<br />
Fritz Press GmbH<br />
Margit & Walter Fritz<br />
9020 Klagenfurt | St. Peter Straße 44<br />
T (0463) 34 198-0<br />
M 0676/3434040<br />
office@fritzpress.net<br />
www.fritzpress.net<br />
Download Presseinformation<br />
www.kwf.at/innovationspreis