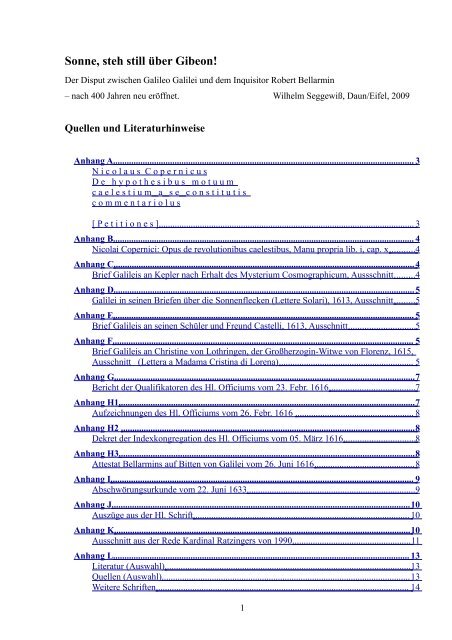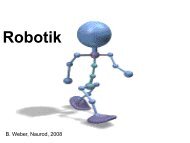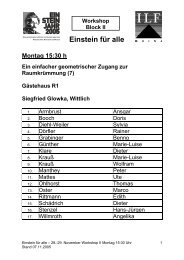Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Sonne</strong>, <strong>steh</strong> <strong>still</strong> <strong>über</strong> <strong>Gibeon</strong>!<br />
Der Disput zwischen Galileo Galilei und dem Inquisitor Robert Bellarmin<br />
– nach 400 Jahren neu eröffnet. Wilhelm Seggewiß, Daun/Eifel, 2009<br />
Quellen und Literaturhinweise<br />
Anhang A....................................................................................................................................<br />
3<br />
N i c o l a u s C o p e r n i c u s<br />
D e h y p o t h e s i b u s m o t u u m<br />
c a e l e s t i u m a s e c o n s t i t u t i s<br />
c o m m e n t a r i o l u s<br />
[ P e t i t i o n e s ] ................................................................................................................ 3<br />
Anhang B....................................................................................................................................<br />
4<br />
Nicolai Copernici: Opus de revolutionibus caelestibus, Manu propria lib. i, cap. x...........<br />
4<br />
Anhang C....................................................................................................................................<br />
4<br />
Brief Galileis an Kepler nach Erhalt des Mysterium Cosmographicum, Aussschnitt.........<br />
4<br />
Anhang D....................................................................................................................................<br />
5<br />
Galilei in seinen Briefen <strong>über</strong> die <strong>Sonne</strong>nflecken (Lettere Solari), 1613, Ausschnitt.........<br />
5<br />
Anhang E....................................................................................................................................<br />
5<br />
Brief Galileis an seinen Schüler und Freund Castelli, 1613, Ausschnitt.............................<br />
5<br />
Anhang F....................................................................................................................................<br />
5<br />
Brief Galileis an Christine von Lothringen, der Großherzogin-Witwe von Florenz, 1615,<br />
Ausschnitt (Lettera a Madama Cristina di Lorena) ........................................................... 5<br />
Anhang G....................................................................................................................................<br />
7<br />
Bericht der Qualifikatoren des Hl. Officiums vom 23. Febr. 1616.....................................<br />
7<br />
Anhang H1..................................................................................................................................<br />
7<br />
Aufzeichnungen des Hl. Officiums vom 26. Febr. 1616 .................................................... 8<br />
Anhang H2 ................................................................................................................................. 8<br />
Dekret der Indexkongregation des Hl. Officiums vom 05. März 1616...............................<br />
8<br />
Anhang H3..................................................................................................................................<br />
8<br />
Attestat Bellarmins auf Bitten von Galilei vom 26. Juni 1616............................................<br />
8<br />
Anhang I.....................................................................................................................................<br />
9<br />
Abschwörungsurkunde vom 22. Juni 1633..........................................................................<br />
9<br />
Anhang J...................................................................................................................................<br />
10<br />
Auszüge aus der Hl. Schrift...............................................................................................<br />
10<br />
Anhang K..................................................................................................................................<br />
10<br />
Ausschnitt aus der Rede Kardinal Ratzingers von 1990....................................................<br />
11<br />
Anhang L..................................................................................................................................<br />
13<br />
Literatur (Auswahl) ............................................................................................................ 13<br />
Quellen (Auswahl) ............................................................................................................. 13<br />
Weitere Schriften...............................................................................................................<br />
14<br />
1
Anhang A<br />
N i c o l a u s C o p e r n i c u s<br />
D e h y p o t h e s i b u s m o t u u m<br />
c a e l e s t i u m a s e c o n s t i t u t i s<br />
c o m m e n t a r i o l u s<br />
[ P e t i t i o n e s ]<br />
___________________________________________<br />
Igitur cum haec animadvertissem ego, saepe cogitabam, si forte rationabilior modus circulorum inveniri<br />
possit, e quibus omnis apparens diversitas dependeret, omnibus in seipsis aequaliter motis,<br />
quemadmodum ratio absoluti motus poscit. rem sane diffcilem aggressus ac paene inexplicabilem obtulit<br />
se tandem, quomodo id paucioribus ac multo convenientioribus rebus, quam olim sit proditum, feri<br />
possit, si nobis aliquae petitiones, quas axiomata vocant, concedantur, quae hoc ordine sequuntur.<br />
Prima petitio<br />
Omnium orbium caelestium sive sphaerarum unum centrum non esse.<br />
Secunda petitio<br />
Centrum terrae non esse centrum mundi, sed tantum gravitatis et orbis Lunaris.<br />
Tertia petitio<br />
Omnes orbes ambire Solem, tanquam in medio omnium existentem, ideoque circa Solem esse centrum<br />
mundi.<br />
Quarta petitio<br />
Minorem esse comparationem distantiarum Solis et terrae ad altitudinem frmamenti, quam<br />
semidimetientis terrae ad distantiam Solis, adeo ut sit ad summitatem frmamenti insensibilis.<br />
Quinta petitio<br />
Quicquid ex motu apparet in frmamento, non esse ex parte ipsius, sed terrae. Terra igitur cum proximis<br />
elementis motu diurno tota convertitur in polis suis invariabilibus frmamento immobili permanente ac<br />
ultimo caelo.<br />
Sexta petitio<br />
Quicquid nobis ex motibus circa Solem apparet, non esse occasione ipsius, sed telluris et nostri orbis, cum<br />
quo circa Solem volvimur ceu aliquo alio sidere, sicque terram pluribus motibus ferri.<br />
Septima petitio<br />
Quod apparet in erraticis retrocessio ac progressus, non esse ex parte ipsarum sed telluris. huius igitur<br />
solius motus tot apparentibus in caelo diversitatibus suffcit.<br />
Quelle: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost16/Copernicus/kop_c00.html<br />
2
Anhang B<br />
Nicolai Copernici: Opus de revolutionibus caelestibus, Manu propria lib. i, cap. x<br />
Die erste und oberste von allen Sphären ist die der Fixsterne, die sich selbst und alles<br />
andere enthält (…). Es folgt als erster Planet Saturn, der in dreißig Jahren seinen<br />
Umlauf vollendet. Hierauf Jupiter mit seinem zwölfjährigen Umlauf. Dann Mars, der in<br />
zwei Jahren seine Bahn durchläuft. Den vierten Platz in der Reihe nimmt der jährliche<br />
Kreislauf ein, in dem, wie wir gesagt haben, die Erde mit der Mondbahn als Epizykel<br />
enthalten ist. An fünfter Stelle kreist Venus in neun Monaten. Die sechste Stelle<br />
schließlich nimmt Merkur ein, der in einem Zeitraum von achtzig Tagen seinen Umlauf<br />
vollendet. In der Mitte von allen aber hat die <strong>Sonne</strong> ihren Sitz.<br />
Denn wer möchte sie in diesem herrlichen Tempel als Leuchte an einen anderen oder gar<br />
besseren Ort stellen als dorthin, von wo aus sie das Ganze zugleich beleuchten kann?<br />
Nennen doch einige sie ganz passend die Leuchte der Welt, andere den Weltengeist,<br />
wieder andere ihren Lenker, Trismegistos nennt sie den sichtbaren Gott, die Elektra des<br />
Sophokles den Allessehenden.<br />
So lenkt die <strong>Sonne</strong> gleichsam auf königlichem Thron sitzend, in der Tat die sie<br />
umkreisende Familie der Gestirne. Auch wird die Erde keineswegs der Dienste des<br />
Mondes beraubt, sondern der Mond hat (...) mit der Erde die nächste Verwandtschaft.<br />
Indessen empfängt die Erde von der <strong>Sonne</strong> und wird mit jährlicher Frucht gesegnet.<br />
Quelle: N. Kopernikus, De rev., Handschrift, Erstes Buch, Kap. 10 (neben der Zeichnung!)<br />
Anhang C<br />
Brief Galileis an Kepler nach Erhalt des Mysterium Cosmographicum, Aussschnitt<br />
“Euer Buch, mein gelehrter Doktor, das Ihr mir durch Paulus Amberger zukommen ließet, erhielt<br />
ich nicht vor ein paar Tagen, sondern bloß ein paar Stunden. ... Ich nehme dieses Buch umso<br />
dankbarer an, da ich es für ein Zeichen halte, Eurer Freundschaft für würde befunden worden zu<br />
sein. . . . und ich wünsche mit fürwahr Glück, einen Kameraden bei der Untersuchung der<br />
Wahrheit zu haben, der ein Freund der Wahrheit ist. . . .<br />
Ich will bloß noch hinzufügen, daß ich Euch verspreche, Euer Buch in Ruhe zu lesen, in der<br />
Gewißheit, die bewundernswertesten Dinge darin zu finden, und es umso freudiger zu tun, als<br />
ich mir die Lehre des Kopernikus vor vielen Jahren zu eigen machte und sein Standpunkt es<br />
mir ermöglichte, viele Naturerscheinungen zu erklären, die nach den landläufigen<br />
Hypothesen gewiß unerklärlich blieben. . . . Das Schicksal des Kopernikus [erschreckte mich],<br />
der, obgleich er bei einigen unsterblichen Ruhm erlangte, den unendlich vielen (denn so groß ist<br />
die Zahl der Toren) ein Gegenstand des Spotts und des Hohns ist. . . .”<br />
Galileus Galileus, 4. August 1597<br />
Quelle : Koestler 361, gesamter Brief in Mudry II, 9<br />
3
Anhang D<br />
Galilei in seinen Briefen <strong>über</strong> die <strong>Sonne</strong>nflecken (Lettere Solari), 1613, Ausschnitt<br />
“Vielleicht fügt sich auch dieser Planet *, nicht weniger als die gehörnte Venus, in wunderbarer<br />
Weise dem erhabenen kopernikanischen System ein, weht doch jetzt ein günstiger Wind für die<br />
allgemeine Verbreitung dieser Lehre auf uns zu, der kaum noch Ängste vor Wolken oder<br />
Gegenwind aufkommen läßt.”<br />
* Gemeint ist Saturn. Galilei hatte statt Saturn mit Ring ein Art Dreiersystem gesehen (wegen<br />
ungenügender Qualität seines Teleskops) und interpretierte es als Saturn mit zwei Monden.<br />
Quelle: Koestler 437<br />
Anhang E<br />
Brief Galileis an seinen Schüler und Freund Castelli, 1613, Ausschnitt<br />
Ich möchte glauben, daß die Autorität der heiligen Schrift nur den Zweck hat, die Menschen von<br />
den Glaubenssätzen zu <strong>über</strong>zeugen, die für ihr Heil nötig sind, und die <strong>über</strong> jede menschliche<br />
Erkenntnis hinausgehen, und die daher durch keine Wissenschaft und durch kein anderes Mittel<br />
als durch den Mund des heiligen Geistes dem Glauben nahe gebracht werden können.<br />
Ich will zunächst dem Gegner zuge<strong>steh</strong>en, daß die Worte der Schrift genau so verstanden werden<br />
sollen, wie sie erklingen, d.h. daß Gott auf das Gebot des Josua die <strong>Sonne</strong> <strong>still</strong><strong>steh</strong>en hieß und so<br />
den Tag verlängerte, damit er den Sieg gewinnen konnte. Dann verlange ich aber, daß das gleiche<br />
für mich gilt, und daß ich nicht an den Wortlaut gebunden bin, während der Gegner frei ist, die<br />
Bedeutung der Worte zu ändern und zu verwandeln. Ich sage dann, 10 daß jene Stelle die<br />
Falschheit und Unmöglichkeit des aristotelisch-ptolemäischen Weltsystems dartut, während sie<br />
sich bestens mit dem kopernikanischen verträgt. Wenn wir mit Kopernikus der Erde die täglichen<br />
Bewegungen zuweisen, wer sieht dann nicht, daß es zum Stillstand des ganzen Systems, ohne<br />
Änderung der gegenseitigen Lage der Planeten, zwecks Verlängerung des Tages, genügt, die<br />
<strong>Sonne</strong> zur Ruhe zu bringen, genau wie es in der Schrift <strong>steh</strong>t?<br />
Quelle: Textsammlung: Der Fall Galilei, W. Rade<br />
Dazu auch: "Die Hl. Schrift kann nie lügen oder irren. Wenn aber auch die Bibel nicht irren<br />
kann, so könnte doch ein Ausleger derselben in verschiedener Weise irren. Ein solcher Irrtum<br />
wäre es, wenn wir immer bei der eigentlichen Bedeutung des Wortes <strong>steh</strong>en bleiben wollten (...).<br />
Denn wir müßten dann Gott Hände, Füße, Ohren beilegen und nicht minder körperliche und<br />
menschliche Affekte.“<br />
Anm.: der gesamte Brief (deutsch) in Mudry I, 168<br />
Anhang F<br />
Brief Galileis an Christine von Lothringen, der Großherzogin-Witwe von Florenz, 1615,<br />
Ausschnitt (Lettera a Madama Cristina di Lorena)<br />
4
Ich frage mich, ob da nicht eine Art Ausflucht vorliegt, wenn man es unterläßt, die Tugenden<br />
namentlich aufzuführen, welche der geheiligten Theologie gestatten, sich den Titel >Königin<<br />
beizulegen. Sie würde diesen Namen verdienen, wenn sie alles in sich schlösse, was wir aus den<br />
anderen Wissenschaften erfahren, und es mit besseren Methoden und profunderer Gelehrsamkeit<br />
erwiese . . . Oder die Theologie könnte Königin sein, weil sie sich mit einem Gegenstand<br />
befaßt, der an Hoheit alle Gegenstände, welche die übrigen Wissenschaften ausmachen,<br />
<strong>über</strong>trifft, und weil ihre Lehren auf viel erhabenerer Weise geoffenbart werden.<br />
Quelle: Koestler 441f.<br />
Mir scheint, wir sollten in der Diskussion von Naturproblemen nicht von der Autorität der<br />
Bibeltexte ausgehen, sondern von der Sinneserfahrung und von notwendigen Beweisführungen.<br />
Denn die Heilige Schrift und die Natur gehen gleicherweise aus dem göttlichen Wort hervor, die<br />
eine als Diktat des Heiligen Geistes, die andere als gehorsamste Vollstreckerin von Gottes<br />
Befehlen. Zudem ist es der Heiligen Schrift erlaubt (da sie sich dem Verständnis aller Menschen<br />
zuneigt), manche Dinge – soweit es die reine Wortbedeutung angeht - scheinbar abweichend von<br />
der absoluten Wahrheit zu sagen. Aber die Natur ist andererseits unerklärlich und unwandelbar;<br />
sie <strong>über</strong>schreitet nie die Grenzen der Gesetze, die ihr auferlegt sind, so als ob es sie nicht<br />
kümmere, ob ihre dunklen Gründe und Wirkweisen dem Ver<strong>steh</strong>en des Menschen greifbar sind<br />
oder nicht. Es ist klar, daß jene Dinge, natürliche Wirkungen betreffend, die entweder die<br />
Erfahrung der Sinne uns vor Augen stellt oder notwendige Demonstrationen uns beweisen, auf<br />
keinen Fall auf Grund von Schrifttexten, die wahrscheinlich etwas ganz anderes meinen, in Frage<br />
gestellt oder gar verurteilt werden dürfen. Denn ein Ausdruck der Heiligen Schrift ist nicht an<br />
strikte Bedingungen gebunden wie jede Wirkung in der Natur; und Gott offenbart sich nicht<br />
weniger herrlich in den Wirkungen der Natur als in den heiligen Worten der Schrift.<br />
Natürlich ist es nicht die Absicht des Heiligen Geistes, uns Physik oder Astronomie zu lehren<br />
oder uns zu zeigen, ob sich die Erde bewegt oder nicht. Diese Fragen sind theologisch neutral;<br />
wir sollten jedoch den heiligen Text respektieren und, wo es angebracht ist, die Ergebnisse der<br />
Wissenschaft benutzen, um seine Bedeutung zu erkennen.<br />
Quelle: Textsammlung: Der Fall Galilei, W. Rade<br />
[Schon der Hl. Augustinus habe sich mit scheinbaren Widersprüchen zwischen Wissen und<br />
Glauben beschäftigt, wo er z.B. anführt, daß man das Himmelsgewölbe als Kugel betracht,<br />
während es in der Hl. Schrift hieße, Gott habe es wie einen Teppich ausgebreitet:]<br />
Ecco le sue parole: “Sed ait aliquis: Quomodo non est contrarium iis qui figuram spherae coelo<br />
tribuunt, quod scriptum est in libris nostris, Qui extendit coelum sicut pellem? Sit sane<br />
contrarium, si falsum est quod illi dicunt; hoc enim verum est, quod divina dicit authoritas,<br />
potius quam illud quod humana infirmitas coniicit. Sed si forte illud talibus illi documentis<br />
probare potuerint, ut dubitari inde non debeat, demonstrandum est, hoc quod apud nos est de<br />
pelle dictum, veris illis rationibus non esse contrarium.” . . .<br />
[Der hl. Hieronymus erkläre ausdrücklich, manches in der Hl. Schrift sei einfach nach der<br />
Ausfassung jener Zeit ausgedrückt:]<br />
Di che parlando san Girolamo scrive: “Quasi non multa in Scripturis Sanctis dicantur iuxta<br />
opinionem illius temporis quo gesta referuntur, et non iuxta quod rei veritas continebat.” Ed<br />
altrove il medesimo Santo: “Consuetudinis, Scripturarum est, ut opinionem multarum rerum sic<br />
narret Historicus, quomodo eo tempore ab omnibus credebatur.”<br />
[Und der hl. Thomas klärt <strong>über</strong> die “Leere” auf, <strong>über</strong> der nach Worten der Hl. Schrift der<br />
Himmel gegründet sei. Darunter könne nur der die Erde umgebene Luftraum verstanden werden,<br />
der also in Wirklichkeit nicht leer sei:]<br />
E san Tommaso in Iob, al cap. 27, sopra le parole “Qui extendit aquilonem super vacuum, et<br />
appendit Terram super nihilum”, nota che la Scrittura chiama vacuo e niente lo spazio che<br />
5
abbraccia e circonda la Terra, e che noi sappiamo non esser vòto, ma ripieno d'aria: nulla<br />
dimeno, dice egli che la Scrittura, per accomodarsi alla credenza del vulgo, che pensa che in tale<br />
spazio non sia nulla, lo chiama vacuo e niente. Ecco le parole di san Tommaso: “Quod de<br />
superiori hemisphaerio coeli nihil nobis apparet. nisi saptium aere plenum, quod vulgares<br />
homines reputant vacuum: loquitur enim secundum extimationem vulgarium hominum, pro ut<br />
est mos in Sacra Scriptura.”<br />
Quelle: nach Müller 101f. (kursiv), Galileitext aus der Gesamtausgabe des Briefes<br />
(italienisch) in http://www.liberliber.it/biblioteca/g/galilei/lettere/html/lett14.htm<br />
Wenn nun wahrhaft erwiesene physikalische Schlußfolgerungen der Schrift nicht untergeordnet<br />
werden müssen, sondern vielmehr nachgewiesen werden muß, daß die letztere den ersteren nicht<br />
widerspricht, dann muß, bevor eine physikalische Behauptung verurteilt wird, gezeigt werden,<br />
daß sie nicht auf das genaueste erwiesen ist – und zwar nicht von denen, die sie für wahr<br />
halten, sondern von denen, die sie für falsch erklären. Das scheint mir sehr begründet und<br />
natürlich, denn diejenigen, die ein Argument für falsch halten, finden viel leichter den Fehler als<br />
diejenigen, die es für wahr und <strong>über</strong>zeugend halten . . .<br />
Quelle: Koestler 443<br />
(Schlußworte, untesrchiedlich in diversen Fassungen des Briefes:)<br />
Naturam Rerum invenire difficile; et ubi inveneris, indicare in vulgus nefas - Das Wesen der<br />
Dinge ist schwer zu ergründen, und falls du es ergründet, hüte dich, es der Menge zu sagen. 1<br />
Quelle: Müller 102<br />
Anhang G<br />
Bericht der Qualifikatoren des Hl. Officiums vom 23. Febr. 1616<br />
Sätze zur Begutachtung, den Qualifikatoren am 19. Febr. 1616 vorgelegt:<br />
1. Die <strong>Sonne</strong> ist das Zentrum der Welt und in Folge dessen ohne örtliche Bewegung.<br />
2. Die Erde ist nicht das Zentrum der Welt und nicht unbeweglich, sondern bewegt sich<br />
auch in täglicher Umdrehung um sich selbst.<br />
Gutachten der Qualifikatoren vom 23. Febr. 1616:<br />
1. Den ersten Satz erklärten alle für töricht und absurd in der Philosophie (= Naturphilosophie,<br />
Naturwissenschaft] und formell ketzerisch, insofern dieser ausdrücklich den<br />
Sätzen der Heiligen Schrift in vielen Stellen nach dem eigentlichen Wortsinn wie nach<br />
der allgemeinen Auslegung und Auffassung der heiligen Väter und gelehrten Theologen<br />
widerspreche.<br />
2. Bezüglich des zweiten Satzes sagten alle, daß er in Philosophie demselben Tadel<br />
unterliege und bezüglich der theologischen Wahrheit zum mindesten irrig im Glauben sei.<br />
Quelle: v. Gebler 95 und 398 (Dokumente 1 und 2 in Italienisch bzw. Latein)<br />
Anhang H1<br />
1 Galilei zitiert hier eine Stelle aus Platons Timaios (ed. Stephan 28c).<br />
6
Aufzeichnungen des Hl. Officiums vom 26. Febr. 1616<br />
"In der Wohnung des Kardinals Bellarmin hat dieser Kardinal in Gegenwart des Fr. Michael<br />
Angelus Seghitius von Landa aus dem Prediger-Orden, des Generalkommissars des hl.<br />
Officiums, den oben genannten Galilei <strong>über</strong> das Irrtümliche der oben besagten Meinung belehrt<br />
und ihn ermahnt, dieselbe aufzugeben, und gleich darauf hat in meiner Gegenwart und in<br />
Gegenwart von Zeugen und noch in Anwesenheit des besagten Kardinals, der Pater<br />
Kommissarius dem besagten dort noch anwesenden Galilei im Namen unseres heiligsten Herren<br />
des Papstes und der ganzen Kongregation des hl. Officiums befohlen und geboten, die oben<br />
besagte Meinung, daß die <strong>Sonne</strong> (...), ganz aufzugeben und sie in Zukunft in keiner Weise<br />
mehr festzuhalten, zu lehren oder zu verteidigen, in Wort oder Schrift, widrigenfalls werde<br />
gegen ihn im hl. Officium verfahren werden. Diesem Gebot fügte sich selbiger Galilei und<br />
versprach zu gehorchen ..."<br />
Quelle: http://histor.ws/galilei/11.htm, vgl. v. Gebler 97 und 399 (Dokument 3)<br />
Anhang H2<br />
Dekret der Indexkongregation des Hl. Officiums vom 05. März 1616<br />
"Weil es zur Kenntnis der hl. Kongregation gekommen ist, daß jene falsche Pythagoräische und<br />
der Hl. Schrift gänzlich widersprechende Lehre von der Bewegung der Erde und der<br />
Unbeweglichkeit der <strong>Sonne</strong>, welche auch N. Copernicus und Didacus von Stunica lehren, bereits<br />
unter das Volk verbreitete und von vielen angenommen werde, wie man aus einem gedruckten<br />
Briefe eines Karmeliters, eines gewissen L. A. Foscarini, ersehen kann, so hat, damit nicht eine<br />
derartige Meinung zum Verderben der katholischen Kirche weiterschleiche, dieselbe für gut<br />
befunden, des genannten N. Copernicus Werk "Über die Bewegung der Himmelskörper" und des<br />
Didacus von Stunica Buch <strong>über</strong> "Job" zu suspendieren, bis sie verbessert werden; das Buch des<br />
Karmeliters Antonio Foscarini aber gänzlich zu verbieten zu verwerfen, sowie alle anderen<br />
Bücher, die in gleicher Weise dasselbe lehren, zu untersagen.“ [. . . zu untersagen, wie es denn<br />
auch alles durch dieses Dekret verboten, verdammt bzw. suspendiert ist.]<br />
Quelle: http://histor.ws/galilei/11.htm, Übersetzung nicht ganz vollständig und korrekt;<br />
vgl. v. Gebler 105 und 401 (Dokument 5, der Zusatz in eckigen Klammern!)<br />
Anhang H3<br />
Attestat Bellarmins auf Bitten von Galilei vom 26. Juni 1616<br />
"Da wir, Robert Kardinal Bellarmin, gehört haben, daß der Herr Galileo Galilei verleumdet und<br />
von ihm gesagt worden ist, er habe in unsere Hand abgeschworen, und ferner, es seien ihm<br />
heilsame Bußübungen auferlegt worden, und da wir ersucht worden sind, die Wahrheit zu<br />
bezeugen, so erklären wir: der besagte Herr Galilei hat weder vor uns, noch vor einem anderen<br />
hier in Rom, noch, so viel wir wissen, anderswo eine seiner Meinungen und Lehren<br />
abgeschworen, noch sind ihm Bußübungen und dergleichen auferlegt worden; vielmehr ist ihm<br />
nur die von unserem Herrn (dem Papste) gemachte und von der hl. Kongregation der Index<br />
publizierte Erklärung mitgeteilt worden, daß die dem Copernicus zugeschriebene Lehre, - die<br />
7
Erde bewege sich um die <strong>Sonne</strong> und die <strong>Sonne</strong> <strong>steh</strong>e im Mittelpunkt der Welt, ohne sich von<br />
Osten nach Westen zu bewegen, - der Hl. Schrift zuwider sei und nicht verteidigt oder für wahr<br />
gehalten werden dürfe."<br />
Quelle: http://histor.ws/galilei/11.htm vgl. v. Gebler 402 (Dokument 6)<br />
Anhang I<br />
Abschwörungsurkunde vom 22. Juni 1633<br />
Ich, Galileo, Sohn des Vinzenz Galilei aus Florenz, siebzig Jahre alt, stand persönlich vor<br />
Gericht und ich knie vor Euch Eminenzen, die Ihr in der ganzen Christenheit die Inquisitoren<br />
gegen die ketzerische Verworfenheit seid. Ich habe vor mir die heiligen Evangelien, berühre sie<br />
mit der Hand und schwöre, daß ich immer geglaubt habe, auch jetzt glaube und mit Gottes Hilfe<br />
auch in Zukunft glauben werde, alles was die heilige katholische und apostolische Kirche für<br />
wahr hält, predigt und lehrt. Es war mir von diesem Heiligen Offizium von Rechts wegen die<br />
Vorschrift auferlegt worden, daß ich völlig die falsche Meinung aufgeben müsse, daß die <strong>Sonne</strong><br />
der Mittelpunkt der Welt ist, und daß sie sich nicht bewegt, und daß die Erde nicht der<br />
Mittelpunkt der Welt ist, und daß sie sich bewegt. Es war mir weiter befohlen worden, daß ich<br />
diese falsche Lehre nicht vertreten dürfe, sie nicht verteidigen dürfe und daß ich sie in keiner<br />
Weise lehren dürfe, weder in Wort noch in Schrift. Es war mir auch erklärt worden, daß jene<br />
Lehre der Heiligen Schrift zuwider sei. Trotzdem habe ich ein Buch geschrieben und zum Druck<br />
gebracht, in dem ich jene bereits verurteilte Lehre behandele und in dem ich mit viel Geschick<br />
Gründe zugunsten derselben beibringe, ohne jedoch zu irgendeiner Entscheidung zu gelangen.<br />
Daher bin ich der Ketzerei in hohem Maße verdächtig befunden worden, darin be<strong>steh</strong>end, daß<br />
ich die Meinung vertreten und geglaubt habe, daß die <strong>Sonne</strong> Mittelpunkt der Welt und<br />
unbeweglich ist, und daß die Erde nicht Mittelpunkt ist und sich bewegt. Ich möchte mich nun<br />
vor Euren Eminenzen und vor jedem gläubigen Christen von jenem schweren Verdacht, den ich<br />
gerade näher bezeichnete, reinigen. Daher schwöre ich mit aufrichtigem Sinn und ohne<br />
Heuchelei ab, verwünsche und verfluche jene Irrtümer und Ketzereien und dar<strong>über</strong> hinaus ganz<br />
allgemein jeden irgendwie gearteten Irrtum, Ketzerei und Sektiererei, die der Heiligen Kirche<br />
entgegen ist. Ich schwöre, daß ich in Zukunft weder in Wort noch in Schrift etwas verkünden<br />
werde, das mich in einen solchen Verdacht bringen könnte. Wenn ich aber einen Ketzer kenne,<br />
oder jemanden der Ketzerei verdächtig weiß, so werde ich ihn diesem Heiligen Offizium<br />
anzeigen oder ihn dem Inquisitor oder der kirchlichen Behörde meines Aufenthaltsortes angeben.<br />
Ich schwöre auch, daß ich alle Bußen, die mir das Heilige Offizium auferlegt hat oder noch<br />
auferlegen wird, genauestens beachten und erfüllen werde. Sollte ich irgendeinem meiner<br />
Versprechen und Eide, was Gott verhüten möge, zuwiderhandeln, so unterwerfe ich mich allen<br />
Strafen und Züchtigungen, die das kanonische Recht und andere allgemeine und besondere<br />
einschlägige Bestimmungen gegen solche Sünder festsetzen und verkünden. Daß Gott mir helfe<br />
und seine heiligen Evangelien, die ich mit den Händen berühre.<br />
Ich, Galileo Galilei, habe abgeschworen, geschworen, versprochen und mich verpflichtet, wie<br />
ich eben näher ausführte. Zum Zeugnis der Wahrheit habe ich diese Urkunde meines<br />
Abschwörens eigenhändig unterschrieben und sie Wort für Wort verlesen, in Rom im Kloster der<br />
Minerva am 22. Juni 1633.<br />
Ich, Galileo Galilei, habe abgeschworen und eigenhändig unterzeichnet.<br />
8
Quelle: Textsammlung: Der Fall Galilei, W. Rade; vgl. v. Gebler 301 u. 427 (latein.<br />
Dokument)<br />
Anhang J<br />
Auszüge aus der Hl. Schrift<br />
Josua 10, 12-13: 12 Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete Josua mit<br />
dem Herrn; dann sagte er [der Herr] in Gegenwart der Israeliten: “<strong>Sonne</strong>, bleib <strong>steh</strong>en <strong>über</strong><br />
<strong>Gibeon</strong> und du, Mond, <strong>über</strong> dem Tal von Ajalon!”<br />
13 Und die <strong>Sonne</strong> blieb <strong>steh</strong>en, und der Mond stand <strong>still</strong>, bis das Volk an seinen Feinden Rache<br />
genommen hatte. Das <strong>steh</strong>t im »Buch der Aufrechten«. * Die <strong>Sonne</strong> blieb also mitten am Himmel<br />
<strong>steh</strong>en, und ihr Untergang verzögerte sich, ungefähr für einen ganzen Tag lang.<br />
* Anmerkung: Das »Buch der Aufrechten« ist ein sonst unbekanntes Liederbuch Israels.<br />
1. Buch der Chronik 16,30: Erbebt vor dem Herrn, alle Länder der Erde! Den Erdkreis hat er<br />
gegründet, so daß er nicht wankt.<br />
Psalm 93, 1*: Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit; der Herr hat sich bekleidet und mit<br />
Macht umgürtet. Der Erdkreis ist fest gegründet, nie wird er wanken.<br />
*Anmerkung: Ähnliche Aussagen finden sich in den Psalmen 96,10; 98,69; 104,5; 119,90.<br />
Kohelet (Prediger Salomo) 1, 4-5: 4 Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde <strong>steh</strong>t<br />
in Ewigkeit.<br />
5 Die <strong>Sonne</strong>, die aufging und wieder unterging, atemlos jagt sie zurück an den Ort, wo sie<br />
wieder aufgeht.<br />
Psalm 19, 6-7: 5Doch ihre Botschaft (die der Ruhmesstimmen <strong>über</strong> Gottes Herrlichkeit) geht in<br />
die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Dort hat er der <strong>Sonne</strong> ein Zelt<br />
gebaut.<br />
6Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam: sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre<br />
Bahn.<br />
7Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende; nichts kann sich vor<br />
ihrer Glut verbergen.<br />
Sprichwörter (Sprüche) 25,3: Der Himmel hoch und die Erde so tief und das Herz des<br />
Königs: sie sind nicht zu erforschen.<br />
Job (Hiob, Ijob) 9,6: (Gottes Macht:) Er erschüttert die Erde an ihrem Ort, so daß ihre<br />
Säulen erzittern.<br />
Job (Hiob, Ijob) 26,7: Er spannt <strong>über</strong> dem Leeren den Norden*, hängt die Erde auf am<br />
Nichts.<br />
*Anmerkung: Luther <strong>über</strong>setzt “die Mitternacht”<br />
Anhang K<br />
9
Ausschnitt aus der Rede Kardinal Ratzingers von 1990<br />
Vorausbemerkung: Von einem geplanten Besuch und Vortrag <strong>über</strong> die Todesstrafe Anfang Januar<br />
2008 wurde Benedikt XVI. von der größten Universität Europas, der römischen "Sapientia" (=<br />
Weisheit) – 135.000 Hörer, 4500 Professoren – ausgeladen. Ratzinger sei untragbar, so der<br />
Protest von 67 ehemaligen Physikprofessoren der Uni, da er in einem fast zwei Jahrzehnte<br />
zurückliegenden Vortag den Inquisitionsprozess gegen den Wissenschaftler Galileo Galilei von<br />
1632-33 als "vernünftig und gerecht" bezeichnet habe.<br />
Ausschnitt aus der Rede, die Kardinal Joseph Ratzinger 1990 in Parma hielt:<br />
„Der Glaube wächst nicht aus der Bezweiflung der Rationalität, sondern nur aus einer<br />
grundlegenden Bejahung und aus einer weiträumigen Vernünftigkeit.“<br />
(...) Unsere bisherigen Überlegungen hatten ihren Ausgangspunkt in den Vorgängen des<br />
europäischen Ostens genommen, aber wir haben versucht, darin auch immer unsere eigenen<br />
Probleme, die Probleme der westlichen Welt und ihrer Ideologien mitzubedenken.<br />
Diesen Aspekt unseres Fragens müssen wir in einem zweiten Teil noch etwas vertiefen, bevor<br />
wir Konsequenzen für die Wege des Glaubens heute ziehen können. Drei Aspekte vor allem<br />
möchte ich ansprechen: die Krise des Wissenschaftsglaubens, die neue Frage nach dem Geistigen<br />
und dem Ethischen und die neue Suche nach Religion.<br />
a) Die Krise des Wissenschaftsglaubens<br />
Der Widerstand der Schöpfung gegen ihre Manipulation durch den Menschen ist im letzten<br />
Jahrzehnt zu einem neuen Faktor der geistigen Situation geworden. Die Frage nach den Grenzen<br />
der Wissenschaft und nach den Maßen, denen sie zu folgen hat, stellt sich unausweichlich.<br />
Bezeichnend für die Änderung des Klimas erscheint mir die Änderung in der Art und Weise, wie<br />
man den Fall Galilei beurteilt. Das im 17. Jahrhundert noch wenig beachtete Ereignis war im<br />
Jahrhundert darauf geradezu zum Mythos der Aufklärung <strong>über</strong>höht worden: Galilei erscheint als<br />
das Opfer des in der Kirche festgehaltenen mittelalterlichen Obskurantismus.<br />
Gut und Böse <strong>steh</strong>en sich in reinlicher Scheidung gegen<strong>über</strong>: Auf der einen Seite finden wir die<br />
Inquisition als die Macht des Aberglaubens, als Gegenspieler von Freiheit und Erkenntnis. Auf<br />
der anderen Seite <strong>steh</strong>t die Naturwissenschaft, vertreten durch Galilei, als Macht des Fortschritts<br />
und der Befreiung des Menschen aus den Fesseln der Unkenntnis, die ihn ohnmächtig der Natur<br />
gegen<strong>über</strong> hielten. Der Stern der Neuzeit geht <strong>über</strong> der Nacht des mittelalterlichen Dunkels auf.<br />
(1)<br />
Seltsamerweise war Ernst Bloch mit seinem romantischen Marxismus einer der ersten, der sich<br />
offen diesem Mythos widersetzte und eine neue Interpretation der Ereignisse anbot. Für ihn<br />
beruht das heliozentrische Weltsystem ebenso wie das geozentrische auf unbeweisbaren<br />
Voraussetzungen.<br />
Dazu gehöre vor allem die Annahme eines ruhenden Raumes, die inzwischen durch die<br />
Relativitätstheorie erschüttert worden ist. Er formuliert: „Indem folglich mit dem Wegfall eines<br />
leeren ruhenden Raums keine Bewegung gegen ihn vorkommt, sondern lediglich eine relative<br />
Bewegung von Körpern gegeneinander, und deren Feststellung von der Wahl des als ruhend<br />
angenommenen Körpers abhängt: so könnte, falls die Kompliziertheit der dabei auftretenden<br />
Rechnungen dies eben nicht als untunlich erscheinen ließe, nach wie vor die Erde als<br />
fest<strong>steh</strong>end, die <strong>Sonne</strong> als bewegt angenommen werden.“ (2)<br />
Der Vorsprung des heliozentrischen Systems gegen<strong>über</strong> dem geozentrischen be<strong>steh</strong>t demnach<br />
nicht in einem Mehr an objektiver Wahrheit, sondern lediglich in einer leichteren<br />
10
Berechenbarkeit für uns. Bis hierher drückt Bloch wohl nur moderne naturwissenschaftliche<br />
Einsicht aus.<br />
Erstaunlich ist aber nun die Wertung, die er daraus ableitet: „Nachdem die Relativität der<br />
Bewegung außer Zweifel <strong>steh</strong>t, hat ein humanes und ein älteres christliches Bezugssystem zwar<br />
nicht das Recht, sich in die astronomischen Rechnungen und ihre heliozentrische Vereinfachung<br />
einzumischen, wohl aber hat es das eigene methodische Recht, für die Zusammenhänge der<br />
humanen Wichtigkeit diese Erde festzuhalten und die Welt um das auf der Erde Geschehende<br />
und Geschehene herumzuordnen.“ (3)<br />
Wenn hier die beiden methodischen Sphären noch deutlich voneinander geschieden und in ihrem<br />
jeweiligen Recht wie in ihren Grenzen anerkannt werden, so klingt das Resümee des skeptischagnostischen<br />
Philosophen P. Feyerabend schon sehr viel aggressiver, wenn er schreibt:<br />
„Die Kirche zur Zeit Galileis hielt sich viel enger an die Vernunft als Galilei selber, und sie zog<br />
auch die ethischen und sozialen Folgen der Galileischen Lehre in Betracht. Ihr Urteil gegen<br />
Galilei war rational und gerecht, und seine Revision läßt sich nur politisch-opportunistisch<br />
rechtfertigen.“ (4)<br />
Unter den Gesichtspunkten der praktischen Wirkung geht zum Beispiel C. F. von Weizsäcker<br />
noch einen Schritt weiter, wenn er einen „schnurgeraden Weg“ von Galilei zur Atombombe sieht.<br />
Zu meiner Überraschung wurde ich vor kurzem in einem Interview <strong>über</strong> den Fall Galilei nicht<br />
etwa gefragt, wieso die Kirche sich angemaßt habe, naturwissenschaftliche Erkenntnis zu<br />
behindern, sondern ganz im Gegenteil, warum sie eigentlich nicht klarer gegen die Verhängnisse<br />
Stellung genommen habe, die sich ergeben mußten, als Galilei die Büchse der Pandora öffnete.<br />
Es wäre töricht, auf solchen Auflassungen eine kurzschlüssige Apologetik aufzubauen; der<br />
Glaube wächst nicht aus dem Ressentiment und aus der Bezweiflung der Rationalität, sondern<br />
nur aus einer grundlegenden Bejahung und aus einer weiträumigen Vernünftigkeit; wir werden<br />
darauf zurückkommen. Ich erwähne dies alles nur als einen symptomatischen Fall, an dem<br />
sichtbar wird, wie tief die Selbstbezweiflung der Moderne, der Wissenschaft und der Technik<br />
heute greift (...)<br />
Anmerkungen<br />
1 Vgl. W. Brandmüller, Galilei und die Kirche oder Das Recht auf Irrtum (Regensburg 1982)<br />
2 E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung (Frankfurt/Main 1959) 920; vgl. F. Hartl, Der Begriff des<br />
Schöpferischen. Deutungsversuche der Dialektik durch E. Bloch und F. v. Baader<br />
(Frankfurt/Main 1979) 110<br />
3 Bloch. a.a.O. 920f.- Hartl 111<br />
4 P. Feyerabend. Wider den Methodenzwang (Frankfurt/Main 1976, 1983), 206<br />
Quelle: www.kath.net/detail.php?id=18782; vgl.: Joseph Cardinal Ratzinger: Wendezeit für<br />
Europa. Diagnosen und Prognosen zur Lage von Kirche und Welt. S. 69-71<br />
11
Anhang L<br />
Literatur (Auswahl)<br />
Dautel, Klaus: Brechts “Leben des Galilei”, Unterrichtsvorschläge und –materialien. Werkstatt<br />
für kreativen Unterricht, http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/Brecht/galilei.htm<br />
Fölsing, Albrecht: Galileo Galilei – Prozeß ohne Ende. Rowohlt Taschenbuchverlag, rororo<br />
science sachbuch 60118, Reinbek 1996 (ISBN 978 3 499 60118 7)<br />
von Gebler, Karl: Galileo Galilei und Die Römische Kurie – nach den authentischen Quellen.<br />
Neudruck der Ausgabe 1876-1877, Martin Sändig, Wiebaden 1968<br />
van Helden, Albert, siehe unten: Galilei, Sidereus Nuncius<br />
Koestler, Arthur: Die Nachtwandler – Das Bild des Universums im Wandel der Zeit. Alfred<br />
Scherz, Bern und Stuttgart 1959<br />
Kuhn, Thomas S.: Die kopernikanische Revolution. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden 1981<br />
(ISBN-10 3 528 08433 2)<br />
Mudry, Anna, siehe unten: Galilei, Schriften, Briefe, Dokumente<br />
Müller, Adolf: Galileo Galilei und das kopernikanische Weltsystem. Herder, Freiburg 1909<br />
Reinhardt, Volker: Das Konzil von Trient und die Naturwissenschaften – Die<br />
Auseinandersetzung zwischen Bellarmin und Galilei als Paradigma. In: Das Konzil von Trient<br />
und die Moderne, P. Prodi und W. Reinhard (Hrgg.), Duncker & Humblot, Berlin 2001<br />
(ISBN-10 3 428 10641 5)<br />
Strauss, Emil, siehe unten Galilei (2)<br />
Quellen (Auswahl)<br />
Brecht, Bertolt: Leben des Galilei. edition suhrkamp TB 1, Suhrkamp, Berlin o.J. (ISBN 978 3<br />
518 10001 1)<br />
Galilei (1), Galileo: Dialog <strong>über</strong> die beiden hauptsächlichen Weltsysteme – das ptolemäische und<br />
das kopernikanische. Voltmedia, Paderborn o.J. (nur Ausschnitte!) (ISBN 978 3 86763 600 1)<br />
Galilei (2), Galileo: Dialog <strong>über</strong> die beiden hauptsächlichen Weltsysteme – das ptolemäische und<br />
das kopernikanische, aus dem Italienischen <strong>über</strong>setzt und erläutert von Emil Strauss. Teubner,<br />
Leipzig 1891<br />
Galilei, Galileo: Werke im Internet. http://www.liberliber.it/biblioteca/g/galilei/index.htm<br />
Galilei, Galileo: Le Opere, Edizione Nazionale, Hg. A. Favaro, Florenz 1968 (Reprint der<br />
Ausgabe von 1890-1909))<br />
Galilei, Galileo: Schriften, Briefe, Dokumente, herausgegeben von Anna Mudry. 2 Bde, C.H.<br />
Beck, München 1987 (ISBN-10 3 406 32056 2)<br />
Galilei, Galileo: Sidereus Nuncius or The Siderial Messenger, Translated with introduction,<br />
conclusion and notes by Albert van Helden. Univ. Chicago Press, Chicago and London 1989<br />
Kepler, Johannes: Unterredung mit dem Sternenboten der unlängst von dem Paduanischen<br />
Mathematiker Galileo Galilei zu den Sterblichen gesandt wurde. Internat. Astronom. Union,<br />
Hamburg 1964 (Dissertatio cum Nuncio Siderio, Daniel Sedanus, Prag 1610)<br />
12
Kopernikus, Nikolaus: Opus de revolutionibus caelestibus manu propria. Faksimile=Wiedergabe,<br />
Gesamtausgabe Bd 1, Oldenbourg, München und Berlin 1944<br />
Weitere Schriften<br />
Bredekamp, Horst: Galilei der Künstler. Der Mond. Die <strong>Sonne</strong>. Die Hand. Akademie Verlag,<br />
Berlin 1907 (ISBN 978 3 05 004319 7)<br />
Bredekamp, Horst: Luchse, Bienen und Delphine: Galilei in Rom. In: Katalog zur Ausstellung<br />
Barock im Vatikan – Kunst und Kultur im Rom der Päpste II, Kunst- und Ausstellungshalle<br />
der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, und Seemann Verlag, Leipzig 2005 (ISBN 978 3<br />
86502 125 0)<br />
Dorn, Matthias: Das Problem der Autonomie der Naturwissenschaften bei Galilei. Steiner,<br />
Stuttgart 2000, (ISBN 978 3515071277), im Internet teilweise<br />
veröff.http://books.google.de/books?<br />
id=TOo_w_dRzgkC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=Leopold+von+<br />
%C3%96sterreich+Galilei&source=web&ots=sIAjfAZkZv&sig=tGmP7Cy0c6RkIvya_cLRC<br />
4vh5rI&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result unter<br />
Dorn, Matthias: Hintergründe und Entwicklungen des Galileo-Prozesses. Vortrag, München<br />
1992, http://home.arcor.de/matthias.dorn/gglmu/GLMU92.html<br />
Redondi, Pietro: Galilei, der Ketzer. Deutscher Taschenbuchverlag, dtv 4564, München 1991,<br />
(ISBN-10 3 4223 045464 7)<br />
Sobel, Dava: Galileos Tochter – Eine Geschichte von der Wissenschaft, den Sternen und der<br />
Liebe. Goldmann, btb Taschenbuch 72296, München 2001 (ISBN-10 3 442 72296 9)<br />
13