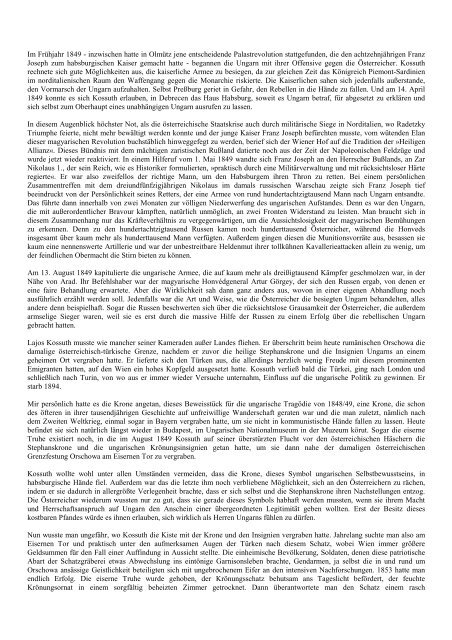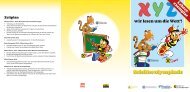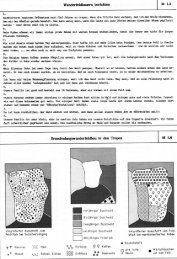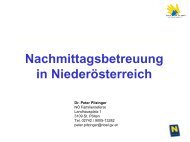Humbert Fink
Humbert Fink
Humbert Fink
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Im Frühjahr 1849 - inzwischen hatte in Olmütz jene entscheidende Palastrevolution stattgefunden, die den achtzehnjährigen Franz<br />
Joseph zum habsburgischen Kaiser gemacht hatte - begannen die Ungarn mit ihrer Offensive gegen die Österreicher. Kossuth<br />
rechnete sich gute Möglichkeiten aus, die kaiserliche Armee zu besiegen, da zur gleichen Zeit das Königreich Piemont-Sardinien<br />
im norditalienischen Raum den Waffengang gegen die Monarchie riskierte. Die Kaiserlichen sahen sich jedenfalls außerstande,<br />
den Vormarsch der Ungarn aufzuhalten. Selbst Preßburg geriet in Gefahr, den Rebellen in die Hände zu fallen. Und am 14. April<br />
1849 konnte es sich Kossuth erlauben, in Debrecen das Haus Habsburg, soweit es Ungarn betraf, für abgesetzt zu erklären und<br />
sich selbst zum Oberhaupt eines unabhängigen Ungarn ausrufen zu lassen.<br />
In diesem Augenblick höchster Not, als die österreichische Staatskrise auch durch militärische Siege in Norditalien, wo Radetzky<br />
Triumphe feierte, nicht mehr bewältigt werden konnte und der junge Kaiser Franz Joseph befürchten musste, vom wütenden Elan<br />
dieser magyarischen Revolution buchstäblich hinweggefegt zu werden, berief sich der Wiener Hof auf die Tradition der »Heiligen<br />
Allianz«. Dieses Bündnis mit dem mächtigen zaristischen Rußland datierte noch aus der Zeit der Napoleonischen Feldzüge und<br />
wurde jetzt wieder reaktiviert. In einem Hilferuf vom 1. Mai 1849 wandte sich Franz Joseph an den Herrscher Bußlands, an Zar<br />
Nikolaus 1., der sein Reich, wie es Historiker formulierten, »praktisch durch eine Militärverwaltung und mit rücksichtsloser Härte<br />
regierte«. Er war also zweifellos der richtige Mann, um den Habsburgem ihren Thron zu retten. Bei einem persönlichen<br />
Zusammentreffen mit dem dreiundfünfzigjährigen Nikolaus im damals russischen Warschau zeigte sich Franz Joseph tief<br />
beeindruckt von der Persönlichkeit seines Retters, der eine Armee von rund hundertachtzigtausend Mann nach Ungarn entsandte.<br />
Das führte dann innerhalb von zwei Monaten zur völligen Niederwerfung des ungarischen Aufstandes. Denn es war den Ungarn,<br />
die mit außerordentlicher Bravour kämpften, natürlich unmöglich, an zwei Fronten Widerstand zu leisten. Man braucht sich in<br />
diesem Zusammenhang nur das Kräfteverhältnis zu vergegenwärtigen, um die Aussichtslosigkeit der magyarischen Bemühungen<br />
zu erkennen. Denn zu den hundertachtzigtausend Russen kamen noch hunderttausend Österreicher, während die Honveds<br />
insgesamt über kaum mehr als hunderttausend Mann verfügten. Außerdem gingen diesen die Munitionsvorräte aus, besassen sie<br />
kaum eine nennenswerte Artillerie und war der unbestreitbare Heldenmut ihrer tollkühnen Kavallerieattacken allein zu wenig, um<br />
der feindlichen Obermacht die Stirn bieten zu können.<br />
Am 13. August 1849 kapitulierte die ungarische Armee, die auf kaum mehr als dreißigtausend Kämpfer geschmolzen war, in der<br />
Nähe von Arad. Ihr Befehlshaber war der magyarische Honvédgeneral Artur Görgey, der sich den Russen ergab, von denen er<br />
eine faire Behandlung erwartete. Aber die Wirklichkeit sah dann ganz anders aus, wovon in einer eigenen Abhandlung noch<br />
ausführlich erzählt werden soll. Jedenfalls war die Art und Weise, wie die Österreicher die besiegten Ungarn behandelten, alles<br />
andere denn beispielhaft. Sogar die Russen beschwerten sich über die rücksichtslose Grausamkeit der Österreicher, die außerdem<br />
armselige Sieger waren, weil sie es erst durch die massive Hilfe der Russen zu einem Erfolg über die rebellischen Ungarn<br />
gebracht hatten.<br />
Lajos Kossuth musste wie mancher seiner Kameraden außer Landes fliehen. Er überschritt beim heute rumänischen Orschowa die<br />
damalige österreichisch-türkische Grenze, nachdem er zuvor die heilige Stephanskrone und die Insignien Ungarns an einem<br />
geheimen Ort vergraben hatte. Er lieferte sich den Türken aus, die allerdings herzlich wenig Freude mit diesem prominenten<br />
Emigranten hatten, auf den Wien ein hohes Kopfgeld ausgesetzt hatte. Kossuth verließ bald die Türkei, ging nach London und<br />
schließlich nach Turin, von wo aus er immer wieder Versuche unternahm, Einfluss auf die ungarische Politik zu gewinnen. Er<br />
starb 1894.<br />
Mir persönlich hatte es die Krone angetan, dieses Beweisstück für die ungarische Tragödie von 1848/49, eine Krone, die schon<br />
des öfteren in ihrer tausendjährigen Geschichte auf unfreiwillige Wanderschaft geraten war und die man zuletzt, nämlich nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg, einmal sogar in Bayern vergraben hatte, um sie nicht in kommunistische Hände fallen zu lassen. Heute<br />
befindet sie sich natürlich längst wieder in Budapest, im Ungarischen Nationalmuseum in der Muzeum körut. Sogar die eiserne<br />
Truhe existiert noch, in die im August 1849 Kossuth auf seiner überstürzten Flucht vor den österreichischen Häschern die<br />
Stephanskrone und die ungarischen Krönungsinsignien getan hatte, um sie dann nahe der damaligen österreichischen<br />
Grenzfestung Orschowa am Eisernen Tor zu vergraben.<br />
Kossuth wollte wohl unter allen Umständen vermeiden, dass die Krone, dieses Symbol ungarischen Selbstbewusstseins, in<br />
habsburgische Hände fiel. Außerdem war das die letzte ihm noch verbliebene Möglichkeit, sich an den Österreichern zu rächen,<br />
indem er sie dadurch in allergrößte Verlegenheit brachte, dass er sich selbst und die Stephanskrone ihren Nachstellungen entzog.<br />
Die Österreicher wiederum wussten nur zu gut, dass sie gerade dieses Symbols habhaft werden mussten, wenn sie ihrem Macht<br />
und Herrschaftsanspruch auf Ungarn den Anschein einer übergeordneten Legitimität geben wollten. Erst der Besitz dieses<br />
kostbaren Pfandes würde es ihnen erlauben, sich wirklich als Herren Ungarns fühlen zu dürfen.<br />
Nun wusste man ungefähr, wo Kossuth die Kiste mit der Krone und den Insignien vergraben hatte. Jahrelang suchte man also am<br />
Eisernen Tor und praktisch unter den aufmerksamen Augen der Türken nach diesem Schatz, wobei Wien immer größere<br />
Geldsummen für den Fall einer Auffindung in Aussicht stellte. Die einheimische Bevölkerung, Soldaten, denen diese patriotische<br />
Abart der Schatzgräberei etwas Abwechslung ins eintönige Garnisonsleben brachte, Gendarmen, ja selbst die in und rund um<br />
Orschowa ansässige Geistlichkeit beteiligten sich mit ungebrochenem Eifer an den intensiven Nachforschungen. 1853 hatte man<br />
endlich Erfolg. Die eiserne Truhe wurde gehoben, der Krönungsschatz behutsam ans Tageslicht befördert, der feuchte<br />
Krönungsornat in einem sorgfältig beheizten Zimmer getrocknet. Dann überantwortete man den Schatz einem rasch