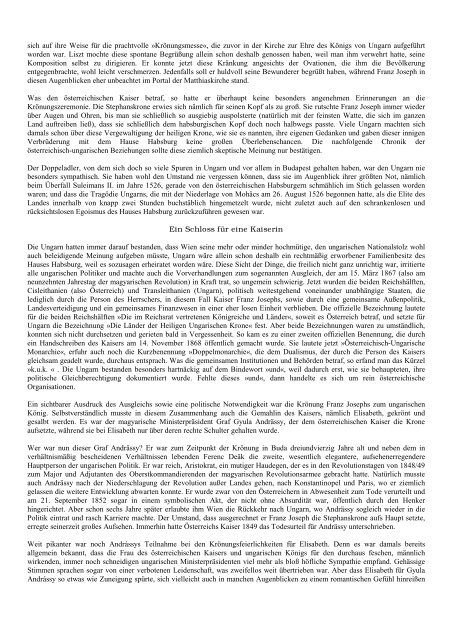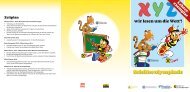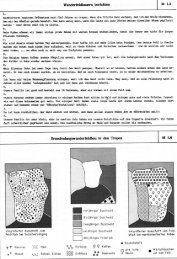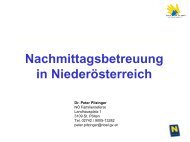Humbert Fink
Humbert Fink
Humbert Fink
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sich auf ihre Weise für die prachtvolle »Krönungsmesse«, die zuvor in der Kirche zur Ehre des Königs von Ungarn aufgeführt<br />
worden war. Liszt mochte diese spontane Begrüßung allein schon deshalb genossen haben, weil man ihm verwehrt hatte, seine<br />
Komposition selbst zu dirigieren. Er konnte jetzt diese Kränkung angesichts der Ovationen, die ihm die Bevölkerung<br />
entgegenbrachte, wohl leicht verschmerzen. Jedenfalls soll er huldvoll seine Bewunderer begrüßt haben, während Franz Joseph in<br />
diesen Augenblicken eher unbeachtet im Portal der Matthiaskirche stand.<br />
Was den österreichischen Kaiser betraf, so hatte er überhaupt keine besonders angenehmen Erinnerungen an die<br />
Krönungszeremonie. Die Stephanskrone erwies sich nämlich für seinen Kopf als zu groß. Sie rutschte Franz Joseph immer wieder<br />
über Augen und Ohren, bis man sie schließlich so ausgiebig auspolsterte (natürlich mit der feinsten Watte, die sich im ganzen<br />
Land auftreiben ließ), dass sie schließlich dem habsburgischen Kopf doch noch halbwegs passte. Viele Ungarn machten sich<br />
damals schon über diese Vergewaltigung der heiligen Krone, wie sie es nannten, ihre eigenen Gedanken und gaben dieser innigen<br />
Verbrüderung mit dem Hause Habsburg keine großen Überlebenschancen. Die nachfolgende Chronik der<br />
österreichisch-ungarischen Beziehungen sollte diese ziemlich skeptische Meinung nur bestätigen.<br />
Der Doppeladler, von dem sich doch so viele Spuren in Ungarn und vor allem in Budapest gehalten haben, war den Ungarn nie<br />
besonders sympathisch. Sie haben wohl den Umstand nie vergessen können, dass sie im Augenblick ihrer größten Not, nämlich<br />
beim Überfall Suleimans II. im Jahre 1526, gerade von den österreichischen Habsburgern schmählich im Stich gelassen worden<br />
waren; und dass die Tragödie Ungarns, die mit der Niederlage von Mohäcs am 26. August 1526 begonnen hatte, als die Elite des<br />
Landes innerhalb von knapp zwei Stunden buchstäblich hingemetzelt wurde, nicht zuletzt auch auf den schrankenlosen und<br />
rücksichtslosen Egoismus des Hauses Habsburg zurückzuführen gewesen war.<br />
Ein Schloss für eine Kaiserin<br />
Die Ungarn hatten immer darauf bestanden, dass Wien seine mehr oder minder hochmütige, den ungarischen Nationalstolz wohl<br />
auch beleidigende Meinung aufgeben müsste, Ungarn wäre allein schon deshalb ein rechtmäßig erworbener Familienbesitz des<br />
Hauses Habsburg, weil es sozusagen erheiratet worden wäre. Diese Sicht der Dinge, die freilich nicht ganz unrichtig war, irritierte<br />
alle ungarischen Politiker und machte auch die Vorverhandlungen zum sogenannten Ausgleich, der am 15. März 1867 (also am<br />
neunzehnten Jahrestag der magyarischen Revolution) in Kraft trat, so ungemein schwierig. Jetzt wurden die beiden Reichshälften,<br />
Cisleithanien (also Österreich) und Transleithanien (Ungarn), politisch weitestgehend voneinander unabhängige Staaten, die<br />
lediglich durch die Person des Herrschers, in diesem Fall Kaiser Franz Josephs, sowie durch eine gemeinsame Außenpolitik,<br />
Landesverteidigung und ein gemeinsames Finanzwesen in einer eher losen Einheit verblieben. Die offizielle Bezeichnung lautete<br />
für die beiden Reichshälften »Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder«, soweit es Österreich betraf, und setzte für<br />
Ungarn die Bezeichnung »Die Länder der Heiligen Ungarischen Krone« fest. Aber beide Bezeichnungen waren zu umständlich,<br />
konnten sich nicht durchsetzen und gerieten bald in Vergessenheit. So kam es zu einer zweiten offiziellen Benennung, die durch<br />
ein Handschreiben des Kaisers am 14. November 1868 öffentlich gemacht wurde. Sie lautete jetzt »Österreichisch-Ungarische<br />
Monarchie«, erfuhr auch noch die Kurzbenennung »Doppelmonarchie«, die dem Dualismus, der durch die Person des Kaisers<br />
gleichsam geadelt wurde, durchaus entsprach. Was die gemeinsamen Institutionen und Behörden betraf, so erfand man das Kürzel<br />
»k.u.k. « . Die Ungarn bestanden besonders hartnäckig auf dem Bindewort »und«, weil dadurch erst, wie sie behaupteten, ihre<br />
politische Gleichberechtigung dokumentiert wurde. Fehlte dieses »und«, dann handelte es sich um rein österreichische<br />
Organisationen.<br />
Ein sichtbarer Ausdruck des Ausgleichs sowie eine politische Notwendigkeit war die Krönung Franz Josephs zum ungarischen<br />
König. Selbstverständlich musste in diesem Zusammenhang auch die Gemahlin des Kaisers, nämlich Elisabeth, gekrönt und<br />
gesalbt werden. Es war der magyarische Ministerpräsident Graf Gyula Andrässy, der dem österreichischen Kaiser die Krone<br />
aufsetzte, während sie bei Elisabeth nur über deren rechte Schulter gehalten wurde.<br />
Wer war nun dieser Graf Andrässy? Er war zum Zeitpunkt der Krönung in Buda dreiundvierzig Jahre alt und neben dem in<br />
verhältnismäßig bescheidenen Verhältnissen lebenden Ferenc Deäk die zweite, wesentlich elegantere, aufsehenerregendere<br />
Hauptperson der ungarischen Politik. Er war reich, Aristokrat, ein mutiger Haudegen, der es in den Revolutionstagen von 1848/49<br />
zum Major und Adjutanten des Oberstkommandierenden der magyarischen Revolutionsarmee gebracht hatte. Natürlich musste<br />
auch Andrässy nach der Niederschlagung der Revolution außer Landes gehen, nach Konstantinopel und Paris, wo er ziemlich<br />
gelassen die weitere Entwicklung abwarten konnte. Er wurde zwar von den Österreichern in Abwesenheit zum Tode verurteilt und<br />
am 21. September 1852 sogar in einem symbolischen Akt, der nicht ohne Absurdität war, öffentlich durch den Henker<br />
hingerichtet. Aber schon sechs Jahre später erlaubte ihm Wien die Rückkehr nach Ungarn, wo Andrässy sogleich wieder in die<br />
Politik eintrat und rasch Karriere machte. Der Umstand, dass ausgerechnet er Franz Joseph die Stephanskrone aufs Haupt setzte,<br />
erregte seinerzeit großes Aufsehen. Immerhin hatte Österreichs Kaiser 1849 das Todesurteil für Andrässy unterschrieben.<br />
Weit pikanter war noch Andrássys Teilnahme bei den Krönungsfeierlichkeiten für Elisabeth. Denn es war damals bereits<br />
allgemein bekannt, dass die Frau des österreichischen Kaisers und ungarischen Königs für den durchaus feschen, männlich<br />
wirkenden, immer noch schneidigen ungarischen Ministerpräsidenten viel mehr als bloß höfliche Sympathie empfand. Gehässige<br />
Stimmen sprachen sogar von einer verbotenen Leidenschaft, was zweifellos weit übertrieben war. Aber dass Elisabeth für Gyula<br />
Andrássy so etwas wie Zuneigung spürte, sich vielleicht auch in manchen Augenblicken zu einem romantischen Gefühl hinreißen