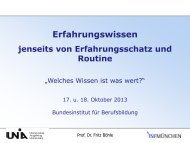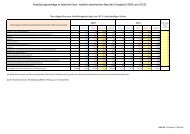forsch 402 - BiBB
forsch 402 - BiBB
forsch 402 - BiBB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Informationsdienst<br />
des Bundesinstituts<br />
für Berufsbildung<br />
Oktober 2002<br />
W. Bertelsmann Verlag<br />
ISSN 1615-4363<br />
<strong>forsch</strong>unG42002<br />
Impressum<br />
BIBB<strong>forsch</strong>ung<br />
3. Jahrgang, Heft 4/2002, Oktober 2002<br />
Herausgeber<br />
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)<br />
Der Generalsekretär<br />
Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn<br />
Redaktion<br />
Dr. Eckart Strohmaier (verantw.)<br />
Petra Spilles (Redaktionsassistenz),<br />
Dr. Wolfgang Becker, Edith Bellaire,<br />
Katrin Gutschow, Heinrich Althoff,<br />
Dr. Ilona Zeuch-Wiese<br />
Telefon 0228 / 107-1721<br />
Telefax 0228 / 107-2967<br />
E-Mail: bibb<strong>forsch</strong>ung@bibb.de<br />
Internet: http://www.bibb.de<br />
Gestaltung<br />
Hoch Drei, Berlin<br />
Verlag, Anzeigen, Vertrieb<br />
W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG<br />
Postfach 10 06 33, 33506 Bielefeld<br />
Telefon 0521 / 91101-11<br />
Telefax 0521 / 91101-19<br />
E-Mail: service@wbv.de<br />
Anregungen zu BIBB<strong>forsch</strong>ung nimmt<br />
die Redaktion gerne entgegen.<br />
■ Schwerpunkte<br />
staatlicher Förderung<br />
der betrieblichen<br />
Ausbildung im dualen<br />
System<br />
Der Eindruck einer zunehmenden „Verstaatlichung“<br />
der dualen Ausbildung, die Kritik<br />
an der mangelnden Transparenz der Gesamtausgaben<br />
zur öffentlichen Ausbildungsförderung<br />
und die gleichzeitig in Frage gestellte<br />
Wirksamkeit dieser Förderung waren<br />
Ausgangspunkte für das BIBB-Forschungsprojekt:<br />
„Öffentliche Förderung der betrieblichen<br />
Ausbildung im dualen System“.<br />
Während die staatlichen Ausgaben zur Ausbildungsförderung<br />
des Bundes vergleichsweise<br />
gut dokumentiert sind, geben Berufsbildungsberichte<br />
und andere Dokumentationen<br />
zu den Bildungsausgaben nur<br />
lückenhaft Aufschluss über die länderspezifischen<br />
Aufwendungen für Ausbildungsförderung.<br />
Für den Bund werden in den Berufsbildungsberichten<br />
die beruflichen Bildungsausgaben<br />
der Ressorts Bildung, Wirtschaft<br />
und Arbeit dokumentiert. Werden nur die<br />
Ausgaben zur Förderung der Berufsausbildung<br />
berücksichtigt, so lagen diese in den<br />
Jahren 1999 bis 2000 bei ungefähr 490<br />
Mio. e (Ist) und stiegen im Haushaltsjahr<br />
2001 auf fast 600 Mio. e. In den Jahren<br />
1999 und 2001 lassen sich insgesamt drei<br />
Förderschwerpunkte identifizieren:<br />
• Infrastrukturförderung betrieblicher Ausbildung<br />
(insbesondere die Förderung<br />
überbetrieblicher Berufsbildungsstätten<br />
und die Förderung der Errichtung oder<br />
des Ausbaus von Einrichtungen der beruflichen<br />
Ausbildung, Fortbildung und<br />
Umschulung).<br />
Inhalt<br />
■ Staatliche Förderung der<br />
betrieblichen Ausbildung<br />
■ Qualitätsmanagementsysteme<br />
bei<br />
Weiterbildungsanbietern<br />
■ E-qualification in<br />
Vocational Training – ein<br />
Qualifizierungskonzept für<br />
Trainerinnen und Trainer<br />
■ Termine<br />
■ Lösung von<br />
Ausbildungsverträgen<br />
■ Literatur<br />
• Ausbildungsförderung von Berufsschüler(inne)n<br />
(nach §§ 2, 68 BaföG)<br />
• Förderausgaben des Bundes für außerbetriebliche<br />
Ausbildungsplätze<br />
Die Förderausgaben des Bundes konzentrieren<br />
sich damit sowohl auf die Finanzierung<br />
des Ausbildungsprozesses als auch auf<br />
die finanzielle Unterstützung von Individuen.<br />
Die Finanzierung des Ausbildungsprozesses<br />
schließt dabei einerseits Förderangebote zur<br />
Verbesserung des quantitativen Ausbildungsangebotes<br />
und andererseits die Finanzierung<br />
strukturverbessernder Maßnahmen im<br />
Bereich der Ausbildung ein. Im Jahr 2001<br />
stellen die Ist-Ausgaben zur Verbesserung<br />
der Infrastruktur, der Ausbildungsqualität<br />
und der Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems<br />
mit rd. 42 % den Schwerpunkt<br />
der Bundesausgaben für Berufsausbildung.<br />
Eine Analyse der Länderhaushalte zeigte,<br />
dass sich die Ist-Ausgaben der Länder für<br />
Ausbildungsförderung (ohne berufsbildende<br />
Schulen) in den Jahren 1997–2000 auf<br />
durchschnittlich rd. 738 Mio. e pro Jahr bezifferten.<br />
Die Soll-Ausgaben lagen 2001 bei<br />
628 Mio. e. Dabei kommt es jährlich zu<br />
durchschnittlich rd. 160.000 Förderfällen.<br />
Rund 24% der Durchschnittsausgaben von
<strong>forsch</strong>unG<br />
4 2002<br />
1997–2000 wurden über Mittel des Europäischen<br />
Sozialfonds (ESF) und 12% über<br />
Bundesmittel finanziert. Fast zwei Drittel der<br />
Länderaufwendungen für Ausbildungsförderung<br />
wurden von den ostdeutschen Ländern<br />
einschließlich Berlin verausgabt. Die Ausgaben<br />
in Ostdeutschland werden fast zur Hälfte<br />
durch ESF und Bund finanziert. Insgesamt<br />
lassen sich, bezogen auf alle Bundesländer,<br />
vier Förderschwerpunkte ermitteln:<br />
• Förderung außerbetrieblicher Ausbildung<br />
• Förderung zusätzlicher Ausbildungsmöglichkeiten<br />
über EU-Programme<br />
• ÜBS-Förderung und Förderung der Verbundausbildung<br />
• Förderung betrieblicher Ausbildungsplätze<br />
Während die Bundesförderung einen wichtigen<br />
Ausgabenschwerpunkt bei den strukturverbessernden<br />
Maßnahmen wie z.B. der<br />
ÜBS-Förderung hat, steht bei den Länderausgaben<br />
zur Ausbildungsförderung die<br />
quantitative Verbesserung des Ausbildungsangebotes<br />
im Vordergrund. Bei dieser Förderung<br />
nehmen die Bund-Länder-Ausbildungsplatzprogramme<br />
Ost einen wichtigen<br />
Stellenwert ein. Im Rahmen des Projektes<br />
wurde eine Evaluierung dieser Ausbildungsplatzprogramme<br />
durchgeführt. Eine soeben<br />
neu erschienene Veröffentlichung von Klaus<br />
Berger und Günter Walden berichtet über<br />
die Ergebnisse der Untersuchung, zieht<br />
Schlussfolgerungen und gibt Empfehlungen<br />
(siehe Literaturempfehlungen).<br />
Kontakt: Dr. Günter Walden –<br />
walden@bibb.de<br />
Klaus Berger – berger@bibb.de<br />
■ QualitätssicherungundQualitätsmanagementsysteme<br />
bei Weiterbildungsanbietern<br />
Im Juli 2002 hat – mit finanzieller Unterstützung<br />
des Bundesministeriums für Bildung<br />
und Forschung (BMBF) – die Abteilung<br />
Weiterbildungstest bei der Stiftung Bildungstest<br />
ihre Arbeit aufgenommen. Damit wurde<br />
ein wichtiger Grundstein auf dem Weg<br />
zu mehr Qualität und Transparenz auf dem<br />
Weiterbildungsmarkt gelegt. Weiterbildungstests<br />
sollen den Teilnehmerschutz und<br />
das Qualitätsbewusstsein bei Bildungsnachfragern<br />
und -interessierten stärken. Weiterbildungstests<br />
sollen es ihnen erleichtern, aus<br />
der Vielzahl bestehender Angebote ein qua-<br />
Qualitätsentwicklung bei Weiterbildungsanbietern<br />
Beginn der Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Linie<br />
vor<br />
1985<br />
109<br />
1985–<br />
1989<br />
178<br />
litativ gutes und für ihre persönliche und berufliche<br />
Entwicklung adäquates Angebot<br />
auszuwählen. Von Bildungseinrichtungen<br />
wird in diesem Kontext erwartet, durch Anwendung<br />
von Qualitätssicherungs- und<br />
Qualitätsmanagementsystemen ihre Geschäftsprozesse<br />
zu verbessern, um ein aktuelles<br />
und qualitativ gutes Bildungsangebot<br />
zu erhalten.<br />
Die Verbreitung und Akzeptanz von Verfahren<br />
zur Qualitätssicherung bei Bildungsanbietern<br />
stehen im Mittelpunkt der vom<br />
BMBF geförderten Studie „Qualitätsentwicklung<br />
in der Weiterbildung – Zum Stand<br />
der Anwendung von Qualitätssicherungsund<br />
Qualitätsmanagementsystemen bei<br />
Weiterbildungsanbietern“. Die Studie wird<br />
vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)<br />
durchgeführt. Als Auftragnehmer beteiligt<br />
sind das Institut für Entwicklungsplanung<br />
und Struktur<strong>forsch</strong>ung GmbH (IES) sowie<br />
die Sozialwissenschaftliche Forschung und<br />
Beratung. Im ersten Schritt geht es um Informationen<br />
und Einschätzungen zu Verfahren<br />
der Qualitätssicherung bei 1.500<br />
Weiterbildungsanbietern im Rahmen einer<br />
telefonischen Befragung. Im zweiten Schritt<br />
werden ausgewählte Ergebnisse der telefonischen<br />
Befragung bei rund 40 Anbietern in<br />
persönlichen Interviews vertieft.<br />
Die ersten Ergebnisse zeigen: Das Thema<br />
„Qualität“ hat sich bei den Weiterbildungsanbietern<br />
erst in den letzten Jahren durchgesetzt.<br />
Die bisher vorherrschende Diskussion<br />
war eher auf einen kleinen Kreis von<br />
Fachleuten beschränkt. Die Praxis hat erst<br />
mit einer zeitlichen Verzögerung mit der<br />
Umsetzung begonnen und scheint sich zur<br />
Zeit intensiv mit der Qualität von Weiterbil-<br />
dung zu befassen. Die Abbildung macht<br />
deutlich, dass „Qualität“ heute für fast alle<br />
Weiterbildungseinrichtungen wichtig ist.<br />
Von den rund 1.500 befragten Weiterbildungseinrichtungen<br />
hatten bis 1990 knapp<br />
zwölf Prozent Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung<br />
angestoßen. Als eigentlicher<br />
Startpunkt zeichnet sich das Jahr 1990 ab.<br />
Danach folgt eine kontinuierliche Zunahme<br />
der Aktivitäten bei den Anbietern. Weniger<br />
als vier Prozent der Befragten führen bis<br />
zum Befragungszeitpunkt keine Maßnahmen<br />
zur Qualitätsentwicklung durch oder<br />
haben zum Startpunkt ihrer Aktivitäten keine<br />
Angabe gemacht.<br />
Im Vordergrund der Qualitätskonzepte bei<br />
Weiterbildungsanbietern steht die Selbstevaluation.<br />
Auf die Frage „Welche der folgenden<br />
Ansätze zur Qualitätsentwicklung<br />
verfolgen Sie in Ihrer Einrichtung?“ hat der<br />
größte Teil der Befragten, nämlich 76 Prozent,<br />
angeben, einen Ansatz der Selbstevaluation<br />
zu verfolgen. 15 Prozent haben geantwortet,<br />
dass sie sich am Modell des European<br />
Foundation for Quality Management<br />
(EFQM) orientieren, 22 Prozent legen ihrem<br />
Konzept die Teilnahme an Wettbewerben<br />
zugrunde, 24 Prozent orientieren sich an<br />
Qualitäts- oder Gütesiegeln und 29 Prozent<br />
an der ISO 9000.<br />
Die Ergebnisse des Projektes werden im<br />
Rahmen einer Fachtagung vertieft, die am<br />
20. November 2002 in Hannover stattfindet.<br />
Erste Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht<br />
(siehe Literaturempfehlungen).<br />
Kontakt: Dr. Christel Balli – balli@bibb.de<br />
Dr. Elisabeth M. Krekel –<br />
krekel@bibb.de<br />
www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de<br />
1990–<br />
1994<br />
491<br />
1995<br />
616<br />
1996<br />
739<br />
1997<br />
893<br />
Einrichtungen mit Qualitätsansätzen<br />
1998<br />
1064<br />
1999<br />
1230<br />
2000<br />
1346<br />
ab<br />
2001<br />
1441
<strong>forsch</strong>unG<br />
4 2002<br />
■ E-qualification in<br />
Vocational Training –<br />
Chancengleichheit in<br />
der Weiterbildung –<br />
ein Qualifizierungskonzept<br />
für Trainerinnen<br />
und Trainern<br />
Die typischen Lebens- und Berufsbiografien<br />
von Frauen wirken sich auch in der Weiterbildung<br />
aus, z.B. hinsichtlich des Zeitbudgets,<br />
das für Weiterbildung zu Verfügung<br />
steht, und den persönlichen Erfahrungen,<br />
die den Zugang zu Weiterbildungsinhalten<br />
beeinflussen.<br />
Um die Bildungsarbeit mit Frauen effektiv<br />
gestalten zu können, müssen Ausbilder(inne)n<br />
und Weiterbilder(innen) in der beruflichen<br />
Bildung mit diesen spezifischen Bedingungen<br />
und den bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten<br />
vertraut sein. Dieser<br />
Aspekt wird in traditionellen „train-thetrainer“-Kursen<br />
bisher nur unzureichend<br />
berücksichtigt. In einem europäischen Projekt,<br />
koordiniert vom Berufsförderungsinstitut<br />
Österreich, wurde mit Beteiligung des<br />
BIBB daher ein modular aufgebauter Lehrgang<br />
für die Aus- und Weiterbildung von<br />
Ausbilder(inne)n und Weiterbilder(inne)n<br />
entwickelt und erprobt.<br />
Dieser Lehrgang<br />
• ermöglicht es Ausbilder(inne)n und Dozent(inn)en,<br />
sich mit den gesellschaftlichen<br />
und rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
ihrer Arbeit auseinandersetzen,<br />
• ist praxisnah gestaltet,<br />
• greift neue Erkenntnisse der Geschlechter<strong>forsch</strong>ung<br />
auf,<br />
• sensibilisiert die teilnehmenden Trainerinnen<br />
und Trainern für die Beobachtung<br />
des eigenen Verhaltens und das von Mitgliedern<br />
ihrer Lerngruppen und<br />
• macht Methoden in der Weiterbildung<br />
durch Transparenz des Methodeneinsatzes<br />
erfahrbar.<br />
<strong>forsch</strong>unG<br />
Es werden dabei die folgenden Module angeboten:<br />
1. Chancengleichheit und Europäische<br />
Vision<br />
Das Modul stellt als Einführung eine gute<br />
Grundlage zum Thema Chancengleichheit<br />
dar. Es will dazu beitragen, die Bedingungen<br />
und Inhalte in der Arbeitswelt unter historischen,<br />
sozialen, pädagogischen und rechtlichen<br />
Aspekten zu betrachten. Auch die<br />
Europäische Dimension der Gleichstellungsfrage,<br />
z.B. der Begriff des Gender Mainstreaming,<br />
wird behandelt.<br />
2. Karriereplanung/Zeitmanagement<br />
In diesem Modul wird die Auswirkung der<br />
dualen Orientierung von Frauen auf die<br />
Lebens- und Karriereplanung thematisiert.<br />
Behandelt wird auch die Bedeutung neuer<br />
Formen der Arbeitsorganisation auf Berufsverläufe<br />
von Frauen. Den Teilnehmer(inne)n<br />
werden Methoden der Karriereplanung und<br />
des Zeitmanagements vermittelt, die sie in<br />
die Lage versetzen, konfligierenden Zielen<br />
und Ansprüchen in Berufs- und Privatleben<br />
angemessen zu begegnen.<br />
3. Geschlechtsspezifische Muster im<br />
Umgang mit Konflikten, Macht und<br />
Gruppendynamik<br />
Im Mittelpunkt dieses Moduls steht der Vergleich<br />
zwischen Frauen und Männern hinsichtlich<br />
ihrer Selbstdarstellung und ihrer<br />
kommunikativen Strategien, wenn es darum<br />
geht, in Konflikt-, Konkurrenz- und Machtsituationen<br />
zum Erfolg zu kommen.<br />
Ziele dieses Moduls sind:<br />
• Bewußtsein dafür zu schaffen, wie sehr<br />
unser Verhalten im Umgang mit Konflikten,<br />
Hierarchie und Macht von sogenannten<br />
Genderregeln bestimmt ist,<br />
• Interesse dafür zu wecken, diese Männlichkeits-<br />
und Weiblichkeitsnormen zu<br />
überwinden und damit das eigene Handlungsspektrum<br />
zu erweitern und<br />
• Konsequenzen für die eigene didaktische<br />
Praxis abzuleiten, um im eigenen Trainingsalltag<br />
Geschlechtsstereotypien entgegenzuwirken<br />
bzw. vorzubeugen.<br />
4. Schlüsselqualifikationen<br />
Mit diesem Modul wird ein Überblick über<br />
die verschiedenen Aufgaben der Trainerinnen<br />
und Trainer und über partizipative Methoden<br />
in der Erwachsenenbildung gegeben.<br />
Die Teilnehmer(innen) verbessern im<br />
Seminar ihre Selbstwahrnehmung und ihre<br />
Möglichkeiten, auf Lerngruppen einzuwirken,<br />
um den Lernprozess zu stimulieren.<br />
5. Kreative Techniken<br />
Das Maß, in dem das eigene kreative Potential<br />
genutzt wird, hängt maßgeblich von<br />
der durch Umwelt und Erziehung beeinflußten<br />
Persönlichkeitsstruktur und Persönlichkeitsentwicklung<br />
ab. Kreative Fähigkeiten<br />
eines jeden Menschen lassen sich, wie<br />
auch intellektuelle und körperliche Fähigkeiten,<br />
entwickeln und fördern. Durch<br />
Reflexion und praktische Erfahrung sowie<br />
Erfahrungsaustausch in der Gruppe sollen<br />
die Teilnehmer(innen) Impulse zur eigenen<br />
Seminargestaltung und damit zur Umsetzung<br />
persönlichkeitsadäquater Techniken erhalten.<br />
6. Neue Technologien<br />
Dieses Modul bietet Frauen und Männern<br />
die Möglichkeit, sich mit „Neue Technologien“<br />
auseinander zu setzen und sich darüber<br />
auszutauschen, wie sich Frauen und<br />
wie sich Männer Technik und Technikkompetenz<br />
aneignen, wie sie an die Nutzung<br />
herangehen, was für sie dabei hilfreich bzw.<br />
was hinderlich ist.<br />
7. Professionelle Strategien in der<br />
Arbeit<br />
Dieses Modul schließt die Seminarreihe ab.<br />
Es ist einerseits eine Synthese der vorangegangenen<br />
Module und unterstützt andererseits<br />
die Teilnehmenden bei einem individuellen<br />
Projekt der Karriereplanung.<br />
8. Rechtliche Grundlagen<br />
Mit diesem Modul erwerben die Teilnehmenden<br />
Kenntnisse über Rechtsangelegenheiten<br />
auf nationalstaatlicher und europäischer<br />
Ebene, die für die Tätigkeit als Trainer<br />
(in) relevant sind. Sie werden außerdem<br />
dafür sensibilisiert, Auswirkungen von rechtlichen<br />
Vorschriften unter gleichstellungspolitischen<br />
Aspekten zu analysieren.<br />
Dieses Modul ist als Fernunterrichtseinheit<br />
angelegt.<br />
Weitere Informationen unter<br />
http://www.bfi.at/deutsch/angebote/<br />
e-qualification/index.html<br />
Kontakt: Katrin Gutschow –<br />
gutschow@bibb.de<br />
■ Termine<br />
BIBB-Fachkongress in Berlin vom 23.–25.<br />
Oktober 2002<br />
Internationales Congress-Centrum<br />
Sie finden uns in der Foyer-Ebene, blaues<br />
Seitenfoyer<br />
6. VLB-Berufsbildungskongress (Verband<br />
der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern<br />
e. V.) vom 22.–23. November 2002 in<br />
Passau, Staatl. Berufsschule I, Karl-Peter-<br />
Obermaier-Schule, Am Fernsehturm 1 (mit<br />
BIBB-Stand)<br />
Bayerischer Berufsbildungskongress<br />
Nürnberg Messe GmbH vom 2.–5. Dezember<br />
2002<br />
Sie finden uns in Halle 8, Stand 208<br />
Learntec 2003 in Karlsruhe (Karlsruher<br />
Messe- und Kongress-GmbH) vom 4.–7.<br />
Februar 2003 (mit BIBB-Beteiligung)<br />
www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de
<strong>forsch</strong>unG<br />
42002<br />
■ Lösung von<br />
Ausbildungsverträgen<br />
und Abbruch der<br />
Ausbildung<br />
Durch den Abbruch der Lehre bzw. die<br />
Lösung eines Vertrages gehen gerade in<br />
Zeiten knapper Lehrstellen viele Ausbildungsressourcen<br />
verloren, sowohl auf Seiten<br />
der Betriebe wie auch auf Seiten der<br />
Jugendlichen. Beispielsweise haben im Jahre<br />
2001 156.000 Auszubildende ihren Vertrag<br />
gelöst. Das entspricht einer Quote von<br />
25,5%, bezogen auf die neuen Verträge<br />
des gleichen Jahres, und einer Steigerung<br />
von 0,4 Prozentpunkten gegenüber dem<br />
Vorjahr (25,1%). Damit setzt sich die seit<br />
1997 steigende Tendenz fort.<br />
Um die Abbrecherquoten zu senken und<br />
entsprechende Maßnahmen einzuleiten, bedarf<br />
es zuverlässiger und aktueller statistischer<br />
Informationen. Abbruch der Ausbildung<br />
und Vertragslösung sind sehr komplexe<br />
Phänomene, die durch viele Wechselvorgänge<br />
geprägt sind (Vertragsabschluss,<br />
Lösung des Vertrags, Wiedereintritt in eine<br />
Lehre mit oder ohne Wechsel des Ausbildungsberufs<br />
oder Beginn einer schulischen<br />
Ausbildung, endgültiger Verzicht auf eine<br />
berufliche Qualifizierung usw.). Idealerweise<br />
müsste daher eine Verlaufsstatistik angelegt<br />
werden, die den Weg jedes einzelnen Jugendlichen<br />
über Jahre hinweg verfolgt, um<br />
dann ein endgültiges Bild für eine Ausbildungskohorte<br />
erstellen zu können. Die amtliche<br />
Berufsbildungsstatistik stellt dagegen<br />
nur aggregierte Angaben über Vertragslösungen<br />
zu einem bestimmten Zeitpunkt zur<br />
Verfügung. Die Frage, in welcher Weise aus<br />
diesem Datenmaterial dennoch aussagekräftige<br />
Quoten berechnet werden können<br />
und welche Einschränkungen und Unschärfen<br />
dabei zu beachten sind, wurde vom<br />
BIBB jetzt genauer untersucht.<br />
<strong>forsch</strong>unG<br />
In einem ersten Untersuchungsschritt werden<br />
verschiedene Berechnungsmöglichkeiten<br />
(Retrospektiv-, Schichten-, Kohortenmodelle)<br />
auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik<br />
geprüft. Im Ergebnis wird eine im Vergleich<br />
zu den bisherigen Ansätzen differenziertere<br />
Methode vorgeschlagen, die auf der<br />
spezifischen Zuordnung der Vertragslösungen<br />
nach Ausbildungsjahren zu den jeweiligen<br />
Kohorten (Neuabschlüssen) beruht.<br />
Fest steht allerdings, dass auf der Basis der<br />
amtlichen Statistik die Berechnung einer exakten<br />
Lösungsquote oder gar einer Quote<br />
der endgültigen Abbrecher nicht möglich ist.<br />
Auf der Basis einer breit angelegten Befragung<br />
von Jugendlichen werden in einem<br />
zweiten Schritt die Bildungsbiografien in Bezug<br />
auf die rechnerischen Unterschiede zwischen<br />
Ausbildungsabbruch und Vertragslösung<br />
untersucht. Diese retrospektiv erhobenen<br />
Verlaufsdaten ermöglichen es nicht<br />
nur, die individuellen Bildungswege zeitlich<br />
genau nachzuvollziehen und Abbrecherquoten<br />
zu berechnen, sondern die Daten<br />
auch so zu aggregieren, dass sie den Erfassungsmerkmalen<br />
der amtlichen Statistik entsprechen.<br />
Auf diese Kennzahlen wurden als<br />
Test die gleichen Rechenmethoden wie bei<br />
den Daten der Berufsbildungsstatistik angewandt.<br />
Ein Vergleich der Ergebnisse zeigt,<br />
dass die Modelle, die für die amtliche Statistik<br />
verwendet werden, den „wahren“<br />
Werten recht nahe kommen.<br />
Ein weiterer Untersuchungsansatz dient<br />
ebenfalls der Validierung der untersuchten<br />
Methoden. In einem Simulations-Modell<br />
wurden alle Werte eingetragen, die zu einer<br />
Berechnung der Lösungsquoten nötig<br />
■ Literatur<br />
• Althoff, Heinrich; Brosi, Walter; Troltsch,<br />
Klaus; Ulrich, Joachim Gerd; Werner,<br />
Rudolf: Vorzeitige Lösung von Lehrverträgen<br />
und Ausbildungsabbruch –<br />
Problemaufriss und Untersuchung<br />
der methodisch-statistischen Grundlagen<br />
(erscheint demnächst bei WBV).<br />
• Balli, Christel; Krekel, Elisabeth M.; Sauter,<br />
Edgar (Hrsg.): Qualitätsentwicklung in<br />
der Weiterbildung. Zum Stand der Anwendung<br />
von Qualitätssicherungsund<br />
Qualitätsmanagementsystemen<br />
bei Weiterbildungsanbietern. Wissenschaftliche<br />
Diskussionspapiere. Bundesinstitut<br />
für Berufsbildung. Bonn 2002.<br />
• Berger, Klaus; Walden, Günter: Evaluierung<br />
der Bund-Länder-Programme<br />
zur Ausbildungsförderung in den<br />
neuen Bundesländern 1996–1999.<br />
Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 102.255<br />
• Bundesinstitut für Berufsbildung:<br />
Geschäftsbericht 2001<br />
Erhältlich beim BIBB, Best.-Nr. 09.073<br />
• Frank, Irmgard; Zimmermann, Hildegard:<br />
Lernen in neuen Kooperationsfeldern.<br />
Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 102.256<br />
• Autsch, Bernhard; Meerten, Egon (Hrsg.):<br />
Überbetriebliche Berufsbildungsstätte<br />
auf dem Weg zu dienstleistungs-<br />
wären. Die Zuordnung der Vertragslösungen<br />
zu Kohorten und die Aufteilung der Vertragslösungen<br />
auf Kalenderjahre und Ausbildungsjahre<br />
spielen dabei eine besondere<br />
Rolle. Sodann werden diese Annahmen variiert,<br />
ihre Auswirkungen auf die Ergebnisse<br />
der verschiedenen Berechnungsmodelle<br />
untersucht und somit die Stärken und<br />
Schwächen der verschiedenen Ansätze<br />
deutlich gemacht. Manche Modelle reagieren<br />
„empfindlicher“ auf Schwankungen bei<br />
der Kohortenstärke, andere auf die Aufteilung<br />
der Probezeitlösungen. Diese Untersuchungen<br />
beleuchten eindrucksvoll die Unschärfen,<br />
aber auch die Validität einzelner<br />
Modelle. Die verschiedenen Untersuchungsansätze<br />
stellt das BIBB jetzt in einem Sammelband<br />
vor (siehe Literaturempfehlungen).<br />
Kontakt: Dr. Rudolf Werner –<br />
wernerrdf@bibb.de<br />
Heinrich Althoff –<br />
althoff@bibb.de<br />
Klaus Troltsch – troltsch@bibb.de<br />
Dr. Joachim G. Ulrich –<br />
ulrich@bibb.de<br />
orientierten Kompetenzzentren.<br />
Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 110.413<br />
• Wiemann, Günter: Didaktische Modelle<br />
beruflichen Lernens im Wandel.<br />
Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 110.412<br />
• Ebbinghaus, Margit: Gestaltungsoffene<br />
Abschlussprüfung.<br />
Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 110.410<br />
• Bau, Henning; Ehrlich, Klaus (Hrsg.): An<br />
Wartungsaufträgen lernen. Die Entwicklung<br />
von Lehr- und Lernaufgaben<br />
im Rahmen der Lernortkooperation.<br />
Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 103.111<br />
• Gravalas, Brigitte: „Noch nicht 50 und<br />
fit wie ein Turnschuh ...“<br />
Eine Analyse von Stellengesuchen<br />
Älterer. Selbstdarstellung, Qualifikationsprofile,<br />
Berufswünsche. Erhältlich bei<br />
WBV, Best.-Nr. 110.407<br />
• Melms, Brigitte: Relevanz rechtlicher<br />
Regelungen für die Qualitätssicherung<br />
in der Weiterbildung auf Ebene<br />
der Länder in der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Erhältlich bei WBV, Best.-<br />
Nr. 110.408<br />
• Döhl, Volker; Dreiß, Manfred: Strategien<br />
überbetrieblicher Personalflexibilisierung.<br />
Kolloquien im BIBB, Heft 1.<br />
Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 116.001<br />
www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de