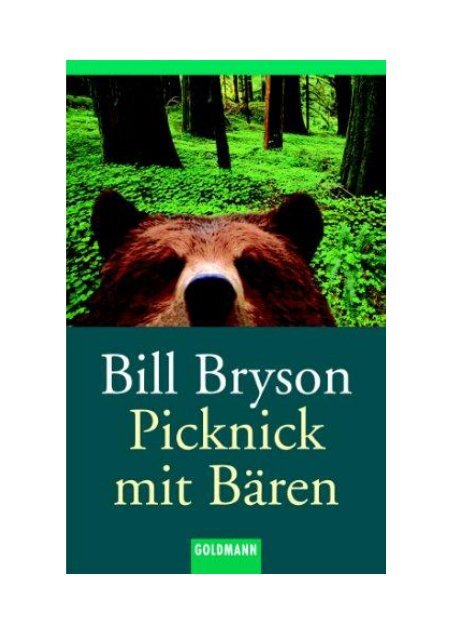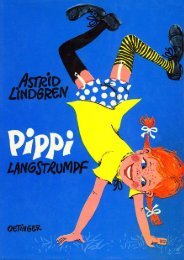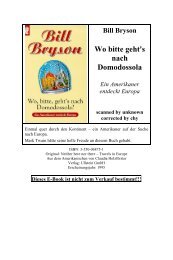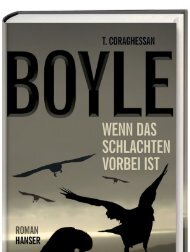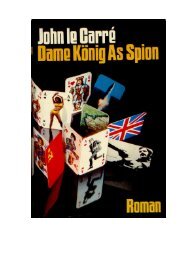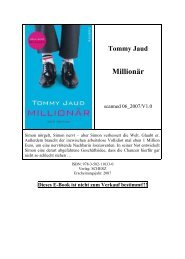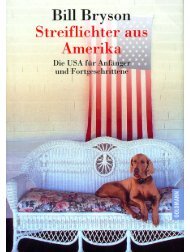Picknick mit Baren - Bryson, Bill.pdf
Picknick mit Baren - Bryson, Bill.pdf
Picknick mit Baren - Bryson, Bill.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Picknick</strong> <strong>mit</strong> Bären<br />
<strong>Bill</strong> <strong>Bryson</strong> will es seinen gehfaulen amerikanischen Landsleuten zeigen.<br />
Gemeinsam <strong>mit</strong> seinem Freund Katz plant er, den längsten Fußweg der<br />
Welt, den »Appalachian Trail«, zu bezwingen.<br />
Durch vierzehn Bundesstaaten der USA soll die Reise gehen und den Wanderern<br />
die großartigsten Naturschönheiten des Landes bescheren Doch lauern<br />
allerhand Gefahren im Dickicht, und die beiden können sich auf so<br />
manche Überraschung gefaßt machen…<br />
Ein Reisebericht der etwas anderen Art – humorvoll, selbst- ironisch und<br />
<strong>mit</strong> einem scharfen Blick für die Marotten von Menschen und Bären!<br />
»Der Leser wird sich dabei ertappen, wie der die Seiten <strong>mit</strong> wachsender<br />
Begeisterung verschlingt, denn er befindet sich in der Hand eines Satirikers<br />
ersten Ranges!«<br />
The New York Times Book Review<br />
»<strong>Bill</strong> <strong>Bryson</strong> ist ein Naturwunder!«<br />
Sunday Times<br />
Deutsche Erstveröffentlichung
Buch<br />
Anders als seine amerikanischen Landsleute, von denen <strong>Bill</strong> <strong>Bryson</strong> süffisant<br />
feststellt, sie würden sich täglich nicht mehr als 300 Meter zu Fuß<br />
bewegen, hat er sich Großes vorgenommen: Gemeinsam <strong>mit</strong> seinem alten<br />
Schulfreund Stephen Katz, der aufgrund seiner Leibesfülle und ausgesprochenen<br />
Leidenschaft für Unmengen von Snickers allerdings nicht eben die<br />
besten Voraussetzungen <strong>mit</strong>bringt, plant er eine Bezwingung des »Appalachian<br />
Trail« – jenes legendären längsten Fußweges der Welt, der sich über<br />
3000 Kilometer durch 14 Staaten hindurch an der Ostküste Amerikas entlangwindet<br />
und dem Wanderer die spektakulärsten Naturschönheiten offenbart.<br />
Aber unberührte Wälder, verwunschene Seen und atemberaubende<br />
Schluchten sind nicht das Einzige, was dieser Trip den beiden Wagemutigen<br />
beschert: Von den Tücken einer mangelhaften Ausrüstung einmal abgesehen,<br />
lauern allerhand Gefahren im Dickicht, und da selbst die einschlägige<br />
Fachliteratur keine verläßlichen Tips für den Fall einer Bärenattacke zu<br />
geben vermag – außer, unter gar keinen Umständen Snickers bei sich zu<br />
führen – , nimmt das Bangen kein Ende. Und dann sind da auch noch die<br />
lieben Mitmenschen, die unvermeidlicherweise ihren Weg kreuzen und sie<br />
in so manch fatale Situation bringen…<br />
Autor<br />
<strong>Bill</strong> <strong>Bryson</strong> wurde 1951 in Des Moines, Iowa, geboren. 1977 ging er nach<br />
Großbritannien und schrieb dort mehrere Jahre u. a. für die Times und den<br />
Independent. Mit »Reif für die Insel« (Goldmann Taschenbuch 44.279)<br />
gelang <strong>Bryson</strong>, der zuvor bereits Reiseberichte geschrieben hat, der ganz<br />
große Durchbruch. <strong>Bill</strong> <strong>Bryson</strong> lebt heute <strong>mit</strong> seiner Familie in Hanover,<br />
New Hampshire.<br />
Außerdem von <strong>Bill</strong> <strong>Bryson</strong> bei Goldmann lieferbar:<br />
Reif für die Insel. England für Anfänger und Fortgeschrittene (44.279) •<br />
Streifzüge durch das Abendland. Europa für Anfänger und Fortgeschrittene<br />
(45.073) • Streiflichter aus Amerika. Die USA für Anfänger und Fortgeschrittene<br />
(45.124) • Frühstück und Kängurus. Australische Abenteuer (geb.<br />
30.931)<br />
<strong>Bill</strong> <strong>Bryson</strong><br />
<strong>Picknick</strong> <strong>mit</strong> Bären<br />
Deutsch von Thomas Stegers
GOLDMANN<br />
Die Originalausgabe erschien 1998<br />
unter dem Titel »A Walk in the Woods«<br />
bei Broadway Books, New York<br />
Umwelthinweis:<br />
Alle bedruckten Materialien dieses Taschenbuches sind chlorfrei und umweltschonend.<br />
Deutsche Erstausgabe 9/99 Copyright © der Originalausgabe 1998<br />
by <strong>Bill</strong> <strong>Bryson</strong> Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1999<br />
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random<br />
House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München<br />
Umschlagfoto: Tony Stone/Wolfe<br />
Satz: deutsch-türkischer fotosatz, Berlin<br />
Druck: Eisnerdruck, Berlin<br />
Verlagsnummer: 44.395<br />
Redaktion: Hennette Zeltner<br />
CN • Herstellung: Peter Papenbrok<br />
Made in Germany<br />
ISBN 3-442-44.395-4<br />
www.goldmann-verlag.de<br />
7 9 10 8<br />
scanned & corrected<br />
by<br />
Grebo
Für Katz.<br />
Wen sonst.
TEIL l<br />
1. Kapitel<br />
Kurz nachdem ich <strong>mit</strong> meiner Familie in eine Kleinstadt in New Hampshire<br />
gezogen war, entdeckte ich zufällig einen Wanderweg, der sich am Ortsausgang<br />
in einem Wald verlor.<br />
Ein Schild verkündete, daß es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen<br />
Weg handelte, sondern um den berühmten Appalachian Trail. Mit seinen<br />
über 3.300 Kilometern durch die majestätischen und verlockenden Appalachen,<br />
entlang der amerikanischen Ostküste, zählt der AT, wie er bei Kennern<br />
heißt, zu den Altvordern unter den Fernwanderwegen. Er führt von<br />
Georgia bis nach Maine, durch 14 verschiedene Bundesstaaten, über stattliche,<br />
reizvolle Berge, deren Namen – Blue Ridge, Smokies, Cumberlands,<br />
Catskills, Green Mountains, White Mountains – schon wie eine Einladung<br />
zum Spazierengehen klingen. Wer kann schon die Worte »Great Smoky<br />
Mountains« oder »Shenandoah Valley« aussprechen, ohne dabei nicht das<br />
Bedürfnis zu verspüren, »einen Laib Brot und ein Pfund Tee in einen alten<br />
Rucksack zu werfen, über den Gartenzaun zu springen und loszuziehen«,<br />
wie es der Naturforscher John Muir ausdrückte.<br />
Da war er also, der Weg, schlängelte sich – für mich ganz unerwartet –<br />
verführerisch durch das friedliche Nest in New England, in dem ich mich<br />
gerade niedergelassen hatte. Die Vorstellung, ich könnte von zu Hause<br />
aufbrechen und 2.800 Kilometer weit durch einen Wald bis nach Georgia<br />
wandern, oder in die andere Richtung, 700 Kilometer nach Norden, über die<br />
rauhen und gebirgigen White Mountains klettern, bis auf den sagenhaften<br />
burgähnlichen Gipfel des Mount Katahdin, die ganze Zeit über umgeben<br />
von Bäumen, durch eine Wildnis, die nur wenige Menschen je zu Gesicht<br />
bekommen haben – diese Vorstellung erschien mir so außergewöhnlich, daß<br />
sich eine leise Stimme in meinem Inneren meldete: »Hört sich toll an! Das<br />
machen wir!«<br />
Ich legte mir eine Reihe vernünftiger Gründe zurecht, die dafür sprachen.<br />
Es würde mich nach Jahren der Faulenzerei wieder auf die Beine bringen.<br />
Es wäre eine interessante und besinnliche Art, sich nach 20 Jahren im Ausland<br />
wieder <strong>mit</strong> der Größe und Schönheit meines Heimatlandes vertraut zu<br />
machen. Es würde mir von Nutzen sein – wenn ich auch noch nicht wußte<br />
wie –, einmal zu lernen, mich in der Wildnis zurechtzufinden und für mich<br />
selbst zu sorgen. Ich brauchte mir nicht mehr wie ein Schlappschwanz vorzukommen,<br />
wenn die Männer in Tarnhosen und <strong>mit</strong> Jägerhüten im Four
Aces Diner beisammen saßen und sich über ihre schaurigen Erlebnisse in<br />
der freien Natur unterhielten. Ich wollte ein bißchen von der Großspurigkeit<br />
abhaben, die sich einstellt, wenn man <strong>mit</strong> Granitaugen in die Ferne blickt<br />
und <strong>mit</strong> einem gedehnten, virilen Räuspern sagen kann: »Ja, ich kenne den<br />
Wald wie meine Westentasche.«<br />
Es gab noch einen anderen, unwiderstehlicheren Grund. Die Appalachen<br />
sind die Heimat des größten Laubwaldes der Erde - der ausgedehnte Restbestand<br />
des üppigsten und abwechslungsreichsten Waldgebietes, das je die<br />
gemäßigte Klimazone unseres Planeten zierte –, und dieser Wald ist gefährdet.<br />
Sollte sich die Erdatmosphäre im Laufe der nächsten 50 Jahre um vier<br />
Grad Celsius erwärmen, was durchaus wahrscheinlich ist, würde sich die<br />
gesamte Wildnis der Appalachen südlich von New England in eine Savanne<br />
verwandeln. Das Baumsterben hat bereits erschreckende Ausmaße angenommen.<br />
Ulmen und Kastanien sind dort längst verschwunden; der stattliche<br />
Schierling und der blütenreiche Hartriegel sind im Verschwinden begriffen;<br />
Rottanne, Frasertanne, Eberesche und Zuckerahorn sind als nächste<br />
dran. Wenn es jemals an der Zeit war, diese einzigartige Wildnis zu erleben,<br />
dann jetzt.<br />
Ich faßte also den Entschluß, es zu machen. Vorschnell teilte ich Freunden<br />
und Nachbarn meine Absicht <strong>mit</strong>, informierte selbstsicher meinen Verlag,<br />
sorgte für Verbreitung der Neuigkeit unter allen, die mich kannten. Sodann<br />
kaufte ich mir ein paar Bücher und redete <strong>mit</strong> Leuten, die den Trail ganz<br />
oder abschnittweise gegangen waren, und allmählich wurde mir klar, daß<br />
dieses Unternehmen alles, aber wirklich alles übertreffen würde, was ich<br />
jemals angepackt hatte.<br />
Fast jeder, <strong>mit</strong> dem ich mich darüber unterhielt, hatte eine Geschichte über<br />
irgendeinen arglosen Bekannten parat, der sich <strong>mit</strong> großen Hoffnungen und<br />
neuen Wanderschuhen auf den Weg gemacht hatte und zwei Tage später<br />
<strong>mit</strong> einem Rotluchs als Halskrause oder einem Hemdsärmel, aus dem nur<br />
noch ein bluttriefender Stumpf ragte, zurückgetorkelt kam und heiser flüsterte:<br />
»Bär!« bevor er in tiefe Bewußtlosigkeit versank.<br />
Die Wälder waren voller Gefahren – Klapperschlangen und Mokassinschlangen,<br />
Rotluchse, Bären, Kojoten, Wölfe und Wildschweine; gemütskranke<br />
Hinterwäldler, durch den großzügigen Konsum von Maisschnaps<br />
und sündigen Sexualpraktiken über Generationen aus der Bahn geworfen;<br />
tollwütige Stinktiere, Waschbären und sogar Eichhörnchen; unbarmherzige,<br />
rote Ameisen und wütende Kriebelmücken; gemeiner Giftsumach, kletternder<br />
Giftsumach, giftige Färbereiche und giftige Salamander; versprengte<br />
Elche, die von einem parasitären tödlichen Wurm befallen sind, der sich in<br />
ihrem Gehirn einnistet und sie dazu anstiftet, harmlose Wanderer über entlegene,<br />
sonnenbeschienene Wiesen zu jagen und sie in Gletscherseen zu
treiben.<br />
Unvorstellbare Dinge konnten einem da draußen widerfahren. Ich habe von<br />
einem Mann gehört, der nächtens zum Pinkeln aus seinem Zelt trat und von<br />
einer kurzsichtigen Eule am Kopf gestreift wurde – seinen Skalp sah er<br />
zuletzt von den Krallen des Vogels herab- baumeln, hübsch anzuschauen<br />
vor der Silhouette des Vollmonds; und von einer jungen Frau, die von einem<br />
Kitzeln am Bauch aufwachte, in ihren Schlafsack blickte und eine<br />
Mokassinschlange entdeckte, die es sich in der Wärme zwischen ihren Beinen<br />
gemütlich gemacht hatte. Ich habe vier verschiedene Versionen – stets<br />
<strong>mit</strong> einem unterdrückten Lachen vorgetragen – von ein und derselben Geschichte<br />
über das Zusammentreffen von Wanderern und Bären gehört, die<br />
sich für einen kurzen, aufreibenden Moment ein Zelt <strong>mit</strong>einander teilten;<br />
Geschichten von Leuten, die auf einem Gebirgskamm, von einem plötzlichen<br />
Sturm überrascht und von mannsdicken Blitzstrahlen getroffen, sich in<br />
Dampf auflösten (»es blieb nur noch ‘n Brandfleck von ihm übrig«); Geschichten<br />
von Zelten, die von stürzenden Bäumen zerschmettert, von strömendem<br />
Regen wie auf Kugellagern ganze Abhänge hinuntergerollt, gleitschirmartig<br />
in ferne Täler getragen oder von der Wasserwand einer Sturzflut<br />
weggespült wurden; von unzähligen Wanderern, deren letzter Gedanke im<br />
Angesicht der erzitternden Erde war: »Was um Himmels willen -?«<br />
Bereits die oberflächliche Lektüre von Abenteuerbüchern und ein Mindestmaß<br />
an Phantasie reichten aus, um sich Situationen auszumalen, in die ich<br />
unweigerlich geraten würde: umzingelt von Wölfen, die der Hunger treibt;<br />
in die Flucht geschlagen von bissigen Ameisen, taumelnd, mir die Kleider<br />
vom Leib reißend oder wie versteinert vom Anblick des zum Leben erwachten<br />
Unterholzes, das wie ein Unterwassertorpedo auf mich zukommt und<br />
sich als schrankgroßes Wildschwein <strong>mit</strong> kalten, glänzenden Augen entpuppt,<br />
das mich, begleitet von markigen Grunzlauten, <strong>mit</strong> unstillbarem<br />
Appetit auf rosiges, schwabbeliges, vom Stadtleben verweichlichtes Menschenfleisch<br />
lustvoll verzehrt.<br />
Dann wären da noch diverse Krankheiten zu nennen, für die der Mensch in<br />
der Wildnis anfällig ist – Giardiasis, östliche Pferdeenzephalitis, Rocky-<br />
Mountain-Fleckfieber, Lymekrankheit, Ehrlichiosis, Bilharziose, Bruzellose<br />
und die bazilläre Ruhr, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Die östliche<br />
Pferdeenzephalitis, durch einen Moskitostich hervorgerufen, greift Gehirn<br />
und Zentralnervensystem an. Man kann von Glück sagen, wenn man den<br />
Rest seines Lebens im Sessel sitzend verbringen darf, <strong>mit</strong> Lätzchen um den<br />
Hals – im allgemeinen ist die Krankheit tödlich. Ein Gegen<strong>mit</strong>tel ist nicht<br />
bekannt. Nicht weniger interessant ist die Lymekrankheit, die durch den Biß<br />
einer winzigen Rotwildzecke übertragen wird. Unentdeckt kann das Virus<br />
jahrelang im menschlichen Körper schlummern, bis es sich in einem wahren
Inferno Bahn bricht. Diese Krankheit ist etwas für Leute, die es wirklich<br />
wissen wollen. Zu den Symptomen zählen – ohne Garantie auf Vollständigkeit<br />
– Kopfschmerzen, Erschöpfungszustände, Fieberanfälle, Schüttelfrost,<br />
Kurzatmigkeit, Schwindelgefühl, stechende Gliederschmerzen, Herzrhythmusstörungen,<br />
Gesichtslähmung, Muskelzuckungen, schwere geistige<br />
Schäden, Verlust der Kontrolle über Körperfunktionen und - was niemanden<br />
überraschen wird – chronische Depression.<br />
Hinzu kommt die kaum bekannte Familie der Organismen, die man als<br />
Hantaviren bezeichnet. Sie tummeln sich <strong>mit</strong> Vorliebe in den Mikroschwaden,<br />
die sich über Mäuse- und Rattenkot bilden, und werden in die menschlichen<br />
Luftwege eingesogen, wenn der Betreffende versehentlich eine der<br />
Atemöffnungen in die Nähe hält – indem er sich beispielsweise auf ein<br />
Schlafpodest bettet, unter dem kürzlich ein paar Mäuse herumgetollt sind.<br />
1993 kamen durch eine einzige Hantavirusepidemie im Südwesten der Vereinigten<br />
Staaten 32 Menschen ums Leben, und im Jahr darauf forderte die<br />
Krankheit ihr erstes Opfer auf dem AT. Ein Wanderer hatte sie sich in einer<br />
»nagetierbefallenen Schutzhütte« zugezogen, wobei gesagt werden muß,<br />
daß alle Schutzhütten auf dem Appalachian Trail von Nagetieren befallen<br />
sind. Von den bekannten Viren garantieren nur noch die Tollwut, das Ebolavirus<br />
und das HIV einen sicheren Tod. Auch für das Hantavirus gibt es<br />
kein Gegen<strong>mit</strong>tel.<br />
Zu guter Letzt gibt es immer noch die Möglichkeit, ermordet zu werden –<br />
wir leben schließlich in Amerika. Seit 1974 sind mindestens neun Wanderer<br />
auf dem AT ermordet worden, wobei die tatsächliche Zahl schwankt, je<br />
nachdem, welche Quelle man konsultiert und was man unter dem Wort<br />
Wanderer versteht. Während ich den AT entlang wanderte, starben jedenfalls<br />
zwei Frauen.<br />
Aus diversen praktischen Gründen, die im wesentlichen <strong>mit</strong> den langen,<br />
zermürbenden Wintern im nördlichen New England zu tun haben, stehen<br />
jedes Jahr nur entsprechend wenige Monate zum Wandern zur Verfügung.<br />
Beginnt man die Wanderung im Norden, am Mount Katahdin in Maine,<br />
muß man bis Ende Mai, Anfang Juni abwarten, da<strong>mit</strong> aller Schnee geschmolzen<br />
ist. Beginnt man dagegen in Georgia und arbeitet sich Richtung<br />
Norden vor, gilt es, die Wanderung zeitlich so zu legen, daß man vor Mitte<br />
Oktober, wenn der erste Schneefall einsetzt, am Ziel angelangt ist. Die<br />
meisten wandern <strong>mit</strong> Beginn des Frühjahrs von Süden nach Norden und<br />
halten idealerweise immer einen Vorsprung von einigen Tagen vor der<br />
schlimmsten Hitze und den lästigen und Krankheiten übertragenden Insekten<br />
ein. Ich beabsichtigte, Anfang März im Süden aufzubrechen und rechnete<br />
sechs Wochen für die erste Etappe.<br />
Die Frage nach der exakten Länge des Appalachian Trail bleibt ein interes-
santes Rätsel. Der U.S. National Park Service, der sich immer wieder durch<br />
diverse Ungereimtheiten hervortut, bringt es fertig, die Länge des Weges in<br />
einem einzigen Prospekt mal <strong>mit</strong> 3.468 Kilometer, mal <strong>mit</strong> 3.540 Kilometer<br />
anzugeben. Die Appalachian Trail Guides, der offizielle Wanderführer, ein<br />
Schuber <strong>mit</strong> elf Büchlein, von denen jedes einen bestimmten Bundesstaat<br />
oder einen Abschnitt behandelt, spricht nach Belieben von 3.450, 3.455,<br />
3.474 und einmal von »über 3459 Kilometern«. Die Appalachian Trail<br />
Conference legte 1993 die Länge des Wanderwegs auf genau 3.454,6 Kilometer<br />
fest, ging dann für ein paar Jahre zu der vagen Angabe »mehr als<br />
3.460 Kilometer« über und kehrte erst kürzlich selbstbewußt zu der präzisen<br />
Angabe von 3.467,4 Kilometern zurück. Ebenfalls 1993 gingen drei Leute<br />
die gesamte Strecke <strong>mit</strong> einem Meßrad ab und kamen auf eine Distanz von<br />
3.483,97 Kilometern. Ungefähr zur gleichen Zeit ergab eine sorgfältige<br />
Überprüfung, die auf Karten der U.S. Geological Survey basierte, eine Gesamtlänge<br />
von 3.408,98 Kilometern.<br />
Eins ist sicher: es ist ein langer Wanderweg, und er ist, egal, an welchem<br />
Ende man startet, weiß Gott nicht leicht. Die Gipfel entlang des Appalachian<br />
Trail sind nicht gewaltig, im Vergleich zu den Alpen etwa – der höchste,<br />
Clingmans Dome in Tennessee, erreicht gerade mal 2.042 Meter –, aber sie<br />
wollen dennoch erklommen werden, und es bleibt nicht bei einem Berg.<br />
Mehr als 350 Gipfel am AT sind über 1.500 Meter hoch, und in der Umgebung<br />
befinden sich noch einmal tausend weitere. Insgesamt veranschlagt<br />
man etwa fünf Monate und fünf Millionen Schritte, um von einem Ende des<br />
Trails zum anderen zu kommen.<br />
Natürlich muß man alles, was man unterwegs braucht, auf dem Rücken<br />
<strong>mit</strong>schleppen. Für andere mag das selbstverständlich sein, aber für mich war<br />
es ein kleiner Schock, als mir klar wurde, daß eine Wanderung entlang des<br />
AT nicht im entferntesten <strong>mit</strong> einem gemächlichen Spaziergang in den<br />
englischen Cotswolds oder im Lake District zu vergleichen ist, zu dem man<br />
<strong>mit</strong> einer Provianttasche aufbricht, die ein Lunchpaket und eine Wanderkarte<br />
enthält, und von dem man am Ende des Tages in eine gemütliche<br />
Herberge zurückkehrt, zu einem heißen Bad, einem herzhaften Abendessen<br />
und einem weichen Bett. Auf dem AT schläft man draußen und kocht sich<br />
sein Essen selbst. Kaum einem gelingt es, das Gewicht des Rucksacks auf<br />
weniger als 18 Kilogramm zu reduzieren, und wenn man so viel <strong>mit</strong> sich<br />
herumschleppt, spürt man jedes einzelne Gramm, das kann ich Ihnen versichern.<br />
3.000 Kilometer zu wandern ist eine Sache, 3.000 Kilometer <strong>mit</strong><br />
einem Kleiderschrank auf dem Rücken sind etwas ganz anderes.<br />
Eine erste Ahnung davon, was für ein waghalsiges Unternehmen das werden<br />
würde, bekam ich in unserem Dartmouth Co-Op, als ich dort hinging,<br />
um mir eine Ausrüstung zu kaufen. Mein Sohn hatte gerade angefangen,
nach der Schule in dem Laden zu jobben, ich hatte also strengste Anweisung,<br />
mich gut zu benehmen. Vor allem sollte ich nichts Blödes sagen oder<br />
tun, nichts anprobieren, wozu ich meinen Bauch hätte entblößen müssen,<br />
nicht sagen: »Wollen Sie mich verarschen?«, wenn mir der Preis eines Artikels<br />
genannt würde, betont unaufmerksam tun, wenn mir ein Verkäufer die<br />
richtige Pflege oder Nachbehandlung eines Produktes erläuterte, und unter<br />
gar keinen Umständen irgend etwas Unpassendes anziehen, zum Beispiel<br />
eine Skimütze für Damen aufsetzen, nur so aus Spaß.<br />
Ich sollte nach einem gewissen Dave Mengle fragen, weil er große Abschnitte<br />
des Weges selbst gegangen war und so etwas wie ein wandelndes<br />
Lexikon in Sachen Outdoor-Bekleidung sein sollte. Mengle entpuppte sich<br />
als ein freundlicher, rücksichtsvoller Mensch, der schätzungsweise vier<br />
Tage lang ununterbrochen und <strong>mit</strong> großem Interesse über jeden Aspekt<br />
einer Wanderausrüstung dozieren konnte.<br />
Ich war noch nie so beeindruckt und gleichzeitig so verwirrt worden. Wir<br />
gingen einen ganzen Vor<strong>mit</strong>tag lang sein Lager durch, und Dave konnte<br />
dabei Sätze loslassen wie etwa folgenden: »Der hier hat einen 70 Denier,<br />
verschleißresistenten Reißverschluß <strong>mit</strong> hoher Dichte und Doppelzwirnnaht.<br />
Andererseits, und in dem Punkt will ich ehrlich zu Ihnen sein« – wobei<br />
er sich zu mir hinüberbeugte, seine Stimme senkte und einen freimütigeren<br />
Ton anschlug, als wollte er mir eröffnen, besagter Reißverschluß sei<br />
einmal zusammen <strong>mit</strong> einem Matrosen auf einer öffentlichen Bedürfnisanstalt<br />
verhaftet worden –, »die Nähte sind bandisoliert statt diagonal versetzt,<br />
und das Vestibül ist ein bißchen eng.«<br />
Da ich beiläufig erwähnt hatte, daß ich in England ein bißchen gewandert<br />
sei, unterstellte er mir eine gewisse Kompetenz. Ich wollte ihn nicht beunruhigen<br />
oder enttäuschen, so daß ich, als er mich fragte, »Was halten Sie<br />
eigentlich von Kohlenstoffasern?« nur <strong>mit</strong> einem <strong>mit</strong>leidigen Lächeln den<br />
Kopf schüttelte, angesichts dieses heiklen Dauerthemas, und antwortete:<br />
»Wissen Sie, Dave, ich bin in dem Punkt immer noch zu keinem abschließenden<br />
Ergebnis gekommen. Was meinen Sie?«<br />
Gemeinsam diskutierten wir über Kompressionsriemen, erwogen ernsthaft<br />
die relativen Vorteile von Schneeschürzen, Klettverschlüssen, Lastentransferausgleich,<br />
Belüftungskanälen, Gewebeschlaufen und Kopfmulden für<br />
größere Bewegungsfreiheit. Das wurde bei jedem Artikel durchexerziert.<br />
Selbst bei einem Kochgeschirr aus Aluminium ließen sich Überlegungen<br />
hinsichtlich Gewicht, Kompaktheit, Thermodynamik und allgemeiner Nützlichkeit<br />
anstellen, die den Verstand stundenlang beschäftigen konnten. Zwischendurch<br />
bot sich immer wieder Gelegenheit, über das Wandern ganz<br />
allgemein zu plaudern, was sich jedoch auf die Risiken beschränkte, als da<br />
wären Steinschlag, Begegnungen <strong>mit</strong> Bären, Kocherexplosionen und
Schlangenbisse, die Dave <strong>mit</strong> einem verschleierten Blick hingebungsvoll<br />
beschrieb, bevor er sich wieder dem eigentlichen Thema widmete.<br />
Wie gesagt, er redete viel, besonders viel über Gewicht. Mir erschien es<br />
eine Idee zu pingelig, einen bestimmten Schlafsack einem anderen vorzuziehen,<br />
weil dieser ein paar Gramm leichter war, aber immer mehr Ausrüstungsgegenstände<br />
türmten sich um uns herum auf, und immer deutlicher<br />
wurde mir vorgeführt, wie aus vielen Gramm ganz allmählich ein Kilo wird.<br />
Ich hatte nicht da<strong>mit</strong> gerechnet, so viel zu kaufen – ich besaß bereits Wanderschuhe,<br />
ein Schweizer Offiziersmesser und eine Kartentasche aus Plastik,<br />
die man an einer Kordel um den Hals trug; ich dachte, ich sei eigentlich<br />
bestens ausgestattet – aber je länger ich <strong>mit</strong> Dave redete, desto klarer wurde<br />
mir, daß ich dabei war, mich für eine Expedition auszurüsten.<br />
Was mich dann wirklich schockierte, war zum einen, wie teuer alles war –<br />
jedesmal, wenn Dave ins Lager sprang oder loszog, um das Gewicht des<br />
Gewebes in der Maßeinheit Denier zu überprüfen, warf ich einen verstohlenen<br />
Blick auf die Preisschildchen und war ausnahmslos entsetzt – und zum<br />
anderen, daß jeder Ausrüstungsgegenstand unweigerlich den Erwerb eines<br />
weiteren erforderlich machte. Wenn man einen Schlafsack kaufte, brauchte<br />
man einen Packbeutel für den Schlafsack. Der Packbeutel kostete 29 Dollar.<br />
Für diese Nötigung hatte ich zunehmend weniger Verständnis.<br />
Als ich mich schließlich nach reiflicher Überlegung für einen Rucksack<br />
entschieden hatte – einen sehr hochwertigen Gregory, vom Allerfeinsten,<br />
nach dem Motto: es bringt nichts, hier zu knausern –, fragte Dave: »Was für<br />
Gurte wollen Sie dazu haben?«<br />
»Wie bitte?« erwiderte ich und merkte auf der Stelle, daß ich mich am Rand<br />
einer gefährlichen Krise befand, auch als Konsumverweigerung bekannt.<br />
Ab jetzt konnte ich nicht mehr unbekümmert von mir geben: »Packen Sie<br />
nur ruhig gleich sechs Stück davon ein, Dave. Und wenn ich schon mal<br />
dabei bin – von den anderen Dingern nehme ich acht Stück. Ach, was soll’s,<br />
warum nicht gleich zwölf? Man gönnt sich ja sonst nichts.« Der Haufen<br />
Klamotten, der mir eben noch verschwenderisch vorgekommen war und<br />
mich irgendwie ganz aufgeregt gemacht hatte - alles neu! alles meins! –,<br />
erschien mir plötzlich erdrückend und übertrieben.<br />
»Gurte«, erklärte Dave. »Um Ihren Schlafsack draufzuschnallen und Sachen<br />
festzubinden.«<br />
»Gehören die Gurte nicht dazu?« sagte ich leicht gereizt.<br />
»Nein.« Er ließ seinen Blick über eine Wand, vollbehängt <strong>mit</strong> Kleinkram,<br />
schweifen. »Jetzt brauchen Sie natürlich auch noch einen Regenschutz.«<br />
Ich sah ihn verständnislos an. »Einen Regenschutz? Wozu das denn?«<br />
»Gegen den Regen.«<br />
»Ist der Rucksack denn nicht wasserdicht?«
Er verzog das Gesicht, als müßte er einen höchst schwierigen Sachverhalt<br />
klären. »Na ja, nicht hundertprozentig…«<br />
Das fand ich höchst seltsam. »Wirklich? Ist dem Hersteller nie in den Sinn<br />
gekommen, daß die Kunden ihre Rucksäcke gelegentlich auch mal <strong>mit</strong> nach<br />
draußen nehmen wollen? Vielleicht sogar über Nacht draußen zelten wollen?<br />
Wieviel kostet der Rucksack eigentlich?«<br />
»250 Dollar.«<br />
»250 Dollar? Wollen Sie mich verarsch…«<br />
Ich unterbrach mich und schlug einen anderen Ton an. »Soll das heißen,<br />
man zahlt 250 Dollar für einen Rucksack, der keine Gurte hat und nicht<br />
wasserdicht ist?«<br />
Dave nickte.<br />
»Hat er wenigstens einen Boden?«<br />
Mengle grinste verlegen. Kritik an der unerschöpflichen, vielversprechenden<br />
Welt der Wanderausrüstung oder gar Überdruß gehörte nicht zu seinem<br />
Wesen. »Die Gurte gibt es in sechs verschiedenen Farben«, bot er mir zur<br />
Versöhnung an.<br />
Zum Schluß hatte ich so viel Ausrüstung beisammen, daß ich einen ganzen<br />
Treck Sherpas hätte beschäftigen können: Zelt für einen Drei-Jahreszeiten-<br />
Einsatz; Isoliermatte, die sich selbst aufbläst; Kombitöpfe und -pfannen;<br />
Klappbesteck; Plastikteller und -tasse; Wasserfilter <strong>mit</strong> einem komplizierten<br />
Pumpsystem; Packbeutel in allen Regenbogenfarben; Nahtdichter; Klebeflicken;<br />
Schlafsack; Spanngurte; Wasserflaschen; wasserdichter Poncho; wasserfeste<br />
Sturm-Zündhölzer; Regenschutz; ein niedlicher Schlüsselanhänger<br />
<strong>mit</strong> eingebautem Minikompaß und Thermometer; ein kleiner, zusammenklappbarer<br />
Kocher, der eindeutig Ärger zu machen versprach; Gaskartusche<br />
und Ersatzkartusche; eine Taschenlampe, die man sich wie eine Grubenlampe<br />
auf die Stirn setzt, so daß die Hände frei sind (die gefiel mir sehr<br />
gut); ein großes Messer, um Bären und andere Hinterwäldler abzumurksen;<br />
Thermo-Unterwäsche; lange Unterhosen und Unterhemden; vier große<br />
Tücher, auch als Stirnbänder zu benutzen; und jede Menge anderer Sachen,<br />
für die ich extra nochmal in den Laden zurückgehen mußte, um zu fragen,<br />
wozu sie eigentlich gut waren. Bei einem Designer-Zeltboden für 59,95<br />
Dollar -war bei mir Schluß, weil ich wußte, daß es im Supermarkt Zeltplanen<br />
für fünf Dollar gab. Ein Erste-Hilfe-Set, ein Nähset, ein Schlangenbiß-<br />
Set, eine Trillerpfeife für zwölf Dollar und einen kleinen orangefarbenen<br />
Spaten, um seine Hinterlassenschaft zu verbuddeln, ließ ich ebenfalls links<br />
liegen <strong>mit</strong> der Begründung, daß diese Dinge nicht nötig und zu teuer seien<br />
oder man sich da<strong>mit</strong> der Lächerlichkeit preisgeben würde. Besonders der<br />
kleine orangefarbene Spaten schien mir zuzurufen: »Grünschnabel!<br />
Schlappschwanz! Ist sich zu fein für die eigene Scheiße!«
Um gleich alles in einem Aufwasch zu erledigen, ging ich noch nach nebenan<br />
in den Buchladen von Dartmouth und kaufte Bücher – The Thru-<br />
Hiker’s Handbook, Walking the Appalachian Trail, diverse Bücher über<br />
wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen, naturwissenschaftliche<br />
Werke, einen historischen Abriß über die geologische Entwicklung des<br />
Appalachian Trail von einem Autor <strong>mit</strong> dem köstlichen Namen V. Collins<br />
Chew, und die bereits erwähnte, vollständige Sammlung der offiziellen<br />
Appalachian Trail Guides, die elf Taschenbücher und 59 Karten umfaßt,<br />
letztere allesamt von unterschiedlicher Größe und Aufmachung und <strong>mit</strong><br />
verschiedenen Maßstäben. Diese Anthologie stellt den gesamten Weg vom<br />
Springer Mountain bis zum Mount Katahdin dar und ist zu dem stolzen<br />
Preis von 233,45 Dollar zu haben. Beim Hinausgehen fiel mir ein Buch auf,<br />
Bären: Jäger und Gejagte in Amerikas Wildnis. Ich schlug es wahllos auf,<br />
las den Satz: »Hier haben wir ein typisches Beispiel für den nicht selten<br />
auftretenden Fall, daß ein Schwarzbär einen Menschen erblickt und beschließt,<br />
ihn zu töten und zu fressen«, und warf es gleich <strong>mit</strong> in die Einkaufstüte.<br />
Ich brachte den Krempel nach Hause und trug ihn in mehreren Etappen<br />
runter in den Keller. Es war ungeheuer viel, und <strong>mit</strong> der ganzen Technik der<br />
Ausrüstung war ich absolut nicht vertraut; es war spannend und gleichzeitig<br />
beängstigend, hauptsächlich beängstigend. Ich setzte die Stirnlampe auf, nur<br />
so zum Spaß, zog das Zelt aus der Plastikhülle und baute es auf. Ich rollte<br />
die Isomatte aus, die sich selbst aufblies, schob sie ins Zelt und kroch dann<br />
selbst <strong>mit</strong> meinem neuen Schlafsack hinein. Dann schlüpfte ich in den<br />
Schlafsack und blieb eine ganze Weile so liegen. Dabei versuchte ich, mich<br />
in der teuren, arg begrenzten, noch seltsam neu riechenden, gänzlich ungewohnten<br />
Räumlichkeit, die schon bald mein Zuhause fern von zu Hause<br />
sein würde, zurechtzufinden. Ich versuchte mir vorzustellen, ich läge nicht<br />
in einem Keller, neben dem gemütlichen Heizungskessel <strong>mit</strong> seinem gezähmten<br />
Gebrumm, sondern draußen, auf einem hohen Gebirgspaß, lauschte<br />
dem Wind und dem Blätterrauschen, dem einsamen Heulen hundeähnhcher<br />
Geschöpfe, dem heiseren Flüstern, aus dem unüberhörbar der Dialekt<br />
aus den Bergen von Georgia herausklang: »He, Virgil, hier liegt einer. Hast<br />
du an das Seil gedacht?« Es wollte mir nicht gelingen.<br />
Seit ich im Alter von ungefähr neun Jahren aufgehört hatte, aus<br />
Decken und Spieltischen Hütten zu bauen, hatte ich mich nicht mehr in so<br />
einer Umgebung aufgehalten. Es war sogar ziemlich urig, und wenn man<br />
sich erstmal an den Geruch, von dem ich naiverweise annahm, er würde<br />
sich im Laufe der Zeit verflüchtigen, und an die kränklich blaßgrüne Färbung<br />
gewöhnt hatte, die das Material allen Dingen um einen herum wie der<br />
Schein eines leuchtenden Radarschirms verlieh, war es gar nicht so furcht-
ar. Vielleicht ein bißchen klaustrophobisch, komisch riechend, aber dennoch<br />
gemütlich und urig.<br />
Es würde schon nicht so schlimm werden, redete ich mir ein. Aber insgeheim<br />
wußte ich, daß ich mich gründlich irrte.
2. Kapitel<br />
Am 5. Juli 1983 schlugen drei erwachsene Aufseher und eine Gruppe Jugendlicher<br />
an einer bei Wanderern beliebten Stelle am Lake Canimma <strong>mit</strong>ten<br />
in einem würzig riechenden Kiefernwald westlich von Quebec, ungefähr<br />
130 Kilometer nördlich von Ottawa, in einem Park, der sich La Verendrye<br />
Provincial Reserve nennt, nach<strong>mit</strong>tags ihr Lager auf. Sie kochten sich ein<br />
Abendessen und verstauten anschließend ihre Lebens<strong>mit</strong>telvorräte, wie es<br />
sich gehört, in einen Beutel, trugen diesen etwa 100 Meter weit in den Wald<br />
hinein und hängten ihn zwischen zwei Bäumen auf, in einer Höhe, die für<br />
Bären nicht zu erreichen war.<br />
Um Mitternacht strich ein Schwarzbär am Rand des Lagers herum, entdeckte<br />
den Beutel und holte ihn herunter, indem er auf den Baum kletterte und<br />
einen Ast abknickte. Er plünderte den Vorrat und verschwand, kehrte aber<br />
eine Stunde später wieder zurück und betrat diesmal das Lager, angezogen<br />
von dem Geruch gebratenen Fleischs, der noch in den Kleidern und Haaren,<br />
den Schlafsäcken und Zelten der Leute hing. Es sollte eine lange Nacht für<br />
die Gruppe am Lake Canimma werden. Zwischen Mitternacht und halb vier<br />
stattete der Bär dem Lager dreimal einen Besuch ab.<br />
Stellen Sie sich, falls Sie Masochist sind, vor, Sie liegen mutterseelenallein<br />
im Dunkeln in einem kleinen Zelt, zwischen Ihnen und der kalten Nachtluft<br />
nur eine Nylonmembran von ein paar tausendstel Millimeter Dicke, und<br />
draußen rumort dieser zentnerschwere Koloß. Stellen Sie sich vor, Sie hören<br />
sein leises Grunzen und unerklärliches Schniefen, das Schmatzen und Nagen,<br />
das Tapsen der Ballen unter den Tatzen, den schweren Atem, das Geräusch,<br />
wenn er sich an Ihrer Zeltwand reibt, das Klappern von gestapeltem<br />
Kochgeschirr, wenn er dagegentritt. Stellen Sie sich vor, was für ein heißer<br />
Adrenalinschub durch Ihren Körper geht, wie es in Ihren Achselhöhlen<br />
kribbelt – dann der plötzliche, rauhe Stoß der Schnauze des Tieres gegen<br />
die Wand am Fußende Ihres Zeltes, das alarmierend wilde Flattern Ihrer<br />
dünnhäutigen Hülle, wenn das Tier Ihren Rucksack durchwühlt, den Sie unachtsamerweise<br />
am Eingang aufgebockt haben und in dessen Seitentasche<br />
sich, wie Ihnen siedendheiß einfällt, ein Snickers befindet. Bären sind geradezu<br />
versessen auf Snickers, haben Sie mal gehört.<br />
Und dann das dumpfe Gefühl – ach, du meine Güte –, daß Sie den Snickers-<br />
Riegel <strong>mit</strong> ms Zelt genommen haben, daß er hier irgendwo liegt, zu ihren<br />
Füßen oder unter Ihnen, oder – ach, du Scheiße, hier ist er ja! Der nächste<br />
Stoß der Schnauze, begleitet von einem Grunzen, gegen das Zelt, diesmal<br />
unweit Ihrer Schulter. Wieder das Flattern der Zeltwand. Dann Stille, eine<br />
lang anhaltende Stille, und – Moment, psssst!… jawohl! – die unsägliche<br />
Erleichterung, als Ihnen klar wird, daß der Bär hinüber auf die andere Seite
des Lagers geschlurft ist oder sich zurück in den Wald verzogen hat.<br />
Ich sage Ihnen, ich würde das nicht aushaken.<br />
Nun stellen Sie sich vor, wie erst dem kleinen zwölfjährigen David Anderson<br />
zumute gewesen sein mußte, als um halb vier morgens, bei dem dritten<br />
Übergriff, sein Zelt urplötzlich <strong>mit</strong> einem Tatzenhieb aufgeschlitzt wurde<br />
und der Bär, von dem starken, in der Luft liegenden Geruch nach Hamburgern<br />
zur Raserei getrieben, seine Zähne in ein hastig zurückzuckendes Bein<br />
schlug und den brüllenden, strampelnden Knaben durch das Lager schleppte,<br />
hinein in den Wald. In den wenigen Sekunden, die seine Kameraden<br />
brauchten, um sich aus ihren Sachen zu schälen. Und stellen Sie sich weiter<br />
vor, was es heißt, sich aus plötzlich voluminösen Schlafsäcken herauszuwühlen,<br />
nach den Taschenlampen zu kramen, sich einen provisorischen<br />
Knüppel zu schnappen, die Zeltverschlüsse hochzuziehen und hinter dem<br />
Tier herzujagen – in diesen wenigen Sekunden hauchte der arme kleine<br />
David Anderson sein Leben aus.<br />
Und nun stellen Sie sich vor, Sie läsen ein Sachbuch, in dem es nur so<br />
wimmelt von solchen Geschichten – wahren Geschichten, nüchtern erzählt<br />
–, kurz bevor Sie allein zu einer Wanderung durch die nordamerikanische<br />
Wildnis aufbrächen. Das Buch, von dem hier die Rede ist, heißt Bären:<br />
Jäger und Gejagte in Amerikas Wildnis, und der Verfasser ist der kanadische<br />
Wissenschaftler Stephen Herrero. Wenn das Buch nicht das letzte<br />
Wort in dieser Angelegenheit ist, dann möchte ich das letzte Wort lieber<br />
nicht erfahren. Während sich draußen in New Hampshire der Schnee auftürmte<br />
und meine Frau friedlich neben mir im Bett schlummerte, verbrachte<br />
ich ganze Nächte da<strong>mit</strong>, <strong>mit</strong> angstvoll aufgerissenen Augen klinisch exakte<br />
Berichte über Menschen zu lesen, die in ihren Schlafsäcken zu Brei zermalmt,<br />
die wimmernd von Bäumen heruntergeholt worden waren, an die die<br />
Bestie sich geräuschlos herangepirscht hatte – ich wußte nicht, daß so etwas<br />
vorkam –, als sie gerade unbedarft durchs Laub schlenderten oder ihre Füße<br />
in einem kalten Gebirgsbach baumeln ließen. Über Menschen, die den verhängnisvollen<br />
Fehler begangen hatten, sich wohlriechendes Gel ins Haar zu<br />
schmieren, ein saftiges Stück Fleisch zu essen, sich für später einen Snikkers-Riegel<br />
in die Brusttasche zu stecken, sich sexuell zu betätigen, zu menstruieren<br />
oder die Geruchsempfindlichkeit des hungrigen Bäreninsonstwie<br />
unachtsamer Weise zu reizen. Oder deren Verhängnis, auch das gab es,<br />
schlicht darin bestand, außerordentlich großes Pech zu haben – um eine<br />
Kurve zu gehen und auf ein hungriges Bärenmännchen zu treffen, das den<br />
Weg versperrt, den Kopf erwartungsvoll hin und her wiegt, oder darin,<br />
nichts Böses ahnend in das Revier eines Bären zu tapern, der, bedingt durch<br />
Alter und Trägheit, zu alt war, um flinkere Beute zu jagen.<br />
Ich will gleich klarstellen, daß die Wahrscheinlichkeit eines schweren
Übergriffs durch einen Bären am Appalachian Trail äußerst gering ist. Zunächst<br />
einmal wütet der wirklich gefährliche amerikanische Bär, der Grizzly<br />
– Ursus horribilis, wie er anschaulich und korrekterweise bezeichnet wird –<br />
, nicht östlich des Mississippi, was immerhin von Vorteil ist, denn Grizzlys<br />
sind riesig, stark und geraten schnell in Wut. Als Meriwether Lewis und<br />
William Clark zu Beginn des letzten Jahrhunderts zu ihrer Expedition in die<br />
Wildnis aufbrachen, stellten sie fest, daß nichts die eingeborenen Indianer<br />
mehr zermürbte als ein Grizzlybär. Und das ist nicht weiter erstaunlich,<br />
denn man kann einen Grizzly <strong>mit</strong> Pfeilen durchlöchern, ihn buchstäblich<br />
da<strong>mit</strong> spicken, so daß er aussieht wie ein Stachelschwein – er wird immer<br />
noch nicht aufgeben. Selbst Lewis und Clark zeigten sich erstaunt und verunsichert<br />
über die Fähigkeit des Grizzlys, ganze Geschützsalven zu verkraften,<br />
ohne auch nur leicht ms Wanken zu geraten.<br />
Herrero berichtet von einem Fall, der die Robustheit des Grizzlys sehr<br />
schön veranschaulicht. Die Geschichte handelt von einem erfahrenen Jäger<br />
in Alaska, Alexei Pitka, der sich durch den Schnee an ein großes Männchen<br />
herangeschlichen und es <strong>mit</strong> einem gezielten Schuß ms Herz aus einem<br />
großkalibrigen Gewehr niedergestreckt hatte. Pitka hätte vorher noch einmal<br />
in den Verhaltensregeln nachlesen sollen. »Erst überprüfen, ob der Bär<br />
auch wirklich tot ist. Dann Waffe ablegen.« Er näherte sich behutsam und<br />
beobachtete ein, zwei Minuten lang, ob der Bär sich nicht rührte. Als er<br />
keine Regung feststellen konnte, lehnte er sein Gewehr gegen einen Baum<br />
(schwerer Fehler!) und trat vor, um seine Beute zu beanspruchen. Gerade<br />
wollte er das Fell berühren, da sprang der Bär auf, legte ihm seine breiten<br />
Tatzen um den Kopf, als wollte er ihm einen Kuß geben, und riß ihm <strong>mit</strong><br />
einem Ruck das Gesicht weg.<br />
Pitka überlebte wie durch ein Wunder. »Ich weiß auch nicht, wieso ich das<br />
Scheißgewehr an den Baum gestellt habe«, sagte er später. (Eigentlich war<br />
nur »Mnnnpfffnnnndgnnn« zu verstehen, da Pitka weder über Lippen, Zähne,<br />
Nase, Zunge noch über ein anderes Stimmorgan mehr verfügte.)<br />
Sollte ich betätschelt und angeknabbert werden – was mir immer wahrscheinlicher<br />
erschien, je mehr ich las –, dann von einem Schwarzbären,<br />
Ursus americanus. Es gibt ungefähr eine halbe Million Schwarzbären in<br />
Amerika, vielleicht sogar eine dreiviertel Million. Sie sind sehr verbreitet in<br />
den Bergen entlang des Appalachian Trail, ja sie benutzen den Weg sogar<br />
gern, weil er so bequem ist, und ihre Zahl ist im Steigen begriffen. Die Zahl<br />
der Grizzlybären dagegen beläuft sich, bezogen auf ganz Nordamerika, auf<br />
höchstens 35.000; davon entfallen gerade einmal 1.000 auf das Herzland der<br />
Vereinigten Staaten, hauptsächlich auf den Yellowstone National Park und<br />
Umgebung. Schwarzbären sind in der Regel kleiner (das ist allerdings relativ<br />
zu sehen, denn ein Schwarzbärmännchen kann immer noch 300 Kilo auf
die Waage bringen), und sie sind eindeutig zurückhaltender.<br />
Schwarzbären greifen selten von sich aus an, aber manchmal eben doch.<br />
Alle Bären sind behende, schlau und unglaublich stark, und sie haben immer<br />
Hunger. Sie können einen Menschen töten und fressen, wenn sie wollen,<br />
und sie tun es auch – wenn sie wollen. Es kommt nicht oft vor, aber –<br />
und das ist der springende Punkt: einmal reicht. Herrero gibt sich alle Mühe,<br />
darauf hinzuweisen, daß Schwarzbärattacken zahlenmäßig selten sind. Für<br />
den Zeitraum von 1900 bis 1980 konstatierte er lediglich 23 Tötungen von<br />
Menschen durch einen Schwarzbären (das sind halb so viele Tötungen wie<br />
durch Grizzlybären), und die meisten ereigneten sich im Westen oder in<br />
Kanada. In New Hampshire hat jedenfalls seit 1784 kein unprovozierter<br />
tödlicher Übergriff eines Bären auf einen Menschen mehr stattgefunden,<br />
und in Vermont sogar noch nie.<br />
Ich hätte mich von diesen quasi Versprechungen ja gerne trösten lassen,<br />
aber mir fehlte es an der nötigen Glaubenskraft. Der Aussage, daß zwischen<br />
1960 und 1980 500 Menschen von Schwarzbären angegriffen und verletzt<br />
wurden – 25 Übergriffe pro Jahr, bei einer Population von mindestens einer<br />
halben Million Bären –, fügt Herrero hinzu, die meisten Verletzungen seien<br />
nicht schwer gewesen. »Die typischen, von einem Bären zugefügten Verletzungen«,<br />
schreibt er kühl, »sind nur geringfügiger Natur und beschränken<br />
sich für gewöhnlich auf ein paar Kratzer oder leichte Bißwunden.« Was,<br />
bitteschön, ist eine leichte Bißwunde? Geht es hier um spielerische Ringkämpfe<br />
und Nasenstüber? Wohl kaum. Und sind 500 nach- gewiesene Übergriffe<br />
tatsächlich eine so bescheidene Zahl, wenn man bedenkt, daß nur<br />
wenige Menschen die Wälder Nordamerikas je betreten? Und wie blöd muß<br />
man sein, da<strong>mit</strong> einen die Information, in Vermont und New Hampshire sei<br />
seit 200 Jahren kein Mensch mehr von einem Bären getötet worden, beruhigen<br />
kann? Die Angriffe blieben ja nicht aus, weil die Bären ein Abkommen<br />
<strong>mit</strong> den Menschen ausgehandelt hatten. Es spricht nichts dagegen, daß sie<br />
nicht schon morgen ein kleines Massaker anrichten.<br />
Stellen wir uns also vor, ein Bär in der Wildnis hätte es auf uns abgesehen.<br />
Wie soll man sich verhalten?<br />
Interessanterweise sind die empfohlenen Tricks bei Grizzly –<br />
beziehungsweise Schwarzbärattacken genau gegensätzlich. Bei dem Überfall<br />
eines Grizzlybären sollte man den nächsten hohen Baum aufsuchen, da<br />
Grizzlys keine guten Kletterer sind. Wenn kein Baum in Reichweite ist,<br />
sollte man langsam rückwärts gehen und dabei den Blickkontakt vermeiden.<br />
Alle Bücher raten einem, auf keinen Fall zu rennen, wenn der Grizzly auf<br />
einen zukommt. Solche Ratschläge können nur von Schreibtischtätern<br />
kommen. Lassen Sie sich gesagt sein: Wenn Sie sich in einem offenen Gelände<br />
befinden und keine Waffe dabei haben, dann nehmen Sie besser die
Beine in die Hand. Was bleibt Ihnen schon anderes übrig? So haben Sie in<br />
den letzten sieben Sekunden Ihres Lebens wenigstens etwas zu tun. Sollte<br />
der Grizzly Sie jedoch einholen, was <strong>mit</strong> an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit<br />
der Fall sein wird, lassen Sie sich auf den Boden fallen und<br />
stellen Sie sich tot. An einem schlaffen Körper knabbert der Grizzly nur ein<br />
bißchen herum, im allgemeinen verliert er nach wenigen Minuten die Lust<br />
und schlurft davon. Bei Schwarzbären dagegen ist der Trick, sich tot zu<br />
stellen, vergeblich, denn sie knabbern weiter an einem herum, bis auch der<br />
beste plastische Chirurg später nichts mehr ausrichten kann. Auf einen<br />
Baum zu klettern wäre ebenfalls ziemlich töricht, denn Schwarzbären sind<br />
geschickte Kletterer, und man würde den Kampf gegen den Bären lediglich<br />
auf den Baum verlagern, wie Herrero trocken feststellt.<br />
Am besten, schlägt Herrero vor, sollte man einen Höllenlärm veranstalten,<br />
um einen aggressiven schwarzen Bären zu vertreiben, auf Töpfe und Pfannen<br />
schlagen, <strong>mit</strong> Stöcken und Steinen werfen und »auf den Bär zulaufen«.<br />
(Bitte. Wenn Sie als erster gehen, Herr Professor!) Andererseits, fügt er<br />
vernünftigerweise hinzu, könnten diese Tricks »den Bären erst recht provozieren«,<br />
Vielen Dank auch. An anderer Stelle empfiehlt Herrero, als Wanderer<br />
solle man daran denken, gelegentlich Krach zu machen, zum Beispiel<br />
ein Lied zu singen, um einen Bären vor seiner Anwesenheit zu warnen, da<br />
ein überraschter Bär höchstwahrscheinlich wütender sein wird. Doch dann<br />
mahnt er ein paar Seiten weiter, daß »es gefährlich sein könnte, Krach zu<br />
machen«, da er einen hungrigen Bären anlocken könnte, der einen sonst<br />
übersehen hätte.<br />
Tatsache ist: Keiner kann einem sagen, was man machen soll. Bei Bären<br />
weiß man vorher nie, wie sie reagieren, und was bei dem einen klappt, ist<br />
bei dem anderen vielleicht verhängnisvoll. Im Jahre 1973 hatten sich zwei<br />
Teenager, Mark Seeley und Michael Whitten, zu einer Wanderung durch<br />
den Yellowstone National Park aufgemacht und gerieten unterwegs unabsichtlich<br />
zwischen eine Schwarzbärmutter und ihre Jungen. Nichts bringt<br />
eine Bärenmutter mehr in Rage als Menschen, die sich in der Nähe ihrer<br />
Brut aufhalten. Wütend drehte sie sich um und eröffnete die Jagd – trotz des<br />
etwas tapsigen Gangs können Bären bis zu 60 Stundenkilometer schnell<br />
laufen – und die beiden Jungen erkletterten den nächsten Baum. Der Bär<br />
sprang Whitten hinterher, faßte <strong>mit</strong> dem Maul seinen rechten Fuß und zog<br />
ihn langsam und geduldig von seinem Hochsitz herunter. (Spüren Sie da<br />
auch, wie sich Ihre Fingernägel in der Rinde verkrallen, oder geht das nur<br />
mir so?) Auf der Erde fing der Bär an, den Jungen übel zuzurichten. Seeley<br />
versuchte, das Tier von seinem Freund wegzulocken und brüllte es an, worauf<br />
es losließ und auch ihn von seinem Baum herunterholte. Beide Jungen<br />
stellten sich daraufhin tot – nach den Verhaltensmaßregeln genau das Ver-
kehrte –, und der Bär verschwand.<br />
Ich möchte nicht behaupten, daß ich wie besessen von dem Thema war,<br />
aber es beschäftigte meine Gedanken während der Monate, in denen ich<br />
darauf wartete, daß endlich der Frühling käme. Mein besonderer Schrecken<br />
– die lebhafte Phantasie, die mich Nacht für Nacht die Baumschatten an der<br />
Schlafzimmerdecke anstarren ließ – war die Vorstellung, ich läge in einem<br />
kleinen Zelt, allein in der pechschwarzen Wildnis, hörte draußen einen Bär,<br />
der auf Futtersuche wäre, und hätte keine Ahnung, was er nun vorhatte. Vor<br />
allem ein Amateurfoto in Herreros Buch faszinierte mich. Es war spät<br />
nachts von einem Camper auf einem Lagerplatz irgendwo im Westen der<br />
USA <strong>mit</strong> Blitzlicht aufgenommen worden. Der Fotograf hatte vier<br />
Schwarzbären erwischt, die sich darüber den Kopf zerbrachen, wie sie an<br />
einen Vorratsbeutel kommen sollten, der von einem Ast herunterhing. Die<br />
Bären wirkten zwar überrascht – von dem Blitzlicht vermutlich –, aber sie<br />
waren nicht im geringsten erschrocken. Es war weniger die Größe oder das<br />
Verhalten der Bären, was mich beunruhigte – sie sehen komischerweise<br />
völlig harmlos aus, wie vier junge Männer, deren Frisbeescheibe im Baum<br />
gelandet war – als ihre Zahl. Bis dahin hatte ich mir nicht klargemacht, daß<br />
Bären auch in Rudeln herumstrolchen konnten. Was um Himmels willen<br />
sollte ich machen, wenn plötzlich vier von diesen Ungeheuern in mein Lager<br />
kämen? Na, was schon? Ich würde natürlich sterben. Buchstäblich tausend<br />
Tode sterben, mir in die Hose machen vor Angst, mir den Schließmuskel<br />
aus dem Hintern pusten, so wie die Luftschlangen, die man auf Kindergeburtstagen<br />
bekommt – ich glaube, es würde das Tier nicht im geringsten<br />
beeindrucken – und in meinem Schlafsack jämmerlich verbluten.<br />
Herreros Buch erschien 1985. Seit damals haben, nach einem Artikel in der<br />
New York Times, die Übergriffe durch Bären in Nordamerika um 25 Prozent<br />
zugenommen. In dem Artikel hieß es außerdem, Bären gingen im Frühjahr<br />
nach einer schlechten Beerenernte wesentlich häufiger auf Menschen los als<br />
sonst. Die Beerenernte im Vorjahr war katastrophal ausgefallen. Das gefiel<br />
mir alles nicht.<br />
Dann gab es noch die ganzen Probleme und speziellen Gefahren, die durch<br />
die Einsamkeit bedingt sind. Ich habe immer noch meinen Blinddarm und<br />
jede Menge anderer, lebenswichtiger Organe, die in der Wildnis aufplatzen<br />
oder auslaufen könnten. Was sollte ich in so einem Fall machen? Was,<br />
wenn ich von einem Felsvorsprung stürzen und mir das Rückgrat brechen<br />
würde? Wenn ich mich bei Nebel oder in einem Schneesturm verirren würde,<br />
von einer giftigen Schlange gebissen, bei der Durchquerung eines Flusses<br />
auf einem bemoosten Stein den Halt verlieren oder mir nach einem<br />
Sturz eine Gehirnerschütterung zuziehen würde? Man kann auch in einer<br />
fünf Zentimeter tiefen Wasserlache ertrinken oder an einem verstauchten
Fußgelenk sterben. Nein ,nein, das gefiel mir alles ganz und gar nicht.<br />
Meine Weihnachtsgrüße an Freunde und Bekannte versah ich <strong>mit</strong> der Einladung,<br />
doch <strong>mit</strong> mir zu wandern, und wenn es nur ein Teil des Weges wäre.<br />
Natürlich reagierte keiner darauf. Dann bekam ich eines Tages im Februar,<br />
der Termin meiner Abreise rückte immer näher, einen Anruf. Er war von<br />
einem alten Schulfreund, Stephen Katz. Katz und ich waren zusammen in<br />
Iowa aufgewachsen, aber ich hatte so ziemlich jeden Kontakt zu ihm verloren.<br />
Diejenigen unter Ihnen – mehr als fünf werden es wohl nicht sein – die<br />
Neither Here nor There gelesen haben, kennen Katz bereits aus den Geschichten<br />
über meine jugendlichen Abenteuer als meinen Reisegefährten in<br />
Europa. In den 25 Jahren, die seitdem vergangen sind, bin ich ihm drei-,<br />
viermal bei Besuchen zu Hause begegnet, aber sonst hatten wir nie mehr<br />
etwas <strong>mit</strong>einander zu tun. Wir waren Freunde geblieben, im theoretischen<br />
Sinn, aber unsere Lebenswege hätten verschiedener nicht sein können.<br />
»Ich habe erst gezögert«, sagte er langsam. Er suchte nach Worten. »Die<br />
Sache <strong>mit</strong> dem Appalachian Trail – könnte ich da vielleicht <strong>mit</strong>kommen?«<br />
Ich wollte meinen Ohren nicht trauen. »Willst du wirklich <strong>mit</strong>kommen?«<br />
»Also, wenn du was dagegen hättest das würde ich verstehen.«<br />
»Was dagegen?« sagte ich. »Nein. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin<br />
heilfroh.«<br />
»Wirklich?« Das schien ihn aufzuheitern.<br />
»Klar.« Ich konnte es nicht fassen. Ich brauchte nicht allein zu gehen. Ich<br />
stimmte innerlich einen Freudengesang an. Ich brauch’ nicht mehr allein zu<br />
gehen. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie überglücklich ich bin.«<br />
»Das ist ja schön«, sagte er, mehr als erleichtert, und fügte dann in bekennendem<br />
Tonfall hinzu: »Ich dachte, vielleicht willst du mich nicht dabeihaben.«<br />
»Wieso denn nicht?«<br />
»Weil ich dir immer noch 600 Pfund schulde, von unserer Reise damals<br />
durch Europa.«<br />
»He, meine Güte, das kann nicht sein… schuldest du mir wirklich 600<br />
Pfund?«<br />
»Ich habe mir fest vorgenommen, sie dir zurückzuzahlen.«<br />
»He!« sagte ich. »He.« Ich konnte mich an diese 600 Pfund gar nicht mehr<br />
erinnern. Ich hatte noch nie jemandem in meinem Leben Schulden in dieser<br />
Höhe erlassen, und es dauerte eine Weile, bis ich die Worte herausbrachte:<br />
»Kein Problem. Komm einfach <strong>mit</strong> wandern. Weißt du auch, worauf du<br />
dich einläßt?«<br />
»Klar.«<br />
»Und wie ist deine körperliche Verfassung?«<br />
»Ziemlich gut. Ich gehe nur noch zu Fuß.«
»Wirklich?« Das ist sehr ungewöhnlich für amerikanische Verhältnisse.<br />
»Na ja, mein Wagen wurde beschlagnahmt. Deswegen.«<br />
»Ach so.«<br />
Wir redeten noch über dies und das, seine Mutter, meine Mutter, Des Moines.<br />
Ich erzählte ihm alles, was ich über den Trail wußte, was nicht viel war,<br />
und über das Leben in der Wildnis, das uns erwartete. Wir verblieben so,<br />
daß er nächsten Mittwoch nach New Hampshire fliegen sollte, wir uns zwei<br />
Tage Zeit für Vorbereitungen nehmen und uns dann auf den Weg machen<br />
würden. Zum ersten Mal seit Monaten hatte ich ein rundum gutes Gefühl,<br />
was unser Unternehmen betraf. Katz klang außerdem recht optimistisch für<br />
jemanden, der das Ganze eigentlich nicht <strong>mit</strong>zumachen brauchte.<br />
Zuletzt fragte ich ihn: »Und? Wie stehst du zu Bären?«<br />
»Bis jetzt haben sie mich jedenfalls noch nicht gekriegt.«<br />
Das ist die richtige Einstellung, dachte ich. Mensch, Katz, altes Haus. Du<br />
kommst mir wie gerufen.<br />
Mir wäre jeder recht gewesen, der diesen Elan hatte und den festen Willen,<br />
<strong>mit</strong> mir loszuziehen. Nachdem ich aufgelegt hatte, fiel mir ein, daß ich<br />
vergessen hatte ihn zu fragen, warum er eigentlich <strong>mit</strong>wollte. Katz war der<br />
einzige Mensch auf der Welt, bei dem ich mir vorstellen konnte, daß er sich<br />
vor jemandem verstecken mußte, vor Leuten, die Julio hießen oder Mister<br />
Big. Egal. Ich brauchte jedenfalls nicht allein zu gehen.<br />
Ich ging zu meiner Frau, die in der Küche am Spülbecken stand, und überbrachte<br />
ihr die gute Nachricht. Ihre Begeisterung fiel reservierter als erwartet<br />
aus.<br />
»Du willst also wochenlang <strong>mit</strong> einem Menschen, den du seit 25 Jahren<br />
nicht mehr gesehen hast, durch die Wildnis wandern. Hast du dir das auch<br />
gründlich überlegt?« (Als hätte ich mir je etwas gründlich überlegt.) »Ich<br />
dachte, ihr beiden wärt euch in Europa gehörig auf die Nerven gegangen.«<br />
»Nein.« Das stimmte nicht ganz. »Wir sind uns bloß am Anfang auf die<br />
Nerven gegangen. Zum Schluß hatten wir nur noch Verachtung füreinander<br />
übrig. Aber das ist lange her.«<br />
Sie warf mir einen zutiefst zweifelnden Blick zu. »Ihr beide habt nichts<br />
gemein. Ihr seid völlig verschieden.«<br />
»Wir sind überhaupt nicht verschieden. Wir sind beide 44 Jahre alt. Wir<br />
werden uns über unsere Hämorrhoiden unterhalten, unsere Schmerzen im<br />
unteren Rückenbereich und darüber, daß wir ständig vergessen, wo wir<br />
irgend etwas hingelegt haben. Und dann frage ich ihn am nächsten Abend,<br />
sag mal, habe ich dir schon von meinen Rückenproblemen erzählt?, und er<br />
sagt, nein, ich glaube nicht, und wir kauen das Thema wieder von vorne<br />
durch. Es wird bestimmt toll.«<br />
»Es wird grauenvoll.“
»Ja, ich weiß«, sagte ich.<br />
Eine Woche später fand ich mich an unserem kleinen Flughafen ein und<br />
beobachtete, wie die Konservenbüchse <strong>mit</strong> Katz an Bord aufsetzte und auf<br />
der Rollbahn knapp 20 Meter vor dem Terminal zum Stehen kam. Das<br />
Brummen der Propeller wurde für einen Moment noch einmal lauter, verstummte<br />
dann stotternd, die Tür öffnete sich und die Gangway wurde heruntergeklappt.<br />
Ich versuchte mir ins Gedächtnis zurückzurufen, wann ich<br />
Katz das letzte Mal gesehen hatte. Nach unserer Europareise im Sommer<br />
war er nach Des Meines zurückgekehrt und dort zu Iowas Drogenguru aufgestiegen.<br />
Jahrelang -war sein Leben ein einziges, rauschendes Fest gewesen,<br />
bis keiner mehr zum Mitfeiern übriggeblieben war, so daß er nur noch<br />
<strong>mit</strong> sich allein feierte, in seiner Wohnung, in T-Shirt und Boxer-Shorts, <strong>mit</strong><br />
einem Vorrat an Marihuana, vor einem Fernseher <strong>mit</strong> Zimmerantenne. Jetzt<br />
erinnerte ich mich auch, daß ich ihn zuletzt vor fünf Jahren in Dennys Restaurant<br />
gesehen hatte, wohin ich meine Mutter zum Frühstück eingeladen<br />
hatte. Er saß ein paar Tische weiter, zusammen <strong>mit</strong> einem verhärmten Kerl,<br />
der aussah, als hieße er Virgil Starkweather oder so ähnlich, er stocherte in<br />
seinen Pfannkuchen herum und trank gelegentlich einen verbotenen Schluck<br />
aus einer Flasche, die in einem Papierbeutel steckte. Es war acht Uhr morgens,<br />
und Katz sah sehr zufrieden aus. Er war immer zufrieden, wenn er<br />
betrunken war, und er war fast immer betrunken.<br />
Wie ich später erfuhr, fand ihn die Polizei zwei Wochen später in einem<br />
Auto, das sich auf einem Stoppelfeld außerhalb der Kleinstadt Mingo überschlagen<br />
hatte. Er hing noch im Sicherheitsgurt, <strong>mit</strong> dem Kopf nach unten,<br />
das Steuerrad fest umklammert, und sagte zu dem Polizisten: »Irgendwelche<br />
Probleme, Officer?« Im Handschuhfach wurde eine geringe Menge Kokain<br />
gefunden, und Katz wurde vorsorglich für 18 Monate in Sicherheitsverwahrung<br />
genommen. Während dieser Zeit fing er an, regelmäßig zu<br />
den Treffen der Anonymen Alkoholiker zu gehen.<br />
Zu unser aller Überraschung, nicht zuletzt seiner eigenen, hatte er seitdem<br />
keinen Tropfen Alkohol oder andere Drogen mehr angerührt.<br />
Nach seiner Entlassung bekam er einen kleinen Job, ging halbtags wieder<br />
aufs College und zog <strong>mit</strong> einer Friseuse namens Patty zusammen. Die letzten<br />
drei Jahre hatte er ein unbescholtenes Leben geführt und, wie ich gleich<br />
feststellen konnte, als er geduckt durch die Tür trat, sich einen Bauch zugelegt.<br />
Katz war erstaunlich breit geworden im Vergleich zum letzten Mal. Er<br />
war immer schon ein wenig pummelig, aber jetzt mußte man gleich an Orson<br />
Welles nach einer durchzechten Nacht denken, wenn man ihn sah. Er<br />
humpelte leicht und atmete schwerer, als nach einem Weg von 20 Metern<br />
zu erwarten wäre.
»Mann, hab’ ich einen Hunger«, sagte er, ohne ein Wort der Begrüßung,<br />
und übergab mir sein Handgepäck. Ich hätte mir beinahe den Arm ausgerenkt.<br />
»Was hast du denn da drin?« keuchte ich.<br />
»Nur ein paar Kassetten und anderen Kram für unterwegs. Gibt es hier<br />
irgendwo ein Dunkin Donuts in der Nähe? Ich habe seit Boston nichts mehr<br />
gegessen.«<br />
»Boston? Da kommst du doch gerade erst her.«<br />
»Ja. Ich muß jede Stunde was essen, sonst kriege ich meine – wie soll ich<br />
sagen? – Anwandlungen.«<br />
»Was denn für Anwandlungen?« Es war nicht gerade das Wieder- sehen,<br />
das ich mir ausgemalt hatte. Ich stellte mir vor, wie er den Appalachian<br />
Trail entlanghüpfte, wie ein Spielzeug zum Aufziehen, das auf den Rücken<br />
gefallen war.<br />
»Die kriege ich regelmäßig, seit ich vor zehn Jahren mal verseuchtes Anilin<br />
eingenommen habe. Mit ein paar Doughnuts ist die Sache normalerweise<br />
erledigt.«<br />
»In drei Tagen sind wir <strong>mit</strong>teninder Wildnis, Stephen. Da gibt es keine<br />
Doughnuts.«<br />
Er strahlte stolz übers ganze Gesicht. »Ich habe vorgesorgt.« Er zeigte auf<br />
seine Tasche an der Gepäckausgabe, einen grünen Army-Seesack, und deutete<br />
mir an, ich solle ihn hochheben. Er wog mindestens 30 Kilo. Er sah<br />
meinen verwunderten Gesichtsausdruck. »Snickers«, erklärte er. »Ein ganzer<br />
Sack voll Snickers.«<br />
Wir machten einen Umweg über Dunkin Donuts, bevor wir nach Hause<br />
fuhren. Meine Frau und ich setzten uns <strong>mit</strong> ihm an den Küchentisch und<br />
sahen zu, wie er fünf Boston-Cream-Doughnuts verputzte, die er <strong>mit</strong> zwei<br />
Bechern Milch hinunterspülte. Dann sagte er, er wolle sich ein bißchen<br />
ausruhen. Er brauchte mehrere Minuten, um die Treppe nach oben zu bewältigen.<br />
Meine Frau sah mich <strong>mit</strong> einem Ausdruck heiterer Verständnislosigkeit an.<br />
»Bitte, sag jetzt nichts«, bat ich sie.<br />
Nachdem er seinen Mittagsschlaf gehalten hatte, suchten wir Dave Mengle<br />
in dem Outdoor-Laden auf, kauften eine Ausstattung für Katz – Rucksack,<br />
Zelt, Schlafsack und den ganzen anderen Kram, – anschließend gingen wir<br />
zu Kmart und besorgten einen Zeltboden, Thermounterwäsche und noch ein<br />
paar Kleinigkeiten. Danach mußte er sich wieder hinlegen.<br />
Am Tag darauf gingen wir in einen Supermarkt, um Proviant für die erste<br />
Woche unserer Wanderung einzukaufen. Ich hatte keine Ahnung vom Kochen,<br />
aber Katz versorgte sich seit Jahren selbst und hatte ein festes Reper-
toire an Gerichten (hauptsächlich Erdnußbutter, Thunfisch und brauner<br />
Zucker, alles in einem Topf vermengt), die seiner Meinung nach auch ganz<br />
gut zur Zeltlageratmosphäre paßten, aber er packte noch eine Menge anderer<br />
Sachen in seinen Einkaufswagen – vier große Salamiwürste, fünf Pfund<br />
Reis, diverse Kekspackungen, Haferflocken, Rosinen, M&Ms, Büchsenfleisch,<br />
noch mehr Snickers, Sonnenblumenkerne, Grahamplätzchen, Instant-Kartoffelpüree,<br />
mehrere Streifen gedörrtes Rindfleisch, ein paar Käsestücke,<br />
Dosenschinken und die gesamte Auswahl unverderblicher Kuchen<br />
und Doughnuts, die der Hersteller Little Debbie im Angebot hat.<br />
»Ich glaube nicht, daß wir das alles tragen können«, gab ich ängstlich zu<br />
bedenken, als er auch noch eine kommetgroße Mortadella in den Einkaufswagen<br />
legte.<br />
Katz begutachtete den Wageninhalt mißmutig. »Du hast recht«, pflichtete er<br />
mir bei. »Fangen wir nochmal von vorne an.«<br />
Er ließ den Wagen einfach stehen und ging los, um sich einen neuen zu<br />
holen. Wir drehten nochmal eine Runde und versuchten, diesmal eine intelligentere<br />
Auswahl zu treffen, hatten aber zum Schluß immer noch viel zu<br />
viel.<br />
Wir brachten alles nach Hause, teilten es auf und machten uns ans Packen –<br />
Katz in dem Gästezimmer, wo auch sein übriger Kram lag, und ich in meinem<br />
Hauptquartier im Keller. Ich packte zwei Stunden lang, aber ich schaffte<br />
es nicht, alles reinzukriegen. Ich legte Bücher, Notizblöcke und die ganze<br />
Ersatzkleidung beiseite und probierte alle möglichen Kombinationen aus,<br />
aber jedesmal, – wenn ich fertig war, entdeckte ich ein großes und -wichtiges<br />
Teil, das übriggeblieben war. Schließlich ging ich nach oben, um zu<br />
sehen, wie Katz zurechtkam. Katz lag auf dem Bett und hatte seinen Walkman<br />
auf. Sein Zeug lag überall verstreut im Zimmer herum. Der neue Rucksack<br />
stand schlaff und vernachlässigt da. Ein leises rhythmisches Zischen<br />
tönte aus dem Kopfhörer.<br />
»Willst du nicht packen?« sagte ich.<br />
»Jaah.«<br />
Ich wartete eine Minute lang. Ich dachte, er würde sich vom Bett erheben,<br />
aber er rührte sich nicht. »Entschuldige bitte, Stephen, aber ich habe den<br />
Eindruck, daß du dich hingelegt hast.«<br />
»Jaah.«<br />
»Kannst du mich eigentlich verstehen?«<br />
»Jaah. Es dauert nur noch eine Minute.«<br />
Ich seufzte und ging wieder runter in den Keller.<br />
Beim Abendessen sprach Katz nur wenig und verschwand danach gleich<br />
wieder in seinem Zimmer. Wir hörten nichts weiter von ihm im Laufe des<br />
Abends, erst vor Mitternacht, als wir schon im Bett lagen, drang Lärm
durch die Wand zu uns herüber – ein Poltern und Murmeln, Geräusche, als<br />
würden Möbel im Zimmer verrückt, und kurze heftige Wutausbrüche, gefolgt<br />
von lang anhaltenden Phasen der Stille. Ich hielt die Hand meiner Frau<br />
fest und wußte nicht, was ich sagen sollte. Am nächsten Morgen klopfte ich<br />
bei Katz an und steckte schließlich, da er nicht antwortete, den Kopf durch<br />
die Tür. Er schlief noch, angezogen, auf einem Haufen zerwühlter Bettwäsche.<br />
Die Matratze war ein Stück vom Bettkasten gerutscht, als hätte er sich<br />
<strong>mit</strong> irgendwelchen nächtlichen Eindringlingen herumgeschlagen. Sein<br />
Rucksack war voll, aber nicht zugebunden, und seine persönlichen Sachen<br />
lagen immer noch weiträumig im ganzen Zimmer verstreut. Ich sagte ihm,<br />
wir müßten in einer Stunde losfahren, wenn wir unseren Flug nicht verpassen<br />
wollten.<br />
»Jaah«, sagte er.<br />
20 Minuten später kam er die Treppe herunter, schwerfällig und unter leisem<br />
Gefluche. Man hörte, ohne hinzusehen, daß er seitlich und übervorsichtig<br />
ging, als wären die Stufen vereist. Den Rucksack hatte er aufgesetzt.<br />
Hinten und an beiden Seiten, überall waren irgendwelche Sachen festgebunden<br />
– ein Paar versiffte Turnschuhe, ein zweites Paar, offenbar normale<br />
Alltagsschuhe, dazu Töpfe und Pfannen, eine Laura-Ashley-Einkaufstasche,<br />
die er im Kleiderschrank meiner Frau gefunden und sich angeeignet hatte<br />
und die jetzt <strong>mit</strong> wer weiß was gefüllt war. »Besser habe ich es nicht hingekriegt«,<br />
sagte er. »Ich mußte ein paar Sachen hier lassen.«<br />
Ich nickte. Ich mußte auch ein paar Sachen zu Hause lassen. An erster Stelle<br />
waren die Haferflocken zu nennen, die ich sowieso nicht mag, und die etwas<br />
ekligeren Kuchen von Little Debbie, will sagen, alle Kuchen von Little<br />
Debbie.<br />
Meine Frau brachte uns bei dichtem Schneetreiben zum Flughafen nach<br />
Manchester, und wir verharrten in dem eigentümlichen Schweigen, das<br />
einer langen Trennung vorausgeht. Katz saß auf dem Rücksitz und aß<br />
Doughnuts. Am Flughafen überreichte mir meine Frau ein Geschenk der<br />
Kinder, einen Spazierstock <strong>mit</strong> Knauf, dem sie eine rote Schleife umgebunden<br />
hatten. Ich hätte in Tränen ausbrechen können – am liebsten wäre ich<br />
gleich wieder in den Wagen gestiegen und zurückgefahren. Katz mühte sich<br />
derweil noch stirnrunzelnd <strong>mit</strong> den vielen Gurten ab. Meine Frau kniff mich<br />
in den Arm, lächelte verlegen und ging.<br />
Ich schaute ihr hinterher, dann betrat ich <strong>mit</strong> Katz den Terminal. Der Mann<br />
am Abfertigungsschalter warf einen Blick auf unsere Tickets nach Atlanta<br />
und sagte in einem – wie ich fand -ziemlich alarmierenden Ton für einen<br />
Menschen, der im Winter <strong>mit</strong> kurzärmeligem Hemd herumlief: »Haben Sie<br />
vor, den Appalachian Trail entlangzuwandern?«<br />
»Und ob!« sagte Katz <strong>mit</strong> stolzgeschwellter Brust.
»Die haben gerade eine Menge Ärger <strong>mit</strong> den Wölfen, da unten in Georgia.«<br />
»Tatsächlich?« Katz spitzte die Ohren.<br />
»Ja, ja. Sind kürzlich ein paar Leute angefallen worden. Ziemlich übel zugerichtet,<br />
wie ich gehört habe.« Er ließ sich noch etwas Zeit <strong>mit</strong> den Tickets<br />
und den Gepäckanhängern.<br />
»Hoffentlich haben Sie genug lange Unterhosen eingepackt.«<br />
Katz verzog schmerzlich das Gesicht. »Gegen die Wölfe?«<br />
»Nein, gegen das Wetter. Es soll die nächsten vier, fünf Tage eine Rekordkälte<br />
geben. Weit unter null Grad heute abend in Atlanta.«<br />
»Na wunderbar«, sagte Katz und stieß einen verzweifelten Seufzer aus. Er<br />
sah den Mann herausfordernd an. »Sonst noch Neuigkeiten für uns? Anruf<br />
vom Krankenhaus, wir hätten Krebs, oder so?«<br />
Der Mann strahlte und knallte die Tickets auf den Schalter. »Nein, das<br />
war’s. Trotzdem gute Reise. Ach, noch etwas«, er wandte sich direkt an<br />
Katz, senkte dabei die Stimme, »hüten Sie sich vor den Wölfen, denn ganz<br />
im Vertrauen, Sie sehen aus wie ein richtiger Leckerbissen.« Er zwinkerte<br />
scherzhaft.<br />
»Meine Güte«, sagte Katz <strong>mit</strong> kaum hörbarer Stimme und wirkte plötzlich<br />
sehr, sehr trübsinnig.<br />
Wir fuhren <strong>mit</strong> dem Aufzug zu unserem Flugsteig. »Und dann geben sie<br />
einem auf diesem Flug nicht mal was Anständiges zu essen«, stellte er abschließend<br />
<strong>mit</strong> ungewöhnlicher Bitterkeit fest.
3. Kapitel<br />
Alles nahm seinen Anfang <strong>mit</strong> einem Mann namens Benton MacKaye,<br />
einem sanftmütigen, freundlichen, unendlich wohlmeinenden Visionär, der<br />
im Sommer 1921 seinem Freund Charles Harris Whitaker, Herausgeber<br />
einer führenden Architektur-Zeitschrift, den ehrgeizigen Plan für einen<br />
Fernwanderweg unterbreitete. Die Behauptung MacKayes Leben sei zu<br />
diesem Zeitpunkt nicht zufriedenstellend verlaufen, wäre eine harmlose Untertreibung.<br />
In dem Jahrzehnt davor war er von diversen Posten in Harvard<br />
und dem National Forest Service entlassen und, mangels einer besseren<br />
Stelle, auf die man ihn hätte abschieben können, <strong>mit</strong> dem unklar umrissenen<br />
Auftrag, Ideen zur Steigerung der Effizienz und der Moral zu entwickeln, in<br />
ein Büro des amerikanischen Ministeriums für Arbeit gesteckt worden.<br />
Pflichtbewußt, wie er war, arbeitete er ehrgeizige und unrealistische Entwürfe<br />
aus, die <strong>mit</strong> Erheiterung zur Kenntnis genommen wurden und anschließend<br />
gleich im Papierkorb landeten. Im April 1921 stürzte sich seine<br />
Frau, die berühmte Pazifistin und Suffragette Jessie Hardy Stubbs, von einer<br />
Brücke in New York in den East River und ertrank.<br />
Soweit die Vorgeschichte. Gerade einmal zehn Wochen nach dem tragischen<br />
Ereignis eröffnete MacKaye seinem Freund Whitaker die Idee für<br />
einen Wanderweg durch die Appalachen, und im Oktober wurde der Vorschlag<br />
in einem dafür eigentlich ungeeigneten Forum, der Zeitschrift von<br />
Whitaker, dem Journal of the American Institute of Architects, veröffentlicht.<br />
Der Appalachian Trail war nur ein Aspekt von MacKayes weitreichender<br />
Vision. Er sah den AT als eine Art roten Faden, um »Arbeitslager«<br />
auf den Berggipfeln <strong>mit</strong>einander zu verbinden. In diese sogenannten Workcamps<br />
sollten die blassen, erschöpften Arbeiter aus den Städten zu Tausenden<br />
strömen und sich im Geiste der Selbstlosigkeit in gesundheitsfördernder<br />
Schufterei ergehen und sich an der freien Natur ergötzen. Herbergen, Rasthäuser<br />
und Studienzentren sollten errichtet werden, schließlich sogar ganze<br />
Walddörfer, die dauerhaft bewohnt sein sollten, Kooperativen »in Selbstverwaltung«,<br />
deren Bewohner sich <strong>mit</strong> »nichtindustrieller Tätigkeit«, basierend<br />
auf Handwerk, Forst- und Landwirtschaft, ihren Lebensunterhalt verdienen<br />
sollten. Das Ganze sollte nach MacKayes überschwenglicher Beschreibung<br />
ein »Rückzug vom Profitdenken« sein – eine Vorstellung, in der<br />
andere »die Geißel des Bolschewismus« erkannten, um <strong>mit</strong> den Worten<br />
eines Biographen zu sprechen.<br />
Zu dem Zeitpunkt, als MacKaye seine Idee entwickelte, existierten bereits<br />
mehrere Wandervereine im Osten der Vereinigten Staaten – der Green<br />
Mountain Club, der Dartmouth Outing Club und der altehrwürdige Appalachian<br />
Mountain Club, um nur einige zu nennen. Diese eher elitären Organi-
sationen besaßen und unterhielten Hunderte Kilometer Forst- und Wanderwege,<br />
hauptsächlich in New England. 1925 kamen Vertreter der führenden<br />
Vereine in Washington zusammen und gründeten die Appalachian Trail<br />
Conference, zu dem Zweck, einen fast 2.000 Kilometer langen Pfad anzulegen,<br />
der die beiden höchsten Gipfel im Osten, den 2037 Meter hohen Mount<br />
Mitchell in North Carolina und den 120 Meter niedrigeren Mount Washington<br />
in New Hampshire , <strong>mit</strong>einander verbinden sollte. Tatsächlich geschah<br />
in den nächsten fünf Jahren erst einmal gar nichts, hauptsächlich deswegen,<br />
weil MacKaye da<strong>mit</strong> beschäftigt war, seine Pläne weiter auszuarbeiten und<br />
zu verfeinern, bis er selbst und seine Vision den Kontakt zur Realität verloren<br />
hatten.<br />
Erst als 1930 der junge Seerechtler und begeisterte Wanderer Myron Avery<br />
aus Washington die Weiterentwicklung des Projekts in die Hand nahm,<br />
konnte die Arbeit richtig beginnen und machte plötzlich rasche Fortschritte.<br />
Avery muß offenbar kein sonderlich liebenswerter Mensch gewesen sein. Er<br />
hinterließ zwischen Maine und Georgia zwei Spuren, wie sich ein Zeitgenosse<br />
ausdrückte. »Die eine war eine Spur der Verwüstung, verletzter Gefühle<br />
und gekränkter Eitelkeiten. Die andere war der Appalachian Trail.«<br />
Avery besaß keine Geduld im Umgang <strong>mit</strong> MacKaye und seinen »quasi<br />
mystischen Sprüchen«; jedenfalls kamen die beiden nicht <strong>mit</strong>einander klar.<br />
1935 hatten sie einen erbitterten Streit über die Erschließung des Shenandoah<br />
National Parks – Avery war bereit, den Bau einer landschaftlich schönen<br />
Schnellstraße durch die Berge zuzulassen, MacKaye empfand das als Verrat<br />
grundlegender Prinzipien –, danach wechselten die beiden kein Wort mehr<br />
<strong>mit</strong>einander.<br />
Es ist MacKaye, dem das Verdienst angerechnet wird, den Trail initiiert zu<br />
haben, aber eigentlich liegt das nur daran, daß er das biblische Alter von 96<br />
Jahren erreichte und schlohweißes Haar auf seinem Kopf hatte. Außerdem<br />
konnte man sich immer auf ihn verlassen, wenn aus Anlaß irgendwelcher<br />
Feierlichkeiten ein paar Worte gesagt werden mußten. Avery dagegen starb<br />
1952, ein Vierteljahrhundert vor MacKaye, als der Weg noch kaum bekannt<br />
war. Aber eigentlich war er Averys Werk. Er hatte Karten erstellt, er hatte<br />
die Vereine bedrängt, Gruppen freiwilliger Helfer zur Verfügung zu stellen,<br />
und er hatte persönlich den Bau von Hunderten Kilometern der Wanderstrecke<br />
überwacht. Er sorgte für eine Verlängerung der ursprünglich geplanten<br />
Strecke von 2.000 auf weit über 3.000 Kilometer und war vor Beendigung<br />
des Baus jeden Kilometer selbst abgewandert. In nicht einmal sieben<br />
Jahren gelang es ihm, <strong>mit</strong> Hilfe ehrenamtlicher Arbeit einen 3.000 Kilometer<br />
langen Wanderweg durch die bergige Wildnis anzulegen. Ganze Armeen<br />
haben weniger zustande gebracht.<br />
Mit der Rodung eines vier Kilometer langen Waldstreifens in einem entle-
genen Teil von Maine am 14. August 1937 wurde der Appalachian Trail<br />
fertiggestellt. Erstaunlicherweise erregte der Bau des längsten Fußweges der<br />
Welt keine große Aufmerksamkeit. Avery war kein Mensch, der die Öffentlichkeit<br />
liebte, und MacKaye hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits zurückgezogen.<br />
Keine Zeitung meldete das Ende der Bauarbeiten, und es gab keine<br />
offizielle Einweihungsfeier aus diesem Anlaß.<br />
Der Weg besitzt keine historischen Wurzeln, er folgt keinem Indianerpfad<br />
oder einer Postroute aus der Kolonialzeit. Er bietet auch nicht die schönsten<br />
Ausblicke, die höchsten Gipfel oder die auffälligsten landschaftlichen<br />
Wahrzeichen. Schließlich bringt er den Wanderer nicht einmal in die Nähe<br />
von Mount Mitchell, schließt dafür aber Mount Washington <strong>mit</strong> ein und<br />
führt sogar noch 560 Kilometer weiter bis zum Mount Katahdin in Maine.<br />
(Es war vor allem Avery, der darauf bestand. Er war in Maine aufgewachsen<br />
und hatte dort seine prägenden »Wanderjahre« verbracht.) Im<br />
wesentlichen verläuft der Trail dort, wo sich am leichtesten Zugang schaffen<br />
ließ, hauptsächlich in den Höhenlagen, über einsame Pässe und durch<br />
verlassene Schluchten, die kein Mensch je vorher benutzt oder sich für sie<br />
begeistert hatte, die häufig nicht mal einen Namen besaßen. Er verfehlt das<br />
geographische südliche Ende der Bergkette der Appalachen um 240, das<br />
nördliche um fast 1.125 Kilometer. Die Workcamps und Blockhütten, die<br />
Schulen und Studienzentren wurden nie gebaut.<br />
Dennoch ist sehr viel von dem ursprünglichen Reiz, der von MacKayes<br />
Vision ausging, erhalten geblieben. Die gesamte Wegstrecke von 3.380<br />
Kilometer, einschließlich der Seitenpfade, Fußgängerbrücken, Hinweisschilder,<br />
Markierungen und Schutzhütten, werden von ehrenamtlichen Helfern<br />
gewartet – es heißt sogar, der AT sei die größte ehrenamtliche Einrichtung<br />
der Welt. Und bislang hat er sich glücklicherweise jeder Kommerzialisierung<br />
widersetzt. Die Appalachian Trail Conference stellte erst 1968 ihren<br />
ersten bezahlten Mitarbeiter ein, aber sie hat sich ihren freundlichen, umgänglichen,<br />
engagierten Charakter bewahrt. Der AT ist nicht mehr der längste<br />
Wanderweg. Der Pacific Crest und der Continental Divide, die beide im<br />
Westen der Vereinigten Staaten liegen, sind etwas länger, aber der AT wird<br />
immer der erste und schönste dieser Art bleiben. Er hat viele Freunde gefunden,<br />
und er hat sie verdient.<br />
Seit dem Tag der Fertigstellung mußte die Wegstrecke immer wieder hier<br />
und da umgeleitet werden. Als erstes wurde ein Abschnitt von 189 Kilometern<br />
in Virginia verlegt, um dem Bau des Skyline Drive durch den Shenandoah<br />
National Park zu ermöglichen. 1985 machte die intensive bauliche<br />
Erschließung des Gebietes um den Mount Oglethorpe in Georgia es erforderlich,<br />
32 Kilometer des südlichen Wegabschnittes zu kappen und den<br />
Ausgangspunkt an den Springer Mountain, <strong>mit</strong>ten in die geschützte Wildnis
des Chattahochee National Forest zu verlegen. Zehn Jahre später wies der<br />
Maine Appalachian Trail Club einen Abschnitt von 423 Kilometer neu aus<br />
– die Hälfte der gesamten Wegstrecke durch diesen Bundesstaat – und führte<br />
den Pfad abseits von Forststraßen, wieder durch freies Gelände. Noch<br />
heute ändert sich die Wegführung Jahr für Jahr.<br />
Die vielleicht größte Schwierigkeit für den Wanderer besteht darin, überhaupt<br />
auf den Appalachian Trail zu kommen, besonders die Endpunkte sind<br />
schwer zu erreichen. Springer Mountain, der Einstieg im Süden, ist elf Kilometer<br />
vom nächsten Highway entfernt und befindet sich im Amicalola<br />
Falls State Park, der wiederum am Ende der Welt liegt. In Atlanta, dem<br />
nächsten Anschluß an die Außenwelt, können Sie sich entscheiden zwischen<br />
täglich einem Zug oder zwei Bussen nach Gainesville, von wo aus es<br />
immer noch 64 Kilometer bis zu dem Ort sind, der die besagten elf Kilometer<br />
vom eigentlichen Trail entfernt hegt. Und an den Katahdin Mountain in<br />
Maine zu gelangen ist sogar noch umständlicher.<br />
Zum Glück gibt es Leute, die einen gegen Bezahlung in Atlanta abholen<br />
und nach Amicalola bringen. So geschah es, daß Katz und ich uns in die<br />
Obhut eines großen, freundlichen Herrn <strong>mit</strong> Baseballmütze und dem Namen<br />
Wes Wissen begaben, der sich bereit erklärt hatte, uns für 60 Dollar vom<br />
Flughafen in Atlanta zur Amicalola Falls Lodge, unserem Ausgangspunkt<br />
am Springer Mountain, zu bringen.<br />
Jedes Jahr machen sich zwischen Anfang März und Ende April 2.000 Wanderer<br />
am Springer Mountain auf den Weg, die meisten in der festen Absicht,<br />
die gesamte Strecke bis zum Katahdin Mountain zu laufen. Nicht einmal<br />
zehn Prozent schaffen es. 50 Prozent kommen nicht über Virginia hinaus,<br />
das entspricht knapp einem Drittel des Weges. 25 Prozent kommen bis<br />
North Carolina, in den Nachbarstaat. Bis zu 20 Prozent geben innerhalb der<br />
ersten sieben Tage auf. Wisson kennt sich <strong>mit</strong> alldem aus.<br />
»Letztes Jahr habe ich einen Mann am Startpunkt des Trail rausgelassen«,<br />
erzählte er uns, während wir durch die dichten Kiefernwälder Richtung<br />
Norden kutschierten, auf die zerklüftete Hügellandschaft von Georgia zu.<br />
»Drei Tage später ruft er mich von einer öffentlichen Telefonzelle in Woody<br />
Gap aus an, dem ersten öffentlichen Telefon auf der Strecke. Meint, er<br />
will nach Hause, der Weg sei nicht das, was er erwartet hätte. Ich bringe ihn<br />
also zurück zum Flughafen, und zwei Tage danach steht er wieder in Atlanta.<br />
Meint, seine Frau hätte ihn zurückgeschickt, weil er so viel Geld für die<br />
Ausrüstung bezahlt hätte, und so leicht würde er ihr nicht davonkommen.<br />
Ich setze ihn also am Einstieg zum Weg ab. Drei Tage später wieder ein<br />
Anruf aus Woody Gap. Er will zum Flughafen gebracht werden. Ich frage<br />
ihn: >Und was ist <strong>mit</strong> Ihrer Frau?< Und er: >Diesmal fahre ich nicht nach<br />
Hause.
»Wie weit ist es bis Woody Gap?« frage ich.<br />
»33 Kilometer vom Springer Mountain. Nicht gerade sehr weit, oder? Immerhin<br />
ist er den ganzen Weg von Ohio hierhergekommen.«<br />
»Warum hat er dann so schnell aufgegeben?«<br />
»Er sagte, es sei nicht das, was er erwartet hätte. Das sagen alle. Gerade<br />
letzte Woche wieder. Ich hatte drei Frauen aus Kalifornien im Wagen –<br />
<strong>mit</strong>telalt, wirklich nette Mädchen, ein bißchen viel gekichert haben sie, aber<br />
ansonsten, wirklich nett – und als ich sie absetzte, waren sie in richtiger<br />
Wanderlaune. Vier Stunden später riefen sie an und sagten, sie wollten nach<br />
Hause. Sie müssen sich vorstellen, die waren von Kalifornien hergekommen,<br />
hatten ein Heidengeld für das Flugticket und die Ausrüstung bezahlt –<br />
die hatten das beste Zeug, was ich je gesehen habe, alles neu, <strong>mit</strong> allen<br />
Schikanen – und waren gerade mal ein, zwei Kilometer gelaufen, und schon<br />
geben sie auf. Sie sagten, es wäre nicht das, was sie erwartet hätten.«<br />
»Was haben sie denn erwartet?«<br />
»Was weiß ich? Vielleicht Rolltreppen. Aber außer Bergen und Felsen und<br />
Wald und dem Weg gibt’s da nichts. Das weiß doch selbst der Dümmste.<br />
Aber Sie wären erstaunt, wieviel Leute aufgeben. Andererseits – neulich<br />
hatte ich hier einen Jungen, es ist vielleicht sechs Wochen her, der hätte<br />
besser aufgegeben. Er hatte gerade den Trail absolviert, war den ganzen<br />
Weg von Maine bis hierher allein gelaufen. Er hatte acht Monate dazu gebraucht,<br />
länger als die meisten, und ich glaube, in den letzten Wochen war<br />
er keiner Menschenseele mehr begegnet. Am Ende war er ein einziges<br />
Wrack, zitterte am ganzen Leib. Ich hatte seine Frau dabei. Sie war <strong>mit</strong>gekommen,<br />
um ihn abzuholen, und er sank bloß in ihre Arme und fing an zu<br />
heulen. Er bekam kein Wort heraus. Und so ging’s die ganze Fahrt zum<br />
Flughafen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so erleichtert war, es<br />
hinter sich gebracht zu haben. Es hat Sie niemand gezwungen, den Appalachian<br />
Trail zu gehen, Sir, habe ich mir nur gedacht. Aber ich habe natürlich<br />
meinen Mund gehalten.«<br />
»Können Sie, wenn Sie die Leute absetzen, erkennen, ob sie es schaffen<br />
werden oder nicht?«<br />
»Im allgemeinen, ja.«<br />
»Glauben Sie, daß wir es schaffen werden?« sagte Katz.<br />
Er musterte uns nacheinander. »Ach, Sie werden es schon schaffen«, antwortete<br />
er, aber in seinem Gesicht stand etwas anderes zu lesen.<br />
Die Amicalola Falls Lodge, die man über eine lange Serpentinenstraße<br />
durch den Wald erreicht, liegt in luftiger Höhe an einem Berghang. Der<br />
Mann am Flughafenschalter in Manchester hatte auf jeden Fall den richtigen<br />
Wetterbericht gehört. Es herrschte eine grimmige Kälte, als wir aus dem<br />
Auto stiegen. Aus allen Richtungen fegte ein heimtückischer, eisiger Wind
und schob einem Ärmel und Hosenbeine hoch.<br />
»Meine Fresse!« rief Katz höchst erstaunt, als hätte soeben jemand einen<br />
Eimer <strong>mit</strong> Eiswürfeln über ihn ausgeschüttet, und rannte in die Hütte. Ich<br />
zahlte und folgte ihm.<br />
Die Hütte war modern eingerichtet und gut geheizt. Sie hatte einen offenen<br />
Empfangsraum, der von einem gemauerten Kamin beherrscht wurde, und<br />
nichtssagende, bequeme Zimmer, wie man sie in jedem Holiday Inn vorfindet.<br />
Wir sagten uns gute Nacht und verabredeten uns für morgen früh, sieben<br />
Uhr. Ich zog mir eine Cola aus dem Automaten im Flur, stellte mich<br />
unter die heiße Dusche, machte verschwenderischen Gebrauch von den<br />
Handtüchern, und bettete mich zwischen gestärkte Laken – wie lange würde<br />
ich auf diesen Luxus wohl verzichten müssen –, sah mir von glücklichen,<br />
unbekümmerten Moderatoren vorgebrachte, entmutigende Berichte auf dem<br />
Wetterkanal an und schlief kaum.<br />
Ich war vor Tagesanbruch auf und setzte mich ans Fenster, als die blasse<br />
Dämmerung widerwillig die Landschaft freigab – ein kahles, scheinbar<br />
grenzenloses Gelände aus mächtigen, geschwungenen Hügeln, <strong>mit</strong> Reihen<br />
nackter Bäume, alles von einer hauchdünnen Schicht Pulverschnee bedeckt.<br />
Es sah nicht gerade abschreckend aus – wir befanden uns hier nicht im<br />
Himalajagebirge –, aber auch nicht so einladend, daß man unbedingt rausgehen<br />
wollte.<br />
Als ich zum Frühstück runterging, kam die Sonne heraus und erfüllte die<br />
Welt hoffnungsfroh <strong>mit</strong> ihrem Licht, und ich trat nach draußen, um die Luft<br />
zu schnuppern. Die Kälte war fürchterlich, wie ein Schlag ins Gesicht, und<br />
es wehte noch immer ein scharfer Wind. Kleine trockene Flocken wirbelten<br />
wie Styroporkügelchen durch die Luft. Ein großes Thermometer am Hütteneingang<br />
zeigte -12 Grad Celsius an.<br />
»Die schlimmste Kälte, die wir je um diese Zeit in Georgia hatten«, sagte<br />
eine Hotelangestellte <strong>mit</strong> einem breiten, zufriedenen Lächeln zu mir, als sie<br />
eilig vom Parkplatz heraufkam. Dann blieb sie stehen und fragte: »Wollen<br />
Sie wandern?«<br />
»Ja.«<br />
»Ich möchte nicht <strong>mit</strong> Ihnen tauschen. Trotzdem viel Glück. Brrrrr!« sagte<br />
sie und schlüpfte hinein.<br />
Zu meiner Überraschung verspürte ich plötzlich einen heftigen Bewegungsdrang.<br />
Ich wollte endlich loswandern. Immerhin hatte ich seit Monaten auf<br />
diesen Tag gewartet, wenn auch meist <strong>mit</strong> gemischten Gefühlen. Ich wollte<br />
sehen, wie es da draußen zuging. Abertausende Menschen in ganz Amerika<br />
würden sich heute zur Arbeit quälen, im Stau stecken und Abgase einatmen.<br />
Ich dagegen durfte im Wald Spazierengehen. Ich wollte los, endlich los.<br />
Ich suchte Katz und fand ihn im Speiseraum, er wirkte sogar recht munter.
Das kam, weil er eine Bekanntschaft geschlossen hatte – eine Kellnerin <strong>mit</strong><br />
dem hübschen Namen Rayette, die sich auf höchst kokette Weise um seine<br />
Bedürfnisse kümmerte. Rayette war über einen Meter achtzig groß und<br />
hatte ein Gesicht, vor dem sich jedes Kind gegruselt hätte, aber sie war<br />
gutmütig und schenkte großzügig Kaffee aus. Sie hätte Katz ihre Bereitschaft<br />
zur Hingabe nicht deutlicher zeigen können, wenn sie die Röcke<br />
gerafft und sich auf seine »Frühstücksplatte für den Wolfshunger« gelegt<br />
hätte. Katz hatte einen regelrechten Hormonschub.<br />
»Oh, ich mag Männer, die gerne saftige Pfannkuchen essen«, flötete sie.<br />
»Und der hier ist besonders saftig, meine Liebe«, erwiderte Katz <strong>mit</strong> vor<br />
Sirup und frühmorgendlicher Glückseligkeit glänzendem Gesicht. Nicht<br />
gerade Hepburn und Tracy, die beiden, aber es war trotzdem irgendwie<br />
rührend.<br />
Rayette ging und kümmerte sich um einen anderen Gast, und Katz schaute<br />
ihr <strong>mit</strong> geradezu väterlichem Stolz hinterher. »Sie ist ziemlich häßlich,<br />
findest du nicht?« sagte er <strong>mit</strong> einem frohen, widersinnigen Strahlen.<br />
Ich bemühte mich um Takt. »Verglichen <strong>mit</strong> anderen Frauen schon.«<br />
Katz nickte nachdenklich und richtete dann einen plötzlich ehrfürchtigen<br />
Blick auf mich. »Weißt du, worauf es mir in letzter Zeit bei einer Frau immer<br />
mehr ankommt? Daß das Herz am rechten Fleck ist und daß sie noch<br />
alle Gliedmaßen hat.«<br />
»Kann ich nachvollziehen.«<br />
»Und das ist bei mir schon die oberste Kategorie. Bei den Gliedmaßen bin<br />
ich zu Kompromissen bereit. Glaubst du, daß sie zu haben ist?«<br />
»Ich vermute, da sind noch andere vor dir dran.«<br />
Er nickte ernüchtert. »Es ist besser, wir essen auf und machen, daß wir<br />
rauskommen.«<br />
Das hörte ich gern. Ich trank meinen Kaffee aus, und wir gingen unsere<br />
Sachen holen. Als wir uns zehn Minuten später in voller Montur und abmarschbereit<br />
wiedertrafen, sah Katz elend aus. »Sollen wir nicht doch noch<br />
einen Tag hierbleiben?« sagte er.<br />
»Was? Machst du Witze?« Ich war sprachlos. »Warum?«<br />
»Weil es warm ist da drinnen, und hier draußen ist es kalt.«<br />
»Wir müssen los.«<br />
Er sah hinüber zum Wald. »Wir werden uns zu Tode frieren.«<br />
Ich sah ebenfalls hinüber. »Ja, wahrscheinlich. Wir müssen trotzdem los.«<br />
Ich setzte meinen Rucksack auf und taumelte unter dem Gewicht nach hinten<br />
– es dauerte Tage, bis ich dieses Manöver auch nur annähernd aufrecht<br />
stehend schaffte –, zog den Hüftgurt stramm und trottete los. Am Waldrand<br />
sah ich mich um, ob Katz auch hinter mir herkam. Vor mir erstreckte sich<br />
eine öde Welt aus winterkahlen Bäumen. Ich betrat <strong>mit</strong> gebührender Würde
den Pfad, ein Abschnitt des ursprünglichen Appalachian Trail aus der Zeit,<br />
als hier die Route zwischen Mount Oglethorpe und Springer Mountain<br />
vorbeiführte.<br />
Wir schrieben den 9. März 1996. Wir waren unterwegs.<br />
Es ging zunächst hinunter in ein bewaldetes Tal <strong>mit</strong> einem plätschernden,<br />
von brüchigem Eis gesäumten Bachlauf, dem der Weg auf einer Strecke von<br />
etwa 700 Metern folgte, bevor er uns bergauf in dichtes Waldgebiet brachte.<br />
Es war, das wurde schnell deutlich, der Fuß unseres ersten großen Berges,<br />
Frosty Mountain, und er stellte uns umgehend auf eine harte Probe. Die<br />
Sonne schien, der Himmel war stahlblau, aber alles in Bodennähe war<br />
braun – braune Bäume, braune Erde, steifgefrorene, braune Blätter – und<br />
die Kälte war unnachgiebig. Ich trottete ungefähr 30 Meter weiter bergauf,<br />
dann blieb ich stehen, meine Augen quollen hervor, meine Atmung ging<br />
schwer, mein Herz raste besorgniserregend. Katz war bereits weit zurückgefallen<br />
und keuchte schlimm. Ich drängte vorwärts.<br />
Es war eine Tortur. Das sind die ersten Tage einer Wanderung immer. Ich<br />
war einfach nicht in Form, es war hoffnungslos. Der Rucksack war zu<br />
schwer, viel zu schwer. Ich hatte mich noch nie einer solchen Anstrengung<br />
ausgesetzt, auf die ich zudem schlecht vorbereitet war. Jeder Schritt war<br />
eine Qual.<br />
Das Schwierigste war, <strong>mit</strong> der immer wieder aufs neue entmutigenden Erkenntnis<br />
fertig zu werden, daß der Berg sozusagen nicht aufhört. Beim<br />
Aufstieg sieht man im Gegensatz zum Abstieg, wenn man den Berg im<br />
Rücken hat, nie genau, was noch vor einem liegt. Zwischen den Vorhängen<br />
aus Bäumen zu beiden Seiten, den ständig zurückweichenden Umrissen des<br />
steilen Hangs vor einem und dem eigenen müden Stapfen verliert sich allmählich<br />
das Gefühl dafür, wie weit man schon gelaufen ist. Jedesmal, wenn<br />
man sich zum vermeintlichen Bergkamm geschleppt hat, stellt man fest, daß<br />
der Berg dahinter nicht etwa aufhört, sondern noch weiter ansteigt, in einem<br />
Winkel, der einem vorher verborgen geblieben war, und daß hinter diesem<br />
Hang der nächste Hang liegt, und dahinter noch einer und noch einer, und<br />
dahinter immer noch welche, bis es einem absolut unmöglich erscheint, daß<br />
der Berg sich so endlos lang hinziehen kann. Schließlich erreicht man ein<br />
Niveau, von dem aus man die Wipfel der am höchsten gelegenen Bäume<br />
erkennen kann, dahinter strahlend blauen Himmel, und das schwankende<br />
Gemüt des Wanderers richtet sich auf – endlich da! –, doch dann, welch<br />
gnadenlose Enttäuschung. Der Gipfel entzieht sich kontinuierlich immer um<br />
genau die Distanz, die man gerade zurückgelegt hat, so daß man jedesmal,<br />
wenn sich das Dach aus Bäumen vor einem weit genug öffnet, um einen<br />
Blick freizugeben, <strong>mit</strong> Bestürzung erkennt, daß die am höchsten gelegenen<br />
Bäume so fern, so unerreichbar sind wie zuvor. Trotzdem stapft man weiter.
Was bleibt einem anderes übrig?<br />
Wenn man dann, nach unendlich langer Zeit, in die wirklich höheren Gefilde<br />
kommt, wo die kühle Luft nach Harz duftet, die Vegetation knorrig und<br />
zäh und windgebeutelt ist, und man bis zur kahlen Bergspitze vorgedrungen<br />
ist, kann einem nichts mehr etwas anhaben. Man legt sich flach auf den<br />
Bauch, streckt alle viere von sich, wird von dem Gewicht des Rucksacks auf<br />
das abschüssige, gneisige Gestein gepreßt, verharrt einige Minuten in dieser<br />
Position und sinniert auf sonderbar distanzierte, außerkörperliche Weise<br />
darüber, daß man Flechten noch nie aus solcher Nähe betrachtet hat, überhaupt<br />
noch nie etwas Natürliches so nahe gesehen hat, seit man vier Jahre<br />
alt war und seine erste Lupe geschenkt bekommen hatte. Schließlich rollt<br />
man <strong>mit</strong> einem matten Schnaufer auf die Seite, schnallt den Rucksack ab,<br />
rappelt sich hoch und erkennt – auch dies wie benommen, als wäre man<br />
nicht ganz anwesend –, daß die Aussicht spektakulär ist: bewaldete Berge,<br />
so weit das Auge reicht, unberührt von Menschenhand, in alle Richtungen.<br />
Es könnte himmlisch sein. Es ist herrlich, keine Frage, aber es kommt einem<br />
der Gedanke, vor dem es kein Entrinnen gibt, daß man sich nämlich<br />
diesen Ausblick zu Fuß erobern mußte und daß das nur ein Bruchteil dessen<br />
ist, was man noch durchwandern muß, um bis ans Ziel zu gelangen.<br />
Man vergleicht die Karte <strong>mit</strong> der umliegenden Landschaft und stellt fest,<br />
daß der Pfad steil in ein Tal hinabgeht – eigentlich eine Schlucht, den<br />
Schluchten nicht unähnlich, in die der Kojote in den Roadrunner-<br />
Zeichentrickfilmen immer abtaucht, Schluchten, deren Tiefpunkte sich im<br />
Nichts verlieren – und einen an den Fuß eines Berges bringt, der noch steiler<br />
und gewaltiger ist als der, auf dem man steht, und daß man seit dem<br />
Frühstück 2,73 Kilometer zurückgelegt haben wird, wenn dieser unsäglich<br />
beschwerliche Gipfel erklommen ist, während der Plan, den man sich zu<br />
Hause am Küchentisch so schön zurechtgelegt und nach höchstens drei<br />
Sekunden des Nachdenkens aufgeschrieben hatte, bis zum Mittagessen<br />
14,32 Kilometer, bis zum Abendessen glatte 27 Kilometer und für morgen<br />
noch größere Entfernungen vorsieht.<br />
Aber vielleicht regnet es ja auch, einen kalten, peitschenden, erbarmungslosen<br />
Regen, <strong>mit</strong> Blitz und Donner, der sich bereits auf den benachbarten<br />
Bergen austobt. Vielleicht kommt ein Zug Pfadfinder in einem<br />
niederschmetternden Tempo vorbei. Vielleicht friert man und hat Hunger<br />
und stinkt so erbärmlich, daß man sich selbst nicht mehr riechen kann. Vielleicht<br />
will man sich einfach nur hinlegen und es den Flechten gleichtun,<br />
nicht unbedingt tot sein, aber ruhen, lange ausruhen, ganz lange ausruhen.<br />
Aber das lag alles noch vor mir. Heute brauchte ich auf einer gut markierten<br />
Strecke von 11,2 Kilometern nur vier <strong>mit</strong>telmäßig hohe Berge bei klarem,<br />
trockenen Wetter zu überqueren. Das war doch wohl nicht zuviel verlangt.
Im Gegenteil. Es war zu viel verlangt. Es war die Hölle.<br />
Ich weiß nicht mehr genau, wann ich Katz aus den Augen verlor, aber es<br />
war schon nach wenigen Stunden. Zuerst hatte ich immer noch gewartet, bis<br />
er aufgeholt hatte. Er fluchte bei jedem Auftreten, blieb nach drei, vier<br />
schlurfenden Schritten stehen, wischte sich die Stirn und sah verdrießlich<br />
auf die nächsten paar Meter, die un<strong>mit</strong>telbar vor ihm lagen. Es war schwer<br />
auszuhalten, in jeder Beziehung. Schließlich wartete ich nur noch ab, bis er<br />
ins Blickfeld rückte, um sicherzugehen, daß er auch nachkam, nicht irgendwo<br />
zitternd am Wegesrand lag oder seinen Rucksack angewidert weggeworfen<br />
und sich auf die Suche nach Wes Wisson gemacht hatte. Ich wartete<br />
und wartete, bis endlich seine Gestalt zwischen den Bäumen auftauchte.<br />
Er japste, bewegte sich <strong>mit</strong> unendlicher Langsamkeit fort und schimpfte laut<br />
<strong>mit</strong> sich selbst. Auf halbem Weg zu unserem dritten Berg, dem l .036 Meter<br />
hohen Black Mountain, blieb ich nochmals stehen, wartete wieder sehr<br />
lange und überlegte, ob ich zurückgehen sollte, aber dann ließ ich es bleiben<br />
und kämpfte mich weiter vorwärts.<br />
11,2 Kilometer hört sich wenig an, aber das ist es keineswegs, glauben Sie<br />
mir. Die Entfernung <strong>mit</strong> Rucksack zu gehen ist selbst für trainierte Menschen<br />
nicht ganz einfach. Kennen Sie das: Sie sind im Zoo oder in irgendeinem<br />
Vergnügungspark, <strong>mit</strong> einem kleinen Kind, das keinen Fuß mehr vor<br />
den anderen setzen will?<br />
Man nimmt es <strong>mit</strong> Schwung auf die Schultern und eine Zeitlang, ein paar<br />
Minuten vielleicht, macht es sogar Spaß, den kleinen Kerl da oben sitzen zu<br />
haben, zu spielen, man würde ihn fallenlassen, oder einen niedrigen Durchgang<br />
<strong>mit</strong> ihm anzusteuern, wo er sich unweigerlich den Kopf stoßen würde,<br />
um im allerletzten Moment auszuweichen. Doch dann wird es allmählich<br />
ungemütlich. Man spürt ein Stechen im Nacken, eine Verspannung zwischen<br />
den Schulterblättern, und der zuerst noch leichte Schmerz sickert<br />
tiefer, breitet sich aus, bis es richtig unangenehm wird, und Sie verkünden<br />
dem kleinen Jimmy, daß Sie ihn mal absetzen müssen, Jimmy ist bockig<br />
und will keinen Schritt weitergehen, und Ihre Frau sieht Sie <strong>mit</strong> einem geringschätzigen<br />
Blick an. »Hätte ich doch bloß einen Footballspieler geheiratet«,<br />
scheint sie zu sagen, denn Sie sind keine 400 Meter weit gegangen.<br />
»Kannst du das nicht verstehen? Es tut weh. Sehr sogar.« – »Ja ja, ist gut.<br />
Ich verstehe schon.«<br />
Und nun stellen Sie sich zwei kleine Jimmies in einem Sack auf Ihrem Rükken<br />
vor, oder noch besser, etwas Träges und Schweres, etwas, das nicht<br />
hochgehoben werden will, das einem, sobald man es berührt, unmißverständlich<br />
zu verstehen gibt, daß es lieber auf dem Boden hocken bleiben<br />
will, sagen wir, ein Zementsack oder eine Kiste <strong>mit</strong> medizinischer Fachliteratur,<br />
jedenfalls eine 20 Kilo schwere Last. Stellen Sie sich vor, wie der
Sack an Ihnen zerrt, ähnlich der Zugkraft eines abwärts fahrenden Aufzugs.<br />
Stellen Sie sich vor, Sie gingen <strong>mit</strong> diesem Gewicht auf dem Rücken stundenlang,<br />
tagelang zu Fuß, und Sie gingen nicht auf einer asphaltierten Straße<br />
<strong>mit</strong> Bänken und Imbißbuden, die in rücksichtsvoll angemessenen Abständen<br />
aufgestellt sind, sondern auf einem rauhen Weg, gespickt <strong>mit</strong><br />
scharfkantigen Steinen und starren Wurzeln und schwindelerregenden Anstiegen,<br />
die allesamt Ihren zarten, zittrigen Schenkeln ungeheure Strapazen<br />
abverlangen. Beugen Sie nun den Kopf nach hinten, bis sich Ihr Nacken<br />
verspannt, und visieren Sie einen Punkt in drei Kilometern Entfernung an.<br />
Das ist Ihr erster Aufstieg. Bis zum Gipfel sind es steile 1.427 Meter, und<br />
von dem Kaliber kommen noch einige Gipfel. Jetzt erzählen Sie mir nicht,<br />
11,2 Kilometer seien nicht viel. Und noch etwas. Sie müssen ja nicht. Ich<br />
meine, wir sind hier nicht bei der Armee. Sie können sofort umkehren.<br />
Nach Hause gehen. Zu Ihrer Familie. Im eigenen Bett schlafen.<br />
Oder aber – Sie können es sich aussuchen, Sie bedauernswerter, armer kleiner<br />
Kerl – Sie laufen 3.500 Kilometer durch die Wildnis und über Berge bis<br />
nach Maine. Und so trottete ich weiter, Stunde um Stunde, unter viel Weh<br />
und Ach, imposante Berge rauf und runter, an endlosen Reihen hoch aufragender<br />
Bäume vorbei, die unbeweglich, wie Gäste auf einer Cocktailparty,<br />
dastanden, und die ganze Zeit dachte ich: Langsam müßte ich die elf Kilometer<br />
geschafft haben. Aber nie hörte der Wanderpfad auf.<br />
Um halb vier erklomm ich einige in Stein gehauene Stufen und befand mich<br />
auf einem breiten Aussichtsfelsen: der Gipfel des Springer Mountain. Ich<br />
warf meinen Rucksack ab und plumpste gegen einen Baum, überrascht von<br />
dem Ausmaß meiner Erschöpfung. Die Aussicht war bezaubernd – die geschwungenen<br />
Hügel der Cohutta Mountains, von einem bläulichen Dunstschleier<br />
umfangen, wie Zigarettenrauch, der sich am fernen Horizont verliert.<br />
Die Sonne stand bereits niedrig am Himmel. Ich ruhte mich ein paar<br />
Minuten aus, stand dann auf und sah mich um. An einem Stein war eine<br />
Bronzeplatte befestigt, die den Ausgangspunkt des Appalachian Trail anzeigte,<br />
und unweit davon war auf einem Pfahl ein Holzkasten montiert, in<br />
dem ein an einem Bindfaden befestigter Kugelschreiber lag, dazu ein Notizblock,<br />
dessen Seiten sich von der Feuchtigkeit wellten. Der Notizblock war<br />
das Gipfelbuch, das Trail Register – eigentlich hatte ich ein ledergebundenes,<br />
irgendwie prächtiges Buch erwartet –, und es war vollgekritzelt <strong>mit</strong><br />
hoffnungsfrohen Einträgen, fast alleinjugendlicher Handschrift. Seit dem<br />
ersten Januar gab es etwa 25 Einträge, allein acht am heutigen Tag. Die<br />
meisten waren in Eile hingeworfen und klangen munter – »2. März. Da sind<br />
wir! Ganz schön kalt hier! Man sieht sich auf dem Katahdin. Jamie und<br />
Spud.« Ungefähr ein Drittel war länger und besinnlicher, versehen <strong>mit</strong> Botschaften<br />
wie dieser: »Da bin ich endlich auf dem Springer. Ich weiß nicht,
was mir die kommenden Wochen noch bescheren werden, aber mein Glaube<br />
an Gott ist stark, und ich weiß die Liebe und Hilfe meiner Familie hinter<br />
mir. Mom und Pookie, diese Wanderung mach ich für euch«, und so weiter.<br />
Ich wartete eine Dreiviertelstunde lang auf Katz, dann machte ich mich auf<br />
die Suche nach ihm. Das Licht schwand bereits, und in die Luft mischte<br />
sich abendliche Kühle. Ich lief und lief den Hang hinunter, durch die endlosen<br />
Waldungen, betrat wieder Boden, den ich für immer hinter mich gebracht<br />
zu haben glaubte, Ich rief mehrmals seinen Namen und lauschte,<br />
nichts. Ich ging weiter, über gestürzte Bäume, über die ich bereits Stunden<br />
zuvor geklettert war, Abhänge hinunter, an die ich mich kaum mehr erinnerte.<br />
Den Weg hätte meine Oma auch noch geschafft, dachte ich immer<br />
bei mir. Schließlich kam ich an eine Biegung, und da war er, torkelte mir<br />
entgegen, <strong>mit</strong> zerzaustem Haar, nur einem Handschuh, und kurz vor einem<br />
hysterischen Anfall, wie ich ihn noch nie bei einem erwachsenen Menschen<br />
erlebt hatte.<br />
Es war nicht einfach, ihm die Geschichte als zusammenhängendes Ganzes<br />
zu entlocken, weil er so zornig war, aber aus dem, was er erzählte, konnte<br />
ich entnehmen, daß er in einem Anfall viele Sachen aus seinem Rucksack<br />
einen Abhang hinuntergeworfen hatte. Alles, was außen am Sack gebaumelt<br />
hatte, war weg.<br />
»Was hast du denn über Bord geworfen?« fragte ich ihn, ohne meine Besorgnis<br />
allzu deutlich durchklingen zu lassen.<br />
»Das schwere Zeug. Was sonst. Die Salami, den Reis, den braunen Zucker,<br />
das Büchsenfleisch, was weiß ich nicht alles. Eine ganze Menge. Scheißkram.«<br />
Katz versteifte sich richtig vor lauter Mißmut. Er führte sich auf, als<br />
hätte der Appalachian Trail ihn schmählich verraten. Ich vermute, er entsprach<br />
nicht dem, was er erwartet hatte.<br />
Ich entdeckte seinen zweiten Handschuh etwa 30 Meter hinter ihm auf dem<br />
Boden und ging hin, um ihn aufzuheben.<br />
»Na dann los«, sagte ich, »es ist sowieso nicht mehr weit.«<br />
»Wie weit?«<br />
»Ungefähr anderthalb Kilometer.«<br />
»Scheiße«, sagte er verbittert.<br />
»Gib mir deinen Rucksack.« Ich schnallte ihn mir auf den Rücken. Er war<br />
nicht gerade leer, aber er war entschieden leichter als vorher. Weiß der<br />
Himmel, was er alles rausgeworfen hatte.<br />
Wir stapften in der sich ausbreitenden Dämmerung den Berg hinauf bis zum<br />
Gipfel. Ein paar hundert Meter unterhalb des Gipfels befanden sich auf<br />
einer großen freien Rasenfläche, vor einem finsteren Wald ein Zeltplatz und<br />
eine Schutzhütte aus Holz. Es waren viele Leute da, mehr als ich zu Saisonbeginn<br />
erwartet hatte. Die Schutzhütte, eher ein Unterstand aus drei Seiten-
wänden und einem Schrägdach, war schon überfüllt, und auf dem Platz<br />
standen verstreut etwa zwölf Zelte. Überall hörte man das Zischen der kleinen<br />
Campingkocher, Rauchfäden stiegen auf, es roch nach Essen, und dazwischen<br />
bewegten sich junge, gelenkige Menschen.<br />
Ich suchte uns eine Stelle am Rand der Lichtung, etwas abseits, fast unter<br />
den Bäumen.<br />
»Ich weiß nicht, wie man ein Zelt aufschlägt«, sagte Katz in gereiztem Tonfall.<br />
»Dann schlage ich es für dich auf.« Du weiches, schwabbliges Riesenbaby<br />
Plötzlich war ich nur noch müde.<br />
Katz saß auf einem Baumstamm und sah zu, wie ich sein Zelt aufstellte. Als<br />
ich fertig war, schob er seine Iso-Matte und den Schlafsack hinein und<br />
kroch dann selbst hinterher. Ich machte mich an mein eigenes Zelt und<br />
baute mir umständlich mein kleines Nest. Nach getaner Arbeit richtete ich<br />
mich auf und stellte fest, daß sich im Nachbarzelt nichts mehr rührte.<br />
»Bist du schon im Bett?« fragte ich entgeistert.<br />
»Mhm«, brummte er bestätigend.<br />
»Und das war’s? Ziehst dich einfach so zurück? Ohne Abendessen?«<br />
»Mhm.«<br />
Ich blieb minutenlang stehen, sprachlos, verwirrt, zu müde, um mich beleidigt<br />
zu fühlen, sogar zu müde, um meinen eigenen Hunger zu spüren. Ich<br />
krabbelte in mein Zelt, holte eine Wasserflasche und ein Buch aus dem<br />
Rucksack, legte mir zur nächtlichen Verteidigung und Beleuchtung Messer<br />
und Taschenlampe bereit und streckte mich schließlich in meinem Schlafsack<br />
aus dankbarer denn je, in der Waagerechten zu sein. Ich war nach wenigen<br />
Sekunden weggetreten. Ich glaube, ich habe noch nie so gut geschlafen.<br />
Als ich aufwachte, war es taghell. Die Innenseite meines Zeltes war <strong>mit</strong><br />
einem merkwürdigen, flockigen Reif beschichtet, der, wie mir nach einiger<br />
Überlegung klar wurde, der Niederschlag meines nächtlichen Schnarchens<br />
sein mußte, kondensiert, gefroren und ans Zeltdach geklebt, wie in einem<br />
Tage- oder besser Nachtbuch der Atmungserinnerungen. Meine Wasserflasche<br />
war ebenfalls gefroren. Das schien mir etwas für echte Machos zu<br />
sein, und ich untersuchte sie interessiert, wie ein seltenes Stück Erz. Es war<br />
erstaunlich gemütlich in meinem Schlafsack, und ich hatte es wahrlich nicht<br />
eilig, die Torheit zu begehen, gleich wieder Berge hochzukraxeln, deswegen<br />
blieb ich liegen, wie unter dem strengsten Befehl, mich nicht zu rühren.<br />
Nach einer Weile nahm ich wahr, daß Katz bereits draußen rumorte, leise<br />
stöhnend, wie vor Schmerz, und irgend etwas machte, was sich unwahrscheinlich<br />
geschäftig anhörte.
Nach ein, zwei Minuten kam er an und hockte sich neben mein Zelt, seine<br />
Gestalt fiel als dunkler Schatten auf die Zeltwand. Ohne mich zu fragen, ob<br />
ich wach sei oder nicht, erkundigte er sich <strong>mit</strong> leiser Stimme: »Sag mal,<br />
habe ich mich gestern abend wie ein Schwein benommen?«<br />
»Das könnte man so sagen.«<br />
Er war einen Moment lang still. »Ich koche Kaffee.« Ich glaube, das war<br />
seine Form der Entschuldigung.<br />
»Das ist nett.«<br />
»Ziemlich kalt hier draußen.«<br />
»Hier drin auch.«<br />
»Meine Wasserflasche ist gefroren.«<br />
»Meine auch.«<br />
Ich schlüpfte aus meinem Nylonbauch heraus und kroch <strong>mit</strong> knackenden<br />
Gelenken aus dem Zelt. Es war ein komisches Gefühl und sehr neuartig, <strong>mit</strong><br />
langen Unterhosen draußen im Freien zu stehen. Katz beugte sich über den<br />
Kocher und hatte einen Topf Wasser aufgesetzt.<br />
Anscheinend waren wir die ersten Camper, die wach waren. Es war kalt,<br />
aber doch eine Idee wärmer als gestern, und die niedrige Sonne, die zwischen<br />
den Bäumen hervorschimmerte, stimmte verhalten optimistisch.<br />
»Wie geht es dir?« sagte er.<br />
Ich beugte probeweise die Knie. »Eigentlich gar nicht so schlecht.«<br />
»Mir auch.«<br />
Er goß Wasser in den Filter. »Ich bin auch ganz lieb heute«, versprach er.<br />
»Gut.« Ich sah ihm über die Schulter. »Gibt es einen Grund«, fragte ich,<br />
»warum du den Kaffee durch Klopapier filterst?«<br />
»Ich…. ach…. ich habe die Filtertüten weggeworfen.«<br />
Mir entwich ein mißglücktes Lachen. »Die können doch höchstens ein paar<br />
Gramm gewogen haben.«<br />
»Ich weiß, aber man konnte so schön da<strong>mit</strong> werfen. Sie flatterten durch die<br />
Luft.« Er goß ein bißchen Wasser nach.<br />
»Mit Klopapier funktioniert es auch ganz gut.«<br />
Wir sahen zu, wie das Wasser durchtröpfelte und waren irgendwie stolz.<br />
Unser erstes Selbstgekochtes in der Wildnis. Er reichte mir einen Becher<br />
Kaffee. Es schwammen reichlich Pulver und kleine, rosa Papierschnipsel<br />
drin herum, dafür war er siedend heiß, das war die Hauptsache.<br />
Er sah mich entschuldigend an. »Den braunen Zucker habe ich auch weggeworfen,<br />
wir müssen unsere Haferflocken also ohne Zucker essen.«<br />
Ach so. »Wir müssen unsere Haferflocken sogar ohne Haferflocken essen.<br />
Die habe ich nämlich in New Hampshire gelassen.«<br />
»Wirklich?« sagte er und fügte hinzu, als wäre es nur fürs Protokoll: »Dabei<br />
esse ich Haferflocken so gerne.«
»Wie war’s <strong>mit</strong> etwas Käse zum Kaffee?«<br />
Er schüttelte den Kopf. »Weggeworfen.«<br />
»Erdnüsse?«<br />
»Weggeworfen.«<br />
»Büchsenfleisch?«<br />
»Das habe ich erst recht weggeworfen.«<br />
Die Sache nahm allmählich bedrohliche Ausmaße an. »Und die Mortadella?«<br />
»Ach die? Die habe ich in Amicalola gegessen«, sagte er, als wäre das bereits<br />
Wochen her, und ergänzte dann in einem Tonfall, als mache er da<strong>mit</strong><br />
ein edelmütiges Zugeständnis: »Mir reichen eine Tasse Kaffee und ein paar<br />
Little Debbies.«<br />
Ich verzog leicht das Gesicht. »Die Little Debbies habe ich auch zu Hause<br />
gelassen.«<br />
Seine Augen weiteten sich. »Das kann nicht dein Ernst sein.«<br />
Ich nickte reumütig.<br />
»Alle?«<br />
Ich nickte noch mal.<br />
Er stöhnte schwer. Das war ein harter Schlag, eine ernste Herausforderung<br />
seines versprochenen Gleichmuts – wenn nicht« mehr. Wir beschlossen eine<br />
Inventur vorzunehmen. Wir räumten eine kleine Fläche auf dem Zeltboden<br />
frei und warfen unsere Verpflegung zusammen. Sie war erschreckend dürftig<br />
– Nudeln, eine Packung Reis, Rosinen, Kaffee, Salz, diverse Schokoriegel<br />
und Klopapier. Das war alles.<br />
Wir frühstückten ein Snickers, tranken unseren Kaffee aus, bauten unser<br />
Lager ab, hievten unsere Rucksäcke auf den Rücken – nicht ohne dabei zur<br />
Seite zu stolpern – und machten uns wieder auf den Weg.<br />
»Ich fasse es nicht – da läßt der Kerl die Little Debbies zu Hause!« sagte<br />
Katz und war bereits nach wenigen Metern wieder zurückgefallen.
4. Kapitel<br />
Der Wald ist nicht wie andere natürliche Räume. Zunächst einmal ist er<br />
kubisch, das heißt, die Bäume umgeben uns, überragen uns, bedrängen uns<br />
von allen Seiten. Der Wald versperrt uns die Sicht, er läßt uns orientierungslos,<br />
und er verwirrt uns. Er macht uns klein und verlegen und verletzlich,<br />
wie ein Kind, das sich in einer Menschenmenge, zwischen lauter fremden<br />
Beinen, verirrt hat. In der Wüste, in der Steppe wissen wir, daß wir uns in<br />
einem großen, offenen Raum befinden. Im Wald spüren wir diesen Raum<br />
nur. Der Wald ist ein riesiges, konturloses Nirgendwo. Und der Wald lebt.<br />
Der Wald ist gespenstisch. Abgesehen davon, daß wilde Tiere in ihm hausen<br />
können und bewaffnete, genetisch gesehen unvollkommene Zweibeiner,<br />
die Zeke oder Festus heißen, ist ihm etwas Finsteres eigen, etwas Unbeschreibliches,<br />
das uns <strong>mit</strong> jedem Schritt eine Atmosphäre der Bedrohung<br />
spüren läßt und uns überdeutlich zu verstehen gibt, daß wir uns nicht in<br />
unserem Element befinden und besser die Ohren spitzen. Obwohl wir uns<br />
einreden, daß es absurd ist, werden wir das Gefühl nicht los, beobachtet zu<br />
werden. Wir sagen uns: Ruhig bleiben, es ist schließlich nur ein Wald, meine<br />
Güte, aber in Wirklichkeit sind wir fickriger als ein Bankräuber <strong>mit</strong> gezogener<br />
Pistole. Bei jedem plötzlichen Geräusch – dem krachenden Lärm<br />
eines herabfallenden Astes, dem Vorbeihuschen eines aufgescheuchten<br />
Rehs – geraten wir ins Rotieren und schicken ein Stoßgebet zum Himmel,<br />
welcher Mechanismus im Körper auch immer für die Adrenalinproduktion<br />
verantwortlich ist, in diesem Moment funktioniert er wie geschmiert, noch<br />
nie war er so versessen darauf, einen heißen Schub dieses Saftes auszustoßen.<br />
Selbst im Schlaf sind wir angespannt wie ein Flitzbogen.<br />
In Amerika hat der Wald die Menschen 300 Jahre lang eingeschüchtert. Der<br />
unsägliche Tugendbold und Langweiler Henry David Thoreau fand alle<br />
Natur prächtig, solange eine Stadt in der Nähe war, wo er Kuchen und Gerstensaft<br />
kaufen konnte, aber als er 1846 bei einem Ausflug auf den Katahdin<br />
einmal echte Wildnis erlebte, war es bis ins Mark erschüttert. Das war<br />
nicht die zahme Welt der verwunschenen Obstgärten im kleinen Vorort von<br />
Concord, Massachusetts, sondern es war das abschreckende, bedrückende,<br />
urzeitliche Land, »grimmig und wild… pri<strong>mit</strong>iv und trüb«, nur für »Menschen<br />
gemacht, die Steinen und wilden Tieren verwandter sind als unsereinem«.<br />
Diese Erfahrung hat ihn, um <strong>mit</strong> den Worten eines Biographen zu<br />
sprechen, »an den Rand des Wahnsinns« gebracht.<br />
Aber selbst hartgesottenere, dem Leben in der Wildnis angepaßtere Männer<br />
als Thoreau ließen sich von der eigentümlichen, fast greifbaren Bedrohung<br />
einschüchtern. Daniel Boone, der sich nicht nur Faustkämpfe <strong>mit</strong> Bären<br />
lieferte, sondern auch <strong>mit</strong> deren Weibchen anbändelte, beschreibt einige
Gegenden in den südlichen Appalachen als »so wild und grauenhaft, daß<br />
man nicht ohne Erschauern davon berichten kann«. Und wenn schon Daniel<br />
Boone Muffensausen kriegt, sollte man sich besser vorsehen.<br />
Als die ersten Europäer in die Neue Welt kamen, gab es in dem Gebiet, das<br />
später als die »Lower 48« bezeichnet wurde, also dem nordamerikanischen<br />
Kontinent <strong>mit</strong> Ausnahme von Alaska, knapp 385 Millionen Hektar bewaldete<br />
Fläche. Der Chattahoochee Forest, durch den Katz und ich gerade<br />
trotteten, gehörte zu einem riesigen geschlossenen Baumbestand, der vom<br />
südlichen Alabama bis nach Kanada reichte, und noch weiter, von der At-<br />
lantikküste bis zum fernen Grasland entlang des Missouri River.<br />
Der größte Teil dieses Waldgebietes ist heute verschwunden, aber was geblieben<br />
ist, ist eindrucksvoll genug. Der Chattahoochee gehört zu einem 1,6<br />
Millionen Hektar – 16.000 Quadratkilometer – großen Staatsforst, der sich<br />
bis zu den Great Smoky Mountains und über vier Bundesstaaten erstreckt.<br />
Auf einer Karte der Vereinigten Staaten stellt er nur einen unbedeutenden<br />
grünen Fleck dar, erst zu Fuß erschließen sich seine kolossalen Ausmaße. In<br />
vier Tagen würden Katz und ich den nächsten Highway überqueren und erst<br />
in einer Woche wieder in eine Stadt kommen.<br />
Und so wanderten wir los. Wir wanderten Berge hinauf, durch verlassene<br />
Senken, entlang einsamer Gebirgskämme, <strong>mit</strong> Aussicht auf noch mehr Gebirgskämme,<br />
über grasgrüne, kahle Bergkuppen, steinige, sich windende,<br />
nervenaufreibende Abstiege hinunter und Kilometer um Kilometer durch<br />
dunklen, tiefen, einsamen Wald, auf dem knapp einen halben Meter breiten<br />
Wanderpfad, der durch weiße, rechteckige Markierungen angezeigt wurde –<br />
ein Balken, fünf Zentimeter hoch, 15 Zentimeter lang –, die in regelmäßigen<br />
Abständen in die graue Borke der Bäume geschnitzt waren. Wir wanderten<br />
und wanderten.<br />
Im Vergleich zu den meisten anderen Ländern der entwickelten Welt ist<br />
Amerika immer noch zu einem erstaunlichen Teil ein Land der Wälder. Ein<br />
Drittel der Landfläche des nordamerikanischen Kontinents, Alaska ausgenommen,<br />
ist <strong>mit</strong> Bäumen bewachsen, 295 Millionen Hektar insgesamt.<br />
Allein Maine hat über vier Millionen Hektar unbewohntes Land. Das sind<br />
mehr als 40.000 Quadratkilometer, ein Gebiet, das um einiges größer ist als<br />
Belgien, ohne einen einzigen Bewohner. Nur zwei Prozent der Vereinigten<br />
Staaten werden als baulich erschlossen eingestuft.<br />
Etwa 97 Millionen Hektar der amerikanischen Wälder gehören dem Staat.<br />
Der größte Anteil davon, 77 Millionen Hektar, verteilt auf 155 Parzellen,<br />
wird vom U.S. National Forest Service unterhalten und steht je nachdem<br />
unter Verwaltung der National Forests, der National Grasslands oder der<br />
National Recreation Areas. Das hört sich an, als sei es unberührtes Land,<br />
ganz im Sinne der Ökologie, aber in Wahrheit sind weite Teile des Wald-
gebietes des Forest Service zur Mischnutzung ausgewiesen, was großzügig<br />
interpretiert wird und alle möglichen Aktivitäten erlaubt: Bergbau; Öl- und<br />
Gasgewinnung; Wintersport (137 Orte); Bau von Eigentumsanlagen;<br />
Schneemobil- und Geländewagenrennen und natürlich jede Menge Holzwirtschaft<br />
– lauter Dinge, die <strong>mit</strong> der Ruhe des Waldes eigentlich unvereinbar<br />
sind.<br />
Der Forest Service ist wirklich eine höchst erstaunliche Institution. Viele<br />
Menschen sehen das Wort Forest im Namen und vermuten, dahinter verberge<br />
sich die Sorge um Bäume. Tatsächlich verhält es sich anders, obwohl die<br />
Pflege des Waldes der ursprüngliche Gedanke war. Vor 100 Jahren, als die<br />
Abholzung amerikanischer Wälder alarmierende Ausmaße annahm, wurde<br />
der Service als eine Art »Waldbank« eingerichtet, als dauerhaftes Depot für<br />
amerikanisches Nutzholz. Der Auftrag lautete: Nutzung und Schonung<br />
dieser Ressourcen für das Land. An Nationalparks war dabei nicht gedacht.<br />
Privatfirmen sollten die Genehmigung bekommen, Erze abzubauen und<br />
Holzwirtschaft zu betreiben, wurden aber angehalten, dies nur in begrenztem<br />
Umfang und auf intelligente und nachhaltige Weise zu tun.<br />
Wo<strong>mit</strong> sich der Forest Service hauptsächlich beschäftigt, ist der Straßenbau.<br />
Das ist kein Witz! Durch die amerikanischen Staatsforste führen Straßen in<br />
einer Gesamtlänge von 608.315 Kilometern. Die Zahl sagt vielleicht nicht<br />
viel aus, aber man kann es auch so sehen: Das Netz ist achtmal so groß wie<br />
das gesamte amerikanische System der Interstate Highways. Es ist das größte<br />
Straßennetz der Welt, das in der Hand eines einzelnen Betreibers hegt.<br />
Der Forest Service beschäftigt im Vergleich zu allen anderen staatlichen<br />
Institutionen auf der Erde die zweitgrößte Anzahl an Straßenbauingenieuren.<br />
Die Aussage, daß diese Leute gerne Straßen bauen, hieße, das Maß<br />
ihrer Hingabe auf charmante Weise untertreiben. Zeigt man ihnen einen<br />
idyllischen Wald, ganz egal wo, werden sie ihn ausgiebig und nachdenklich<br />
in Augenschein nehmen und zum Schluß sagen: »Hier könnte man gut eine<br />
Straße bauen.« Es ist erklärtes Ziel des U.S. Forest Service, bis Mitte des<br />
nächsten Jahrhunderts weitere 933.400 Straßenkilometer durch Waldgebiet<br />
anzulegen.<br />
Der Grund warum der Forest Service diese Straßen baut, abgesehen von der<br />
tiefen Befriedigung, die es den Männern bereitet, <strong>mit</strong> großen Maschinen<br />
möglichst viel Krach im Wald zu machen, liegt darin, daß der privaten<br />
Holzindustrie Zugang zu vorher unerreichbaren Baumbeständen verschafft<br />
werden soll. Von den 60 Millionen Hektar verwertbaren Waldgebiets des<br />
Forest Service sind zwei Drittel für die zukünftige Nutzung reserviert. Das<br />
übrige Drittel – 19 Millionen Hektar, eine Fläche, doppelt so groß wie Ohio<br />
– ist zur Rodung bestimmt. Das ermöglicht den Kahlschlag ganzer, geschlossener<br />
Waldgebiete. Das schließt, um nur ein besonders erschrecken-
des Beispiel zu nennen, auch 84 Hektar eines Bestands von tausendjährigen<br />
Redwoods im Umpqua National Forest in Oregon ein.<br />
1987 gab der Forest Service bekannt, er werde der privaten Holzindustrie ab<br />
sofort erlauben, jährlich Hunderte Hektar Baumbestand aus der uralten<br />
grünen Lunge des Pisgah National Forest, gleich neben dem Great Smoky<br />
Mountams National Park, abzuholzen. Dies sollte zu 80 Prozent nach Methoden<br />
der »wissenschaftlichen Forstwirtschaft« geschehen, wie man es<br />
delikaterweise nannte. Gemeint ist da<strong>mit</strong> Kahlschlag, was nicht nur eine<br />
Beleidigung fürs Auge, sondern ein brutaler Eingriff in die Landwirtschaft<br />
darstellt und große Überschwemmungen auslösen kann, die den Boden<br />
zerfurchen, ihm Nährstoffe entziehen und das ökologische Gleichgewicht<br />
weiter stromabwärts zerstören, manchmal auf eine Länge vom mehreren<br />
Kilometern. Das hat <strong>mit</strong> Wissenschaft nichts mehr zu tun. Das ist Waldfrevel.<br />
Trotzdem schleift der Forest Service weiter. Ende der 80er Jahre – es ist so<br />
abwegig, daß man es kaum aussprechen mag -war er der einzige ernstzunehmende<br />
Vertreter der amerikanischen Holzindustrie, der schneller <strong>mit</strong><br />
dem Abholzen war als <strong>mit</strong> der Wiederaufforstung. Und das <strong>mit</strong> einer grandiosen<br />
Ineffizienz. 80 Prozent seiner Leasingunternehmen machten Verluste,<br />
häufig riesige Summen. In einem typischen Fall verkaufte der Forest<br />
Service hundertjährige Murrays-Kiefern im Targhee National Forest in<br />
Idaho für zwei Dollar pro Stamm, nachdem er umgerechnet vier Dollar pro<br />
Stamm für Landvermessungen, Vertragsakquisition und – wie könnte es<br />
anders sein – Straßenbau ausgegeben hatte. Zwischen 1989 und 1997 verlor<br />
der Forest Service durchschnittlich 242 Millionen Dollar pro Jahr – nach<br />
den Berechnungen der Wilderness Society alles in allem fast zwei Milliarden<br />
Dollar. Das ist dermaßen niederschmetternd, daß ich es lieber dabei<br />
bewenden lassen und mich wieder unseren beiden, durch die verlorene Welt<br />
des Chattahoochee stapfenden, einsamen Helden widmen möchte.<br />
Der Wald, den wir durchquerten, war eigentlich noch ein strammer Jüngling.<br />
1890 kam ein Eisenbahn-Magnat namens Henry C. Bagley aus Cincinnati<br />
in diesen Teil von Georgia, sah die verschiedenen stattlichen, nordamerikanischen<br />
Fichten und Pappeln und war so tief berührt von ihrer Erhabenheit<br />
und Vielfalt, daß er den Entschluß faßte, sie alle zu fällen. Sie waren ihr<br />
Geld wert. Außerdem würden sie die Schornsteine seiner Lokomotiven zum<br />
Rauchen bringen, wenn er das Holz in seine Fabriken im Norden des Landes<br />
schaffte. Diese Radikalkur verwandelte fast alle Berge im nördlichen<br />
Georgia im Laufe der folgenden 30 Jahreinsonnenbeschienene Haine aus<br />
Baumstümpfen. Bis 1920 hatten die Waldarbeiter 36 Millionen Festmeter<br />
Holz geschlagen. Erst 1930, <strong>mit</strong> Gründung des Chattahoochee Forest, wurde<br />
der Natur wieder zu ihrem Recht verhelfen.
In einem forstwirtschaftlich nicht genutzten Wald herrscht eine seltsame<br />
Atmosphäre der erstarrten Gewalt. Es schien so, als hätte jede Lichtung,<br />
jede Senke soeben eine grandiose Umwälzung erfahren. Alle 40 bis 50<br />
Meter lagen umgestürzte Bäume quer über dem Weg, die meisten hatten<br />
riesige Krater um die ausgerissenen Wurzeln herum hinterlassen; auf den<br />
Abhängen lagen noch mehr Bäume, die langsam verrotteten, und jeder dritte<br />
oder vierte Baum, so kam es mir vor, lehnte sich steil an seinen Nachbarn.<br />
Es war, als könnten sie es nicht erwarten umzustürzen, als bestünde ihr<br />
einziger Zweck im Universum darin, groß genug zu werden, um <strong>mit</strong> einem<br />
richtig satten Krachen umzufallen, so daß die Späne nur so flogen. Immer<br />
wieder kam ich an Bäumen vorbei, die sich so bedenklich <strong>mit</strong> ihrem ganzen<br />
Gewicht über den Weg beugten, daß ich zuerst zögerte, dann drunterherhuschte,<br />
jedesmal befürchtend, den falschen Moment erwischt zu<br />
haben und erschlagen zu werden, und mir dann Katz vorstellte, der wenige<br />
Minuten später vorbeikommen, sich meine verdrehten Beine ansehen und<br />
sagen würde: »Scheiße, <strong>Bryson</strong>, was machst du denn da unten?« Aber es<br />
fielen keine Bäume um. Der Wald blieb ruhig, unnatürlich still, und so war<br />
es fast überall. Außer dem gelegentlichen Glucksen eines Wasserlaufs und<br />
dem leisen Rascheln der vom Wind über den Boden gepusteten Blätter gab<br />
es fast kein Geräusch.<br />
Der Wald war deswegen so still, weil der Frühling noch nicht eingesetzt<br />
hatte. Normalerweise wären wir jetzt <strong>mit</strong>ten durch die reizvolle Pracht spaziert,<br />
die der Frühling in den Bergen im Süden <strong>mit</strong> sich bringt: eine strahlende,<br />
fruchtbare, wie neugeborene Welt, erfüllt vom Schwirren der Insekten<br />
und dem Gezwitscher aufgeregter Vögel, eine Welt, gewürzt von frischer,<br />
bekömmlicher Luft und dem samtigen, die Lungen erweiternden<br />
Geruch von Chlorophyll, den man einatmet, wenn man durch niedriges,<br />
blattreiches Gehölz streift. Vor allem aber gäbe es Wildpflanzen in Hülle<br />
und Fülle, die sich tapfer durch die fruchtbare Streu auf dem Waldboden<br />
hindurch dem Licht entgegenstreckten, jeden Sonnenhang und jede Uferböschungineinen<br />
Teppich verwandelten – Wachslilie, kriechende Heide, Doppelsporn,<br />
Zeichenwurz, Alraune, Veilchen, Kornblume, Butterblume und<br />
Blutkraut, Zwerglilie, Akelei, Sauerklee und andere unzählige, wundervolle<br />
Pflanzen. Es gibt 1.500 verschiedene Wildpflanzen in den südlichen Appalachen,<br />
40 seltene Arten allein im Norden von Georgia. Ihr Anblick erwärmt<br />
noch das kälteste Herz. In diesem grimmigen März jedoch war davon<br />
nichts zu sehen. Wir stapften durch eine kalte, stille Welt kahler Bäume,<br />
unter einem bleigrauen Himmel, über steinharten Boden.<br />
Nach einigen Tagen stellte sich ein gewisser Rhythmus ein. Wir standen<br />
jeden Morgen beim ersten Tageslicht auf, bibbernd, wärmten uns, kochten<br />
Kaffee, bauten unsere Zelte ab, aßen ein paar Handvoll Rosinen und bega-
en uns auf den Weg durch den stillen Wald. Wir wanderten von halb acht<br />
bis etwa vier Uhr. Wir gingen selten zusammen, unser Schrittempo paßte<br />
einfach nicht zueinander, aber alle paar Stunden ließ ich mich auf einem<br />
Baumstamm nieder – nicht ohne vorher die Umgebung nach Bären und<br />
Wildschweinen abgesucht zu haben – und wartete ab, bis Katz aufgeholt<br />
hatte, um sicher zu sein, daß auch alles in Ordnung war. Manchmal überholten<br />
mich Wanderer und sagten mir, an welcher Stelle Katz gerade war und<br />
welche Fortschritte er machte, er war fast immer langsamer, aber gut aufgelegt.<br />
Der Trail war für ihn sehr viel beschwerlicher als für mich, aber zu<br />
seinen Gunsten muß ich sagen, daß er sich <strong>mit</strong> Meckern zurückhielt. Ich<br />
vergaß keine Sekunde lang, daß er ja nicht hätte <strong>mit</strong>kommen müssen.<br />
Ich hatte gedacht, wir würden den Massen zuvorkommen, aber in der Region<br />
waren doch schon ziemlich viele Wanderer unterwegs – drei Studenten<br />
von der Rutgers University in New Jersey, ein erstaunlich sportliches älteres<br />
Ehepaar <strong>mit</strong> kleinen Tagesrucksäcken, das zur Hochzeit ihrer Tochter im<br />
fernen Virginia wollte, ein etwas unbedarftes Kerlchen namens Jonathan<br />
aus Florida – <strong>mit</strong> uns zusammen etwa ein Dutzend, die alle Richtung Norden<br />
zogen. Da jeder ein anderes Schrittempo hat und zu unterschiedlichen<br />
Zeiten Pausen einlegt, trifft man unweigerlich irgendwann auf einzelne oder<br />
auf alle Mitwanderer, besonders auf Berggipfeln <strong>mit</strong> Panoramablick, an<br />
Bächen <strong>mit</strong> sauberem Wasser und natürlich an den Schutzhütten, die in<br />
Abständen auf Lichtungen neben dem Trail stehen, angeblich, aber nicht<br />
unbedingt immer jeweils eine Tagesetappe voneinander entfernt. Auf diese<br />
Weise lernt man seine Mitwanderer kennen, wenigstens oberflächlich, noch<br />
besser natürlich, wenn man sie jeden Abend in den Schutzhütten wiedersieht.<br />
Man wird Teil eines bunt zusammengewürfelten Haufens, einer lokkeren,<br />
verständnisvollen Gemeinschaft von Leuten aller Altersgruppen und<br />
sozialen Schichten, die jedoch alle gleichermaßen Wind und Wetter, den<br />
Widrigkeiten des Wanderlebens und der Landschaft ausgesetzt sind, angetrieben<br />
von dem gleichen Impuls, bis nach Maine zu gehen.<br />
Selbst bei Hochbetrieb verschafft einem der Wald noch großartige Momente<br />
der Einsamkeit, und wenn ich stundenlang keine Menschenseele sah,<br />
spürte ich das erhebende Gefühl absoluten Alleinseins. Häufig wartete ich<br />
auf Katz, und es kam kein anderer Wanderer vorbei. Dann ließ ich meinen<br />
Rucksack stehen und ging zurück, um ihn zu suchen, nach ihm zu sehen,<br />
was ihn immer beruhigte. Manchmal winkte er mir schon von weitem <strong>mit</strong><br />
meinem Wanderstab, den ich an einem Baum abgestellt hatte, weil ich mir<br />
die Schuhe zugebunden oder die Tragegurte strammgezogen und ihn dann<br />
vergessen hatte. Wir sorgten füreinander. Das war wirklich schön. Ich kann<br />
es nicht anders sagen.<br />
Gegen vier Uhr suchten wir uns regelmäßig eine Stelle zum Zelten. Einer
ging los, um Wasser zu holen und es zu filtern, während der andere in einem<br />
Topf eine Pampe aus dampfenden Nudeln zubereitete. Manchmal redeten<br />
wir dabei, aber meistens verbrachten wir die Zeit in kameradschaftlichem<br />
Schweigen. Gegen sechs trieben uns die Dunkelheit, die Kälte und die<br />
Müdigkeit in unsere Zelte. Katz schlief jedesmal umgehend ein, soweit ich<br />
das beurteilen kann. Ich las immer noch ungefähr eine Stunde lang und<br />
hatte dafür die völlig untaugliche, kleine Stirnlampe aufgesetzt, deren Strahlen<br />
konzentrische Kreise auf die Buchseite warfen, wie eine Fahrradlampe.<br />
Weil ich das Buch schräg halten mußte, um das Licht einzufangen, wurde<br />
mir irgendwann an Schultern und Armen, die nicht im Schlafsack steckten,<br />
kalt, und sie wurden schwer. Ich blieb noch wach liegen und lauschte in der<br />
Finsternis den seltsam klaren, artikulierten Geräuschen des Waldes bei<br />
Nacht, dem Fegen und Seufzen des Windes, dem müden Stöhnen der sich<br />
wiegenden Äste, dem endlosen Gewese und Gemurmel, wie in einem Genesungsheim<br />
nach dem Lichtlöschen, bis ich selbst auch in einen tiefen Schlaf<br />
fiel. Morgens wachten wir bibbernd vor Kälte auf, wiederholten unsere<br />
kleinen Rituale, packten die Rucksäcke, setzten sie auf und wagten uns<br />
wieder in den großen undurchdringlichen Wald.<br />
Am vierten Abend lernten wir jemanden kennen. Wir waren gerade auf<br />
einer hübschen Lichtung neben dem Trail angekommen, hatten die Zelte<br />
aufgeschlagen, mampften unsere Nudeln, genossen das exquisite Vergnügen,<br />
nichts zu tun und nur herumzusitzen, als eine pummelige Frau <strong>mit</strong><br />
Brille und roter Jacke und dem unvermeidlichen überdimensionalen Rucksack<br />
des Weges kam. Sie musterte uns <strong>mit</strong> dem verkniffenen Blick eines<br />
Menschen, der entweder ständig konfus oder stark kurzsichtig ist. Wir grüßten<br />
einander und tauschten die üblichen Gemeinplätze über das Wetter und<br />
den ungefähren Standort aus. Dann kniff sie wieder die Augen zusammen,<br />
sah, daß die Dämmerung hereinbrach und verkündete, daß sie ihr Lager<br />
neben unserem aufschlagen werde.<br />
Sie hieß Mary Ellen und kam aus Florida. Sie war, wie Katz sie später immer<br />
wieder in ehrfurchtsvollem Ton titulierte, »ein harter Brocken«. Sie<br />
redete ununterbrochen, außer wenn sie ihre Ohrtrompete reinigte, was häufig<br />
genug geschah. Zu diesem Zweck hielt sie sich die Nase zu und stieß<br />
kräftig Luft aus, was <strong>mit</strong> einem kräftigen und höchst alarmierenden<br />
Schnauben verbunden war, bei dem jeder Hund vom Sofa gesprungen und<br />
sich unter dem Tisch im Nebenzimmer verkrochen hätte. Ich weiß längst,<br />
daß Gott in seinem Plan für mich vorgesehen hat, ich solle jeweils etwas<br />
Zeit <strong>mit</strong> den dümmsten Menschen der Welt verbringen, und Mary Ellen war<br />
der Beweis dafür, daß ich diesem Schicksal auch in den Wäldern der Appalachen<br />
nicht entkommen konnte. Es war von der ersten Sekunde an klar, daß
sie ein ganz besonders seltenes Exemplar dieser Gattung war.<br />
»Na, was gibt’s denn bei euch zu essen?« sagte sie, pflanzte sich auf einen<br />
freien Baumstamm und reckte den Hals, um einen Blickinden Topf werfen<br />
zu können. »Nudeln? Schwerer Fehler. Nudeln geben so gut wie keine Energie.<br />
Tendenz gegen Null.« Sie schnaubte wieder, um den Innendruck in<br />
den Ohren loszuwerden. »Ist das ein Zelt von Starship?«<br />
Ich sah hinüber zu meinem Zelt. »Ich weiß es nicht.«<br />
»Schwerer Fehler. Die haben dich bestimmt übers Ohr gehauen in dem<br />
Ausrüstungsladen. Wieviel hast du dafür bezahlt?«<br />
»Ich weiß es nicht.«<br />
»Auf jeden Fall zuviel. Du hättest dir ein Zelt besorgen sollen, das für drei<br />
Jahreszeiten geeignet ist.«<br />
»Das Zelt ist für drei Jahreszeiten geeignet.«<br />
»Entschuldige bitte, wenn ich das sage, aber es ist ausgesprochen dämlich,<br />
im März <strong>mit</strong> einem Zelt hierherzukommen, das nicht für drei Jahreszeiten<br />
geeignet ist.« Sie schnaubte wieder.<br />
»Das Zelt ist für drei Jahreszeiten geeignet.«<br />
»Du kannst von Glück sagen, daß du noch nicht erfroren bist. Geh zurück in<br />
den Laden und schlag den Kerl zusammen, der dir das angedreht hat, denn<br />
das war, sag ich mal, absolut unnötig, dir so’n Ding zu verkaufen.«<br />
»Glaub mir, das Zelt ist für drei Jahreszeiten gedacht.«<br />
Sie schnaubte und schüttelte ungeduldig den Kopf. »Das da ist ein Zelt für<br />
drei Jahreszeiten.« Sie zeigte auf das Zelt von Katz.<br />
»Das ist haargenau das gleiche Zelt.«<br />
Sie sah es sich nochmals an. »Ist ja auch egal. Wie viele Kilometer seid ihr<br />
heute gelaufen?«<br />
»Ungefähr 16.« Eigentlich waren es nur dreizehneinhalb, aber dazu gehörten<br />
einige knifflige Steilabbrüche, unter anderem eine höllische Wand,<br />
Preaching Rock, die höchste Erhebung nach Springer Mountain, für die wir<br />
uns <strong>mit</strong> einem Bonus in Form von erlassenen Kilometern belohnt hatten,<br />
aus moralischen Gründen.<br />
»16 Kilometer? Mehr nicht? Ihr müßt ja wirklich in ganz schön schlechter<br />
Verfassung sein. Ich bin 22 Komma acht Kilometer gelaufen.«<br />
»Und wieviel hat dein Mundwerk zurückgelegt?« sagte Katz und schaute<br />
von seinem Teller Nudeln auf.<br />
Sie fixierte ihn böse aus zusammengekniffenen Augen. »Genauso viel wie<br />
ich natürlich.« Sie sah mich verstohlen an, als wollte sie sagen: Tut dein<br />
Freund nur so doof, oder was soll das? Sie schnaubte wieder. »Ich bin im<br />
Gooch Gab losgegangen.«<br />
»Wir auch. Das sind nur dreizehneinhalb Kilometer.«<br />
Sie schüttelte heftig den Kopf, als wollte sie eine besonders hartnäckige
Fliege loswerden. »22 Komma acht.«<br />
»Nein, im Ernst, es sind nur dreizehneinhalb.«<br />
»Entschuldigt bitte, aber ich bin schließlich den ganzen Weg zu Fuß gelatscht.<br />
Ich muß es ja wohl wissen.« Dann wechselte sie plötzlich das Thema.<br />
»Meine Güte, sind das Timberland-Schuhe? Megaschwerer Fehler.<br />
Wieviel hast du für die bezahlt?«<br />
In dem Stil ging es weiter. Schließlich war ich es leid und stand auf, um<br />
unsere Teller zu spülen und den Vorratsbeutel aufzuhängen. Als ich wiederkam,<br />
bereitete sie ihr Essen zu, redete dabei aber ununterbrochen auf<br />
Katz ein.<br />
»Weißt du was?« sagte sie. »Entschuldige, wenn ich kein Blatt vor den<br />
Mund nehme, aber du bist zu dick.«<br />
Katz sah sie völlig verdattert an. »Wie bitte?«<br />
»Du bist zu dick. Du hättest abnehmen sollen, bevor du losgingst. Ein bißchen<br />
Sport machen sollen, sonst kriegst du noch so eine, ähem, ich meine,<br />
so eine Herzsache.«<br />
»Was für eine Herzsache?«<br />
»Ja. Ich meine, wenn das Herz aufhört zu schlagen und man tot ist.«<br />
»Meinst du einen Herzinfarkt?«<br />
»Ja, genau.«<br />
Dazu muß gesagt werden, daß Mary Ellen auch nicht gerade unter mangelnder<br />
Körperfülle litt und sich just in diesem Moment ungeschickterweise<br />
bückte, um etwas aus dem Rucksack zu holen und dabei ein breitwandiges<br />
Hinterteil präsentierte, auf das man ohne weiteres einen Kinofilm hätte<br />
projizieren können. Das stellte Katz auf eine harte Geduldsprobe. Er sagte<br />
nichts, sondern stand auf, um zu pinkeln und zischte mir im Vorbeigehen<br />
aus dem Mundwinkel ein passendes dreisilbiges Schimpfwort zu, das wie<br />
das Signal eines Güterzugs bei Nacht klang.<br />
Am nächsten Tag standen wir wie immer durchgefroren und wie gerädert<br />
auf und machten uns an die Verrichtung unserer kleinen Pflichten, diesmal<br />
<strong>mit</strong> der zusätzlichen Qual, daß jede Bewegung beobachtet und bewertet<br />
wurde. Während wir unsere Rosinen aßen und unseren Kaffee <strong>mit</strong> Toilettenpapierschnipseln<br />
tranken, verschlang Mary Ellen ein mehrgängiges<br />
Frühstück bestehend aus Müsli, Honigpops, einem speziellen Energiemix<br />
für Wanderer, und einer Handvoll kleiner, rechteckiger Schokoladenstückchen,<br />
die sie neben sich auf dem Baumstamm aufreihte.<br />
Wir sahen ihr wie zwei Waisenkinder auf der Flucht dabei zu, wie sie sich<br />
die Backen vollstopfte und uns über unsere Mängel in puncto Proviant,<br />
Ausrüstung und allgemeiner Virilität aufklärte.<br />
Danach ging es wieder ab in den Wald, diesmal zu dritt. Mary Ellen ging<br />
manchmal neben mir her, manchmal neben Katz, aber immer <strong>mit</strong> einem von
uns beiden. Es war augenscheinlich, daß sie trotz ihres ganzen aufgeblasenen<br />
Getues absolut unerfahren und wanderuntauglich war – zum Beispiel<br />
hatte sie nicht den leisesten Schimmer, wie man eine Karte las – und sich<br />
allein in der Wildnis nicht wohl fühlte. Irgendwie tat sie mir sogar ein bißchen<br />
leid, und außerdem fand ich sie allmählich auf komische Weise unterhaltsam.<br />
Sie hatte eine ungewöhnlich redundante Art, sich auszudrücken.<br />
Sie sagte zum Beispiel Sätze wie diesen: »Da drüben ist ein Wasserfluß«,<br />
oder »Wir haben jetzt zehn Uhr morgens.« Einmal, es ging um den Winter<br />
in Florida, informierte sie mich völlig ernstgemeint: »Normalerweise haben<br />
wir im Winter ein- bis zweimal Frost, aber dieses Jahr schon zweimal.«<br />
Katz litt unter ihrer Gesellschaft und stöhnte, weil sie ihn andauernd bedrängte,<br />
einen Schritt schneller zu gehen.<br />
Endlich einmal war das Wetter freundlich – eher herbstlich als frühlingshaft,<br />
aber dafür erfreulich mild. Um zehn lag die Temperatur bei angenehmen<br />
20 Grad. Zum ersten Mal seit Amicalola zog ich meine Jacke aus, und<br />
sofort bemerkte ich <strong>mit</strong> schwachem Erstaunen, daß ich keinen Platz hatte,<br />
um sie zu verstauen. Schließlich band ich sie <strong>mit</strong> einem Gurt am Rucksack<br />
fest und stapfte weiter.<br />
Es ging 6,5 Kilometer bergauf, über den Blood Mountam, <strong>mit</strong> 1.359 Meter<br />
die höchste und schwierigste Erhebung auf dem Wegabschnitt in Georgia,<br />
danach folgte ein steiler Abstieg über drei Kilometer bis Neels Gap, der für<br />
Aufregung sorgte. Aufregung deswegen, weil sich in Neels Gap ein Laden<br />
befand, genauer gesagt, befand sich der Laden in einem Lokal, das sich<br />
Walasi-Yi Inn nannte und in dem man Sandwiches und Eiscreme kaufen<br />
konnte. Um halb eins etwa vernahmen wir ein neues Geräusch, Autoverkehr,<br />
und wenige Minuten später tauchten wir aus dem Wald auf, und vor<br />
uns lag der U.S. Highway 19 beziehungsweise 129, eigentlich nur eine<br />
kleine Straße über einen hohen Paß <strong>mit</strong>ten im bewaldeten Nirgendwo, obwohl<br />
sie zwei Nummern hat. Direkt gegenüber lag das Walasi-Yi Inn, ein<br />
beeindruckendes Gebäude aus Stein, das das Civilian Conservation Corps,<br />
eine Art Armee der Arbeitslosen, während der Zeit der Depression errichtet<br />
hatte und das heute eine Mischung aus Expeditionsausstatter, Lebens<strong>mit</strong>telgeschäft,<br />
Buchhandlung und Jugendherberge ist. Wir liefen über die Straße,<br />
rannten regelrecht hinüber und gingen hinein.<br />
Es mag unglaubwürdig klingen, wenn ich sage, daß eine geteerte Straße,<br />
rauschender Autoverkehr und ein richtiges Haus nach fünf Tagen in der<br />
Waldeinsamkeit für Aufregung sorgen können und ungewohnt erscheinen,<br />
aber es war tatsächlich so. Allein durch eine Tür zu gehen, in einem Raum<br />
zu sein, umgeben von vier Wänden und einer Decke, war ein neues Gefühl.<br />
Und das Walasi-Yi Inn war wunderbar – ich weiß gar nicht, wo ich an-<br />
fangen soll. Es gab einen einzigen, kleinen Kühlschrank, der vollgestopft
war <strong>mit</strong> frischen Sandwiches, Mineralwasser, Obstsaft und verderblicher<br />
Ware wie Käse und anderem. Katz und ich glotzten minutenlang dumpf und<br />
wie gebannt auf die Regale. Langsam fing ich an zu begreifen, daß die<br />
wichtigste Erfahrung, die man auf dem Appalachian Trail macht, die der<br />
Entbehrung ist, daß der ganze Sinn und Zweck der Unternehmung darin besteht,<br />
sich so weit von den Annehmlichkeiten des Alltags zu entfernen, daß<br />
die gewöhnlichsten Dinge, Schmelzkäse, eine schöne <strong>mit</strong> Kondenswasserperlen<br />
besetzte Dose Limonade, den Menschen <strong>mit</strong> Staunen und Dankbarkeit<br />
erfüllen. Es ist ein berauschendes Erlebnis, Cola zu trinken, als wäre es<br />
das erste Mal, und beim Anblick von Toastbrot an den Rand eines Orgasmus<br />
zu geraten. Ich finde, das macht die ganzen Strapazen vorher erst rich-<br />
tig lohnenswert.<br />
Katz und ich kauften je zwei Eiersalat-Sandwiches, Kartoffelchips, Schokoriegel<br />
und Limonade und setzten uns hinters Haus an einen <strong>Picknick</strong>tisch,<br />
wo wir unsere Köstlichkeiten unter Ausrufen des Entzückens gierig schmatzend<br />
verspeisten, dann kehrten wir wieder zum Kühlschrank zurück, um<br />
noch ein bißchen mehr zu staunen. Das Walasi-Yi, stellte sich heraus, bietet<br />
echten Wanderern noch einigen Service – Waschmaschinen, Duschen,<br />
Handtuchverleih –, und wir machten kräftig Gebrauch von diesen Einrichtungen.<br />
Die Dusche war schon ziemlich betagt und nur ein dünnes Rinnsal,<br />
aber das Wasser war heiß, und ich muß sagen, ich habe noch nie eine Körperreinigung<br />
so sehr genossen wie diese. Mit tiefer Befriedigung beobachtete<br />
ich, wie der Schmutz von fünf Tagen meine Beine hinunterrann und im<br />
Abfluß versickerte, und ich stellte selbstverliebt fest, daß mein Körper<br />
merklich schlankere Konturen angenommen hatte. Wir wuschen zwei Maschinenladungen<br />
Wäsche, spülten unsere Becher, Teller, Töpfe und Pfannen,<br />
kauften verschiedene Postkarten, riefen zu Hause an und füllten unseren<br />
Proviant <strong>mit</strong> frischen und haltbaren Lebens<strong>mit</strong>teln aus dem Laden auf.<br />
Das Walasi-Yi wurde von einem Engländer namens Justin und seiner amerikanischen<br />
Frau Peggy geführt, <strong>mit</strong> denen wir im Laufe des Nach<strong>mit</strong>tags,<br />
während wir ständig rein- und rausgingen, ins Gespräch kamen. Peggy<br />
erzählte uns, sie hätten seit dem ersten Januar bereits tausend Wanderer zu<br />
Besuch gehabt, dabei stehe die eigentliche Wandersaison erst noch bevor.<br />
Die beiden waren ein freundliches Paar, und ich hatte den Eindruck, daß besonders<br />
Peggy ihre Zeit hauptsächlich da<strong>mit</strong> verbrachte, genervte Wanderer<br />
davon abzuhalten aufzugeben. Erst tags zuvor hatte ein junger Mann aus<br />
Surrey sie gebeten, ihm ein Taxi zu bestellen, das ihn nach Atlanta bringen<br />
sollte. Peggy hatte ihn fast dazu überredet durchzuhalten, es wenigstens<br />
noch eine Woche lang zu versuchen, aber zum Schluß war er zusammengebrochen,<br />
hatte still geweint und sie angefleht, ihn doch nach Hause gehen zu<br />
lassen.
Ich selbst verspürte dagegen zum ersten Mal den aufrichtigen Wunsch weiterzugehen.<br />
Die Sonne schien. Ich hatte mich frisch gemacht und eine Stärkung<br />
zu mir genommen, und wir hatten noch reichlich Proviant in unseren<br />
Rucksäcken. Ich hatte <strong>mit</strong> meiner Frau telefoniert, zu Hause war alles in<br />
Ordnung. Vor allem aber fühlte ich mich fit. Ich war mir sicher, daß ich<br />
einige Pfunde verloren hatte. Ich war bereit loszumarschieren. Katz strahlte<br />
ebenfalls vor Sauberkeit und sah auch schon etwas schmächtiger aus. Wir<br />
packten unsere Einkäufe auf der Terrasse zusammen, und im selben Moment<br />
fiel uns beiden zu unserer großen Freude und Erleichterung auf, daß<br />
Mary Ellen nicht mehr zu unserem Gefolge gehörte. Ich steckte noch mal<br />
den Kopf durch die Tür und fragte unsere Gastgeber, ob sie sie gesehen hätten.<br />
»Ach die? Ich glaube, die ist vor einer Stunde gegangen«, sagte Peggy.<br />
Die Sache wurde immer besser.<br />
Es war nach vier Uhr, als wir endlich loszogen. Justin hatte uns gesagt,<br />
ungefähr eine Stunde Fußmarsch von hier gäbe es eine Wiese, die sich ideal<br />
zum Zelten eignete. Jetzt, im warmen Sonnenlicht des späten Nach<strong>mit</strong>tags,<br />
sah der Trail einladend aus, die Bäume warfen lange Schatten, und man<br />
hatte einen weiten Blick über ein Flußtal hinweg auf wuchtige, anthrazitfarbene<br />
Berge. Die Wiese eignete sich tatsächlich ideal, um Station zu machen,<br />
Wir schlugen unsere Zelte auf und aßen die Sandwiches und Kartoffelchips<br />
und tranken die Säfte, die wir fürs Abendessen eingekauft hatten.<br />
Dann holte ich stolz, als hätte ich ihn selbst gebacken, mehrere Päckchen<br />
Napfkuchen von Hostess hervor. Meine kleine Überraschung.<br />
Katz’ Gesicht hellte sich auf, wie bei dem Geburtstagskind auf einem Gemälde<br />
von Norman Rockwell.<br />
»Oh, Mann!«<br />
»Little Debbies hatten sie leider nicht«, sagte ich entschuldigend.<br />
»He«, sagte er. »He.« Zu mehr war er nicht fähig. Katz liebte Kuchen.<br />
Wir teilten uns drei Napfkuchen und legten den letzten auf einen Baumstamm,<br />
wo wir ihn für später aufhoben und solange bewundern konnten.<br />
Wir fläzten uns ins Gras, <strong>mit</strong> dem Rücken an den Baumstamm gelehnt,<br />
verdauten, rauchten, fühlten uns ausgeruht und zufrieden, unterhielten uns<br />
mal ausnahmsweise - kurzum, es war so, wie ich es mir zu Hauseinmeinen<br />
optimistischen Vorstellungen ausgemalt hatte –, als Katz plötzlich leise<br />
aufstöhnte. Ich folgte seinem Blick und sah Mary Ellen, die forschen Schrittes,<br />
aus der falschen Richtung, den Pfad entlang auf uns zukam.<br />
»Ich habe mich schon gefragt, wo ihr beide abgeblieben seid«, schimpfte<br />
sie. »Ich muß sagen, ihr seid ja echt langsam. Wir hätten längst sieben Kilometer<br />
weiter sein können. Ich sehe schon, ich muß jetzt besser auf euch<br />
beide aufpassen. Ist das ein Napfkuchen von Hostess da vorne?« Bevor ich
etwas sagen konnte und bevor sich Katz einen Stock geschnappt hatte, um<br />
ihr den Schädel einzuschlagen, sagte sie: »Ich darf doch, oder?« und verschlang<br />
ihn <strong>mit</strong> zwei Bissen. Es vergingen einige Tage, bis Katz wieder<br />
lächelte.
5. Kapitel<br />
»Welches Sternzeichen bist du?« sagte Mary Ellen.<br />
»Cunnilingus«, sagte Katz und sah zutiefst unglücklich aus.<br />
Sie schaute ihn an. »Das kenne ich nicht.« Sie runzelte die Stirn, als wollte<br />
sie sagen: Ich freß’ ‘nen Besen, sagte aber statt dessen: »Dabei dachte ich,<br />
ich würde alle kennen. Ich bin Waage.« Sie wandte sich an mich. »Und<br />
du?«<br />
»Weiß ich nicht.« Ich versuchte mir etwas auszudenken. »Nekrophilie.«<br />
»Das kenne ich auch nicht. Wollt ihr mich vielleicht verarschen?«<br />
»Erraten.«<br />
Das war zwei Tage später. Wir campierten auf einem kleinen Plateau, Indian<br />
Grave Gap, zwischen zwei dumpfen Gipfeln – an den einen erinnerte ich<br />
mich nur noch schwach, der andere stand uns erst noch bevor. Wir hatten in<br />
48 Stunden 35 Kilometer zurückgelegt, eine ansehnliche Strecke für unsere<br />
Verhältnisse, aber eine ausgeprägte Lustlosigkeit, ein Gefühl der Enttäuschung,<br />
eine gewisse Bergmüdigkeit hatte sich unserer bemächtigt. Wir<br />
verbrachten unsere Tage genauso, wie wir sie immer verbracht hatten und<br />
auch in Zukunft verbringen würden: immer der gleiche Wanderpfad, die<br />
gleichen Hügel und Berge, der gleiche endlose Wald. Die Bäume standen so<br />
dicht, daß man fast nie einen Ausblick genießen konnte, und wenn, dann<br />
wieder nur auf endlose Hügelketten und noch mehr Bäume. Ich war schwer<br />
enttäuscht, als ich merkte, daß ich schon wieder alles madig machte und ich<br />
mich nach Weißbrot sehnte. Mary Ellen und ihr unentwegtes, erschreckend<br />
geistloses Geplapper kamen erschwerend hinzu.<br />
»Wann hast du Geburtstag?« fragte sie mich.<br />
»Am 8. Dezember.«<br />
»Also Jungfrau.«<br />
»Nein, Schütze.«<br />
»Ist ja auch egal.« Dann plötzlich: »Meine Güte, ihr beide stinkt zum Himmel.«<br />
»Na ja, man schwitzt kein Rosenwasser beim Wandern.«<br />
»Ich schwitze überhaupt nicht. Nie. Ich träume auch nicht.«<br />
»Jeder Mensch träumt«, sagte Katz.<br />
»Ich aber nicht.«<br />
»Nur Menschen <strong>mit</strong> ungewöhnlich geringer Intelligenz träumen nicht. Das<br />
ist wissenschaftlich erwiesen.«<br />
Mary Ellen sah ihn einen Moment lang ausdruckslos an, dann sagte sie<br />
plötzlich, ohne sich direkt an einen von uns zu wenden: »Habt ihr das schon<br />
mal geträumt? Also, man sitzt in der Klasse und so, und dann guckt man an<br />
sich runter und so, und man hat nichts an?« Sie schüttelte sich. »Das kann
ich nicht ab.«<br />
»Ich dachte, du träumst nicht«, sagte Katz.<br />
Sie starrte ihn wieder lange an, als überlegte sie, wo sie ihm schon mal<br />
begegnet war. »Und Fallen«, fuhr sie gelassen fort. »Den Traum hasse ich<br />
auch. Wie wenn man in ein Loch fällt und so, und man fällt und fällt.« Sie<br />
schnaubte wieder geräuschvoll, um den Druck in den Ohren loszuwerden.<br />
Katz musterte sie beiläufig interessiert. »Ich kenne jemanden, der hat das<br />
auch mal gemacht«, sagte er, »dabei ist ihm ein Auge rausgesprungen.«<br />
Sie sah ihn fragend an.<br />
»Es kullerte über den Wohnzimmerboden, und sein Hund hat es gefressen.<br />
Stimmt’s, <strong>Bryson</strong>?«<br />
Ich nickte.<br />
»Das hast du dir nur ausgedacht.«<br />
»Nein. Es ist über den Boden gekullert, und bevor er sich’s versah, hatte der<br />
Hund es <strong>mit</strong> einem Happen verschlungen.«<br />
Ich bestätigte das <strong>mit</strong> einem neuerlichen Nicken.<br />
Sie dachte minutenlang darüber nach. »Was hat dein Freund wegen der<br />
Augenhöhle gemacht? Hat er sich ein Glasauge gekauft, oder was?«<br />
»Das hatte er eigentlich vor, aber seine Familie war ziemlich arm. Er hatte<br />
sich einen Tischtennisball besorgt, eine Pupille drauf gemalt und ihn als<br />
Auge benutzt.«<br />
»Ihh«, sagte Mary Ellen leise.<br />
»Deswegen würde ich an deiner Stelle nicht ständig so schnauben.«<br />
Sie ließ sich das Gesagte wieder durch den Kopf gehen. »Ja, vielleicht hast<br />
du recht«, sagte sie und schnaubte.<br />
In den wenigen Momenten, die wir für uns hatten, wenn sich Mary mal zum<br />
Pinkeln in die Büsche verzog, hatten Katz und ich heimlich beschlossen,<br />
morgen die 22,5 Kilometer nach Dicks Creek Gap zu laufen, wo ein Highway<br />
kreuzte, der in die Stadt Hiawassee führte, 17,7 Kilometer weiter nördlich.<br />
Wir würden bis zum Gap wandern, und wenn wir am Ende tot umfielen;<br />
von da aus würden wir nach Hiawassee trampen, um dort zu Abend zu<br />
essen und uns in einem Motel einzumieten. Plan Nummer zwei sah vor,<br />
Mary Ellen zu töten und sich an ihren Honigpops gütlich zu tun.<br />
So kam es, daß wir am nächsten Tag wie die Soldaten marschierten, richtig<br />
marschierten, meine ich, und Mary Ellen <strong>mit</strong> unseren weit ausholenden<br />
Schritten in blankes Erstaunen versetzten. In Hiawassee sollte es ein Motel<br />
geben – Bettlaken! Dusche! Farbfernsehen! – und angeblich eine Auswahl<br />
von Restaurants. Dieser kleine Ansporn reichte, um uns einen Schritt<br />
schneller gehen zu lassen. Katz erlahmte nach einer Stunde, und ich war<br />
nach<strong>mit</strong>tags todmüde, aber wir hielten entschlossen durch. Mary Ellen fiel<br />
immer weiter zurück, bis sie sogar hinter Katz zurückblieb. Ein wahres
Wunder.<br />
Um vier Uhr trat ich erschöpft und erhitzt und <strong>mit</strong> einem von sandigen<br />
Schweißbächen gezeichneten Gesicht aus dem Wald und stieg die breite<br />
Böschung zum U.S. Highway 76 hoch, einem Asphaltband <strong>mit</strong>ten durch<br />
den Wald, und stellte befriedigt fest, daß die Straße mehrspurig war und wie<br />
eine wichtige Hauptverkehrsader aussah. Ein paar hundert Meter weiter<br />
befand sich eine kleine Lichtung und eine Auffahrt – Ausdruck von Zivilisation!<br />
–, bevor die Straße eine verlockende Kurve beschrieb. Mehrere<br />
Autos fuhren vorbei, als ich mich dort hinstellte.<br />
Katz torkelte ein paar Minuten später zwischen den Bäumen hervor. Mit<br />
seinem irren Blick und den zerzausten Haaren sah er verwegen aus, und ich<br />
hetzte ihn trotz seines wortreichen Widerspruchs, er müsse sich auf der<br />
Stelle hinsetzen, über die Straße. Ich wollte unbedingt ein Auto anhalten,<br />
bevor Mary Ellen auftauchte und alles wieder vermasselte. Ich wußte nicht<br />
wie, ich wußte nur, daß sie es schaffen würde.<br />
»Hast du sie gesehen?« fragte ich Katz besorgt.<br />
»Ganz weit hinter mir. Sie saß auf einem Stein, hatte die Schuhe ausgezogen<br />
und rieb sich die Füße. Sie sah ziemlich erledigt aus.«<br />
»Gut.«<br />
Katz pflanzte sich auf seinen Rucksack, schmutzig und erschöpft wie er<br />
war, und ich stellte mich neben ihn an die Böschung, hielt den Daumen<br />
raus, versuchte, uns als ehrbare und anständige Menschen zu verkaufen und<br />
schickte jedem Auto und jedem Pick-up, die an uns vorbeifuhren, im stillen<br />
eine Schimpfkanonade hinterher. Ich war seit 25 Jahren nicht mehr getrampt,<br />
und es war eine etwas demütigende Erfahrung. Die Autos rasten<br />
vorbei, unglaublich schnell, wie wir fanden, die wir jetzt im Wald hausten,<br />
und die Fahrer würdigten uns nicht mal eines Blickes. Ganz wenige näherten<br />
sich etwas langsamer, immer saßen ältere Herrschaften in den Wagen –<br />
kleine, weiße, gerade über Fensterhöhe ragende Köpfchen –, die uns ohne<br />
Mitgefühl ausdruckslos anstarrten, wie eine Herde Kühe auf der Weide. Es<br />
kam mir unwahrscheinlich vor, daß irgend jemand für uns anhalten würde.<br />
Ich hätte auch nicht für uns angehalten.<br />
Nachdem uns eine Viertelstunde lang ein Auto nach dem anderen verschmäht<br />
hatte, verkündete Katz verzagt: »Hier nimmt uns nie einer <strong>mit</strong>.«<br />
Er hatte natürlich recht, aber es ärgerte mich, daß er immer so schnell aufgab.<br />
»Kannst du nicht mal etwas mehr Optimismus ausstrahlen?« bat ich<br />
ihn.<br />
»Na gut, bin ich eben optimistisch. Aber ich bin absolut davon überzeugt,<br />
daß uns hier kein Mensch <strong>mit</strong>nimmt. Sieh uns doch nur an.« Er schnüffelte<br />
angeekelt unter seinen Achselhöhlen, »Ich stinke wie faule Eier.«<br />
Es gibt ein Phänomen, das sich »Trail Magic« nennt, das bei allen Wande-
ern des Appalachian Trail bekannt ist und von dem <strong>mit</strong> Ehrfurcht gesprochen<br />
wird. Man könnte es auch das Wunder des Zufalls nennen, jedenfalls<br />
besagt es, daß häufig dann, wenn es besonders finster aussieht, irgend etwas<br />
passiert, das einen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen läßt. Bei uns<br />
war es ein kleiner Pontiac Trans Am, der vorbeiflog und dann 100 Meter<br />
weiter <strong>mit</strong> quietschenden Reifen und in eine Staubwolke gehüllt am Straßenrand<br />
zum Stehen kam. Es war so weit weg von der Stelle, wo wir standen,<br />
daß wir kaum glauben konnten, das Auto hielte wegen uns, aber dann<br />
wurde der Rückwärtsgang eingelegt, und es kam auf uns zu, fuhr halb auf<br />
der Böschung, halb auf der Straße, sehr schnell und in Schlangenlinien. Ich<br />
stand wie festgenagelt. Am Tag davor hatten uns ein paar erfahrene Wanderer<br />
berichtet, daß sich die Leute im Süden manchmal einen Spaß daraus<br />
machten, auf Tramper, die vom Appalachian Trail kamen, zuzurasen, um im<br />
letzten Moment auszuweichen, oder ihre Rucksäcke zu überfahren, und ich<br />
hatte plötzlich den Verdacht, daß es sich hierbei um solche Leute handelte.<br />
Ich wollte gerade in Deckung springen, und selbst Katz machte schon Ansätze,<br />
sich zu erheben, als das Auto röhrend und wieder <strong>mit</strong> viel aufgewirbeltem<br />
Staub ein paar Meter vor uns stehenblieb und eine junge Frau den<br />
Kopf aus dem Fenster der Beifahrertür , steckte.<br />
»Wollta <strong>mit</strong>komm’?« rief sie.<br />
»Klar, und wie«, sagten wir und benahmen uns wie zwei brave Kinder.<br />
Wir rannten <strong>mit</strong> unseren Rucksäcken zu dem Wagen, schauten durch die<br />
Fenster und sahen ein sehr hübsches, sehr glückliches, sehr betrunkenes<br />
junges Pärchen. Die beiden waren höchstens 18 oder 19 Jahre alt. Die Frau<br />
goß aus einer zu drei Viertel leeren Flasche Wild-Turkey-Whiskey zwei<br />
Plastikbecher randvoll. »Hü« sagte sie. »Kommt rein.«<br />
Wir zögerten. Der Wagen war fast bis unter die Decke <strong>mit</strong> Zeug vollgepackt,<br />
Koffer, Kartons, Plastiktüten, stapelweise Kleider auf Bügeln. Es war<br />
ohnehin ein kleines Auto – und schon für die beiden ziemlich eng.<br />
»Mach mal ein bißchen Platz für die Herren, Darren«, befahl die junge<br />
Frau, und fügte dann erklärend hinzu: »Das ist Darren.«<br />
Darren stieg aus, begrüßte uns grinsend, machte den Kofferraum auf und<br />
stierte <strong>mit</strong> leerem Blick hinein, bis sich allmählich die Erkenntnis in seinem<br />
Gehirn breitgemacht hatte, daß er ebenfalls picke packe voll war. Darren<br />
war dermaßen betrunken, daß ich für einen Augenblick dachte, er würde im<br />
Stehen einschlafen, aber er kam wieder zu sich, fand ein Stück Schnur und<br />
band unsere beiden Rucksäcke geschickt aufs Dach. Dann schob er, die<br />
energischen Ratschläge und Proteste seiner Freundin überhörend, das Zeug<br />
auf dem Rücksitz ein bißchen zusammen, bis ein schmaler Hohlraum geschaffen<br />
war, in den Katz und ich uns quetschten, während wir unter Geächz<br />
und Gestöhn Entschuldigungen und Gefühle größter Dankbarkeit zum
Ausdruck brachten.<br />
Die junge Frau hieß Donna, und die beiden waren unterwegs zu irgendeinem<br />
Ort <strong>mit</strong> einem gräßlichen Namen – Turkey Balls Falls oder Coon Slick<br />
oder so ähnlich, ungefähr achtzig Kilometer von hier, aber sie würden uns<br />
in Hiawassee absetzen, wenn wir vorher nicht alle tot im Straßengraben<br />
landeten. Darren raste <strong>mit</strong> 200 Stundenkilometern, nur einen Finger am<br />
Steuer, wippte dabei <strong>mit</strong> dem Kopf zu irgendeinem Rhythmus, während<br />
Donna sich umdrehte, um sich <strong>mit</strong> uns zu unterhalten. Sie war umwerfend<br />
hübsch, hinreißend hübsch.<br />
»Ihr müßt schon entschuldigen. Wir beide feiern gerade.« Sie hob ihren<br />
Plastikbecher hoch, wie um uns zuzuprosten.<br />
»Was wird denn gefeiert?« fragte Katz.<br />
»Wir wolln morgen heiraten«, verkündete sie stolz.<br />
»Nicht möglich«, sagte Katz. »Meinen Glückwunsch.«<br />
»Ja, ja. Darren macht eine anständige Frau aus mir.« Sie wuschelte in seinem<br />
Haar, beugte sich dann spontan zur Seite und gab ihm einen Kuß auf<br />
die Wange, der immer ausdauernder wurde, dann eindringlicher, dann eindeutig<br />
lüstern und seinen krönenden Abschluß in einem ruckartigen Vorstoß<br />
ihrer Hand an eine gewagte Stelle fand – jedenfalls vermuteten wir das,<br />
denn Darren stieß <strong>mit</strong> dem Kopf an die Decke und machte einen kurzen,<br />
nervenaufreibenden Ausflug auf die Gegenfahrbahn. Donna drehte sich<br />
daraufhin <strong>mit</strong> einem verträumten, unverfroren anzüglichen Grinsen zu uns<br />
um, als wollte sie sagen: Wer will als nächster? Es sah so aus, überlegten<br />
wir uns später, als hätte Darren alle Hände voll zu tun gehabt in dem Moment,<br />
aber wahrscheinlich lohnte sich die Mühe.<br />
»Wollt ihr was trinken?« bot sie plötzlich an, griff die Flasche am Hals und<br />
suchte den Boden nach Bechern ab.<br />
»Nein, danke«, sagte Katz. Es war eine Versuchung für ihn.<br />
»Komm schon«, ermunterte sie ihn.<br />
Katz hielt abwehrend die Hand hoch. »Ich bin geheilt.«<br />
»Wirklich? Wie schön für dich. Trink einen drauf.«<br />
»Nein, danke. Ich möchte nicht.«<br />
»Was ist <strong>mit</strong> dir?« sagte sie zu mir.<br />
»Nein, nein. Danke.« Ich hätte meine eingequetschten Arme sowieso nicht<br />
frei bekommen, selbst wenn ich gewollt hätte. Sie baumelten vor mir wie<br />
zwei schlaffe Gliedmaßen von einem Tyrannosaurus.<br />
»Du bist aber nicht geheilt, oder?«<br />
»Irgendwie schon.« Ich hatte beschlossen, für die Dauer unserer Tour aus<br />
Solidarität dem Alkohol zu entsagen.<br />
Sie sah uns an. »Seid ihr Mormonen oder so?«<br />
»Nein, nur Wanderer.«
Sie nickte bedächtig, gab sich da<strong>mit</strong> zufrieden und trank einen Schluck.<br />
Dann brachte sie Darren wieder an die Decke.<br />
Sie setzten uns vor Mull’s Motel in Hiawassee ab, einem altertümlichen,<br />
nichtssagenden Haus, das offenkundig keiner Hotelkette angeschlossen war<br />
und das an einer Straßenecke unweit des Stadtzentrums lag. Wir dankten<br />
den beiden überschwenglich, machten ein bißchen Getue wegen dem Benzingeld,<br />
das wir ihnen geben wollten, das sie aber hartnäckig ablehnten, und<br />
sahen ihnen hinterher, als Darren, wie von einem Raketenwerfer abgefeuert,<br />
auf die befahrene Straße glitt. Ich bildete mir ein, daß er sich gerade wieder<br />
den Kopf an der Decke stieß, als das Auto hinter einer kleinen Anhöhe<br />
verschwand.<br />
Dann standen wir <strong>mit</strong> unseren Rucksäcken allein da, auf dem leeren Parkplatz<br />
des Motels, in einer staubigen, verlorenen, sonderbaren Stadt im Norden<br />
von Georgia. Das Wort, das jedem Wanderer in den Sinn kommt, wenn<br />
er an Georgia denkt, heißt Deliverance (Beim Sterben ist jeder der Erste),<br />
der Titel des Romans von James Dickey, der später in Hollywood verfilmt<br />
wurde. Es geht darin, wie Sie sich vielleicht erinnern, um vier Männer in<br />
den besten Jahren aus Atlanta, die übers Wochenende eine Kanufahrt auf<br />
dem fiktiven Cahulawassee River machen (dessen Vorbild, der Fluß Chattooga,<br />
verläuft in der Nähe) und völlig aus der Bahn geworfen werden.<br />
»Hier hat jeder, den ich kennengelernt habe, in seiner Familie mindestens<br />
einen Verwandten im Gefängnis sitzen«, sagt eine der Figuren ahnungsvoll<br />
während der Hinfahrt. »Einige wegen Schwarzbrennerei, andere, weil sie<br />
das Zeug verhökern, aber die meisten sind wegen Mordes drin. Ein Menschenleben<br />
ist hier nicht viel wert.« Das erweist sich dann natürlich als<br />
zutreffend: Das muntere Quartett aus der Metropole wird nacheinander in<br />
den Arsch gefickt, von verrückten Hinterwäldlern gejagt und dann umgebracht.<br />
Am Anfang des Romans gibt es eine Stelle, da halten die vier unterwegs an<br />
und fragen »in einer verschlafenen, von einer seltenen Krankheit befallenen,<br />
häßlichen Stadt« nach dem Weg. Diese Stadt hätte gut und gern Hiawassee<br />
sein können. Das Buch spielt jedenfalls in diesem Teil des Bundesstaates,<br />
und der Film wurde auch in dieser Gegend gedreht. Der berühmte Banjo<br />
spielende Albino, der in dem Film »Dueling Banjos« anstimmt, wohnt angeblich<br />
in Clayton, das nicht weit weg liegt.<br />
Dickeys Buch hat bei seinem Erscheinen erwartungsgemäß heftige Kritik<br />
im Staat Georgia ausgelöst – ein Journalist meinte, es sei »die niederträchtigste<br />
Charakterisierung der Bergbewohner des Südens in der gesamten<br />
modernen Literatur«, was noch« eine Untertreibung ist –, aber es läßt sich<br />
nun einmal nicht leugnen, daß die Menschen seit 150 Jahren von den Bewohnern<br />
des nördlichen Georgia geradezu entsetzt sind. Ein Chronist des
19.Jahrhunderts beschreibt die Leute als »groß gewachsene, hagere, leichenähnliche<br />
Kreaturen, melancholisch und träge wie gekochter Kabeljau«.<br />
Andere machen großzügigen Gebrauch von Wörtern wie »verdorben«,<br />
»grob«, »unzivilisiert« und »zurückgeblieben«, um das abgeschiedene,<br />
ungebildete Völkchen in den tiefen, finsteren Wäldern und hoffnungslosen<br />
Städtchen Georgias zu beschreiben. Dickey, der selbst aus Georgia stammte<br />
und die« Gegend gut kannte, schwor Stein und Bein, daß es sich um eine<br />
zutreffende Beschreibung handelte.<br />
Vielleicht lag es an dem nachhaltigen Eindruck, den das Buch hinterlassen<br />
hatte, vielleicht einfach an der Tageszeit, vielleicht auch daran, daß es ungewohnt<br />
war, wieder in einer Stadt zu sein, jedenfalls hatte Hiawassee etwas<br />
spürbar Merkwürdiges und Beunruhigendes an sich. Es war ein Ort, in<br />
dem es einen nicht sonderlich erstaunt hätte, an einer Tankstelle das Benzin<br />
von einem Zyklopen gezapft zu bekommen. Wir betraten den Empfangsraum<br />
des Motels, der mich eher an ein kleines schmuddeliges Wohnzimmer<br />
und nicht an ein Büro erinnerte, und fanden eine alte Frau vor, <strong>mit</strong> wuscheligem,<br />
weißen Haar und einem hellen Baumwollkleid, die auf einem Sofa<br />
neben der Tür saß. Sie schien sich über unseren Besuch zu freuen.<br />
»Hi«, sagte ich. »Wir hätten gern ein Zimmer.«<br />
Die Frau grinste und nickte.<br />
»Eigentlich zwei Zimmer, wenn’s geht.«<br />
Die Frau grinste und nickte wieder. Ich wartete darauf, daß sie aufstand,<br />
aber sie rührte sich nicht.<br />
»Für heute«, sagte ich aufmunternd. »Sie vermieten doch Zimmer, oder<br />
nicht?« Ihr Grinsen erweiterte sich zu einem Strahlen, und sie nahm meine<br />
Hand und hielt sie fest, ihre Finger fühlten sich knochig und kalt an. Sie sah<br />
mir erwartungsvoll und eindringlich in die Augen, als hoffe sie, daß ich<br />
gleich ein Stöckchen werfen würde, das sie holen sollte.<br />
»Sag ihr, wir kämen aus der Wirklichkeit«, flüsterte mir Katz ins Ohr.<br />
Im selben Moment öffnete sich <strong>mit</strong> Schwung eine Tür, und eine grauhaarige<br />
Frau, die ihre Hände an einer Schürze abtrocknete, kam herein.<br />
»Es hat keinen Zweck, <strong>mit</strong> ihr zu reden«, sagte sie in freundlichem Tonfall.<br />
»Sie versteht nichts, und sie spricht nicht. Laß die Hand von dem Mann los,<br />
Mutter.« Die alte Frau strahlte sie an. »Du sollst die Hand von dem Mann<br />
loslassen!«<br />
Meine Hand wurde freigegeben, und wir mieteten zwei Zimmer. Wir zogen<br />
<strong>mit</strong> den Schlüsseln los und vereinbarten, uns in einer halben Stunde wieder<br />
zu treffen. Mein Zimmer war schlicht und schäbig, jede nur denkbare Oberfläche,<br />
einschließlich Toilettenbrille und Türschwelle, verzierten Brandlöcher,<br />
und Wände und Decke waren übersät <strong>mit</strong> Flecken, was den Gedanken<br />
nahelegte, daß hier ein Streit stattgefunden hatte, bei dem es offenbar um
Leben und Tod gegangen war und Unmengen heißen Kaffees eine Rolle<br />
gespielt haben mußten. Für mich jedenfalls war es das Paradies. Ich rief<br />
Katz an, aus purer Lust, mal wieder ein Telefon zu benutzen, und ich erfuhr,<br />
daß sein Zimmer noch schlimmer aussah. Wir waren hochzufrieden.<br />
Wir duschten, zogen die letzten frischen Klamotten an, die wir hatten und<br />
begaben uns erwartungsvoll in ein beliebtes, nahegelegenes Bistro, das sich<br />
Georgia Mountain Restaurant nannte. Auf dem Parkplatz standen lauter<br />
Pick-up-Trucks, und drinnen saßen lauter Fleischklöpse <strong>mit</strong> Baseballmützen<br />
auf dem Kopf. Wenn ich in die Menge gerufen hätte: »Telefon für dich,<br />
Bubba!« es wäre bestimmt jeder zweite aufgesprungen. Das Georgia Mountain<br />
verfügte nicht gerade über eine Küche, für die sich eine Anreise gelohnt<br />
hätte, nicht mal innerhalb der Stadtgrenzen von Hiawassee, aber dafür war<br />
das Essen einigermaßen billig. Für 5,50 Dollar bekam man »Fleisch plus<br />
drei« – die Zahl bezog sich auf die Beilagen –, einen Gang ans Salatbüffet<br />
und Nachtisch. Ich bestellte gebratenes Hühnchen, Erbsen, Röstkartoffeln<br />
und »Ruterbeggars« (gelbe Kohlrüben, die korrekterweise »Rutabagas«<br />
geschrieben werden wie auf der Speisekarte zu lesen war). Die hatte ich<br />
noch nie probiert und werde sie wohl auch so schnell nicht wieder probieren.<br />
Wir aßen schmatzend und <strong>mit</strong>« Lust und bestellten viel Eistee zum<br />
Runterspülen.<br />
Der Nachtisch war natürlich der Höhepunkt. Jeder Wanderer auf dem Trail<br />
träumt unterwegs von irgendeinem Gericht, meist etwas Süßem, Klebrigem.<br />
Die Phantasie, die mich am Laufen hielt, rankte sich um ein überdimensionales<br />
Stück Kuchen. Es hatte mich tagelang beschäftigt, und als die Kellnerin<br />
jetzt kam, um unsere Bestellung aufzunehmen, bat ich sie <strong>mit</strong> einem fle<br />
henden Blick, wobei ich meine Hand auf ihren Unterarm legte, mir das<br />
größte Stück Kuchen zu bringen, das sie mir abschneiden konnte, ohne<br />
ihren Job zu riskieren. Sie brachte mir ein riesiges, pappiges, kanariengelbes<br />
Stück Zitronenkuchen. Es war ein wahres Monument der Lebens<strong>mit</strong>telindustrie,<br />
so knallgelb, daß man vom Anblick allein Kopfschmerzen bekam, so<br />
süß, daß es einem die Augäpfel in die Stirnhöhlen trieb – kurzum, es bot<br />
alles, was man von einem Kuchen dieser Sorte erwartete, solange man Geschmack<br />
und Qualität als Bewertungskriterien vernachlässigte. Ich wollte<br />
gerade herzhaft reinbeißen, als Katz sein langes Schweigen brach und <strong>mit</strong><br />
großer Nervosität in der Stimme sagte: »Weißt du, was ich die ganz Zeit<br />
mache? Ich gucke alle paar Minuten zur Tür, um zu sehen, ob Mary Ellen<br />
hereinkommt.«<br />
Ich hörte auf zu essen, die Gabel <strong>mit</strong> der fettglänzenden Masse auf halbem<br />
Weg zum Mund, und stellte <strong>mit</strong> beiläufigem Staunen, fest, daß sein Nachtischteller<br />
bereits leer war. »Du willst mir doch nicht weismachen, daß sie<br />
dir fehlt, Stephen?« sagte ich und schob die Gabel dahin, wo sie hingehörte.
»Nein«, sagte er sauer. Er fand meine Frage überhaupt nicht komisch. Er<br />
rang nach Worten, um seinen komplizierten Gefühlen Ausdruck zu geben.<br />
»Ich finde, wir haben sie irgendwie sitzengelassen«, platzte er schließlich<br />
heraus.<br />
Ich ließ mir den Vorwurf durch den Kopf gehen. »Eigentlich haben wir sie<br />
nicht irgendwie sitzengelassen. Wir haben sie sitzengelassen. Ganz einfach.«<br />
Ich war absolut nicht seiner Meinung. »Na und?«<br />
»Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl – nur irgendwie –, weil wir sie<br />
allein, auf sich gestellt, im Wald zurückgelassen haben.« Dann verschränkte<br />
er die Arme, als wollte er da<strong>mit</strong> sagen: So, jetzt ist es raus.<br />
Ich legte die Gabel beiseite und überlegte. »Sie ist doch auch allein losgegangen«,<br />
sagte ich. »Wir sind nicht für sie verantwortlich. Wir haben keinen<br />
Vertrag abgeschlossen, nach dem wir uns um sie zu kümmern hätten.«<br />
Noch während ich das sagte, wurde mir <strong>mit</strong> schrecklicher, zunehmender<br />
Deutlichkeit klar, daß er recht hatte. Wir hatten Mary Ellen abgehängt und<br />
sie den Bären, Wölfen und geil lechzenden Bergbewohnern überlassen. Ich<br />
war dermaßen <strong>mit</strong> meiner eigenen wilden Gier nach Essen und einem richtigen<br />
Bett beschäftigt gewesen, daß mir nicht in den Sinn gekommen war,<br />
was unser plötzliches Verschwinden für sie bedeuten würde – eine Nacht<br />
allein zwischen rauschenden Bäumen, umgeben von Finsternis, die Ohren<br />
gezwungenermaßen gespitzt, auf das vielsagende Knacken eines Astes oder<br />
Zweiges unter einem schweren Fuß oder einer Tatze lauschend. So etwas<br />
gönnte ich keinem Menschen. Mein Blick fiel auf meinen Kuchen, und ich<br />
merkte, daß mir der Appetit vergangen war. »Vielleicht hat sie jemand anderen<br />
gefunden, <strong>mit</strong> dem sie ihr Lager teilen kann«, erwiderte ich lahm und<br />
schob den Teller von mir weg.<br />
»Bist du heute unterwegs irgend jemandem begegnet?«<br />
Er hatte recht. Wir hatten fast keine Menschenseele gesehen.<br />
»Wahrscheinlich ist sie jetzt immer noch unterwegs«, sagte Katz <strong>mit</strong> einer<br />
Spur plötzlicher Aufregung. »Und fragt sich, wo wir beide bloß abgeblieben<br />
sind. Scheißt sich vor Angst in ihren Breitwandarsch.«<br />
»Hör auf«, bat ich ihn mißgelaunt und schob den Teller <strong>mit</strong> dem Kuchen<br />
zerstreut noch ein Stück weiter von mir.<br />
Er nickte, ein nachdrückliches, eifriges, selbstgerechtes Nicken und sah<br />
mich <strong>mit</strong> einer seltsam strahlenden Miene an, die besagte: Und wenn sie<br />
stirbt, dann geht das auf deine Kappe. Er hatte recht. Ich war der Rädelsführer<br />
in dieser Sache gewesen. Es war meine Schuld.<br />
Dann beugte er sich weiter vor und sagte in einem völlig veränderten Tonfall:<br />
»Wenn du den Kuchen nicht mehr ißt – darf ich ihn dann haben?«<br />
Am nächsten Morgen frühstückten wir gegenüber bei Hardees und ließen
uns danach von einem Taxi an den Trail fahren. Von Mary Ellen war nicht<br />
mehr die Rede, wir redeten überhaupt nicht viel. Wenn wir einen Tag lang<br />
die Annehmlichkeiten einer Stadt genossen hatten, waren wir bei der Rückkehr<br />
zum Appalachian Trail immer mundfaul.<br />
Es erwartete uns gleich ein steiler Anstieg, und wir gingen langsam, fast<br />
behutsam. Der erste Tag nach einer längeren Unterbrechung war immer<br />
schrecklich für mich. Für Katz dagegen war jeder Tag schrecklich. Mochte<br />
ein Stadtbesuch noch so erholsame Wirkung zeitigen, unterwegs verflüchtigte<br />
sie sich erstaunlich schnell. Nach zwei Minuten war es, als wären wir<br />
nie weg gewesen – eigentlich sogar noch schlimmer, weil man an einem<br />
normalen Wandertag nicht <strong>mit</strong> einem schweren, fettreichen Hardees-<br />
Frühstück im Bauch einen steilen Berg hinaufkraxeln würde, das einem<br />
jederzeit aus dem Gesicht zu fallen drohte.<br />
Wir waren etwa eine halbe Stunde unterwegs, als uns ein Wanderer entgegenkam,<br />
ein ziemlich sportlicher Mann <strong>mit</strong>tleren Alters. Wir erkundigten<br />
uns, ob er einer Frau namens Mary Ellen begegnet sei, rote Jacke, etwas<br />
lautes Stimmorgan.<br />
Er zog ein Gesicht, als könnte er sich an eine solche Person erinnern, und<br />
sagte: »Ist das die Frau – ich will nicht unhöflich erscheinen – aber macht<br />
die immer so?« und er hielt sich die Nase zu und schnaubte ein paarmal<br />
hintereinander geräuschvoll.<br />
Heftiges Kopfnicken unsererseits.<br />
»Ja. Ich habe gestern abend <strong>mit</strong> ihr und noch zwei anderen Männern in der<br />
Plumorchard-Gap-Schutzhütte übernachtet.« Er sah uns mißtrauisch von der<br />
Seite an. »Ist das eine Freundin von euch?«<br />
»Nein, nein«, erwiderten wir, verleugneten sie nach Kräften, was jeder<br />
vernünftige Mensch getan hätte. »Sie hatte sich uns für ein paar Tage angeschlossen.«<br />
Er nickte verständnisvoll, dann grinste er. »Sie ist ein harter Brocken, was?«<br />
Wir grinsten ebenfalls. »War es so schlimm?« sagte ich.<br />
Er zog ein Gesicht, das höllische Qualen ausdrückte, dann schaute er plötzlich<br />
so, als würde er sich einen Reim auf etwas machen. »Ach, dann seid ihr<br />
die beiden, über die sie gesprochen hat.«<br />
»Hat sie wirklich über uns gesprochen?« sagte Katz. »Was hat sie denn<br />
gesagt?«<br />
»Ach, nichts weiter«, antwortete er und verkniff sich ein Lachen, das einem<br />
die nächste Frage abnötigte. »Was hat sie gesagt?«<br />
»Nichts. Es war nichts.« Er lachte immer noch.<br />
»Was denn nun?«<br />
Er war unschlüssig. »Na gut. Sie hat gesagt, ihr beide wärt zwei fettleibige<br />
Nieten, die keine Ahnung vom Wandern hätten, und daß sie keine Lust
mehr hätte, euch an die Hand zu nehmen.«<br />
»Das hat sie gesagt?« fragte Katz empört nach.<br />
»Ich glaube, sie hat euch sogar Schlappschwänze genannt.«<br />
»Schlappschwänze?« wiederholte Katz. »Jetzt hätte ich erst recht Lust, sie<br />
umzubringen.«<br />
»Es dürfte kein Problem sein, dafür Helfer zu finden«, sagte der Mann geistesabwesend,<br />
betrachtete kritisch den Himmel und fügte noch hinzu: »Es<br />
soll Schnee geben.«<br />
Ich stöhnte kurz auf. Das hatte uns gerade noch gefehlt. »Wirklich? Viel?«<br />
Er nickte. »15 bis 20 Zentimeter. Aber nur in den oberen Kammlagen.« Er<br />
zog gleichmütig die Augenbrauen hoch, wie zur Bestätigung meiner genervten<br />
Reaktion. Schnee war nicht nur abschreckend, Schnee war gefährlich.<br />
Er hing einen Augenblick der trüben Aussicht nach, dann sagte er: »Dann<br />
wollen wir mal wieder. Immer in Bewegung bleiben.« Ich nickte verständnisvoll.<br />
Dazu waren wir ja in den Bergen, um weiterzugehen, immer in<br />
Bewegung zu bleiben. Ich sah ihm nach und wandte mich Katz zu, der<br />
kopfschüttelnd dastand.<br />
»Stell dir vor, so was sagt die über uns, nach allem, was wir für sie getan<br />
haben«, meinte er. Dann merkte er, daß ich ihn wütend anstarrte, und er<br />
preßte sich ein mühsames »Was ist?« heraus, und dann noch gepreßter:<br />
»Was ist?«<br />
»Wehe, du vermiest mir noch einmal ein Stück Kuchen. Dann kannst du<br />
was erleben.«<br />
Er zuckte <strong>mit</strong> den Schultern. »Na gut, in Ordnung. Meine Güte«, sagte er<br />
und trottete weiter.<br />
Ein paar Tage später erfuhren wir, daß Mary Ellen aus dem Rennen war. Sie<br />
hatte sich bei dem Versuch, 56 Kilometer in zwei Tagen zurückzulegen,<br />
Blasen gelaufen. Schwerer Fehler.
6. Kapitel<br />
Geht man zu Fuß durch die Welt, nimmt man Entfernungen vollkommen<br />
anders wahr. Ein Kilometer ist ein Spaziergang, zwei Kilometer sind ein<br />
weiter Weg, zehn Kilometer ein ordentlicher Marsch, und 50 Kilometer<br />
hegen fast jenseits der Vorstellungskraft. Die Welt wird, das merkt man<br />
schnell, zu einem Riesenreich, das nur Sie und die kleine Schar Ihrer Mitwanderer<br />
kennen. Globales Denken heißt Ihr kleines Geheimnis.<br />
Außerdem ist das Leben einfach und geregelt. Zeit hat nicht die geringste<br />
Bedeutung mehr. Wenn es dunkel wird, legt man sich schlafen, wenn es hell<br />
wird, steht man auf, und alles, was dazwischen liegt, ist das, was dazwischen<br />
liegt. Mehr nicht. Es ist herrlich. Wirklich, glauben Sie mir. Man hat<br />
keine Termine, keine Bindungen, keine Verpflichtungen und keine Aufgaben,<br />
man hat auch keine besonderen Ambitionen, man hat nur die kleinsten,<br />
schlichtesten Wünsche, die sich leicht erfüllen lassen. Man existiert in einem<br />
Zustand der gelassenen Langeweile, der keine Aufgeregtheit etwas<br />
anhaben kann, »endlos fern von den Stätten des Streits«, wie es einer der<br />
früheren Forscher und Pflanzenkundler, William Bartram, ausdrückte. Das<br />
einzige, was einem abverlangt wird, ist die Bereitschaft weiterzutrotten.<br />
Eile ist völlig fehl am Platz, weil man nirgendwo hin muß. Egal, wie weit<br />
oder lange man wandert, man ist immer am gleichen Ort, im Wald. Da war<br />
man gestern, und da wird man morgen wieder sein. Der Wald ist grenzenlos<br />
in seiner Einzigartigkeit. Hinter jeder Wegbiegung eröffnet sich ein Ausblick,<br />
der sich von allen vorherigen nicht unterscheidet, und ein Blick in die<br />
Baumkronen bietet immer das gleiche Gewirr. Es könnte passieren, daß<br />
man sinnlos im Kreis geht, man würde es nicht merken. Aber eigentlich<br />
wäre das auch egal.<br />
Es gibt Momente, da ist man sich fast sicher, diesen einen Hügel vor drei<br />
Tagen schon mal hinaufgekraxelt zu sein, jenen Bach gestern schon mal<br />
überquert zu haben, und über diesen gestürzten Baum heute mindestens<br />
schon zweimal gestiegen zu sein, aber meistens kommt man gar nicht zum<br />
Denken. Es hat keinen Sinn. Statt dessen befindet man sich in einem Zustand,<br />
den man als Zen der Bewegung bezeichnen könnte. Der Verstand ist<br />
wie ein Fesselballon <strong>mit</strong> Seilen angebunden und begleitet den restlichen<br />
Körper nur, ist aber kein Teil von ihm. Das stundenlange, kilometerweite<br />
Gehen wird zu einer automatischen Angelegenheit, es geschieht fast ohne<br />
daß man es bemerkt, wie das Atmen. Am Ende des Tages denkt man nicht:<br />
»Mensch, heute habe ich 25 Kilometer geschafft«, genauso wenig wie man<br />
denkt: »Heute habe ich achttausendmal ein- und ausgeatmet.« Man macht<br />
es einfach. Punkt.<br />
Und so marschierten wir also, Stunde um Stunde, über Hügel und Berge,
wie auf einer Achterbahn, messerscharfe Kämme entlang und über grasbewachsene<br />
Kuppen, durch unermeßlich tiefe Wälder – Eiche, Esche, Kastanie<br />
und Fichte. Der Himmel wurde düsterer und die Luft kühler, aber erst<br />
am dritten Tag setzte der Schneefall ein. Es fing morgens an, <strong>mit</strong> einzelnen<br />
hauchzarten« Flocken, kaum wahrnehmbar. Dann kam Wind auf, und noch<br />
mehr Wind, bis er <strong>mit</strong> einer das Weltende ankündigenden Macht wehte, die<br />
selbst die Bäume in Angst und Schrecken versetzte. Mit dem Wind kam der<br />
Schnee, riesige Mengen. Um die Mittagszeit mußten wir gegen einen kalten,<br />
scharfen, wütenden Sturm ankämpfen, und kurz danach gelangten wir<br />
an ein schmales Gesims, über das der Weg eine Felswand entlang führte,<br />
Big Butt Mountain.<br />
Selbst bei idealen Wetterbedingungen erfordert der Pfad um den Big Butt<br />
viel Vorsicht und Geschick. Er sieht aus wie eine Fensterbank an einem<br />
Hochhaus, ist knapp 40 Zentimeter breit, an manchen Stellen bröckelig, zur<br />
einen Seite tut sich ein jäher Abgrund von etwa 25 Meter auf, zur anderen<br />
ragt eine bedrohlich steile Granitwand auf. Ein paarmal trat ich fußgroße<br />
Steinbrocken los und sah <strong>mit</strong> lähmendem Entsetzen, wie sie in die tiefsten<br />
Tiefen hinunterkrachten, ihren ewigen Ruhestätten entgegen. Der Pfad war<br />
<strong>mit</strong> Steinen gepflastert, durchwirkt von mäandernden Baumwurzeln, gegen<br />
die man fortwährend stieß oder über die man stolperte, und die, verdeckt<br />
unter einer Schicht Pulverschnee, von einer spiegelblanken Eisschicht überzogen<br />
waren. In häufigen, ermüdenden Abständen wurde der Weg von<br />
tiefen Bächen <strong>mit</strong> steinigem Grund gekreuzt, die zugefroren und vom Eis<br />
wie geriffelt waren und die man nur auf allen vieren überqueren konnte.<br />
Während der ganzen Zeit, in der wir diese irrsinnig schmale, gefährliche<br />
Kante entlanggingen, waren wir vom Schneegestöber wie geblendet und<br />
wurden von Windböen, die zwischen den schwankenden Bäumen pfiffen<br />
und uns an den Rucksäcken packten, beinahe umgestoßen. Das war kein<br />
Schneesturm, das war ein Schneegewitter. Wir kamen nur <strong>mit</strong> äußerster<br />
Behutsamkeit vorwärts, setzten den führenden Fuß erst ganz auf, bevor wir<br />
den hinteren hoben. Dennoch stieß Katz zweimal aus tiefster Seele comichafte<br />
Schreckenslaute von sich – Neihhhn! und Buahhh! –, als er nämlich<br />
den Halt verlor und ich mich umdrehte und sah, daß er <strong>mit</strong> angstgeweiteten<br />
Augen einen Baum umklammert hielt und <strong>mit</strong> strampelnden Füßen halb in<br />
der Luft hing.<br />
Es war nervenaufreibend. Wir brauchten zwei Stunden für 100 Meter. Als<br />
wir endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatten, in Bearpen Gap,<br />
lag der Schnee über zehn Zentimeter hoch, und es schneite immer noch. Die<br />
ganze Welt war weiß und voller münzengroßer Flocken, die schräg zur Erde<br />
fielen, bevor sie vom Wind aufgewirbelt und in alle Richtungen verweht<br />
wurden. Die Sichtweite betrug knapp fünf Meter, häufig nicht einmal das.
Der Pfad kreuzte eine Forststraße und führte dann direkt den Albert Mountain<br />
hinauf, einem steinigen Gipfel, 1.600 Meter über dem Meeresspiegel.<br />
Unten wehte ein heftiger und wütender Wind, der <strong>mit</strong> ohrenbetäubendem<br />
Sausen auf den Berg traf, so daß wir uns anbrüllen mußten, um uns zu verständigen.<br />
Wir kletterten ein Stück weit hinauf und zogen uns schleunigst<br />
wieder zurück. Mit einem schweren Rucksack hat man bestenfalls keinen<br />
richtigen Schwerpunkt, aber wir wurden hier beinahe im wahrsten Sinne des<br />
Wortes vom Winde verweht. Verwirrt standen wir am Fuß des Gipfels und<br />
sahen uns an. Es war wirklich eine prekäre Lage. Wir saßen fest zwischen<br />
einem Berg, den wir nicht erklimmen konnten, und einem Sims, über das<br />
wir auf keinen Fall zurückgehen wollten. Die einzige Möglichkeit, die uns<br />
< blieb, war, unsere Zelte aufzuschlagen – wenn das bei dem Wind überhaupt<br />
möglich war –, hineinzukriechen und das Beste zu hoffen. Ich will<br />
nicht übertreiben, aber es sind schon Menschen unter weniger dramatischen<br />
Umständen umgekommen.<br />
Ich setzte meinen Rucksack ab und suchte die Wanderkarte. Die Karten für<br />
den Appalachian Trail sind dermaßen unbrauchbar, daß ich längst aufgegeben<br />
hatte, sie zu Rate zu ziehen. Es gibt Unterschiede, aber die meisten sind<br />
unergründlicherweise im Maßstab l: 100.000 gezeichnet, wodurch 1.000<br />
Meter im Gelände auf der Karte zu einem einzigen Zentimeter schrumpfen.<br />
Stellen Sie sich einen Quadratkilometer Landschaft vor, und dazu alles, was<br />
sich auf dem Gebiet befindet – Forstwege, Bäche, ein oder zwei Gipfel,<br />
vielleicht ein Feuerwachturm, eine Kuppe, ein« grasbewachsene kahle Erhebung,<br />
der Appalachian Trail, und möglicherweise noch ein oder zwei<br />
Nebenwanderwege –, und nun versuchen Sie mal, diese ganze Information<br />
auf einer Fläche von der Größe eines Fingernagels unterzubringen. So sind<br />
die Karten für den AT.<br />
Eigentlich ist es sogar noch schlimmer, denn die AT-Karten sind aus mir<br />
völlig unverständlichen Gründen viel unvollständiger in den Details, als<br />
nach dem ohnehin dürftigen Maßstab nötig wäre. Von den zwölf oder noch<br />
mehr Gipfeln, die man auf zehn bis 15 Kilometern des Weges überquert,<br />
benennt die Karte vielleicht gerade mal drei. Täler, Seen, Schluchten, Bäche<br />
und andere wichtige, möglicherweise lebenswichtige topographische Merk-<br />
male bleiben notorisch unbezeichnet. Die Straßen und Wege des Forest<br />
Service sind oft nicht eingezeichnet, und wenn doch, dann sind sie uneinheitlich<br />
dargestellt. Selbst Nebenwege werden häufig ausgelassen. Es gibt<br />
keine Koordinaten und so<strong>mit</strong> keine Möglichkeit, im Notfall Retter an eine<br />
bestimmte Stelle zu dirigieren, und es finden sich keine Hinweise auf Städte,<br />
die un<strong>mit</strong>telbar jenseits des Kartenrandes liegen. Mit einem Wort, die<br />
AT-Karten sind absolut untauglich.<br />
Unter normalen Umständen wäre das nur ärgerlich. Jetzt aber, in einem
Schneesturm, grenzte es an Fahrlässigkeit. Ich zerrte die Karte aus meinem<br />
Rucksack und mußte schwer gegen den Wind ankämpfen, um einen Blick<br />
auf sie werfen zu können. Der Weg war als rote Linie eingezeichnet. In<br />
ihrer Nähe befand sich eine dicke schwarze Linie, die nach meiner Einschätzung<br />
der Forstweg des Forest Service sein mußte, neben dem wir standen,<br />
aber das ließ sich nicht <strong>mit</strong> letzter Sicherheit sagen. Nach der Karte zu<br />
urteilen, fing der Forstweg, wenn es denn einer war, <strong>mit</strong>ten im Wald an und<br />
endete nach ungefähr zehn Kilometern ebenfalls <strong>mit</strong>ten im Wald, was nun<br />
wirklich eindeutig unsinnig war, ja unmöglich. Eine Straße kann schlecht<br />
<strong>mit</strong>ten im Nichts anfangen, die Straßenbaumaschinen fallen ja nicht vom<br />
Himmel. Und selbst wenn man eine Straße baute, die ins Nichts führte –<br />
wieso? Irgend etwas war faul an dieser Karte.<br />
»Hat mich elf Dollar gekostet«, sagte ich zu Katz und wedelte ihm dabei<br />
wütend <strong>mit</strong> der Karte vor der Nase herum, faltete sie dann wieder einigermaßen<br />
flach zusammen und steckte sie in die Tasche.<br />
»Was sollen wir machen?« fragte er.<br />
Ich seufzte unsicher, zog dann wieder die Karte hervor und studierte sie<br />
noch mal. Ich schaute von der Karte hoch auf den Forstweg und wieder<br />
zurück. »Es sieht so aus, als würde der Forstweg um den Berg herumführen<br />
und auf der anderen Seite wieder auf den Wanderweg stoßen. Wenn das<br />
stimmt – und wenn Wir ihn finden, dann könnten wir zu der Schutzhütte<br />
gehen, die sich an der Stelle befindet. Und wenn wir nicht auf den Weg<br />
stoßen – ich weiß nicht – ich finde, dann sollten wir den Forst-Weg lieber<br />
bergab gehen und uns auf niedrigerer Höhe einen windgeschützten Platz<br />
zum Zelten suchen.« Ich zuckte hilflos <strong>mit</strong> den Achseln. »Ich weiß auch<br />
nicht. Was meinst du?«<br />
Katz sah in den Himmel, beobachtete die tanzenden Schneeflocken. »Also<br />
wenn du mich fragst«, sagte er nachdenklich, »ich» würde mich jetzt gern<br />
lange und ausgiebig in einem Whirlpool rekeln. Danach hätte ich gern ein<br />
saftiges Steak, dazu eine Folienkartoffel <strong>mit</strong> viel Sahnesoße, becherweise<br />
Sahnesoße, und dann eine heiße Nacht <strong>mit</strong> den Cheerleadern der Dallas<br />
Cowboys auf einem Tigerfell vor einem knisternden Kaminfeuer, so einem<br />
riesigen Kamin aus Stein, wie sie immer in den Skihotels stehen. Weißt du,<br />
welche ich meine?« Er sah mich fragend an. Ich nickte. »Also, das würde<br />
ich jetzt machen. Aber wenn du meinst, das, was du vorschlägst, würde<br />
mehr Spaß machen, bin ich gerne bereit, darauf einzugehen.« Er zupfte sich<br />
eine Schneeflocke von der Augenbraue. »Außerdem wäre es schade, wenn<br />
wir diesen ganzen herrlichen Schnee verpassen würden.« Er stieß ein kurzes,<br />
bitteres Lachen aus und wandte sich wieder dem irren Schneetreiben<br />
zu. Ich setzte meinen Rucksack auf und folgte ihm.<br />
Wir stapften den Forstweg hoch, tiefer gebeugt, vom Wind gepeitscht. An
den Stellen, wo der Schnee liegenblieb, war er naß und schwer und türmte<br />
sich immer höher, so daß es bald unmöglich sein würde weiterzugehen und<br />
wir Schutz suchen mußten, ob wir wollten oder nicht. Es gab nichts, wo<br />
man ein Zelt hätte aufschlagen können, bemerkte ich <strong>mit</strong> Besorgnis, zu<br />
beiden Seiten nur steiler, bewaldeter Hang. Über eine lange Strecke, länger<br />
als er laut Karte sein sollte, verlief der Forstweg schnurgerade, selbst wenn<br />
er weiter vorn auf den Wanderweg abbog, gab es keine Gewißheit – nicht<br />
mal eine Wahrscheinlichkeit –, daß wir den Trail auch tatsächlich finden<br />
würden. Mitten im Wald und bei dem Schnee konnte man wenige Meter<br />
neben dem Trail stehen und ihn trotzdem nicht sehen. Es wäre der reine<br />
Wahnsinn gewesen, den Forstweg zu verlassen und den Wanderweg zu suchen.<br />
Andererseits war es wahrscheinlich genauso wahnsinnig, dem Forstweg<br />
bei Schneesturm bis in höchste Lagen zu folgen.<br />
Ganz allmählich, und schließlich deutlich erkennbar, fing der Weg an, um<br />
den Berg herum zu führen. Nachdem wir uns ungefähr eine Stunde lang<br />
schwerfällig durch immer tieferen Schnee vorgearbeitet hatten, kamen wir<br />
an eine flache Stelle, wo der Wanderweg – jedenfalls irgendein Wanderweg<br />
– auf der Rückseite des Albert Mountain auftauchte und weiter in ein ebenes<br />
Waldgebiet führte. Ich sah verdutzt und wütend auf meine Karte. Sie<br />
enthielt keinerlei Hinweis auf diese Stelle, aber dann entdeckte Katz eine -<br />
weiße Markierung 15 Meter weiter zwischen den Bäumen, und wir schrien<br />
vor Freude. Wir hatten den Appalachian Trail wiedergefunden. Nur ein paar<br />
hundert Meter weiter befand sich eine Schutzhütte. Der Wandergott war uns<br />
noch einmal gnädig gewesen.<br />
Der Schnee reichte uns schon bis zu den Knien, und wir waren müde. Wir<br />
staksten durch die weiße Pracht, so gut es ging, und Katz schrie noch einmal<br />
vor Freude auf, als wir an ein Hinweisschild kamen, das an einem Ast<br />
befestigt war und auf einen Weg zum Big Spring Shelter hinwies. Die<br />
Schutzhütte, eine einfache Holzkonstruktion, zu einer Seite offen, stand auf<br />
einer verschneiten Lichtung, einem traumhaften Winterwunderland, gut 100<br />
Meter neben dem Hauptwanderweg. Selbst aus der Entfernung konnten wir<br />
erkennen, daß die offene Seite dem Wind zugekehrt war und daß eine<br />
Schneewehe bis zum Rand des Schlafpodestes reichte. Wenn schon nicht<br />
mehr, dann bot die Hütte wenigstens eine Zuflucht.<br />
Wir überquerten die Lichtung, setzten unsere Rucksäcke auf dem Podest ab<br />
und sahen im selben Moment, daß noch zwei andere Menschen da waren –<br />
ein Mann und ein etwa 14 Jahre alter Junge. Jim und Heath, Vater und<br />
Sohn, kamen aus Chattanooga, und die beiden waren gutgelaunt, freundlich<br />
und ließen sich nicht im mindesten von dem Wetter abschrecken. Sie seien<br />
nur für eine Wochenendtour hergekommen, sagten sie uns (ich hatte gar<br />
nicht gemerkt, daß Wochenende war), und wußten, daß das Wetter schlimm
werden würde, deswegen waren sie entsprechend ausgerüstet. Jim hatte eine<br />
große Plastikfolie gekauft, <strong>mit</strong> der sonst Maler den Boden auslegen, und<br />
versuchte gerade, da<strong>mit</strong> die offene Vorderfront abzudichten. Katz eilte zur<br />
Hilfe, was ganz untypisch für ihn war. Die Plastikfolie reichte nicht, aber<br />
dann fanden wir heraus, daß sie, verknüpft <strong>mit</strong> einem unserer Zeltböden,<br />
doch die gesamte Front abdeckte. Der Wind brauste hart gegen die Folie,<br />
und gelegentlich riß sie sich teilweise los, dann flatterte und knatterte sie,<br />
klatschte zurück, was sich wie ein Pistolenschuß anhörte, bis einer von uns<br />
aufsprang und sie unter Mühen wieder festband. Die ganze Schutzhütte war<br />
sowieso unglaublich zugig, in den seitlichen Holzplanken und den Bodendielen<br />
waren Risse, durch die eisiger Wind pfiff und ab und zu eine<br />
Schneeböe; trotzdem war es natürlich viel gemütlicher als draußen.<br />
Wir schufen uns ein kleines Zuhause, breiteten unsere Isomatten und<br />
Schlafsäcke aus, zogen alle Ersatzkleider an, die wir dabeihatten und bereiteten<br />
unser Essen im Liegen zu. Sehr bald setzte die Dämmerung ein, die<br />
die Wildnis draußen noch undurchdringlicher erscheinen ließ. Jim und<br />
Heath hatten Schokoladenkuchen dabei, den sie <strong>mit</strong> uns teilten (ein himmlisches<br />
Vergnügen), danach richteten wir vier uns auf eine lange, kalte Nacht<br />
auf hartem Holzboden ein und lauschten dem geisterhaften Wind und seinem<br />
wütenden Zerren an den Ästen.<br />
Als ich aufwachte, herrschte reine Stille um mich herum, eine Stille, die<br />
einen zwingt, sich aufzurichten und sich erstmal zu orientieren. Die Plastikfolie<br />
vor mir war ungefähr ein Fußbreit hochgeschlagen, und ein schwaches<br />
Licht erfüllte den Raum dahinter. Der Schnee reichte fast bis zum Podest<br />
und lag am Fußende meines Schlafsacks ein paar Zentimeter hoch. Ich bewegte<br />
die Beine und schüttelte ihn da<strong>mit</strong> ab. Jim und Heath rumorten bereits.<br />
Katz schlief noch tief und fest, einen Arm quer über der Stirn, den<br />
Mund weit aufgerissen, wie ein großes Loch. Es war noch keine sechs Uhr.<br />
Ich beschloß aufzustehen und das Gelände zu erkunden, um zu sehen, ob<br />
wir nicht etwa in einer Falle saßen. Am Rand des Podestes zögerte ich, dann<br />
sprang ich hinunter in die Schneeverwehung – sie reichte mir bis zur Taille,<br />
und meine Augen weiteten sich vor Schreck, als der Schnee ins Hosenbein<br />
geriet und auf die nackte Haut kam – und kämpfte mich vor bis zur Lichtung,<br />
wo der Schnee nicht ganz so tief war. Selbst an geschützten Stellen,<br />
unter einem Dach aus Nadelbäumen, lag der Schnee kniehoch, und es war<br />
mühsam, sich einen Weg zu bahnen. Der Anblick war trotzdem überwältigend.<br />
Jeder Baum trug einen dicken weißen Pelz, jeder Stumpf und Stein<br />
ein flottes Schneehütchen, und es herrschte jene phantastische Stille, die<br />
sich nur in einem großen verschneiten Wald einstellt. Hier und da plumpsten<br />
Schneeklumpen von den Zweigen, aber sonst gab es kein Geräusch und<br />
keine Bewegung. Ich folgte dem Seitenweg unter den schwer beladenen,
tiefhängenden Ästen bis zu der Kreuzung, an der er auf den Trail traf. Der<br />
AT lag unter einer dicken Schneedecke, rundlich und bläulich, ein langes,<br />
schummriges Gewölbe aus Rhododendren. Das sah nach einem höchst<br />
beschwerlichen Weg aus. Ich stapfte ein paar Meter vor, um zu testen, wie<br />
es sich ging. Es sah nicht nur so aus, es war tatsächlich ein höchst beschwerlicher<br />
Weg.<br />
Als ich wieder zur Hütte kam, war Katz aufgestanden, bewegte sich langsam,<br />
gab sich dem allmorgendlichen Stöhnen und Räkeln hin. Jim studierte<br />
seine Karten, die viel genauer waren als meine. Ich hockte mich neben ihn,<br />
und er machte Platz, da<strong>mit</strong> ich auch etwas sehen konnte. Bis Wallace Gap<br />
und zu einer asphaltierten Straße, der alten U.S. 64, waren es 9,8 Kilometer.<br />
Anderthalb Kilometer weiter die Straße entlang lag der Rambow Spring<br />
Campground, ein Campingplatz <strong>mit</strong> Duschen und einem Laden. Ich hatte<br />
keine Ahnung, wie schwierig es sein würde, zehn Kilometer durch den<br />
tiefen Schnee zu wandern, und ich konnte auch nicht darauf bauen, daß der<br />
Platz zu dieser Jahreszeit bereits geöffnet war. Dennoch war klar, daß diese<br />
Schneemassen in den kommenden paar Tagen nicht schmelzen würden, und<br />
irgendwann mußten wir ja sowieso gehen, warum dann nicht gleich jetzt,<br />
wo es noch hübsch und ruhig war. Wer weiß, was passieren würde, wenn<br />
ein neuer Schneesturm einsetzte und wir dann erst recht aufgeschmissen<br />
wären.<br />
Jim hatte beschlossen, daß er und Heath uns die ersten paar Stunden begleiten<br />
und dann auf einen Nebenwanderweg abbiegen würden, den Long<br />
Branch, der auf 2,7 Kilometern steil in eine Schlucht hinabführte und an<br />
einem Parkplatz endete, auf dem sie ihren Wagen abgestellt hatten. Jim war<br />
den Long Branch Trail bereits mehrere Male entlanggewandert und wußte,<br />
was auf ihn zukam. Trotzdem gefiel mir schon der Name nicht, und ich<br />
fragte Jim zögerlich, ob es wirklich gut sei, einen wenig benutzten Nebenweg<br />
zu gehen, unter wer weiß was für Bedingungen, wo niemand sie finden<br />
würde, wenn er und sein Sohn in Gefahr gerieten. Katz pflichtete mir zu<br />
meiner Erleichterung bei. »Auf dem AT sind wenigstens immer noch andere<br />
Leute«, sagte er. »Auf den Nebenwegen weiß man nie, was einem passieren<br />
kann.« Jim überlegte kurz und sagte, sie würden zurückkommen, wenn<br />
es zu brenzlig werden würde.<br />
Katz und ich gönnten uns zwei Tassen Kaffee, um warm zu werden, und<br />
Jim und Heath gaben uns von ihren Haferflocken ab, was Katz in Hochlaune<br />
versetzte. Dann machten wir uns alle vier auf den Weg. Es war kalt, und<br />
das Gehen fiel schwer. Das Gewölbe aus tiefhängenden Rhododendronbüschen,<br />
das sich über lange Wegstrecken hinzog, war zwar ausnehmend<br />
hübsch anzusehen, aber wenn der Rucksack die Zweige streifte, entluden<br />
sich Schneemassen auf unsere Köpfe und rutschten in den Nacken hinunter.
Die drei Erwachsenen gingen abwechselnd voran, denn die erste Person<br />
bekam immer das meiste ab und mußte zudem noch die Spur im Schnee<br />
austreten, was ziemlich anstrengend war.<br />
Der Long Branch Trail führte steil zwischen Fichten bergab, für mein Empfinden<br />
zu steil, um ihn wieder hochzuklettern, wenn sich der Weg als unpassierbar<br />
erwies, und so sah er aus. Katz und ich bedrängten Jim und<br />
Heath, sich die Sache noch einmal zu überlegen, aber Jim meinte, der Weg<br />
ginge nur bergab und sei gut markiert und er sei sicher, daß nichts passieren<br />
werde. »Wißt ihr, was heute für ein Tag ist?« sagte Jim plötzlich und lieferte<br />
auch gleich die Antwort, als er unsere fragenden Mienen sah. »Der 21.<br />
März.«<br />
Unsere Mienen blieben unverändert.<br />
»Frühlingsanfang«, sagte er.<br />
Wir mußten über diese Ironie des Schicksals lachen, dann gaben wir uns die<br />
Hand, wünschten uns gegenseitig gutes Gelingen und trennten uns. Katz<br />
und ich stiefelten noch drei Stunden schweigsam durch den kalten, verschneiten<br />
Wald und wechselten uns beim »Schneepflügen« ab. Gegen ein<br />
Uhr kamen wir schließlich an die alte U.S. 64, eine abgeschiedene, stillgelegte<br />
zweispurige Straße quer durch die Berge. Sie war nicht geräumt worden,<br />
und man sah keine Reifenspuren. Es fing wieder an zu schneien, und<br />
die Flocken fielen ganz gleichmäßig, was sehr hübsch aussah. Wir folgten<br />
der Straße Richtung Campingplatz und waren gerade einige hundert Meter<br />
weit gegangen, als wir hinter uns das knirschende Geräusch eines schweren<br />
Kraftfahrzeuges vernahmen, das sich vorsichtig seinen Weg durch den<br />
Schnee bahnte. Wir drehten uns um und sahen ein großes jeepähnliches<br />
Gefährt auf uns zurollen. Das Fenster an der Fahrertür glitt herunter. Es<br />
waren Jim und Heath. Sie wollten uns nur Bescheid geben, daß sie es geschafft<br />
hatten, und sie wollten wissen, wie es uns ergangen sei. »Wir können<br />
euch zum Campingplatz <strong>mit</strong>nehmen, wenn ihr möchtet«, sagte Jim.<br />
Wir stiegen dankbar ein, verschmutzten das schöne Auto <strong>mit</strong> reichlich<br />
Schnee und fuhren zum Campingplatz. Jim sagte uns, daß sie auf der Hinfahrt<br />
an dem Platz vorbeigekommen seien und daß es so ausgesehen habe,<br />
als sei geöffnet, aber daß sie uns bis zur nächsten Stadt, Franklin, bringen<br />
würden, wenn er geschlossen wäre. Sie hatten schon den Wetterbericht<br />
gehört. Für die nächsten Tage war noch mehr Schnee angekündigt.<br />
Die beiden setzten uns am Campingplatz ab – er war tatsächlich geöffnet –<br />
und -winkten zum Abschied. Rainbow Springs war ein kleiner privater Platz<br />
<strong>mit</strong> mehreren Hütten zum Übernachten, einem Waschraum und einigen<br />
Nebengebäuden, die verstreut um einen größeren, ebenen, offenen Platz<br />
herum gruppiert waren, der wohl für Campingbusse und Wohnmobile gedacht<br />
war. In einem alten weißen Haus am Eingang war das Büro un-
tergebracht, das gleichzeitig Haushaltswarenladen und Lebens<strong>mit</strong>telgeschäft<br />
war. Wir traten ein und stellten fest, daß alle Wanderer, denen wir auf den<br />
letzten 30 Kilometern begegnet waren, sich bereits eingefunden hatten; die<br />
meisten hockten um einen großen Holzofen herum, wärmten sich, aßen<br />
Chili oder leckten Eis, hatten rote Backen und sahen proper aus. Drei oder<br />
vier von ihnen kannten wir schon. Die Betreiber des Campingplatzes waren<br />
Buddy und Jensine Crossman, die einen angenehmen und freundlichen<br />
Eindruck machten, und wenn es nur daran lag, daß die Geschäfte im Monat<br />
März selten so gut liefen wie in diesem Jahr. Ich erkundigte mich nach einer<br />
Hütte.<br />
Jensine drückte ihre Zigarette aus und lachte über meine naive Frage, was<br />
gleich einen kleinen Hustenanfall bei ihr auslöste. »Die Hütten sind seit<br />
zwei Tagen ausgebucht, mein Lieber. In der Schlafbaracke sind noch zwei<br />
Plätze frei. Alle, die danach kommen, müssen auf dem Boden schlafen.«<br />
Schlafbaracke ist kein Wort, das man in meinem Alter besonders gern hört,<br />
aber uns blieb keine andere Wahl. Wir trugen uns ins Gästebuch ein, bekamen<br />
zwei sehr kleine, brettharte Handtücher und stapften über den Platz<br />
unserem Quartier entgegen, gespannt, was man für elf Dollar erwarten durfte.<br />
Die Antwort lautete: am besten gar nichts.<br />
Das Barackenlager war so spartanisch und häßlich, daß einem gruselte. Der<br />
Raum wurde beherrscht von zwölf schmalen Schlafkojen aus Holz, jeweils<br />
drei übereinander. Auf jeder Koje lag eine dünne, nackte Matratze und ein<br />
schmuddeliges, <strong>mit</strong> Schaumstoffschnipseln gefülltes Kissen ohne Bezug. In<br />
einer Ecke stand ein leise vor sich hin zischender Kanonenofen, von einem<br />
Halbkreis ausgelatschter Wanderschuhe umstellt und <strong>mit</strong> nassen Wollsokken<br />
behängt, von denen üble Dämpfe aufstiegen. Ein kleiner Holztisch und<br />
zwei kaputte Sessel, aus denen die Polsterung hervorquoll, vervollständigten<br />
das Mobiliar. Überall lagen Sachen herum – Zelte, Kleider, Rucksäcke,<br />
Regenhauben - zum Trocknen aufgehängt, träge tropfend. Der Boden war<br />
aus nacktem Beton, die Wände aus nicht isolierten Spanplatten. Es war das<br />
Gegenteil von einladend, etwa so, als würde man in einer Garage campen.<br />
»Willkommen im Gulag«, sagte ein Mann <strong>mit</strong> einem ironischen Grinsen<br />
und britischem Akzent. Er hieß Peter Fleming, war Dozent in New Brunswick<br />
und für eine Woche zum Wandern in den Süden gekommen, aber<br />
dann, wie wir alle, vom Schnee überrascht worden. Er stellte uns die anderen<br />
vor – jeder grüßte <strong>mit</strong> einem freundlichen, aber abwesenden Nicken –<br />
und deutete auf die beiden freien Betten, eins ganz oben, fast unter der Dekke,<br />
das andere ganz unten, am anderen Ende des Raums.<br />
»Rot-Kreuz-Päckchen werden jeden letzten Freitag im Monat ausgegeben,<br />
und heute abend um 19 Uhr trifft sich das Ausbruchsko<strong>mit</strong>ee zur Lagebesprechung.<br />
Mehr braucht ihr vorerst nicht zu wissen.«
»Und bestellt bloß nicht das Philly-Sandwich, wenn ihr nicht die ganze<br />
Nacht kotzen wollt«, tönte eine schwache, aber aufrichtige Stimme von<br />
einer finsteren Koje in der Ecke.<br />
»Das ist Tex«, erklärte Fleming. Wir nickten.<br />
Katz suchte sich das oberste Bett aus und begab sich an die langwierige,<br />
herausfordernde Aufgabe, es zu erklimmen. Ich ging zu meiner eigenen<br />
Koje und untersuchte sie fasziniert und angewidert zugleich. Nach den<br />
Flecken auf der Matratze zu urteilen, hatte der letzte Benutzer nicht an Inkontinenz<br />
gelitten, sondern sich vielmehr ihrer erfreut. Offenbar hatte er das<br />
Kissen in seine Freuden <strong>mit</strong> einbezogen. Ich nahm es in die Hand und roch<br />
daran, was ich lieber hätte bleiben lassen sollen. Ich breitete meinen Schlafsack<br />
aus, hängte ein Paar Socken über den Ofen und noch ein paar andere<br />
Sachen zum Trocknen auf, setzte mich dann auf die Bettkante und verbrachte<br />
eine gemütliche halbe Stunde gemeinsam <strong>mit</strong> dem Rest der Stube da<strong>mit</strong>,<br />
Katz bei seinem verbissenen Kampf, in die Koje zu gelangen, zuzuschauen.<br />
Es wurde alles geboten, tiefes Grunzen, zappelnde Beine, Flüche und Aufforderungen<br />
an die Zuschauer, sie könnten ihn gefälligst mal am Arsch<br />
lecken. Ich konnte von meinem Platz aus allerdings nur seinen enormen<br />
Hintern und seine Gliedmaßen erkennen.<br />
Seine Haltung ließ an einen Schiffbrüchigen denken, der sich an einem in<br />
der rauhen See treibenden Wrackteil festhielt, oder an jemanden, der von<br />
einem Wetterballon, den er gerade hatte starten wollen, unerwarteterweise<br />
in die Luft hochgehoben worden war – auf alle Fälle an jemand, der sich in<br />
einer gefährlichen Situation ans Leben klammerte. Ich packte mein Kissen,<br />
ging zu ihm und fragte ihn, warum er nicht einfach mein Bett nahm.<br />
Sein Gesicht war erhitzt und zerfurcht, ich bin mir nicht einmal sicher, ob er<br />
mich in diesem Moment erkannte. »Weil Wärme nach oben steigt, deswegen«,<br />
sagte er, »und wenn ich oben bin -falls es je dazu kommen sollte –,<br />
dann lasse ich mich schön rösten.« Ich nickte zustimmend – wenn Katz aus<br />
der Puste war oder sich in etwas verbissen hatte, war es sinnlos, vernünftig<br />
<strong>mit</strong> ihm zu diskutieren – und nutzte die Gelegenheit, heimlich unsere Kissen<br />
zu tauschen.<br />
Als das Bild des Jammers einfach nicht mehr zu ertragen war, schubsten wir<br />
Katz zu dritt hoch. Er plumpste schwer auf, wobei die Holzbretter beängstigend<br />
knackten, was den armen stillen Manninder Koje darunter in Panik<br />
versetzte. Dann verkündete Katz, er werde sich so lange nicht vom Fleck<br />
rühren, bis aller Schnee geschmolzen sei und der Frühling in den Bergen<br />
Einzug gehalten habe. Da<strong>mit</strong> kehrte er uns den Rücken zu und schlief ein.<br />
Ich stapfte durch den Schnee hinüber in den Waschraum, aus purer Lust, in<br />
eisiges Wasser zu patschen, begab mich dann zu dem Laden und lungerte<br />
<strong>mit</strong> einem halben Dutzend anderer Leute um den Ofen herum. Was sollte
man sonst machen? Ich verdrückte zwei Teller Chili, die Spezialität des<br />
Hauses, und lauschte der allgemeinen Unterhaltung. Sie wurde zwar hauptsächlich<br />
von Buddy und Jensine bestritten, die über die Gäste des Vortags<br />
meckerten, aber es tat gut, mal andere Stimmen als die von Katz zu hören.<br />
»Die hättet ihr mal sehen sollen«, sagte Jensine angewidert und zupfte sich<br />
einen Tabakkrümel von der Lippenspitze. »Kein Bitte, kein Danke. Nicht<br />
wie ihr, Leutchen. Ihr seid ja die reinste Frischzellenkur dagegen, könnt ihr<br />
mir glauben. Und die Schlafbaracke haben sie in einen regelrechten<br />
Schweinestall verwandelt. Stimmt’s, Buddy?« Sie gab das Kommando an<br />
Buddy weiter.<br />
»Hat mich eine Stunde Saubermachen heute morgen gekostet«, sagte er<br />
verbittert. Die Bemerkung verblüffte mich, denn die Schlafbaracke sah aus,<br />
als hätte sie in den letzten 100 Jahren keinen Besen gesehen. »Auf dem<br />
Boden waren überall Pfützen, und einer, ich weiß nicht wer, hat ein verdrecktes<br />
altes Baumwollhemd dagelassen, das einfach ekelhaft war. Und<br />
obendrein haben sie alles Brennholz verbraucht. Gestern habe ich das Holz<br />
von drei Tagen Holzhacken reingeschafft, und die haben alle Scheite verbrannt.«<br />
»Wir waren heilfroh, als sie abgehauen sind«, sagte Jensine. »Heilfroh. Die<br />
waren nicht wie ihr, Leutchen. Ihr seid ja die reinste Frischzellenkur dagegen,<br />
könnt ihr mir glauben.« Dann zog sie von dannen, -weil das Telefon<br />
klingelte. Ich saß neben einem der drei Studenten von der Rutgers Umversity,<br />
denen wir seit dem zweiten Tag immer wieder über den Weg gelaufen<br />
waren. Sie hatten jetzt eine Hütte für sich, aber die Nacht davor hatten sie in<br />
der Schlafbaracke verbracht. Er beugte sich zu mir herüber und raunte mir<br />
im Flüsterton zu: »Das gleiche hat sie gestern über die Leute gesagt, die<br />
vorgestern hier waren. Und morgen sagt sie das gleiche über uns. Gestern<br />
abend waren wir 15 in der Schlafbaracke.«<br />
»15?« wiederholte ich entgeistert. Mit zwölf war es ja schon kaum noch<br />
erträglich. »Wo haben denn die überzähligen drei gepennt?«<br />
»Auf dem Boden. Und mußten trotzdem die elf Dollar abdrücken. Wie<br />
schmeckt dir das Chili?«<br />
Ich sah auf meinen Teller, als hätte ich mir noch keine Gedanken darüber<br />
gemacht, und es stimmte, ich hatte mir tatsächlich noch keine Gedanken<br />
über das Essen gemacht. »Eigentlich grauenvoll.«<br />
Er nickte. »Warte ab, wenn du es erstmal zwei Tage hintereinander gegessen<br />
hast.«<br />
Auf dem Weg zurück zur Schlafbaracke schneite es immer noch, allerdings<br />
nicht mehr so heftig. Katz war wach und schwer beschäftigt, rauchte eine<br />
geschnorrte Zigarette und bat die Leute, ihm verschiedene Sachen – Schere,<br />
Halstuch, Streichhölzer – heraufzureichen, wenn er sie brauchte, und sie
ihm wieder abzunehmen, wenn er fertig war. Drei Leute standen am Fenster<br />
und sahen hinaus in den Schnee. Die Unterhaltung drehte sich ausschließlich<br />
ums Wetter. Schwer zu sagen, wann wir hier herauskämen. Es<br />
war unmöglich, sich nicht wie ein Gefangener zu fühlen.<br />
Wir verbrachten eine miserable Nacht auf unseren Kojen, beim schwachen<br />
Licht der flackernden Glut im Ofen, den der schüchterne Mensch eifrig<br />
fütterte – er konnte oder wollte wegen der sich hin und her wälzenden Körpermasse<br />
von Katz, der die Bretter direkt über seinem Kopf durchbog, nicht<br />
schlafen. Man war eingelullt von einer Gemeinschaftssymphonie aus nächtlichen<br />
Geräuschen, Seufzern, müdem Ausatmen, schepperndem Schnarchen,<br />
dem ununterbrochenen Todesröcheln des Mannes, der das Philly-<br />
Sandwich <strong>mit</strong> Bratenaufschnitt und Käse gegessen hatte, und dem eintönigen<br />
Zischen des Ofens. Es war wie der Soundtrack zu einem alten Film.<br />
Wir wachten steif und unausgeschlafen bei einem trüben Tagesanbruch auf.<br />
Es schneite, und uns blieb nur die entmutigende Aussicht auf einen sehr<br />
langen Tag, an dem man nichts anderes machen konnte, als sich im Laden<br />
die Zeit zu vertreiben oder auf seiner Koje zu liegen und alte Ausgaben von<br />
Reader’s Digest zu lesen, die ein kleines Regal neben der Tür füllten. Dann<br />
hieß es plötzlich, daß ein beflissener junger Mann namens Zack aus einer<br />
der Hütten sich irgendwie nach Franklin durchgeschlagen und einen Minibus<br />
gemietet hatte und anbot, uns für fünf Dollar pro Nase in die Stadt zu<br />
bringen. Es setzte eine regelrechte Massenflucht ein. Zum Leidwesen von<br />
Buddy und Jensine zahlten fast alle Gäste und brachen auf. 14 Leute<br />
quetschten sich in den Minibus und begaben sich auf die lange Fahrt nach<br />
Franklin, das tief unten in einem schneefreien Tal lag.<br />
So kamen wir zu einem Kurzurlaub in Franklin, einem kleinen, trostlosen<br />
Ort, darauf bedacht, möglichst reizlos zu erscheinen, einem Ort, an dem<br />
man aus Mangel an anderer Zerstreuung die Männer im Sägewerk beim<br />
Verladen von Holzstämmen <strong>mit</strong> dem Gabelstapler beobachtet. Es gab<br />
nichts, aber auch gar nichts, keinen Laden, in dem man ein Buch hätte kaufen<br />
können, geschweige denn eine Zeitschrift, die nicht von Rennbooten,<br />
aufgemotzten Autos oder Waffen und Munition handelte. In dem Städtchen<br />
wimmelte es von Wanderern, die, genau wie wir, aus den Bergen vertrieben<br />
worden waren und nichts anderes zu tun hatten, als lustlos im Diner oder im<br />
Waschsalon herumzuhängen und zwei- bis dreimal am Tag ans andere Ende<br />
der Main Street zu pilgern und einen verzweifelten Blick auf die fernen,<br />
schneebedeckten und offenkundig unpassierbaren Berge zu werfen. Die<br />
Aussichten standen nicht gut. Das Gerücht machte die Runde, in den Smokies<br />
gäbe es zwei Meter hohe Schneeverwehungen. Es würde Tage dauern,<br />
bis der Weg wieder frei wäre.<br />
Ich verfiel dadurch in eine Art unruhige Niedergeschlagenheit, die sich
noch verschlimmerte, als ich merkte, daß Katz bei der Aussicht, sich mehrere<br />
Tage ohne einen bestimmten Zweck, frei von Strapazen, in der Stadt<br />
herumtreiben und verschiedene Möglichkeiten der Zerstreuung ausprobieren<br />
zu können, im siebten Himmel schwebte. Zu meinem Verdruß hatte er<br />
sich bereits eine Fernsehzeitung besorgt, um seinen Fernsehkonsum in den<br />
nächsten Tagen effektiver zu planen.<br />
Ich wollte nur noch zurück auf den Trail, Kilometer fressen. Deswegen<br />
waren wir hergekommen. Außerdem langweilte ich mich schrecklich. Es<br />
war eine Langeweile jenseits von Gut und Böse. Ich vertrieb mir <strong>mit</strong>tlerweile<br />
schon die Zeit <strong>mit</strong> der Lektüre der Platzdeckchen in den Restaurants,<br />
danach drehte ich sie um und schaute nach, ob die Rückseite auch bedruckt<br />
war. In dem Sägewerk unterhielt ich mich <strong>mit</strong> den Arbeitern über den Zaun<br />
hinweg. Am späten Nach<strong>mit</strong>tag des dritten Tages war ich im Burger King<br />
und betrachtete in tiefer Versunkenheit die Fotos des Geschäftsführers und<br />
seiner Mannschaft – wobei mir der merkwürdige Umstand ins Auge fiel,<br />
daß Leute, die in der Pommes- und Hamburger-Industrie arbeiten, immer so<br />
aussehen, als hätten ihre Mütter was <strong>mit</strong> Goofy gehabt –, trat dann einen<br />
Schritt zur Seite und las die Auszeichnungen für die »Mitarbeiter des Monats«.<br />
In dem Moment wurde mir klar, daß ich unbedingt von hier abhauen<br />
mußte.<br />
20 Minuten später gab ich Katz bekannt, daß wir am nächsten Morgen wieder<br />
auf dem Weg sein würden. Er war natürlich entsetzt. »Am Freitag läuft<br />
Akte X«, stotterte er. »Ich habe gerade Cream-Soda gekauft.«<br />
»Die Enttäuschung muß schrecklich sein«, erwiderte ich <strong>mit</strong> einem trockenen,<br />
herzlosen Lächeln.<br />
»Und der Schnee? Da kommen wir nie durch.«<br />
Ich zuckte die Achseln, was optimistisch wirken sollte, aber vermutlich eher<br />
Ausdruck von Gleichgültigkeit war. »Vielleicht doch.«<br />
»Und wenn nicht? Was ist, wenn wieder ein Schneesturm aufzieht? Wir<br />
können von Glück sagen, daß wir beim letzten Sturm <strong>mit</strong> dem Leben davongekommen<br />
sind, wenn du mich fragst.« Er sah mich <strong>mit</strong> einem verzweifelten<br />
Blick an. »Ich habe 18 Dosen Cream-Soda auf meinem Zimmer«,<br />
stieß er hervor und bereute es umgehend.<br />
Ich zog ungläubig die Augenbrauen hoch. »18? Willst du dich hier häuslich<br />
niederlassen?«<br />
»Es war ein Sonderangebot«, murmelte er entschuldigend und zog sich in<br />
seinen Schmollwinkel zurück.<br />
»Es tut mir leid, wenn ich dir deine Festtagslaune verderbe, Stephen, aber<br />
wir sind doch nicht den ganzen Weg hierhergekommen, um fernzusehen<br />
und Cream-Soda zu trinken.«<br />
»Ich bin auch nicht hergekommen, um mir unterwegs den Tod zu holen«,
sagte er, stritt aber nicht weiter <strong>mit</strong> mir herum.<br />
Wir gingen los, und wir hatten Glück. Der Schnee war tief, aber passierbar.<br />
Ein einsamer Wanderer, noch ungeduldiger als wir, war schon vor uns<br />
durchgestapft und hatte den Schnee auf dem Trail ein bißchen plattgetreten,<br />
was eine große Hilfe war. Auf den steilen Abstiegen war es glatt – Katz fiel<br />
andauernd auf den Rücken, rutschte aus, fluchte wild –, und in höheren<br />
Lagen mußten wir gelegentlich um ausgedehnte Schneefelder herumgehen,<br />
aber es gab keine einzige Stelle, die unpassierbar war.<br />
Das Wetter besserte sich ebenfalls. Die Sonne kam heraus, die Luft wurde<br />
milder, die Gebirgsbäche hörten sich durch den Zulauf des plätschernden<br />
und glucksenden Schmelzwassers wieder munterer an. Ich vernahm sogar<br />
zaghaftes Vogelgezwitscher. Oberhalb von 1.300 Meter war der Schnee<br />
liegengeblieben, und die Luft war eisig, aber weiter unten zog sich der<br />
Schnee portionsweise <strong>mit</strong> jedem Tag weiter zurück, bis am dritten Tag nur<br />
noch vereinzelte Flecken an den schattigen Stellen der Hänge zu sehen<br />
waren. Es war alles überhaupt nicht schlimm, nur wollte Katz das nicht<br />
zugeben. Das war mir egal. Ich wollte nur gehen. Ich war sehr, sehr glücklich.
7. Kapitel<br />
Zwei Tage lang wechselte Katz kaum ein Wort <strong>mit</strong> mir. Am zweiten Abend<br />
hörte ich ein ungewohntes Geräusch aus seinem Zelt – das Zischen einer<br />
Getränkedose, die geöffnet wird – und er sagte streitlustig: »Weißt du, was<br />
das ist, <strong>Bryson</strong>? Cream-Soda. Und soll ich dir noch etwas verraten? Ich<br />
trinke sie gerade, und du kriegst nichts davon ab. Sie schmeckt köstlich.« Es<br />
folgte ein absichtlich verstärktes Schlürfen. »Hmmmmmm. Einfach köstlich.«<br />
Noch ein Schluck. »Soll ich dir sagen, warum ich sie trinke? Es ist<br />
neun Uhr, und Akte X hat gerade angefangen, meine absolute Lieblingssendung.«<br />
Man hörte ein lang anhaltendes Gluckern, dann wurde der Reißverschluß<br />
des Zeltes aufgezogen, eine Dose landete <strong>mit</strong> einem Scheppern auf<br />
dem Boden. Dann wurde der Reißverschluß wieder zugezogen. »Mensch,<br />
das tat gut. Und jetzt kannst du mich mal, gute Nacht.«<br />
Da<strong>mit</strong> war die Sache erledigt. Am nächsten Morgen war er wieder gut aufgelegt.<br />
Katz konnte sich nie so recht für das Wandern erwärmen, obwohl er sich<br />
wirklich alle Mühe gab. Ich glaube, nur ganz gelegentlich bekam er eine<br />
Ahnung davon, daß es beim Wandern draußen im Wald etwas gab – etwas<br />
schwer Faßbares und Elementares – was einem tiefe Zufriedenheit verschaffte.<br />
Manchmal freute er sich über einen Ausblick oder betrachtete<br />
erstaunt irgendein Wunder der Natur, aber in der Hauptsache war Wandern<br />
für ihn ein höchst anstrengendes, schmutziges, sinnloses Sich-Dahinschleppen<br />
von einem Ort der Bequemlichkeit zum nächsten, weit entfernt<br />
liegenden Ort. Ich dagegen ging ganz und gar in der simplen Tätigkeit des<br />
Vorwärtsstrebens auf, unbekümmert und zufrieden <strong>mit</strong> mir und der Welt.<br />
Meine entsprechende Abwesenheit faszinierte und amüsierte ihn zugleich,<br />
aber meistens war er einfach genervt.<br />
Am späten Vor<strong>mit</strong>tag des vierten Tages nach unserem Aufbruch in Franklin,<br />
hockte ich mich auf einen gewaltigen, grünen Felsen und wartete auf<br />
Katz, nachdem mir aufgefallen war, daß ich ihn eine ganze Weile nicht<br />
gesehen hatte. Als er endlich kam, wirkte er noch aufgelöster als sonst. In<br />
seinem Haar hingen kleine Zweige, sein Baumwollhemd wies einen neuen<br />
Riß auf, und auf seiner Stirn war ein getrocknetes Rinnsal Blut zu sehen. Er<br />
stellte seinen Rucksack ab und ließ sich erschöpft neben mir nieder, holte<br />
seine Wasserflasche und tat einen langen Zug, wischte sich über die Stirn,<br />
suchte seine Hand nach Blutspuren ab und sagte schließlich wie ganz nebenbei:<br />
»Wie bist du eigentlich um den Baum da unten herumgegangen?«<br />
»Welchen Baum?«<br />
»Den umgestürzten Baum da unten. Der quer über dem Felsgesims liegt.«<br />
Ich überlegte eine Minute lang. »Ich kann mich nicht daran erinnern.«
»Daran kannst du dich nicht erinnern? Er blockiert den Weg, verdammt<br />
noch mal!«<br />
Ich überlegte wieder, strengte mich noch mehr an und schüttelte <strong>mit</strong> dem<br />
Ausdruck leisen Bedauerns den Kopf. Man sah förmlich, wie kalte Wut in<br />
ihm aufstieg.<br />
»Da unten. Nur ein paar hundert Meter von hier.« Er unterbrach sich, wartete<br />
auf ein Zeichen des Wiedererkennens meinerseits und konnte nicht fassen,<br />
daß es ausblieb. »Auf der einen Seite ein steiler Felsabhang, auf der<br />
anderen Seite undurchdringliches Gestrüpp, und in der Mitte ein gestürzter<br />
Baum. Das muß dir doch aufgefallen sein.«<br />
»Wo genau soll das gewesen sein?« fragte ich, als wollte ich auf Zeit spielen.<br />
Katz konnte seine maßlose Verärgerung kaum verbergen. »Da unten, verdammt<br />
noch mal. Auf der einen Seite der Abhang, auf der anderen Seite<br />
Sträucher, und in der Mitte eine riesige umgestürzte Eiche, die gerade mal<br />
so viel Platz zum Durchschlüpfen bot.« Er hielt eine Hand etwa 40 Zentimeter<br />
über den Boden. »Ich weiß nicht, welches Mittel du geschmissen<br />
hast, aber ich will auch was davon haben. Der Baum war zu hoch, um drüberzuklettern,<br />
und zu niedrig, um drunter durchzukriechen, und es gab keinen<br />
Weg drumherum. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um an ihm<br />
vorbeizukommen, und ich habe mir dabei lauter Schrammen geholt. Wie<br />
kommt es, daß du dich nicht an den Baum erinnerst?«<br />
»Vielleicht fällt es mir später wieder ein«, sagte ich hoffnungsvoll. Katz<br />
schüttelte traurig den Kopf. Ich habe nie herausgefunden, warum ihn meine<br />
gelegentliche geistige Abwesenheit eigentlich so aufregte. Dachte er, ich<br />
spielte extra den Begriffsstutzigen, um ihn zu ärgern, oder ich schlüge der<br />
Mühsal ein Schnippchen, indem ich sie unvernünftigerweise ignorierte? Auf<br />
jeden Fall nahm ich mir insgeheim vor, eine Zeitlang aufmerksam und ganz<br />
bei Bewußtsein zu sein, um Katz nicht aufzuregen. Zwei Stunden später<br />
erlebten wir einen jener Momente der Freude, die sich nur selten auf dem<br />
Trail einstellen. Wir überquerten gerade die hohe Wölbung eines Berges,<br />
namens High Top, als sich an einem Aussichtsfelsen aus Granit der Wald<br />
vor uns teilte und uns einen grandiosen Panoramablick bot – ganz plötzlich<br />
tat sich eine neue Welt hoher, kräftiger, vergleichsweise schroffer Berge<br />
auf, gehüllt in einen Dunstschleier und an den Rändern von trüben Wolken<br />
gestreift, verlockend und furchterregend zugleich.<br />
Wir waren in den Smokies angekommen.<br />
Tief unter uns, eingezwängt in einem schmalen Tal, lag der Fontana Lake,<br />
ein langer, fjordähnlicher, lindgrüner See. Am westlichen Ende, wo der<br />
Little Tennessee River in den See mündet, steht ein gigantischer 146 Meter<br />
hoher Staudamm, der in den 30er Jahren von der Tennessee Valley Authori-
ty errichtet wurde. Es ist der größte Staudamm in Nordamerika östlich des<br />
Mississippi und gilt unter Betonfetischisten als absolute Sehenswürdigkeit.<br />
Wir eilten darauf zu, den Weg hinunter, weil wir vermuteten, daß es dort ein<br />
Besucherzentrum gab, also auch eine Cafeteria und andere begrüßenswerte<br />
Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme <strong>mit</strong> der zivilisierten Welt. Wenn schon<br />
nichts anderes, spekulierten wir aufgeregt, dann gab es dort wenigstens<br />
Automaten und Toiletten, wo man sich waschen, frisches Wasser holen und<br />
in einen Spiegel blicken konnte.<br />
Es gab tatsächlich ein Besucherzentrum, aber es war geschlossen. Ein vergilbter<br />
Zettel an der Glastür besagte, daß es erst in vier Wochen wieder<br />
öffnete. Die Automaten waren leer, die Stecker herausgezogen, und zu<br />
unserem Bedauern waren sogar die Toiletten verschlossen. Katz entdeckte<br />
einen Wasserhahn an der Außenwand, aber das Wasser war abgestellt. Wir<br />
warfen uns gegenseitig einen langen, stoischen Leidensblick zu, seufzten<br />
kurz und marschierten weiter. Der Trail verläuft direkt oben auf dem Damm<br />
über dem See. Die Berge vor uns, so schien es, erhoben sich nicht aus dem<br />
See, vielmehr richteten sie sich wie erschreckte Bestien dahinter auf. Es war<br />
auf den ersten Blick zu erkennen, daß sich uns hier eine ganz neue Pracht<br />
und da<strong>mit</strong> auch neue Herausforderungen boten. Das gegenüberliegende<br />
Ufer markierte die südliche Grenze des Great Mountains National Park. Vor<br />
uns lag ein über 200.000 Hektar großes, dichtbewachsenes, bergiges Waldgebiet,<br />
eine Sieben-Tage-Tour, 114 extrem rauhe Kilometer, bevor wir<br />
wieder von Cheeseburgern, Cola, Toiletten und fließend Wasser träumen<br />
durften. Es wäre schön gewesen, wenigstens <strong>mit</strong> sauberen Händen und<br />
sauberem Gesicht loszugehen. Ich hatte es Katz noch nicht <strong>mit</strong>geteilt, aber<br />
wir würden in den nächsten Tagen 16 Gipfel überschreiten, die über 1.800<br />
Meter hoch waren, einschließlich Clingmans Dome, der <strong>mit</strong> 2.024 Meter<br />
höchsten Erhebung am Appalachian Trail (übrigens nur 12,5 Meter niedriger<br />
als der nahegelegene Mount Mitchell, der höchste Berg im Osten der<br />
Vereinigten Staaten). Ich war gespannt und aufgeregt – selbst Katz packte<br />
milde Begeisterung –, denn dazu gab es allen Grund.<br />
Zunächst einmal hatten wir soeben einen neuen Bundesstaat betreten, Tennessee,<br />
unseren dritten, was einem immer das Gefühl gibt, eine Leistung<br />
vollbracht zu haben. Auf seiner gesamten Länge durch die Smokies verläuft<br />
der AT entlang der Grenze zwischen North Carolma und Tennessee. An so<br />
etwas hatte ich meinen Spaß, ich meine die Vorstellung, <strong>mit</strong> dem linken<br />
Bein in einem Bundesstaat und <strong>mit</strong> dem rechten in einem anderen zu stehen,<br />
oder mich für eine Ruhepause zwischen einem Baumstamm in Tennessee<br />
und einem Felsen in North Carolina entscheiden zu können, oder über die<br />
Grenze zu pinkeln, oder was es sonst noch an Möglichkeiten gab. Ich war<br />
gespannt darauf, was wir in diesen prächtigen, finsteren, sagenumwobenen
Bergen alles Neues erleben und sehen würden – Riesensalamander und<br />
gewaltige Tulpenbäume und den berüchtigten Ölbaumpilz, der nachts ein<br />
grünliches phosphoreszierendes Licht abstrahlt, Foxfire genannt. Vielleicht<br />
würden wir sogar einen Bär sehen (natürlich vom Wind abgekehrt, aus<br />
sicherer Entfernung, und mich sollte er links liegenlassen, ausschließlich<br />
Interesse an Katz zeigen, wenn es schon einen von uns beiden treffen sollte).<br />
Aber vor allem gab es die Hoffnung, ja die Überzeugung, daß der Frühling<br />
nicht mehr weit war, daß wir uns ihm <strong>mit</strong> jedem Tag näherten und daß<br />
er hier in den Smokies endlich ausbrechen würde.<br />
Die Smokies sind ein echtes Paradies. Wir betraten ein Gebiet, das die Botaniker<br />
gern als den »schönsten Mischwald der Welt« bezeichnen. Die<br />
Smokies beherbergen eine erstaunliche Pflanzenvielfalt – über 1.500 Arten<br />
von Wildpflanzen, 1.000 verschiedene Sträucher, 530 Moose und Flechten,<br />
2.000 Pilze. Hier ist die Heimat von 130 Baumarten (in ganz Europa gibt es<br />
zum Beispiel nur 85).<br />
Dieser verschwenderische Überfluß ist dem fruchtbaren, lehmigen Boden<br />
der geschützten Täler zu verdanken, die man »coves« nennt, dem feuchtwarmen<br />
Klima, das diesen bläulichen Dunst erzeugt, von dem die Smokies<br />
ihren Namen haben, und vor allem dem glücklichen Umstand, daß die Appalachen<br />
von Norden nach Süden verlaufen. Als sich während der letzten<br />
Eiszeit Gletscher und Eisdecken von der Arktis her ausbreiteten, wich die<br />
Flora der nördlichen Halbkugel nach Süden aus. In Europa stießen dabei<br />
unzählige Arten an die unüberwindliche Grenze der Alpen und anderer<br />
kleinerer Gebirge und starben aus. Im Osten Nordamerikas gab es kein<br />
solches Hindernis, und so bahnten sich Bäume und andere Pflanzen ihren<br />
Weg über Flüsse und an Gebirgsflanken entlang, bis sie das artverwandte<br />
Refugium der Smokies erreichten, wo sie seitdem geblieben sind. (Als sich<br />
das Eis wieder zurückzog, setzte auch ein langer Prozeß der allmählichen<br />
Rückkehr der im Norden einheimischen Bäume in ihre angestammten Gebiete<br />
ein. Manche von ihnen, Zeder und Rhododendron zum Beispiel, kehren<br />
erst jetzt heim – was uns nur zeigt, daß die Eisdecke, geologisch gesehen,<br />
erst gestern abgetaut ist.)<br />
Pflanzenvielfalt bringt natürlich auch eine reiche Tierwelt <strong>mit</strong> sich. In den<br />
Smokies leben 67 verschiedene Säugetiere, 200 Vogelarten sowie 80 Reptilien-<br />
und Amphibienspezies – mehr als in anderen vergleichbar großen<br />
Gebieteninden gemäßigten Klimazonen der Erde. Die Smokies sind vor<br />
allem berühmt wegen ihrer Bären – Schätzungen gehen von 400 bis 600<br />
Tieren aus –, aber diese stellen auch seit Jahren ein Problem dar, denn viele<br />
haben die Scheu vor Menschen verloren. Über eine Million Menschen<br />
kommen jedes Jahr in die Smokies, viele nur um zu picknicken. Bären haben<br />
gelernt, Menschen <strong>mit</strong> Nahrung in Verbindung zu bringen. Für sie sind
Menschen übergewichtige Geschöpfe <strong>mit</strong> Baseballmützen, die jede Menge<br />
Nahrung auf <strong>Picknick</strong>tischen um sich ausbreiten und dann ein bißchen kreischen<br />
und lostapern, um schnell die Videokamera zu holen und zu filmen,<br />
wie der hebe Teddybär daherschlurft, auf ihren Tisch klettert und ihren<br />
Kartoffelsalat und ihren Schokoladenkuchen verschlingt. Weil der Bär<br />
nichts dagegen hat, gefilmt zu werden und ihm das Publikum ziemlich<br />
gleichgültig ist, nähert sich meist irgendeiner aus der Runde der <strong>Picknick</strong>er<br />
dem Tier und versucht, es zu streicheln oder <strong>mit</strong> einem Plätzchen zu füttern.<br />
In einem verbrieften Fall schmierte eine junge Frau Honig auf die Finger<br />
ihres Kindes, da<strong>mit</strong> der Bär sie vor der Kamera ableckte. Der Bär verstand<br />
die Regieanweisung nicht und schnappte sich gleich die ganze Hand des<br />
Kleinen.<br />
Wenn so etwas geschieht – ungefähr ein Dutzend Menschen werden pro<br />
Jahr verletzt, meist an Rastplätzen und meist durch eigenes Fehlverhalten –<br />
oder wenn ein Bär aufdringlich oder aggressiv wird, erlegen die Parkranger<br />
ihn <strong>mit</strong> einem Narkosepfeil, schnüren ihn zusammen und verfrachten ihn<br />
weit ins Hinterland, fernab von Straßen und Rastplätzen und setzen ihn dort<br />
wieder aus. Mittlerweile haben sich die Bären längst an die Menschen und<br />
ihre Nahrung gewöhnt. Bei wem werden sie folglich wohl im Hinterland<br />
nach Nahrung suchen? Bei Leuten wie Katz und mir natürlich. Die »Annalen«<br />
des Appalachian Trail sind voll von Geschichten von Wanderern, die<br />
im Hinterland der Smokies von Bären angegriffen wurden. Ich hielt mich<br />
daher jetzt, als wir in die dicht bewaldeten, steilen Shuckstack Mountains<br />
eintauchten, immer un<strong>mit</strong>telbarinder Nähe von Katz auf, und trug meinen<br />
Wanderstab wie einen Prügel. Katz fand das natürlich albern.<br />
Das Urgeschöpf der Smokies, wenn man so will, ist jedoch der im Verborgenen<br />
lebende und wenig beachtete Salamander. Es gibt 24 verschiedene<br />
Arten in den Smokies, mehr als sonstwo auf der ganzen Welt. Salamander<br />
sind höchst interessante Kreaturen, und das lassen Sie sich bitte von niemandem<br />
ausreden. Zunächst einmal sind sie die ältesten Landwirbeltiere.<br />
Als Lebewesen zum ersten Mal aus dem Wasser krochen, sahen sie so aus<br />
wie Salamander, und sie haben sich seither nicht viel verändert. Manche<br />
Salamanderarten in den Smokies haben noch nicht einmal Lungen entwikkelt,<br />
sie atmen durch die Haut. Die meisten Salamander sind sehr klein, drei<br />
bis fünf Zentimeter lang, nur der Riesensalamander, der seltene und erstaunlich<br />
häßliche Schlammteufel, kann über 60 Zentimeter groß werden. Ich<br />
wollte unbedingt einen Schlammteufel sehen.<br />
Noch artenreicher und noch weniger gewürdigt als der Salamander ist die<br />
Flußmuschel. 300 Flußmuschelarten, ein Drittel aller Arten weltweit, leben<br />
in den Smokies. Die Süßwassermuscheln der Smokies haben phantastische<br />
Namen, zum Beispiel Purple wartyback, Shiny pigtoe oder Monkeyface
pearly-mussel. Leider erschöpft sich da<strong>mit</strong> das Interesse an den Tieren, und<br />
weil die Flußmuscheln so wenig beachtet werden, auch von naturwissenschaftlicher<br />
Seite, verschwinden sie in einem erschreckenden Ausmaß. Fast<br />
die Hälfte aller Flußmuschelarten der Smokies ist akut gefährdet, zwölf<br />
Arten sollen bereits ausgestorben sein.<br />
Eigentlich ist das höchst befremdlich für einen Nationalpark. Muscheln<br />
werfen sich schließlich nicht freiwillig unter die Räder der vorbeifahrenden<br />
Autos. Dennoch sind die Smokies dabei, die meisten ihrer Muschelarten zu<br />
verlieren. Tiere und Pflanzen auszurotten, hat beim National Park Service<br />
gewissermaßen Tradition. Der Bryce Canyon National Park ist vielleicht<br />
das interessanteste, auf jeden Fall aber das treffendste Beispiel dafür. Der<br />
Park wurde 1923 gegründet und hat unter der Verwaltung des Park Service<br />
in nicht einmal einem halben Jahrhundert sieben Säugetierarten verloren –<br />
den weißschwänzigen Eselhasen, den Präriehund, die Gabelantilope, das<br />
Flughörnchen, den Bieber, den Rotfuchs und das gefleckte Stinktier. Eine<br />
beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, daß diese Tiere zig Millionen<br />
Jahre im Bryce Canyon überlebt haben, bevor der Park Service sich ihrer<br />
annahm. Insgesamt sind in diesem Jahrhundert 42 Säugetierarten aus den<br />
amerikanischen Nationalparks verschwunden.<br />
1957 beschloß der Park Service, den Abrams Creek in den Smokies, einen<br />
Nebenfluß des Little Tennessee River, nicht allzu weit entfernt von der<br />
Gegend, in der Katz und ich uns gerade aufhielten, als Lebensraum für die<br />
Regenbogenforelle zu »reklamieren«, obwohl die Regenbogenforelle im<br />
Abrams Creek nie heimisch gewesen war. Zu diesem Zwecke schütteten<br />
Biologen mehrere Fässer von dem Gift Rotenon auf einer Länge von 25<br />
Kilometern in den Fluß. Nach wenigen Stunden trieben Tausende toter<br />
Fische auf der Wasseroberfläche. Zu den 31 Fischarten des Abrams Creek,<br />
die dabei vernichtet wurden, gehörte auch der Blaurücken, den die Wissenschaftler<br />
noch nie zuvor gesehen hatten. Die Biologen des Park Service<br />
brachten das unglaubliche Kunststück fertig, ein und dieselbe Fischart<br />
gleichzeitig zu entdecken und zu vernichten. (1980 wurde in einem Bach in<br />
der Nähe noch eine Kolonie von Blaurücken entdeckt.)<br />
Das ist alles 40 Jahre her, und heute, in unseren aufgeklärten Zeiten, wäre<br />
so eine Dummheit undenkbar. Heutzutage befleißigt sich der National Park<br />
Service eines etwas zwangloseren Stils in der Zerstörung der Natur: Vernachlässigung.<br />
Er stellt so gut wie kein Geld für Forschung irgendwelcher<br />
Art zur Verfügung – weniger als drei Prozent der gesamten Finanz<strong>mit</strong>tel –,<br />
und deswegen weiß niemand zu sagen, wie viele Muscheln bereits ausgestorben<br />
sind, geschweige denn aus welchem Grund. Wo man auch hinschaut<br />
in den Wäldern an der Ostküste, überall sterben die Bäume. In den Smokies<br />
sind 90 Prozent der Fräser-Tannen – ein sehr edles Gewächs und eine Be-
sonderheit der südlichen Appalachen – erkrankt oder bereits tot. Dafür gibt<br />
es zwei Gründe: den sauren Regen und die Verwüstung durch einen Baumschädling,<br />
der sich Fichtengallenlaus schimpft. Fragt man einen Angestellten<br />
des Park Service, was dagegen unternommen wird, bekommt man zur<br />
Antwort: »Wir beobachten die Situation genau«, was so viel heißt wie, »wir<br />
gucken den Bäumen beim Sterben zu.«<br />
Das gleiche Bild bietet sich bei den sogenannten »balds«, grasbewachsenen<br />
Kuppeln – baumlose, wiesenähnliche Berggipfel, bis zu 100 Hektar groß<br />
und ebenfalls einmalig in den südlichen Appalachen. Man weiß nicht, seit<br />
wann diese Kuppeln existieren, wie sie entstanden sind oder warum es sie<br />
auf manchen Berggipfeln gibt und auf anderen nicht. Einige Experten meinen,<br />
es handle sich um ein Naturphänomen, Überreste von Feuersbrünsten,<br />
ausgelöst durch Blitzschlag, andere meinen, sie seien das Werk von Menschen,<br />
Brandrodungen, um Platz für Sommerweiden zu schaffen. Auf jeden<br />
Fall sind sie absolut typisch für die Smokies. Nach Stunden einsamen Wanderns<br />
durch kühlen, finsteren Wald endlich eine freie, offene, sonnenbeschienene<br />
Kuppe unter strahlend blauem Himmel und <strong>mit</strong> Panoramablick zu<br />
betreten, ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergißt. Diese Kuppen<br />
sind jedoch mehr als ein bloßes Kuriosum. Nach Angaben des Buchautors<br />
Hiram Rogers nehmen die Graskuppen gerade einmal 0,015 Prozent der<br />
Gesamtfläche der Smokies ein, beherbergen jedoch 29 Prozent der Flora.<br />
Für eine unbestimmte Zeit wurden sie zuerst von Indianern, später dann von<br />
eingewanderten Europäern im Sommer als Weideland für Vieh genutzt;<br />
heute, da die Viehzucht verdrängt ist und der Park Service nichts unternimmt,<br />
erobern sich Straucharten wie Weißdorn und Brombeere die Berggipfel<br />
zurück. Wenn nichts unternommen wird, ist es gut möglich, daß es in<br />
20 Jahren keine Graskuppen mehr in den Smokies gibt. Seit Gründung des<br />
Parks in den 30er Jahren sind 90 Pflanzenarten auf den Bergkuppen ausgestorben,<br />
und für die nächsten paar Jahre wird das Verschwinden von 25<br />
weiteren Arten erwartet. Es gibt keinen Plan, diese Pflanzen vor dem sicheren<br />
Tod zu retten.<br />
Man soll aus alldem nicht den Schluß ziehen, ich sei kein Freund des Park<br />
Service und seiner Mitarbeiter. Das Gegenteil ist der Fall – ich bewundere<br />
diese Leute. Ich habe nicht einen Ranger kennengelernt, der nicht freundlich,<br />
engagiert und im allgemeinen gut informiert war. (Ich muß hinzufügen,<br />
ich habe selten einen getroffen, die meisten hat man nämlich entlassen,<br />
aber diejenigen, <strong>mit</strong> denen ich zu tun hatte, waren nett und hilfsbereit.) Das<br />
Problem sind nicht die Leute an der Basis. Das Problem ist der Park Service<br />
selbst. Immer wieder wird zur Verteidigung das Argument vorgeschoben,<br />
den Nationalparks würden die Mittel gestrichen, was zweifellos zutrifft. Der<br />
Jahresetat des Park Service liegt heute um 200 Millionen Dollar unter der
Summe, die dem Park Service noch vor zehn Jahren zur Verfügung stand.<br />
Infolgedessen wurden trotz gestiegener Besucherzahlen – von 79 Millionen<br />
im Jahre 1960 auf heute 270 Millionen – Campingplätze und Informationszentren<br />
geschlossen, die Zahl der Aufseher verringert und wichtige Waldpflegearbeiten<br />
auf ein lächerliches Mindestmaß heruntergeschraubt. 1997<br />
betrugen die Kosten für den Arbeitsrückstand in den Nationalparks sechs<br />
Milliarden Dollar. Ein Skandal. Gleichzeitig gönnte sich der National Park<br />
Service 1991 – als die Bäume reihenweise starben, die Gebäude zunehmend<br />
verfielen, die Besucher von den Campingplätzen, die man nicht mehr halten<br />
konnte, vertrieben wurden, und als es zu Massenentlassungen unter den<br />
Angestellten kam – aus Anlaß seines 75jährigen Bestehens eine Geburtstagsparty<br />
in Vail, Colorado, die eine halbe Million Dollar gekostet hat. Das<br />
ist zwar nicht ganz so gedankenlos wie die willentliche Entsorgung von<br />
Hunderten Liter Gift in einem Wildbach, aber es zeugt auch nicht gerade<br />
von der richtigen Einstellung.<br />
Trotzdem sollten wir die Dinge im Verhältnis sehen. Die Smokies haben<br />
ihre natürliche Pracht und Schönheit nicht unter der Führung des Park Service<br />
erreicht und brauchen ihn eigentlich gar nicht. Sieht man sich das<br />
höchst seltsame und sprunghafte Verhalten des Park Service in seiner Geschichte<br />
an (hier noch ein Beispiel: In den 60er Jahren wurde die Walt Disney<br />
Corporation beauftragt, im Sequoia National Park in Kalifornien einen<br />
Vergnügungspark zu errichten), scheint es mir gar keine so schlechte Idee,<br />
ihm die Mittel zu kürzen. Ich bin mir fast sicher, daß die 200 Millionen<br />
Dollar, sollten sie dem Jahresetat wieder hinzugefügt werden, nur in den<br />
Bau von noch mehr Parkplätzen und Stromanschlüssen für Wohnmobile<br />
und nicht in die Rettung von Bäumen und schon gar nicht in die Rekultivierung<br />
der herrlichen, grasbewachsenen Bergkuppen fließen würden. In Wirklichkeit<br />
gehört es zur Politik des Park Service, die Kuppen einfach zum<br />
Verschwinden zu bringen. Nachdem man <strong>mit</strong> seinen jahrelangen Eingriffen<br />
in die Natur alle gegen sich aufgebracht hat, scheint man jetzt beschlossen<br />
zu haben, sich überhaupt nicht mehr einzumischen – selbst dann nicht,<br />
wenn es nachweisbar nützlich wäre. Ich kann Ihnen sagen, der Park Service<br />
ist mir ein Rätsel.<br />
Die Abenddämmerung setzte gerade ein, als wir die Birch-Spring-Gap-<br />
Schutzhütte erreichten, die neben einem Bach an einem Hang stand, ungefähr<br />
100 Meter unterhalb des Trails. In dem silbrigen Zwielicht sah sie<br />
herrlich aus. Im Vergleich zu den zweckmäßigen Furnierholzkonstruktionen,<br />
die man sonst entlang des Appalachian Trails findet, sind die Schutzhütten<br />
der Smokies solide Steinbauten in einem malerischen, rustikalen Stil,<br />
so daß die Birch-Spring-Gap-Shelter von fern wie ein richtiges, gemütliches
Cottage aussah. Aus der Nähe betrachtet, war sie alles andere als bezaubernd.<br />
Drinnen war es dunkel, die Wände schienen undicht, der Boden war<br />
aus Lehm und sah aus wie Schokoladenpudding, das Schlafpodest war eng<br />
und dreckig, und überall lag naß gewordener Abfall herum. An der Innenseite<br />
lief Wasser herab und tropfte in kleine Pfützen auf das Podest. Draußen<br />
gab es keinen <strong>Picknick</strong>tisch und auch kein Klo, wie sonst bei fast allen<br />
Hütten. Selbst gemessen an den asketischen Standards des Appalachian<br />
Trail, war das hier ziemlich hart. Immerhin hatten wir die Hütte für uns<br />
allein.<br />
Wie bei den meisten AT-Schutzhütten war die Vorderseite offen – ich habe<br />
nie verstanden, welcher Gedanke dahintersteckt, welches architektonische<br />
oder wartungstechnische Prinzip es erfordert, daß eine ganze Seite und<br />
da<strong>mit</strong> alle Gäste den Elementen ausgesetzt sind – , aber hier war noch ein<br />
Maschendrahtzaun davor angebracht. Auf einem Schild stand geschrieben:<br />
»Achtung. Nachtaktive Bären. Tür immer geschlossen halten.« Mich interessierte,<br />
wie aktiv sie wirklich waren, und während Katz schon mal Wasser<br />
für die Nudeln aufsetzte, warf ich einen Blick ins Hüttenbuch. Jede Hütte<br />
verfügt über ein Hüttenbuch, eine Art Gästebuch oder Register, in das die<br />
Besucher tagebuchartige Einträge über das Wetter, die Wegbedingungen,<br />
das eigene Gefühlsleben, soweit vorhanden, oder über ungewöhnliche Vorkommnisse<br />
machen können. In diesem war nur über gelegentliche »bärenähnliche«<br />
Geräusche des Nachts zu lesen, aber was die Chronisten am meisten<br />
beschäftigte, war die ungewöhnliche Lebhaftigkeit der anderen Hüttenbewohner<br />
– der Mäuse und Ratten.<br />
Von dem Moment an, als wir unsere müden Häupter niederbetteten, war das<br />
wuselige Getrippel der kleinen Nagetiere zu hören. Sie waren absolut zutraulich<br />
und liefen dreist über unsere Schlafsäcke und sogar über unsere<br />
Köpfe. Wild fluchend warf Katz seine Wasserflasche und was ihm sonst<br />
gerade in die Finger kam nach ihnen. Einmal machte ich meine Stirnlampe<br />
an und sah eine kleine Buschschwanzratte auf meinem Schlafsack sitzen, in<br />
Brusthöhe; sie hockte auf den Hinterläufen und glotzte mich <strong>mit</strong> stechendem<br />
Blick an. Spontan trat ich von innen gegen den Schlafsack und versetzte<br />
das arme Tierchen in Angst und Schrecken.<br />
»Ich habe eine erwischt!« rief Katz.<br />
»Ich auch«, sagte ich stolz.<br />
Katz rutschte auf Händen und Knien über den Boden, als wolle er selbst<br />
Mäuschen spielen, ließ den Strahl der Taschenlampe durch die Dunkelheit<br />
huschen und blieb von Zeit zu Zeit stehen, um einen Schuh zu werfen oder<br />
<strong>mit</strong> seiner Wasserflasche auf den Boden zu schlagen. Dann kroch er wieder<br />
in seinen Schlafsack, blieb eine Zeitlang ruhig, fluchte plötzlich lauthals,<br />
warf alles von sich und wiederholte die Prozedur. Ich vergrub mich in mei-
nen Schlafsack und band die Zugschnur über meinem Kopf fest zu. So verging<br />
die Nacht, <strong>mit</strong> wiederholten Gewaltausbrüchen von Katz, gefolgt von<br />
den Phasen der Ruhe, dann wieder Getrippel, dann ein erneuter Katzscher<br />
Gewaltausbruch. Ich schlief erstaunlich gut, trotz alldem.<br />
Ich hatte erwartet, daß Katz übelgelaunt aufwachen würde, aber er war viel<br />
vergnügter als am Abend zuvor.<br />
»Ich muß sagen, es geht nichts über einen anständigen Schlaf, und ich muß<br />
sagen, ich habe anständig geschlafen«, verkündete er beim ersten Räkeln<br />
und lachte bestätigend. Seine Selbstzufriedenheit rührte daher, daß er sieben<br />
Mäuse gekillt hatte, wie sich zeigte, und in höchstem Maße stolz darauf<br />
war, wie ein Gladiator <strong>mit</strong> geschwellter Brust. Mir fiel auf, daß noch etwas<br />
Pelziges und ein Klumpen rosa Fleischiges am Boden seiner Wasserflasche<br />
klebte, als er sie zum Trinken ansetzte. Gelegentlich hat es mich beunruhigt<br />
– ich vermute, es beunruhigt alle Wanderer von Zeit zu Zeit – , wie weit<br />
man sich unterwegs vom üblichen zivilisierten Verhalten entfernen kann.<br />
Dies war so ein Augenblick.<br />
Draußen war Nebel aufgezogen und füllte den Raum zwischen den Bäumen.<br />
Kein aufmunternder Anblick am Morgen. Ein Sprühregen hing in der<br />
Luft, als wir uns auf den Weg machten, und nach kurzer Zeit war er in einen<br />
gleichmäßigen, gnadenlosen Bindfadenregen übergegangen.<br />
Regen kann einem den letzten Nerv rauben. Es macht absolut keinen Spaß,<br />
in einem Regencape zu wandern. Das Knistern von steifem Nylongewebe<br />
und das unentwegte, seltsam verstärkt klingende Pladdern von Regentropfen<br />
auf synthetischem Material haben etwas zutiefst Entmutigendes. Und<br />
was das Schlimmste ist: Man bleibt trotzdem nicht trocken. Die wasserdichte<br />
Kleidung hält zwar den Regen ab, aber man schwitzt so stark, daß man<br />
von innen her bald ganz durchgeweicht ist. Am Nach<strong>mit</strong>tag war der Pfad<br />
ein einziger Wasserlauf. Meine Wanderschuhe hatten längst aufgegeben.<br />
Ich war klatschnaß, und es gluckste bei jedem Schritt. In manchen Teilen<br />
der Smokies regnet es bis zu 300 Zentimeter pro Jahr, das ist weit mehr als<br />
die normale Zimmerhöhe. Eine ganze Menge Regen, könnte man sagen,<br />
und wir bekamen jetzt den größten Teil davon ab.<br />
Wir gingen 15 Kilometer weit bis zum Spence Field Shelter, eigentlich<br />
keine großartige Entfernung, selbst für unsere Verhältnisse, aber wir waren<br />
bis auf die Haut durchnäßt und durchgefroren, als wir ankamen, und zur<br />
nächsten Schutzhütte war es sowieso zu weit. Der Park Service – man<br />
kommt einfach nicht um ihn herum – hat eine Unmenge kleinlicher, starrer,<br />
ärgerlicher Vorschriften für die Wanderer des Appalachian Trail erlassen,<br />
darunter die, daß man stets zügig weitergehen soll, niemals vom Weg abweichen<br />
darf und die Nacht in einer Schutzhütte campieren muß. Praktisch<br />
bedeutet es, daß man nicht nur jeden Tag eine vorgeschriebene Distanz
ewältigen, sondern auch jede Nacht eingepfercht zwischen lauter Fremden<br />
verbringen müßte. Wir schälten uns aus den nassen Klamotten und kramten<br />
in den Rucksäcken nach trockenen, aber sogar die Sachen von ganz unten<br />
fühlten sich klamm an. In eine der Hüttenwände war ein in Stein gefaßter<br />
Kamin eingebaut, und ein aufmerksamer Mensch hatte daneben ein paar<br />
Äste und Scheite gelegt. Katz versuchte ein Feuer anzuzünden, aber alles<br />
war so feucht, daß nichts brannte, nicht einmal die Streichhölzer wollten<br />
zünden. Katz stöhnte entnervt und gab auf. Ich beschloß, Kaffee zu kochen,<br />
um uns aufzuwärmen, aber der Kocher erwies sich ebenfalls als zu launisch.<br />
Während ich noch <strong>mit</strong> dem Kocher herumspielte, hörte ich von draußen das<br />
quietschende Knistern von Nylongewebe, und zwei junge Frauen betraten<br />
verdreckt und durchnäßt die Hütte. Die beiden kamen aus Boston und waren<br />
über einen Nebenwanderweg von Cades Cove aus auf den AT gestoßen. Ein<br />
paar Minuten später kamen vier Studenten der Wake Forest University<br />
dazu, die gerade Semesterferien hatten, dann ein einzelner Wanderer, unser<br />
alter Bekannter Jonathan, und schließlich noch zwei bärtige Männer <strong>mit</strong>tleren<br />
Alters. Nach vier Tagen, in denen wir kaum jemand gesehen hatten,<br />
waren wir plötzlich umringt von Menschen.<br />
Jedermann war freundlich und rücksichtsvoll, aber man kam nicht um die<br />
Erkenntnis herum, daß die Hütte hoffnungslos überbelegt war. Ich dachte<br />
daran – und nicht zum ersten Mal –, wie herrlich es wäre, wie absolut<br />
traumhaft, wenn MacKayes ursprüngliche Vision Wirklichkeit geworden<br />
wäre: wenn die Schutzhütten richtige Herbergen wären, <strong>mit</strong> heißen Duschen,<br />
Einzelbetten, <strong>mit</strong> Trennvorhängen für die Intimsphäre, <strong>mit</strong> Leselampe<br />
bitteschön, und <strong>mit</strong> einem Hüttenwirt, beziehungsweise Koch, der<br />
immer ein Feuer in Gang hielt und der uns jetzt jeden Augenblick auffordern<br />
würde, uns an einen langen Tisch zu setzen, um das Abendbrot aus<br />
Eintopf und Knödeln, Vollkornbrot und, sagen wir, einem Stückchen Pfirsichkuchen<br />
einzunehmen. Draußen gäbe es eine Terrasse <strong>mit</strong> Schaukelstühlen,<br />
auf der könnte man sitzen und gemütlich sein Pfeifchen rauchen und<br />
dabei der Sonne beim Untergehen hinter den fernen Bergen zuschauen. Was<br />
für ein Segen wäre das. Ich saß auf dem Rand des Schlafpodestes, versunken<br />
in meine Träumerei und ganz in Anspruch genommen von der Tätigkeit,<br />
eine kleine Wassermenge zum Kochen zu bringen – eigentlich war ich<br />
ganz zufrieden –, als einer der älteren Männer herüberschlurfte und sich<br />
vorstellte. Ich hatte sofort das beklemmende Gefühl, daß wir uns gleich<br />
über unsere Ausrüstung unterhalten würden. Ich sah es förmlich kommen.<br />
Nichts ist mir so verhaßt, wie Gespräche über Wanderausrüstung.<br />
»Darf ich fragen, warum du dir einen Gregory-Rucksack gekauft hast?«<br />
wollte Bob wissen.<br />
»Ich habe gedacht, es ist bequemer als das ganze Zeug in den Armen zu
tragen.«<br />
Er nickte bedächtig, als erachtete er diese Erklärung einer Erwägung für<br />
würdig, dann sagte er: »Ich habe einen Kelly«<br />
Am liebsten hätte ich geantwortet: Mach dich bitte <strong>mit</strong> dem Gedanken vertraut,<br />
Bob, daß mir das total am Arsch vorbeigeht. Aber es gehört nun mal<br />
dazu, daß man sich über Ausrüstung unterhält, so wie man <strong>mit</strong> den Bekannten<br />
seiner Eltern auch ein paar Worte wechselt, wenn man sie beim Einkaufen<br />
trifft. »Ach ja?« sagte ich. »Und, bist du zufrieden da<strong>mit</strong>?«<br />
»Ja, sehr«, lautete die zutiefst ernst gemeinte Antwort.<br />
»Ich will dir auch erklären warum.« Er holte den Rucksack her, um mir die<br />
Besonderheiten zu demonstrieren – die Klettverschlußtaschen, die Kartenhülle,<br />
die wundersame Eigenschaft, Dinge aufnehmen zu können. Besonders<br />
stolz führte er mir einen herausklappbaren Packbeutel im Innern des<br />
Rucksacks vor, zum Bersten voll <strong>mit</strong> Plastikfläschchen, Vitamintabletten<br />
und Medikamenten, und der vorn ein Sichtfenster hatte. »Da kann man<br />
sofort erkennen, was drin ist, ohne den Reißverschluß zu öffnen«, erklärte<br />
er und sah mich <strong>mit</strong> einem Blick an, der maßloses Erstaunen meinerseits<br />
einklagte.<br />
In dem Moment kam Katz dazu. Er knabberte an einer Möhre – keiner<br />
verstand es so geschickt, Essen zu schnorren wie er – und wollte mich etwas<br />
fragen, aber als er Bobs Beutel <strong>mit</strong> dem Sichtfenster erspähte, sagte er:<br />
»Guck mal, eine Tasche <strong>mit</strong> Sichtfenster. Ist das für Leute, die zu doof sind,<br />
das Ding aufzukriegen?«<br />
»Eigentlich finde ich die Idee ganz praktisch«, sagte Bob in gemäßigt abwehrendem<br />
Ton. »So kann man den Inhalt sehen, ohne daß man den Reißverschluß<br />
aufmachen muß.«<br />
Katz sah ihn baß erstaunt an. »Wieso? Bist du so beschäftigt beim Wandern,<br />
daß du nicht mal die drei Sekunden aufbringen kannst, um deinen Reißverschluß<br />
zu öffnen und in die Tasche zu gucken?« Er wandte sich mir zu.<br />
»Die Studenten haben sich bereit erklärt, ihre Pop Tarts gegen unsere Snikkers<br />
zu tauschen. Was hältst du davon?«<br />
»Eigentlich finde ich das ganz praktisch«, sagte Bob <strong>mit</strong> leiser Stimme, wie<br />
zu sich selbst, räumte seinen Rucksack beiseite und ließ uns fortan in Ruhe.<br />
Ich muß gestehen: Gespräche über Ausrüstungen endeten bei mir immer so,<br />
daß der andere beleidigt und <strong>mit</strong> einem eng an die Brust gedrückten, eben<br />
noch angepriesenen Ausrüstungsgegenstand von dannen zog. Ob Sie’s<br />
glauben oder nicht, das war nie meine Absicht.<br />
Von da an war uns kein Glück mehr in den Smokies beschieden. Wir wanderten<br />
vier Tage lang, und es regnete Bindfäden, ein unaufhörliches Pladdern.<br />
Der Weg war überall morastig und glitschig, in jeder Kuhle, in jeder<br />
Mulde stand das Wasser. Matsch wurde quasi zu einem Bestandteil unseres
Alltags. Wir stapften hindurch, stolperten und fielen hinein, knieten darin,<br />
setzten unsere Rucksäcke im Matsch ab, hinterließen einen Matschstreifen<br />
auf allem, was wir berührten. Und dazu immer das monotone Wisch Wisch<br />
Wisch des Nylonanoraks, zum Wahnsinnigwerden. Am liebsten hätte man<br />
sich das Ding vom Leib gerissen und es in Stücke zerfetzt. Ich sah weder<br />
einen Bären noch einen Salamander, kein Foxfire, kein nichts, kein gar<br />
nichts – nur die Regentropfen und ihre Bahnen auf meinen Brillengläsern.<br />
Jeden Abend übernachteten wir in irgendeinem undichten Kuhstall und<br />
kochten und lebten zusammen <strong>mit</strong> Fremden – Massen von Leuten, allesamt<br />
durchgefroren und durchnäßt, bunt durcheinandergewürfelt, ausgezehrt und<br />
halb verrückt von dem ununterbrochenen Regen und der Freudlosigkeit des<br />
Wanderns unter diesen Bedingungen. Es war schrecklich. Und je schlimmer<br />
das Wetter, desto voller die Schutzhütten. Die Colleges an der Ostküste<br />
hatten Semesterferien, und ganze Armeen von Leuten waren auf die Idee<br />
gekommen, in den Smokies wandern zu gehen. Die Schutzhütten in den<br />
Smokies sind eigentlich für Fernwanderer gedacht, nicht für Ausflügler auf<br />
einem Kurztrip, und gelegentlich führte das zu Streit. Was ziemlich untypisch<br />
für den AT war. Es war einfach furchtbar.<br />
Am dritten Tag hatten Katz und ich nichts Trockenes mehr zum Anziehen,<br />
und wir froren ständig. Wir patschten durch den Regen den Hang zum<br />
Clingmans Dome hinauf – nach allem, was ich gelesen hatte, ein Höhepunkt<br />
der ganzen Wanderstrecke, bei klarem Wetter <strong>mit</strong> einem Ausblick, der einem<br />
angeblich Flügel wachsen läßt – und sahen nichts, rein gar nichts,<br />
außer den Wipfeln von sterbenden Bäumen, die aus dem wabernden Nebelmeer<br />
aufragten.<br />
Wir waren durchgeweicht und dreckig, brauchten dringend saubere, trockene<br />
Wäsche, <strong>mit</strong> anderen Worten einen Waschsalon, ein anständiges Essen<br />
und Ripleys »Believe It or Not Museum«. Es wurde Zeit, nach Gatlinburg<br />
aufzubrechen.
8. Kapitel<br />
Aber zuerst mußten wir da hinkommen.<br />
Vom Clingmans Dome zur U.S. 441, der ersten asphaltierten Straße seit<br />
dem Fontana-Damm vor vier Tagen, waren es 13 Kilometer. Gatlinburg lag<br />
24 Kilometer weiter nördlich, eine lange, serpentinenartig verlaufende,<br />
abschüssige Wegstrecke. Das war zu weit zum Wandern, aber es war wenig<br />
wahrscheinlich, daß man in einem Nationalpark als Tramper <strong>mit</strong>genommen<br />
würde. Auf einem nahegelegenen Parkplatz entdeckte ich drei Jugendliche,<br />
die gerade ihr Gepäck in einem großen schicken Auto <strong>mit</strong> Kennzeichen<br />
New Hampshire verstauten. Ich stellte mich ihnen als Landsmann des Granite<br />
State vor und fragte sie, ob sie die Güte hätten, zwei müde alte Herrschaften<br />
nach Gatlinburg <strong>mit</strong>zunehmen. Bevor sie Einwände erheben konnten,<br />
was deutlich erkennbar ihre Absicht war, dankten wir ihnen überschwenglich<br />
und kletterten in ihren Wagen. So ergatterten wir uns eine stilvolle,<br />
aber dafür in ziemlich trüber Stimmung verlaufende Fahrt nach Gatlinburg.<br />
Gatlinburg ist ein Schocker fürs Gemüt, egal aus welchem Blickwinkel man<br />
die Stadt betrachtet, um so mehr, wenn man nach einem naßkalten Ausflug<br />
in die trübe Einsamkeit der Wälder in den Ort hinabsteigt. Er liegt am<br />
Haupteingang des Great Smoky Mountains National Park und hat sich darauf<br />
spezialisiert, das zur Verfügung zu stellen, was der Park nicht bieten<br />
kann – im wesentlichen sind das Imbißbuden, Motels, Geschenkeboutiquen<br />
und Gehsteige, auf denen sich hin und her schlendern läßt –, alles entlang<br />
der einzigen und unsäglich häßlichen Main Street. Die seit Jahren anhaltende<br />
wirtschaftliche Blüte dieser Stadt gründet auf der allgemeinen Überzeugung,<br />
daß Amerikaner, wenn sie ihr Auto beladen und riesige Entfernungen<br />
zu grandiosen Schauplätzen der Natur zurückgelegt haben, am Ziel angekommen,<br />
unbedingt Minigolf spielen und fetttriefendes Essen zu sich nehmen<br />
wollen. Der Great Smoky Mountains National Park ist der beliebteste<br />
Nationalpark Amerikas, nur Gatlinburg – und das ist das Unfaßbare – ist<br />
noch beliebter.<br />
Gatlinburg ist also abstoßend. Wir hatten nichts dagegen. Nach einer Woche<br />
Wandern suchten wir das Abstoßende, wir lechzten geradezu danach. Wir<br />
stiegen in einem Motel ab, wo man uns <strong>mit</strong> einem spürbaren Mangel an<br />
Herzlichkeit empfing, wurden zweimal beim Überqueren der Main Street<br />
angehupt (für das Kreuzen von Straßen verliert man beim Wandern das Gespür)<br />
und betraten schließlich ein Etablissement, das sich Jersey Joe’s Restaurant<br />
nannte. Dort bestellten wir bei einer blasierten, kaugummiblähenden<br />
Kellnerin, die sich von unserem natürlichen Lachen nicht erweichen<br />
ließ, Cheeseburger und Cola. Wir hatten unser schlichtes, enttäuschendes
Mahl zur Hälfte verzehrt, als die Kellnerin im Vorbeigehen die Rechnung<br />
auf unseren Tisch pfefferte. Sie belief sich auf 22,74 Dollar.<br />
»Das muß ein Versehen sein«, sagte ich stotternd.<br />
Die Kellnerin blieb stehen, schlurfte langsam zurück an unseren Tisch und<br />
sah mich lange und <strong>mit</strong> nicht zu überbietender Geringschätzung an.<br />
»Irgendwelche Probleme?«<br />
»20 Dollar sind ein bißchen happig für zwei Burger, finden Sie nicht?«<br />
quäkte ich <strong>mit</strong> einer Bertie-Wooster-Stimme, die ich an mir noch nicht<br />
kannte.<br />
Sie behielt ihren hochnäsigen Blick bei, nahm die Rechnung auf und las sie<br />
uns zu Gefallen laut vor, wobei sie jeden Posten <strong>mit</strong> einem Schmatzen begleitete.<br />
»Zwei Burger. Zwei Cola. Staatliche Umsatzsteuer. Örtliche Umsatzsteuer.<br />
Getränkesteuer. Vorgeschriebenes Trinkgeld. Gesamtsumme: 22<br />
Dollar und 74 Cents.« Sie ließ die Rechnung auf den Tisch segeln und<br />
schnitt eine Grimasse.<br />
»Willkommen in Gatlinburg, meine Herren.«<br />
Herzlich willkommen. Das konnte man wohl sagen.<br />
Und dann machten wir uns auf den Weg und sahen uns die Stadt an. Ich war<br />
besonders scharf auf Gatlinburg, weil ich mal in einem köstlichen Buch <strong>mit</strong><br />
dem Titel Straßen der Erinnerung: Reisen durch ein vergessenes Amerika,<br />
etwas über diese Stadt gelesen hatte. Der Autor beschreibt die Szenerie auf<br />
der Main Street folgendermaßen: »Scharen übergewichtiger Touristen in<br />
schriller Kleidung, <strong>mit</strong> vor den Bäuchen baumelnden Kameras, schoben<br />
sich gemächlich die Straße entlang, verzehrten Eis, Zuckerwatte oder Maiskolben,<br />
und manchmal auch alles auf einmal.« Daran hatte sich auch bis zu<br />
unserem Besuch nichts geändert. Die gleichen Gruppen birnenförmiger<br />
Menschenleiber <strong>mit</strong> Reeboks an den Füßen wandelten zwischen dem<br />
Dampf und dem Qualm der Buden und hielten ihre absurden Fressalien und<br />
eimergroßen Getränkebehältnisse fest umklammert. Es war immer noch der<br />
gleiche geschmacklose, gräßliche Ort. Dennoch hätte ich ihn jetzt nach der<br />
neun Jahre alten Beschreibung kaum wiedererkannt. Fast jedes Gebäude, an<br />
das ich mich daraus erinnern konnte, war abgerissen und durch ein neues<br />
ersetzt worden -hauptsächlich kleine Einkaufspassagen und Höfe <strong>mit</strong> Geschäften,<br />
die eine ganz neue Welt der Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten<br />
eröffneten.<br />
Aus Straßen der Erinnerung habe ich eine exemplarische Liste der Touristenattraktionen<br />
von Gatlinburg zusammengestellt, wie sie sich 1987 darboten:<br />
Elvis Presley Hall of Fame, National Bible Museum, Stars Over Gatlinburg-Wachsfigurenkabinett,<br />
Ripleys Believe It or Not Museum, American<br />
Historical Wax Museum, Gatlinburg Space Needle. Bonnie Lou and<br />
Buster Country Music Show, Carbo’s Police Museum, Guiness Book of
Records Exhibition Center, Irlene Mandrell Hall of Stars Museum and<br />
Shopping Mall, zwei Geisterhäuser und noch drei andere Attraktionen,<br />
Hillbilly Village, Paradise Island und World of Illusions. Von diesen 15<br />
Sehenswürdigkeiten waren neun Jahre später anscheinend nur noch drei<br />
übriggeblieben. Natürlich waren statt dessen andere hinzugekommen –<br />
Mysterious Mansion, Hillbilly Golf, Motion Master Ride – die in neun<br />
Jahren wohl ebenfalls wieder verschwunden sein werden, denn so läuft das<br />
nun mal in Amerika.<br />
Ich weiß, daß die Welt ständig in Bewegung ist, aber das Tempo der Veränderungen<br />
in den Vereinigten Staaten ist schwindelerregend. 1951, in meinem<br />
Geburtsjahr, gab es in Gatlinburg nur ein Einzelhandelsgeschäft, den<br />
Gemischtwarenladen Ogle’s. In der wirtschaftlichen Blütezeit der Nachkriegsjahre<br />
fuhren immer mehr Menschen <strong>mit</strong> dem Auto in die Smokies,<br />
und es eröffneten reihenweise Motels, Restaurants, Tankstellen und Souvenirläden.<br />
1987 hatte Gatlinburg 60 Motels und 200 Souvenirläden, heute<br />
sind es 100 Motels und 400 Souvenirläden. Und das Erstaunliche daran ist,<br />
daß daran absolut nichts erstaunlich ist.<br />
Das muß man sich einmal klarmachen: Die Hälfte aller Bürohäuser und<br />
Einkaufszentren in Amerika wurde nach 1980 gebaut. Wohlgemerkt, die<br />
Hälfte. 80 Prozent der Wohnhäuser stammen aus der Zeit nach 1945. Von<br />
der Gesamtzahl aller Motelzimmer in Amerika sind 230.000 in den letzten<br />
15 Jahren entstanden. Nur ein paar Kilometer hinter Gatlinburg liegt das<br />
Städtchen Pigeon Forge, das 20 Jahre zuvor noch ein verschlafenes Nest<br />
war – was sage ich, erst noch ein verschlafenes Nest werden wollte – und<br />
nur Berühmtheit erlangte, weil es die Heimatstadt von Dolly Parton ist.<br />
Dann errichtete die ehrenwerte Ms. Parton einen Vergnügungspark, Dollywood,<br />
und nun verfügt Pigeon Forge über 200 Einzelhandelsgeschäfte, die<br />
sich entlang eines fünf Kilometer langen Highways hinziehen. Pigeon Forge<br />
ist größer und noch häßlicher als Gatlinburg, hat aber bessere Parkmöglichkeiten<br />
und deswegen mehr Gäste.<br />
Und nun vergleichen Sie das alles mal <strong>mit</strong> dem Appalachian Trail. Zu dem<br />
Zeitpunkt, als wir unsere Wanderung unternahmen, war der AT 59 Jahre alt,<br />
ein stattliches Alter für amerikanische Verhältnisse. Der Oregon Trail und<br />
der Santa Fe Trail sind nicht so alt geworden. Route 66 ist nicht so alt geworden.<br />
Und der ehemalige Lincoln Highways, eine Straße, die beide Küsten<br />
<strong>mit</strong>einander verband und Leben und bleibenden Wohlstand in viele<br />
Kleinstädte brachte, und die so berühmt und beliebt war, daß sie »America’s<br />
Main Street« genannt wurde, ist auch nicht so alt geworden. In Amerika<br />
wird nichts alt. Wenn ein Produkt sich nicht dauernd selbst neu erfindet,<br />
wird es abgeschafft, verdrängt, ohne Skrupel aufgegeben für etwas Größeres,<br />
Neueres und leider meist auch Häßlicheres. Und dann gibt es da den
guten alten AT, der nach sechs Jahrzehnten immer noch still und bescheiden<br />
seine Aufgabe erfüllt, getreu seinen Grundprinzipien, sympathischerweise<br />
ohne sich darum zu kümmern, daß die Welt sich ein ganzes Stück weiterentwickelt<br />
hat. Eigentlich ein Wunder.<br />
Katz brauchte neue Schnürbänder, wir gingen daher in einen Laden für<br />
Wanderausrüstung, und während er sich in der Schuhabteilung umtat,<br />
schlenderte ich ein bißchen herum. An einer Wand war eine Karte aufgehängt,<br />
die den gesamten Verlauf des Appalachian Trail durch alle 14 Bundesstaaten<br />
zeigte. Die östliche Meeresküste war seitenverkehrt dargestellt,<br />
so daß man den Eindruck bekam, der Trail habe eine genaue Nordsüd-<br />
Ausrichtung, was es den Kartographen ermöglichte, den Wanderweg in<br />
einem ordentlichen Rechteck unterzubringen, 15 Zentimeter breit, 1,2 Meter<br />
lang. Ich sah mir die Karte <strong>mit</strong> gierigem, geradezu besitzergreifendem Interesse<br />
an – es war das erste Mal, seit ich von New Hampshire aufgebrochen<br />
war, daß ich den Weg in seiner Gesamtlänge sah –, dann trat ich <strong>mit</strong><br />
weit aufgerissenen Augen und heruntergefallener Kinnlade näher heran.<br />
Von der 120 Zentimeter langen Wanderkarte, die mir von den Knien bis ungefähr<br />
zum Scheitel reichte, hatten wir gerade mal die untersten fünf Zentimeter<br />
absolviert.<br />
Ich ging los und suchte Katz, packte ihn am Arm, als ich ihn aufgestöbert<br />
hatte, und zog ihn hinter mir her zu der Pinnwand. »Was ist los?« sagte er.<br />
Ich wies auf die Karte. »Na und?« Katz mochte keine Rätsel.<br />
»Guck dir mal die Karte an, und dann guck dir an, wieviel wir gegangen<br />
sind.«<br />
Er sah hin, er sah noch mal hin. Ich beobachtete ihn, während sein Gesicht<br />
ausdruckslos wurde. »Meine Fresse«, stöhnte er schließlich. Er wandte sich<br />
mir zu, Erstaunen stand ihm jetzt ins Gesicht geschrieben. »Wir haben ja<br />
noch überhaupt nichts geschafft.«<br />
Wir gingen erstmal einen Kaffee trinken und blieben eine Zeitlang in fassungslosem<br />
Schweigen verharrend am Tisch sitzen. Was hatten wir nicht<br />
alles getan und erlebt – die ganzen Mühen und Strapazen, die Schmerzen,<br />
die Feuchtigkeit, die Berge, der grauenhafte pappige Nudelfraß, die<br />
Schneestürme, die langweiligen Abende <strong>mit</strong> Mary Ellen, die vielen, vielen<br />
nicht enden wollenden, zäh errungenen Kilometer – und alles summierte<br />
sich gerade mal zu fünf Zentimetern. Meine Haare waren in der Zeit mehr<br />
gewachsen.<br />
Eins stand fest: Wir würden niemals bis Maine wandern.<br />
In gewisser Weise war das befreiend. Wenn wir nicht den ganzen Weg<br />
wandern konnten, dann brauchten wir ihn auch nicht ganz zu wandern – ein<br />
Gedanke, der an Anziehungskraft gewann, je mehr wir uns <strong>mit</strong> ihm vertraut
machten. Die Schinderei, die uns noch bevorgestanden hätte – das ermüdende,<br />
wahnsinnige, eigentlich sinnlose Unterfangen, jeden Zentimeter des<br />
steinigen Wegs zwischen Georgia und Maine abzugehen –, war von uns genommen.<br />
Ab jetzt konnten wir die Sache locker angehen.<br />
Am nächsten Morgen breiteten wir unsere Karten auf dem Bett in meinem<br />
Motelzimmer aus und wogen die verschiedenen Möglichkeiten ab, die uns<br />
plötzlich offenstanden. Wir kamen zu dem Schluß, nicht in Newfound Gap<br />
wieder loszuwandern, wo wir den Trail verlassen hatten, sondern ein Stück<br />
weiter, an einer Stelle, die sich Spivey Gap nannte, in der Nähe von Ernestville.<br />
Das brachte uns auf die andere Seite der Smokies – weg von den<br />
überfüllten Schutzhütten und den starren Vorschriften – zurück in eine<br />
Welt, in der wir uns ungezwungener bewegen konnten. Ich holte mir die<br />
Gelben Seiten und schlug unter Taxiunternehmen nach. Es gab drei in Gatlinburg.<br />
Ich rief gleich das erste an.<br />
»Wieviel kostet eine Fahrt für zwei Personen nach Ernestville?« erkundigte<br />
ich mich.<br />
»Weiß nich«, lautete die Antwort.<br />
Das brachte mich etwas aus dem Konzept. »Fragen wir mal so: Wieviel<br />
glauben Sie, daß es kostet?«<br />
»Weiß nich.«<br />
»Es ist nicht so weit von hier.«<br />
Es folgte ein beharrliches Schweigen, dann sagte die Stimme: »Jawoll.«<br />
»Haben Sie noch nie jemanden dahingebracht?«<br />
»Nö.«<br />
»Nach meiner Karte zu urteilen sind es etwas über 30 Kilometer. Glauben<br />
Sie, daß das ungefähr hinkommt?«<br />
Wieder Schweigen. »Könnte sein.«<br />
»Und wieviel kosten bei Ihnen 30 Kilometer?«<br />
»Weiß nich.«<br />
Ich sah wütend den Hörer an. »Entschuldigen Sie, aber ich muß es einfach<br />
loswerden: Sie sind wirklich dümmer, als die Polizei erlaubt.«<br />
Ich legte auf.<br />
»Vielleicht sollte ich mich da nicht einmischen«, setzte Katz nachdenklich<br />
an, »aber ich könnte mir vorstellen, daß das nicht gerade der sicherste Weg<br />
zu prompter und freundlicher Bedienung ist.«<br />
Ich rief das nächste Taxiunternehmen an und fragte, wieviel eine Fahrt nach<br />
Ernestville kosten würde.<br />
»Weiß nich«, sagte die Stimme.<br />
Nein, nicht schon wieder, dachte ich.<br />
»Was wollen Sie denn da?« verlangte der Mann zu wissen.<br />
»Wie bitte?«
»Was Sie in Ernestville wollen? Da ist doch nichts los.«<br />
»Eigentlich wollen wir nach Spivey Gap. Es ist nämlich so - wir wandern<br />
den Appalachian Trail entlang.«<br />
»Nach Spivey Gap sind es noch mal acht Kilometer.«<br />
»Ja, ich weiß, ich wollte nur ungefähr wissen…«<br />
»Das hätten Sie gleich sagen sollen, weil, nach Spivey Gap sind es noch<br />
mal acht Kilometer.«<br />
»Na gut. Wieviel würde es denn nach Spivey Gap kosten?«<br />
»Weiß nich.«<br />
»Entschuldigen Sie, aber kann es sein, daß sich Taxifahrer in Gatlinburg<br />
besonders blöd anstellen müssen, um ihre Lizenz zu kriegen?«<br />
»Was?«<br />
Ich legte wieder auf und sah Katz an. »Was ist los <strong>mit</strong> dieser Stadt? Mein<br />
Nasenpopel ist intelligenter als dieser lahme Haufen.«<br />
Ich rief das dritte und letzte Taxiunternehmen an und fragte, wie teuer eine<br />
Fahrt nach Ernestville sei.<br />
»Wieviel können Sie denn zahlen?« blaffte mich eine lebhafte Stimme an.<br />
Endlich mal jemand, <strong>mit</strong> dem man Tacheles reden konnte. Ich mußte grinsen<br />
und sagte. »Ich weiß nicht. Einen Dollar 50?«<br />
Ein verächtliches Schnauben war zu hören. »Also ein bißchen teurer wird es<br />
schon.« Es folgten eine Pause und das Knarren eines Stuhls, in den sich<br />
jemand zurücklehnte. »Es kommt natürlich drauf an, was auf dem Taxameter<br />
steht, aber ich schätze mal, es sind so um die 20 Dollar. Wozu wollen<br />
Sie eigentlich nach Ernestville?«<br />
Ich erklärte ihm das <strong>mit</strong> Spivey Gap und dem Appalachian Trail.<br />
»Appalachian Trail? Sie sind wohl übergeschnappt. Wann wollen Sie los?«<br />
»Ich weiß nicht. Wie war’s jetzt gleich?«<br />
»Wo sind Sie gerade?«<br />
Ich nannte ihm den Namen des Motels.<br />
»Ich bin in zehn Minuten da. 15 Minuten höchstens. Wenn ich in 20 Minuten<br />
nicht da bin, dann machen Sie sich ohne mich auf den Weg, und wir<br />
treffen uns dann in Ernestville.« Er legte auf. Wir hatten nicht nur einen<br />
Fahrer gefunden, wir hatten einen Komiker entdeckt.<br />
Während wir auf einer Bank draußen vor dem Motel warteten, zog ich mir<br />
eine Ausgabe des Nashville Tennessean aus einem Automaten, nur so, weil<br />
ich wissen wollte, was so in der Welt vor sich ging. In dem Leitartikel der<br />
Zeitung wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die Regierung des Bundesstaates<br />
– in einem jener Akte der Aufklärung, durch die sich die südlichen<br />
Staaten häufig zu profilieren versuchen – dabei sei, ein Gesetz zu verabschieden,<br />
das Lehrern in Zukunft verbieten sollte, die Evolutionstheorie an<br />
den Schulen zu unterrichten. Statt dessen sollten sie dazu verpflichtet wer-
den, den Kindern beizubringen, Gott habe die Erde erschaffen, in sieben<br />
Tagen, irgendwann früher, sagen wir, vor der Jahrhundertwende. Der Artikel<br />
rief den Zeitungslesern ins Gedächtnis, daß dieses Thema in Tennessee<br />
schon mal auf der Tagesordnung gestanden hatte. Die kleine Stadt Dayton,<br />
zufällig ganz in der Nähe von dem Ort, in dem Katz und ich uns gerade<br />
befanden, war 1925 Schauplatz eines Gerichtsprozesses gewesen, in dem<br />
der Bundesstaat den Lehrer John Thomas Scopes angeklagt hatte, voreilig<br />
die darwinistische Irrlehre unter die Leute gebracht zu haben. Wie fast jeder<br />
Amerikaner weiß, gelang es dem Verteidiger Clarence Darrow, den Ankläger<br />
in Person von William Jennings Bryan in aller Öffentlichkeit zu demütigen,<br />
aber den meisten ist nicht bekannt, daß Darrow am Ende den Prozeß<br />
verlor. Scopes wurde verurteilt, und erst 1967 wurde das entsprechende<br />
Gesetz in Tennessee abgeschafft. Jetzt sollte es zum zweiten Mal erlassen<br />
werden – wo<strong>mit</strong> Tennessee endgültig den Beweis dafür lieferte, daß die<br />
Gefahr für seine Landeskinder nicht darin bestand, daß sie von Affen abstammten,<br />
sondern darin, von solchen regiert zu werden.<br />
Urplötzlich, ich vermag auch nicht zu sagen warum, verspürte ich das dringende<br />
Bedürfnis, mich schleunigst aus dem tiefen Süden in Richtung Norden<br />
abzusetzen. Ich wandte mich Katz zu.<br />
»Warum fahren wir nicht nach Virginia?«<br />
»Wie bitte?«<br />
Vor ein paar Tagen hatte uns jemand in einer der Schutzhütten erzählt, wie<br />
wunderschön, wie absolut wanderfreundlich die Berge des Virginia Blue<br />
Ridge seien. Wenn man erst mal oben sei, hatte er uns versichert, verliefen<br />
die Wege praktisch alle ohne Steigung, und man habe prächtige Ausblicke<br />
auf das breite Tal des Shenandoah River. Man könne ohne weiteres 40 Kilometer<br />
am Tag schaffen. Von den finsteren, feuchtkalten Schutzhütten der<br />
Smokies aus betrachtet, klang das paradiesisch, und der Gedanke hatte sich<br />
bei mir festgesetzt. Ich erklärte Katz, was ich meinte.<br />
Er rutschte aufgeregt nach vorn. »Heißt das, wir lassen die ganze Strecke<br />
von hier nach Virginia aus? Überspringen sie einfach?« Er wollte offenbar<br />
nur nachfragen, ob er mich auch richtig verstanden hatte.<br />
Ich nickte.<br />
»Ja, verdammt noch mal.«<br />
Als der Taxifahrer eine Minute später vorfuhr, ausstieg und uns musterte,<br />
erklärte ich ihm zögerlich und etwas ratlos – weil ich mir die ganze Sache<br />
selbst nicht gründlich überlegt hatte –, daß wir nicht mehr nach Ernestville<br />
fahren wollten, sondern nach Virginia.<br />
»Virginia?« sagte er, als hätten wir ihn gefragt, wo man sich hier die Syphilis<br />
holen könne. Der Mann war klein, aber gebaut wie ein Gewichtheber,<br />
und er war mindestens 70 Jahre alt und hellwach im Kopf, klüger als Katz
und ich zusammen. Er hatte den Gedanken hinter meinen Überlegungen<br />
begriffen, bevor ich irgend etwas erklärt hatte.<br />
»Dann müssen Sie nach Knoxville, mieten sich da ein Auto und fahren bis<br />
Roanoke. Das ist am besten.«<br />
Ich nickte. »Und wie kommt man nach Knoxville?«<br />
»Wie war’s <strong>mit</strong> einem Taxi?« blaffte er mich wieder an, als hätte er einen<br />
Schwachsinnigen vor sich. Ich glaube, er war etwas schwerhörig oder er<br />
brüllte einfach nur gerne Leute an. »Kostet ungefähr 50 Dollar«, sagte er<br />
abwägend.<br />
Katz und ich sahen uns an. »Gut. In Ordnung«, sagte ich, und wir stiegen<br />
ein.<br />
Also auf nach Roanoke und zu den sanften, grünen Hügeln von Virginia.
9. Kapitel<br />
Earl V. Shaffer, ein junger Mann, der gerade seinen Abschied von der Armee<br />
genommen hatte, war der erste Mensch, der den Appalachian Trail an<br />
einem Stück vom Anfang bis zum Ende abgewandert ist. Er war 123 Tage<br />
unterwegs, von April bis August 1948, ohne Zelt und häufig nur <strong>mit</strong> Straßenkarten<br />
zur Orientierung, und legte durchschnittlich 27 Kilometer am Tag<br />
zurück. Zufälligerweise erschien während dieser Zeit in den Appalachian<br />
Trail News, der Zeitschrift der Appalachian Trail Conference, ein langer<br />
Artikel von Myron Avery und dem Herausgeber Jean Stephenson, in dem<br />
ausführlich dargestellt wurde, warum die Wanderung an einem Stück wahrscheinlich<br />
nicht zu bewerkstelligen sei.<br />
Der Pfad, den Shaffer vorfand, war <strong>mit</strong> dem ordentlich gepflegten Wanderweg<br />
von heute nicht zu vergleichen. Obwohl die Fertigstellung des Wegs<br />
erst elf Jahre zurücklag, war er 1948 bereits wieder in Vergessenheit geraten.<br />
Shaffer mußte feststellen, daß weite Abschnitte überwuchert oder durch<br />
Rodungen im großen Stil vernichtet worden waren. Es gab nur wenige<br />
Schutzhütten und oftmals keine Markierungen. Viel Zeit ging ihm da<strong>mit</strong><br />
verloren, daß er den Pfad über <strong>mit</strong> Gestrüpp bewachsene Berghänge erst <strong>mit</strong><br />
einem Buschmesser freischlagen mußte oder daß er weite Umwege lief,<br />
wenn er an einer Gabelung erstmal in die falsche Richtung gegangen war.<br />
Gelegentlich stieß er auf eine Straße, und es zeigte sich, daß er kilometerweit<br />
vom Weg abgekommen war. Die Bewohner der Orte, durch die er<br />
kam, wußten oft nichts von der Existenz des Trails und wenn doch, waren<br />
sie jedesmal erstaunt darüber, daß er tatsächlich von Georgia bis Maine<br />
führte. Häufig begegneten ihm die Menschen <strong>mit</strong> Mißtrauen.<br />
Andererseits gab es zu der Zeit auch noch in den entlegensten Nestern fast<br />
immer ein Geschäft oder ein Cafe, und in der Regel konnte Shaffer, wenn er<br />
den Trail verließ, da<strong>mit</strong> rechnen, irgendwann auf einen Linienbus zu treffen,<br />
den er anhalten konnte und der ihn in die nächste Stadt bringen würde.<br />
Obwohl er in den vier Monaten keinem Wanderer begegnete, gab es doch<br />
genug anderes Leben entlang des Wegs. Er kam oft an kleinen Farmen oder<br />
Waldhütten vorbei oder stieß auf Viehzüchter, die ihre Herden auf den<br />
grasbewachsenen Bergkuppen hüteten. Diese Lebensformen sind längst<br />
untergegangen. Heute ist der Appalachian Trail eine geplante Wildnis, auf<br />
Befehl, wenn man so will, denn die meisten Gehöfte, an denen Shaffer<br />
vorbeikam, wurden später zwangsenteignet und unauffällig in Waldland<br />
zurückverwandelt. Und noch ein paar Unterschiede zu damals: 1948 gab es<br />
doppelt so viele Singvögel in den Vereinigten Staaten wie heute, und außer<br />
den Kastanien waren die Bäume gesund. Hartriegel, Ulme, Schierling, Balsamtanne<br />
und Rotfichte gediehen alle noch. Vor allem aber hatte unser
Freund Shaffer die ganzen 3.200 Kilometer Wanderweg ganz für sich allem.<br />
Als Shaffer Anfang August seine Wanderung beendete, auf den Tag genau<br />
vier Monate nach dem Start, und diese einmalige Leistung dem Büro der<br />
Appalachian Trail Conference zur Kenntnis brachte, gab es dort zunächst<br />
niemanden, der ihm Glauben schenkte. Er mußte erst offiziellen Vertretern<br />
seine Fotos und Wander-Tagebücher zeigen und eine, wie er sich in seinem<br />
später erschienenen Reisebericht Walking with Spring ausdrückte, »freundliche<br />
aber eingehende Prüfung« über sich ergehen lassen, bevor man ihm<br />
seine Geschichte schließlich abnahm.<br />
Als sich die Nachricht von Shaffers Wanderung verbreitete, erregte sie<br />
ungeheuer viel Aufsehen. Zeitungsjournalisten reisten für Interviews an,<br />
National Geographie veröffentlichte einen langen Artikel über ihn, und der<br />
Appalachian Trail erlebte ein bescheidenes Revival. Wandern ist allerdings<br />
schon immer ein seltener, geradezu exotischer Zeitvertreib in Amerika gewesen,<br />
und nach wenigen Jahren war der AT außer bei einigen Unnachgiebigen<br />
und Exzentrikern schon wieder weitgehend vergessen. Anfang der<br />
60er Jahre tauchte der Plan auf, den Blue Ridge Parkway, eine malerische<br />
Straße südlich der Smokies, zu verlängern und dafür den entsprechenden<br />
Abschnitt des AT einfach zu überbauen. Der Plan scheiterte – aus Kostengründen,<br />
nicht etwa, weil es einen Aufschrei der Empörung gegeben hätte –,<br />
aber dafür wurde der AT an anderer Stelle beschnitten oder verkam zu einem<br />
matschigen Trampelpfad durch Gewerbegebiet. 1958 wurden, wie<br />
bereits erwähnt, von der Südhälfte, dem Abschnitt zwischen Mount<br />
Oglethorpe und Springer Mountain, 32 Kilometer gekappt. Mitte der 60er<br />
Jahre sah es für jeden sensiblen Beobachter so aus, als würde der AT nur als<br />
ein Sammelsurium unzusammenhängender, hier und da verstreut liegender,<br />
einzelner Wegstrecken überleben – in den Smokies und dem Shenandoah<br />
National Park, quer durch Vermont bis nach Maine –, einsame, übriggebliebene<br />
Abschnitte in dem obligatorischen State Park, aber ansonsten begraben<br />
unter Shopping Mails und Erschließungsprojekten. Weite Strecken des<br />
Trails führten über Privatgrundstücke, und neue Besitzer widerriefen oft das<br />
einstmals inoffiziell erteilte Wegerecht und erzwangen da<strong>mit</strong> eine meist<br />
voreilige und verworrene neue Wegführung entlang befahrener Highways<br />
oder anderer öffentlicher Straßen – was kaum das Erlebnis der Wildnis bot,<br />
das Benton MacKaye im Auge gehabt hatte. Wieder einmal war der AT<br />
bedroht.<br />
Dann wollte es der Zufall, daß Amerika einen Innenminister bekam, der<br />
selbst begeisterter Wanderer war, Stewart Udall. In seiner Amtszeit wurde<br />
1968 der National Trails System Act verabschiedet, ein ehrgeiziges und<br />
weitreichendes Gesetzesvorhaben, das größtenteils nie verwirklicht worden<br />
ist. Es sah neue Wanderwege in einer Gesamtlänge von 40.000 Kilometer
kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten vor, von denen die meisten<br />
allerdings nie gebaut wurden. Das Gesetz brachte aber immerhin den Pacific<br />
Crest Trail hervor und sicherte die Zukunft des AT, indem er ihn zum de<br />
facto National Park erklärte. Außerdem gewährte es Finanz<strong>mit</strong>tel, 170 Millionen<br />
Dollar seit 1978, für den Erwerb von Land, um wenigstens eine Art<br />
Wildnis-Pufferzone links und rechts des Wegesrands zu gewährleisten.<br />
Heute verläuft fast der gesamte Weg durch geschützte Wildnis, nur 33 Kilometer,<br />
knapp ein Prozent der Strecke, führen über öffentliche Straßen,<br />
meistens über Brücken, da, wo der Weg Ortschaften durchquert.<br />
In den 50 Jahren nach Shaffers Wanderung haben etwa 4.000 Menschen<br />
diesen Kraftakt unternommen. Unter den Wanderern, die den Trail von<br />
Anfang bis Ende gehen, gibt es zwei Typen, einmal diejenigen, die ihn in<br />
einer einzigen Saison hinter sich bringen, die sogenannten »Weitwanderer«,<br />
und diejenigen, die den Weg portionsweise gehen, die »Etappenwanderer«.<br />
Der Rekord für die längste Etappenwanderung liegt bei 46 Jahren. Die Appalachian<br />
Trail Conference erkennt Geschwindigkeitsrekorde nicht an, <strong>mit</strong><br />
der Begründung, dies widerspräche der Grundidee. Das hält die Leute jedoch<br />
nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen. In den 80er Jahren ging ein<br />
gewisser Ward Leonard <strong>mit</strong> voll bepacktem Rucksack und ohne Helfermannschaften<br />
den Weg in 60 Tagen ab – eine unglaubliche Leistung, wenn<br />
man bedenkt, daß man für die gleiche Entfernung <strong>mit</strong> dem Auto etwa fünf<br />
Tage braucht. Im Mai 1991 traten der »Extremläufer« David Horton und der<br />
»Extremwanderer« Scott Grierson gegeneinander an und gingen im Abstand<br />
von zwei Tagen los. Horton hatte auf der gesamten Strecke ein Netz von<br />
Helfermannschaften gespannt, die an Straßenkreuzungen und anderen strategischen<br />
Punkten auf ihn warteten, so daß er beim Wandern nur eine Flasche<br />
Wasser <strong>mit</strong>zuführen brauchte. Jeden Abend wurde er <strong>mit</strong> einem Auto<br />
in ein Motel gefahren oder privat untergebracht. Er legte pro Tag durchschnittlich<br />
61,6 Kilometer zurück, das sind zehn bis elf Stunden Dauerlauf.<br />
Grierson dagegen ging ausschließlich zu Fuß, am Tag bis zu 18 Stunden.<br />
Am 39. Tag wurde er von Horton in New Hampshire überholt, der sein Ziel<br />
in 52 Tagen und neun Stunden erreichte. Grierson kam zwei Tage später an.<br />
Alle möglichen Leute haben die Wanderung an einem Stück geschafft. Ein<br />
Mann war bereits über Achtzig, ein anderer ging an Krücken, und ein Blinder<br />
namens <strong>Bill</strong> Irwin ist den Weg zusammen <strong>mit</strong> seinem Blindenhund<br />
gewandert und unterwegs schätzungsweise 6.OOOmal hingefallen. Die<br />
berühmteste Person unter den Weitwanderern oder zumindest diejenige,<br />
über die am meisten geschrieben wurde, ist Emma »Grandma« Gatewood,<br />
die den Trail <strong>mit</strong> über sechzig Jahren bereits zweimal erfolgreich absolviert<br />
hat, obwohl sie eine sehr exzentrische Person ist, schlecht ausgerüstet war<br />
und sich sozusagen selbst im Weg stand – sie verirrte sich dauernd. Mein
Lieblingskandidat ist jedoch Woodrow Murphy aus Pepperell, Massachusetts,<br />
der 1995 die Wanderung an einem Stück unternahm. Er hätte auch so<br />
meine Sympathie gehabt, schon weil er Woodrow heißt, aber ich bewunderte<br />
ihn um so mehr, als ich las, daß er 160 Kilo wog und sich auf den Weg<br />
machte, um Gewicht zu verlieren. In der ersten Woche schaffte er ein Tagespensum<br />
von acht Kilometern, aber er hielt durch, und im August, als er<br />
wieder zu Hause ankam, hatte er seine Tagesleistung auf 19 Kilometer gesteigert.<br />
Er hatte 24 Kilo abgenommen – nicht gerade viel bei dem Gesamtgewicht<br />
-und wollte im Jahr darauf die Wanderung wiederholen.<br />
Erstaunlich viele Weitwanderer kommen in Katahdin an, machen auf der<br />
Stelle kehrt und gehen den ganzen Weg nach Georgia noch mal zurück. Sie<br />
können einfach nicht aufhören <strong>mit</strong> dem Wandern, was einen dann doch<br />
stutzig macht. Es ist sogar so, daß man gar nicht mehr aus dem Staunen<br />
herauskommt, wenn man mehr über diese Weitwanderer liest. Nehmen wir<br />
zum Beispiel <strong>Bill</strong> Irwin, den Blinden. Nach seinem Abenteuer meinte er:<br />
»Das Wandern an sich hat mir keinen Spaß gemacht. Ich fühlte mich eher<br />
dazu gezwungen. Ich mußte es tun. Ich hatte keine andere Wahl.« Oder<br />
David Horton, der Extremläufer, der 1991 den Geschwindigkeitsrekord<br />
aufstellte: Nach eigener Darstellung war er am Ende »ein geistiges und<br />
körperliches Wrack«, und während der Durchquerung von Maine hat er die<br />
meiste Zeit über furchtbar geweint. Da fragt man sich doch: Warum tun sich<br />
die Leute das an? Selbst Earl Shaffer fristete später sein Leben als Einsied-<br />
ler in den abgelegenen Wäldern von Pennsylvania. Ich will da<strong>mit</strong> nicht<br />
sagen, daß der Appalachian Trail einen verrückt macht, nur, daß man für<br />
diese Wanderung irgendwie veranlagt sein muß.<br />
Welche Schamgefühle mich plagten, als ich meinen Ehrgeiz aufgab, die<br />
ganze Strecke zu gehen – wenn doch eine Oma in Turnschuhen, ein wandelnder<br />
Wasserball namens Woodrow und über 3.990 andere es bis Katahdin<br />
geschafft hatten? Keine. Ich würde ja immer noch den Appalachian<br />
Trail entlangwandern, nur nicht mehr jeden Meter. Kaum zu glauben, aber<br />
Katz und ich hatten bereits eine halbe Million Schritte getan. Es schien<br />
nicht unbedingt notwendig, auch noch die restlichen viereinhalb Millionen<br />
zu tun, um einen Eindruck von der Sache zu kriegen.<br />
Wir ließen uns also von dem witzigen Taxifahrer nach Knoxville bringen,<br />
mieteten uns am Flughafen einen Wagen und befanden uns schon am frühen<br />
Nach<strong>mit</strong>tag auf dem Weg Richtung Norden, auf einer Ausfallstraße, die uns<br />
durch eine Welt führte, die wir beinahe vergessen hatten: befahrene Straßen,<br />
Ampelanlagen, riesige Kreuzungen, überdimensionale Verkehrsschilder,<br />
landverschlingende Einkaufszentren, Tankstellen, <strong>Bill</strong>igkaufhäuser, Auspuffwerkstätten,<br />
Parkplätze und was sonst noch alles dazu gehört. Selbst<br />
nach einem Tag in Gatlinburg war der Kulturschock überwältigend. Ich
habe irgendwo gelesen, daß einmal zwei Indianer aus dem brasilianischen<br />
Regenwald, die keine Kenntnisse von der Welt jenseits des Dschungels<br />
besaßen und auch keine Erwartungen da<strong>mit</strong> verknüpften, nach Sao Paulo<br />
oder Rio gebracht wurden, und als sie sahen, woraus diese Welt bestand –<br />
aus Häusern, Straßen, Flugzeugen am Himmel – und wie grundlegend sie<br />
sich von ihrem eigenen einfachen Leben unterschied, machten sie sich beide<br />
ausgiebig in die Hose. Ich kann gut nachvollziehen, wie sich die beiden<br />
vorgekommen sind.<br />
Es ist so ein extremer Kontrast. Draußen auf dem Trail ist der Wald dein<br />
Universum, ganz und gar. Man erlebt nichts anderes, sieht nichts anderes,<br />
Tag für Tag. Schließlich kann man sich gar nichts anderes mehr vorstellen.<br />
Man weiß natürlich, daß es irgendwo jenseits des Horizonts große Städte,<br />
rauchende Fabrikschlote und verstopfte Highways gibt, aber diesseits, da,<br />
wo der Wald die Landschaft bedeckt, so weit das Auge reicht, herrscht die<br />
Natur. Auch die kleinen Städte, Franklin oder Hiawassee, selbst Gatlinburg,<br />
sind nur Wegstationen, die verstreut im großen Kosmos des Waldes hegen.<br />
Aber man braucht nur den Trail zu verlassen und irgendwo hinzufahren, so<br />
wie wir jetzt, und es wird einem klar, wie herrlich man getäuscht worden<br />
ist. Hier waren die Berge lediglich Kulisse – bekannt, vertraut, in der Nähe,<br />
aber nicht auffälliger oder folgenschwerer als die Wolken, die über die<br />
Gipfel dahinjagten. Hier tobte das Leben, rückte einem förmlich auf den<br />
Leib: Tankstellen, Wal-Marts, Kmarts, Dunkin Donuts, Blockbuster Videotheken,<br />
ein unaufhörlicher Aufmarsch kommerzieller Abscheulichkeiten.<br />
Sogar Katz war angewidert. »Meine Güte, ist das häßlich«, sagte er erstaunt,<br />
als hätte er so etwas noch nie gesehen. Ich schaute an ihm vorbei auf<br />
eine gigantische Shopping Mall <strong>mit</strong> einem gigantischen Parkplatz davor,<br />
und pflichtete ihm bei. Es war schrecklich. Und dann machten wir uns gemeinsam<br />
ausgiebig in die Hose.
10. Kapitel<br />
Es gibt ein Gemälde von Asher Brown Durand, das den Titel »Verwandte<br />
Geister« trägt und häufig als Beispiel herangezogen wird, wenn es um amerikanische<br />
Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts geht. Das Bild stammt<br />
von 1849, und es zeigt zwei Männer, die auf einem Felsvorsprung in den<br />
Catskills vor einer grandiosen Kulisse stehen, die eine jener stilisierten,<br />
untergegangenen Welten zeigt, die man offenbar nur <strong>mit</strong> einer Expedition<br />
erreichen kann, aber dazu sind die beiden Männer gänzlich unpassend gekleidet,<br />
eher wie fürs Büro, <strong>mit</strong> langen Mänteln und dicken Halstüchern.<br />
Unter ihnen, in einer düsteren Schlucht, rauscht zwischen einem Gewirr von<br />
Felsbrocken ein Wildbach dahin. Jenseits, am Horizont, durch einen Baldachin<br />
aus Blättern, fällt der Blick auf eine lange Kette bedrohlich wirkender,<br />
aber herrlicher, blauer Berge. Von links und rechts schieben sich unregelmäßige<br />
Baumreihen ms Bild, die in einer alles verschlingenden Dunkelheit<br />
verschwimmen.<br />
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gern ich mich in dieses Bild hineinbegeben<br />
würde. Die Landschaft hat etwas dermaßen Ungezähmtes an sich, der<br />
Horizont etwas so Undurchdringliches, daß es auf mich wie eine tollkühne<br />
Verlockung wirkt. Natürlich würde man da draußen umkommen – von<br />
einem Puma zerfetzt, von einem Tomahawk getroffen werden oder einfach<br />
nur beim Gehen in einen jämmerlichen Tod stürzen. Das sieht man auf den<br />
ersten Blick. Und dennoch. Man sucht bereits den Vordergrund nach einem<br />
geeigneten Weg über die steilen Felsen hinunter zu dem Wildbach ab und<br />
fragt sich, ob der Engpaß dahinter wohl zu einem Nachbartal führt oder<br />
nicht. Lebt wohl, Freunde. Das Schicksal ruft. Wartet nicht <strong>mit</strong> dem Abendessen<br />
auf mich.<br />
Es gibt heute nichts Vergleichbares mehr. Vielleicht hat es solche Ausblicke<br />
nie gegeben. Wer weiß, welche Freiheiten sich diese romantischen Pinselquäler<br />
herausgenommen haben. Wer erklimmt schon an einem heißen Julinach<strong>mit</strong>tag<br />
<strong>mit</strong> Staffelei, Klappstuhl und Farbenkasten im Gepäck einen<br />
Aussichtsfelsen <strong>mit</strong>ten in gefährlicher Wildnis, wenn er nicht von dem<br />
Wunsch beseelt wäre, etwas Erhabenes und Großartiges auf die Leinwand<br />
zu bannen?<br />
Selbst wenn die Appalachen vor dem Industriezeitalter nur halb so wildromantisch<br />
waren wie auf dem Bild von Durand und denen anderer Maler,<br />
müssen sie doch etwas Spektakuläres an sich gehabt haben. Man kann sich<br />
heute kaum vorstellen, wie wenig bekannt das Hinterland der Ostküste einst<br />
war und welchen Reichtum es bot. Als Thomas Jefferson die beiden Forscher<br />
Meriwether Lewis und William Clark in die Wildnis schickte, rechnete<br />
er fest da<strong>mit</strong>, daß sie auf zottelige Mammuts und Mastodons stoßen
würden. Hätte man damals schon von Dinosauriern gewußt, hätte er die<br />
beiden sicher gebeten, ihm einen Triceratops <strong>mit</strong>zubringen.<br />
Die ersten Menschen, die von Osten her bis tief in die Wälder vordrangen –<br />
abgesehen von den Indianern, die bereits 20.000 Jahre zuvor so weit gekommen<br />
waren –, suchten keine prähistorischen Lebewesen, keine Passage<br />
nach Westen, auch keine neuen Siedlungsmöglichkeiten. Sie suchten Pflanzen.<br />
Amerikas botanische Vielfalt begeisterte die Europäer außerordentlich,<br />
und die Ausbeutung des Waldes brachte Ruhm und Geld. In den Wäldern<br />
des östlichen Amerikas gab es eine reichhaltige Flora, die in der Alten Welt<br />
unbekannt war, und sowohl Wissenschaftler als auch Hobbybotaniker waren<br />
gleichermaßen erpicht darauf, sich ein Stück des Kuchens zu sichern.<br />
Man stelle sich vor, ein Raumschiff würde morgen auf der Venus einen<br />
Dschungel entdecken. Was gäbe nicht zum Beispiel <strong>Bill</strong> Gates dafür, sich<br />
irgendein exotisches Gewächs von der Venus in sein Gewächshaus stellen<br />
zu können. Die Pflanze <strong>mit</strong> entsprechendem Flair im 18. Jahrhundert war<br />
der Rhododendron – ebenso angesagt waren Kamelie, Hortensie, Traubenkirsche,<br />
Sonnenhut, Azalee, Aster, Straußfarn, Trompetenbaum, Gewürzstrauch,<br />
Fliegenfalle, die virginische Kletterpflanze und die Wolfsmilch.<br />
Diese Pflanzenarten und noch Hunderte mehr wurden in den Wäldern Amerikas<br />
gesammelt und übers Meer nach England, Frankreich und Rußland<br />
verschickt, wo ihre neuen Besitzer sie ungeduldig erwarteten.<br />
Alles nahm seinen Anfang <strong>mit</strong> John Bartram (eigentlich fing es <strong>mit</strong> Tabak<br />
an, aber im wissenschaftlichen Sinn war Bartram der erste), einem Quäker<br />
aus Pennsylvania, geboren 1699, der nach der Lektüre eines Buches über<br />
Botanik sein Interesse für das Thema entdeckte und Pflanzensamen und -<br />
ableger an einen Glaubensbruder in London schickte. Aufgefordert, nach<br />
weiteren Pflanzen zu suchen, begab er sich auf zunehmend gefährlichere<br />
Reisen in die Wildnis und legte manchmal Tausende von Kilometern durch<br />
zerklüftetes gebirgiges Gelände zurück. Obwohl er Autodidakt war, nie<br />
Latein gelernt hatte und nur oberflächliche Kenntnisse der Linneschen<br />
Klassifikation besaß, war Bartram ein begabter Pflanzensammler, <strong>mit</strong> einem<br />
sicheren Instinkt dafür, unbekannte Arten aufzuspüren und sie überhaupt als<br />
solche zu erkennen. Von den 800 während der Kolonialzeit in Amerika<br />
entdeckten Pflanzen geht ein Viertel auf sein Konto, sein Sohn William<br />
entdeckte noch viel mehr.<br />
Ende des Jahrhunderts wimmelte es in den Wäldern des Ostens förmlich<br />
von Botanikern – Peter Kalm, Lars Yungstroem, Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz,<br />
John Fräser, Andre Michaux, Thomas Nuttall, John Lynn<br />
und zahllose andere. So viele Menschen waren dort, konkurrierten in ihrer<br />
Jagd nach seltenen Pflanzen, daß sich heute kaum <strong>mit</strong> Bestimmtheit sagen<br />
läßt, welcher Fund von wem stammt. Je nachdem, welche Quelle man kon-
sultiert, entdeckte allein Fräser entweder 44 oder 215 Arten, möglicherweise<br />
liegt die korrekte Zahl auch irgendwo dazwischen. Verbürgt ist jedoch<br />
seine Entdeckung der wohlriechenden Balsamtanne, auch Fräser-Tanne<br />
genannt, die charakteristisch für die hohen Regionen von North Carolina<br />
und Tennessee ist. Aber sie trägt seinen Namen nur deswegen, weil er den<br />
Gipfel des Clingmans Dome kurz vor seinem schärfsten Rivalen Michaux<br />
erklommen hatte.<br />
Diese Männer bereisten in einem beachtlichen Zeitraum oft riesige Gebiete.<br />
Eine der letzten Expeditionen von Bartram dauerte über fünf Jahre und<br />
führte ihn so tief in unerforschtes Waldgebiet, daß er lange als verschollen<br />
galt. Als er wieder auftauchte, mußte er feststellen, daß sich Amerika seit<br />
einem Jahr im Krieg <strong>mit</strong> England befand und er folglich seine Gönner verloren<br />
hatte. Michaux führten seine Reisen von Florida bis zur Hudson Bay,<br />
und der Abenteurer Nuttall stieß bis zur fernen Küste des Lake Superior<br />
vor, wobei er aus Geldmangel weite Strecken zu Fuß zurücklegte.<br />
Die Forscher sammelten Unmengen von Pflanzenarten, und ihre Reisen<br />
glichen eher Raubzügen. Lyon zog allein an einem Berghang 3.600 Setzlinge<br />
der Magnolia macrophylla aus der Erde, dazu Tausende anderer Pflanzen,<br />
einschließlich eines hübschen roten Gewächses, das ihn in einen Fieberwahn<br />
versetzte und seinen Körper »umgehend in eine einzige Wundblase«<br />
verwandelte – er hatte den Giftsumach entdeckt. 1765 entdeckte John<br />
Bartram eine besonders hübsche Kamelie, Franklinia alta-maha, schon<br />
damals eine seltene Pflanze, die im Laufe von nur 25 Jahren ausgerottet<br />
wurde. Sie konnte nur als Züchtung überleben, was wir allein Bartram zu<br />
verdanken haben. Rafinesque-Schmaltz ist sieben Jahre lang durch die Appalachen<br />
gewandert und hat dabei nicht allzu viel entdeckt, er brachte jedoch<br />
50.000 Samen und Ableger <strong>mit</strong> nach Hause.<br />
Wie die Forscher das geschafft haben, ist ein Rätsel. Jede Pflanze mußte<br />
katalogisiert und bestimmt werden, die Samen eingesammelt oder ein Ableger<br />
geschnitten werden, letzterer mußte in ein Behältnis aus steifem Papier<br />
oder Segeltuch eingetopft, gegossen und gepflegt und dann noch durch eine<br />
weglose Wildnis in die Zivilisation transportiert werden. Die Entbehrungen<br />
und Gefahren waren allgegenwärtig und kräftezehrend. Es wimmelte von<br />
Bären, Schlangen und Panthern. Michaux’ Sohn wurde auf einer Expedition<br />
einmal übel zugerichtet, als ein Bär ihn aus einem Baum vertrieb.<br />
(Schwarzbären scheinen früher wilder gewesen zu sein, denn in fast allen<br />
Expeditionsberichten finden sich Hinweise auf plötzliche, willkürliche<br />
Attacken. Es ist durchaus denkbar, daß die Bären im Osten der Vereinigten<br />
Staaten insgesamt zurückhaltender geworden sind, weil sie gelernt haben,<br />
Menschen <strong>mit</strong> Gewehren in Verbindung zu bringen.) Auch Indianer waren<br />
den Forschern im allgemeinen feindlich gesinnt – ebenso häufig allerdings
amüsierten sie sich über die weißen, europäischen Gentlemen, die lauter<br />
Pflanzen, die um sie herum doch in Hülle und Fülle wuchsen, behutsam<br />
einsammelten und <strong>mit</strong>nahmen – und dann gab es noch all die Krankheiten,<br />
die man sich in den Wäldern holen konnte: Malaria, Gelbfieber und andere.<br />
»Nicht einer meiner Freunde ist bereit, die Strapazen auf sich zu nehmen<br />
und mich auf meinen Wanderungen zu begleiten«, beklagt sich John Bartram<br />
bitterlich in einem Brief an seinen englischen Gönner. Das überrascht<br />
kaum.<br />
Offenbar haben sich die Reisen trotzdem gelohnt. Ein einziger besonders<br />
wertvoller Samen brachte bis zu fünf Guineen ein. In einem Jahr erzielte<br />
John Lyon bei einer Reise nach Abzug aller Kosten einen Gewinn von 900<br />
Pfund – damals ein beträchtliches Vermögen. Im Jahr darauf begab er sich<br />
wieder auf Reisen und verdiente ungefähr noch mal die gleiche Summe.<br />
Fräser unternahm eine sehr lange Reise im Auftrag der russischen Zarin Katharina<br />
der Großen und mußte, als er aus der Wildnis heimkehrte, feststellen,<br />
daß es einen neuen Zar gab, der sich nicht für Pflanzen interessierte, ihn<br />
für verrückt hielt und seinen Vertrag nicht anerkannte. Fräser schaffte danach<br />
alles nach Chelsea, wo er eine kleine Gärtnerei besaß, und verdiente<br />
sich fortan seinen Lebensunterhalt <strong>mit</strong> dem Verkauf von Azaleen, Rhododendren<br />
und Magnolien an die englische Oberschicht.<br />
Andere wiederum gingen aus reiner Entdeckerfreude auf Reisen, allen voran<br />
Thomas Nuttall, ein junger, kluger, aber ungebildeter Handwerker und<br />
Drucker aus Liverpool, der 1808 nach Amerika kam und seine bislang ungeahnte<br />
Leidenschaft für Pflanzen entdeckte. Er unternahm zwei große<br />
Expeditionen, die er aus eigener Tasche finanzierte, machte zahlreiche,<br />
bedeutende Entdeckungen und spendete viele Pflanzen, <strong>mit</strong> denen er ohne<br />
weiteres sehr viel Geld hätte verdienen können, großzügigerweise dem<br />
Botanischen Garten in Liverpool. In nur neun Jahren entwickelte er sich von<br />
einem Laien ohne jegliche Kenntnisse zur führenden Autorität auf dem<br />
Gebiet der Pflanzen Amerikas. 1817 produzierte er – was ganz wörtlich zu<br />
verstehen ist, denn er verfaßte nicht nur den Text, sondern setzte auch die<br />
Druckstöcke zum großen Teil selbst – sein Buch Genera of North America,<br />
das über viele Jahrzehnte hinweg als das wichtigste Nachschlagewerk für<br />
amerikanische Botanik galt. Vier Jahre später wurde er zum Direktor des<br />
Botanischen Gartens der Harvard University ernannt, ein Amt, das er <strong>mit</strong><br />
Würde zwölf Jahre lang bekleidete; er fand trotzdem Zeit, sich auch noch zu<br />
einem führenden Experten der Vogelkunde zu machen, und legte 1832<br />
einen viel beachteten Text über die Vogelwelt Amerikas vor. Er war nach<br />
einhelliger Aussage ein sehr freundlicher Mensch, der den Respekt all jener<br />
gewann, die seine Bekanntschaft machten. Schönere Geschichten kann das<br />
Leben eigentlich nicht schreiben.
Bereits zu Nuttals Zeiten unterlag der Wald dramatischen Veränderungen.<br />
Pumas, Wapitis und Timberwölfe waren bereits ausgerottet, Biber und Bären<br />
standen kurz davor. Die meisten großen nordamerikanischen Kiefern<br />
der ersten Generation - Mastbaumkiefer, Strobe und Weymouthskiefer, von<br />
denen einige bis zu 70 Meter groß wurden, was ungefähr der Höhe eines<br />
zwanzigstöckigen Hauses entspricht – waren bereits gefällt worden, um<br />
daraus Schiffsmasten herzustellen oder um Weideland zu erhalten, der Rest<br />
war bis Ende des Jahrhunderts verschwunden. Es herrschte ein Geist der<br />
Rücksichtslosigkeit, die der Vorstellung entsprang, die Wälder Amerikas<br />
seien im Grunde unerschöpflich. Es war gang und gäbe, zweihundertjährige<br />
Pecanobäume einfach umzuhauen, weil sich so die Nüsse in den Ästen der<br />
Wipfel bequemer ernten ließen. Mit jedem Jahr veränderte sich der Charakter<br />
des Waldes sichtbar. Bis vor kurzem - leider nur bis vor kurzem – gab es<br />
allerdings einen Baum im Überfluß, was den Eindruck von paradiesischen<br />
Zuständen in den Wäldern Amerikas aufrecht erhielt: die Kastanie.<br />
Es gibt keinen anderen vergleichbaren Baum. Die amerikanische Kastanie<br />
streckt sich bis zu 30 Meter aus dem Waldboden empor, und ihre aufragenden<br />
Äste breiten sich zu einem unglaublich üppigen Baldachin aus, bis zu<br />
4.000 Quadratmeter pro Baum, Millionen Quadratmeter Blattfläche insgesamt.<br />
Obwohl nur halb so groß wie die höchsten Kiefern in den Wäldern der<br />
Ostküste, besitzt die Kastanie einiges mehr an Masse und Gewicht, und sie<br />
ist symmetrischer geformt. In Bodennähe erreicht ein ausgewachsener<br />
Baum bis zu drei Meter Durchmesser und über sechs Meter Umfang. Ich<br />
habe einmal ein Foto gesehen, das Anfang des Jahrhunderts aufgenommen<br />
wurde. Es zeigt eine Gesellschaft, die in einem Kastanienwald ein <strong>Picknick</strong><br />
veranstaltet, unweit von der Stelle, an der Katz und ich uns gerade befanden,<br />
in einem Gebiet, das zum Jefferson National Forest gehört. Es ist eine<br />
heitere Gruppe von Wochenendausflüglern, alle tragen schwere Kleidung,<br />
die Damen <strong>mit</strong> aufgespannten Sonnenschirmen, die Herren <strong>mit</strong> Melone und<br />
buschigen Schnauzbärten. Man sitzt im Halbkreis auf einer Decke auf einer<br />
Lichtung, vor einem Hintergrund aus steil einfallenden Sonnenstrahlen,<br />
zwischen Bäumen von sagenhafter Erhabenheit. Die Menschen nehmen sich<br />
so winzig aus, ihre Größe steht in einem so grotesken Mißverhältnis zu den<br />
sie umgebenden Bäumen, daß man sich im ersten Moment fragt, ob das Bild<br />
nicht manipuliert worden ist, so wie die Postkarten aus der Zeit, auf denen<br />
scheunentorgroße Wassermelonen oder Maiskolben zu sehen sind, die einen<br />
ganzen Wagen für sich beanspruchen, darunter die witzige Unterschrift:<br />
»Typische Farmszene in Iowa.« Aber so hat es tatsächlich einmal ausgesehen<br />
– auf Zehntausenden von Quadratkilometern Hügellandschaft von<br />
North und South Carolina bis New England. Alles verschwunden.<br />
1904 fiel einem Pfleger im Zoo der Bronx in New York auf, daß die schö-
nen Kastanienbäume auf dem Gelände über und über <strong>mit</strong> kleinen, orangefarbenen,<br />
krebsartigen Geschwüren eines unbekannten Typs bedeckt waren.<br />
Innerhalb weniger Tage erkrankten die Bäume und starben. Als Wissenschaftler<br />
den Erreger identifiziert hatten, einen asiatischen Pilz <strong>mit</strong> der Bezeichnung<br />
Endothia parasitica – wahrscheinlich <strong>mit</strong> einer Schiffsladung<br />
infizierter Bäume oder Holzbretter aus dem Orient eingeschleppt –, waren<br />
die Kastanienbäume bereits alle abgestorben und der Pilz in die Weite der<br />
Appalachen verschleppt, wo jeder vierte Baum eine Kastanie war.<br />
Trotz seiner Masse ist ein Baum ein höchst empfindliches Gebilde. Das<br />
gesamte Innenleben spielt sich in drei hauchdünnen Gewebeschichten direkt<br />
unter der Borke ab – Phloem, Xylem und Kambium –, die zusammen einen<br />
feuchten Mantel um das tote Kernholz bilden. Wie groß ein Baum auch<br />
immer wird, im Grunde besteht er nur aus einigen Kilogramm lebender<br />
Zellen, die sich weiträumig zwischen Wurzeln und Blättern verteilen. Diese<br />
drei aktiven Zellenschichten sind zuständig für die gesamte komplizierte<br />
Wissenschaft und Technik, die nötig sind, um einen Baum am Leben zu<br />
erhalten, und die Effizienz, <strong>mit</strong> der dies geschieht, zählt zu den größten<br />
Naturwundern. Ohne viel Getöse und Aufhebens zieht jeder Baum im Wald<br />
riesige Wassermengen aus dem Boden hoch – bei großen Bäumen sind das<br />
an heißen Tagen 1.000 Liter und mehr –, von den Wurzeln bis in die Blätter,<br />
von wo aus es zurück in die Atmosphäre gelangt. Stellen Sie sich den<br />
Lärm vor, den die Maschinen der Feuerwehr veranstalten würden, wenn sie<br />
die gleiche Menge Wasser dort hinaufbefördern müßten.<br />
Der Wassertransport ist nur eine der vielen Aufgaben von Phloem, Xylem<br />
und Kambium. Sie stellen außerdem Lignin und Zellstoff her, regulieren<br />
den Vorrat und die Produktion von Gerbsäure, Saft, Gummi, Ölen und Harzen,<br />
verteilen Mineralien und Nährstoffe, verwandeln Stärke in Zucker, der<br />
für zukünftiges Wachstum gebraucht wird (Stichwort Ahornsirup), und erledigen<br />
lauter andere wichtige Dinge. Alles vollzieht sich in einer sehr zarten<br />
Schicht, weswegen ein Baum höchst anfällig für eindringende Organismen<br />
ist. Um dem entgegenzuwirken, verfügen Bäume über ein ausgeklügeltes<br />
Abwehrsystem. Der Grund, warum ein Gummibaum beim Anschneiden<br />
zum Beispiel Latex absondert, liegt darin, daß da<strong>mit</strong> Insekten und anderen<br />
Organismen <strong>mit</strong>geteilt werden soll: »Vorsicht! Ungenießbar. Verschwindet!«<br />
Bäume können auch gefräßige Raupen abschmettern, indem sie ihre<br />
Blätter <strong>mit</strong> Gerbsäure überschwemmen, wodurch die Blätter weniger<br />
schmackhaft werden und die Raupe genötigt wird, sich woanders nach Futter<br />
umzusehen. Wenn der Befall besonders schlimm ist, können manche<br />
Bäume diesen Umstand sogar als Information weitergeben. Einige Eichenarten<br />
setzen eine chemische Substanz frei, durch die anderen Eichen in der<br />
Umgebung <strong>mit</strong>geteilt wird, daß in Kürze ein Angriff erfolgen wird. Als
Reaktion darauf erhöhen die so gewarnten Eichenbäume die Produktion von<br />
Gerbsäure, um sich gegen den Überfall zu wappnen.<br />
Solche Mittel sind es, die die Natur am Leben erhalten. Probleme ergeben<br />
sich dann, wenn der Baum einem Angreifer gegenübersteht, für den ihn die<br />
Evolution nicht ausgerüstet hat, und selten war ein Baum einem Eindringling<br />
schutzloser ausgeliefert als seinerzeit die amerikanische Kastanie der<br />
Endothia parasitica. Dieser Parasit dringt mühelos in den Baum ein, verspeist<br />
die Kambiumzellen und stellt sich bereits auf einen Angriff auf den<br />
nächsten Baum ein, bevor ersterer – chemisch gesehen – auch nur eine<br />
Ahnung davon bekommt, was ihn befallen hat. Er breitet sich <strong>mit</strong>tels Sporen<br />
aus, die millionenfach in jedem Geschwür produziert werden. Ein einziger<br />
Specht kann allein <strong>mit</strong> einem Flug zwischen zwei Bäumen Milliarden<br />
Sporen transportieren. Auf dem Höhepunkt des Kastanienbaumsterbens in<br />
Amerika wurden <strong>mit</strong> jeder Windböe Milliarden von Sporen freigesetzt und<br />
als tödliche Wolke auf die Nachbarberge geweht. Die Sterberate lag bei 100<br />
Prozent. Nach gut 35 Jahren gehörte die amerikanische Kastanie der Vergangenheit<br />
an. Allein die Appalachen verloren im Zeitraum einer Generation<br />
vier Milliarden Bäume, die ein Viertel der Gesamtfläche einnahmen.<br />
Das ist natürlich eine große Tragödie. Aber was für ein Glück, wenn man<br />
bedenkt, daß solche Krankheiten wenigstens artenspezifisch sind. Viel<br />
schlimmer wäre es, wenn es statt Kastanienbaumsterben oder Ulmensterben<br />
oder dem schwarzen Brenner bei Hartriegel eine allgemeine Plage für Bäume<br />
gäbe, die wahllos alle treffen und unaufhaltsam ganze Wälder vernichten<br />
würde. Es gibt diese Plage aber bereits. Sie heißt saurer Regen.<br />
Genug der Wissenschaft, ich denke, das reicht für ein Kapitel. Aber bitte<br />
behalten Sie den Gedanken im Hinterkopf, denn eines kann ich Ihnen versichern:<br />
Es gab nicht einen Tag in den Wäldern der Appalachen, an dem ich<br />
nicht Dankbarkeit empfand für das, was von ihnen noch vorhanden war.<br />
Der Wald, durch den Katz und ich jetzt stapften, war nicht zu vergleichen<br />
<strong>mit</strong> den Wäldern, die die Generation unserer Väter noch gekannt hatte, aber<br />
immerhin waren wir von Bäumen umgeben. Und es war ein herrliches Gefühl,<br />
wieder in unserer vertrauten Umgebung zu sein. Eigentlich war es in<br />
jeder Hinsicht der gleiche Wald, den wir in North Carolina verlassen hatten<br />
- die gleichen gefährlich schiefen Bäume, der gleiche schmale braune Pfad,<br />
die gleiche ausgedehnte Stille, nur unterbrochen von unserem leisen Ächzen<br />
und angestrengten Schnaufen, als wir Berge erklommen, die sich als mindestens<br />
so steil erwiesen wie die, die wir hinter uns gelassen hatten, wenn<br />
auch nicht ganz so hoch. Aber obwohl wir uns jetzt ein paar hundert Kilometer<br />
weiter nördlich befanden, war hier der Frühling merkwürdigerweise<br />
schon weiter fortgeschritten. Die Bäume, vorwiegend Eichen, standen in<br />
voller Blüte, hier und da sah man Büschel von Wildpflanzen aus der Schicht
der Blätter des Vorjahres herausragen -Blutkraut, Wachslilien und Doppelsporn.<br />
Das Sonnenlicht sickerte durch die Zweige über uns und warf<br />
scheinwerferartig Lichtflecken auf den Weg, und in der Luft lag eine gewisse<br />
berauschende, charakteristisch frühlingshafte Leichtigkeit. Zuerst zogen<br />
wir unsere Jacken aus, dann folgten die Pullover. Die Welt war wieder ein<br />
freundlicher Ort.<br />
Am schönsten waren die Ausblicke rechts und links, herrlich und betörend.<br />
Der Blue Ridge sieht in seinem 650 Kilometer langen Verlauf durch Virginia<br />
im Grunde wie eine Rückenflosse aus.<br />
Er ist zwei bis drei Kilometer breit, hier und da <strong>mit</strong> tiefen, V-förmigen<br />
Durchlässen, den sogenannten Gaps versehen, ansonsten hält er sich<br />
gleichmäßig auf einer Höhe von knapp 1000 Metern. Im Westen erstreckte<br />
sich das breite, grüne Valley of Virginia, das bis zu den Allegheny Montains<br />
reicht, im Osten träger und ländlicher die Piedmontebene. Wenn wir<br />
uns hier auf einen Berggipfel schleppten und einen Aussichtsfelsen betraten,<br />
sahen wir keine haubenförmigen grünen Berge, die bis zum Horizont reichten,<br />
sondern blickten jedesmal aus luftiger Höhe hinab auf eine bewohnte<br />
Welt: sonnenbeschienene Farmen, kleine Dörfer, einzelne Waldstücke,<br />
Serpentinenstraßen, alles sehr idyllisch aus der Ferne. Selbst ein Interstate<br />
Highway <strong>mit</strong> seinen kleeblattförmigen Kreuzen und Querstraßen sah<br />
freundlich und besinnlich aus, wie die Illustrationen in den Kinderbüchern,<br />
die ich als kleiner Junge hatte und auf denen ein Amerika zu sehen war, das<br />
geschäftig und immer in Bewegung war, aber wiederum nicht allzu hektisch,<br />
um nicht seinen Reiz zu verlieren.<br />
Wir wanderten eine Woche lang und begegneten kaum Menschen. An einem<br />
Nach<strong>mit</strong>tag lernte ich einen Mann kennen, der den Trail seit 25 Jahren<br />
abschnittsweise <strong>mit</strong> Auto und Fahrrad absolvierte. Jeden Morgen brachte er<br />
das Fahrrad <strong>mit</strong> dem Auto zehn, 15 Kilometer weit ans Ziel der anstehenden<br />
Tagesetappe, begab sich <strong>mit</strong> dem Wagen an den Ausgangspunkt, das Ziel<br />
des Vortages, wanderte die Strecke zwischen beiden ab und fuhr <strong>mit</strong> dem<br />
Fahrrad wieder zurück zum Parkplatz. Das machte er jedes Jahr im April<br />
zwei Wochen lang und hatte sich ausgerechnet, daß er noch ungefähr 20<br />
weitere Jahre brauchen würde. An einem anderen Tag folgte ich einem<br />
älteren Mann, der bestimmt weit über Siebzig war. Er trug einen kleinen,<br />
altmodischen Tagesrucksack aus sandfarbenem Segeltuch und war <strong>mit</strong><br />
einem unglaublichen Tempo unterwegs. Zwei- bis dreimal in der Stunde sah<br />
ich ihn 40, 50 Meter vor mir zwischen den Bäumen auftauchen und wieder<br />
verschwinden. Obwohl er sehr viel schneller ging als ich und anscheinend<br />
nie eine Pause einlegte, war er stets da. Immer wenn man 40 bis 50 Meter<br />
weit blicken konnte, sah man ihn bzw. nur seinen Rücken, der gleich wieder<br />
wegtauchte. Als würde man einem Geist folgen. Ich versuchte ihn einzuho-
len, aber es gelang mir nicht. Er sah mich kein einziges Mal an, aber ich bin<br />
mir sicher, daß er mich bemerkt hatte. Man entwickelt ein Gespür für die<br />
Anwesenheit von anderen Menschen im Wald, und wenn man merkt, daß<br />
Leute in der Nähe sind, wartet man meist, bis sie einen eingeholt haben, nur<br />
um guten Tag zu sagen, ein paar Worte zu wechseln oder zu fragen, ob<br />
jemand den Wetterbericht gehört hat. Der Mann vor mir blieb nie stehen<br />
oder wartete, veränderte nie sein Schrittempo, schaute sich nie um. Am<br />
späten Nach<strong>mit</strong>tag verschwand er aus meinem Blickfeld, und ich sah ihn nie<br />
wieder.<br />
Am Abend erzählte ich Katz von meinem Erlebnis.<br />
»Meine Güte«, murmelte er, »jetzt fängst du schon an zu halluzinieren.«<br />
Am nächsten Tag sah Katz den Mann. Diesmal blieb der Fremde hinter ihm,<br />
immer in der Nähe, ohne zu überholen. Es war höchst seltsam. Danach<br />
sahen wir ihn beide nicht wieder. Wir sahen überhaupt niemanden mehr.<br />
Das hatte zur Folge, daß wir jeden Abend die Schutzhütten ganz für uns<br />
allein hatten, was ein echter Luxus war. Man muß schon ziemlich tief gesunken<br />
sein, wenn man sich für ein überdachtes Holzpodest begeistern<br />
kann, das man für eine Nacht sein eigen nennen darf – aber so war es, wir<br />
waren begeistert. Die meisten Schutzhütten auf diesem Abschnitt des Trails<br />
sind neu und blitzsauber. Manche waren <strong>mit</strong> einem Besen ausgestattet, eine<br />
gemütliche, häusliche Note. Die Besen wurden sogar benutzt - wir benutzten<br />
sie jedenfalls und pfiffen ein Liedchen dabei –, ein Beweis dafür, daß<br />
der AT-Wanderer dankbar für alles ist, was ihm Bequemlichkeit verschafft,<br />
und verantwortungsbewußt da<strong>mit</strong> umgeht. Jede Hütte hat ein Plumpsklo in<br />
der Nähe, außerdem eine gute Wasserquelle und einen <strong>Picknick</strong>tisch, so daß<br />
wir unsere Mahlzeiten in mehr oder weniger normaler Körperhaltung zubereiten<br />
konnten und dabei nicht auf einem feuchten Baumstamm hocken<br />
mußten. Das alles ist echter Luxus für die Wanderer auf dem Appalachian<br />
Trail. Am Abend des vierten Tages, als ich mich<br />
<strong>mit</strong> der trüben Aussicht konfrontiert sah, bald mein einziges Buch ausgelesen<br />
zu haben, und da<strong>mit</strong>, daß mir für die Nächte danach nichts anderes<br />
übrigbleiben würde, als im Halbdunkel zu liegen und Katz’ Geschnarche zu<br />
lauschen, entdeckte ich plötzlich ein Buch von Graham Green, das ein früherer<br />
Gast liegengelassen hatte. Ich war hocherfreut und unendlich dankbar.<br />
Wenn es etwas gibt, das man auf dem AT lernt, dann ist es die Freude über<br />
kleine Dinge – etwas, das uns allen im Leben ganz gut tun würde.<br />
Ich war selig. Wir marschierten 25 Kilometer am Tag, nicht annähernd die<br />
40 Kilometer, die man angeblich schaffen konnte, wie man uns gesagt hatte,<br />
aber eine ganz ansehnliche Strecke für unsere Verhältnisse. Ich fühlte mich<br />
beschwingt, körperlich fit, und zum ersten Mal seit Jahren sah mein Bauch<br />
nicht mehr wie eine Wampe aus. Ich war immer noch müde und steif am
Ende eines langen Wandertages – das blieb auch weiterhin so –, aber ich<br />
hatte einen Punkt erreicht, an dem die Schmerzen und die Blasen ein so<br />
zentrales Merkmal meiner Existenz waren, daß ich sie nicht mehr bemerkte.<br />
Wenn man die bequeme, klinische Welt der Städte verläßt und in die Berge<br />
zieht, durchläuft man jedesmal Phasen der Transformation – ein sanfter<br />
Abstieg in die Verwahrlosung – und immer kommt es einem so vor, als sei<br />
es das erste Mal. Am Ende des ersten Tages fühlt man sich etwas schmutzig,<br />
trägt es aber <strong>mit</strong> Fassung; am zweiten Tag verstärkt sich das Gefühl bis<br />
zum Ekel; am dritten Tag kümmert es einen nicht mehr; am vierten hat man<br />
vergessen, daß es mal anders war. Auch das Hungergefühl folgt einem bestimmten<br />
Muster. Am ersten Tag quält einen der Hunger auf die abendlichen<br />
Nudeln; am zweiten Abend quält einen der Hunger, aber nicht schon<br />
wieder auf Nudeln; am dritten Tag kann man keine Nudeln mehr sehen,<br />
aber man weiß, daß man was essen muß; am vierten Tag hat man überhaupt<br />
keinen Appetit, aber man ißt trotzdem etwas, weil man das abends eben so<br />
tut. Ich weiß auch nicht warum, aber das Ganze ist irgendwie angenehm.<br />
Und dann geschieht etwas, das einem deutlich macht, wie gerne, wie<br />
wahnsinnig gern man wieder in die zivilisierte Welt zurückkehren möchte.<br />
An unserem sechsten Tag, nach einem langen Marsch durch einen ungewöhnlich<br />
dichten Wald, kamen wir gegen Abend an eine kleine grasbewachsene<br />
Lichtung auf einer Steilklippe <strong>mit</strong> einer sensationellen, ungehinderten<br />
Aussicht nach Norden und nach Westen. Die Sonne ging hinter dem<br />
fernen, blaugrauen Kamm der Allegheny Mountains unter, und das Licht in<br />
der Landschaft davor – weites, regelmäßig angeordnetes Ackerland, <strong>mit</strong><br />
Baumgruppen und Farmhäusern – hatte gerade den Moment erreicht, in<br />
dem alle Farbe aus ihm weicht. Aber es war der Anblick einer Stadt, die<br />
ungefähr zehn, elf Kilometer Richtung Norden lag, der unsre Herzen höher<br />
schlagen ließ; eine richtige Stadt, die erste seit einer Woche. Von unserem<br />
Standort aus erkannten wir gerade noch die großen, hell erleuchteten bunten<br />
Schilder von Restaurants und Motels an einer Straße. Ich glaube, ich habe<br />
nie etwas annähernd so Schönes, annähernd so Verlockendes gesehen. Ich<br />
hätte schwören können, daß man den Duft von gebratenen Steaks roch, den<br />
uns die Abendbrise heraufwehte. Wir standen unendlich lange da und<br />
schauten auf die Stadt, als hätte man immer nur über sie gelesen, aber nie<br />
da<strong>mit</strong> gerechnet, sie einmal tatsächlich zu sehen.<br />
»Waynesboro«, sagte ich schließlich zu Katz.<br />
Er nickte feierlich. »Wie weit?«<br />
Ich holte meine Karte hervor und sah nach. »Ungefähr 13 Kilometer.«<br />
Er nickte wieder feierlich. »Gut«, sagte er. Das war, wie mir klar wurde, die<br />
längste Unterhaltung, die wir seit zwei, drei Tagen geführt hatten, und mehr<br />
brauchte auch nicht gesagt werden. Wir waren seit einer Woche unterwegs
und würden morgen runter in die Stadt gehen. Das mußte nicht ausgesprochen<br />
werden. Wir würden 13 Kilometer wandern, uns ein Zimmer mieten,<br />
duschen, nach Hause telefonieren, unsere Wäsche waschen, zu Abend essen,<br />
Lebens<strong>mit</strong>tel einkaufen, fernsehen, in einem Bett schlafen, frühstücken<br />
und dann auf den Trail zurückkehren. Das verstand sich von selbst. Alles,<br />
was wir machten, verstand sich von selbst. Eigentlich herrlich.<br />
Wir schlugen unsere Zelte auf und kochten <strong>mit</strong> unserem letzten Wasser<br />
Nudeln, setzten uns dann nebeneinander auf einen Baumstamm und aßen<br />
schweigend, Waynesboro im Blick. Der Vollmond ging an einem blassen<br />
Abendhimmel auf und schien in einem hellen weißen Licht, das einen an<br />
die Cremeschicht von Oreo-Plätzchen erinnerte. (Irgendwann erinnert einen<br />
unterwegs alles nur noch ans Essen.) Nach langem Schweigen wandte ich<br />
mich abrupt an Katz und fragte ihn in einem Tonfall, der eher hoffnungsvoll<br />
als anklagend klingen sollte: »Kannst du überhaupt irgendwas anderes kochen<br />
als Nudeln?« Ich stellte gerade in Gedanken den Einkaufszettel für<br />
morgen zusammen.<br />
Er mußte eine Zeitlang überlegen. »Arme Ritter«, sagte er schließlich und<br />
verfiel wieder in Schweigen, drehte dann seinen Kopf zu mir und fragte:<br />
»Und du?«<br />
»Nein«, gestand ich. »Nichts.«<br />
Katz dachte darüber nach, welche Folgen das möglicherweise hatte, sah<br />
einen Moment lang so aus, als ob er etwas dazu sagen wollte, schüttelte<br />
dann aber nur gleichmütig den Kopf und widmete sich wieder dem Essen.
11. Kapitel<br />
Ein Gedanke am Rande: Alle 20 Minuten waren Katz und ich auf dem Appalachian<br />
Trail eine längere Strecke zu Fuß gegangen als der durchschnittliche<br />
Amerikaner pro Woche. 93 Prozent aller Wege außerhalb der eigenen<br />
vier Wände, wie weit und für welchen Zweck auch immer, werden in Amerika<br />
heute <strong>mit</strong> dem Auto zurückgelegt. Insgesamt geht jeder Amerikaner im<br />
Schnitt 2,25 Kilometer pro Woche zu Fuß – da<strong>mit</strong> sind alle möglichen Gänge<br />
gemeint: vom Auto zum Büro, vom Büro zum Auto, und auch die Wege<br />
in Supermärkten und Einkaufszentren – das macht 320 Meter pro Tag. Das<br />
ist einfach grotesk.<br />
Als meine Familie und ich in die Vereinigten Staaten umzogen, wollten wir<br />
unbedingt in einer typischen Kleinstadt wohnen, in irgendeinem gemütlichen<br />
Nest, wo Jimmy Stewart Bürgermeister war, die Hardy Boys einem<br />
den Einkauf nach Hause brachten und Deanna Durbin immer und ewig ein<br />
Liedchen pfeifend am offenen Fenster stand. Solche idyllischen kleinen<br />
Städte sind gar nicht so leicht zu finden, aber Hanover, wo wir uns niederließen,<br />
kommt dem schon sehr nahe. Es handelt sich um ein nettes Collegestädtchen,<br />
typisch für New England, angenehm, ruhig und überschaubar,<br />
<strong>mit</strong> vielen alten Bäumen und spitzen Kirchtürmen. Es hat einen großen<br />
Stadtpark, eine altmodische Main Street, einen hübschen Campus <strong>mit</strong> einer<br />
gediegenen und ehrwürdigen Ausstrahlung, und von Laubbäumen gesäumte<br />
Straßen. Für jeden Einwohner sind die Post, die Stadtbücherei und die Geschäfte<br />
bequem zu Fuß zu erreichen.<br />
Die Sache ist nur die: Kaum einer geht irgendwohin zu Fuß. Ich kenne<br />
einen Mann, der die 500 Meter zu seinem Arbeitsplatz <strong>mit</strong> dem Auto fährt.<br />
Und eine Frau, die in ihren Wagen steigt, 400 Meter bis zur Sporthalle fährt,<br />
um dort auf einem Laufband zu trainieren, und sich bitter darüber beklagt,<br />
daß sie keinen Parkplatz findet. Als ich sie einmal fragte, warum sie nicht<br />
zu Fuß zur Sporthalle gehen und statt dessen fünf Minuten weniger auf dem<br />
Laufband trainieren würde, sah sie mich entgeistert an, als wollte ich sie<br />
provozieren. »Weil ich mein Trainingsprogramm auf dem Laufband absolvieren<br />
muß«, erklärte sie mir. »Es speichert die zurückgelegte Distanz und<br />
das Schrittempo, und ich kann den Schwierigkeitsgrad einstellen.« Ich hatte<br />
nicht bedacht, daß die Natur in dieser Hinsicht absolut unzulänglich ist.<br />
In Hanover jedenfalls könnte sie noch zu Fuß gehen, wenn sie wollte. In<br />
vielen anderen amerikanischen Städten ist es heute dagegen schon unmöglich,<br />
sich als Fußgänger fortzubewegen, selbst wenn man wollte. Das wurde<br />
mir am nächsten Tag in Waynesboro wieder überdeutlich bewußt, nachdem<br />
wir uns ein Zimmer gemietet und uns ein extravagantes spätes Frühstück<br />
gegönnt hatten. Ich ließ Katz in einem Waschsalon zurück – aus einem mir
schleierhaften Grund machte er gern große Wäsche, las dabei die zerrissenen<br />
Zeitschriften und genoß das Erlebnis der wundervollen Verwandlung<br />
unserer vor Schmutz starrenden Kleider in flauschige und duftende, aus<br />
großen Maschinen hervorquellende Wäschestücke – und machte mich auf<br />
den Weg, um Insektenspray für uns zu kaufen.<br />
Waynesboro besaß früher einmal eines der üblichen, einigermaßen hübschen<br />
Geschäftsviertel aus insgesamt vielleicht fünf bis sechs Häuserblocks,<br />
aber wie so häufig heutzutage waren auch hier die meisten Einzelhandelsunternehmen<br />
in ein Einkaufszentrum an den Stadtrand umgezogen, und was<br />
einmal eine pulsierende Innenstadt gewesen war, wird heute von ein paar<br />
Banken, Versicherungen, <strong>Bill</strong>iganbietern und Secondhandläden beherrscht.<br />
In vielen Läden brannte kein Licht, oder sie standen leer; ich konnte nirgendwo<br />
ein Geschäft finden, das Insektenspray verkaufte. Ein Mann vor der<br />
Post schlug vor, ich sollte es mal bei Kmart versuchen.<br />
»Wo steht Ihr Wagen?« fragte er als erstes, bevor er mir den Weg erklären<br />
wollte.<br />
»Ich habe keinen Wagen.«<br />
Das machte ihn erstmal stutzig. »Wirklich? Es ist aber über einen Kilometer<br />
weit.«<br />
»Das macht nichts.«<br />
Er schüttelte leise zweifelnd den Kopf, als wollte er jede Verantwortung für<br />
das, was er mir gleich sagen würde, ablehnen. »Sie gehen hier die Broad<br />
Street entlang, biegen bei Burger King rechts ab, und dann immer geradeaus.<br />
Aber, wenn ich jetzt so darüber nachdenke – es sind bestimmt zwei<br />
Kilometer, vielleicht sogar zweieinhalb. Wollen Sie auch zu Fuß zurückgehen?«<br />
»Ja.«<br />
Wieder Kopfschütteln. »Es ist ein weiter Weg.«<br />
»Ich habe Notproviant dabei.«<br />
Wenn er die Ironie verstanden hatte, ließ er es sich nicht anmerken. »Na<br />
dann, viel Glück«, sagte er.<br />
»Vielen Dank.«<br />
»Gleich um die Ecke ist ein Taxiunternehmen«, bot er mir noch als letzte<br />
Hilfe an.<br />
»Eigentlich würde ich lieber gehen«, erklärte ich.<br />
Er nickte unsicher. »Dann viel Glück«, wiederholte er.<br />
Und so marschierte ich los. Es war ein warmer Nach<strong>mit</strong>tag, und ich fühlte<br />
mich wunderbar leicht. Sie können sich nicht vorstellen, wie herrlich es ist,<br />
endlich mal ohne Rucksack zu gehen, federnd und unbeschwert. Mit einem<br />
Rucksack auf dem Rücken geht man geneigt, geduckt, wie nach vorn gedrückt,<br />
die Augen auf den Boden gerichtet. Man stapft, mehr ist nicht drin.
Ohne Rucksack fühlt man sich wie befreit. Man geht aufrecht, man sieht<br />
sich um, man hüpft, man schlendert, man geht spazieren.<br />
Wenigstens vier Straßen weit – denn dann kommt man bei Burger King an<br />
eine wahnsinnige Kreuzung und muß feststellen, daß die neue sechsspurige<br />
Straße bis zum Kaufhaus Kmart lang und schnurgerade und stark befahren<br />
ist und daß sie gänzlich ohne Einrichtungen für Fußgänger auskommt, ohne<br />
Bürgersteige, ohne Zebrastreifen, ohne Verkehrsinseln, ohne Ampelanlagen<br />
an belebten Kreuzungen. Ich lief durch das Gelände von Tankstellen, über<br />
Auffahrten von Motels, überquerte Parkplätze, kletterte über Betonsperren,<br />
kreuzte Rasenflächen und zwängte mich durch vernachlässigte Geißblatt-<br />
und Ligusterhecken sowie Grenzstreifen von Privatgrundstücken. Wenn ich<br />
an eine Brücke kam, die über einen Bach führte oder über einen Abflußkanal<br />
– und eins kann ich Ihnen flüstern: Stadtplaner sind verliebt in<br />
Abflußkanäle –, blieb mir nichts anderes übrig, als auf der Straße zu gehen,<br />
mich dicht an der dreckigen Leitplanke zu halten und die weniger aufmerksamen<br />
Autofahrer zum Ausscheren zu zwingen. Vier Autofahrer hupten,<br />
weil ich die Frechheit besaß, mich ohne Blechkiste durch die Stadt fortzubewegen.<br />
Eine Brücke war so gefährlich, daß ich zögernd davor stehenblieb.<br />
Der Bach, den sie überspannte, war eigentlich nur ein verschilftes<br />
Rinnsal, schmal genug, um rüberzuspringen, was ich dann auch tat. Dabei<br />
rutschte ich aus und purzelte die Böschung hinunter. Ich fand mich in einem<br />
von oben nicht erkennbaren Streifen aus grauem, klebrigem Schlick wieder,<br />
schlug zweimal auf, kroch die andere Seite hinauf, fiel wieder hin und<br />
tauchte zum Schluß übersät <strong>mit</strong> Schlammstreifen und -flecken und <strong>mit</strong><br />
apartem Kleiderschmuck in Form von Kletten wieder hervor. Als ich endlich<br />
zum Kmart Plaza kam, stellte ich fest, daß ich mich auf der falschen<br />
Straßenseite befand und in einem Spurt sechs Spuren feindlichen Verkehrs<br />
überwinden mußte. Auf der anderen Seite überquerte ich den Parkplatz und<br />
betrat die klimatisierten, <strong>mit</strong> Dudelmusik berieselten Hallen von Kmart. Ich<br />
war so dreckig, als käme ich direkt vom Appalachian Trail, und zitterte am<br />
ganzen Leib.<br />
Kmart hatte kein Insektenspray vorrätig.<br />
Ich machte kehrt und begab mich auf den Rückweg in die Stadt, aber diesmal<br />
ging ich <strong>mit</strong> einer irren Wut im Bauch querfeldein, über Wiesen und<br />
durch Gewerbegebiete. Ich riß mir die Jeans an einem Stacheldrahtzaun auf<br />
und machte mich noch schmutziger, als ich ohnehin schon war. Ich sah<br />
Katz, der auf der Wiese des Motels in einem Gartenstuhl in der Sonne saß,<br />
geduscht, in frisch gewaschener Kleidung und <strong>mit</strong> einer so behaglichen<br />
Miene, wie sie nur ein Wanderer haben kann, der zur Abwechslung in der<br />
Stadt ist und sich einen schönen Tag macht. Eigentlich war er dabei, seine<br />
Schuhe einzuwachsen, aber in Wahrheit saß er nur da, ließ die Welt an sich
vorbeiziehen und erfreute sich an der Sonne. Er grüßte mich herzlich. In der<br />
Stadt war Katz immer wie ausgewechselt.<br />
»Meine Güte, wie siehst du denn aus!« rief er, als freute er sich über meine<br />
dreckigen Klamotten. »Wo warst du? Du bist ja eklig dreckig.« Er sah mich<br />
bewundernd von oben bis unten an und sagte dann <strong>mit</strong> ernster Stimme:<br />
»Hast du’s schon weder <strong>mit</strong> einem Stachelschwein getrieben, <strong>Bryson</strong>?«<br />
»Ha ha, sehr witzig.«<br />
»Diese Tiere sind nicht sauber, mußt du wissen, mögen sie einem nach vier<br />
Wochen Wandern auch noch so attraktiv erscheinen. Außerdem sind wir<br />
nicht mehr in Tennessee. Wahrscheinlich machst du dich hier sogar strafbar<br />
– jedenfalls ohne Bescheinigung vom Tierarzt.« Er klopfte auf den Stuhl<br />
neben sich und strahlte übers ganze Gesicht, zufrieden über seine Spöttelei.<br />
»Komm her. Setz dich und erzähl mir alles. Wie heißt sie denn? Domina?«<br />
Er beugte sich vertraulich zu mir herüber. »Hat sie viel gequiekt dabei?«<br />
Ich ließ mich nieder. »Du bist ja nur eifersüchtig.«<br />
»Bin ich nicht, wenn du es genau wissen willst. Ich habe nämlich heute<br />
auch jemanden kennengelernt. Im Waschsalon. Sie heißt Beulah.«<br />
»Beulah? Soll das ein Witz sein?«<br />
»Wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist leider kein Witz.«<br />
»Wer heißt denn heutzutage noch Beulah?«<br />
»Sie zum Beispiel. Und nett ist sie auch noch. Nicht die Allerklügste, aber<br />
ziemlich nett, <strong>mit</strong> kleinen süßen Grübchen.« Er piekste sich <strong>mit</strong> zwei Fingern<br />
in die Wangen, um anzudeuten, wo die Grübchen waren. »Und sie hat<br />
einen sagenhaften Körper.«<br />
»Ach ja?«<br />
Er nickte. »Natürlich«, ergänzte er bedächtig, »ist er unter 100 Kilo wabbelnden<br />
Fetts verborgen. Aber zum Glück macht mir Körperfülle bei einer<br />
Frau nichts aus, solange man nicht gerade eine Mauer einschlagen muß,<br />
da<strong>mit</strong> sie durch die Zimmertür paßt.« Er putzte sorgfältig seinen Schuh.<br />
»Und wie hast du sie kennengelernt?«<br />
»Also eigentlich«, hob er an und rutschte nervös an den Rand der Sitzfläche,<br />
als handele es sich um eine Geschichte, die es sich lohne weiterzuerzählen,<br />
»hat sie mich gefragt, ob ich mir mal ihr Höschen ansehen könnte.«<br />
Ich nickte. »Klar.«<br />
»Das Höschen hatte sich in der Trommel verfangen«, erklärte er.<br />
»Und sie hat es die ganze Zeit angehabt? Du hast gesagt, sie wäre nicht die<br />
Allerklügste.«<br />
»Nein. Sie wollte es waschen, aber der Gummizug hatte sich festgehakt,<br />
und sie bat mich, ihr dabei zu helfen, es herauszuholen. Übergröße«, fügte<br />
er nachdenklich hinzu, verfiel bei dem Gedanken daran kurz in Träumerei<br />
und fuhr dann fort: »Ich konnte es rausholen, aber es war total zerfetzt, und
ich sagte, nur so zum Spaß: >Hoffentlich haben Sie noch ein zweites Paar,<br />
Miss, die hier sind nämlich total zerfetzt.Das wüßten Sie wohl gern, was?
Was ist passiert?«<br />
»Ich stand vor der Feuerwehr, wie verabredet. Da kommt ein roter Pick-up<br />
angerast, bremst <strong>mit</strong> quietschenden Reifen neben mir, und der Fahrer, der<br />
ziemlich sauer ist, sagt, er sei Beulahs Mann und er hätte ein Wörtchen <strong>mit</strong><br />
mir zu reden.«<br />
»Und was hast du gemacht?«<br />
»Ich bin abgehauen. Was denkst du denn?«<br />
»Und, hat er dich nicht eingeholt?«<br />
»Mit 250 Kilo am Leib? Der war kein sportlicher Typ. Eher so ein Rambo,<br />
von dem Schlag: >Ich hau dir gleich in die Eier, Alter.< Er ist eine halbe<br />
Stunde in der Gegend rumgefahren und hat mich gesucht. Ich bin durch<br />
Hinterhöfe und Gärten gerannt, habe mich in Wäscheleinen verheddert und<br />
bin in allen möglichen Scheiß reingetreten. Zum Schluß hat noch ein anderer<br />
Kerl Jagd auf mich gemacht, weil er mich für einen Penner gehalten hat.<br />
Was soll ich bloß machen, <strong>Bryson</strong>?«<br />
»Als erstes darfst du keine dicken Frauen in Waschsalons mehr anbaggern.«<br />
»Ja,ja,ja.«<br />
»Ich gehe raus, gucke, ob die Luft rein ist, und gebe dir dann durchs Fenster<br />
ein Zeichen.«<br />
»Gut. Und dann?«<br />
»Dann gehst du zügig zurück zum Hotel, hältst dir die Hände vor die Eier<br />
und hoffst, daß dich der Kerl nicht erwischt.«<br />
Er gab einen Moment lang Ruhe. »Das ist alles? Was Besseres fällt dir nicht<br />
ein?«<br />
»Fällt dir was Besseres ein?«<br />
»Nein, aber ich bin auch nicht vier Jahre aufs College gegangen.«<br />
»Ich bin nicht aufs College gegangen, um zu lernen, wie man in Waynesboro<br />
deinen Arsch rettet, Stephen. Mein Hauptfach war Politikwissenschaft.<br />
Wenn dein Problem <strong>mit</strong> dem Verhältniswahlrecht in der Schweiz zu tun<br />
hätte, könnte ich dir vielleicht weiterhelfen.«<br />
Er seufzte, lehnte sich <strong>mit</strong> verschränkten Armen zurück, rekapitulierte<br />
nüchtern seine Lage und überlegte, wie sie sich meistern ließe. »Du paßt<br />
auf, daß ich kein Wort mehr <strong>mit</strong> einer Frau wechsle, egal wie dick sie ist,<br />
wenigstens solange, bis wir die Südstaaten hinter uns haben. Die Kerle hier<br />
sind ja alle bewaffnet. Versprichst du mir das?«<br />
»Versprochen.«<br />
Er schwieg gereizt. Während ich mein Abendessen beendete, drehte er den<br />
Kopf hin und her, schaute aus allen Fenstern, als warte er darauf, daß sich<br />
jeden Moment ein wütendes schwammiges Gesicht an die Scheibe preßte.<br />
Als ich fertig war und bezahlt hatte, gingen wir zur Tür.<br />
»Vielleicht bin ich in fünf Minuten tot«, sagte er griesgrämig und packte
mich am Unterarm. »Paß auf. Tu mir einen Gefallen, für den Fall, daß ich<br />
erschossen werde. Ruf meinen Bruder an und sag ihm, in seinem Vorgarten<br />
sei eine Kaffeedose <strong>mit</strong> 10.000 Dollar vergraben.«<br />
»Hast du wirklich 10.000 Dollar im Garten von deinem Bruder vergraben?«<br />
»Natürlich nicht, aber der Kerl ist ein Arschloch, und es geschähe ihm<br />
recht. Los, komm.«<br />
Ich trat nach draußen. Die Straße war leer, es herrschte kein Verkehr. Ganz<br />
Waynesboro war zu Hause und saß vor dem Fernseher. Ich nickte Katz zu.<br />
Er steckte den Kopf durch die Tür, sah vorsichtig nach links und rechts und<br />
raste in einem für seine Verhältnisse wirklich beachtlichen Tempo die Straße<br />
entlang. Ich brauchte ein paar Minuten bis zu unserem Motel. Ich begegnete<br />
unterwegs niemandem. Im Motel klopfte ich an Katz’ Tür.<br />
Eine lächerlich tiefe, autoritäre Stimme antwortete. »Wer ist da?«<br />
Ich seufzte. »Bubba T. Flubba. Rück die Alte raus, Bürschchen.«<br />
»<strong>Bryson</strong>! Laß den Scheiß. Ich kann dich durch den Spion erkennen.«<br />
»Warum fragst du dann, wer da ist?«<br />
»Zur Übung.«<br />
Ich wartete eine Minute lang. »Willst du mich nicht reinlassen?«<br />
»Kann ich nicht. Ich habe eine Kommode vor die Tür gerückt.«<br />
»Wirklich?«<br />
»Geh in dein Zimmer. Ich rufe dich an.«<br />
Mein Zimmer war nebenan, und als ich hineinkam, klingelte das Telefon<br />
bereits. Katz wollte meinen Heimweg in allen Einzelheiten beschrieben<br />
haben und entwarf umständliche Pläne zu seiner Verteidigung, in denen<br />
unter anderem der schwere Keramikfuß einer Stehlampe eine Rolle spielte,<br />
zu guter Letzt wollte er durch das rückwärtige Fenster fliehen. Ich sollte in<br />
der Zwischenzeit Ablenkungsmanöver durchführen, im Idealfall den Truck<br />
des Mannes in Brand setzen und dann in die entgegengesetzte Richtung<br />
Reißaus nehmen. Zweimal rief er mich noch an, einmal kurz nach Mitternacht,<br />
um mir <strong>mit</strong>zuteilen, er habe draußen einen roten Pick-up vorbeifahren<br />
sehen. Am nächsten Morgen weigerte er sich, fürs Frühstück das Motel<br />
zu verlassen, also zog ich los zum nächsten Supermarkt, besorgte Lebens<strong>mit</strong>tel<br />
und kaufte für uns beide je einen Beutel <strong>mit</strong> Proviant von Hardees. Er<br />
kam erst aus dem Zimmer, als vor dem Motel das Taxi <strong>mit</strong> laufendem Motor<br />
wartete. Es waren sechseinhalb Kilometer bis zum Trail, und Katz sah<br />
die ganze Zeit über aus dem Heckfenster.<br />
Das Taxi setzte uns am Rockfish Gap ab, dem südlichen Tor zum Shenandoah<br />
National Park, dem letzten langen Wanderabschnitt, <strong>mit</strong> dem wir den<br />
ersten Teil unseres großen Abenteuers beschließen wollten. Wir hatten<br />
sechseinhalb Wochen für diesen ersten Ausflug angesetzt, und die waren
jetzt bald rum. Ich brauchte dringend Urlaub – den brauchten wir weiß Gott<br />
beide -und hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht nach meiner Familie.<br />
Trotzdem freute ich mich auf das, was ich mir als einen Höhepunkt unseres<br />
Unternehmens erwartete. Der Shenandoah National Park – 162 Kilometer<br />
von einem Ende bis zum anderen -ist berühmt für seine Schönheit, und ich<br />
wollte mich endlich einmal <strong>mit</strong> eigenen Augen davon überzeugen. Wir<br />
hatten immerhin einen weiten Weg zurückgelegt, um hierher zu kommen.<br />
In Rockfish Gap befand sich ein <strong>mit</strong> Rangers besetztes Mauthäuschen, an<br />
dem Autofahrer Eintrittsgeld entrichten müssen; Wanderer brauchen sich<br />
nur eine Wandererlaubnis für das Gebiet zu besorgen. Die Bescheinigung<br />
ist kostenlos – eine der edelsten Traditionen des Appalachian Trail ist, daß<br />
alles umsonst ist –, aber man muß ein langes Formular ausfüllen, seine<br />
persönlichen Daten angeben, die geplante Route durch den Park, und wo<br />
man gedenkt jeden Abend zu kampieren (was ein bißchen absurd ist, weil<br />
man das Gelände noch nicht gesehen hat und nicht weiß, wie viele Kilometer<br />
man am Tag schaffen wird). An das Formular war ein Blatt <strong>mit</strong> den<br />
üblichen Vorschriften und Warnungen geheftet, Androhungen von schweren<br />
Strafen und sofortigem Verweis im Falle von – ach, eigentlich allem<br />
möglichem. Ich füllte das Formular so gut es ging aus und reichte es der<br />
Rangerin hinter dem Fensterchen.<br />
»Sie wollen also den Trail entlangwandern«, stellte sie unvermutet scharfsinnig<br />
fest, nahm das Formular entgegen, ohne einen Blick darauf zu werfen,<br />
stempelte es routinemäßig ab und riß den Durchschlag ab, der als Erlaubnis<br />
dafür diente, den Grund und Boden zu betreten, der uns, theoretisch<br />
jedenfalls, sowieso gehörte.<br />
»Wir wollen es zumindest versuchen«, sagte ich.<br />
»Irgendwann muß ich auch mal in die Berge. Ich habe gehört, es soll wirklich<br />
sehr schön sein.«<br />
Für einen Moment war ich fassungslos. »Sie sind den Trail noch nie gegangen?«<br />
Aber Sie sind doch ein Ranger, wollte ich ergänzen.<br />
»Nein, leider nicht«, erwiderte sie wehmütig. »Ich habe mein ganzes Leben<br />
hier verbracht, aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Eines Tages wird es<br />
soweit sein.«<br />
Katz zerrte mich, aus Angst vor Beulahs Mann, praktisch hinter sich her,<br />
aber ich war neugierig geworden.<br />
»Wie lange sind Sie schon Ranger?« fragte ich sie.<br />
»Im August sind es zwölf Jahre«, sagte sie stolz.<br />
»Sie sollten es mal <strong>mit</strong> dem Wandern probieren. Es ist wirklich schön.«<br />
»Und Sie wären die Speckfalten an Ihrem Hintern los«, murmelte Katz in<br />
sich hinein und ging vor in den Wald. Ich sah ihm <strong>mit</strong> einiger Verwunderung<br />
hinterher. Diese Erbarmungslosigkeit sah Katz überhaupt nicht ähn-
lich, und ich schrieb sie dem Schlafentzug, tiefer sexueller Frustration und<br />
der Übersättigung <strong>mit</strong> Hardees Wurstsnacks zu.<br />
Der Shenandoah National Park hat seine Probleme. Er leidet, noch viel<br />
stärker als der Park in den Smokies, unter chronischem Geldmangel, Zyniker<br />
würden sagen unter chronischem Mißmanagement <strong>mit</strong> den vorhandenen<br />
Mitteln. Einige kilometerlange Abschnitte des Trail sind gesperrt, andere<br />
vernachlässigt. Wenn die freiwilligen Helfer des Potomac Appalachian<br />
Trail Club nicht die Pflege von 80 Prozent der Wanderwege durch den Park<br />
übernommen hätten, wäre die Situation noch schlimmer. Mathews Arm<br />
Campground, eine der größten Freizeiteinrichtungen in dem Park, wurde<br />
1993 wegen Geldmangel geschlossen und seitdem nicht wieder eröffnet.<br />
Viele andere Einrichtungen bleiben mehrere Monate im Jahr geschlossen. In<br />
den 80er Jahren waren sogar die Schutzhütten – die hier nicht shelters,<br />
sondern huts heißen – für einige Zeit dicht. Ich verstehe nicht, wie so etwas<br />
gehen soll – ich meine, wie kann man ein Holzhaus dichtmachen, dessen<br />
viereinhalb Meter breite Vorderseite offen ist? Und noch weniger verstehe<br />
ich den Grund, da ein Verbot für die Wanderer, sich nach einem stundenlangen<br />
Marsch auf einem Holzpodest schlafen zu legen, die Finanzen der<br />
Parkverwaltung wohl kaum entlasten wird. Aber Wanderern das Leben<br />
schwer zu machen hat Tradition in den Parks im Osten der Vereinigten<br />
Staaten. Ein paar Monate zuvor waren wegen einer Pattsituation im Haushaltsausschuß<br />
zwischen Präsident Clinton und dem Kongreß neben einigen<br />
untergeordneten staatlichen Behörden auch alle Nationalparks geschlossen<br />
worden. Aber für einen Wachdienst, der an jedem Zugang zum AT postiert<br />
wurde, um Wanderer <strong>mit</strong> Rucksack abzuwehren, kratzte die Shenandoah-<br />
Park-Verwaltung trotz chronischer Finanzkrise doch noch das nötige Geld<br />
zusammen. Folglich mußten ein paar Dutzend harmloser Leute umständliche,<br />
sinnlose Umwege über die Straße in Kauf nehmen, bevor sie ihre Wanderung<br />
fortsetzen konnten. Diese übertriebene Vorsichtsmaßnahme hat die<br />
Parkverwaltung mindestens 20.000 Dollar gekostet, also etwa 1.000 Dollar<br />
pro abgewimmeltem gefährlichen Wanderer.<br />
Außer <strong>mit</strong> diesen selbstverschuldeten Defiziten muß sich die Parkverwaltung<br />
von Shenandoah <strong>mit</strong> einer Reihe von Problemen herumschlagen, die<br />
von Faktoren herrühren, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Der Park ist<br />
über 160 Kilometer lang, aber an keiner Stelle breiter als zwei, drei Kilometer.<br />
Die Folge ist, daß die Millionen Besucher, die Jahr für Jahr herkommen,<br />
sich in einem außerordentlich schmalen Korridor entlang des Gebirgsgrats<br />
drängeln müssen. Campingplätze, Besucherzentren, Parkplätze, <strong>Picknick</strong>zonen,<br />
der AT und der Skyline Drive – die Aussichtsstraße, die am Grat<br />
entlang verläuft –, alles liegt dicht nebeneinander, auf Tuchfühlung sozusagen.<br />
Eine der beliebtesten Wanderrouten im Park, die zum Old Rag Moun-
tain hinauf, ist dermaßen gefragt, daß an Sommerwochenenden die Leute<br />
dort Schlange stehen.<br />
Dazu kommt das beunruhigende Phänomen der Luftverschmutzung. Noch<br />
vor 30 Jahren konnte man an besonders klaren Tagen das 120 Kilometer<br />
entfernte Washington-Monument erkennen. Heute kann es passieren, daß<br />
die Sichtweite an Sommertagen, an denen Smog herrscht, gerade einmal<br />
3.000 bis 4.000 Meter beträgt, und sie hegt nie mehr über 50 Kilometer. Der<br />
saure Regen in den Flüssen hat der Forelle den Garaus gemacht. Seit 1983<br />
gibt es Schwammspinner, die hektargroße Bestände von Eichen und Walnußbäumen<br />
vernichtet haben. Der große Kiefernmarkkäfer hat an Nadelbäumen<br />
ein ähnliches Werk verrichtet, und der Robinienkäfer und die Miniermotte<br />
haben an Tausenden Robinien schwere, entstellende, aber gnädigerweise<br />
keine tödlichen Schäden angerichtet. Innerhalb von nur sieben<br />
Jahren haben dagegen die Fichtengallenläuse an 90 Prozent des Schierlingsbestands<br />
im Park schweren Schaden angerichtet. Und wenn Sie das<br />
hier lesen, werden auch die restlichen zehn Prozent dahin sein. Eine unheilbare<br />
Pilzerkrankung, Anthraknose oder schwarzer Brenner genannt, ist<br />
dabei, die herrlichen Hartriegelsträucher auszurotten, nicht nur in Shenandoah,<br />
sondern überall in Amerika. Über kurz oder lang wird es den Hartriegel<br />
nicht mehr geben, ebenso wie die nordamerikanische Kastanie und die<br />
nordamerikanische Ulme. Kurzum, man kann sich kaum ein von Umweltproblemen<br />
stärker geplagtes Gebiet als den Shenandoah National Park<br />
vorstellen.<br />
Trotzdem ist der Shenandoah National Park immer noch wunderschön. Er<br />
ist wahrscheinlich der schönste Nationalpark, den ich je gesehen habe, und<br />
dafür, daß so viele unglaubliche und widersprüchliche Anforderungen an<br />
ihn gestellt werden, ist er außerordentlich gut gepflegt. Er war von allen<br />
Parks, durch die der Appalachian Trail führt, mein Lieblingspark.<br />
Wir wanderten durch dichte Wälder, über wunderbar bequemes Terrain, bei<br />
einem sanften Anstieg von 150 Meter auf einer Strecke von 6,5 Kilometern.<br />
In den Smokies kann es einem passieren, daß man 150 Meter auf, na ja, 150<br />
Meter ansteigt. Das hier entsprach meinen Wünschen schon eher. Das Wetter<br />
war freundlich, und man spürte das Nahen des Frühlings. Überall pulsierte<br />
das Leben – Insekten summten, Eichhörnchen huschten über Äste,<br />
Vögel zwitscherten und hüpften in den Bäumen, Spinnweben glitzerten<br />
silbern im Sonnenlicht. Zweimal scheuchte ich Waldhühner auf, und jedesmal<br />
erschrak ich – es ist wie eine Explosion unter den Füßen, als würden<br />
aufgerollte Socken abgefeuert, gefolgt von flatternden Federn und empörtem<br />
Geschnattere. Ich sah eine Eule, die mich von einem dicken Ast aus<br />
seelenruhig beobachtete, und unzählige Rehe, die kurz ihre Köpfe reckten,<br />
wenn man vorbeiging, einen anstarrten, aber ansonsten zutraulich waren
und weiterästen. Vor 60 Jahren gab es in dieser Gegend der Blue Ridge<br />
Mountains keine Rehe. Sie waren durch die Jagd ausgerottet worden. Bei<br />
der Gründung des Parks 1936 setzte man 13 Weißwedelhirsche aus, und da<br />
kein Mensch und nur wenige Raubtiere Jagd auf sie machten, vermehrten<br />
sie sich rasch. Heute gibt es 5.000 Hirsche in dem Park, und alle stammen<br />
von den ersten 13 Tieren ab, oder von anderen, die aus der Umgebung dazustießen.<br />
Der Park ist reich an wildlebenden Tieren, wenn man bedenkt, wie bescheiden<br />
die Ausmaße sind und daß eigentlich kein richtiges Hinterland zur Verfügung<br />
steht. Rotluchse, Bären, Rot- und Graufüchse, Biber, Stinktiere,<br />
Waschbären, Flughörnchen und unsere Freunde, die Salamander, gibt es in<br />
großer Zahl, auch wenn man die Tiere nicht häufig zu Gesicht bekommt, da<br />
die meisten nachtaktiv oder menschenscheu sind. Shenandoah hat angeblich<br />
die größte Dichte an Schwarzbären auf der ganzen Welt – ein Bär auf etwa<br />
zweieinhalb Quadratkilometer. Es sollen auch Berglöwen gesichtet worden<br />
sein, darüber liegen Berichte vor, unter anderem von Parkrangern, die es<br />
eigentlich besser wissen müßten – denn den Berglöwen gibt es in den Wäldern<br />
im Osten der Vereinigten Staaten nachweislich seit über 70 Jahren<br />
nicht mehr. Es gibt sie höchstens noch in einigen Restgebieten der Wälder<br />
im hohen Norden – aber dazu später (Sie müssen sich noch etwas gedulden,<br />
doch ich denke, es lohnt sich) –, aber nicht in einem so schmalen und eingeengten<br />
Gebiet wie dem Shenandoah National Park.<br />
Wir bekamen nichts Exotisches zu Gesicht, nicht im entferntesten, aber es<br />
war ganz hübsch, auch mal ganz normale Eichhörnchen und Rehe zu sehen,<br />
das Gefühl zu haben, daß der Wald belebt ist. Am späten Nach<strong>mit</strong>tag kam<br />
ich an eine Kurve, hinter der ich einen Truthahn <strong>mit</strong> seinen Küken entdeckte,<br />
die vor mir den Pfad kreuzten. Die Mutter war prächtig und unerschütterlich,<br />
ihre Küken stolperten unentwegt und kamen wieder auf die Beinchen<br />
und waren viel zu sehr <strong>mit</strong> sich selbst beschäftigt, um mich zu bemerken.<br />
So sollte es in einem Wald zugehen. Meine Freude hätte nicht größer sein<br />
können.<br />
Wir wanderten bis fünf Uhr und campierten neben einem Bächlein auf einer<br />
kleinen, grasbewachsenen Lichtung zwischen Bäumen direkt neben dem<br />
Weg. Da es unser erster Tag nach der Pause war, hatten wir reichlich Vorrat,<br />
einschließlich verderblicher Ware wie Käse und Brot, die verspeist<br />
werden mußte, bevor sie schlecht oder in unseren Rucksäcken zu Krümeln<br />
zermalmt wurde. Wir schlemmten regelrecht, legten uns anschließend ins<br />
Gras, rauchten und plauderten, bis die vielen penetranten mückenartigen<br />
Tierchen – die unter AT-Wanderern allgemein nur die Unsichtbaren genannt<br />
werden, denn »man sieht sie nicht, man hört sie nur« – uns in die<br />
Zelte trieben. Es war bestes Wetter zum Schlafen, so kalt, daß man einen
Schlafsack brauchte, aber warm genug, um in Unterwäsche zu schlafen. Ich<br />
hoffte auf eine lange, ausgiebige Nachtruhe und erfreute mich auch derselben,<br />
bis zu irgendeiner finsteren Stunde ein Geräusch in un<strong>mit</strong>telbarer Nähe<br />
zu hören war. Ich riß die Augen auf. Normalerweise kann mich nichts wekken,<br />
weder Donner noch Katz’ Schnarchen oder sein geräuschvolles <strong>mit</strong>ternächtliches<br />
Wasserlassen. Etwas so Lautes und Besonderes, daß ich davon<br />
aufwachte, mußte etwas höchst Ungewöhnliches sein. Man hörte, wie im<br />
Unterholz gewühlt wurde, das Knacken von Zweigen, offenbar ein schweres<br />
tapsiges Wesen, das sich durchs Laub schob, und dann ein lautes, leicht<br />
nervöses Schnüffeln.<br />
Ein Bär!<br />
Ich richtete mich kerzengerade auf. Jedes Neuron in meinem Gehirn war<br />
sofort hellwach und entfaltete hektische Betriebsamkeit, wie Ameisen,<br />
wenn man unversehens auf ihren Bau tritt. Ich wollte instinktiv nach meinem<br />
Messer greifen, aber dann fiel mir ein, daß ich es in meinem Rucksack<br />
gelassen hatte – draußen vor dem Zelt. An nächtliche Verteidigung hatten<br />
wir nach so vielen aufeinanderfolgenden Nächten beschaulicher Ruhe keinen<br />
Gedanken mehr verschwendet. Wieder hörte ich ein Geräusch, diesmal<br />
ganz nahe.<br />
»Stephen? Bist du wach?« flüsterte ich.<br />
»Ja«, antwortete er <strong>mit</strong> müder, unaufgeregter Stimme.<br />
»Was war das gerade?«<br />
»Woher soll ich das wissen?«<br />
»Hörte sich nach einem großen Tier an.«<br />
»Im Wald hört sich alles nach großen Tieren an.«<br />
Das stimmte. Einmal war ein Stinktier durch unser Nachtlager spaziert, und<br />
es hatte sich angehört wie ein Dinosaurier. Wieder war ein lautes Rascheln<br />
zu vernehmen, und dann ein schlabberndes Geräusch vom Bach her. Es<br />
trank Wasser, das unbekannte Wesen.<br />
Ich rutschte auf Knien zum Zelteingang, öffnete vorsichtig den Reißverschluß<br />
und steckte den Kopf hinaus. Es war pechschwarze Nacht. So leise<br />
ich konnte, holte ich meinen Rucksack ins Zelt und suchte im Schein der<br />
Taschenlampe nach meinem Messer. Als ich es gefunden und die Klinge<br />
aufgeklappt hatte, war ich entsetzt. Das Messer war viel zu klein, einfach<br />
lächerlich. Es war ein solides Besteckmesser, bestens geeignet, um Butter<br />
auf einen Pfannkuchen zu streichen, aber völlig ungeeignet, um einen wütenden<br />
Pelz von mehreren Zentnern Lebendgewicht abzuwehren. Vorsichtig<br />
kroch ich aus dem Zelt und schaltete die Taschenlampe ein, die ein erbärmliches<br />
Licht warf. Das Wesen in vier bis fünf Meter Entfernung schaute zu<br />
mir auf. Ich konnte nichts erkennen, weder Umriß noch Größe, nur zwei<br />
leuchtende Augen. Es blieb still stehen und erwiderte meinen starren Blick.
»Stephen«, flüsterte ich, »hast du ein Messer eingepackt?«<br />
»Nein.«<br />
»Hast du irgendwas Scharfes dabei?«<br />
Er überlegte einen Moment. »Meine Nagelschere.«<br />
Ich war verzweifelt. »Nichts Gefährlicheres? Hier draußen ist nämlich wirklich<br />
irgendwas.«<br />
»Wahrscheinlich bloß ein Stinktier.«<br />
»Dann muß es aber ein Riesenstinktier sein. Die Augen sind einen Meter<br />
vom Boden entfernt.«<br />
»Dann eben ein Reh.«<br />
Ich warf dem Tier einen Zweig hin, aber es rührte sich nicht. Ein Reh wäre<br />
aufgeschreckt und davongelaufen. Das Wesen klimperte einmal <strong>mit</strong> den<br />
Augen und starrte mich weiter an.<br />
Ich machte Meldung an Katz.<br />
»Vielleicht ein Rehbock. Die sind nicht ganz so zahm. Schimpf doch mal<br />
<strong>mit</strong> ihm.«<br />
Ich schimpfte <strong>mit</strong> zittriger Stimme. »He! Du da! Hau ab!« Das Geschöpf<br />
klimperte wieder <strong>mit</strong> den Augen, seltsam ungerührt. »Schimpf du mal«,<br />
sagte ich zu Katz.<br />
»He, du blödes Vieh, geh weg. Los, geh!« i<strong>mit</strong>ierte Katz meine Stimme.<br />
»Hinweg, du scheußliche Kreatur!« Er war gnadenlos.<br />
»Blödmann«, sagte ich und trug mein Zelt neben seins. Ich wußte selbst<br />
nicht, was ich da<strong>mit</strong> bezweckte, aber es beruhigte mich ein klein wenig, ihm<br />
ein Stück näher zu sein.<br />
»Was machst du da?«<br />
»Ich verrücke mein Zelt.«<br />
»Großartige Idee. Das macht das arme Tierchen bestimmt ganz konfus.«<br />
Ich schaute angestrengt in die Finsternis, aber ich konnte auch auf die kurze<br />
Entfernung nichts erkennen außer zwei weit aufgerissenen Augen, wie in<br />
einem Comic. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich lieber draußen<br />
bleiben wollte, um gleich zu sterben, oder lieber drinnen, um aufs Sterben<br />
zu warten. Eigentlich wollte ich nur, daß das Tier abhaute. Ich hob einen<br />
kleinen Stein auf und warf ihn nach dem Tier. Ich glaube, ich habe es sogar<br />
getroffen, denn es setzte lautstark zu einem Sprung an – was mich zu Tode<br />
erschreckte und mir ein Wimmern entlockte – und gab dann ein Geräusch<br />
von sich, kein richtiges Knurren, aber fast. Vielleicht sollte ich es lieber<br />
nicht provozieren.<br />
»Was machst du da, <strong>Bryson</strong>? Laß das Tier in Ruhe, dann haut es von alleine<br />
ab.«<br />
»Wie kannst du bloß so ruhig sein?«<br />
»Was soll ich denn machen? Es reicht doch, wenn einer von uns beiden den
Hysterischen spielt.«<br />
»Entschuldige bitte, aber ich habe allen Grund, beunruhigt zu sein. Ich stehe<br />
hier <strong>mit</strong>ten im dunklen Wald, Auge in Auge <strong>mit</strong> einem Bär, am Ende der<br />
Welt, zusammen <strong>mit</strong> einem Kerl, der nichts anderes zur Verteidigung dabei<br />
hat als eine Nagelschere. Sag mir eins, Katz: Wenn das hier ein Bär ist, und<br />
er geht auf dich los, was willst du dann machen – ihm die Fußnägel schneiden?«<br />
»Ich laß’ die Dinge auf mich zukommen«, sagte Katz unerschütterlich.<br />
»Du willst das Ding hier auf dich zukommen lassen? Das Ding ist ein Bär,<br />
und es kommt nicht erst noch, es ist längst da, verfluchte Kacke. Es sieht<br />
uns an. Es riecht die Nudeln und die Snickers – ach, du schöne Scheiße!«<br />
»Was ist?«<br />
»Scheiße!«<br />
»Was ist?«<br />
»Es sind zwei. Ich kann ein zweites Augenpaar erkennen.« In dem Moment<br />
machte die Batterie der Taschenlampe schlapp. Das Licht flackerte, dann<br />
verlosch es ganz. Ich eilte in mein Zelt, stach mir dabei vor Aufregung in<br />
den Oberschenkel und begann eine hektische Suche nach Ersatzbatterien.<br />
Als Bär hätte ich mich genau jetzt, in diesem günstigen Moment auf meine<br />
Beute gestürzt.<br />
»Ich leg’ mich wieder schlafen«, verkündete Katz.<br />
»Was redest du da? Du kannst doch jetzt nicht einfach schlafen.«<br />
»Und ob ich das kann. Ich hab’s oft genug getan.« Ich hörte, wie er auf die<br />
Seite rollte und dann eine Folge von Schnief- und Schnüffelgeräuschen von<br />
sich gab, ähnlich denen der Kreatur draußen am Bach.<br />
»Stephen, du kannst jetzt nicht einschlafen«, verlangte ich von ihm. Aber er<br />
konnte es sehr wohl, und zwar erstaunlich schnell.<br />
Das Tier – die Tiere – schlabberten munter weiter. Ich konnte keine Ersatzbatterien<br />
finden, warf die Taschenlampe hin und setzte die Stirnlampe auf,<br />
probierte, ob sie auch funktionierte, und schaltete sie wieder aus, um die<br />
Batterie zu schonen. Danach blieb ich stundenlang auf meinen Knien hokken,<br />
den Zelteingang fest im Visier, lauschte angestrengt, hielt in der einen<br />
Hand meinen Wanderstab wie einen Baseballschläger umklammert, bereit,<br />
bei einem Angriff zurückzuschlagen, in der anderen, als Verteidigung von<br />
der Flanke her, das geöffnete Klappmesser. Die Bären, die Tiere, was auch<br />
immer, tranken noch etwa 20 Minuten lang und verließen dann leise die<br />
Lichtung in der Richtung, aus der sie gekommen waren. Es war ein Augenblick<br />
der Freude, aber ich wußte aus meiner Lektüre einschlägiger Literatur,<br />
daß sie aller Wahrscheinlichkeit nach zurückkommen würden. Ich lauschte<br />
und lauschte, aber Stille senkte sich über den Wald, und es blieb ruhig.<br />
Schließlich ließ ich meinen Wanderstab los und zog mir einen Pullover
über, dabei hielt ich zweimal inne, um noch die winzigsten Geräusche zu<br />
identifizieren, fürchtete den Lärm, der einen zweiten Besuch ankündigte,<br />
und kroch nach sehr langer Zeit wieder in meinen Schlafsack, weil mir kalt<br />
wurde. Ich blieb lange wach liegen, starrte in die völlige Finsternis und<br />
wußte, daß ich nie wieder unbeschwert in einem Wald würde schlafen können.<br />
Dann schlief ich unweigerlich allmählich doch ein.
12. Kapitel<br />
Ich hatte erwartet, daß Katz am nächsten Morgen unerträglich sein würde,<br />
aber er war erstaunlich gnädig <strong>mit</strong> mir. Er weckte mich <strong>mit</strong> Kaffee, und als<br />
ich aus meinem Zelt hervorkroch, wie gerädert und um den Schlaf gebracht,<br />
sagte er zu mir: »Ist irgendwas? Du siehst schlimm aus.«<br />
»Ich habe nicht genug geschlafen.«<br />
Er nickte. »Glaubst du wirklich, daß es ein Bär war?«<br />
»Was weiß ich.« Plötzlich fiel mir der Vorratsbeutel ein – auf den gehen<br />
Bären normalerweise zuerst los – und ich wandte den Kopf zur Seite, um<br />
nachzusehen, aber er hing immer noch sicher ein paar Meter über dem Boden<br />
an einem Ast, ungefähr 15 Meter von unseren Zelten entfernt. Ein zu<br />
allem entschlossener Bär hätte ihn da bestimmt heruntergeholt. Eigentlich<br />
hätte ihn jedes Kind herunterholen können. »Vielleicht doch nicht«, sagte<br />
ich enttäuscht.<br />
»Weißt du, was hier drin ist? Für alle Fälle«, sagte Katz und klopfte vielsagend<br />
auf seine Brusttasche. »Meine Nagelschere. Man weiß ja nie. Gefahren<br />
lauern überall. Eins kann ich dir flüstern, mein Freund, aus Schaden<br />
wird man klug. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.« Dann lachte er<br />
schallend.<br />
Danach ging es wieder in den Wald. Der Appalachian Trail verläuft auf fast<br />
der gesamten Länge des Shenandoah National Park parallel zum Skyline<br />
Drive und kreuzt diesen sogar häufig, obwohl man das als Wanderer meistens<br />
kaum merkt. Es kann passieren, daß man durch die heiligen Säulenhallen<br />
des Waldes streift, und plötzlich gleitet ein paar Meter vor einem ein<br />
Auto zwischen den Bäumen hindurch – ein immer wieder irritierender Anblick.<br />
Anfang der 30er Jahre wurde der Potomac Appalachian Trail Club – Myron<br />
Averys Lieblingskind und zeitweilig von der Appalachian Trail Conference<br />
nicht zu unterscheiden – von anderen Wandervereinen scharf angegriffen,<br />
besonders von dem elitären Appalachian Mountain Club in Boston, er habe<br />
sich dem Bau der Skyline Drive durch den Park nicht widersetzt. Avery<br />
fühlte sich von dieser Rüge schwer getroffen und schrieb im Dezember<br />
1935 einen beleidigenden Brief an MacKaye, der dessen Beziehung zum<br />
Trail Club, die ohnehin nur noch recht oberflächlich war, offiziell ein Ende<br />
setzte. Die beiden Männer haben nie wieder ein Wort <strong>mit</strong>einander gesprochen,<br />
dennoch zollte MacKaye ihm bei seinem Tod im Dezember 1952 die<br />
gebührende Anerkennung und bemerkte, ohne Avery wäre der Trail wohl<br />
nie gebaut worden. Viele Menschen mögen den Skyline Drive nicht, aber<br />
Katz und ich konnten ihm durchaus etwas abgewinnen. Häufig verließen
wir den Trail und gingen für ein, zwei Stunden auf dem Highway weiter.<br />
Jetzt, in der Vorsaison, Anfang April, fuhren kaum Autos durch den Park,<br />
und wir nutzten den Skyline Drive einfach als breiten, bequemen, asphaltierten<br />
Nebenwanderweg. Es war ein ganz neues Gefühl, zur Abwechslung<br />
festen Boden unter den Füßen zu haben, und äußerst angenehm, nach wochenlangem<br />
Marschieren durch undurchdringlichen Wald draußen im Freien<br />
zu sein, in der Sonne. Autofahrer führen wirklich ein verwöhnteres,<br />
sorgenfreieres Leben als wir Wanderer. Es gab an der Straße viele eigens<br />
angelegte Aussichtspunkte, die einen herrlichen Ausblick boten – obwohl<br />
auch jetzt, bei klarem Frühlingswetter, alles, was weiter als neun bis zehn<br />
Kilometer weg war, unter einer staubigen Dunstdecke lag. Diese Plätze waren<br />
<strong>mit</strong> Informationstafeln, die nützliche Hinweise über Flora und Fauna<br />
des Parks enthielten, und sogar <strong>mit</strong> Mülleimern ausgestattet. So was hätten<br />
wir auf dem Trail auch ganz gut gebrauchen können, fanden wir. Wenn die<br />
Sonne zu heiß wurde oder die Füße schmerzten – Asphalt ist eigentlich eine<br />
Tortur für die Füße – oder wenn wir eine Abwechslung benötigten, kehrten<br />
wir wieder in den vertrauten, kühlen, heimeligen Wald zurück. Es war sehr<br />
angenehm, geradezu luxuriös, zwischen beiden Möglichkeiten wählen zu<br />
können.<br />
An einem der Rastplätze am Skyline Drive hing eine Informationstafel, die<br />
den Besucher auf einen Hang in der Nähe aufmerksam machte, der über und<br />
über <strong>mit</strong> Schierling bewachsen war, einer sehr dunklen, fast schwarzen<br />
Konifere, die typisch für die Blue Ridge Mountains ist. Dieser Schierling,<br />
überhaupt aller Schierling, der am Trau und im Wald zu beiden Seiten<br />
wächst, ist von einer Blattlaus befallen, die 1924 aus Asien eingeschleppt<br />
wurde, und stirbt ab. Der National Park Service, lautete die traurige Feststellung<br />
auf der Informationstafel, könne sich eine Behandlung der Bäume<br />
nicht leisten. Es gäbe zu viele, das Gebiet sei zu weitläufig, eine Schädlingsbekämpfung<br />
<strong>mit</strong> Flugzeugen erscheine daher nicht praktikabel. Ich<br />
habe dazu einen Vorschlag: Warum behandelt man nicht wenigstens ein<br />
paar Bäume? Wenigstens einen einzigen? Es wäre ein Anfang. Die gute<br />
Nachricht sei, laut Informationstafel, daß der National Park Service die<br />
Hoffnung hege, daß sich einige Bäume in Laufe der Zeit auf natürlichem<br />
Weg erholen werden. Was sagt man dazu?<br />
Vor 60 Jahren gab es fast überhaupt keine Bäume in den Blue Ridge Mountains.<br />
Das war alles Ackerland. Der Weg durch den Wald führte jetzt des<br />
öfteren an den Überresten alter Steinwälle entlang, und einmal kamen wir<br />
an einem kleinen abgelegenen Friedhof vorbei, eine Erinnerung daran, daß<br />
dies eine der wenigen Bergregionen in den gesamten Appalachen ist, wo<br />
tatsächlich einmal Menschen gelebt haben – ihr Pech, daß es leider die<br />
falschen Leute waren. In den 20er Jahren strömten Soziologen und andere
Wissenschaftler aus den Städten in die Berge und waren entsetzt über das,<br />
was sie dort vorfanden. Armut und Entbehrungen waren allgegenwärtig.<br />
Der Boden war äußerst karg. Viele Bauern bewirtschafteten Steilhänge, die<br />
fast senkrecht waren. Dreiviertel der Bergbewohner konnten nicht lesen.<br />
Die meisten waren kaum je zur Schule gegangen. 90 Prozent der Kinder<br />
waren unehelich. Hygiene war ein Fremdwort, nur zehn Prozent der Haushalte<br />
verfügten über einen pri<strong>mit</strong>iven Außenabort.<br />
Hinzu kam, daß die Blue Ridge Mountains von sensationeller Schönheit<br />
waren und für eine neue Klasse motorisierter Touristen bequem erreichbar.<br />
Die naheliegende Lösung war, die Menschen aus den Bergregionen in die<br />
Täler umzusiedeln, wo sie ruhig weiter arm bleiben durften, und oben eine<br />
malerische Straße zu bauen, auf der man sonntags spazierenfahren konnte,<br />
und das Ganze in einen Gipfelrummel zu verwandeln, <strong>mit</strong> kommerziell<br />
betriebenen Campingplätzen, <strong>mit</strong> Restaurants, Eisdielen, Minigolf und<br />
wo<strong>mit</strong> sonst noch leicht Geld zu verdienen war.<br />
Die Geschäftsleute hatten aber ebenfalls Pech, denn die Wirtschaftskrise<br />
setzte ein, und die kommerziellen Interessen traten in den Hintergrund. Statt<br />
dessen rückte unter der Präsidentschaft von Frankhn Roosevelt ein konfuser<br />
sozialistischer Gedanke in den Vordergrund, und der Staat kaufte das Land.<br />
Die verbliebenen Bewohner wurden evakuiert, und das Civilian Conservation<br />
Corps machte sich an den Bau hübscher Steinbrücken, <strong>Picknick</strong>areale,<br />
Besucherzentren und diverser anderer Einrichtungen. Alles zusammen wurde<br />
im Juli 1936 der Öffentlichkeit übergeben. Es ist im wesentlichen die<br />
handwerkliche Qualität, die den Ruhm des Shenandoah National Park begründet.<br />
Der Park ist ein Meisterwerk gemeinsamer menschlicher Anstrengung,<br />
eines der wenigen Beispiele für großangelegte Bauprojekte – der<br />
Hoover-Damm ist ein weiteres Beispiel, und Mount Rushmore, würde ich<br />
sagen, ein drittes –, die sich in die natürliche Landschaft einfügen, sie eigentlich<br />
erst richtig zur Geltung bringen. Ich glaube, das ist einer der Gründe,<br />
warum ich so gern den Skylme Drive entlangging, <strong>mit</strong> seinen breiten<br />
Grasstreifen und den Befestigungsmauern aus Stein, den kunstvoll angelegten<br />
Birkenhainen und den sanft geschwungenen Kurven, die zu atemberaubenden,<br />
klug in Szene gesetzten Panoramablicken führen. In dem Stil<br />
sollten alle Highways sein, und eine Zeitlang sah es auch tatsächlich danach<br />
aus. Es ist kein Zufall, daß die ersten Highways in Amerika Parkways hießen.<br />
Als solche waren sie konzipiert – Parkanlagen, durch die man hindurchfahren<br />
konnte.<br />
Von dieser handwerklichen Tradition ist auf dem Appalachian Trau im Park<br />
nichts zu spüren – vielleicht wäre das für einen Wanderweg, der sich der<br />
Wildnis verschrieben hat, auch zuviel verlangt –, aber man begegnet ihr<br />
angenehmerweise in den Schutzhütten, die etwas von dem charmanten
ustikalen Charakter der Hütten in den Smokies haben, aber luftiger, sauberer<br />
und praktischer sind und nicht diese gräßlichen Maschendrahtzäune an<br />
der Vorderseite haben.<br />
Katz fand es lächerlich, aber ich bestand darauf, daß wir nach unserer Nacht<br />
an dem Bach nur noch in Schutzhütten schliefen - ich bildete mir ein, eine<br />
Hütte ließe sich gegen marodierende Bären besser verteidigen –, und außerdem<br />
sind die Hütten im Shenandoah Park viel zu schön, um sie links liegen<br />
zu lassen. Jede Hütte hatte ihren eigenen Reiz, war an einem sorgfältig<br />
ausgewählten Standort errichtet worden, verfügte über eine Wasserquelle in<br />
der Nähe, <strong>Picknick</strong>tische und ein Außenklo. Zwei Abende hintereinander<br />
hatten wir jeweils eine Hütte für uns allein gehabt, und am dritten Abend<br />
sah es wieder danach aus. Gerade wollten wir uns zu dieser erstaunlichen<br />
Glückssträhne gratulieren, als eine Kakophonie von Stimmen aus dem Wald<br />
erscholl. Wir sahen um die Ecke und entdeckten eine Gruppe Pfadfinder,<br />
die auf die Lichtung zumarschierten. Sie begrüßten uns, wir grüßten zurück,<br />
dann setzten wir uns auf das Schlafpodest, ließen die Füße baumeln und<br />
beobachteten die Jungen dabei, wie sie die Lichtung <strong>mit</strong> ihren Zelten und<br />
ihrer Ausrüstung in Beschlag nahmen und freuten uns darüber, daß wir mal<br />
etwas anderes zu sehen bekamen als immer nur uns selbst. Es waren drei<br />
erwachsene Aufseher und 17 Pfadfinder, alle <strong>mit</strong> jeweils zwei linken Händen.<br />
Zelte wurden aufgebaut und brachen sofort wieder in sich zusammen<br />
oder neigten sich zur Seite. Einer der Erwachsenen ging Wasser holen und<br />
fiel dabei in den Bach. Selbst Katz gab zu, das sei ja besser als Fernsehen.<br />
Zum ersten Mal seit unserem Aufbruch in New Hampshire fühlten wir uns<br />
wie die Herren des Trails.<br />
Ein paar Minuten später kam ein munterer Einzelwanderer an, John Connolly,<br />
Highschool-Lehrer im Norden des Bundesstaates New York. Er war seit<br />
vier Tagen unterwegs, anscheinend immer ein paar Kilometer hinter uns,<br />
und hatte jede Nacht allein im Freien kampiert, was ich jetzt als außerordentlich<br />
mutig empfand. Er hatte keine Bären gesehen – er ging den AT seit<br />
vier Jahren in Etappen und hatte nur ein einziges Mal einen Bären gesehen,<br />
tief in den Wäldern von Maine, nur kurz, nur von hinten und auf der Flucht.<br />
Nach John kamen noch zwei Männer unseren Alters, zwei sehr nette Kerle,<br />
zurückhaltend, aber lustig. Wir waren höchstens drei, vier Wanderern begegnet,<br />
seit wir in Waynesboro aufgebrochen waren, und jetzt auf einmal<br />
wurden wir förmlich überrannt.<br />
»Was für ein Tag ist heute?« fragte ich, und alle mußten innehalten und<br />
überlegen.<br />
»Freitag«, sagte jemand. »Ja, heute ist Freitag.« Das war die Erklärung –<br />
das Wochenende hatte begonnen.<br />
Wir setzten uns alle an den <strong>Picknick</strong>tisch, kochten und aßen. Es war richtig
gesellig. Die drei anderen waren schon viel gewandert und erzählten alles<br />
Wissenswerte über die Strecke, die noch vor uns lag, bis rauf nach Maine,<br />
das für uns immer noch in unerreichbarer Ferne lag. Dann wandte sich das<br />
Gespräch einem Thema zu, das sich bei Hikern anhaltender Beliebtheit<br />
erfreut - wie überlaufen der Trail doch sei. Connolly erzählte, daß er 1987,<br />
zur Hochsaison im Sommer, fast die Hälfte der Gesamtstrecke abgewandert<br />
und tagelang keinem Menschen begegnet sei, und Jini und Chuck pflichteten<br />
ihm bei.<br />
Diese Klage hört man immer wieder, und es trifft sicher zu, daß mehr Menschen<br />
das Wandern für sich entdeckt haben als je zuvor. Bis in die 70er<br />
Jahre hinein bewältigten keine 50 Personen die gesamte Strecke des AT an<br />
einem Stück, und bis 1984 war die Zahl auf gerade mal 100 gestiegen. 1990<br />
war sie auf über 200 geklettert, und heute nähert sie sich der 300er-Marke.<br />
Das sind enorme Steigerungen, aber es bleibt doch insgesamt eine kleine<br />
Zahl. Un<strong>mit</strong>telbar vor unserem Aufbruch war in meiner Lokalzeitung in<br />
New Hampshire ein Interview <strong>mit</strong> einem Mitarbeiter des Wartungspersonals<br />
für den AT erschienen, einem Trail-Pfleger, wie sie sich nennen. Der berichtete,<br />
die drei Lagerplätze in seinem Abschnitt seien vor 20 Jahren in den<br />
Monaten Juli und August wöchentlich von etwa einem Dutzend Besucher<br />
frequentiert worden, heute seien es bis zu 100 Personen in der Woche. Ich<br />
finde daran viel erstaunlicher, daß über so lange Zeit nur so wenig Leute<br />
gekommen sind. Wie dem auch sei, 100 Gäste pro Woche in der Hochsaison,<br />
verteilt auf drei Lagerplätze, erscheint mir nicht überwältigend viel.<br />
Vielleicht sehe ich das aus der falschen Perspektive, weil ich über Jahre<br />
immer nur auf dem für amerikanische Maßstäbe kleinen, überfüllten Inselchen<br />
England gewandert bin, aber was mich in dem Sommer unserer langen<br />
Tour regelmäßig erstaunt hat, war die Tatsache, wie leer der Pfad eigentlich<br />
war. Keiner weiß genau, wie viele Menschen den Appalachian Trail benutzen,<br />
aber die meisten Schätzungen gehen von einer Zahl zwischen drei und<br />
vier Millionen pro Jahr aus. Nehmen wir an, vier Millionen trifft zu, und<br />
nehmen wir weiter an, daß die meisten Wanderer in den sechs wärmsten<br />
Monaten unterwegs sind, dann kommen wir auf durchschnittlich 16.500<br />
Personen, die täglich unterwegs sind. Das macht 4,6 Personen auf einen<br />
Kilometer, also etwa einen Menschen alle 220 Meter. Tatsächlich erreichen<br />
nur wenige Abschnitte eine so hohe Dichte. Ein großer Teil der jährlich vier<br />
Millionen Wanderer konzentriert sich für einen Tag oder eine Woche auf<br />
bestimmte beliebte Abschnitte – den Presidential Range in New Hampshire,<br />
den Baxter State Park in Maine, Mount Greylock in Massachusetts, die<br />
Smokies und den Shenandoah National Park. Zu diesen vier Millionen gehören<br />
auch die sogenannten Reebok-Hiker, die zu Tausenden einfallen. Sie<br />
kommen <strong>mit</strong> dem Auto vorgefahren, gehen ein paar hundert Meter, setzen
sich wieder in ihr Auto und lassen sich nie wieder zu so etwas atemberaubend<br />
Gefährlichem hinreißen. Egal, was die Leute sagen, der Appalachian<br />
Trail ist nicht überlaufen, glauben Sie mir.<br />
Wenn die Leute darüber schimpfen, der Trail sei überfüllt, dann meinen sie<br />
in Wahrheit, die Hütten seien überfüllt, und da muß ich ihnen recht geben.<br />
Das Problem besteht jedoch nicht dann, daß es zu viele Wanderer gibt,<br />
gemessen an der Zahl der Hütten, sondern zu wenig Hütten, gemessen an<br />
der Zahl der Wanderer. Der Shenandoah National Park verfügt nur über<br />
acht Hütten – von denen jede nicht mehr als acht Personen aufnehmen kann,<br />
höchstens zehn –, und das auf 162 Kilometern Wanderweg. Das entspricht<br />
ungefähr dem Durchschnitt für den gesamten Appalachian Trail. Obwohl<br />
die Entfernungen zwischen den einzelnen Hütten sehr stark variieren können,<br />
befindet sich im Schnitt alle 16 Kilometer eine Schutzhütte, ein Blockhaus<br />
oder ein Unterstand. Das bedeutet, es existieren auf 3.540 Kilometer<br />
Wanderweg nur 2.500 angemessene Schlafgelegenheiten. Wenn man bedenkt,<br />
daß im Umkreis einer Tagesreise vom Appalachian Trail 100 Millionen<br />
Menschen leben, dann kann es kaum überraschen, daß 2.500 Schlafplätze<br />
manchmal nicht ausreichen. Es klingt widersinnig, aber trotzdem<br />
wächst der Druck, die Anzahl der Schutzhütten in manchen Abschnitten zu<br />
reduzieren, um das zu vermeiden, was als Überfrequentierung des Trails<br />
verstanden wird – meiner Meinung nach ist das völlig unverständlich.<br />
Wie immer, wenn sich das Gespräch um die Überfüllung des Trail drehte<br />
und den Umstand, daß man jetzt manchmal an einem einzigen Tag ein Dutzend<br />
Leute trifft, wo man früher, wenn man Glück hatte, nur zwei Menschen<br />
begegnet ist, hörte ich höflich zu und sagte dann: »Ihr solltet erstmal<br />
in England wandern.«<br />
Jim sagte daraufhin freundlich und geduldig zu mir: »Aber wir sind nun mal<br />
nicht in England, <strong>Bill</strong>.« Da konnte er recht haben.<br />
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich den Shenandoah National<br />
Park besonders mag und warum ich wahrscheinlich nicht aus dem gleichen<br />
Holz geschnitzt bin wie ein richtiger amerikanischer Hiker: Cheeseburger.<br />
Man kann sich im Shenandoah National Park regelmäßig <strong>mit</strong> Cheeseburgern,<br />
eisgekühlter Cola, Pommes, Eis und jeder Menge anderem Zeug versorgen.<br />
Obwohl die zügellose Kommerzialisierung, von der ich eben sprach,<br />
ausgeblieben ist – zum Glück natürlich –, hat sich dieser esprit de commerce<br />
in Shenandoah teilweise gehalten. Der Park ist geradezu übersät <strong>mit</strong><br />
öffentlichen Camping- und Rastplätzen, an denen sich Restaurants und<br />
Geschäfte befinden – und der AT führt Gott sei Dank an fast allen vorbei.<br />
Es steht ganz und gar im Widerspruch zur Idee des Appalachian Trail, unterwegs<br />
Pausen in Restaurants einzulegen, aber ich kenne keinen Wanderer,
der nicht ab und zu trotzdem gerne dort eingekehrt wäre.<br />
Katz, Connolly und ich machten gleich am Tag darauf unsere erste Erfahrung<br />
da<strong>mit</strong>, nachdem wir uns von Jim und Chuck und den Pfadfindern verabschiedet<br />
hatten, die alle Richtung Süden weiterzogen, und wir gegen<br />
Mittag einen gut besuchten »Rummelplatz« namens Big Meadows erreichten.<br />
Big Meadows verfügt über einen Campingplatz, eine Hütte, ein Restaurant<br />
und einen Souvenir- und Gemischtwarenladen. Unmengen von Menschen<br />
lümmelten sich auf einem großen, sonnigen Rasen. (Big Meadows bedeutet<br />
eigentlich große Wiese; tatsächlich rührt die Bezeichnung aber von einem<br />
Mann namens Meadows her, was mir außerordentlich gut gefiel.) Wir stellten<br />
unsere Rucksäcke auf dem Rasen ab und eilten in das volle Restaurant,<br />
wo wir uns gierig über die besonders fettigen Speisen hermachten, dann<br />
begaben wir uns wieder nach draußen, ließen uns auf dem Rasen nieder,<br />
rauchten, rülpsten und gaben uns dem stillen Akt der Verdauung hin. Während<br />
wir so dalagen, gegen die Rucksäcke gelehnt, näherte sich uns ein<br />
Tourist <strong>mit</strong> einem albernen Strohhütchen auf dem Kopf, die Eistüte fest<br />
umklammert, und musterte uns freundlich. »Sie sind wohl Wanderer, was?«<br />
sagte er.<br />
Wir bejahten.<br />
»Tragen Sie die Rucksäcke die ganze Zeit?«<br />
»Bis wir jemanden gefunden haben, der sie für uns trägt«, sagte Katz vergnügt.<br />
»Welche Entfernung haben Sie heute morgen schon zurückgelegt?«<br />
»Ungefähr 13 Kilometer.«<br />
»13 Kilometer! Meine Güte. Und wie weit wollen Sie heute nach<strong>mit</strong>tag<br />
noch kommen?«<br />
»Noch mal 13 Kilometer.«<br />
»Im Ernst? 26 Kilometer zu Fuß? Mit den Dingern auf dem Rücken? Mann,<br />
o Mann – ist ja irre.« Er rief quer über den Platz. »Komm mal her, Bernice!<br />
Das mußt du dir ansehen.« Er betrachtete uns wieder. »Was haben Sie denn<br />
alles da drin? Kleider und so Zeug, nehme ich an.«<br />
»Und Proviant«, sagte Connolly<br />
»So so, Sie haben Ihren eigenen Proviant dabei.«<br />
»Da kommt man nicht drumherum.«<br />
»Ist ja irre.«<br />
Bernice kam, und er erklärte ihr, daß wir doch tatsächlich die eigenen Beine<br />
benutzten, um uns durchs Gelände zu bewegen. »Ist das nicht toll? Proviant<br />
und alles, was sie sonst noch brauchen, ist in den Rucksäcken.«<br />
»Wirklich?« fragte Bernice voller Bewunderung. »Dann gehen Sie also die<br />
ganze Zeit zu Fuß?« Wir nickten. »Sind Sie zu Fuß hierhergekommen? Den
ganzen Weg?«<br />
»Wir gehen überall zu Fuß hin«, sagte Katz ernst.<br />
»Sie sind doch nicht den ganzen Weg zu Fuß hier raufgegangen!«<br />
»Doch«, sagte Katz, den dieser Moment <strong>mit</strong> größtem Stolz erfüllte.<br />
Ich begab mich auf die Suche nach einem öffentlichen Telefon, um zu Hause<br />
anzurufen, danach ging ich aufs Klo. Als ich ein paar Minuten später<br />
wiederkam, hatte Katz eine kleine Gruppe neugieriger Zuschauer um sich<br />
geschart und demonstrierte den Gebrauch verschiedener Gurte und Steckverschlüsse.<br />
Dann setzte er auf besonderen Wunsch den Rucksack auf und<br />
ließ sich fotografieren. Ich hatte ihn noch nie so zufrieden erlebt.<br />
Während Katz noch <strong>mit</strong> seiner Vorführung beschäftigt war, gingen Connolly<br />
und ich los, um den Laden auf dem Rastplatz in Augenschein zu nehmen.<br />
Mir fiel auf, wie gering die richtigen Wanderer hier geschätzt werden, was<br />
für eine untergeordnete Rolle sie in dem ganzen kommerziellen Betrieb der<br />
Nationalparks spielen. Nur drei Prozent der jährlich zwei Millionen Besucher<br />
des Shenandoah gehen mehr als ein paar Schritte in das Hinterland,<br />
wie es vollmundig genannt wird. 90 Prozent der Besucher reisen <strong>mit</strong> dem<br />
Auto oder dem Wohnmobil an, und auf diese Klientel war der Laden zugeschnitten.<br />
Für fast alle Lebens<strong>mit</strong>tel benötigte man einen Mikrowellenherd<br />
oder Backofen zur Zubereitung, vieles mußte kühl gelagert werden oder<br />
wurde nur in großen Mengen angeboten. (Welcher Wanderer, der allein<br />
unterwegs ist, will schon 24 Hamburgerbrötchen auf einmal?) Es gab nichts<br />
von dem typischen Wanderproviant – Rosinen, Nüsse oder kleine, leicht zu<br />
transportierende Packungen und Konserven –, was ich für einen Laden in<br />
einem Nationalpark ziemlich enttäuschend finde.<br />
Da die Auswahl beschränkt war und wir auf keinen Fall schon wieder Nudeln<br />
essen wollten, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ (Connolly war,<br />
wie ich zu meiner Genugtuung feststellte, auch ein Nudelesser), kauften wir<br />
24 Hotdogs und die dazugehörigen Brötchen, eine Zwei-Liter-Flasche Cola<br />
und ein paar große Packungen Plätzchen. Danach holten wir Katz ab – der<br />
seinem Publikum <strong>mit</strong> Bedauern verkündete, er müsse jetzt los, die Berge<br />
warteten auf ihn – und stapften mutig zurück in den Wald.<br />
Abends machten wir Halt an einem beschaulichen, abgelegenen Platz, Rock<br />
Spring Hut, oberhalb eines steilen Abhangs, <strong>mit</strong> einem weiten Blick ins<br />
Shenandoah Valley. Die Schutzhütte hatte sogar eine Schaukel, einen Zweisitzer,<br />
der an Ketten von dem Vordach der Hütte hing und zum Gedenken<br />
an eine gewisse Theresa Affronti angebracht worden war, die eine besonders<br />
innige Beziehung zum Trail gehabt hatte, wie uns eine Plakette auf der<br />
Rückseite <strong>mit</strong>teilte. Frühere Besucher der Hütte hatten einen Vorrat an<br />
Konserven dagelassen, Bohnen, Mais, Büchsenfleisch, Karotten, die ordentlich<br />
auf einem Stützbalken aufgereiht waren. So etwas kommt durchaus
häufiger vor. Manchmal wandern AT-Begeisterte aus der Umgebung nur<br />
zur nächsten Hütte und bringen selbstgebackene Plätzchen, Sandwiches<br />
oder Brathühnchen <strong>mit</strong>. Eigentlich eine schöne Sitte.<br />
Wir kochten gerade unser Essen, als ein junger Mann ankam, der den Trail<br />
an einem Stück ging, von Norden nach Süden – der erste Weitwanderer, den<br />
wir in dieser Saison trafen. Er war an dem Tag 42 Kilometer gelaufen und<br />
war ganz aus dem Häuschen, als er erfuhr, daß Hotdogs auf dem Speiseplan<br />
standen. Katz, Connolly und ich hätten niemals sechs Stück heruntergekriegt,<br />
wir aßen pro Person nur vier, allerdings jede Menge Plätzchen zum<br />
Nachtisch, die übrigen hoben wir fürs Frühstück auf. Der junge Mann dagegen<br />
aß wie ein Scheunendrescher. Er vertilgte sechs Hotdogs, eine Dose<br />
Karotten, bediente sich großzügig bei den Oreo-Schokoladenplätzchen,<br />
zwölf Stück, eins nach dem anderen, und aß sie genüßlich und <strong>mit</strong> ausgiebigen<br />
Kaubewegungen auf. Er erzählte uns, er sei in Maine bei hohem Schnee<br />
losgegangen, sei unterwegs von Schneestürmen aufgehalten worden, liefe<br />
im Durchschnitt aber immer noch 40 Kilometer täglich. Er war nur knapp<br />
einssechzig groß, und sein Rucksack war ein Ungetüm. Kein Wunder, daß<br />
er so einen Mordshunger hatte. Er wollte versuchen, den Trail in drei Monaten<br />
zu schaffen, dazu nutzte er jede helle Stunde. Als wir am nächsten Morgen<br />
aufwachten, war die Dämmerung gerade erst angebrochen, aber unser<br />
Gast war bereits gegangen. An seiner Schlafstelle lag ein Zettel, auf dem er<br />
sich für das Essen bedankte und uns viel Glück wünschte. Wir wußten nicht<br />
einmal seinen Namen.<br />
Am späten Vor<strong>mit</strong>tag, als ich merkte, daß ich Connolly und Katz, die sich<br />
unterhielten und reichlich trödelten, ein gutes Stück hinter mir gelassen<br />
hatte, blieb ich in einer Schneise stehen und wartete auf sie. Die Schneise<br />
war breit und wirkte anmutig, wie aus grauer Vorzeit, eingebettet zwischen<br />
steilen Hügeln, die dem Ort einen verzauberten, geheimnisvollen Charakter<br />
verliehen. Es war alles da, was man von einer Waldszene erwarten konnte -<br />
hohe, stattliche Bäume, hier und da Balken aus schräg einfallendem Sonnenlicht,<br />
in dem die Staubkörnchen tanzten, ein mäandernder Bach, Teppiche<br />
aus prallem Farnkraut, und durch das stille Grün wehte beständig kühle<br />
Luft. Ich weiß noch, daß ich dachte, was für ein ungewöhnlich schöner<br />
Lagerplatz dies wäre.<br />
Ungefähr einen Monat später hatten zwei junge Frauen, Lollie Winans und<br />
Julianne Williams, offenbar den gleichen Gedanken. Sie schlugen ihre Zelte<br />
in dieser verschwiegenen Lichtung auf und wanderten die kurze Strecke<br />
durch den Wald zur Skyland Lodge – noch so ein Touristenzentrum –, um<br />
in dem Restaurant dort zu essen. Niemand weiß genau, was dann geschah,<br />
aber vermutlich hat sie jemand in Skyland beobachtet und ist ihnen zu ihrem<br />
Lager gefolgt. Drei Tage später fand man die beiden, an den Händen
gefesselt und <strong>mit</strong> durchgeschnittenen Kehlen. Es gab kein eindeutiges Motiv.<br />
Es gab auch nie einen Verdächtigen. Ihr Tod wird für immer ein Rätsel<br />
bleiben. Natürlich hatte ich damals keine Ahnung davon, und als Katz und<br />
Connolly aufgeholt hatten, teilte ich ihnen nur <strong>mit</strong>, was für eine schöne<br />
Stelle das sei. Sie sahen sie sich an und stimmten mir zu, dann gingen wir<br />
weiter.<br />
Wir aßen noch zusammen <strong>mit</strong> Connolly im Skyland zu Mittag, danach<br />
verließ er uns, um zurück nach Rockfish Gap zu trampen, wo er seinen<br />
Wagen abgestellt hatte. Katz und ich verabschiedeten uns und zogen weiter,<br />
dazu waren wir schließlich hergekommen. Der erste Teil unseres Abenteuers<br />
war fast vorbei, weshalb sich auf dem Endspurt Richtung Heimat eine<br />
gewisse Forschheit im Schritt einstellte. Wir wanderten noch drei Tage<br />
lang, aßen in Restaurants, wenn wir an welchen vorbeikamen, und kampierten<br />
in Schutzhütten, die wir jetzt wieder fast ganz für uns allein hatten. An<br />
unserem vorletzten Tag auf dem Trail, dem sechsten nach unserem Aufbruch<br />
in Rockfish Gap, waren wir die ganze Zeit unter einem trüben Himmel<br />
marschiert, als plötzlich ein kalter, stürmischer Wind aufkam. Die<br />
Bäume schwankten und bogen sich, Staub und Blätter wurden aufgewirbelt,<br />
und unsere Kleidung bauschte sich und flatterte uns am Leib. Ein Donnergrollen<br />
war zu hören, und dann fing es an zu regnen – ein kalter, elender,<br />
durchdringender Regen. Wir hüllten uns in Nyloncapes und stapften unerschütterlich<br />
weiter.<br />
Es wurde ein schrecklicher Tag, in jeder Hinsicht. Am frühen Nach<strong>mit</strong>tag<br />
stellte ich fest, daß ich den Regenschutz für meinen Rucksack verloren hatte<br />
(der sich aber übrigens als ein völlig nutzloses und unpraktisches Scheißding<br />
erwiesen hatte, für das ich 25 Dollar bezahlt hatte). In meinem Rucksack<br />
mußte jetzt fast alles entweder unangenehm feucht oder klatschnaß<br />
sein. Zum Glück hatte ich mir angewöhnt, meinen Schlafsack in zwei Müllbeutel<br />
einzuwickeln (die für 35 Cents), so daß wenigstens der trocken war.<br />
20 Minuten später, als ich unter einem Ast Zuflucht suchte, um auf Katz zu<br />
warten, kam dieser endlich und sagte sofort: »He, wo hast du denn deinen<br />
Spazierstock gelassen?« Ich hatte meinen schönen Stock verloren – plötzlich<br />
fiel mir ein, daß ich ihn an einen Baum gelehnt hatte, als ich stehengeblieben<br />
war, um mir die Schnürsenkel festzubinden. Ich war todtraurig.<br />
Der Stock hatte mich sechseinhalb Wochen lang durch die Berge begleitet,<br />
war ein Teil von mir geworden. Es war irgendwie eine Verbindung zu meinen<br />
Kindern, die mir sehr fehlten. Ich hätte in Tränen ausbrechen können.<br />
Ich sagte Katz, wo ich ihn wahrscheinlich liegengelassen hatte, an einer<br />
Stelle, die sich Elkwater Gap nannte und die ungefähr sechseinhalb Kilometer<br />
hinter uns lag.
»Ich gehe zurück und hole ihn dir«, sagte er ohne zu zögern und wollte<br />
schon seinen Rucksack absetzen. Ich hätte schon wieder heulen können; er<br />
meinte es ernst, aber ich wollte ihn nicht gehen lassen. Es war zu weit, und<br />
außerdem war Elkwater Gap ein ziemlich belebter Ort. Bestimmt hatte<br />
längst jemand den Stock als Souvenir <strong>mit</strong>genommen.<br />
Wir liefen weiter bis zur Graved Springs Hut. Es war erst halb drei, als wir<br />
dort ankamen. Wir hatten eigentlich vorgehabt, noch zehn Kilometer weiterzugehen,<br />
aber wir waren dermaßen durchnäßt, und der Regen war so<br />
unerbittlich, daß wir uns zum Bleiben entschlossen. Ich hatte keine trockene<br />
Kleidung mehr, deshalb zog ich mich bis auf die Unterwäsche aus und verkroch<br />
mich in meinen Schlafsack. Es wurde der längste Nach<strong>mit</strong>tag, an den<br />
ich mich erinnern kann: Ich las gelangweilt in meinem Buch und starrte<br />
zwischendurch nach draußen in den strömenden Regen.<br />
Um das Maß voll zu machen, fiel gegen fünf Uhr eine Gruppe von sechs<br />
lärmenden Leuten ein, drei Männer und drei Frauen, allesamt <strong>mit</strong> absolut<br />
lächerlicher Wanderkleidung a la Ralph Lauren ausstaffiert – Safarijacken,<br />
breitkrempige Segeltuchhüte und Wanderschuhe aus Veloursleder. Es war<br />
Kleidung für einen Sonntagnach<strong>mit</strong>tagsspaziergang am Mackinac entlang,<br />
für eine Großwildjagd vom Jeep aus, aber definitiv nicht für eine Wandertour.<br />
Eine der Frauen, die ein paar Schritte hinter den anderen hinterherhinkte<br />
und durch den Matsch stapfte, als wäre er radioaktiv verseucht,<br />
schaute zu Katz und mir in die Schutzhütte und sagte in einem Ton unverhohlenen<br />
Mißfallens: »Oh, müssen wir uns den Platz auch noch teilen?«<br />
Sie waren dumm, unangenehm, unbedarft und auf erstaunliche Weise <strong>mit</strong><br />
sich selbst beschäftigt und nicht im geringsten vertraut <strong>mit</strong> den Umgangsformen<br />
unter Wanderern. Unter weniger nervenaufreibenden Umständen<br />
hätten sie sicher faszinierende Studienobjekte abgegeben, aber sie stapften<br />
einfach über Katz und mich hinweg, drängten uns unsanft in die dunkelste<br />
Ecke, bespritzten uns <strong>mit</strong> Wasser, als sie ihre Kleider ausschüttelten und<br />
stießen uns <strong>mit</strong> achtlos hingeworfenen oder abgestellten Sachen an den<br />
Kopf. Mit Verwunderung sahen wir, daß unsere Kleider, die wir auf eine<br />
Wäscheleine zum Trocknen aufgehängt hatten, zur Seite und zusammengeschoben<br />
wurden, da<strong>mit</strong> die Klamotten der neuen Gäste Platz hatten. Ich saß<br />
mürrisch in meiner Ecke, unfähig, mich auf mein Buch zu konzentrieren, als<br />
zwei von den Männern sich neben mich hockten, in den Lichtkegel meiner<br />
Lampe, und folgende Unterhaltung führten:<br />
»So was habe ich noch nie gemacht.«<br />
»Was? In einer Schutzhütte übernachtet?«<br />
»Nein, durch ein Fernglas geguckt und meine Brille dabei aufgelassen.«<br />
»Ach so, und ich dachte, du meintest, in einer Hütte übernachten – ha! ha!<br />
ha!«
»Nein, ich meinte, durch ein Fernglas gucken und meine Brille dabei auflassen<br />
– ha! ha! ha!«<br />
Nachdem es ungefähr eine halbe Stunde in dem Stil weitergegangen war,<br />
kam Katz herübergekrochen, kniete sich neben mich und flüsterte: »Einer<br />
von den Kerlen hat gerade Sportsfreund zu mir gesagt. Ich muß hier raus.«<br />
»Was willst du machen?«<br />
»Mein Zelt in der Lichtung aufschlagen. Kommst du <strong>mit</strong>?«<br />
»In der Unterhose?« fragte ich ihn gequält.<br />
Katz nickte verständnisvoll und erhob sich. »Meine Damen und Herren«,<br />
verkündete er, »ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigen Sie bitte,<br />
Sportsfreund – darf ich auch um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir gehen<br />
nach draußen und schlagen unsere Zelte im Regen auf, da<strong>mit</strong> Sie über den<br />
gesamten Platz in dieser Hütte verfügen können, aber mein Freund hier trägt<br />
nur seine Unterhose, und er macht sich Sorgen, er könne den Damen unter<br />
Ihnen zu nahe treten – und die Herren möglicherweise erregen«, fügte er<br />
<strong>mit</strong> einem süßlichen, anzüglichen Grinsen hinzu, »wenn Sie sich also bitte<br />
für einen Augenblick umdrehen würden, da<strong>mit</strong> er sich richtig ankleiden<br />
kann. Ich möchte mich bereits jetzt von Ihnen verabschieden und mich bei<br />
Ihnen dafür bedanken, daß Sie uns gestattet haben, ein paar Millimeterchen<br />
von Ihrem Platz eine Weile <strong>mit</strong> Ihnen zu teilen. Es war uns ein Vergnügen.«<br />
Dann sprang er hinaus in den Regen. Ich zog mich hastig an, Schweigen<br />
und trotzig abgewandte Blicke um mich herum, und hüpfte <strong>mit</strong> einem knappen,<br />
kaum zu vernehmenden »Auf Wiedersehen« auf den Lippen vom<br />
Schlafpodest hinunter. Wir schlugen unsere Zelte in ungefähr 30 Metern<br />
Entfernung auf – kein leichtes Unterfangen oder gar Vergnügen bei strömendem<br />
Regen, das können Sie mir glauben – und krochen hinein. Bevor<br />
wir fertig waren, hatten die Stimmen in der Schutzhütte wieder eingesetzt,<br />
gefolgt von triumphierendem Gelächter. Sie waren laut bis in die Nacht,<br />
dann betrunken grölend bis in die frühen Morgenstunden. Ich fragte mich,<br />
ob diese Leute überhaupt einen Hauch von Mitleid oder gar Gewissensbissen<br />
empfanden, vielleicht sogar ein Friedensangebot machen würden – <strong>mit</strong><br />
einem Plätzchen, zum Beispiel, oder einem Hotdog – aber nichts dergleichen.<br />
Als wir am nächsten Morgen aufwachten, hatte der Regen aufgehört, aber<br />
es war immer noch öde und trübe draußen, und Regenwasser tropfte von<br />
den Bäumen. Wir kochten erst gar keinen Kaffee. Wir wollten einfach nur<br />
weg. Wir brachen unsere Zelte ab und packten unsere Siebensachen. Katz<br />
holte noch ein Hemd von der Wäscheleine und meldete, daß unsere sechs<br />
Freunde fest schliefen. Zwei leere Flaschen Bourbon, ergänzte er im Ton<br />
tiefster Verachtung.<br />
Wir setzten die Rucksäcke auf und begaben uns auf den Trau. Wir waren
ungefähr 400 Meter weit gelaufen, außer Sichtweite des Camps, als Katz<br />
mich anhielt.<br />
»Kannst du dich noch an die Frau erinnern, die gesagt hat, >Oh, müssen wir<br />
uns den Platz auch noch teilen
TEIL 2<br />
13. Kapitel<br />
Da<strong>mit</strong> ging der erste Teil unseres großen Abenteuers zu Ende. Wir marschierten<br />
die 29 Kilometer bis nach Front Royal, wo meine Frau uns in zwei<br />
Tagen abholen sollte, vorausgesetzt, sie fand den weiten Weg von New<br />
Hampshire <strong>mit</strong> dem Auto durch unbekanntes Terrain hierher.<br />
Ich mußte vier Wochen aussetzen und mich anderen Dingen widmen –<br />
hauptsächlich Leute dazu überreden, mein neues Buch zu kaufen, obwohl es<br />
nichts <strong>mit</strong> streßfreiem Abnehmen, Tänzen <strong>mit</strong> irgendwelchen Wölfen, Erfolg<br />
im Zeitalter der Angst oder dem Prozeß gegen O.J. Simpson zu tun<br />
hatte. (Trotzdem verkaufte es sich über sechzigmal.) Katz wollte zurück<br />
nach Des Moines, wo er für den Sommer einen Job auf dem Bau in Aussicht<br />
hatte, aber er versprach, im August wiederzukommen, um den berühmten<br />
und gefährlichen Abschnitt des Trails in Maine, der sich Hundred<br />
Mile Wilderness nennt, <strong>mit</strong> mir zu gehen.<br />
Ganz am Anfang unserer Wanderung hatte er ernsthaft in Erwägung gezogen,<br />
den gesamten Trail zu gehen, sich allein auf den Weg zu machen, bis<br />
ich dann im Juni wieder dazustoßen würde, aber als ich ihn jetzt danach<br />
fragte, lachte er nur und sagte, ich sollte gefälligst auf dem Teppich bleiben.<br />
»Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich erstaunt, daß wir überhaupt so weit<br />
gekommen sind«, sagte er, und ich stimmte ihm zu. Wir waren 800 Kilometer<br />
weit gelaufen, hatten eineinviertel Millionen Schritte getan, seit wir in<br />
Amicalola aufgebrochen waren. Wir hatten allen Grund, stolz zu sein. Wir<br />
waren jetzt richtige Wanderer. Wir hatten in den Wäldern geschissen, und<br />
wir hatten <strong>mit</strong> Bären gefrühstückt. Wir waren Männer der Berge und würden<br />
es immer bleiben.<br />
29 Kilometer an einem Stück zu laufen war eine Heldentat für unsere Verhältnisse,<br />
aber wir waren dreckig, hatten den Trail satt und freuten uns auf<br />
eine Stadt, und deshalb trotteten wir weiter. Gegen sieben Uhr kamen wir<br />
todmüde in Front Royal an und stiegen gleich im erstbesten Motel ab, an<br />
dem wir vorbeikamen. Es war unsäglich schäbig, aber billig. Die Matratze<br />
hing durch, das Bild auf dem Fernsehschirm wackelte, als würde es gnadenlos<br />
von irgendeinem elektronischen Bauteil traktiert, und meine Zimmertür<br />
schloß nicht richtig. Sie tat nur so, aber wenn man sie j von außen antippte,<br />
sprang sie auf. Es beunruhigte mich zuerst, ) aber dann machte ich mir klar,<br />
daß wohl kaum ein Einbrecher scharf auf irgendeine meiner Habseligkeiten<br />
sein würde, also zog ich die Tür einfach zu und ging <strong>mit</strong> Katz Abend essen.<br />
Wir fanden ein Steakhouse, ein Stück die Straße hinunter, und lagen an-
schließend zufrieden in unseren Betten vor dem Fernseher.<br />
Am nächsten Morgen trabte ich früh zum nächsten Kmart und kaufte zwei<br />
komplette Herrenausstattungen – Strümpfe, Unterwäsche, Jeans, Turnschuhe,<br />
Taschentücher und die beiden schrillsten Hemden, die ich auftreiben<br />
konnte, eines <strong>mit</strong> Booten und Ankern drauf, das andere <strong>mit</strong> den berühmtesten<br />
Sehenswürdigkeiten Europas. Ich kehrte zum Motel zurück, überreichte<br />
eines der Pakete <strong>mit</strong> Klamotten Katz, der total begeistert war, ging auf mein<br />
Zimmer und zog mir die neuen Sachen an. Zehn Minuten später trafen wir<br />
uns auf dem Parkplatz wieder, frisch rasiert, schick angezogen, und machten<br />
uns gegenseitig Komplimente. Wir hatten einen ganzen freien Tag vor<br />
uns und gingen erst mal frühstücken. Danach bummelten wir zufrieden<br />
durch die bescheidenen Einkaufsstraßen, stöberten aus Langeweile in Secondhandläden,<br />
stießen auf ein Geschäft für Campingausrüstung, wo ich<br />
einen Ersatz für meinen Wanderstab erstand, der genauso aussah wie der,<br />
den ich verloren hatte. Anschließend aßen wir zu Mittag und beschlossen,<br />
am Nach<strong>mit</strong>tag spazierenzugehen. Deswegen waren wir ja hier.<br />
Wir stießen auf eine Bahnlinie, die dem Verlauf des Shenandoah River<br />
folgte. Es gibt nichts Schöneres, nichts, was ich stärker <strong>mit</strong> Sommer verbinde,<br />
als in einem neuen Hemd Bahngleise entlangzuschlendern. Wir gingen<br />
ohne Eile, ohne bestimmten Zweck, wie Bergmenschen auf Urlaub, plauderten<br />
unentwegt über Gott und die Welt, traten gelegentlich zur Seite, um<br />
einen Güterzug vorbeirattern zu lassen, und freuten uns ungemein an der<br />
kräftigen Sonne, den verlockend schimmernden, unendlichen Gleisen und<br />
dem schlichten Vergnügen, sich auf Beinen fortzubewegen, die nicht müde<br />
waren. So spazierten wir fast bis Sonnenuntergang. Schöner hätten wir den<br />
letzten Tag nicht verbringen können.<br />
Am nächsten Morgen gingen wir wieder frühstücken, und dann folgten drei<br />
Stunden elender Warterei neben der Einfahrt des Motel-Parkplatzes: den<br />
Verkehr beobachten, Ausschau halten nach einem bestimmten Auto voller<br />
strahlender, aufgeregter, lang ersehnter Gesichter. Wochenlang hatte ich<br />
versucht, diesen verborgenen Ort des Schmerzes, wo die Gedanken an meine<br />
Familie hausten, nicht zu betreten, aber jetzt, wo sie bald da sein würde –<br />
jetzt, wo ich meinen Gedanken freien Lauf lassen konnte –, war die Vorfreude<br />
unerträglich.<br />
Sie können sich die Wiedersehensfreude vorstellen, als meine Familie endlich<br />
kam, die überschwenglichen Umarmungen, das vielstimmige Geschnatter,<br />
das Durcheinander unwichtiger, aber wunderbar detaillierter Informationen<br />
über die Schwierigkeit, die richtige Interstate-Ausfahrt und das Motel<br />
zu finden, das Lob für Dads trainierten Körper, das Mißfallen über sein<br />
neues Hemd. Plötzlich fiel mir Katz wieder ein, verschämt stand er abseits<br />
und grinste. Ich versuchte, ihn in die Begrüßung <strong>mit</strong> einzubeziehen, in das
Wuscheln in den Haaren und was sonst so zu dem ganzen, überirdisch<br />
glücklichen Theater, endlich wieder vereint zu sein, dazugehört.<br />
Wir brachten Katz zum National Airport in Washington, von wo aus er für<br />
den späten Nach<strong>mit</strong>tag einen Flug nach Des Moines gebucht hatte. In der<br />
Wartehalle merkte ich, daß wir bereits wieder in zwei verschiedenen Welten<br />
waren – er war abgelenkt von der Suche nach dem richtigen Flugsteig, ich<br />
war abgelenkt von dem Gedanken an meine Familie, die auf mich wartete.<br />
Mich beschäftigte, daß wir im Parkverbot standen, daß gleich die Rushhour<br />
in Washington einsetzen würde – und so trennten wir beide uns etwas verlegen,<br />
abwesend, <strong>mit</strong> hastig hingeworfenen: Wünschen für einen angenehmen<br />
Heimflug und dem Versprechen, uns im August zur Vollendung unserer<br />
großen Wanderung wiederzutreffen. Als er weg war, fühlte ich mich<br />
elend, aber dann ging ich zurück zum Auto, sah meine Familie und dachte<br />
wochenlang nicht mehr an Katz.<br />
Erst Ende Mai, Anfang Juni kehrte ich zum Appalachian Trail zurück. Ich<br />
machte eine Tageswanderung in dem Wald hinter unserem Haus, <strong>mit</strong> kleinem<br />
Gepäck, einer Wasserflasche, zwei Sandwiches und – pro forma –<br />
einer Karte, sonst nichts. Es war Sommer, der Wald ein neuer, ganz anderer<br />
Ort, voller Leben, voller Grün, Vogelgezwitscher, Schwärmen von Moskitos<br />
und Kriebelmücken. Ich ging acht Kilometer weit durch hügeliges Gelände<br />
bis nach Etna, eine Kleinstadt, wo ich mich neben einen alten Friedhof<br />
setzte und meine Sandwiches verzehrte, dann alles wieder zusammenpackte<br />
und zurückging. Ich war vor Mittag wieder zu Hause. Das war nicht<br />
das Richtige für mich.<br />
Am nächsten Tag fuhr ich zum Mount Moosilauke, 80 Kilometer von zu<br />
Hause entfernt, am südlichen Rand der White Mountains. Moosilauke ist<br />
ein herrlicher Berg von beeindruckender Erhabenheit. Er liegt da wie ein<br />
Löwe, <strong>mit</strong>ten in der Pampa, so daß er wenig Beachtung erfährt. Er gehört<br />
zum Dartmouth College, Hanover, dessen berühmter Outing Club sich seit<br />
Anfang des Jahrhunderts gewissenhaft und auf löblich unspektakuläre Weise<br />
um das Gebiet kümmert. Dartmouth hat am Moosilauke den Abfahrtsskilauf<br />
in Amerika eingeführt, und 1933 wurde dort die erste Nationalmeisterschaft<br />
ausgetragen. Für so etwas ist der Berg jedoch zu abgelegen, und die<br />
Fans des neuen Sports zogen rasch weiter zu anderen Bergen New Englands,<br />
die in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen liegen, und Moosilauke<br />
versank wieder in grandioser Einsamkeit. Heute würde man nie darauf kommen,<br />
daß er einst berühmt gewesen ist.<br />
Ich stellte meinen Wagen auf einem kleinen Schotterplatz ab, es war das<br />
einzige Auto an diesem Tag dort, und machte mich auf den Weg in den<br />
Wald. Diesmal hatte ich Wasser, Sandwiches, eine Karte und Insektenspray
<strong>mit</strong>genommen. Mount Moosilauke ist 1.463 Meter hoch und sehr steil.<br />
Befreit von jeglicher Last auf dem Rücken konnte ich ohne Pause glatt<br />
durchmarschieren -eine neue und erfreuliche Erfahrung. Der Ausblick vom<br />
Gipfel war phantastisch, ein Panoramablick, aber ohne anständigen Rucksack<br />
und ohne Katz war das alles nicht das Wahre. Um vier Uhr war ich<br />
wieder zu Hause. Irgend etwas stimmte einfach nicht. Man wandert nicht<br />
den Appalachian Trail entlang, und geht dann nach Hause und mäht den<br />
Rasen.<br />
Ich war so lange <strong>mit</strong> der Vorbereitung und der Durchführung des ersten<br />
Teils der Wanderung beschäftigt gewesen, daß ich nicht aufhören konnte,<br />
mir auszurechnen, wo ich zu diesem Zeitpunkt <strong>mit</strong>tlerweile gewesen wäre.<br />
In Wirklichkeit stand ich jetzt allein da, ohne meinen Wandergefährten,<br />
weit entfernt von der Stelle, wo wir den Trail verlassen hatten, und hinkte<br />
dem rührend optimistischen Zeitplan, den ich vor nunmehr fast einem Jahr<br />
aufgestellt hatte, hoffnungslos hinterher. Danach wäre ich jetzt irgendwo in<br />
New Jersey gewesen, munter Kilometer fressend, bis zu 50 am Tag.<br />
Ich mußte den Plan meinen Verhältnissen anpassen, soviel stand fest. Aber<br />
ich konnte noch so komplizierte Zahlenspielereien anstellen, selbst wenn<br />
ich das riesige Teilstück, das Katz und ich ausgelassen hatten, indem wir<br />
einfach von Gatlinburg nach Roanoke vorgesprungen waren, unberücksichtigt<br />
ließ: Es war völlig klar, daß ich die ganze Strecke niemals in einer Saison<br />
schaffen würde. Angenommen, ich würde in Front Royal, wo wir den<br />
Trail verlassen hatten, meine Wanderung nach Norden wieder aufnehmen,<br />
dann könnte ich froh sein, wenn ich im Winter Vermont erreichte, 800 Kilometer<br />
vom Mount Katahdin, dem Endpunkt des Trails, entfernt.<br />
Diesmal wäre auch der kindlich unschuldige Reiz des Neuen nicht mehr<br />
dabei, jener erwartungsfrohe, gespannte Schauder, der sich einstellt, wenn<br />
man <strong>mit</strong> einer nagelneuen Ausrüstung loszieht. Diesmal wußte ich genau,<br />
was mich erwartete – viele, viele Kilometer einer schwierigen Strecke,<br />
steile, felsige Berge, harte Böden in den Schutzhütten, heiße Tage ohne die<br />
Möglichkeit, sich zu waschen, unbefriedigende, auf einem launischen Kocher<br />
zubereitete Mahlzeiten. Hinzu kamen die durch warme Witterung bedingten<br />
Gefahren: schlimme Gewitter <strong>mit</strong> heftigen Blitzen, bißfreudige<br />
Klapperschlangen, fieberauslösende Zecken, hungrige Bären und schließlich,<br />
nicht zu vergessen, herumstreunende Mörder, die unversehens und<br />
grundlos zustechen, wie die Berichte über den Tod der beiden im Shenandoah<br />
National Park umgebrachten Frauen zeigten.<br />
Es war mehr als entmutigend. Das Beste, was ich tun konnte, war – das<br />
Beste daraus zu machen. Jedenfalls mußte ich es versuchen. Jeder zu Hause,<br />
der mich kannte (zugegeben sind das nicht so viele, aber immerhin genügend,<br />
als daß ich ständig in Hauseingänge hätte huschen müssen, wenn mir
jemand auf der Hauptstraße begegnet wäre), wußte, daß ich mir vorgenommen<br />
hatte, den AT zu machen – was ja schlecht stimmen konnte, wenn ich<br />
dabei erwischt wurde, wie ich mich in der Stadt herumdrückte. (»Heute<br />
habe ich <strong>Bryson</strong> gesehen, wie er gerade <strong>mit</strong> einer Zeitung vorm Gesicht in<br />
Eastmans Pharmacy gehüpft ist. Ich dachte, der wollte den AT abgehen. Es<br />
stimmt, du hast recht. Er ist ein komischer Kauz.«)<br />
Ich mußte zurück auf den Trail. Ich meine, so richtig weit weg von zu Hause,<br />
irgendwo ins nördliche Virginia, jedenfalls weit genug, um <strong>mit</strong> Anstand<br />
behaupten zu können, ich sei den AT, wenn schon nicht ganz, dann wenigstens<br />
fast ganz entlanggewandert. Die Schwierigkeit war bloß die, daß man<br />
auf der gesamten Strecke ohne fremde Hilfe weder auf den Weg rauf- noch<br />
von ihm runterkommt. Ich konnte nach Washington fliegen, nach Newark<br />
oder Scranton oder jeden beliebigen anderen Ort in der Nähe des Trails,<br />
aber jedesmal wäre ich noch kilometerweit vom eigentlichen Wanderweg<br />
entfernt gewesen. Ich wollte auch nicht die Geduld meiner lieben Frau strapazieren<br />
und sie bitten,sich zwei Tage freizunehmen, um mich nach Virginia<br />
oder Pennsylvania zu bringen, also beschloß ich, selbst zu fahren. Ich<br />
würde, so stellte ich mir vor, den Wagen an einer günstigen Stelle parken, in<br />
die Berge wandern, dann zurück zum Wagen, ein Stück weiterfahren und<br />
das Ganze wiederholen. Ich rechnete schon da<strong>mit</strong>, daß das im Grunde ziemlich<br />
unbefriedigend werden würde, eigentlich war es sogar schwachsinnig –<br />
und ich sollte in beiden Punkten recht behalten –, aber mir fiel keine bessere<br />
Alternative ein.<br />
Und so stand ich in der ersten Juniwoche wieder an den Ufern des Shenandoah,<br />
in Harpers Ferry, West Virginia, blinzelte in den grauen Himmel und<br />
versuchte mir krampfhaft einzureden, daß ich mir nichts anderes gewünscht<br />
hatte.<br />
Harpers Ferry ist aus verschiedenen Gründen ein interessanter Ort. Zunächst<br />
einmal ist er sehr hübsch. Das liegt daran, daß es sich hier um einen National<br />
Historical Park handelt und es deswegen keine Pizza Huts, McDonalds,<br />
Burger Kings, nicht einmal Einwohner im eigentlichen Sinn gibt, jedenfalls<br />
nicht in dem tiefer gelegenen, älteren Stadtteil. Statt dessen findet man<br />
lauter restaurierte oder im historischen Stil wiederaufgebaute Häuser <strong>mit</strong><br />
Plaketten und Hinweistafeln, so daß es eigentlich kaum städtisches Leben<br />
gibt, eigentlich gar kein Leben. Trotzdem hat diese geputzte Niedlichkeit<br />
etwas Betörendes. Es wäre sogar ein ganz netter Ort zum Leben, wenn man<br />
den Einwohnern nur trauen könnte, nicht dem Drang nachzugeben, unbedingt<br />
Pizza Huts und Taco Beils in ihren Mauern haben zu wollen (ich persönlich<br />
glaube, man könnte ihnen trauen – aber höchstens anderthalb Jahre<br />
lang). Es ist ein Ort, der nur so tut als ob, eine Art Fälschung, hübsch ver-
steckt gelegen zwischen steilen Bergen, dort, wo Shenandoah und Potomac<br />
River zusammenfließen.<br />
Es ist deswegen ein National Historical Park, weil der Ort tatsächlich eine<br />
geschichtliche Bedeutung hat. In Harpers Ferry beschloß der Abolitionist<br />
John Brown, die amerikanischen Sklaven zu befreien und einen eigenen<br />
neuen Staat im Nordwesten Virginias zu gründen – ein ziemlich kühnes<br />
Unterfangen, wenn man bedenkt, daß er über eine Armee von gerade mal 21<br />
Mann verfügte. Zu diesem Zweck schlich er sich im Schutz der Dunkelheit<br />
<strong>mit</strong> seinen Getreuen am 16. Oktober 1859 in die Stadt. Sie nahmen die<br />
Waffenkammer der Union ein, wobei sie auf keinen nennenswerten Widerstand<br />
trafen, denn das Lager wurde nur von einem einzigen Nachtwächter<br />
beschützt, aber sie töteten bei der Aktion dennoch einen unschuldigen Passanten<br />
– Ironie des Schicksals, daß es sich dabei ausgerechnet um einen<br />
befreiten schwarzen Sklaven handelte. Als sich die Nachricht verbreitete,<br />
ein Waffendepot der Union <strong>mit</strong> 100.000 Gewehren und Unmengen Munition<br />
sei in die Hände einer kleinen Bande Verrückter gefallen, schickte der<br />
Präsident James Buchanan den Lieutenant Colonel Robert E. Lee, zu dem<br />
Zeitpunkt natürlich noch ein treuer Soldat der Union, in den Ort, da<strong>mit</strong><br />
dieser sich der Sache annähme. Lee und seine Männer brauchten keine drei<br />
Minuten, um den glücklosen Aufstand niederzuschlagen. Brown wurde<br />
gefangengenommen, und man machte ihm umgehend den Prozeß. Einen<br />
Monat später wurde er zum Tod durch den Strang verurteilt.<br />
Unter den zur Aufsicht über die Exekution abkommandierten Soldaten<br />
befand sich auch Thomas J. Jackson – der bald als Stonewall Jackson Berühmtheit<br />
erlangen sollte – und unter den begeisterten Zuschauern der spätere<br />
Lincoln-Mörder John Wilkes Booth. Insofern war der Überfall auf die<br />
Waffenkammer in Harpers Ferry eine Art Vorspiel der folgenden Ereignisse.<br />
Nach Browns kleinem Abenteuerfeldzug brach nämlich die Hölle los.<br />
Einige Abolitionisten aus dem Norden, Ralph Waldo Emerson zum Beispiel,<br />
stilisierten Brown zu einem Märtyrer, und die Loyalisten des Südens<br />
gingen im ‘wahrsten Sinne des Wortes auf die Barrikaden bei dem Gedanken,<br />
daß sich hier möglicherweise eine Bewegung entwickelte. Bevor man<br />
sich’s versah, befand sich die junge Nation im Krieg.<br />
Harpers Ferry stand während des gesamten überaus blutigen Konflikts, der<br />
nun folgte, im Mittelpunkt des Interesses. Gettysburg lag knapp 50 Kilometer<br />
weiter nördlich, Manassas in gleicher Entfernung Richtung Süden. Antietam<br />
– eigentlich ein Fluß, aber auch der Name der Schlacht von<br />
Sharpsburg, Maryland, 1862, in der an einem einzigen Tag doppelt so viele<br />
Männer starben wie im Krieg von 1812, dem Mexikanischen Krieg und dem<br />
Spanisch-Amerikanischen Krieg zusammengenommen – war nur 16 Kilometer<br />
entfernt. Harpers Ferry selbst wurde während des Krieges achtmal
eingenommen. Den Rekord in dieser Beziehung hält allerdings Winchester<br />
in Virginia, ein paar Kilometer weiter südlich, das insgesamt 75mal erobert<br />
und zurückerobert wurde.<br />
Heutzutage begnügt man sich in Harpers Ferry da<strong>mit</strong>, Touristen unterzubringen<br />
und nach Überschwemmungen aufzuräumen. Bei zwei so lebhaften<br />
Flüssen und einem natürlichen Trichter aus Steilufern davor und dahinter ist<br />
es kein Wunder, daß der Ort ständig überflutet wird. Gerade ein halbes Jahr<br />
vor meinem Besuch hatte es eine schlimme Flut in der Stadt gegeben, und<br />
die Angestellten des Nationalparks waren noch da<strong>mit</strong> beschäftigt aufzuräumen,<br />
zu streichen und Möbel, Geräte und Ausstellungsstücke von den oberen<br />
Lagerräumen nach unten ins Erdgeschoß zu tragen. (Drei Monate nach<br />
meinem Besuch mußten sie alles wieder hochschleppen.) An einem Haus<br />
kamen gerade zwei Ranger aus der Tür, gingen ein Stück den Pfad lang und<br />
nickten mir beim Vorbeigehen <strong>mit</strong> einem Lächeln zu. Beide hatten Seitenwaffen<br />
umgeschnallt, wie mir auffiel. Weiß der Himmel, wohin das<br />
führen soll, wenn auch noch Parkranger Dienstwaffen tragen!<br />
Ich bummelte durch die Stadt, aber an fast jedem Haus hing ein Schild:<br />
»Wegen Aufräumungsarbeiten geschlossen.« Danach ging ich zu der Stelle,<br />
an der die beiden Flüsse zusammentreffen, dort gab es eine Informationstafel<br />
zum Appalachian Trail. Der Mord an den beiden Frauen im Shenandoah<br />
National Park war zwar erst zehn Tage her, aber an der Tafel hing bereits<br />
ein kleines Plakat <strong>mit</strong> der Bitte um Aufklärung, dazu Farbfotos von den beiden.<br />
Es war deutlich zu erkennen, daß die Frauen die Bilder selbst unterwegs<br />
aufgenommen hatten, sie waren beide in Wanderausrüstung, wirkten<br />
glücklich und gesund, strahlten geradezu. Es war schwer, den Anblick zu<br />
ertragen, wenn man ihr Schicksal kannte. Ich dachte <strong>mit</strong> einem leichten<br />
Schaudern daran, daß sie wahrscheinlich gerade jetzt, zu diesem Zeitpunkt,<br />
in Harpers Ferry eingetroffen wären, wenn man sie nicht umgebracht hätte,<br />
und ich mich <strong>mit</strong> ihnen unterhalten würde, statt hier zu stehen und mir ihre<br />
Fotos anzuschauen – oder, wenn das Schicksal zufällig eine andere Wendung<br />
genommen hätte, die beiden jetzt hier an meiner Stelle stehen und ein<br />
Bild von Katz und mir betrachten würden, wie wir glücklich und zufrieden<br />
in die Kamera strahlten.<br />
In einem der wenigen geöffneten Häuser traf ich auf einen freundlichen, gut<br />
informierten und zum Glück unbewaffneten Ranger namens David Fox, der<br />
staunte, daß sich überhaupt ein Besucher einfand, und sich darüber freute.<br />
Er sprang eilfertig von seinem Hocker auf, als ich eintrat, und war, wie man<br />
ihm deutlich ansah, bereit, mir jede Frage zu beantworten. Wir kamen auf<br />
Natur- und Landschaftsschutz zu sprechen, und er erwähnte, wie schwierig<br />
es für den Park Service sei, <strong>mit</strong> den bescheidenen Mitteln, die ihm zur Verfügung<br />
stünden, gute Arbeit zu leisten. Bei der Gründung des Parks sei
genug Geld vorhanden gewesen, um wenigstens die Hälfte des Schoolhouse<br />
Ridge Battlefield oberhalb der Stadt zu kaufen (eines der bedeutendsten,<br />
wenn auch kaum gewürdigten Schlachtfelder des Bürgerkriegs), und jetzt<br />
sei eine Planungsgesellschaft dabei, auf diesem, in seinen Augen geheiligten<br />
Boden Häuser und Geschäfte zu errichten. Die Gesellschaft habe bereits<br />
Leitungen auf Grundstücken des Nationalparks verlegt, in der zuversichtlichen,<br />
wie sich aber herausstellte, irrigen Annahme, der Park Service habe<br />
weder den Wunsch noch das Geld, sie davon abzuhalten. Fox riet mir, ich<br />
solle mir das unbedingt ansehen. Ich versprach es ihm.<br />
Zuerst aber mußte ich eine -wichtige Pilgerstätte aufsuchen. Harpers Ferry<br />
ist das Hauptquartier der Appalachian Trail Conference, Aufsichtsbehörde<br />
des prächtigen Wanderwegs, den ich mir für diesen Sommer vorgenommen<br />
hatte. Die ATC ist in einem bescheidenen weißen Haus an einem steilen<br />
Hang oberhalb der Altstadt untergebracht. Ich erklomm den Hang und<br />
betrat das Haus. Das Hauptquartier ist halb Büro, halb Laden; das Büro<br />
macht den löblichen Eindruck, als würde dort gearbeitet, und der Laden ist<br />
bestückt <strong>mit</strong> AT-Führern und Andenken. In einer Ecke des öffentlichen<br />
Teils stand ein Modell des gesamten Trails in großem Maßstab, das mich<br />
sicher von meinem ehrgeizigen Unternehmen abgebracht hätte, wenn ich es<br />
vor Beginn der Wanderung gesehen hätte. Es war ungefähr viereinhalb<br />
Meter lang und ver<strong>mit</strong>telte auf eindrucksvolle Weise und <strong>mit</strong> einem Blick,<br />
was eine 3.500 Kilometer lange Bergkette bedeutete: Schwerstarbeit. Die<br />
übrigen öffentlichen Räume waren <strong>mit</strong> AT-Souvenirs angefüllt – T-Shirts,<br />
Ansichtskarten, Tüchern, verschiedenen Broschüren und Schriften. Ich<br />
kaufte ein paar Bücher und Postkarten und wurde von einer freundlichen<br />
jungen Frau bedient, Laune Potteiger, deren Namensschildchen sie als »Information<br />
Specialist« auswies. Anscheinend hatte man <strong>mit</strong> ihr genau die<br />
Richtige für diesen Job gefunden, denn sie war eine wahre Fundgrube für<br />
Informationen.<br />
Sie erzählte mir, im Vorjahr seien 1.500 Wanderer <strong>mit</strong> der Absicht losgegangen,<br />
den ganzen Trail an einem Stück zu gehen, besagte Weitwanderer.<br />
1.200 hätten es bis Neels Gap geschafft (<strong>mit</strong> anderen Worten, 20 Prozent<br />
hatten nach einer Woche aufgegeben!); etwa ein Drittel sei bis Harpers<br />
Ferry gekommen, ungefähr bis zur Hälfte der Strecke; und 300 seien bis<br />
zum Mount Katahdin gekommen. Das war eine höhere Erfolgsquote als<br />
üblich. 60 Leute hätten den Weg von Norden nach Süden erfolgreich absolviert.<br />
In den letzten vier Wochen habe das diesjährige Kontingent der<br />
Weitwanderer den Ort passiert, aber es sei noch zu früh für eine Einschätzung,<br />
auf jeden Fall werde die endgültige Zahl wieder höher liegen. Sie<br />
steige sowieso fast jedes Jahr.<br />
Ich erkundigte mich nach den Gefahren, die einem auf dem Trail drohten,
und sie sagte mir, in den acht Jahren, die sie nun hier arbeite, habe es nur<br />
zwei nachgewiesene Fälle von Schlangenbiß gegeben, beide nicht tödlich;<br />
eine Person sei durch Blitzschlag umgekommen.<br />
Dann fragte ich sie nach dem Mord an den beiden Frauen.<br />
Sie setzte eine <strong>mit</strong>fühlende Miene auf. »Schrecklich. Das hat uns alle sehr<br />
aufgeregt, weil Vertrauen in seine Mitmenschen eine Grundvoraussetzung<br />
für jeden ist, der den AT entlanggeht. Ich bin selbst 1987 die ganze Strecke<br />
abgewandert. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie sehr man auf die<br />
Hilfsbereitschaft von Fremden angewiesen ist. Eigentlich ist der ganze Trail<br />
darauf ausgerichtet. Und wenn das Vertrauen erst mal dahin ist…« Dann<br />
wurde sie sich ihrer Position bewußt und nahm den offiziellen Standpunkt<br />
ein – die altbekannte Leier, man dürfe nicht vergessen, daß der Trail von<br />
den allgemeinen Übeln der Gesellschaft nicht ausgenommen sei, aber daß er<br />
trotzdem, statistisch gesehen, außerordentlich sicher sei, verglichen <strong>mit</strong><br />
vielen anderen Orten in Amerika. »Seit 1937 sind neun Morde geschehen,<br />
so viele wie in jeder normalen Kleinstadt.« Das war korrekt, aber auch ein<br />
bißchen irreführend. In den ersten 36 Jahren war nämlich auf dem AT kein<br />
einziger Mord passiert, aber neun Morde in den vergangenen 22 Jahren.<br />
Dennoch war ihr erstes Argument unbestreitbar. Die Wahrscheinlichkeit, in<br />
seinem eigenen Bett ermordet zu werden, ist höher, als die, auf dem AT<br />
gewaltsam ums Leben zu kommen. Wie drückte es doch ein amerikanischer<br />
Bekannter so schön aus: »Zieht man eine 3.000 Kilometer lange, gerade<br />
Linie durch die USA, egal in welchem Winkel, trifft man dabei insgesamt<br />
unweigerlich auf neun Mordopfer.«<br />
»Es gibt ein Buch über einen der Morde, falls Sie das interessiert«, sagte die<br />
Verkäuferin und faßte unter die Ladentheke. Sie kramte eine Weile in einem<br />
Karton und holte dann ein Taschenbuch <strong>mit</strong> dem Titel Eight Bullets hervor,<br />
das sie mir zur Ansicht reichte. Es ging um zwei Wanderer, die<br />
1988inPennsylvania erschossen worden waren. »Wir haben es nicht ausgestellt,<br />
weil es die Leute nur aufregt, besonders jetzt«, sagte sie entschuldigend.<br />
Ich kaufte das Buch, und als sie mir das Wechselgeld herausgab, teilte ich<br />
ihr meinen Gedanken von eben <strong>mit</strong>, daß nämlich die beiden Frauen aus<br />
Shenandoah jetzt hier durchgekommen wären, wenn sie überlebt hätten.<br />
»Ja«, sagte sie, »daran habe ich auch schon gedacht.«<br />
Es nieselte, als ich nach draußen trat. Ich ging hoch zum Schoolhouse Ridge,<br />
um mir das Schlachtfeld anzusehen. Es war ein weiter, parkähnlicher<br />
Hügel, durch den sich ein Lehrpfad schlängelte, in Abständen versehen <strong>mit</strong><br />
Informationstafeln über Sprengladungen, über letzte, verzweifelte Attacken<br />
und andere kriegerische Handlungen. Die Schlacht um Harpers Ferry war<br />
der schönste Moment im Leben von Stonewall Jackson (der zuletzt in die
Stadt gekommen war, um John Brown an den Galgen zu bringen), denn hier<br />
gelang es ihm <strong>mit</strong> einem geschickten Manöver und etwas Glück, 12.500<br />
Soldaten der Unionstruppen gefangenzunehmen, mehr amerikanische Soldaten,<br />
als je bei einer einzigen militärischen Operation in gegnerische Hände<br />
gerieten – abgesehen vom Frühling 1942, als amerikanische Einheiten in<br />
Bataan und Corregidor auf den Philippinen von japanischen Truppen besiegt<br />
wurden.<br />
Stonewall Jackson war eine wahrhaft schillernde Gestalt. Es lohnt sich, ihn<br />
einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Nur wenigen Menschen ist es<br />
bislang gelungen, <strong>mit</strong> nutzloseren Gehirnaktivitäten in kürzerer Zeit mehr<br />
Ruhm zu ernten als General Thomas J. Jackson. Seine Marotten waren<br />
legendär. Er war hoffnungslos hypochondrisch veranlagt und dabei sehr<br />
erfinderisch. Einer seiner liebenswerteren physiologischen Glaubenssätze<br />
besagte, daß ein Arm größer sei als der andere, folglich ging und ritt er<br />
immer <strong>mit</strong> einem erhobenen Arm, so daß das Blut in seinen Körper zurückfließen<br />
konnte. Er war ein Viel- und Langschläfer, und mehr als einmal<br />
schlief er <strong>mit</strong> vollem Mund bei Tisch ein. Bei der Battle of White Oak<br />
Swamp sahen sich seine Offiziere außerstande, ihn zu wecken, und hievten<br />
ihn, der nur halb bei Bewußtsein war, auf sein Pferd, wo er weiterschlummerte,<br />
während um ihn herum die Granaten explodierten. Er legte übertriebenen<br />
Eifer bei der Inventur von Beute an den Tag und verteidigte sie, koste<br />
es, was es wolle. Die Liste des Kriegsmaterials, das er während des Feldzugs<br />
in Shenandoah 1862 der Armee der Unionstruppen entriß, umfaßte<br />
»sechs Taschentücher, zweidreiviertel Dutzend Halstücher und eine Flasche<br />
rote Tinte«. Seine Vorgesetzten und Offizierskollegen trieb er zum Wahnsinn,<br />
weil er sich einerseits wiederholt Anweisungen widersetzte, andererseits,<br />
weil er die paranoide Angewohnheit besaß, seine Strategie, wenn er<br />
denn eine hatte, keinem Menschen zu verraten. Einem Offizier, der unter<br />
seinem Kommando stand, befahl er, sich aus der Stadt Gordonsville zurückzuziehen,<br />
obwohl dieser dort kurz vor einem entscheidenden Sieg stand,<br />
und auf kürzestem Weg nach Staunton zu marschieren. Als er in Staunton<br />
ankam, war eben der Befehl eingegangen, sich auf der Stelle nach Mount<br />
Crawford zu begeben. Dort wiederum wurde ihm <strong>mit</strong>geteilt, nach Gordonsville<br />
zurückzukehren.<br />
Jackson handelte sich bei den verwirrten, feindlichen Offizieren hauptsächlich<br />
wegen der Angewohnheit, seine Truppen ohne jede Logik und für niemanden<br />
nachvollziehbar im Shenandoah Valley hin und her zu schieben,<br />
den Ruf eines arglistigen Menschen ein. Sein unsterblicher Ruhm beruht<br />
fast einzig und allein auf der Tatsache, daß er einige wenige, beflügelnde<br />
Siege errang, als anderswo die Truppen der Südstaaten abgeschlachtet und<br />
in Marsch gesetzt wurden, und daß er den besten Spitznamen trägt, dessen
sich je ein Soldat erfreut hat. Er war zweifellos ein tapferer Mensch, aber es<br />
ist durchaus möglich, daß er den Spitznamen nicht wegen seines Wagemuts<br />
und seiner Verwegenheit erhielt, sondern wegen seiner Unbeweglichkeit,<br />
seiner Sturheit, wenn flexibles Handeln vonnöten gewesen wäre. General<br />
Barnard Bee, der ihm diesen Spitznamen bei der First Battle of Manassas<br />
verliehen hatte, wurde getötet, bevor der Tag zu Ende ging, so daß das Rätsel<br />
um den Namen für immer ungelöst bleiben wird.<br />
Den Sieg bei Harpers Ferry, der größte Triumph, den die Konföderierte<br />
Armee während des Bürgerkriegs verbuchen konnte, errang Jackson nur<br />
deswegen, weil er das erste und einzige Mal den Befehlen von Robert E.<br />
Lee folgte. Das besiegelte seinen Ruhm. Ein paar Monate später wurde er in<br />
der Battle of Chancellorsville versehentlich von seinen eigenen Truppen<br />
angeschossen und starb eine Woche später an den Folgen. Der Krieg war<br />
noch längst nicht vorbei. Und Jackson war gerade erst 31 Jahre alt.<br />
Jackson verbrachte die meiste Zeit während des Kriegs in der Umgebung<br />
der Blue Ridge Mountains, schlug dort sein Lager auf und marschierte<br />
durch denselben Wald und über dieselben Höhenzüge, die Katz und ich erst<br />
kürzlich durchstreift hatten. Mich interessierte daher die Stätte seines größten<br />
Triumphs, aber eigentlich wollte ich herausfinden, ob die Entwicklungsgesellschaft<br />
hier oben irgend etwas angestellt hatte, über das man sich<br />
empören konnte.<br />
Im Regen und bei dem dämmerigen Licht konnte ich keine Anzeichen von<br />
Neubauten erkennen, jedenfalls keine in der Nähe oder gar direkt auf dem<br />
»geheiligten Boden«. Ich folgte dem Weg über das wellige Gelände, las mir<br />
<strong>mit</strong> gebührender Aufmerksamkeit die Informationstafeln durch, versuchte<br />
den Umstand, daß Captain Poagues Bataillon genau hier gestanden und<br />
Colonel Grigsbys Truppen dort drüben Aufstellung genommen hatten, auf<br />
mich wirken zu lassen, was allerdings von weitaus bescheidenerem Erfolg<br />
gekrönt war, als zu hoffen gewesen wäre, da ich dabei allmählich bis auf die<br />
Haut durchnäßt wurde. Ich besaß nicht mehr die nötige Energie, um mir den<br />
Lärm, den Rauch und das Gemetzel vorzustellen. Außerdem hatte ich vom<br />
Thema Tod genug für heute. Also ging ich zurück zum Auto und fuhr los.
14. Kapitel<br />
Am nächsten Morgen fuhr ich nach Pennsylvania, knapp 50 Kilometer nach<br />
Norden. Der Appalachian Trail führt in einem 370 Kilometer langen, nordöstlich<br />
ausgerichteten Bogen, der aussieht wie das dicke Ende eines Kuchenstücks,<br />
durch den Bundesstaat Pennsylvania. Ich kenne keinen Wanderer,<br />
der ein gutes Wort für den Trailabschnitt in Pennsylvania übrig hätte. Es<br />
ist der Ort, »an dem Wanderschuhe sich zum Sterben begeben«, wie sich<br />
jemand 1987 einem Reporter des National Geographie gegenüber ausdrückte.<br />
Während der letzten Eiszeit herrschte hier, was Geologen ein periglaziales<br />
Klima nennen. Es bezeichnet eine Zone am Rand einer Eisdecke,<br />
die sich durch häufige Frost- und Tauwetter-Zyklen auszeichnet und den<br />
felsigen Boden aufbricht. Die Folge sind endlose Gebiete aus zerklüfteten,<br />
bizarr geformten Steinbrocken, die in wackligen Schichten übereinanderliegen.<br />
Fachleute nennen das ein Felsenmeer. Es erfordert ständige Aufmerksamkeit<br />
beim Gehen, wenn man sich nicht den Knöchel verstauchen<br />
oder auf die Schnauze fallen will – keine angenehme Erfahrung <strong>mit</strong> einem<br />
Schub von 20 Kilo auf dem Rücken. Viele Wanderer kehren <strong>mit</strong> Schrammen<br />
und Knochenbrüchen aus Pennsylvania zurück. Außerdem soll es dort<br />
die aggressivsten Klapperschlangen und die unzuverlässigsten Wasserquellen<br />
geben, vor allem im Hochsommer. Die wirklich herrlichen Bergkämme<br />
der Appalachen in Pennsylvania – Nittany, Jacks und Tussey – liegen weiter<br />
nördlich und westlich. Aus diversen praktischen und historischen Gründen<br />
kommt der AT nicht einmal in die Nähe dieser Berge. Er führt eigentlich<br />
über gar keine bedeutende Erhebung in Pennsylvania, hat keine besonders<br />
einprägsamen Ausblicke zu bieten, berührt keine Nationalparks oder Wälder<br />
und läßt die bemerkenswerte Geschichte des Bundesstaates völlig außer<br />
acht. Der AT ist hier im wesentlichen das Herzstück eines sehr langen,<br />
strapaziösen Weges, der den Süden <strong>mit</strong> New England verbindet. Kein Wunder,<br />
daß die meisten Leute ihn nicht sonderlich mögen.<br />
Und noch etwas: Die Karten für diesen Abschnitt sind die schlechtesten, die<br />
je für Wanderer erstellt wurden. Die sechs Blätter für Pennsylvania – die<br />
Bezeichnung Karten wäre zuviel der Ehre –, die von einer Institution herausgegeben<br />
werden, die sich Keystone Trail Association nennt, sind klein,<br />
einfarbig, schlecht gedruckt, erstaunlich ungenau, und die Legende ist unzureichend<br />
– <strong>mit</strong> einem Wort, sie sind nutzlos, lächerlich, ja gefährlich. Niemand<br />
sollte <strong>mit</strong> solchen Karten in die Wildnis geschickt werden.<br />
Dieser Umstand offenbarte sich mir in seiner ganzen Tragweite erst, als ich<br />
auf dem Parkplatz des Caledonia State Park stand und mir einen Kartenausschnitt<br />
ansah, der ein einziger Fleck aus lauter Spiralen -war, - wie ein mißratener<br />
Fingerabdruck. Es war zum Heulen. In die einzige Höhenlinie hinein
war eine Zahl in mikroskopischer Größe geschrieben. Die Zahl sollte entweder<br />
548 oder 348 heißen, es war unmöglich zu erkennen, aber das spielte<br />
sowieso keine Rolle, denn es war nirgendwo ein Maßstab angegeben,<br />
nichts, woraus der Höhenunterschied von einer Linie zur nächsten hervorging<br />
oder ob das Bündel von Linien einen steilen Aufstieg oder einen jähen<br />
Abhang anzeigte. Was den Park und die nähere Umgebung betrifft, war<br />
nichts, aber auch gar nichts eingetragen. Mein Standort hätte 20 Meter oder<br />
auch zwei Kilometer vom Appalachian Trail entfernt sein können, es war<br />
anhand der Karte einfach nicht zu erkennen.<br />
Dummerweise hatte ich mir die Karten nicht angeschaut, bevor ich von zu<br />
Hause aufgebrochen war. Ich hatte überstürzt meinen Rucksack gepackt und<br />
nur darauf geachtet, daß ich das richtige Karten-Set dabeihatte, und es in<br />
den Sack gestopft. Jetzt sah ich sie mir alle nacheinander an und war bestürzt,<br />
so als würde ich mir kompro<strong>mit</strong>tierende Fotos von einem geliebten<br />
Menschen anschauen. Ich hatte von Anfang an gewußt, daß ich nicht durch<br />
ganz Pennsylvania laufen wollte – dazu hatte ich weder die Zeit noch die<br />
geringste Lust –, aber ich hatte gedacht, wenigstens ein paar schöne Rundwanderwege<br />
zu finden, die mir etwas von der Besonderheit des Bundesstaates<br />
ver<strong>mit</strong>telten, ohne ständig denselben Weg zurückgehen zu müssen. Bei<br />
der Durchsicht des gesamten Karten-Sets wurde jedoch nicht nur deutlich,<br />
daß es keine Rundwanderwege gab, sondern daß es jedesmal reines Glück<br />
bedeuten würde, wenn ich überhaupt hier und da auf den Trail stieße.<br />
Seufzend steckte ich die Karten wieder ein, machte mich auf den Weg<br />
durch den Park und suchte nach den vertrauten, weißen Zeichen des AT. Es<br />
war ein hübscher Park, in einem waldreichen Tal gelegen und ziemlich leer<br />
an diesem herrlichen Morgen. Ich ging ungefähr eine Stunde lang, zwischen<br />
Bäumen hindurch, über Fußgängerbrücken aus Holz, aber den AT fand ich<br />
trotzdem nicht. Über einen einsamen Highway und durch dichtes Blättertreiben<br />
vom Michaux State Forest her gelangte ich zum Pine Grove Furnace<br />
State Park, einem großen Freizeitpark, den man um einen alten Schmelzofen<br />
aus dem 19. Jahrhundert herum angelegt hat, woher auch der Name<br />
stammt. Der Ofen ist heute eine malerische Ruine. Es gab Imbißstände,<br />
<strong>Picknick</strong>tische und einen See <strong>mit</strong> einem abgetrennten Bereich zum Baden,<br />
aber alles war geschlossen, und es war keine Menschenseele zu sehen. Am<br />
Rand des <strong>Picknick</strong>areals stand ein riesiger Müllcontainer <strong>mit</strong> einem robusten<br />
Metalldeckel, der ziemlich malträtiert und verbeult aussah, fast aus den<br />
Angeln gehoben, wahrscheinlich von einem Bären, der sich über die Abfälle<br />
hermachen wollte. Ich sah mir den Container ehrerbietig aus der Nähe an.<br />
Ich wußte nicht, daß Bären solche Kräfte entwickeln konnten.<br />
Endlich prangten mir auch die AT-Zeichen entgegen. Der Weg führte um<br />
den See herum und dann steil aufwärts durch einen Wald bis zum Gipfel
des Piney Mountain, der nicht auf der Karte eingezeichnet ist und <strong>mit</strong> knapp<br />
460 Metern eigentlich auch kein richtiger Berg ist. Trotzdem stellte er an<br />
einem warmen Sommertag wie heute eine Herausforderung dar. Außerhalb<br />
des Parks befindet sich eine Tafel, die die traditionelle, aber rein theoretische<br />
Mitte des Appalachian Trail markiert, <strong>mit</strong> 1.738,36 Kilometern Fußweg<br />
in beide Richtungen. Da niemand genau sagen kann, wie lang der AT<br />
tatsächlich ist, liegt die Mitte wahrscheinlich irgendwo 80 Kilometer weiter<br />
links oder rechts von dem angezeigten Punkt; auf jeden Fall verschiebt sie<br />
sich wegen der dauernden Änderung des Wegverlaufs jedes Jahr. Zwei<br />
Drittel der Weitwanderer bekommen den Punkt ohnehin nie zu sehen, weil<br />
sie bis dahin längst aufgegeben haben. Eigentlich muß es doch ein enttäuschender<br />
Moment sein, wenn man sich zehn, elf Wochen lang durch bergige<br />
Wildnis gequält hat und einem an dieser Stelle klar wird, daß man trotz aller<br />
Strapazen erst die Hälfte geschafft hat.<br />
Hier ungefähr fand auch einer der berüchtigteren Morde des Trail statt, der<br />
Mord, der im Zentrum des Buches Eight Bullets steht, das ich in der Hauptgeschäftsstelle<br />
des ATC gekauft hatte. Die Geschichte ist schnell erzählt. Im<br />
Mai 1988 erregten zwei junge Hiker, Rebecca Wight und Claudia Brenner,<br />
die zufällig auch lesbisch waren, die Aufmerksamkeit eines gestörten Mannes<br />
<strong>mit</strong> einem Gewehr, der aus der Ferne achtmal auf die beiden schoß, als<br />
sie auf einer laubübersäten Lichtung neben dem Trail <strong>mit</strong>einander schliefen.<br />
Wight wurde getötet. Claudia Brenner gelang es, schwer verwundet, den<br />
Hügel hinunterzulaufen, auf eine Straße, wo sie von Jugendlichen, die in<br />
einem Pick-up vorbeifuhren, gerettet wurde. Der Mörder wurde schnell<br />
gefaßt und verurteilt.<br />
Im Jahr darauf wurden in einer Schutzhütte ein paar Kilometer nördlich von<br />
hier ein junger Mann und eine Frau von einem herumstreunenden Mann<br />
ermordet, was Pennsylvania für eine Weile einen schlechten Ruf einbrachte,<br />
aber dann kam es sieben Jahre lang zu keinen weiteren Morden entlang des<br />
AT, bis zu dem gewaltsamen Tod der beiden jungen Frauen kürzlich im<br />
Shenandoah National Park. Ihr Tod erhöhte die offizielle Zahl der Mordfälle<br />
auf neun – eine recht hohe Zahl für einen Wanderweg, daran gibt es<br />
nichts zu deuteln –, obwohl es in Wahrheit vermutlich mehr waren. Zwischen<br />
1946 und 1950 verschwanden drei Personen während einer Wanderung<br />
durch ein relativ kleines Gebiet in Vermont, aber sie sind in der Zählung<br />
nicht berücksichtigt – ob das daran liegt, daß es so lange her ist oder<br />
weil nie abschließend geklärt wurde, ob sie ermordet wurden, kann ich nicht<br />
sagen. Ein Bekannter in New England erzählte mir außerdem von einem<br />
älteren Ehepaar, das in den 70er Jahren in Maine von einem Mann <strong>mit</strong> einer<br />
Axt umgebracht worden war, aber auch dieser Fall taucht in der Statistik<br />
nicht auf, denn offenbar befanden sich die beiden auf einem Nebenwander-
weg, als sie angegriffen wurden.<br />
Eight Bullets, Brenners Bericht über den Mord an ihrer Freundin, las ich in<br />
einer Nacht durch, mir waren also die Umstände im großen und ganzen<br />
bekannt, aber ich ließ das Buch absichtlich im Auto liegen, weil es mir<br />
irgendwie ein bißchen morbid vorkam, knapp zehn Jahre danach den genauen<br />
Ort des Geschehens zu suchen. Ich war durch die Lektüre nicht im<br />
geringsten in Angst versetzt worden, aber ich spürte dennoch ein leichtes<br />
Unbehagen, so ganz allein im stillen Wald, weit weg von zu Hause. Katz<br />
fehlte mir, sein Stöhnen und Schimpfen, seine durch nichts zu erschütternde<br />
Unerschrockenheit, und mir mißfiel der Gedanke, daß ich warten könnte,<br />
bis ich schwarz würde, wenn ich mich auf dem nächsten Stein niederlassen<br />
würde, da<strong>mit</strong> er aufholen konnte: Katz würde nicht kommen. Der Wald<br />
stand jetzt in seiner ganzen chlorophyllgeschwängerten Pracht, was ihn<br />
noch bedrückender und geheimnisvoller machte. Häufig konnte man keinen<br />
Meter weit durch das dichte Laubwerk zu beiden Seiten des Wegs sehen.<br />
Wenn mir jetzt zufällig ein Bär entgegengekommen wäre, hätte ich ziemlich<br />
dumm dagestanden. Und es wäre auch kein Katz nach einer Minute zur<br />
Stelle gewesen, um dem Tier die Fresse zu polieren und zu mir zu sagen:<br />
»Meine Güte, <strong>Bryson</strong>, kannst du nicht selbst auf dich aufpassen?« Es würde<br />
überhaupt niemand vorbeikommen, an dem man sich abreagieren konnte.<br />
Wahrscheinlich gab es im Umkreis von 80 Kilometern keinen einzigen<br />
Menschen außer mir. Ich stapfte weiter, von leichter Unruhe ergriffen und<br />
kam mir vor wie jemand, der zu weit aufs Meer hinausgeschwommen ist.<br />
Es waren 5,6 Kilometer bis zum Gipfel des Piney Mountain. Oben angekommen,<br />
stand ich unschlüssig herum. Ich konnte mich nicht entscheiden,<br />
ob ich noch ein Stück weitergehen oder umkehren und einen anderen Weg<br />
probieren sollte. Es lag eine gewisse Hilflosigkeit und entmutigende Sinnlosigkeit<br />
in allem, was ich tat. Ich wußte längst, daß ich nicht den gesamten<br />
AT schaffen würde, aber erst jetzt dämmerte es mir, wie läppisch und aussichtslos<br />
es war, sich die Strecke häppchenweise vorzunehmen. Es war im<br />
Grunde egal, ob ich fünf, zehn oder 15 Kilometer weit ging. Wenn ich 15<br />
Kilometer ging statt, sagen wir zehn - was hätte ich dabei gewonnen? Ganz<br />
sicher keinen Ausblick, keine Erfahrung, kein Erlebnis, das ich nicht bereits<br />
tausendfach gehabt hatte. Das ist das Problem beim AT – er ist ein weiter,<br />
unvorstellbar langer Weg, und es gab immer mehr, unendlich viel mehr<br />
Wegstrecke, als ich bewältigen konnte. Nicht, daß ich aufhören wollte. Im<br />
Gegenteil. Ich ging gern, ich war scharf aufs Gehen. Ich wollte nur wissen,<br />
was ich hier draußen eigentlich zu suchen hatte.<br />
Während ich unentschlossen herumstand, hörte ich plötzlich ein trockenes<br />
Knacken in den Zweigen, wie eine unbedachte Bewegung im Unterholz,<br />
ungefähr 15 Meter von mir entfernt im Wald – es mußte ein ziemlich großes
Tier sein, aber es war nicht zu sehen. Ich erstarrte, hörte auf zu atmen, zu<br />
denken, stellte mich auf Zehenspitzen und versuchte, zwischen den Blättern<br />
etwas zu erkennen. Wieder das Geräusch, diesmal näher. Was auch immer<br />
es verursachte, es kam direkt auf mich zu. Vor Angst leise wimmernd, lief<br />
ich ein paar hundert Meter; mein Tagesrucksack hüpfte auf und ab, Gläser<br />
klirrten, dann drehte ich mich um, mein Herzschlag setzte aus, und ich sah<br />
hinter mich. Ein Reh, ein großer Bock, schön und stolz, trat auf den Pfad,<br />
blickte mich einen Moment lang unverwandt an und trabte dann weiter. Es<br />
dauerte eine Zeitlang, bis ich wieder Luft bekam, dann wischte ich mir den<br />
Schweiß von der Stirn und fühlte mich vollkommen ernüchtert.<br />
Irgendwann hat jeder Wanderer auf dem AT seinen persönlichen Tiefpunkt<br />
erreicht, für gewöhnlich dann, wenn der Wunsch aufzugeben geradezu<br />
überwältigend ist. Die Ironie in meinem Fall lag darin, daß ich auf den Trail<br />
zurück wollte, aber nicht wußte wie. Ich hatte nicht nur Katz verloren, meinen<br />
lustigen Gefährten, sondern meine ganz eigene Beziehung zum Trail.<br />
Mir war jeder Antrieb abhanden gekommen, das Gefühl für den Sinn und<br />
Zweck des Ganzen. Ich mußte wieder auf eigenen Füßen stehen, was ganz<br />
wörtlich gemeint war. Zu allem Übel zitterte ich jetzt auch noch vor Furcht,<br />
als wäre ich noch nie allein im Wald gewesen. Die ganzen Erfahrungen, die<br />
ich in den Wochen vorher auf dem Trail gesammelt hatte, machten es mir<br />
schwerer und nicht leichter, auf mich allein gestellt zu sein. Das hatte ich<br />
nicht erwartet. Es erschien mir nicht gerecht. Es stimmte irgendwie nicht. In<br />
niedergeschlagener Stimmung kehrte ich zu meinem Wagen zurück.<br />
Ich verbrachte die Nacht in der Nähe von Harrisburg und fuhr am nächsten<br />
Morgen über Nebenstraßen in nördliche und östliche Richtung, quer durch<br />
den Bundesstaat. Ich hielt mich so dicht wie möglich an den Verlauf des<br />
Trail, blieb ab und zu stehen, um vor Ort ein Stück Weg zu gehen, entdeckte<br />
aber nichts, das irgendwie vielversprechend aussah, also fuhr ich die<br />
meiste Zeit.<br />
Allmählich klangen die Ortsnamen unterwegs immer mehr wie in einem<br />
Industriegebiet – Port Carbon, Minersville, Slatedale. Ich hatte die eigentümliche,<br />
fast vergessene Welt des Kohlereviers von Pennsylvania erreicht.<br />
In Minersville bog ich in eine Nebenstraße und durchquerte eine Landschaft<br />
aus überwachsenen Abraumhalden und verrosteten Maschinen und fuhr bis<br />
nach Centralia, in die seltsamste, traurigste Stadt, die ich je gesehen habe.<br />
Unter dem östlichen Teil Pennsylvanias liegen die reichsten Kohlenflöze<br />
der Welt. Bereits die ersten Europäer, die hier siedelten, erkannten, daß sich<br />
dort Kohle in unvorstellbaren Mengen befand. Es gab nur ein Problem: Es<br />
handelte sich fast ausschließlich um Anthrazitkohle, Steinkohle, eine Kohleart,<br />
die so ungemein hart ist – sie besteht zu 95 Prozent aus Kohlenstoff –,
daß man lange Zeit rätselte, wie man sie ans Tageslicht befördern könnte.<br />
Erst 1823 kam ein erfinderischer Schotte namens James Neilson auf die<br />
geniale Idee, <strong>mit</strong>tels eines Gebläses erhitzte statt kalte Luft in einen Eisenofen<br />
zu leiten. Das sogenannte Heißwindverfahren revolutionierte die Kohleindustrie<br />
auf der ganzen Welt (auch in Wales gab es viel Anthrazitkohle),<br />
aber besonders in den USA. Gegen Ende des Jahrhunderts produzierten die<br />
USA 270 Millionen Tonnen Kohle jährlich, annähernd so viel wie der Rest<br />
der Welt zusammengenommen, und der größte Teil davon kam aus der<br />
Kohleregion in Pennsylvania.<br />
Mittlerweile hatte man dort auch Öl entdeckt, aber es wurde nicht nur entdeckt,<br />
sondern man fand auch Mittel und Wege, es industriell zu nutzen.<br />
Petroleum, auch Steinöl genannt, war schon seit langem eine Kuriosität im<br />
westlichen Pennsylvania. Es drang in Sickergruben an Flußufern an die<br />
Erdoberfläche, wo es <strong>mit</strong> Decken aufgefangen und zu Medikamenten verarbeitet<br />
wurde, die für ihre Wirksamkeit bei der Heilung aller möglichen<br />
Krankheiten, von Lymphknotentuberkulose bis Durchfall, geschätzt waren.<br />
Es war der rätselhafte Colonel Edwin Drake (der in Wahrheit gar kein Colonel,<br />
sondern pensionierter Lokomotivführer war, ohne jegliche geologische<br />
Kenntnisse) und sein unerschütterlicher Glaube daran, daß man das Öl<br />
aus dem Boden über Brunnen fördern könne, der 1859 die Entwicklung<br />
vorantrieb. In Titusville bohrte er ein 21 Meter tiefes Loch in die Erde und<br />
besaß da<strong>mit</strong> die erste Springquelle der Welt. Schnell erkannte man, daß<br />
Petroleum nicht nur die Gedärme in Schach halten und die Krätze bannen<br />
konnte, sondern sich auch zu gewinnbringenden Produkten wie Paraffin und<br />
Kerosin verarbeiten ließ. Pennsylvania erlebte einen Aufschwung sondergleichen.<br />
In drei Monaten wuchs die Bevölkerung von Pithole City, so der<br />
liebevolle Spitzname, von Null auf 15.000, wie John McPhee in seinem<br />
Buch In Snspect Terrain schreibt. Noch einige andere Städte in der Region<br />
entstanden quasi über Nacht, zum Beispiel Oil City, Petroleum Center und<br />
Red Hot. John Wilkes Booth kam ebenfalls hierher und verlor sein erspartes<br />
Geld, dann zog er los und erschoß einen Präsidenten, aber andere blieben<br />
und machten ein Vermögen.<br />
Ein quirliges halbes Jahrhundert lang besaß Pennsylvania praktisch ein<br />
Monopol auf eines der wertvollsten Produkte der Welt – Öl, und spielte eine<br />
beherrschende Rolle in der Förderung eines anderen Produkts, nämlich<br />
Kohle. Aufgrund der Nachbarschaft dieser beiden gewaltigen Brennstoffvorkommen<br />
entwickelte sich Pennsylvania zu einem Zentrum brennstoffintensiver<br />
Industriezweige wie Stahl und Chemie. Sehr viele Leute wurden<br />
unermeßlich reich.<br />
Nur die Bergarbeiter nicht. Der Bergbau war schon immer und überall eine<br />
furchtbare Arbeit, aber nirgendwo war es so schlimm wie in Amerika in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dank ungehinderter Einwanderung<br />
standen Bergarbeiter in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Als die Waliser<br />
zu aufsässig wurden, holte man Iren. Als die Iren nicht mehr zufriedenstellend<br />
arbeiteten, holte man Italiener, Polen oder Ungarn. Die Arbeiter<br />
wurden nach Tonnen bezahlt, was sie dazu antrieb, die Kohle <strong>mit</strong> leichtsinniger<br />
Eile herauszuhauen, und was selbstverständlich auch bedeutete, daß<br />
jeder Aufwand, der getrieben wurde, um die Arbeit sicherer oder bequemer<br />
zu gestalten, nicht entlohnt . wurde. Stollen wurden wild in die Erde getrieben,<br />
wie Löcher in Schweizer Käse, was häufig ganze Talregionen zum<br />
Absinken brachte. 1846 brachen in Carbondale Stollen auf einer Fläche von<br />
20 Hektar ohne jede Vorwarnung <strong>mit</strong> einem Schlag zusammen, was Hunderte<br />
Menschenleben forderte. Explosionen und Brände waren an der Tagesordnung.<br />
Zwischen 1870 und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ließen<br />
in amerikanischen Bergwerken 50.000 Arbeiter ihr Leben.<br />
Die Ironie des Schicksals will es, daß Anthrazitkohle sehr schwer entflammbar<br />
ist, aber kaum zu löschen, wenn sie einmal brennt. Die Geschichten<br />
über unkontrollierte Grubenbrände im östlichen Pennsylvania sind Legion.<br />
Ein Feuer zum Beispiel brach 1850 in Lehigh aus und erlosch erst zur<br />
Zeit der Großen Depression, 80 Jahre nach seinem Ausbruch.<br />
Und hier komme ich <strong>mit</strong> meiner Geschichte nach Centralia. Ein Jahrhundert<br />
lang war Centralia ein solides, beschauliches Bergarbeiterstädtchen. Wie<br />
schwer das Leben für die ersten Grubenarbeiter auch gewesen sein mag, in<br />
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedenfalls war Centralia eine einigermaßen<br />
blühende, behagliche, betriebsame kleine Stadt <strong>mit</strong> knapp 2.000<br />
Einwohnern. Die Stadt besaß ein belebtes Geschäftsviertel, <strong>mit</strong> Banken,<br />
Post und der üblichen Auswahl an Läden und kleinen Kaufhäusern, eine<br />
High School, vier Kirchen, einen Old Fellows Club, ein Rathaus – <strong>mit</strong> anderen<br />
Worten, es war eine typische, gemütliche, einigermaßen anonyme amerikanische<br />
Kleinstadt.<br />
Leider hockte die Gemeinde aber auch auf über 30 Millionen Tonnen Anthrazitkohle.<br />
1962 entzündete sich durch den Brand einer Müllhalde am<br />
Stadtrand ein Kohlenflöz. Die Feuerwehr verspritzte zigtausend Liter Wasser,<br />
aber jedesmal, wenn es so aussah, als sei das Feuer erloschen, flackerte<br />
es wieder auf – wie der beliebte Scherzartikel, diese Geburtstagskerzen, die<br />
man ausbläst und die sich einen Augenblick später von selbst wieder entflammen.<br />
Danach begann das Feuer, sich durch die unterirdischen Flöze zu<br />
fressen. Über ein ausgedehntes Gebiet stieg gespenstischer Rauch vom<br />
Boden auf, wie Dampf von einem See in der Morgendämmerung. Der Asphalt<br />
auf dem Highway 61 wurde so heiß, daß man ihn nicht berühren konnte,<br />
dann bekam die Decke Risse und senkte sich ab, so daß die Straße unpassierbar<br />
wurde. Die Zone, aus der der Rauch aufstieg, zog unter dem
Highway durch und breitete sich in einem benachbarten Waldstück und<br />
weiter oben auf einem Hügel oberhalb der Stadt aus, wo die katholische<br />
Kirche St. Ignatius stand.<br />
Das U.S. Bureau of Mines schickte Experten in das Gebiet, die alle möglichen<br />
Vorschläge machten – einen tiefen Graben quer durch die Stadt auszuheben,<br />
den Verlauf des Feuers durch Sprengungen abzulenken, das Flöz <strong>mit</strong><br />
Druckwasser zu überfluten -aber schon die billigste Methode hätte mindestens<br />
20 Millionen Dollar gekostet, ohne Garantie, daß sie auch funktionierte,<br />
und ohnehin sah sich niemand befugt, eine solche Summe auszugeben.<br />
Und so schwelte das Feuer langsam vor sich hin.<br />
1979 stellte der Besitzer einer Tankstelle unweit des Stadtzentrums fest, daß<br />
die Temperatur in seinen unterirdischen Benzintanks bei fast 80 Grad Celsius<br />
lag. In den Boden versenkte Sensoren zeigten an, daß die Temperatur<br />
vier Meter unterhalb des Tanklagers 500 Grad Celsius betrug. Hausbesitzer<br />
klagten über heiße Kellerwände und -böden. Mittlerweile stieg in der gesamten<br />
Stadt Rauch aus der Erde auf, und die Menschen litten aufgrund des<br />
überhöhten Kohlendioxydgehalts in ihren eigenen vier Wänden zunehmend<br />
unter Brechreiz und Schwindelanfällen. 1981 spielte ein zwölfjähriger Junge<br />
im Garten seiner Großmutter, als vor ihm eine Rauchfahne erschien. Er<br />
starrte sie fasziniert an, als sich plötzlich unter ihm der Boden auftat. Er<br />
klammerte sich an eine Baumwurzel und schrie um Hilfe, bis jemand kam<br />
und ihn herauszog. Das Loch war 24 Meter tief. Innerhalb weniger Tage<br />
kam es im gesamten Stadtgebiet zu ähnlichen Bodenabsenkungen. Erst jetzt<br />
fingen die Menschen an, ernsthaft etwas gegen das Feuer zu unternehmen.<br />
Die Regierung initiierte ein 42-Millionen-Dollar-Programm zur Evakuierung<br />
der Stadt. Sobald die Bewohner weg waren, wurden ihre Häuser <strong>mit</strong><br />
Planierraupen plattgemacht, der Schutt samt und sonders weggeräumt, bis<br />
fast keine Gebäude mehr übrig waren. Centralia ist heute nicht einmal mehr<br />
eine Geisterstadt. Es ist ein großer, freier Platz, ein Netz leerer Straßen, hier<br />
und da noch <strong>mit</strong> Parkverbotsschildern und Hydranten versehen, was surreal<br />
anmutet. Etwa alle zehn Meter befindet sich eine sauber asphaltierte Einfahrt,<br />
die 15, 20 Meter ins Nichts führt. Verstreut stehen noch ein paar Häuser<br />
im Gelände – bescheidene, schmale Holzkonstruktionen, die von Stützpfeilern<br />
aus Stein zusammengehalten werden – und ein paar Gebäude im<br />
ehemaligen Geschäftsviertel.<br />
Ich stellte meinen Wagen vor einem Gebäude ab, an dem ein verblaßtes<br />
Schild <strong>mit</strong> der pompösen Aufschrift »Centralia Grubenbrand-Projektbüro,<br />
Sanierungsgesellschaft Columbia« hing. Der Eingang und die Fenster waren<br />
<strong>mit</strong> Brettern vernagelt, und das Haus selbst sah aus, als drohte es jeden<br />
Moment einzustürzen. Nebenan stand noch ein Haus, in einem besseren<br />
Zustand, Speed Stop Car Parts stand darauf, davor eine tiptop gepflegte
Grünanlage, <strong>mit</strong> Fahnenmast, an dem das Sternenbanner wehte. Das Geschäft<br />
war offenbar immer noch in Betrieb, aber innen brannte kein Licht,<br />
und es war niemand da. Es war überhaupt kein Mensch zu sehen – wie mir<br />
jetzt auffiel –, nicht ein einziges Geräusch zu hören, außer dem Klirren<br />
eines Eisenrings, der gegen den Fahnenmast schlug. Auf den freien<br />
Grundstücken befanden sich hier und da Metallröhren, die wie Ölfässer in<br />
die Erde hinabgelassen worden waren und leise Rauch absonderten.<br />
Oben auf einem sanft ansteigenden Hügel, der sich über die Breite mehrerer<br />
abgeräumter Grundstücke erstreckte, stand eine ziemlich große moderne<br />
Kirche in eine weiße Rauchglocke gehüllt, vermutlich St. Ignatius. Ich stieg<br />
hinauf. Die Kirche sah durchaus noch stabil und benutzbar aus, die Fenster<br />
waren nicht vernagelt, und ich sah auch kein Schild »Betreten verboten«.<br />
Der Eingang war verschlossen, und es gab keine Informationstafel <strong>mit</strong> den<br />
Anfangszeiten der Gottesdienste oder dergleichen, nicht mal der Name der<br />
Kirche und ihre Konfession standen angeschlagen. Drumherum qualmte der<br />
Boden, und auf der Rückseite quollen auf einer großen Fläche ganze Rauchschwaden<br />
aus der Erde. Ich durchschritt das Gelände und fand mich am<br />
Rand eines riesigen Kessels wieder, etwa halb so groß wie ein Fußballfeld,<br />
der dicken, wolkenartigen, hellweißen Rauch ausstieß, wie er beim<br />
Verbrennen von Autoreifen oder alten Decken entsteht. Ich konnte in der<br />
dicken Suppe unmöglich erkennen, wie tief das Loch war. Der Boden fühlte<br />
sich warm an und war <strong>mit</strong> einer feinen Ascheschicht bedeckt.<br />
Ich begab mich wieder zum Eingang der Kirche. Eine schwere, querstehende<br />
Straßensperre blockierte die Zufahrt zu der alten Straße, und ein neuer<br />
Highway führte über einen Nachbarhügel um die Stadt herum. Ich stieg<br />
über die Straßensperre und ging ein Stück den alten Highway 61 entlang.<br />
Unkraut wuchs in Büscheln hier und da aus der Asphaltdecke hervor, aber<br />
die Straße an sich sah noch immer befahrbar aus. Zu beiden Seiten qualmte<br />
das Land auf unübersichtlicher Fläche düster vor sich hin, wie nach einem<br />
Waldbrand. Ungefähr 50 Meter weiter war in der Mitte der Straße ein gezackter<br />
Riß zu sehen, der rasch zu einer breiten Spalte wurde, aus der noch<br />
mehr Qualm aufstieg. An manchen Stellen der Spalte war die Fahrbahn auf<br />
einer Seite 30 bis 40 Zentimeter tief abgesunken oder hatte sich zu einer<br />
rinnenartigen Vertiefung verformt. Ab und an schaute ich in die Spalte<br />
hinunter, konnte aber wegen des Rauchs, der sich als unangenehm beißend<br />
und schwefelhaltig erwies, als eine Windböe ihn mir ins Gesicht wehte,<br />
nicht sehen, wie tief sie reichte.<br />
Ich ging eine Weile an der Spalte entlang, untersuchte sie <strong>mit</strong> ernster Miene,<br />
wie ein Ingenieur vom Straßenbauamt, bevor mein Blick ziellos umherschweifte<br />
und mir dämmerte, daß ich mich <strong>mit</strong>ten, geradezu im Zentrum<br />
einer unentwegt qualmenden Landschaft befand, auf einer vermutlich
hauchdünnen Asphaltdecke, über einem brennenden Feuer, das seit 35 Jahren<br />
außer Kontrolle war. Sich ausgerechnet an diesen Ort in ganz Amerika<br />
zu begeben zeugt nicht gerade von besonderer Klugheit. Vielleicht war es<br />
nur meine buchstäblich erhitzte Phantasie, jedenfalls erschien mir der Boden<br />
plötzlich ausgesprochen schwammig und elastisch, als würde ich auf<br />
einer Matratze gehen. Ich machte rasch wieder kehrt und lief zu meinem<br />
Wagen zurück.<br />
Wenn ich so darüber nachdenke, erscheint es mir merkwürdig, daß jeder<br />
Verrückte, ich eingeschlossen, in einem so offenkundig gefährlichen und<br />
instabilen Ort wie Centralia <strong>mit</strong> dem Auto spazierenfahren und sich alles<br />
ansehen kann, aber es gab nichts, das einen davon abgehalten hätte herumzustreunen.<br />
Noch merkwürdiger fand ich allerdings, daß Centralia nicht<br />
vollständig evakuiert worden ist. Diejenigen, die nicht wegziehen mochten<br />
und <strong>mit</strong> der Gefahr leben wollten, daß ihr Haus eines Tages von der Erde<br />
verschluckt würde, durften bleiben, und einige hatten sich offenbar dafür<br />
entschieden. Ich fuhr <strong>mit</strong> dem Auto zu einem einsamen Haus <strong>mit</strong>ten im<br />
ehemaligen Stadtzentrum. Das in einem blassen Grün gestrichene Haus war<br />
gepflegt und gut erhalten. Gespenstisch. Auf einer Fensterbank standen eine<br />
Vase <strong>mit</strong> künstlichen Blumen und anderer Nippes. Vor der frisch gestrichenen<br />
Veranda befand sich ein Beet <strong>mit</strong> Ringelblumen, allerdings stand<br />
kein Auto in der Einfahrt, und niemand öffnete auf mein Klingeln die Haustür.<br />
Mehrere andere Gebäude stellten sich bei näherem Hinsehen als unbewohnt<br />
heraus. An zwei Häusern waren Fenster und Türen <strong>mit</strong> Brettern vernagelt,<br />
und es hingen Schilder dran, »Achtung! Betreten verboten!«. In fünf, sechs<br />
anderen Häusern, darunter drei kleine Reihenhäuser am Ende des Stadtparks,<br />
lebten offensichtlich noch Menschen, in einem Vorgarten lag sogar<br />
Kinderspielzeug (wer um Himmels willen möchte hier Kinder großziehen?).<br />
Aber nirgends reagierte jemand auf mein Klingeln. Entweder waren alle in<br />
der Arbeit oder lagen, wie ich vermutete, längst mausetot in der Küche. Bei<br />
einem Haus, an dem ich klingelte, bewegte sich eine Gardine, wie ich mir<br />
einbildete, aber ich war mir nicht sicher. Wer weiß, wie gestört die Leute<br />
sind, nachdem sie 30 Jahre auf einem Inferno gelebt und Unmengen von<br />
CO2 inhaliert haben, beziehungsweise wie genervt von Fremden, die fröhlich<br />
an ihre Tür klopften und ihre Stadt als Kuriosum betrachteten. Insgeheim<br />
war ich erleichtert, daß niemand auf mein Klingeln reagierte, denn mir<br />
wäre ums Verrecken keine Frage eingefallen, <strong>mit</strong> der ich ein Gespräch hätte<br />
beginnen können.<br />
Es war bereits nach Mittag, ich fuhr daher die restlichen acht Kilometer<br />
nach Mt. Carmel, der nächsten Stadt, <strong>mit</strong> dem Auto. Mt. Carmel war eine<br />
kleine Überraschung nach Centralia – ein lebendiges Städtchen, angenehm
altmodisch, <strong>mit</strong> Verkehr auf der Main Street, Bürgersteigen voller Einkäufern<br />
und anderen Bewohnern der Stadt, die ihren Geschäften nachgingen.<br />
Ich aß im Academy Luncheonette and Sporting Goods Store zu Mittag<br />
(vermutlich der einzige Ort in ganz Amerika, an dem man beim Verzehr<br />
seines Thunfisch-Sandwichs eine Auswahl von Suspensorien bewundern<br />
kann) und hatte vor, anschließend meine Suche nach dem AT fortzusetzen.<br />
Auf dem Weg zum Auto kam ich jedoch an der Stadtbücherei vorbei, ging<br />
spontan hinein und erkundigte mich, ob es irgendwelches Material über<br />
Centralia gäbe.<br />
Es gab reichlich Material – drei dicke Aktenordner, prallvoll <strong>mit</strong> Zeitungsausschnitten,<br />
die meisten aus der Zeit von 1979 bis 1981, als Centralia für<br />
kurze Zeit landesweites Interesse hervorrief, besonders nachdem der kleine<br />
Junge, ein gewisser Todd Dombowski, im Garten seiner Oma beinahe vom<br />
Erdboden verschluckt worden wäre.<br />
Darüber hinaus gab es noch ein schmales gebundenes Bändchen, eine Geschichte<br />
Centralias, das, aus heutiger Sicht nicht ohne Pikanterie, aus Anlaß<br />
der Hundertjahrfeier der Stadt kurz vor Ausbruch des Feuers in Auftrag<br />
gegeben worden war. Es war reich bebildert, lauter Fotos, die eine Stadt<br />
zeigten, in der lebhaftes Treiben auf den Straßen herrschte, nicht viel anders<br />
als das, was sich vor den Toren der Bücherei abspielte, <strong>mit</strong> dem Unterschied,<br />
daß alles etwas über 30 Jahre zurücklag. Ich hatte vergessen, wie<br />
entrückt die 60er Jahre bereits waren. Die Männer auf den Fotos trugen<br />
Hüte, die Frauen und Mädchen weite, ausgestellte Röcke. Sie wirkten alle<br />
unbekümmert, denn natürlich ahnte niemand, daß ihre hübsche, unbekannte<br />
kleine Stadt dem Untergang geweiht war. Es fiel mir schwer, die Lebendigkeit,<br />
die auf diesen Fotos zum Ausdruck kam, <strong>mit</strong> dem öden Ort, den ich<br />
gerade verlassen hatte, in Verbindung zu bringen.<br />
Als ich alles wieder in den Aktenordner einlegte, fiel ein Zeitungsausschnitt<br />
zu Boden, ein Artikel aus Newsweek. Ein kurzer Absatz am Ende des Textes<br />
war unterstrichen und am Rand <strong>mit</strong> drei Ausrufezeichen versehen. Ein Mitarbeiter<br />
der Brandbekämpfung wurde <strong>mit</strong> den Worten zitiert, wenn das<br />
Feuer gleichmäßig weiterschwele, reiche die Kohle unter Centralia noch für<br />
1.000 Jahre.<br />
Ein paar Kilometer von Centralia entfernt liegt ein weiterer, eindrucksvoller<br />
Ort der Verwüstung, von dem ich zufällig erfahren hatte und den ich unbedingt<br />
aufsuchen wollte – ein Berghang im Lehigh Valley, der durch die<br />
Hinterlassenschaften einer Zinkhütte so gründlich verschmutzt worden war,<br />
daß dort kein Grashalm mehr wuchs. John Connolly hatte mir von dem<br />
Berg erzählt und gesagt, er befände sich unweit von Palmerton, und so<br />
begab ich mich am nächsten Tag dorthin. Palmerton war eine ziemlich
große Stadt, schmutzig, <strong>mit</strong> viel Industrie, aber nicht ohne gewissen Reiz –<br />
ein paar städtische Bauten der Jahrhundertwende, die dem Ort etwas Würdevolles<br />
verliehen, ein behäbiger Platz im Zentrum, und ein Einkaufsviertel,<br />
das eindeutig krisengeschüttelt war, aber den Widrigkeiten mutig trotzte.<br />
Überall im Hintergrund dominierten große Fabrikanlagen, die wie Gefängnisse<br />
aussahen und anscheinend alle geschlossen waren. An einem Ende<br />
der Stadt fand ich, weswegen ich hergekommen war – eine steile, breite<br />
kahle Erhebung, ungefähr 450 Meter hoch und einige Kilometer lang, auf<br />
der keine Vegetation zu erkennen war. Neben der Straße war ein Parkplatz,<br />
ein paar hundert Meter davon entfernt eine Fabrik. Ich bog auf den Parkplatz<br />
ein, stieg aus und staunte – es war ein überwältigender Anblick.<br />
Im selben Moment trat ein dicker uniformierter Mann aus einem Wachhäuschen<br />
und watschelte <strong>mit</strong> mürrischer Miene diensteifrig auf mich zu.<br />
»Was haben Sie hier zu suchen?« schnauzte er mich an.<br />
»Wie bitte?« erwiderte ich betroffen, und dann: »Ich sehe mir den Berg an.«<br />
»Das dürfen Sie nicht.«<br />
»Man darf sich diesen Berg nicht ansehen?«<br />
»Jedenfalls nicht hier. Das ist Privatgelände.«<br />
»Entschuldigung. Das habe ich nicht gewußt.«<br />
»Es ist trotzdem Privatgelände, wie auf dem Schild da zu lesen ist.« Er wies<br />
auf einen Pfosten, an dem überhaupt kein Schild hing, und war für einen<br />
Moment ganz verdattert. »Ist trotzdem Privatgelände«, fügte er hinzu.<br />
»Entschuldigung. Das habe ich nicht gewußt«, wiederholte ich, noch ohne<br />
wirklich begriffen zu haben, wie ernst der Mann seinen Job nahm. Ich bestaunte<br />
weiterhin den Berg. »Ist das nicht ein sagenhafter Anblick?« sagte<br />
ich.<br />
»Was?«<br />
»Der Berg. Nicht ein einziger Grashalm ist zu erkennen.«<br />
»Kann ich nichts zu sagen. Ich werde nicht dafür bezahlt, mir Berge anzuschauen.«<br />
»Sollten Sie ab und zu mal tun. Sie wären erstaunt, was Sie da zu sehen<br />
bekämen. Das da drüben ist dann wohl die Zinkfabrik, oder?« sagte ich und<br />
deutete <strong>mit</strong> einem Kopfnicken auf den Gebäudekomplex hinter seinem<br />
Rücken.<br />
Er musterte mich mißtrauisch. »Wieso wollen Sie das wissen?«<br />
Ich erwiderte seinen Blick. »Weil ich Zink brauche«, entgegnete ich.<br />
Er sah mich von der Seite an, als wollte er sagen: Klugscheißer, was? Statt<br />
dessen sagte er plötzlich entschlossen: »Ich notiere mir mal lieber Ihren<br />
Namen.« Umständlich zog er ein Notizbuch und einen Bleistiftstummel aus<br />
der Gesäßtasche.<br />
»Nur, weil ich Sie gefragt habe, ob das die Zinkfabrik ist?«
»Weil Sie Privatgelände betreten haben.«<br />
»Ich wußte nicht, daß es Privatgelände ist. Da steht ja nicht mal ein Hinweisschild.«<br />
Er hielt den Stummel schreibbereit. »Name?«<br />
»Machen Sie sich nicht lächerlich.«<br />
»Sie haben Privatgelände betreten, Sir. Wollen Sie mir jetzt bitte Ihren<br />
Namen sagen?«<br />
»Nein.«<br />
In dem Stil ging es etwa eine Minute lang hin und her, schließlich schüttelte<br />
er <strong>mit</strong> bedauerlicher Miene den Kopf und meinte: »Ganz wie Sie wollen.«<br />
Er holte ein Funkgerät, zog die Antenne raus und schaltete es ein. Zu spät<br />
war mir klargeworden, daß er während vieler, langer ereignisloser Wachschichten<br />
in seinem kleinen Glaskasten von so einem Moment geträumt<br />
haben mußte.<br />
»J. D.?« sagte er in das Funkgerät. »Luther hier. Hast du die Parkkralle<br />
dabei? Ich stehe hier <strong>mit</strong> einem Einbrecher auf Parzelle A.«<br />
»Was machen Sie da?« fragte ich.<br />
»Ich beschlagnahme Ihr Fahrzeug.«<br />
»Ich bitte Sie. Ich habe doch nur kurz angehalten. In Ordnung, ich fahre ja<br />
schon.«<br />
Ich stieg ein, ließ den Motor an und fuhr los, aber der Mann versperrte mir<br />
den Weg. Ich beugte mich aus dem Fenster. »Würden Sie bitte beiseitetreten?«<br />
rief ich, aber er rührte sich nicht vom Fleck. Er stand <strong>mit</strong> dem Rücken<br />
zu mir, die Arme verschränkt, und schenkte mir keine Beachtung. Ich hupte<br />
leise, aber er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich steckte wieder den<br />
Kopf durchs Fenster und sagte: »Also gut, ich sage Ihnen meinen Namen,<br />
wenn es unbedingt sein muß.«<br />
»Zu spät.«<br />
»Meine Güte«, murmelte ich, und dann, wieder durchs Fenster, sagte ich<br />
»Bitte«, danach nochmal, diesmal flehentlicher: »Ich bitte Sie, wirklich«,<br />
aber er hatte sich nun einmal entschieden und war durch nichts davon abzubringen.<br />
»Stand in der Stellenausschreibung: Arschloch gesucht, oder haben<br />
Sie dafür extra einen Lehrgang besucht?« Dann stieß ich noch ein schlimmes<br />
Schimpfwort aus, blieb sitzen und kochte innerlich.<br />
Eine halbe Minute später fuhr ein Wagen vor, und ein Mann <strong>mit</strong> Sonnenbrille<br />
stieg aus. Er trug die gleiche Uniform wie der Dicke, aber er war<br />
zehn, 15 Jahre älter und sehr viel schlanker. Er hatte das Gebaren eines<br />
Ausbildungsoffiziers.<br />
»Was gibt’s?« fragte er, von einem zum anderen blickend.<br />
»Vielleicht können Sie mir weiterhelfen«, sagte ich im süßlichen Tonfall<br />
bedingungsloser Einsicht. »Ich suche den Appalachian Trail. Und dann sagt
mir dieser Herr hier, ich sei auf Privatgelände eingedrungen.«<br />
»Er hat sich den Berg angesehen, J. D.«, widersprach der Dicke hitzig, aber<br />
J. D. hob abwehrend die Hand und wandte sich dann mir zu.<br />
»Sind Sie Wanderer?«<br />
»Ja, Sir«, sagte ich und zeigte auf meinen Rucksack auf dem Rücksitz. »Ich<br />
wollte nur nach dem Weg fragen, und ehe ich mich’s versah« – ich stieß ein<br />
gespielt erschrockenes Lachen aus –, »kommt der Herr da an und sagt, ich<br />
befände mich auf Privatgelände, und er müsse meinen Wagen beschlagnahmen.«<br />
»J. D. der Mann hat sich den Berg angeschaut und Fragen gestellt.« J. D.<br />
hielt diesmal die andere Hand abwehrend hoch.<br />
»Wo wollen Sie denn wandern?«<br />
Ich sagte es ihm.<br />
Er nickte. »Gut. Dann fahren Sie ungefähr sechs Kilometer geradeaus auf<br />
dieser Straße weiter bis Little Gap und biegen da rechts nach Danielsville<br />
ab. Oben auf dem Hügel kreuzt der Trail die Straße. Das können Sie gar<br />
nicht verfehlen.«<br />
»Vielen Dank.«<br />
»Keine Ursache. Frohes Wandern noch!«<br />
Ich bedankte mich noch mal wortreich und brauste davon. Im Rückspiegel<br />
sah ich <strong>mit</strong> Genugtuung, daß er Luther zurechtwies, ruhig aber bestimmt –<br />
und da<strong>mit</strong> drohte, wie ich stark hoffte, ihm das Funkgerät abzunehmen.<br />
Die Straße führte steil bergauf bis zu einer einsamen Paßhöhe, wo sich ein<br />
<strong>mit</strong> Schotter befestigter Parkplatz befand. Ich stellte den Wagen ab, fand<br />
den AT und folgte ihm auf einem hohen, freiliegenden Grat, durch ein unvorstellbar<br />
verwüstetes Gelände. Kilometerweit nur kahle Landschaft, hier<br />
und da die dürren Stämme abgestorbener Bäume, einige konnten sich noch<br />
aufrechthalten, aber die meisten waren eingeknickt. Die Szenerie erinnerte<br />
unweigerlich an ein Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs nach schwerem<br />
Artilleriebeschuß. Der Boden war <strong>mit</strong> einem sandigen schwarzen Staub<br />
bedeckt, der aussah wie Eisenspäne.<br />
Das Gehen fiel ungewöhnlich leicht – der Grat war fast vollkommen flach –<br />
und das Fehlen jeglicher Vegetation erlaubte einen ungehinderten Ausblick.<br />
Die Bäume auf allen anderen Bergen der nahen Umgebung, einschließlich<br />
der Hügel direkt gegenüber, auf der anderen Seite des schmalen Tals, waren,<br />
soweit man erkennen konnte, in gesundem Zustand, außer an den Stellen,<br />
wo der Berg durch Steinbrüche oder Tagebau verunstaltet oder ausgehöhlt<br />
worden war. Ich ging etwas länger als eine Stunde, bis ich zu einem<br />
jähen, irrsinnig steilen Abstieg nach Lehigh Gap gelangte – 300 Meter in<br />
die Tiefe. Ich hatte eigentlich noch gar keine Lust, für heute Schluß zu machen,<br />
im Gegenteil, ich war gerade erst so richtig in Fahrt gekommen, aber
die Vorstellung, 300 Meter abzusteigen, nur um unten umzukehren und<br />
wieder hochzuklettern, hatte nicht den geringsten Reiz, und es gab auch<br />
keinen anderen Rückweg, der nicht stundenlanges Marschieren an einem<br />
verkehrsreichen Highway bedeutet hätte. Genau das ist eben das Problem,<br />
wenn man den AT in Tagesetappen abwandert: Er ist so angelegt, daß man<br />
weitergeht, immer weiter, nach vorn und nicht Stippvisiten absolviert, mal<br />
hier, mal da.<br />
Seufzend machte ich kehrt und ging denselben Weg zurück, den ich gekommen<br />
war, in einer der Landschaft angepaßten Laune. Es war fast vier<br />
Uhr, als ich den Parkplatz erreichte, zu spät, um noch einen anderen Abschnitt<br />
des Trails auszuprobieren. Der Tag war so gut wie gelaufen. Ich<br />
hatte 560 Kilometer zurückgelegt, um hierher nach Pennsylvania zu kommen,<br />
hatte vier quälend lange Tage in diesem Bundesstaat zugebracht und<br />
war unterm Strich 17 Kilometer des Appalachian Trail abgegangen. Nie<br />
wieder, schwor ich mir, nie wieder würde ich versuchen, <strong>mit</strong> dem Auto an<br />
den Appalachian Trail heranzufahren und ihn in Etappen zu wandern.
15. Kapitel<br />
Früher, vor Jahrmillionen, konnten es die Appalachen in ihrem Ausmaß und<br />
ihrer Erhabenheit durchaus <strong>mit</strong> dem Himalaja aufnehmen – wie Pfeilspitzen,<br />
schneebedeckt, die Wolkendecke durchstoßend, ragten sie atemberaubende<br />
6.000 Meter und höher auf. Mount Washington in New Hampshire<br />
bietet immer noch einen eindrucksvollen Anblick, die Gesteinsmasse, die<br />
sich heute aus den Wäldern New Englands erhebt, stellt jedoch bestenfalls<br />
das rumpfartige untere Drittel dessen dar, was vor zehn Millionen Jahren<br />
hier stand.<br />
Die Appalachen haben heute eine bescheidenere Gestalt, weil ihnen sehr<br />
viel Zeit zur Verfügung stand, um sich abzuschleifen, Sie sind unvorstellbar<br />
alt, älter als die Meere und Kontinente, jedenfalls in ihrer heutigen Ausprägung,<br />
und sie sind weitaus älter als die meisten anderen Bergketten, sogar<br />
älter als fast alle anderen landschaftlichen Merkmale der Erde. Die Appalachen<br />
standen schon zur Begrüßung bereit, als einfachste Pflanzenformen die<br />
Erde besiedelten und die ersten Tiere nach Luft schnappend aus dem Meer<br />
an Land krochen.<br />
Vor etwa einer Milliarde Jahren waren die Kontinente der Erde eine einzige<br />
Landmasse. Sie bildeten den Urkontinent Pangäa, umgeben vom Urozean,<br />
dem Panthalassischen Meer. Eine unerklärliche Erschütterung des Erdmantels<br />
führte dazu, daß die Landmasse zerbrach und die einzelnen asymmetrischen<br />
Blöcke auseinanderdrifteten. Von Zeit zu Zeit im Laufe von Jahrmillionen<br />
– bisher insgesamt dreimal – vollzogen die Kontinente eine Art Wiedervereinigung,<br />
trieben zurück an einen zentralen Ort und stießen dabei sehr<br />
langsam, aber doch <strong>mit</strong> zerstörerischer Wucht zusammen. Bei der dritten<br />
Kollision, die vor 470 Millionen Jahren passierte, wurden die Appalachen<br />
aus der Erdmasse herausgedrückt, wie ein Falten werfender Teppich, um<br />
einen immer wieder bemühten Vergleich zu benutzen. 470 Millionen Jahre<br />
sind eine Zeitspanne, die über den menschlichen Verstand hinausgeht, aber<br />
wenn man sich vorstellt, man flöge in der Zeit rückwärts, <strong>mit</strong> einer Geschwindigkeit<br />
von einem Jahr pro Sekunde, dann brauchte man 16 Jahre,<br />
um diese Zeitspanne zu überwinden. Das ist doch ziemlich lange, würde ich<br />
sagen.<br />
Die Kontinente haben sich nicht einfach wie bei einem Square Dance in<br />
Zeitlupe aufeinander zu und wieder voneinander weg bewegt, sondern sie<br />
drehten sich träge im Kreis, wechselten die Richtung, begaben sich auf<br />
weite Reisen in die Tropen, zu den beiden Polen, begegneten unterwegs<br />
kleineren Landmassen und nahmen diese gleich <strong>mit</strong>. Florida gehörte einst<br />
zu Afrika. Eine Ecke von Staten Island ist, geologisch gesehen, ein Teil<br />
Europas. Die Meeresküste von New England bis Kanada scheint ur-
sprünglich aus Marokko zu stammen. Teile von Grönland, Irland, Schottland<br />
und Skandinavien sind aus dem gleichen Gestein wie der Osten der<br />
USA – im Grunde versprengte Vorposten der Appalachen. Es gibt sogar<br />
Vermutungen, daß selbst so ferne Berge wie die Shackleton Range in der<br />
Antarktis ein Bruchstück aus der Familie der Appalachen ist.<br />
Die Appalachen bildeten sich in drei langen Phasen heraus -ein Vorgang,<br />
den man in der Geologie Orogenese nennt: die takonische, die akadische<br />
und die alleghenische Phase. Die ersten beiden zeichnen im wesentlichen<br />
für den nördlichen Abschnitt der Appalachen verantwortlich, die dritte für<br />
die Mitte und den südlichen Teil. Bei der Berührung oder gar dem Zusammenstoß<br />
der Kontinente rutschte manchmal eine Kontinentalplatte über die<br />
andere, schob den Meeresboden vor sich her und gestaltete so<strong>mit</strong> das Gelände<br />
landeinwärts auf einem Streifen von 200 bis 300 Kilometern vollkommen<br />
um. In anderen Fällen tauchte die eine Platte unter die andere und<br />
hob den Mantel auf, die Folge waren langanhaltende Perioden vulkanischer<br />
Aktivitäten und Erdbeben. Manchmal wurden bei den Kollisionen Gesteinsschichten<br />
durchstoßen, als würden Karten neu gemischt.<br />
Die Versuchung liegt nahe, sich diesen Vorgang als gigantischen Zusammenstoß<br />
zweier Autos vorzustellen, aber natürlich geschah das alles <strong>mit</strong><br />
unendlicher Langsamkeit. Der protoatlantische Ozean, der Urozean, der<br />
während einer der ersten Spaltungen der Landmasse den Raum zwischen<br />
den Kontinenten ausfüllte, sieht auf den Darstellungen der meisten Lehrbücher<br />
immer wie eine zufällige Pfütze aus – in Abbildung 9A noch vorhanden,<br />
in Abbildung 9B verschwunden, als wäre für einen Tag die Sonne<br />
herausgekommen und hätte das Wasser verdunsten lassen –, dennoch existierte<br />
er viel länger, 100 Millionen Jahre länger als der Atlantische Ozean,<br />
so wie wir ihn kennen. Das gleiche gilt für die Entstehung der Berge. Würde<br />
man sich in eine der Phasen der Gebirgsbildung der Appalachen zurückversetzen,<br />
würde man auch nicht merken, daß große geologische Veränderungen<br />
vor sich gingen, genauso wenig wie wir heute spüren, daß Indien<br />
sich in einen Teil Asiens bohrt – wie ein Lastwagen, der sich selbständig<br />
gemacht hat, in eine Schneeverwehung – und den Himalaja Jahr für Jahr um<br />
etwa einen Millimeter anhebt.<br />
Kaum waren die Berge aufgetürmt, fingen sie auch schon ebenso unvermeidlich<br />
an zu erodieren. Trotz ihrer scheinbaren Beständigkeit sind Berge<br />
höchst vergängliche landschaftliche Merkmale. In seinem Buch Physik in<br />
der Berghütte: Von Gipfeln, Gletschern und Gesteinen rechnet der Autor<br />
und Geologe James S. Trefil vor, daß ein durchschnittlicher Gebirgsbach<br />
jährlich 28 Kubikmeter Bergmasse abträgt, meist in Form von Sandgranulat<br />
und anderen Schwebepartikeln. Das entspricht ungefähr der Lademenge<br />
eines durchschnittlichen Muldenkippers – nicht allzu viel. Man stelle sich
vor, so ein Kipper führe einmal im Jahr am Fuß eines Berges vor, nähme<br />
eine einzige Ladung auf, führe davon und käme erst nach zwölf Monaten<br />
wieder. Bei dem Tempo erscheint es fast unmöglich, einen ganzen Berg auf<br />
diese Weise abzutragen – steht jedoch genügend Zeit zur Verfügung, geschieht<br />
genau das. Angenommen, der Berg ist 1.500 Meter hoch und hat<br />
eine Gesteinsmasse von 14 Milliarden Kubikmetern – das entspricht ungefähr<br />
der Größe des Mount Washington – dann könnte ein einziger Gebirgsbach<br />
ihn in 500 Millionen Jahren dem Erdboden gleichmachen.<br />
Natürlich gibt es in den meisten Gebirgen mehrere Bäche darüber hinaus<br />
sind Berge noch einer breiten Palette anderer Faktoren ausgesetzt, die zu<br />
einer Reduzierung ihrer Masse führen, angefangen bei den säurehaltigen<br />
Sekreten von Flechten – geringe Mengen, die aber sehr wirkungsvoll sind –<br />
bis hin zum Abrieb durch Eisschichten. Die meisten Berge verschwinden<br />
daher sehr viel schneller, ungefähr in zwei statt in 500 Millionen Jahren.<br />
Gegenwärtig schrumpfen die Appalachen durchschnittlich um 0,03 Millimeter<br />
pro Jahr. Sie haben diesen Zyklus mindestens schon zweimal durchlaufen,<br />
wahrscheinlich aber sogar mehr als zweimal – erst zu enormen Höhen<br />
erhoben, dann auf Null abgetragen und anschließend wieder erhoben,<br />
wobei die Komponenten, aus denen sie sich zusammensetzten, jedesmal in<br />
einem äußerst komplizierten geologischen Verfahren recycelt wurden.<br />
Die Details dieser Entwicklung sind reine Theorie, versteht sich. Nur sehr<br />
wenig gilt als allgemein gesicherte Erkenntnis. Manche Wissenschaftler<br />
sind der Ansicht, die Appalachen hätten noch eine frühere, vierte Gebirgsbildungsphase<br />
durchlaufen, die Grenville Orogenese, und daß es davor noch<br />
mehr gegeben haben könnte. Ebenso kann sich Pangäa nicht nur dreimal<br />
aufgespalten und wieder vereinigt haben, sondern ein dutzend- oder vielleicht<br />
hundertmal. Darüber hinaus gibt es einige Ungereimtheiten in dieser<br />
Theorie, allen voran die Tatsache, daß kaum direkte Hinweise auf eine<br />
Kollision der Kontinentalplatten existieren, was seltsam, ja unerklärlich ist,<br />
wenn man davon ausgeht, daß sich mindestens drei Kontinente über einen<br />
Zeitraum von 150 Millionen Jahren <strong>mit</strong> enormen Kräften ihren jeweiligen<br />
Plattenrand abgeschliffen haben. Zu erwarten wäre eine Art Nahtstelle, eine<br />
Schicht von Schrammspuren, die sich an der östlichen Meeresküste der<br />
Vereinigten Staaten befinden müßte. Diese Schicht gibt es jedoch nicht.<br />
Ich bin kein Geologe. Man braucht mir nur ein ungewöhnliches Stück<br />
Grauwacke oder einen hübschen Brocken Gabbro zu präsentieren, und ich<br />
betrachte ihn andachtsvoll und höre mir höflich die dazugehörigen Erläuterungen<br />
an, aber eigentlich sagen sie mir überhaupt nichts. Wenn man mir<br />
erklärt, das sei früher einmal Schlick auf dem Meeresboden gewesen, der<br />
durch einen unglaublichen, fortlaufenden Prozeß tief ins Erdinnere gedrückt,<br />
dort Millionen Jahre geknetet, gebacken und anschließend an die
Oberfläche geschleudert worden sei, was die herrlichen Furchen, die leuchtenden,<br />
vitrophyrischen Kristalle und das schuppige, biotische Glimmern<br />
erkläre, kann ich nur antworten: »Meine Güte! Sagen Sie bloß!« Aber ich<br />
könnte nicht behaupten, daß ich dabei irgend etwas Spektakuläres empfinden<br />
würde.<br />
Nur gelegentlich ist mir ein Einblick in die Wunderwelt der Geologie vergönnt.<br />
Delaware Water Gap ist ein solcher Ort. Hier ragt der Kittatinny<br />
Mountain über dem ruhigen Delaware River auf, eine Wand aus Stein, 400<br />
Meter hoch, aus widerstandsfähigem Quarzit, der freigelegt wurde, als sich<br />
der gleichmäßige, gemächliche Wasserlauf auf seinem Weg zum Meer eine<br />
Passage durch weicheres Gestein suchte. Das Ergebnis ist ein Querschnitt<br />
durch einen Berg und ein Anblick, den man nicht alle Tage geboten bekommt,<br />
jedenfalls -wüßte ich nicht, wo man so etwas entlang des Appalachian<br />
Trail sonst noch bewundern könnte. Und dieser hier ist besonders<br />
eindrucksvoll, weil der freigelegte Quarzit in langen, wellenförmigen Streifen<br />
angeordnet ist, die in einem so schrägen Winkel zueinander liegen –<br />
etwa 45 Grad - daß selbst ein <strong>mit</strong> bescheidener Phantasie ausgestatteter<br />
Mensch begreift, daß sich hier etwas Grandioses zugetragen hat, geologisch<br />
gesehen.<br />
Es ist ein wunderschöner Anblick. Vor 100 Jahren wurde er <strong>mit</strong> dem Rhein<br />
verglichen und sogar <strong>mit</strong> den Alpen, was ich ein wenig übertrieben finde.<br />
Der Maler Georges Innes kam hierher und malte sein berühmtes Bild »Delaware<br />
Water Gap«. Es zeigt den Fluß, der sich träge durch wiesenartige<br />
Felder schlängelt, in denen vereinzelt Bäume und Farmhäuser stehen; fern<br />
im Hintergrund ragen herbstlich gefärbte Hügel auf, in die ein V eingekerbt<br />
ist, durch das der Delaware fließt. Es sieht aus wie eine Landschaft in Yorkshire<br />
oder Cumbria, die auf den amerikanischen Kontinent verpflanzt worden<br />
ist. Um die Mitte des letzten Jahrhunderts erhob sich ein stolzer Bau am<br />
Flußufer, das Hotel Kittatinny House <strong>mit</strong> 250 Zimmern, das so erfolgreich<br />
war, daß sehr schnell weitere Hotels folgten. Für die Dauer einer Generation<br />
nach dem Bürgerkrieg war der Delaware Water Gap der beliebteste Ferienort<br />
der feineren Gesellschaft im Sommer. Dann wechselte – wie immer in<br />
solchen Fällen – die Mode, und die White Mountains waren angesagt, danach<br />
die Niagara-Fälle, dann die Catskills und schließlich die Disney Parks.<br />
Heute kommt fast niemand mehr nach Water Gap, um ein paar Tage zu<br />
bleiben. Noch immer drängen sich Menschenmassen hier, aber sie kommen<br />
<strong>mit</strong> Autos, halten an einem Rastplatz an, werfen kurz einen anerkennenden<br />
Blick auf die Sehenswürdigkeit, steigen wieder ein und fahren weiter.<br />
Leider muß man sich heute schon sehr anstrengen, um eine Vorstellung von<br />
der stillen Schönheit zu ergattern, die Innes einst so angezogen hat. Water<br />
Gap ist nicht nur die einzige Attraktion im Osten Pennsylvanias, die man als
spektakulär bezeichnen könnte, Water Gap ist in der Region der Poconos<br />
auch die einzige Lücke in den Appalachen, die sich dem Verkehr bietet.<br />
Folglich ist dieser schmale Landsockel vollgestopft <strong>mit</strong> Bundes- und Landstraßen,<br />
einer Eisenbahnlinie und einem Interstate Highway <strong>mit</strong> einer langen,<br />
phantasielosen Betonbrücke, über die ein endloser Strom von Lastwagen<br />
und Autos zwischen Pennsylvania und New Jersey hin und her fließt.<br />
McPhee hat in dem Buch In Suspect Terrain ein passendes Bild dafür gefunden:<br />
»Hier laufen Röhren zusammen, die zu einem Patienten auf einer<br />
Intensivstation führen.«<br />
Trotz alledem – Kittatinny Mountain, wie er sich auf der Seite von New<br />
Jersey über den Fluß erhebt, ist ein unwiderstehlicher Anblick, und man<br />
kann – das heißt, ich konnte es nicht, und schon gar nicht an jenem Tag –<br />
den Wunsch, ihn zu besteigen und von dort oben herabzusehen, kaum unterdrücken.<br />
Ich stellte meinen Wagen an einem Informationszentrum am<br />
Fuß des Berges ab und begab mich auf meinen Marsch durch den einladenden<br />
grünen Wald. Es war ein Morgen wie aus dem Bilderbuch: taufrisch<br />
und kühl, doch die Sonne und die laue Luft versprachen bereits Hitze für die<br />
Mittagsstunden; aber ich war früh genug dran, um einen Tagesausflug zu<br />
schaffen. Ich mußte das Auto erst am nächsten Tag wieder zu Hause in New<br />
Hampshire abliefern, aber ich war fest entschlossen, wenigstens eine ordentliche<br />
Tageswanderung zu machen, um einiges von dem Debakel, zu<br />
dem diese Reise für mich geworden war, wieder wettzumachen. Zum Glück<br />
hatte ich eine gute Wahl getroffen. Ich ging in<strong>mit</strong>ten von Hunderten Hektar<br />
herrlichen Waldes, den sich der Worthington State Forest und die Delaware<br />
Water Gap National Recreation Area <strong>mit</strong>einander teilten. Der Weg war<br />
gepflegt und gerade so steil, daß man das Gefühl bekam, ein gesundheitsförderndes<br />
Training zu absolvieren und sich keiner zwanghaften Quälerei<br />
zu unterziehen.<br />
Es kam noch ein weiterer Pluspunkt hinzu: Ich hatte ausgezeichnete Karten.<br />
Ich befand mich nämlich inzwischen kartographisch in den guten Händen<br />
der New York - New Jersey Trail Conference, deren Karten sehr detailliert<br />
und vierfarbig sind. Grün steht für Wald, Blau für Wasser, rot sind die<br />
Wanderwege, und die Beschriftung ist schwarz. Die Bezeichnungen sind<br />
klar und deutlich, die Karten haben einen vernünftigen Maßstab, 1:36.000,<br />
und sie enthalten alle Verbindungsstraßen und Nebenwanderwege. Es<br />
scheint so, als wollten die Kartographen, daß man jederzeit weiß, wo man<br />
sich gerade befindet, und daß man seine Freude an diesem Wissen hat.<br />
Ich kann gar nicht beschreiben, was für ein erhebendes Gefühl das ist, immer<br />
sagen zu können: »Ah, ja! Genau, das ist Dunnfield Creek.« Oder:<br />
»Das da unten muß Shawnee Island sein.« Wenn alle Karten des AT nur<br />
annähernd so gut wären, hätte ich deutlich mehr Freude an der Wanderung
gehabt – schätzungsweise 25 Prozent mehr. Es ging mir erst jetzt auf, daß<br />
meine Gleichgültigkeit gegenüber meiner Umgebung vorher schlicht und<br />
ergreifend daher rührte, daß ich nicht wußte, wo ich mich befand, gar nicht<br />
in der Lage war, es zu wissen. Jetzt konnte ich mich wenigstens orientieren,<br />
den Weg erahnen, in Kontakt treten <strong>mit</strong> einer sich verändernden und erfahrbaren<br />
Landschaft.<br />
Und so wanderte ich acht höchst angenehme Kilometer den Kittatinny hinauf<br />
zum Sunfish Pond, einem sehr hübschen, 16 Hektar großen See, umgeben<br />
von Wald. Unterwegs traf ich nur zwei andere Wanderer – beide waren<br />
Tagestouristen –, und wieder dachte ich mir, was für eine maßlose Übertreibung<br />
es ist zu sagen, der Appalachian Trail sei überlaufen. 30 Millionen<br />
Menschen leben im Umkreis von zwei Autostunden von Water Gap -New<br />
York liegt 110 Kilometer östlich, Philadelphia ein Stück weiter südlich –,<br />
und es war ein makelloser Sommertag. Der Wald in seiner majestätischen<br />
Schönheit gehörte trotzdem nur uns Dreien.<br />
Für den Trail-Wanderer Richtung Norden ist Sunfish Pond eine echte Neuheit,<br />
denn südlich von hier findet man keinen Bergsee in dieser Höhe. Tatsächlich<br />
ist er das erste glaziale Merkmal: Bis hierher reichte während der<br />
letzten Eiszeit die Eisdecke. Der weiteste Vorstoß in New Jersey liegt ungefähr<br />
16 Kilometer südlich von Water Gap, aber selbst hier, wo das Klima<br />
ein weiteres Vorrücken verhinderte, war die Eisdecke immer noch 600 Meter<br />
dick gewesen.<br />
Das muß man sich mal vorstellen – eine Wand aus Eis, über einen halben<br />
Kilometer hoch, und dahinter Zehntausende Quadratkilometer noch mehr<br />
Eis, lediglich durchbrochen von den Gipfeln der höchsten Berge. Wir vergessen<br />
meist, daß wir uns heute immer noch in einer Eiszeit befinden, bloß<br />
erleben wir sie hautnah nur während eines Teils des Jahres. Schnee, Eis und<br />
Kälte sind keine typischen Merkmale der Erde. Langfristig gesehen, ist die<br />
Antarktis eigentlich ein Dschungel. (Er hat nur gerade eine leichte Erkältung.)<br />
Auf dem Höhepunkt der Eiszeit, vor 20.000 Jahren, lag ein Drittel der<br />
Erde unter Eis, heute sind es immer noch zehn Prozent. In den letzten zwei<br />
Millionen Jahren hat es bestimmt ein Dutzend Eiszeiten gegeben, von denen<br />
jede etwa 100.000 Jahre dauerte. Die jüngste Intrusion, die Wisconsin-Eisdecke,<br />
erstreckte sich von den Polarregionen über weite Teile Europas und<br />
Nordamerikas, erreichte eine Dicke von bis zu 3.000 Meter und rückte <strong>mit</strong><br />
einer Geschwindigkeit von 120 Meter pro Jahr vor. Der Meeresspiegel sank<br />
um 140 Meter, da die Decke alle freien Wasserreservoirs der Erde in sich<br />
aufsaugte. Dann, vor 10.000 Jahren, fing die Decke an zu schmelzen und<br />
sich zurückzuziehen, nicht über Nacht, aber allmählich. Man hat bis heute<br />
keine Erklärung dafür. Sie hinterließ eine völlig umgestaltete Landschaft,<br />
schüttete Long Island, Cape Cod, Nantucket und den größten Teil von
Martha’s Vineyard auf, wo sich vorher nur Wasser befunden hatte, und hob<br />
neben vielen anderen auch die Becken der Great Lakes, der Hudson Bay<br />
und den kleinen Sunfish Pond aus. Jeder Quadratmeter der Landschaft nördlich<br />
von hier hat Narben, Kerben und andere Spuren der letzten Vereisung<br />
davongetragen – verstreute Felsbrocken, die sogenannten Findlinge, Moränen,<br />
Geschiebehügel, Bergseen, Kare. Ich betrat eine neue Welt.<br />
Über die vielen Eiszeiten der Erde weiß man nur sehr wenig - warum sie<br />
kamen, warum sie aufhörten, ob und wann sie wiederkommen. Eine interessante<br />
Theorie, wenn man an unsere gegenwärtige Sorge um die Erderwärmung<br />
denkt, besagt, daß die Eiszeiten nicht durch sinkende, sondern durch<br />
steigende Temperaturen entstanden sind. Warmes Wetter führe zu stärkerem<br />
Niederschlag, dieser wiederum zu einer dichteren Wolkendecke, was<br />
eine geringere Schneeschmelze in höheren Regionen zur Folge habe. Es<br />
braucht nicht allzu viel schlechtes Wetter, um eine Eiszeit auszulösen.<br />
Gwen Schultz bemerkt dazu in ihrem Buch Ice Age Lost: »Nicht die<br />
Schneemenge allein verursacht Eisdecken, sondern die Tatsache, daß der<br />
Schnee, und sei es noch so wenig, liegenbleibt.« Was den Niederschlag<br />
betrifft, führt sie weiter aus, sei die Antarktis »das trockenste Gebiet der<br />
Erde, trockener als jede Wüste«.<br />
Und noch ein weiterer interessanter Gedanke: Sollten sich heute wieder<br />
neue Gletscher bilden, dann könnten sie sich aus erheblich mehr Wasserreservoirs<br />
speisen als früher – Hudson Bay, die Great Lakes, die 100.000<br />
kleinen Seen in Kanada standen für die letzten Eisdecken noch nicht zur<br />
Verfügung – und würden viel schneller wachsen. Wie würden wir uns verhalten,<br />
sollten in naher Zukunft tatsächlich neue Gletscher vorrücken? Würden<br />
wir sie <strong>mit</strong> TNT oder gar Atomsprengköpfen beschießen? Das ist<br />
durchaus wahrscheinlich. Dabei sollten wir aber eines bedenken: 1964 wurde<br />
Alaska durch das schwerste, jemals in Nordamerika registrierte Erdbeben<br />
erschüttert, von 200.000 Megatonnen geballter Energie, was der zerstörerischen<br />
Kraft von 2.000 Atombomben entspricht. In Texas, 5.000 Kilometer<br />
entfernt, schwappte dabei das Wasser über die Ränder der Swimmingpools,<br />
in Anchorage sackte eine Straße sechs Meter tief ab. Das Erdbeben verwüstete<br />
60.000 Quadratkilometer Wildnis, der größte Teil davon vergletschert.<br />
Und welche Auswirkungen hatte das Erdbeben auf Alaskas Gletscher?<br />
Nicht die geringsten.<br />
Gleich hinter dem See befand sich ein Nebenwanderweg, der Garvey<br />
Springs Trail, der steil bergab, zu einer alten, asphaltierten Straße am Fluß<br />
entlangführte, direkt unterhalb von Tocks Island, und der mich in einem<br />
weiten Bogen zurück zu dem Informationszentrum bringen würde, wo ich<br />
mein Auto abgestellt hatte. Das waren sechseinhalb Kilometer, und es wur-
de langsam warm, aber die Straße war schattig und kaum befahren, drei Autos<br />
in einer Stunde, und so glich meine Wanderung einem gemütlichen<br />
Spaziergang, <strong>mit</strong> friedlichen Ausblicken über üppige Wiesen auf den Fluß.<br />
Nach amerikanischen Maßstäben ist der Delaware kein sonderlich beeindruckender<br />
Wasserlauf, aber ein Umstand ist charakteristisch für ihn. Es ist<br />
praktisch der letzte bedeutende Fluß in den Vereinigten Staaten, der nicht<br />
verbaut ist. Das mag manchen als ein unschätzbarer Gewinn erscheinen –<br />
ein Fluß, der so verläuft, wie die Natur ihn geschaffen hat. Eine Folge dieses<br />
unregulierten Verlaufs sind jedoch die regelmäßigen Überschwemmungen.<br />
1955 gab es eine Flut, die noch heute als »die große Flut« bezeichnet<br />
wird, wie Frank Dale in seinem ausgezeichneten Buch Delaware<br />
Diary feststellt. Im August – ironischerweise auf dem Höhepunkt einer der<br />
schlimmsten Dürreperioden seit Jahrzehnten – suchten nacheinander zwei<br />
Wirbelstürme den Bundesstaat North Carolina heim und brachten die Wetterverhältnisse<br />
an der gesamten Ostküste gehörig durcheinander. Der erste<br />
brachte in zwei Tagen 25 Zentimeter Niederschlag in die Region des Delaware<br />
River Valley Zwei Tage später gingen in weniger als 24 Stunden noch<br />
einmal 25 Zentimeter Regen in dem Tal nieder. In Camp Davis, einem<br />
Erholungsort, flüchteten 46 Menschen, meist Frauen und Kinder, vor den<br />
steigenden Wassermassen in das Hauptgebäude der Ferienanlage, zuerst ins<br />
Erdgeschoß, dann in den ersten Stock, und < schließlich auf den Dachboden.<br />
Doch es half nichts. Gegen Mitternacht rollte eine neun Meter hohe<br />
Flutwelle durch das Tal und riß das Gebäude <strong>mit</strong>. Erstaunlicherweise überlebten<br />
neun Menschen das Unglück.<br />
Brücken wurden weggefegt und Uferstädte überschwemmt, bevor der Tag<br />
zu Ende ging, war der Delaware River um 13 Meter gestiegen. Als der Pegelstand<br />
endlich fiel, waren 400 Menschen umgekommen und das gesamte<br />
Delaware Valley war verwüstet.<br />
Dann mischte sich das U.S. Army Corps of Engineers <strong>mit</strong> einem Plan in das<br />
schlammige Chaos, der den Bau eines Damms in Tocks Island vorsah, unweit<br />
der Stelle, an der ich mich gerade befand. Der Damm sollte nicht nur<br />
den Fluß zähmen, sondern es sollte auch ein neuer Nationalpark dabei entstehen,<br />
in dessen 3 Zentrum sich ein 65 Kilometer langer See für diverse<br />
Freizeitaktivitäten befinden sollte. 8.000 Anwohner wurden umgesiedelt.<br />
Das ganze Projekt war sehr unprofessionell vorbereitet. Einer der Vertriebenen<br />
war blind. Vielen Farmern wurde ihr Grund und Boden nur teilweise<br />
abgekauft, so daß manche zum Schluß <strong>mit</strong> Ackerland, aber ohne Haus –<br />
oder <strong>mit</strong> Haus, aber ohne Ackerland dastanden. Eine Frau, deren Familie<br />
dasselbe Stück Land seit dem 18. Jahrhundert bewirtschaftete, wehrte sich<br />
<strong>mit</strong> Händen und Füßen, als sie aus ihrem Haus getragen wurde – zur Freude<br />
der Zeitungsreporter und Fernsehteams.
Die Bauten des Army Corps of Engineers sind berüchtigt für ihre schlechte<br />
Qualität. Ein Damm über den Missouri River in Nebraska verschlammte so<br />
stark, daß ein widerlicher Schlick in die Kanalisation von Niobrara drang,<br />
was schließlich zur Zwangsevakuierung der Stadt führte. Einmal brach ein<br />
vom Corps of Engineers errichteter Damm in Idaho. Zum Glück geschah es<br />
in einem dünn besiedelten Gebiet, und es hatte eine Vorwarnung gegeben.<br />
Dennoch wurden viele Kleinstädte überschwemmt, und elf Menschen verloren<br />
ihr Leben. Aber das waren alles kleine Dämme. Mit dem Bau von Tocks<br />
Island wäre eines der größten Wasserreservoires der Welt entstanden, die<br />
Wassermassen des 65 Kilometer langen Sees hätten gegen das Bauwerk<br />
gedrückt. Flußabwärts befanden sich vier große Städte, Trenton, Camden,<br />
Wilmington, Philadelphia und Hunderte kleinerer Gemeinden. Eine Katastrophe<br />
am Delaware hätte alles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt.<br />
Und jetzt schickte sich das rührige Army Corps of Engineers an, 950 Millionen<br />
Kubikmeter Wasser <strong>mit</strong> Moränenschutt zu stauen, der berüchtigt ist<br />
für seine Instabilität. Darüber hinaus gab es umweltpolitische Bedenken –<br />
zum Beispiel würde der Salzgehalt im Boden unter dem Damm gefährlich<br />
steigen und das ökologische Gleichgewicht flußabwärts zerstören, von den<br />
Austernbänken der Delaware Bay ganz zu schweigen.<br />
Nach jahrelangem zunehmenden Widerstand, der nicht allein aus dem Delaware<br />
Valley kam, sondern sich darüber hinaus ausweitete, wurde der Plan<br />
1992 endlich auf Eis gelegt, aber bis dahin waren bereits Farmhäuser und<br />
ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht worden. Ein stilles, einsames,<br />
wunderschönes Tal, das sich in 200 Jahren kaum verändert hatte, war für<br />
immer verloren. »Für den AT ergab sich aus dem (aufgegebenen) Projekt<br />
ein Vorteil«, heißt es dazu im Appalachian Trail Guide to New York and<br />
New Jersey, »das vom Staat gekaufte Land für das geplante Naherholungsgebiet<br />
ist heute ein geschützter Korridor.«<br />
Solche Sprüche konnte ich allmählich nicht mehr hören. Ich weiß, daß der<br />
Appalachian Trail einem die Wildnis näherbringen soll, und ich sehe ein,<br />
daß es zahlreiche Gebiete gibt, wo der Eingriff des Menschen eine Tragödie<br />
bedeuten würde, aber manchmal, so wie hier, reagiert die ATC geradezu<br />
pathologisch auf menschlichen Kontakt. Ich hätte nichts dagegen gehabt,<br />
zur Abwechslung mal durch ein Dörfchen zu wandern, vorbei an Farmen,<br />
statt durch einen totenstillen »geschützten Korridor«.<br />
Zweifellos hat das alles <strong>mit</strong> unserem historisch begründeten Drang, die<br />
Wildnis zu zähmen und auszubeuten, zu tun, aber Amerikas Einstellung zur<br />
Natur ist in vieler Hinsicht sehr sonderbar. Ich konnte nicht umhin, meine<br />
Erfahrungen auf dem AT <strong>mit</strong> einer anderen Wanderung zu vergleichen, die<br />
ich ein paar Jahre zuvor durch Luxemburg gemacht hatte, und zwar im Auftrag<br />
einer Zeitschrift und zusammen <strong>mit</strong> meinem Sohn. Luxemburg eignet
sich hervorragend zum Wandern, besser als man denkt. Es gibt viel Wald,<br />
aber auch Burgen, Bauernhäuser, Dörfer <strong>mit</strong> Kirchtürmen und romantische<br />
Flußtäler – Europa im Paket sozusagen. Die Wanderwege, die wir entlanggingen,<br />
führten hauptsächlich durch Wald, tauchten aber in Abständen wieder<br />
daraus hervor und verliefen über sonnenbeschienene Nebenstraßen, über<br />
Zauntritte durch Felder und Weiler. Irgendwann im Laufe des Tages kamen<br />
wir immer an einer Bäckerei oder einer Post vorbei, hörten die Türglocke<br />
eines Ladens bimmeln und konnten Gesprächen lauschen, von denen wir<br />
kein Wort verstanden. Jeden Abend kehrten wir in einer Pension ein und<br />
aßen in einem Restaurant, saßen zusammen <strong>mit</strong> anderen Leuten an einem<br />
Tisch. Wir lernten Luxemburg kennen, nicht nur seine Bäume. Es war herrlich,<br />
und zwar deswegen, weil die reizende kleine Besichtigung nahtlos und<br />
mühelos in die Wandertour überging und umgekehrt.<br />
In Amerika dagegen ist die Schönheit der Natur zu diversen Ausflugszielen<br />
verkommen, die man <strong>mit</strong> dem Auto aufsucht. Und was die Natur selbst<br />
betrifft, heißt es entweder/oder – entweder macht man sie sich gnadenlos<br />
Untertan, wie im Fall von Tocks-Damm und in tausend anderen Fällen, oder<br />
man vergöttert sie als etwas Heiliges, Entrücktes, Losgelöstes, wie den Appalachian<br />
Trail. Selten kommt ein Vertreter der einen oder anderen Seite auf<br />
die Idee, daß Mensch und Natur auch zusammengehen können, zu beiderseitigem<br />
Vorteil, daß eine elegantere Brücke über den Delaware River, um<br />
nur ein Beispiel zu nennen, die grandiose Umgebung erst richtig zur Geltung<br />
bringen kann, oder daß der AT interessanter und attraktiver sein könnte,<br />
wenn er nicht ausschließlich durch die Wildnis verliefe, sondern wenn er<br />
den Wanderer ab und zu auch mal an weidenden Kühen oder bestellten<br />
Feldern vorbeiführte.<br />
Ich hätte es viel schöner gefunden, wenn im AT-Führer zu lesen gewesen<br />
wäre: Dank den Bemühungen der Conference konnte im Delaware River<br />
Valley der Ackerbau wieder eingeführt und der Wanderweg neu verlegt<br />
werden, so daß er jetzt 25 Kilometer Uferweg umfaßt, denn ehrlich gesagt:<br />
Manchmal kann man auch von Bäumen genug haben.<br />
Trotzdem sollte man das Positive hervorheben. Wenn es nach dem Army<br />
Corps of Engineers gegangen wäre, müßte ich jetzt zu meinem Auto zurückschwimmen,<br />
und ich war dankbar, daß mir wenigstens das erspart<br />
blieb.<br />
Auf jeden Fall wurde es höchste Zeit für mich, mal wieder richtig zu wandern.
16. Kapitel<br />
1983 behauptete ein Mann steif und fest, ihm sei beim Wandern in den<br />
Berkshire Hills in Massachusetts, ein Stück abseits des Appalachian Trail,<br />
ein Berglöwe über den Weg gelaufen. Das klang beunruhigend und gleichzeitig<br />
unglaubwürdig, war doch seit 1903, als das letzte Exemplar dieser<br />
Gattung im Staat New York erschossen worden war, in den USA kein Berglöwe<br />
mehr gesichtet worden.<br />
Bald kamen aus allen Teilen New Englands ähnlich lautende Berichte. Ein<br />
Mann hatte auf einer Nebenstraße in Vermont zwei junge Tiere auf einer<br />
Böschung spielen sehen, vor zwei anderen Wanderern war ein Muttertier<br />
<strong>mit</strong> zwei Jungen über eine Wiese in New Hampshire spaziert. Jedes Jahr<br />
gab es ein halbes Dutzend oder noch mehr ähnlich lautende Berichte, und<br />
alle stammten von glaubwürdigen Zeugen. Im Winter 1994 ging ein Farmer<br />
in Vermont über seinen Hof, um Futter in eine Vogelkrippe zu streuen, als<br />
er in etwa 20 Meter Entfernung drei Berglöwen entdeckte. Er sah die Tiere<br />
minutenlang wie versteinert an – Berglöwen sind geschickte und gefährliche<br />
Raubtiere, und hier standen gleich drei, die ihn <strong>mit</strong> ruhigem Blick musterten<br />
–, dann raste er zum nächsten Telefon und meldete seine Beobachtung<br />
einem Biologen der staatlichen Tierschutzbehörde. Die Tiere waren bei<br />
der Ankunft des Mannes natürlich längst verschwunden, aber der Biologe<br />
fand frischen Kot, den er pflichtbewußt eintütete und an das U.S. Fish and<br />
Wildlife Laboratory schickte. Der Laborbefund bestätigte, daß es sich tatsächlich<br />
um die Hinterlassenschaft eines Felis concolor handelte, eines<br />
östlichen Berglöwen, der verschiedentlich und ehrerbietig auch als Panther,<br />
Silberlöwe, Puma und, vor allem in New England, als Wildkatze bezeichnet<br />
wird.<br />
Diese Meldungen fanden mein lebhaftes Interesse, denn ich wanderte gerade<br />
unweit der Stelle, an der so eine Kreatur zum ersten Mal gesehen worden<br />
war. Ich war <strong>mit</strong> neuem Eifer, neuer Entschlossenheit und einem neuen Plan<br />
wieder auf den Appalachian Trail zurückgekehrt. Ich hatte mir vorgenommen,<br />
durch New England zu wandern oder jedenfalls so viele Kilometer der<br />
Strecke zu absolvieren, wie ich schaffen konnte, bis Katz in sieben Wochen<br />
wieder dazustoßen und <strong>mit</strong> mir die Hundred Mile Wilderness in Maine<br />
abgehen würde. In New England führt der Trail fast 1.120 Kilometer weit<br />
über wunderschöne bergige Wanderwege; das ist knapp ein Drittel der Gesamtlänge<br />
des AT, und es reichte, um mich bis August zu beschäftigen. Zu<br />
diesem Zweck brachte mich meine hilfsbereite Frau <strong>mit</strong> dem Auto in den<br />
Südwesten von Massachusetts und setzte mich für meine dreitägige Tour<br />
durch die Berkshires an einer Stelle des Trails unweit von Stockbridge ab.<br />
Genau da also befand ich mich an einem heißen Junimorgen, stapfte schwit-
zend eine steile, aber an sich bescheidene Erhebung, Becket Mountain,<br />
hinauf. Während ein Schwarm abwehr<strong>mit</strong>telresistenter Mücken mich umschwirrte,<br />
faßte ich in meine Tasche, um zu überprüfen, ob mein Messer<br />
noch da war.<br />
Ich rechnete eigentlich nicht da<strong>mit</strong>, einem Berglöwen zu begegnen, aber<br />
erst am Tag zuvor hatte ich in einem Artikel im Boston Globe gelesen, daß<br />
sich Berglöwen im Westen – wo sie definitiv noch nicht ausgerottet sind –<br />
in letzter Zeit in den Wäldern von Kalifornien vermehrt an Wanderer und<br />
Jogger heranpirschten und sie töteten. Es traf sogar den unvermeidlichen<br />
armen Kerl, der <strong>mit</strong> Schürze und lustigem Hütchen an seinem Grill im Garten<br />
stand. Das kam mir wie ein böses Omen vor.<br />
Es ist durchaus möglich, daß Berglöwen in New England unentdeckt überlebt<br />
haben. Rotluchse, die zugegebenermaßen erheblich kleiner sind als<br />
Berglöwen, gibt es wieder in beträchtlicher Zahl, aber die Tiere halten sich<br />
versteckt und sind so scheu, daß man ihre Existenz kaum wahrnimmt. Viele<br />
Ranger kriegen während ihres gesamten Berufslebens kein einziges Exemplar<br />
zu Gesicht, und in den Wäldern im Osten Amerikas finden große Wildkatzen<br />
genügend Platz, um ungehindert herumstreunen zu können. Allein in<br />
Massachusetts gibt es 100.000 Hektar Wald, davon entfallen 40.000 auf die<br />
attraktiven Berkshires. Von meinem augenblicklichen Standort aus hätte<br />
ich, festen Willen und einen unerschöpflichen Nudelvorrat vorausgesetzt,<br />
bis nach Cape Chidley im nördlichen Quebec durchwandern können, 2.900<br />
Kilometer weit bis zur eiskalten Labrador Sea, und kaum je unter dem<br />
schützenden Dach der Bäume hervorzutreten brauchen. Dennoch ist es<br />
höchst unwahrscheinlich, daß von einer so großen Wildkatzenart genug<br />
Exemplare überlebt haben, um sich nicht nur in einem überschaubaren Gebiet,<br />
sondern in ganz New England unbemerkt über neun Jahrzehnte hinweg<br />
fortzupflanzen. Dennoch gab es den von einem Biologen untersuchten Kot.<br />
Und der stammte zweifelsohne von einem Berglöwen.<br />
Die plausibelste Erklärung für die Existenz der Löwen draußen im Wald<br />
war, daß es sich dabei um ausgesetzte Haustiere handelte, die unüberlegt<br />
gekauft worden waren und die man später wieder loswerden wollte. Ich<br />
hätte also noch Glück, wenn mich ein Tier <strong>mit</strong> Flohhalsband und Impfpaß<br />
anfallen würde. Ich stellte mir vor, ich läge auf dem Rücken, würde gerade<br />
genüßlich verspeist und könnte dabei auf der über mir baumelnden Hundemarke<br />
lesen: »Ich heiße Mr. Bojangles. Wer mich findet, ruft bitte Tanya<br />
und Vinny an, Telefon: 924-4667«<br />
Wie die meisten großen Tiere – und jede Menge kleinerer -wurde der Berglöwe<br />
im Osten ausgerottet, weil er als Plage galt. Bis 1940 gab es in vielen<br />
Bundesstaaten im Osten groß angekündigte »Kampagnen zur Schädlingsbekämpfung«,<br />
die häufig vom Amt für Naturschutz durchgeführt wurden. Das
Amt verteilte für jedes erlegte Raubtier, wozu fast alle Tierarten gehörten,<br />
zum Beispiel Habichte, Eulen, Eisvögel, Adler und praktisch jedes größere<br />
Säugetier, Siegerpunkte an die Jäger. West Virginia vergab sogar jährlich<br />
ein Universitätsstipendium an den Studenten, der die meisten Tiere erlegte;<br />
andere Bundesstaaten belohnten die Schützen großzügig <strong>mit</strong> Auszeichnungen<br />
und Bargeld. Mit vernünftigem Tierschutz hatte das wenig zu tun.<br />
Pennsylvania gab in einem Jahr 90.000 Dollar an Prämien für die Tötung<br />
von 130.000 Eulen und Adlern aus, um den Farmern geschätzte Verluste<br />
ihres Viehbestandes in der nicht gerade gigantischen Höhe von 1.875 Dollar<br />
zu ersparen – es kommt schließlich nicht alle Tage vor, daß eine Eule eine<br />
Kuh reißt.<br />
Noch bis 1890 zahlte der Staat New York Prämien für 107 erlegte Berglöwen,<br />
und innerhalb von zehn Jahren war das Tier praktisch ausgerottet. Der<br />
letzte wildlebende Berglöwe im Osten wurde 1920 in den Smokies erschossen.<br />
Der amerikanische Wolf und das Karibu oder nordamerikanische Rentier<br />
wurden ebenfalls in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts aus ihrem<br />
letzten Refugium in den Appalachen vertrieben, gefolgt vom Schwarzbären.<br />
Im Jahre 1900 war der Bestand an Bären in New Hampshire, der heute<br />
wieder auf über 3.000 angewachsen ist, auf gerade mal 50 gesunken.<br />
Es gibt immer noch jede Menge Leben draußen in den Wäldern, aber es<br />
sind vorwiegend kleine Tiere. Einer repräsentativen Schätzung des Ökologen<br />
V E. Shelford von der Umversity of Illinois zufolge leben in den Wäldern<br />
im Osten Amerikas auf einer Fläche von 25 Quadratkilometern durchschnittlich<br />
300.000 Säugetiere – 220.000 Mäuse und andere kleine Nager,<br />
63.500 Eichhörnchen, gestreifte und ungestreifte, 470 Hirsche und Rehe, 30<br />
Füchse und fünf Schwarzbären.<br />
Die großen Verlierer in dieser Region sind die Singvögel. Der schmerzlichste<br />
Verlust war sicher der des Carolina-Sittichs, eines herrlichen, harmlosen<br />
Vogels, der als wildlebendes Tier zahlenmäßig ursprünglich nur noch von<br />
der in unvorstellbaren Mengen vorhandenen Wandertaube übertroffen wurde.<br />
(Als die ersten Siedler nach Amerika kamen, gab es schätzungsweise<br />
neun Milliarden Wandertauben – mehr als doppelt so viel wie alle Vögel<br />
zusammengenommen, die heute in Amerika zu finden sind.) Beide Arten<br />
wurden durch exzessives Jagen ausgerottet – die Wandertaube aus purer<br />
Lust der Jäger, gleich Dutzende von Vögeln beim ziellosen Herumballern<br />
vom Himmel zu holen.<br />
Außerdem dienten die Tiere als Schweinefutter. Der Carolina-Sittich hatte<br />
keine Chance, weil er das Obst der Farmer fraß und auffallende Federn<br />
besaß, die als Hutschmuck bei den Damen Gefallen fanden. 1914 verendeten<br />
in einem Abstand von nur wenigen Wochen die letzten beiden Vertreter<br />
dieser Gattung in Gefangenschaft.
Ein ähnliches Schicksal ereilte die entzückende Bachman-Grasmücke. Der<br />
ohnehin seltene Vogel soll einen der lieblichsten Gesänge gehabt haben.<br />
Jahrelang war das Tier nicht aufzuspüren, dann entdeckten 1914 zufällig<br />
zwei Vogelfänger unabhängig voneinander innerhalb von zwei Tagen je ein<br />
Exemplar. Beide erschossen ihre Beute – saubere Arbeit, Jungs! –, und<br />
da<strong>mit</strong> war es um die Bachman-Grasmücke geschehen. Es ist anzunehmen,<br />
daß noch andere Vögel von der Bildfläche verschwanden, ohne daß es überhaupt<br />
jemand bemerkt hat. John James Audubon hat zum Beispiel drei<br />
Vogelarten gemalt – den kleinköpfigen Fliegenschnäpper, die Mönchsgrasmücke<br />
und die Blue-Mountain-Grasmücke –, die seitdem nicht wieder gesichtet<br />
wurden. Das gleiche gilt für die Townsend-Ammer, von der es nur<br />
ein ausgestopftes Exemplar im S<strong>mit</strong>hsonian Institute in Washington gibt.<br />
Zwischen 1940 und 1980 ging der Bestand der Zugsingvögel im Osten der<br />
Vereinigten Staaten um 50 Prozent zurück (was größtenteils auf den Verlust<br />
von Brutplätzen und anderen lebenswichtigen Winterquartieren in Lateinamerika<br />
zurückzuführen ist); er sinkt manchen Schätzungen zufolge pro<br />
Jahr um weitere drei Prozent. 70 Prozent aller Vogelarten haben seit den<br />
60er Jahren Bestandsverluste erlitten.<br />
Heutzutage herrscht ziemliches Schweigen im Wald.<br />
Am späten Nach<strong>mit</strong>tag trat ich aus dem dichten Wald auf eine Forststraße,<br />
die offenbar nicht mehr in Benutzung war. Mitten auf der Straße stand ein<br />
alter Mann <strong>mit</strong> Rucksack und einem merkwürdigen, verwirrten Ausdruck<br />
im Gesicht, als wäre er soeben aus einer Trance erwacht und wüßte nicht,<br />
wie er hierher geraten wäre. Ein ganzer Schwärm Mücken umkreiste ihn.<br />
»Können Sie mir sagen, wo der Trail weitergeht?« fragte er mich. Eine<br />
seltsame Frage, denn es war klar und deutlich zu erkennen, daß er einfach<br />
auf der anderen Seite weiterging. Direkt vor uns tat sich ein etwa ein Meter<br />
breiter Durchgang zwischen den Bäumen auf, und sollten noch Zweifel<br />
bestehen, leuchtete auf einer kräftigen Eiche die weiße Markierung des AT.<br />
Ich wedelte zum tausendsten Mal an diesem Tag <strong>mit</strong> der Hand vor meinem<br />
Gesicht herum, um die Mücken zu verscheuchen, und deutete <strong>mit</strong> einem<br />
Kopfnicken auf den Durchgang. »Ich würde sagen, da.«<br />
»Ach so, ja«, erwiderte er. »Natürlich.«<br />
Wir traten gemeinsam den Weg durch den Wald an und unterhielten uns<br />
darüber, wo wir heute morgen aufgebrochen waren, was unser Ziel war und<br />
so weiter. Er war ein Weitwanderer, der erste, den ich so weit im Norden<br />
traf, und wollte, wie ich, heute noch bis nach Dalton. Er trug die ganze Zeit<br />
über eine unschlüssige, erstaunte Miene zur Schau und musterte die Bäume<br />
auf eigentümliche Weise, betrachtete sie immer wieder von oben bis unten,<br />
als hätte er so etwas noch nie in seinem Leben gesehen.
»Wie heißen Sie?« fragte ich ihn.<br />
»Die Leute sagen Chicken John zu mir.«<br />
»Chicken John!« Chicken John war eine Berühmtheit. Ich war ziemlich<br />
aufgeregt. Manche Leute auf dem Trail erlangen wegen irgendeiner besonderen<br />
Eigenart einen geradezu mythischen Status. Am Anfang unserer<br />
Wanderung hörten Katz und ich zum Beispiel dauernd von einem jungen<br />
Mann, der eine absolute Hightech-Ausrüstung besaß, wie man sie bislang<br />
noch nie gesehen hatte, unter anderem ein Zelt, das sich von allein aufstellte.<br />
Offenbar brauchte man nur einen Beutel zu öffnen, und es flog heraus,<br />
wie ein Schachtelteufelchen aus seinem Karton. Außerdem hatte er noch ein<br />
Satellitennavigationsgerät und verschiedenen anderen Hokuspokus. Das<br />
einzige Problem war, daß sein Kucksack am Ende über 40 Kilo wog. Er<br />
mußte aufgeben, bevor er Virginia erreicht hatte, deswegen haben wir ihn<br />
nie gesehen. Im Jahr zuvor hatte sich Woodrow Murphy, der dicke Wanderer,<br />
ähnlichen Ruhm erworben. Mary Ellen wäre diese Ehre sicher auch<br />
zuteil geworden, wenn sie nicht schon längst aufgegeben hätte. Dieses Jahr<br />
war also Chicken John dran – aber ich konnte mich beim besten Willen<br />
nicht mehr an den Grund dafür erinnern. Es war Monate her, daß ich in<br />
Georgia das erste Mal von ihm gehört hatte.<br />
»Woher kommt der Name Chicken John?« fragte ich ihn.<br />
»Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht«, sagte er, als hätte er sich die Frage<br />
auch schon oft gestellt.<br />
»Wann sind Sie losgegangen?«<br />
»Am 27 Januar.«<br />
»Am 27 Januar?« sagte ich leise erstaunt und rechnete rasch im Kopf nach.<br />
»Das sind ja fast fünf Monate.«<br />
»Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen«, sagte er <strong>mit</strong> gespieltem Gram.<br />
Er war seit fast einem halben Jahr unterwegs und hatte gerade erst Dreiviertel<br />
der Strecke nach Katahdin zurückgelegt.<br />
»Wieviel -«, ich wußte nicht recht, wie ich mich ausdrücken sollte – »wie<br />
viele Kilometer laufen Sie am Tag, John?«<br />
»Ach, 22 bis 23, wenn alles klappt. Allerdings« – er sah mich scheel an –<br />
»verlaufe ich mich oft.«<br />
Genau. Das war’s. Chicken John verlief sich andauernd und kam an den<br />
unmöglichsten Stellen heraus. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man sich<br />
auf dem Appalachian Trau verirren kann. Er ist der am deutlichsten und<br />
besten markierte Wanderpfad, den man sich vorstellen kann. Gewöhnlich ist<br />
es der Teil des Waldes, wo keine Bäume stehen. Wer zwischen Bäumen und<br />
einer langen, offenen Schneise unterscheiden kann, der dürfte keine<br />
Schwierigkeiten haben, sich auf dem AT zurechtzufinden. Wo auch nur die<br />
geringsten Unsicherheiten auftreten könnten, wenn der AT etwa auf einen
Nebenwanderweg stößt oder eine Straße kreuzt, finden sich immer gut<br />
sichtbare Markierungen. Trotzdem verirren sich manche Leute: die berühmte<br />
Grandma Gatewood zum Beispiel, die unterwegs dauernd irgendwo anklopfte<br />
und sich erkundigte, wo sie sich denn gerade befände.<br />
Ich fragte Chicken John, wie weit der längste Umweg war, den er mal gelaufen<br />
ist.<br />
»60 Kilometer«, sagte er geradezu stolz. »Ich bin auf dem Blood Mountain<br />
in Georgia vom Trail abgekommen – ich weiß bis heute nicht, wie ich das<br />
geschafft habe – und bin drei Tage lang im Wald herumgeirrt, bis ich an<br />
einen Highway kam. Ich dachte schon, jetzt hätte ich mich endgültig ausgetrickst.<br />
Ich landete schließlich in Tallulah Falls, mein Foto kam sogar in die<br />
Zeitung. Die Polizei hat mich am nächsten Tag zurück an den Trail gebracht<br />
und mir die richtige Richtung gezeigt. Die waren wirklich nett.«<br />
»Stimmt es, daß Sie einmal drei Tage hintereinander in die falsche Richtung<br />
gelaufen sind?«<br />
Er nickte zufrieden lächelnd. »Zweieinhalb Tage, um genau zu sein. Zum<br />
Glück kam ich am dritten Tag in eine Stadt, und ich fragte jemanden: Entschuldigen<br />
Sie, junger Mann. Wo bin ich hier?< und er antwortete: >Na, wo<br />
schon? In Damascus, Virginia, Sir.< Ich dachte, hm, komisch, ich war doch<br />
gerade vor drei Tagen in einem Ort <strong>mit</strong> genau demselben Namen. Und dann<br />
habe ich die Feuerwache wiedererkannt.«<br />
»Wie kann man sich bloß -« Ich beschloß, die Frage anders zu formulieren.<br />
»Warum passiert Ihnen das so oft, John?«<br />
»Tja, wenn ich das wüßte, würde ich mich wohl nicht mehr verlaufen«,<br />
sagte er <strong>mit</strong> einem leisen Lachen. »Ich weiß nur, daß ich ab und zu weit<br />
vom Weg abkomme und irgendwo lande, wo ich gar nicht hinwollte. Andererseits<br />
macht es das Leben auch interessant. So habe ich viele nette Leute<br />
kennengelernt, und ich bin oft zum Essen eingeladen worden. Entschuldigen<br />
Sie«, unterbrach er abrupt, »gehen wir auch bestimmt in die richtige<br />
Richtung.«<br />
»Ganz bestimmt.«<br />
Er nickte. »Heute würde ich mich nämlich höchst ungern verlaufen, denn in<br />
Dalton gibt es ein Restaurant.« Das konnte ich gut verstehen. Wenn man<br />
sich schon verirren mußte, dann wenigstens nicht an einem Tag, an dem ein<br />
Restaurantbesuch auf dem Programm stand.<br />
Wir gingen die letzten zehn Kilometer gemeinsam, aber wir redeten nicht<br />
mehr viel <strong>mit</strong>einander. Ich wollte heute meine 30 Kilometer schaffen, die<br />
längste Etappe, die ich je auf meiner Wanderung laufen sollte, und obwohl<br />
die Strecke keine besonderen Schwierigkeiten aufwies und mein Rucksack<br />
recht leicht war, war ich am späten Nach<strong>mit</strong>tag rechtschaffen müde. John<br />
schien ganz zufrieden zu sein, jemanden zu haben, dem er nachlaufen konn-
te, und außerdem hatte er ja genug da<strong>mit</strong> zu tun, die Bäume zu betrachten.<br />
Es war bereits nach sechs Uhr, als wir in Dalton ankamen. John hatte die<br />
Adresse eines Mannes in der Depot Street, der Wanderer in seinem Garten<br />
kampieren ließ, die Dusche sollte man auch benutzen dürfen, und so trabte<br />
ich <strong>mit</strong> John zur nächsten Tankstelle, um nach dem Weg zu fragen. Als wir<br />
aus dem Verkaufsraum traten, ging John genau in die entgegengesetzte<br />
Richtung los.<br />
»Hier geht’s lang, John«, sagte ich.<br />
»Natürlich«, stimmte er mir zu. »Übrigens heiße ich Bernard. Ich weiß auch<br />
nicht, wo die Leute den Namen Chicken John herhaben.«<br />
Ich nickte und versprach ihm, am nächsten Tag auf ihn aufzupassen, aber<br />
ich habe ihn nie wieder gesehen.<br />
Ich verbrachte die Nacht in einem Motel und wanderte am nächsten Tag<br />
weiter nach Cheshire. Es waren nur 14 Kilometer über leichtes Gelände,<br />
aber die Kriebelmücke machte den Weg zu einer einzigen Strapaze. Ich<br />
habe noch nirgendwo eine wissenschaftliche Bezeichnung für diese winzigen,<br />
bösartigen geflügelten Wesen gefunden, ich weiß daher nur, daß sie<br />
massenhaft in der Luft schweben, daß sie einen auf Schritt und Tritt begleiten,<br />
in die Ohren eindringen, in den Mund und selbst in die Nasenlöcher.<br />
Menschlicher Schweiß versetzt sie in orgiastische Ekstase, und Insektenspray<br />
scheint ihre Erregung nur noch zu steigern. Sie sind besonders unbarmherzig,<br />
wenn man zwischendurch mal stehenbleibt, um etwas zu trinken<br />
– so unbarmherzig, daß man schließlich gar nicht mehr anhält und<br />
gleich im Gehen trinkt und danach einen ganzen Mundvoll von diesen Viechern<br />
ausspuckt. Es ist die Hölle auf Erden. Mit einiger Erleichterung verließ<br />
ich daher am frühen Nach<strong>mit</strong>tag ihre waldreichen Jagdgründe und trottete<br />
in das sonnige, träge Örtchen Cheshire.<br />
In Cheshire gab es freie Unterkunft für Wanderer in der Kirche auf der<br />
Main Street. Massachusetts tut überhaupt viel für seine Wanderer, jedenfalls<br />
bin ich häufig an Häusern vorbeigekommen, an denen draußen ein Schild<br />
<strong>mit</strong> der Aufforderung hing, sich doch bitte bei den Apfelbäumen im Garten<br />
zu bedienen, Wasser dürfe man sich auch holen. Ich hatte jedoch keine Lust<br />
auf eine Nacht in einem Etagenbett, noch weniger auf endlose Nach<strong>mit</strong>tagsstunden<br />
ohne eine Beschäftigung, deswegen ging ich weiter bis nach Adams,<br />
6,5 Kilometer über einen knallheißen Highway, aber wenigstens <strong>mit</strong><br />
der Aussicht auf ein Bett in einem Motel und eine Auswahl an Restaurants.<br />
In Adams gab es nur ein Motel, eine Absteige am Stadtrand. Ich nahm mir<br />
ein Zimmer und verbrachte den restlichen“ Nach<strong>mit</strong>tag da<strong>mit</strong>, in der Stadt<br />
herumzustreunen, guckte gelangweilt in die Schaufenster und stöberte in
den Bücherkisten eines Trödelladens. Es gab natürlich nichts Interessantes<br />
außer den üblichen Readers-Digest-Heften und dann ganz obskure Titel,<br />
wie man sie nur in solchen Läden findet: Das große Buch der häuslichen<br />
Kanalisation, oder Nick <strong>mit</strong> dem Kopf, wenn du mich verstehst – Das Leben<br />
<strong>mit</strong> einem Debilen. Danach ging ich ein Stück spazieren, aus der Stadt heraus,<br />
um einen Blick auf Mount Greylock zu werfen, mein Ziel für den nächsten<br />
Tag. Greylock ist die höchste Erhebung in Massachusetts und für Wanderer,<br />
die in Richtung Norden gehen, der erste Berg nach Virginia, der über<br />
900 Meter hoch ist. Es sind nur l .064 Meter bis zum Gipfel, aber da er von<br />
vielen niedrigeren Bergen umgeben ist, sieht er sehr viel gewaltiger aus,<br />
jedenfalls besitzt er etwas Majestätisches, das einen anzieht. Ich freute mich<br />
auf ihn.<br />
Ich brach am nächsten Morgen früh auf, bevor die Mittagshitze Gelegenheit<br />
hatte, sich richtig auszubreiten – ein glühendheißer Tag war vorhergesagt<br />
worden –, machte noch kurz Station in der Stadt, um mir mein Mittagessen<br />
zu kaufen, etwas zu trinken und ein Sandwich, und begab mich dann auf<br />
einen Schotterweg zum Gould Trail, einem Nebenwanderweg, der steil<br />
bergauf zum AT und weiter zum Greylock führte.<br />
Mount Greylock ist <strong>mit</strong> Sicherheit der literarischste Berg der Appalachen.<br />
Herman Melville, der auf der Farm Arrowhead an seiner Westseite lebte,<br />
hatte ihn vom Fenster seines Arbeitszimmers aus im Blick, während er an<br />
seinem Roman Moby Dick schrieb, und seine Umrisse erinnerten ihn an<br />
einen Wal, jedenfalls behaupten das Maggie Stier und Ron McAdow in<br />
ihrem ausgezeichneten Buch Into the Mountains, einer Geschichte der<br />
Berggipfel New Englands. Als Melville <strong>mit</strong> seinem Roman fertig war, stieg<br />
er zusammen <strong>mit</strong> Freunden auf den Gipfel und feierte bis in die Morgenstunden.<br />
Nathaniel Hawthorne und Edith Wharton lebten und arbeiteten<br />
ebenfalls in der Nähe. Eigentlich gibt es zwischen 1850 und 1920 keine in<br />
irgendeiner Art und Weise <strong>mit</strong> New England verbundene literarische Gestalt,<br />
die den Berg nicht wenigstens einmal bestiegen hat oder hinaufgeritten<br />
ist, um die Aussicht zu genießen.<br />
Ironischerweise erfreute sich Greylock auf dem Höhepunkt seines Ruhms<br />
keineswegs der grünen Erhabenheit von heute. Seine Hänge waren krätzig<br />
von den Narben der Abholzung, und die Ausläufer entstellt von Schiefer-<br />
und Marmorhalden. Überall stachen windschiefe Schuppen und Sägewerke<br />
ins Auge. Das alles ist heute verheilt und überwachsen, doch dann wurden<br />
in den 60er Jahren <strong>mit</strong> Unterstützung bundesstaatlicher Behörden in Boston<br />
Pläne für die Erschließung des Greylock als Skigebiet erstellt, <strong>mit</strong> einer<br />
Seilbahn, einem Netz von Sesselliften und einem Gebäudekomplex auf dem<br />
Gipfel, zu dem ein Hotel, Läden und Restaurants gehören sollten – allesamt<br />
in dem schnittigen Jetson-Stil der Zeit. Zum Glück wurde aus diesen Plänen
nichts. Heute erhebt sich der Greylock aus einem 4.700 Hektar großen Naturschutzgebiet.<br />
Er ist ein wirkliches Prachtstück.<br />
Der steile Aufstieg zum Gipfel war schweißtreibend und zog sich endlos<br />
lange hin, aber die Mühe lohnte sich. Das offene, sonnige Gipfelareal, auf<br />
dem ständig ein frischer Wind weht, krönt ein großes, hübsches Steinhaus,<br />
Bascom Lodge, das in den 30er Jahren von den unermüdlichen Kadern des<br />
Civilian Conservation Corps errichtet wurde. Heute beherbergt es ein Restaurant<br />
und Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer. Auf dem Gipfel<br />
befindet sich außerdem ein Leuchtturm, der dort liebenswert anachronistisch<br />
wirkt (Greylock ist 225 Kilometer von der Küste entfernt) und als<br />
Mahnmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus Massachusetts<br />
dient. Ursprünglich war der Turm für den Hafen von Boston gedacht,<br />
aber aus irgendeinem Grund steht er jetzt hier.<br />
Ich verzehrte mein <strong>mit</strong>gebrachtes Mittagessen, ging aufs Klo, wusch mich<br />
in der Lodge und eilte dann weiter, denn ich hatte noch 13 Kilometer zu<br />
laufen und war <strong>mit</strong> meiner Frau um vier Uhr in Williamstown verabredet.<br />
Auf den nächsten fünf Kilometern führte der Weg weitgehend über einen<br />
luftigen Grat, der den Greylock <strong>mit</strong> dem Mount Williams verbindet. Der<br />
Ausblick war spektakulär, über sanfte, grüne Hügel und hinauf bis zu den<br />
Adirondacks, zehn Kilometer weiter westlich, aber es war unglaublich heiß<br />
und selbst hier oben schwül und stickig. Hinzu kam der steile Abstieg, 914<br />
Meter auf fünf Kilometern, zum Glück durch dichten, kühlen, grünen Wald<br />
bis zu einer Nebenstraße, die weiter durch die offene schöne Landschaft<br />
führte.<br />
Außerhalb des Waldes war die Luft drückend. Es ging drei Kilometer über<br />
eine Straße ohne ein Fleckchen Schatten, und der Asphalt war so heiß, daß<br />
ich die Hitze durch meine Schuhsohlen hindurch spürte. Als ich schließlich<br />
in Williamstown ankam, zeigte das Thermometer an einer Bank 36 Grad<br />
Celsius an. Kein Wunder, daß ich so schwitzte. Ich überquerte die Straße<br />
und ging zu Burger King, wo wir uns verabredet hatten. Welch ein Genuß,<br />
aus der Affenhitze eines Sommertages in die kühle, keimfreie Frische eines<br />
klimatisierten Restaurants zu treten. Wenn es einen besseren Grund gibt,<br />
dankbar dafür zu sein, daß man im 20. Jahrhundert lebt, dann kenne ich ihn<br />
nicht.<br />
Ich holte mir ein großes Glas Cola, ließ mich an einem Tisch am Fenster<br />
nieder und fühlte mich durch und durch wohl. Ich hatte 27 Kilometer zurückgelegt,<br />
war bei sehr warmem Wetter über einen einigermaßen schwierigen<br />
Berg gestiegen. Ich war schmutzig, verschwitzt, verständlicherweise<br />
erledigt und stank so, daß sich die Leute nach mir umdrehten. Ich war wieder<br />
ein richtiger Wanderer.
1850 bestand New England zu 70 Prozent aus Ackerland und zu 30 Prozent<br />
aus Wald. Heute ist das Verhältnis genau umgekehrt. Wahrscheinlich gibt<br />
es in der entwickelten Welt keine Region, die in gerade mal einem Jahrhundert<br />
so dramatische Veränderungen erlebt hat, oder jedenfalls keine, die<br />
dem normalen Verlauf des Fortschritts zuwiderlaufen.<br />
Wenn man sich für den Beruf des Farmers entschieden hat, gibt es eigentlich<br />
kein ungeeigneteres Land als New England. Der Boden ist steinig, das<br />
Gelände steil und das Wetter so schlecht, daß die Leute regelrecht stolz<br />
darauf sind. Ein Jahr in Vermont besteht, einem alten Sprichwort zufolge,<br />
aus »neun Monaten Winter, gefolgt von drei Monaten <strong>mit</strong> schlechten Rodelbedingungen«.<br />
Bis Mitte des letzten Jahrhunderts überlebten die Farmer in New England<br />
nur wegen der Nähe zu den Küstenstädten Boston und Portland, und, so<br />
meine Vermutung, weil sie nichts anderes kannten. Dann geschahen zwei<br />
Dinge: erstens die Erfindung der McCormick-Mähmaschine, die sich ideal<br />
für die Bewirtschaftung der großen, kaum hügeligen Felder im Mittleren<br />
Westen eignete, aber auf den steinigen, schmalen Feldern New Englands<br />
völlig nutzlos war, und zweitens das Aufkommen der Eisenbahn, die den<br />
Farmern des Mittleren Westens die Möglichkeit gab, ihre Produkte praktisch<br />
ohne Zeitverlust in den Osten des Landes zu transportieren. Da konnten<br />
die New-England-Farmer nicht <strong>mit</strong>halten und wanderten vielfach in den<br />
Mittleren Westen ab. 1860 lebte fast die Hälfte aller in Vermont Gebürtigen<br />
woanders -200.000 von 450.000 Menschen.<br />
1840, während des Präsidentschaftswahlkampfs, hielt Daniel Webster auf<br />
dem Stratton Mountain in Vermont eine Rede vor 20.000 Menschen. 20<br />
Jahre später hätte er von Glück sagen können, wenn 50 Zuhörer gekommen<br />
wären. Stratton Mountain ist heute weitgehend von Wald bedeckt, nur wenn<br />
man genauer hinschaut, kann man hier und da noch Kellereingänge und die<br />
überwucherten Reste von Obstgärten erkennen, die sich in den schattigen<br />
»Untergeschossen« zwischen jüngeren, widerstandsfähigeren Birken, Ahorn-<br />
und Walnußbäumen behaupten. Überall in New England finden sich<br />
ehemalige, eingestürzte Einfriedungsmauern, häufig <strong>mit</strong>ten im dichtesten<br />
Wald, der aussieht, als stünde er schon seit Jahrhunderten da – ein Zeichen<br />
dafür, wie geschwind sich die Natur das Terrain zurückerobert.<br />
Ich erklomm Stratton Mountain an einem wolkenverhangenen, gnädigerweise<br />
kühlen Junitag. Es waren sechseinhalb Kilometer Fußweg zum Gipfel,<br />
der bei etwas über l .200 Meter liegt. In Vermont folgt der AT auf einer<br />
Länge von 160 Kilometern den Spuren des Long Trail, der sich über die<br />
höchsten und bedeutendsten Gipfel der Green Mountains bis hinauf nach<br />
Kanada zieht. Eigentlich ist der Long Trail sogar älter als der AT. Er wurde<br />
1921 eröffnet, in dem Jahr, als man den AT konzipierte, und einige Long-
Trail-Anhänger sollen noch heute auf den AT als einen ordinären und überehrgeizigen<br />
Parvenü herabschauen. Der Stratton Mountain wird jedenfalls<br />
stets als der geistige Geburtsort beider Pfade bezeichnet, denn hier hatten<br />
angeblich sowohl James E Taylor als auch Benton MacKaye ihre jeweiligen<br />
Eingebungen, die später zu dem Bau der beiden Fernwanderwege durch die<br />
Wildnis führten – Taylor 1909, MacKaye einige Zeit später.<br />
Nichts gegen Stratton Mountain, er ist ein herrlicher Berg <strong>mit</strong> prima Aussicht<br />
auf mehrere andere berühmte Gipfel – Equinox, Ascutney, Snow und<br />
Monadnock –, aber ich kann nicht behaupten, daß er mich dazu inspiriert<br />
hätte, mir eine Machete zu schnappen und einen Weg nach Georgia oder<br />
Quebec freizuschlagen. Vielleicht lag es an dem tristen, bedeckten Himmel<br />
und dem fahlen Licht, das allem einen öden, verwaschenen Anstrich gab.<br />
Acht, neun Leute standen verloren auf dem Gipfel herum, unter anderem<br />
ein etwas untersetzter junger Mann, der allein unterwegs war und eine<br />
Windjacke trug, die ziemlich teuer aussah. Er hielt ein kleines elektronisches<br />
Gerät in der Hand, <strong>mit</strong> dem er geheimnisvolle Messungen vornahm.<br />
Er sah, daß ich ihm zuschaute, und sagte in einem Ton, aus dem der dringliche<br />
Wunsch herauszuhören war, es möge endlich jemand sein Interesse<br />
bekunden: »Das ist ein Enviro Monitor.«<br />
»Ach ja?« erwiderte ich höflich.<br />
»Mit dem kann man acht Werte messen. Temperatur, UV-Index, Taupunkt,<br />
alles mögliche.« Er hielt die Anzeige etwas schräger, so daß ich sie auch<br />
ablesen konnte. »Das ist der Wert der Hitzebelastung.« Man sah irgendeine<br />
nichtssagende Zahl <strong>mit</strong> zwei Stellen hinterm Komma. »Sonneneinstrahlung<br />
kann es auch messen«, fuhr er fort, »Luftdruck, Windkälte, Regenmenge,<br />
Feuchtigkeit – Umgebungsfeuchtigkeit und aktive Feuchtigkeit –, sogar die<br />
Verbrennungszeit für den jeweiligen Hauttyp.«<br />
»Kann man da<strong>mit</strong> auch Plätzchen backen?« fragte ich.<br />
Er war beleidigt. »Es gibt Situationen, da kann einem so ein Ding das Leben<br />
retten, glauben Sie mir«, sagte er tapfer. Ich versuchte mir eine Situation<br />
vorzustellen, in der ich durch einen steigenden Taupunkt in Lebensgefahr<br />
geraten könnte – es gelang mir nicht. Ich wollte den Mann aber auch nicht<br />
vor den Kopf stoßen, also sagte ich: »Was ist das?« und zeigte auf eine<br />
blinkende Zahl in der linken oberen Ecke der Anzeige.<br />
»Ach das? Das weiß ich auch nicht. Aber das hier« – er hackte auf die Tasten<br />
–, »das ist die Sonneneinstrahlung.« Wieder eine nichtssagende Zahl,<br />
diesmal <strong>mit</strong> drei Stellen hinterm Komma. »Ziemlich niedrig heute«, stellte<br />
er fest und kippte den Schirm ein wenig, um den Wert noch mal abzulesen.<br />
»Ja, stimmt, sehr niedrig heute.« Irgendwie wußte ich das auch so. Ich<br />
konnte zwar keinen dieser Werte bis auf drei Stellen hinterm Komma angeben,<br />
aber ich hatte ein ganz gutes Gespür für die Wetterbedingungen,
einfach, weil ich mich im Freien befand. Interessanterweise hatte der Mann<br />
keinen Rucksack dabei, also auch keine Regenhaube, er trug Shorts und<br />
Turnschuhe. Sollte das Wetter umschlagen, und in New England konnte das<br />
in Sekunden geschehen, würde er wahrscheinlich umkommen, aber wenigstens<br />
hatte er dann ein Gerät dabei, das ihm seinen finalen Taupunkt anzeigte.<br />
Ich finde diesen ganzen technischen Krimskrams albern. Manche AT-<br />
Wanderer, hatte ich irgendwo gelesen, haben sogar Notebooks und Modems<br />
dabei, da<strong>mit</strong> sie jeden Tag Berichte an Familie und Freunde schicken können.<br />
Und zunehmend findet man Leute <strong>mit</strong> solchem elektronischen<br />
Schnickschnack wie dem Enviro Monitor oder <strong>mit</strong> Sensoren am Handgelenk,<br />
die den Puls messen. Das sieht aus, als kämen sie direkt von der<br />
Schlafklinik hierher auf den Trail.<br />
1996 erschien im Wall Street Journal ein köstlicher Artikel über die Plage<br />
der Satellitennavigation, der Handys und ähnlicher Geräte in der Wildnis.<br />
Diese Hightech-Ausrüstung, so scheint es, bringt Leute in die Berge, die<br />
vielleicht nicht dahingehören. Im Baxter State Park, berichtet das Journal,<br />
habe ein Wanderer eine Einheit der Nationalgarde angerufen und darum<br />
gebeten, <strong>mit</strong> einem Hubschrauber zum Mount Katahdin geflogen zu werden,<br />
er sei zu müde zum Wandern. Und auf dem Mount Washington hatten<br />
nach Angaben eines Mitarbeiters »zwei resolute Frauen« das Hauptquartier<br />
der Bergwacht angerufen und gesagt, sie würden die letzten l .500 Meter<br />
zum Gipfel nicht mehr schaffen, obwohl es noch vier Stunden bis zum Einbruch<br />
der Dunkelheit waren. Sie verlangten, eine Rettungsmannschaft solle<br />
sie zurück zu ihrem Wagen bringen. Die Bitte wurde abgewiesen. Ein paar<br />
Minuten später riefen sie wieder an und verlangten, daß man ihnen wenigstens<br />
Taschenlampen brachte. Auch diese Bitte wurde abgelehnt. Ein paar<br />
Tage später meldete sich ein anderer Hiker und verlangte einen Hubschrauber,<br />
er hinke schon einen Tag hinter seinem Zeitplan her und befürchte,<br />
einen wichtigen geschäftlichen Termin zu verpassen. In dem Artikel war<br />
auch von Leuten die Rede, die sich trotz Satellitennavigation verirrt hatten.<br />
Sie konnten haargenau ihre Position angeben, 36,2 Grad Nord, 17,48 Grad<br />
West oder so, hatten aber nicht den geringsten Schimmer, was das bedeutete,<br />
da sie weder Kompaß noch Karten dabei hatten und offenbar auch ihren<br />
Verstand zu Hause gelassen hatten. Meine Bekanntschaft auf dem Stratton<br />
hätte ganz gut in diesen Verein gepaßt. Ich fragte ihn, ob ein Abstieg bei<br />
einer Sonnenstrahlung von 18,574 ratsam sei.<br />
»Ja, ja«, antwortete er ganz ernsthaft. »Sonneneinstrahlungsmäßig besteht<br />
heute nur geringes Risiko.«<br />
»Da bin ich aber froh«, sagte ich, ebenfalls ganz ernsthaft und verabschiedete<br />
mich von ihm und dem Berg. Ich eroberte mir Vermont in mehreren
aufeinanderfolgenden, angenehmen Tagestouren, nicht <strong>mit</strong> irgendeinem<br />
elektronischen Gerät, sondern <strong>mit</strong> den Füßen und den köstlichen Lunchpaketen,<br />
die mir meine Frau jeden Abend vor dem Zubettgehen machte und<br />
im obersten Fach des Kühlschranks deponierte. Obwohl ich mir hoch und<br />
heilig geschworen hatte, nie wieder <strong>mit</strong> Hilfe des Autos meine Etappenwanderungen<br />
zu absolvieren, stellte sich heraus, daß das hier ganz angebracht<br />
war, ja, daß es mir sogar sehr entgegenkam. Ich konnte den ganzen<br />
Tag wandern und zum Abendessen wieder zu Hause sein. Ich konnte in<br />
meinem eigenen Bett schlafen und mich jeden Tag <strong>mit</strong> sauberer, trockener<br />
Kleidung und <strong>mit</strong> einem üppigen Lunchpaket auf den Weg machen. Es war<br />
eigentlich ideal.<br />
So kam es, daß ich drei -wunderbare Wochen lang zwischen den Bergen<br />
und meinem Haus hin und her pendelte. Ich stand jeden Morgen bei Sonnenaufgang<br />
auf, steckte mein Lunchpaket ein und fuhr über den Connecticut<br />
River nach Vermont. Ich stellte den Wagen ab und stieg einen hohen<br />
Berg hinauf oder stapfte über sanfte, grüne Hügel. Irgendwann, wenn mir<br />
danach war, meist gegen elf Uhr, setzte ich mich auf einen Stein oder<br />
Baumstumpf, holte mein Lunchpaket heraus und untersuchte erstmal den<br />
Inhalt. Und dann folgte je nachdem: »Hmm, Erdnußbutter! Meine Lieblingsplätzchen!«<br />
oder »Oh, lecker, heute wieder kalter Braten!« Ich biß<br />
gierig hinein, mummelte still vor mich hm und dachte an die vielen Berggipfel,<br />
die ich <strong>mit</strong> Katz erklommen hatte. Was hätten wir da nicht für so<br />
eine herzhafte Mahlzeit gegeben! Anschließend packte ich alles wieder<br />
ordentlich zusammen, verstaute es in meinem Rucksack und wanderte weiter,<br />
bis es Zeit wurde, Feierabend zu machen und nach Hause zu gehen. So<br />
vergingen die letzte Juni- und die ersten beiden Juliwochen.<br />
Ich erwanderte mir Stratton Mountain und Bromley Mountain, Prospect<br />
Rock und Spruce Peak, Baker Peak und Griffith Lake, White Rocks Mountain,<br />
Button Hill, Killington Peak, Gifford Woods State Park, Quimby<br />
Mountain, Thistle Hill und schlenderte zum Schluß gemütliche 17 Kilometer<br />
von West Hartford nach Norwich. Diese Wanderung führte vorbei an der<br />
Happy Hill Cabin, der ältesten und wahrscheinlich malerischsten Schutzhütte<br />
des AT – die kurz darauf von einigen Angestellten der Trail Conference,<br />
die für solche Sentimentalitäten nicht das geringste Verständnis haben,<br />
plattgemacht wurde. Norwich ist hauptsächlich deswegen erwähnenswert,<br />
weil die Stadt als Vorlage für die Bob Newhart Show diente (Bob Newhart<br />
betreibt in der Fernsehserie eine Kneipe, und die einheimischen Gäste sind<br />
alle auf liebenswerte Weise ein bißchen schlicht im Gemüt). Außerdem ist<br />
es die Heimatstadt von Alden Partridge, von dem nie ein Mensch gehört hat.<br />
Partridge wurde 1755 in Norwich geboren und war ein leidenschaftlicher<br />
Wanderer, vermutlich der erste Mensch auf der ganzen Welt, der aus purer
Freude auch weite Entfernungen zu Fuß zurücklegte. 1785 wurde er in dem<br />
für damalige Verhältnisse unerhört jugendlichen Alter von 30 Jahren Leiter<br />
von West Point. Dort wurde er allerdings in irgendeine Auseinandersetzung<br />
verwickelt und zog sich anschließend nach Norwich zurück, wo er ein Konkurrenzunternehmen<br />
gründete, die American Literary, Scientific and Military<br />
Academy Er prägte den Begriff physical education – Leibeserziehung,<br />
und er unternahm <strong>mit</strong> seinen entsetzten jungen Schülern Gewaltmärsche<br />
von 50, 60 Kilometern in den benachbarten Bergen. Zwischendurch begab<br />
er sich allein auf noch viel gewagtere Unternehmungen. Einmal ging er,<br />
was keine Ausnahme war, 180 Kilometer weit, von Norwich nach Williamstown,<br />
Massachusetts (ungefähr die Route, die ich gerade in gemütlichen<br />
Etappen absolviert hatte), stapfte den Mount Greylock hoch und spazierte<br />
den gleichen Weg wieder zurück nach Hause. Für die Wanderung hin und<br />
zurück brauchte er lediglich vier Tage – und das zu einer Zeit, das dürfen<br />
wir nicht vergessen, als es noch keine angelegten Wege und hilfreichen<br />
Markierungen gab. Auf diese Weise erklomm er praktisch jeden Gipfel in<br />
New England. Eigentlich hat er eine Gedenktafel in Norwich verdient, um<br />
die wenigen Wanderer, die noch Richtung Norden -weitergehen, moralisch<br />
aufzubauen, aber leider gibt es keine solche Tafel.<br />
Von Norwich sind es ungefähr anderthalb Kilometer zum Connecticut River.<br />
Eine angenehme, unauffällige Brücke aus den 30er Jahren führt zum<br />
Bundesstaat New Hampshire und der Stadt Hanover am gegenüberliegenden<br />
Ufer. Die Straße von Norwich nach Hanover war früher mal eine gewundene,<br />
zweispurige Allee – eine der typischen, verlockenden Verbindungsstraßen<br />
zwischen zwei, nur anderthalb Kilometer auseinanderliegenden<br />
alten Städtchen, wie man sie in New England erwartet. Dann kam<br />
irgendein Straßenbauer oder sonst jemand auf die grandiose Idee, die alte<br />
Landstraße zu einer breiten, mehrspurigen Schnellstraße auszubauen, da<strong>mit</strong><br />
sich die anderthalb Kilometer sagenhafte acht Sekunden schneller zurücklegen<br />
ließen und die Autofahrer keine Qualen mehr erlitten, weil sie warten<br />
mußten, wenn der Vordermann in eine Nebenstraße abbiegen wollte. Jetzt<br />
sollte es überall Ausfahrten geben, so groß, daß auch ein Schwertransporter<br />
<strong>mit</strong> Titanrakete um die Kurve käme, ohne die Bordsteinkante zu rammen<br />
oder den lebenswichtigen Verkehrsfluß zu stören.<br />
Die Straße wurde also zu einem breiten, schnurgeraden Highway ausgebaut,<br />
teilweise sechsspurig, <strong>mit</strong> Betonleitplanken in der Mitte und überdimensionalen<br />
Natriumdampflampen, die den Nachthimmel kilometerweit erleuchten.<br />
Der Bau hatte den Effekt, daß die Brücke zu einer Art Flaschenhals<br />
wurde, an der sich die Straße auf zwei Spuren verengte. Manchmal kamen<br />
zwei Autos gleichzeitig an der Brücke an, und einer mußte dem anderen die<br />
Vorfahrt lassen – man stelle sich das mal vor! Deshalb geht man jetzt, wäh-
end ich dies niederschreibe, gerade daran, diese überflüssig reizvolle, alte<br />
Brücke gegen eine andere, größere auszutauschen, die dem Betonzeitalter<br />
eher entspricht. Noch dazu wird die Straße verbreitert, die einen kleinen<br />
Hügel hinauf ins Stadtzentrum und zu dem hübschen, historischen Stadtpark<br />
von Hanover führt. Das bedeutet natürlich, daß die Bäume rechts und links<br />
der Straße gefällt und die meisten Vorgärten für den Bau von Stützmauern<br />
aus Beton drastisch verkürzt werden müssen. Selbst ein Angestellter des<br />
Straßenbauamtes müßte zugeben, daß das Ergebnis keineswegs vorzeigbar<br />
ist, nichts, was man gern vorn auf einen Fotokalender »Malerisches New<br />
England« drucken würde, aber es verkürzt eben die gefährliche Reise von<br />
Norwich nach Hanover noch mal um vier Sekunden, und nur darauf kommt<br />
es ja an.<br />
Das alles ist für mich nicht ohne Bedeutung, zum einen, weil ich in Hanover<br />
wohne, zum anderen, weil ich im 20. Jahrhundert lebe. Zum Glück verfüge<br />
ich über eine lebhafte Phantasie, so daß ich mir bei meinem Gang von Norwich<br />
nach Hanover keine mehrspurige, befahrene Schnellstraße vorstellte,<br />
sondern eine <strong>mit</strong> Bäumen, Hecken und Wildpflanzen bestandene, schattige<br />
Landstraße, geschmückt <strong>mit</strong> einer stattlichen Reihe wohlproportionierter<br />
Straßenlaternen, von denen jeweils kopfüber ein Angestellter des Straßenbauamtes<br />
baumelt. – Und sogleich fühlte ich mich viel besser.
17. Kapitel<br />
Von allen Gefahren, die einem draußen in der freien Natur zum Verhängnis<br />
werden können, ist keine so unheimlich und unvorhersehbar wie die Hypothermie.<br />
Es gibt fast keinen Fall von Kältetod, dem nicht in irgendeiner<br />
Hinsicht etwas Mysteriöses und Unwahrscheinliches anhaftet. David<br />
Quammen berichtet davon in seinem Buch Natural Acts.<br />
Im Spätsommer 1982 verbrachten vier Jugendliche und zwei Erwachsene<br />
ihren Urlaub im Banff National Park <strong>mit</strong> Kanufahren. Eines Abends kehrten<br />
sie nicht in ihr Zeltlager zurück. Am nächsten Morgen machte sich ein<br />
Suchtrupp auf den Weg und fand die Vermißten in ihren Schwimmwesten<br />
tot auf einem See treibend, <strong>mit</strong> dem Gesicht nach oben und unversehrt.<br />
Nichts an ihren Körpern deutete auf eine Notlage oder auf eine Panik hin.<br />
Einer der Männer trug sogar noch seine Mütze und seine Brille. Die Kanus,<br />
die unweit der Fundstelle auf dem Wasser schaukelten, waren unbeschädigt,<br />
und in der Nacht hatte ruhiges, mildes Wetter geherrscht. Aus einem unerklärlichen<br />
Grund hatten die sechs ihre Kanus verlassen und sich in voller<br />
Montur in das kalte Wasser des Sees gestürzt, wo sie umgekommen waren.<br />
»Als hätten sie sich friedlich schlafen gelegt«, wie sich ein Mitglied des<br />
Suchtrupps ausdrückte. In gewisser Weise traf das zu.<br />
Entgegen landläufiger Meinung sterben nur relativ wenige Hypothermieopfer<br />
in Extremsituationen, etwa, wenn sie sich in einem Schneesturm verirrt<br />
haben oder sich gegen beißende arktische Kälte wehren mußten. Zunächst<br />
einmal gehen nur relativ wenige Menschen bei so einem Wetter<br />
überhaupt vor die Tür, und wenn, dann sind sie im allgemeinen gut ausgerüstet.<br />
Die meisten Hypothermieopfer sterben auf viel banalere Weise, in<br />
gemäßigten Jahreszeiten und bei Temperaturen, die keineswegs nahe dem<br />
Nullpunkt liegen. In der Regel werden sie von einem unvorhergesehenen<br />
Ereignis oder gleich von mehreren, gleichzeitig eintretenden Veränderungen<br />
überrascht – plötzlicher Temperaturabfall, ein kalter Platzregen, die Erkenntnis,<br />
daß sie sich verirrt haben – für die sie psychisch und physisch<br />
mangelhaft ausgestattet sind. Fast immer komplizieren sie das Problem,<br />
indem sie eine Dummheit begehen – sie verlassen einen gut markierten<br />
Weg, um eine Abkürzung zu suchen, und geraten dabei nur noch tiefer in<br />
den Wald, wenn es angebrachter gewesen wäre, an einer Stelle zu bleiben;<br />
sie waten durch Flüsse, wodurch sie nur naß werden und ihr Körper noch<br />
stärker unterkühlt wird.<br />
Dieses traurige Schicksal ereilte auch Richard Salinas, der 1990 zusammen<br />
<strong>mit</strong> einem Freund im Pisgah National Forest in North Carolina wanderte.<br />
Von der plötzlich einsetzenden Dämmerung überrascht, machten sie sich<br />
auf den Rückweg zu ihrem Wagen, wurden unterwegs aber aus irgendeinem
Grund getrennt. Salinas war ein erfahrener Hiker, er brauchte nur den gut<br />
gekennzeichneten Wanderweg entlang zurück zum Parkplatz zu gehen. Er<br />
ist nie dort angekommen. Drei Tage später fand man zuerst seine Jacke und<br />
seinen Rucksack, kilometerweit vom Weg entfernt, tief im Wald. Seine<br />
Leiche wurde zwei Monate später entdeckt, aufgespießt von Ästen in dem<br />
kleinen Linville River. Vermutlich hatte er den Pfad auf der Suche nach<br />
einer Abkürzung verlassen, sich verirrt, war immer tiefer in den Wald hineingestürmt,<br />
in Panik geraten, weitergelaufen, bis schließlich die Hypothermie<br />
ihn seiner Sinne beraubte.<br />
Hypothermie ist eine Art schleichendes, heimtückisches Trauma. Es überkommt<br />
einen buchstäblich schrittweise: Die Körpertemperatur sinkt, und<br />
die natürlichen Reaktionen werden schwerfällig und unkoordiniert. In diesem<br />
Zustand hat Salinas seine Ausrüstung abgelegt und wenig später aus<br />
lauter Verzweiflung die unvernünftige Entscheidung getroffen, den durch<br />
Regenwasser angeschwollenen Fluß zu durchqueren. Unter normalen Umständen<br />
hätte er erkannt, daß ihn das nur noch weiter vom Ziel entfernte. In<br />
der Nacht, als er sich verirrte, war es trocken bei etwa fünf Grad Celsius.<br />
Wenn er seine Jacke anbehalten hätte und nicht ins Wasser gestiegen wäre,<br />
hätte er eine kalte, ungemütliche Nacht verbracht und später etwas zu erzählen<br />
gehabt. Statt dessen verlor er sein Leben.<br />
Ein Mensch, der unter Hypothermie leidet, durchläuft mehrere aufeinanderfolgende<br />
Phasen, beginnend – wie unschwer zu erraten ist – <strong>mit</strong> einem<br />
leichten und zunehmend heftiger werdenden Zittern des Körpers, der versucht,<br />
durch Muskelkontraktionen Wärme zu erzeugen; danach folgt äußerste<br />
Erschöpfung, Trägheit in den Bewegungen, ein gestörtes Gefühl für Zeit<br />
und Entfernungen und eine zunehmend hoffnungslose Verwirrtheit, die aus<br />
dem Unvermögen heraus, das Naheliegende zu erkennen, zu unüberlegten<br />
und unlogischen Entscheidungen führt. Das Opfer verliert allmählich immer<br />
mehr die Orientierung und erliegt gefährlichen Halluzinationen – einschließlich<br />
der grausamen Fehleinschätzung, daß es nicht friert, sondern geradezu<br />
verbrennt. Viele Opfer reißen sich deshalb die Kleider vom Leib,<br />
werfen die Handschuhe fort oder kriechen aus ihren Schlafsäcken. Die Annalen<br />
der Todesfälle bei Wanderungen sind voller Geschichten von halbnackten,<br />
in Schneeverwehungen direkt vor ihrem Zelt aufgefundenen Hikern.<br />
In dieser Phase hört der Schüttelfrost auf, denn der Körper hat längst<br />
aufgegeben, und Apathie setzt ein. Der Herzschlag verlangsamt sich, und<br />
die Gehirnwellen sehen aus wie eine Autospur durch die Prärie. Selbst wenn<br />
das Opfer in diesem Zustand noch gefunden würde, wäre der Wiederbelebungsschock<br />
für den Körper möglicherweise nicht mehr zu verkraften.<br />
Dies wurde in einem Bericht der Zeitschrift Outside im Januar 1997 auf<br />
anschauliche Weise verdeutlicht. 1980 sendeten 16 dänische Seeleute einen
Funknotruf aus, zogen sich Schwimmwesten über und sprangen in die<br />
Nordsee, während ihr Schiff vor ihren Augen im Meer versank. Anderthalb<br />
Stunden lang waren sie ein Spiel der Wellen, bevor ein Rettungsschiff endlich<br />
in der Lage war, sie aus den Fluten zu ziehen. Selbst im Sommer ist die<br />
Nordsee von einer so mörderischen Kälte, daß ein Mensch in ihr innerhalb<br />
einer halben Stunde den Tod findet. Daher war das Überleben aller 16 Seeleute<br />
wahrlich ein Grund zum Feiern. Die Männer wurden in Decken eingewickelt<br />
und in die Messe nach unten gebracht, wo man ihnen ein heißes<br />
Getränk verabreichte, woraufhin sie tot umfielen – alle 16.<br />
Genug der fesselnden Anekdoten, setzen wir uns einmal sozusagen persönlich<br />
<strong>mit</strong> dieser faszinierenden Krankheit auseinander.<br />
Ich war jetzt in New Hampshire, was mich sehr freute, da wir erst kürzlich<br />
hierhergezogen waren und ich natürlich ein besonderes Interesse daran<br />
hatte, Land und Leute kennenzulernen. Vermont und New Hampshire liegen<br />
so eng beieinander und sind sich so ähnlich, was Größe, Klima und<br />
Dialekt angeht, und darin, wo<strong>mit</strong> sich die Bewohner ihren Lebensunterhalt<br />
verdienen – hauptsächlich Wintersport und Tourismus –, daß sie häufig als<br />
Zwillinge apostrophiert werden. In Wahrheit sind sie grundverschieden. Mit<br />
Vermont verbindet man Volvos und Antiquitätenläden und Landgasthäuser<br />
<strong>mit</strong> putzigen Namen, Quail Hollow Lodge und Fiddlehead Farm Inn. Mit<br />
New Hampshire dagegen verbindet man Männer <strong>mit</strong> Jagdmützen und Pickups<br />
<strong>mit</strong> Aufklebern und markigen Sprüchen: »Freiheit oder Tod.« Auch die<br />
Landschaft unterscheidet sich grundlegend. Die Berge in Vermont gleichen<br />
eher sanften, lieblichen Hügelketten, und die Vielzahl der Farmen, die sich<br />
auf Milchwirtschaft spezialisiert haben, verleiht dem Bundesstaat etwas<br />
insgesamt Menschenfreundlicheres. New Hampshire dagegen ist ein einziger<br />
großer Wald. Von den insgesamt 24.097 Quadratkilometern des Staatsgebietes<br />
sind knapp 85 Prozent – eine Fläche, die größer ist als Wales –<br />
Wald, der Rest besteht entweder aus Seen oder liegt oberhalb der Baumgrenze.<br />
Abgesehen von einigen Städten und Wintersportgebieten hier und<br />
da ist New Hampshire im großen und ganzen die pure Wildnis – manchmal<br />
geradezu beängstigend wild. Die Berge hier sind höher, zerklüfteter,<br />
schwieriger zu erklimmen und gefährlicher als die in Vermont.<br />
Im Thru-Hiker’s Handbook, dem einzigen unverzichtbaren Führer für den<br />
Appalachian Trail, wie ich an dieser Stelle mal erwähnen sollte, bemerkt<br />
der große Dan »Wingfoot« Bruce hierzu, daß der Wanderer, der von Süden<br />
nach Norden geht, bei Überschreiten der Staatsgrenze von Vermont nach<br />
New Hampshire vier Fünftel der Wegstrecke, aber erst die Hälfte der Mühsal<br />
geschafft hat. Allein auf dem Abschnitt in New Hampshire, der 260<br />
Kilometer durch die White Mountains führt, befinden sich 35 Berggipfel,<br />
die über 900 Meter aufragen. New Hampshire ist also ein ganz schöner
Brocken.<br />
Ich hatte so viel über die ungestümen und gefährlichen White Mountains<br />
gelesen, daß mir bei dem Gedanken, mich allein in das Gebiet zu wagen,<br />
unwohl war – nicht, daß ich es <strong>mit</strong> der Angst zu tun bekommen hätte, aber<br />
wenn ich noch eine einzige Geschichte über die Flucht vor einem Bären<br />
gehört hätte, wäre ich soweit gewesen. Man kann sich daher meine heimliche<br />
Freude vorstellen, als mein Freund und Nachbar <strong>Bill</strong> Abdu mir anbot,<br />
mich auf einigen meiner Tagestouren zu begleiten. <strong>Bill</strong> ist ein sehr netter<br />
Zeitgenosse, liebenswert und kenntnisreich, ein erfahrener Wanderer <strong>mit</strong><br />
dem unschätzbaren Vorzug, obendrein noch ein geschickter orthopädischer<br />
Chirurg zu sein – genau das, was man in der gefährlichen Wildnis braucht.<br />
Ich rechnete zwar nicht da<strong>mit</strong>, daß seine Chirurgenhände von großem Nutzen<br />
sein würden, aber sollte ich stürzen und mir das Rückgrat brechen, dann<br />
erführe ich wenigstens noch die lateinische Bezeichnung dafür.<br />
Wir beschlossen, <strong>mit</strong> dem Mount Lafayette anzufangen, und begaben uns zu<br />
diesem Zweck an einem klaren Julimorgen in aller Frühe zu dem zwei Autostunden<br />
entfernt gelegenen Franconia Notch Park (»notch« bedeutet im<br />
Sprachgebrauch von New Hampshire Bergpaß). Das ist ein berühmtes,<br />
wunderschönes Fleckchen Erde zu Füßen imposanter Gipfel, <strong>mit</strong>ten im<br />
283.000 Hektar großen White Mountain National Forest gelegen. Der<br />
Mount Lafayette – das sind 1.599 Meter steil aufragender, unbarmherziger<br />
Granitfels. In einem Reisebericht von 1870, der in dem Buch Into the<br />
Mountains zitiert wird, heißt es: »Mt. Lafayette… ist ein wahrer Alptraum,<br />
<strong>mit</strong> Gipfeln und Spitzen, auf denen Blitz und Donner ihr Spiel treiben. Die<br />
Hänge sind braun und weisen Schrammen und tiefe Spalten auf.« Stimmt.<br />
Lafayette ist ein Monster. Nur der nahegelegene Mount Washington übertrifft<br />
ihn noch an Wuchtigkeit und Beliebtheit als Wanderziel in den White<br />
Mountains.<br />
Von der Talsohle gerechnet mußten wir 1.130 Meter erklimmen, 600 Meter<br />
auf den ersten drei Kilometern und drei kleinere Gipfel unterwegs – Mount<br />
Liberty, Little Haystack und Mount Lincoln –, aber es war ein herrlicher<br />
Morgen, die Sonne schien nicht zu heiß, und uns umgab die belebende,<br />
pfefferminzklare, saubere Luft, die es nur in den Bergen des Nordens gibt.<br />
Kurz: alles, was man für einen makellosen Tag braucht. Wir gingen ungefähr<br />
drei Stunden, redeten wegen des steilen Anstiegs nur wenig, freuten<br />
uns bloß darüber, draußen im Freien zu sein und gut voranzukommen.<br />
Jeder Wanderführer, jeder erfahrene Hiker, jede Informationstafel neben<br />
den Parkplätzen am Ausgangs- oder Zielort einer Wanderstrecke warnt<br />
davor, daß das Wetter in den White Mountains innerhalb von Sekunden<br />
umschlagen kann. Camper, die in kurzen Hosen und <strong>mit</strong> Turnschuhen in<br />
luftigen Höhen nur einen Spaziergang machen wollten und wenige Stunden
später in dichtem, eiskalten Nebel ihrem Tod entgegentaumeln – das sind<br />
Geschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählt, aber sie sind leider auch<br />
wahr. Wenige hundert Meter unterhalb des Gipfels von Little Haystack<br />
Mountain passierte uns das gleiche. Urplötzlich war die Sonne verschwunden,<br />
und wie aus dem Nichts rollte eine Dunstwolke zwischen den Bäumen<br />
heran. Da<strong>mit</strong> ging ein so rapider Temperatursturz einher, als hätten wir<br />
einen Kühlraum betreten. Innerhalb von Minuten war der Wald in Nebel<br />
gehüllt, feucht und kühl. Die Baumgrenze in den White Mountains liegt an<br />
manchen Stellen bereits bei 1.460 Meter, halb so hoch wie in den meisten<br />
anderen Regionen, weil die Witterung sehr viel strenger ist, und jetzt sah ich<br />
auch warum. Als wir aus dem Krummholz hervortraten, die Zone aus verkrüppelten<br />
Bäumen, die den letzten Ausläufer des Waldes vor der Baumgrenze<br />
markiert, und das kahle Dach des Little Haystack betraten, schlug<br />
uns <strong>mit</strong> einem Mal ein heftiger Wind entgegen – die Sorte Wind, die einem<br />
die Mütze vom Kopf reißt und sie ein paar hundert Meter weiterweht, bevor<br />
man überhaupt dazu kommt, eine Hand zu heben. Vorher war er durch den<br />
Berg über uns auf den geschützten Westhang abgelenkt worden, aber jetzt<br />
fegte er ungehindert über den bloßliegenden Gipfel. Wir stellten uns in den<br />
Windschatten einiger Felsen, um unsere Regencapes überzuziehen. Sie<br />
spendeten uns zusätzliche Wärme, denn ich war schon von der schweißtreibenden<br />
Anstrengung und der feuchten Luft ganz naß am Körper – ein ziemlich<br />
unangenehmer Zustand, wenn die Außentemperaturen sinken und der<br />
Wind jede Körperwärme wegbläst. Ich machte meinen Rucksack auf, wühlte<br />
in meinen Sachen herum und schaute dann <strong>mit</strong> jenem Gesichtsausdruck<br />
hoch, der <strong>mit</strong> einer bestürzenden Erkenntnis einhergeht: Ich hatte mein<br />
Regencape vergessen. Ich durchwühlte noch einmal meinen Rucksack, aber<br />
es war ja kaum etwas drin – eine Karte, ein dünner Pullover, eine Wasserflasche<br />
und ein Lunchpaket. Ich überlegte kurz und erinnerte mich <strong>mit</strong> einem<br />
innerlichen Stoßseufzer daran, daß ich das Regencape ein paar Tage<br />
vorher ausgepackt, im Keller zum Lüften aufgehängt und dann vergessen<br />
hatte, es wieder einzupacken.<br />
<strong>Bill</strong>, der das Band an der Kapuze seiner Windjacke strammzog, sah zu mir<br />
herüber. »Ist irgendwas?«<br />
Ich sagte es ihm. Er machte ein besorgtes Gesicht. »Willst du umkehren?«<br />
»Nein, nein.« Das wollte ich wirklich nicht. Außerdem, so schlimm war es<br />
nun auch wieder nicht. Es regnete nicht, mir war nur ein bißchen kühl. Ich<br />
zog den Pullover an und fühlte mich gleich besser. Wir schauten beide auf<br />
die Karte: Wir hatten schon fast alle Gipfel erklommen, und zum Lafayette<br />
waren es nur zweieinhalb Kilometer entlang eines Grats, danach folgte ein<br />
steiler 360 Meter tiefer Abstieg zur Greenleaf Hut, einer Berghütte <strong>mit</strong> einer<br />
Cafeteria. Wenn ich mich aufwärmen mußte, dann schien es ratsamer wei-
terzugehen. Die Hütte würden wir viel schneller erreichen als den acht Kilometer<br />
entfernten Parkplatz, wo unser Auto stand.<br />
»Willst du auch bestimmt nicht umkehren?«<br />
»Nein.« Ich beharrte darauf. »Wir sind in einer halben Stunde da.«<br />
Wir machten uns wieder auf den Weg durch die graue Suppe und den peitschenden<br />
Wind, überquerten den l .554 Meter hohen Mount Lincoln und<br />
stiegen dann ein Stück zu einem sehr schmalen Grat ab. Die Sicht betrug<br />
jetzt keine fünf Meter, und es wehte ein messerscharfer Wind. Die Temperatur<br />
sinkt alle 300 Höhenmeter um etwa 1,8 Grad Celsius; in dieser Höhe<br />
wäre es also ohnehin kälter gewesen, aber jetzt war es richtig ungemütlich.<br />
Ich sah <strong>mit</strong> Entsetzen, daß sich Hunderte kleiner Wassertropfen auf meinem<br />
Pullover ansammelten, die allmählich durch das Gewebe drangen und sich<br />
<strong>mit</strong> der Feuchtigkeit des Hemdes darunter vereinigten. Ehe wir auch nur<br />
einen halben Kilometer zurückgelegt hatten, war der Pullover klitschnaß<br />
und hing schwer auf meinen Schultern und an den Armen.<br />
Zu allem Unglück trug ich auch noch Jeans. Jeder wird einem bestätigen,<br />
daß Blue Jeans das ungeeignetste Kleidungsstück für eine Wanderung sind.<br />
Ich hatte mich dennoch zu einem Fan von diesen Hosen entwickelt, weil sie<br />
strapazierfähig sind und einen ganz gut vor Dornen, Zeckenbissen, Insekten<br />
und Giftpflanzen schützen – ideal für den Wald also. Ich gebe allerdings<br />
unumwunden zu, daß sie bei Kälte und Feuchtigkeit nutzlos sind. Den<br />
Baumwollpullover hatte ich nur pro forma eingesteckt, so wie man auch ein<br />
Schlangenbiß-Set oder Schienen für Knochenbrüche einpackt. Meine Güte,<br />
es war Juli. Ich hatte nicht da<strong>mit</strong> gerechnet, daß man sonst noch Oberbekleidung<br />
benötigen würde, höchstens das Regencape, das ich ja nun leider<br />
nicht dabei hatte. Kurzum, ich war unpassend angezogen, was gefährlich<br />
werden konnte, und forderte mein Leiden und meinen Tod regelrecht heraus.<br />
Ich litt wirklich.<br />
Dabei hatte ich noch Glück. Der Wind fegte laut und gleichmäßig <strong>mit</strong> einer<br />
Geschwindigkeit von etwa 40 Stundenkilometern, aber die Böen kamen <strong>mit</strong><br />
mindestens doppelter Geschwindigkeit und zudem aus ständig wechselnden<br />
Richtungen. Wenn der Wind uns direkt ins Gesicht blies, ging es nur zwei<br />
Schritte vor und einen zurück. Wenn er von der Seite kam, versetzte er uns<br />
jedesmal einen kräftigen Schubs und drängte uns an den Rand des Grats.<br />
Bei dem Nebel ließ sich nicht feststellen, wie tief der Sturz auf beiden Seiten<br />
sein würde, aber die Hänge waren ziemlich steil, wir befanden uns<br />
schließlich auf über l .600 Metern und hoch in den Wolken. Wenn sich die<br />
Verhältnisse auch nur ein klein bißchen verschlechtert hätten – man vor<br />
lauter Nebel seine eigenen Füße nicht mehr gesehen hätte, oder die Böen<br />
genug Kraft gehabt hätten, einen erwachsenen Menschen umzustoßen –,<br />
dann hätten wir da unten festgesessen, und ich wäre obendrein bis auf die
Knochen durchnäßt gewesen. Vor einer knappen Dreiviertelstunde hatten<br />
wir in der Sonne noch fröhlich ein Liedchen gepfiffen. Jetzt begriff ich, wie<br />
man in den White Mountains zu Tode kommen konnte, sogar <strong>mit</strong>ten im<br />
Sommer.<br />
Ich befand mich gewissermaßen in einer leichten Notlage. Ich bibberte wie<br />
verrückt und fühlte mich seltsam benommen. Der Grat schien kein Ende zu<br />
nehmen, und in der milchigen Brühe war es unmöglich abzuschätzen, wann<br />
sich der Lafayette vor uns erheben würde. Ich schaute auf meine Uhr – zwei<br />
Minuten vor elf, genau richtig für eine Mittagspause, sollten wir jemals bei<br />
dieser verdammten Hütte ankommen. Ich tröstete mich <strong>mit</strong> dem Gedanken,<br />
daß ich wenigstens meinen Humor nicht verloren hatte. Jedenfalls kam es<br />
mir so vor. Angeblich ist ein verwirrter Mensch viel zu unsicher, um zu<br />
erkennen, daß er verwirrt ist. Logische Schlußfolgerung: Wenn man weiß,<br />
daß man nicht verwirrt ist, ist man nicht verwirrt. Es sei denn, kam es mir<br />
plötzlich in den Sinn – und ich war ganz fasziniert von dem Gedanken –, es<br />
sei denn, der Versuch, sich einzureden, man sei nicht verwirrt, ist lediglich<br />
ein erstes furchtbares Symptom für geistige Verwirrung. Vielleicht sogar für<br />
fortgeschrittene geistige Verwirrung. Wer weiß das schon? Durchaus möglich,<br />
daß ich mich auf eine Frühphase hilfloser Verwirrung zubewegte, die<br />
seitens des Betroffenen durch die Befürchtung gekennzeichnet ist, er bewege<br />
sich auf eine Frühphase hilfloser Verwirrung zu. Das ist das Problem,<br />
wenn man seinen Verstand verliert: Wenn er erst mal weg ist, kriegt man<br />
ihn nicht wieder.<br />
Ich schaute auf meine Uhr und stellte <strong>mit</strong> Schrecken fest, daß es immer<br />
noch zwei Minuten vor elf war. Mein Zeitgefühl war weg! Ich war vielleicht<br />
nicht in der Lage, meinen Grips verläßlich zu beurteilen, aber jetzt<br />
hatte ich den Beweis am Handgelenk. Wie lange würde es noch dauern, bis<br />
ich halbnackt durch die Gegend tanzte und versuchte, angebliche Flammen<br />
zu ersticken, oder mich die fixe Idee überkäme, der eleganteste Ausweg aus<br />
diesem Schlamassel wäre ein Sprung <strong>mit</strong> einem unsichtbaren Zauberfallschirm<br />
in die Talsohle? Ich jammerte ein bißchen vor mich hin, ging aber<br />
weiter, wartete eine geschlagene Minute ab und sah dann wieder auf meine<br />
Uhr. Immer noch zwei Minuten vor elf! Ich war geliefert!<br />
<strong>Bill</strong>, der anscheinend gänzlich unbekümmert war und unempfindlich gegenüber<br />
der Kälte und der natürlich keine Ahnung davon hatte, daß wir auf<br />
dem Grat bei diesem für die Jahreszeit untypischen Wind alles andere als<br />
vorankamen, drehte sich ab und zu um und fragte, wie es mir ging.<br />
»Gut!« sagte ich jedesmal, denn ich hätte mich geschämt einzugestehen,<br />
daß ich auf dem besten Weg war, meinen Verstand zu verlieren, bevor ich<br />
<strong>mit</strong> einem wissenden Lächeln auf den Lippen und dem Abschiedsruf »Bis<br />
nachher im Jenseits, alter Freund!« über den Rand des Grats springen wür-
de. Vermutlich war ihm noch nie ein Patient auf einem Berggipfel abhanden<br />
gekommen, und ich wollte ihn nicht unnötig aufregen. Außerdem war ich<br />
mir nicht hundertprozentig sicher, daß ich die Kontrolle über mich verlor,<br />
ich fühlte mich nur ziemlich elend.<br />
Ich weiß nicht, wie lange wir bis zum Gipfel des Lafayette brauchten, jedenfalls<br />
kam es mir wie eine Ewigkeit vor. Vor 100 Jahren stand ein Hotel<br />
an diesem öden, abschreckenden Ort, und die vom Wind traktierten Fundamente<br />
sind immer noch eine Art Wahrzeichen. Ich habe sie auf Fotos gesehen,<br />
aber ich kann mich kein bißchen an sie erinnern. Ich war voll und ganz<br />
auf den Abstieg über den Nebenwanderweg zur Greenleaf Hut konzentriert.<br />
Er führte über ein riesiges Geröllfeld und dann, ungefähr anderthalb Kilometer<br />
weiter, durch Wald. Kaum hatten wir den Gipfel hinter uns gelassen,<br />
legte sich der Wind, und nach 150 Metern hatte sich alles wieder beruhigt.<br />
Das war geradezu gespenstisch, und auch der Nebel hing nur noch hier und<br />
da in Fetzen. Plötzlich konnten wir die Welt unter uns erkennen, und auch,<br />
wie weit oben wir uns befanden, fast abgehoben, obwohl alle anderen Gipfel<br />
in der Umgebung von Wolken verhüllt waren. Zu meiner Überraschung<br />
und Genugtuung ging es mir gleich besser. Ich richtete mich <strong>mit</strong> einem<br />
neuen Gefühl der Stärke auf, und mir wurde klar, daß ich die ganze Zeit<br />
über <strong>mit</strong> einem regelrechten Buckel gegangen war. Es ging mir wirklich<br />
viel besser, ich fror nicht mehr, und mein Kopf war wieder klar.<br />
»So schlimm war es nun auch wieder nicht«, sagte ich <strong>mit</strong> einem derben<br />
Bergwandererlachen zu <strong>Bill</strong> und drängte weiter zur Hütte.<br />
Greenleaf Hut ist eine von zehn malerischen und in diesem Fall besonders<br />
praktischen Steinhütten, die von dem altehrwürdigen Appalachian Mountain<br />
Club in den White Mountains betrieben werden. Der AMC, der vor über<br />
120 Jahren gegründet wurde, ist nicht nur der älteste Wanderverein in Amerika,<br />
sondern auch die älteste »Bürgerinitiative«, die sich überhaupt um die<br />
Belange des Umweltschutzes kümmert. Der Verein verlangt stolze 50 Dollar<br />
für Übernachtung und Halbpension und wird infolgedessen von den<br />
Weitwanderern nur als Appalachian Money Club bezeichnet. Zu seiner<br />
Verteidigung wäre zu sagen, daß der AMC ein Wegenetz von 2.250 Kilometern<br />
in den White Mountains unterhält, ein ausgezeichnetes Besucherzentrum<br />
in Pinkham Notch führt, lesenswerte Bücher herausgibt und jeden<br />
Wanderer in seinen Hütten aufnimmt, auch wenn er nur aufs Klo muß,<br />
Wasser holen oder sich einfach nur ausruhen will – ein Service, den wir<br />
jetzt dankbar in Anspruch nahmen.<br />
Wir bestellten uns einen heißen Kaffee und setzten uns da<strong>mit</strong> an einen der<br />
vielen langen Tische zu den anderen verschwitzten Hikern und verzehrten<br />
unser Lunchpaket. In der Hütte herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre,<br />
die Einrichtung war einfach und rustikal, <strong>mit</strong> einer hohen Decke und viel
Platz zum Herumlaufen. Als wir fertig waren, setzte bei mir der Muskelkater<br />
ein. Deshalb stand ich auf, spazierte herum und sah mir einen der beiden<br />
Schlafräume an. Er war ziemlich groß, <strong>mit</strong> fest eingebauten Etagenbetten,<br />
vier Kojen übereinander. Er war sauber und hell und sehr karg, aber vermutlich<br />
sah es hier abends, <strong>mit</strong> lauter Wanderern und dem ganzen Gepäck, wie<br />
in einer Kaserne aus. Es machte auf mich keinen einladenden Eindruck.<br />
Benton MacKaye hatte <strong>mit</strong> diesen Hütten nichts zu tun gehabt, dennoch<br />
entsprachen sie voll und ganz seiner einstigen Vision – einfache Ausstattung,<br />
rustikal, auf das Leben in der Gemeinschaft zugeschnitten. Mir wurde<br />
<strong>mit</strong> einem dumpfen Schrecken klar: Wäre MacKayes Traum von einer ganzen<br />
Kette von Herbergen am Wegesrand Wirklichkeit geworden, dann hätten<br />
sie aller Wahrscheinlichkeit nach so wie dieses Haus ausgesehen. Aus<br />
dem ruhigen und gemütlichen Refugium <strong>mit</strong> einer ganzen Veranda voller<br />
Schaukelstühle, wie ich es mir in der Phantasie ausgemalt hatte, wäre wohl<br />
eher ein Kurzaufenthalt in einem Ausbildungslager geworden, obendrein<br />
ein kostspieliger, nach den Preisen des AMC zu urteilen.<br />
Ich rechnete im Kopf nach: Angenommen, der stolze Preis von 50 Dollar<br />
hätte überall gegolten, dann hätte es den typischen Weitwanderer zwischen<br />
6.000 und Z500 Dollar gekostet, wenn er unterwegs jeden Abend in einer<br />
Hütte eingekehrt wäre. Das hätte wohl nicht funktioniert. Vielleicht war es<br />
besser so, wie es war.<br />
Die Sonne schien nur schwach, als wir aus der Hütte nach draußen traten<br />
und uns über einen Nebenweg nach Franconia Notch an den Abstieg machten.<br />
Unterwegs nahm sie an Kraft zu, bis man schließlich wieder von einem<br />
herrlichen Julitag sprechen konnte, die Luft war mild, in den Bäumen tanzte<br />
das Sonnenlicht, und die Vögel zwitscherten. Als wir spät nach<strong>mit</strong>tags an<br />
unserem Auto ankamen, war ich fast wieder völlig trocken, und meine vorübergehende<br />
Panik auf dem Lafayette – der jetzt vor einem strahlend blauen<br />
Himmel im Sonnenlicht glänzte – war nur noch eine ferne Erinnerung.<br />
Beim Einsteigen schaute ich auf meine Uhr. Sie zeigte zwei Minuten vor<br />
elf. Ich schüttelte sie und sah <strong>mit</strong> Interesse, wie sich der Sekundenzeiger<br />
wieder in Bewegung setzte.
18. Kapitel<br />
Am Nach<strong>mit</strong>tag des 12. April 1934 hatte Salvatore Pagliuca, ein Meteorologe<br />
der Wetterstation auf dem Gipfel des Mount Washington, ein Erlebnis,<br />
das niemand vor ihm je gehabt hatte und seitdem auch nie wieder jemand<br />
gehabt hat.<br />
Auf dem Mount Washington ist es, milde ausgedrückt, gelegentlich etwas<br />
stürmisch, und an jenem 12. April wehte ein besonders heftiger Wind. In<br />
den vorangegangenen 24 Stunden war die Windgeschwindigkeit nicht unter<br />
170 Stundenkilometer gefallen, in den Böen lag sie zeitweilig sogar noch<br />
darüber. Als es Zeit wurde für Pagliuca, wie jeden Nach<strong>mit</strong>tag die Anzeigen<br />
an den Meßgeräten abzulesen, war der Wind so stark, daß er sich ein Seil<br />
um die Taille band und zwei Kollegen bat, das andere Ende festzuhalten.<br />
Die Männer hatten bereits Schwierigkeiten, die Tür zur Wetterstation aufzukriegen,<br />
und brauchten ihre ganze Kraft, da<strong>mit</strong> ihnen Pagliuca nicht als<br />
lebender Drachen davonflog. Wie es ihm gelang, an seine Instrumente heranzukommen<br />
und die Werte abzulesen, ist nicht überliefert, auch nicht<br />
seine Worte, als er schließlich wieder in die Station getorkelt kam, aber<br />
»Wahnsinn!« scheint mir sehr wahrscheinlich.<br />
Fest steht jedenfalls, daß Pagliuca eine Bodenwindgeschwindigkeit des<br />
Windes von 371 Stundenkilometer gemessen hatte. Ein solches Tempo war<br />
nie zuvor auf der ganzen Welt registriert worden.<br />
In seinem Buch The Worst Weather: A History of the Mount Washington<br />
Observatory bemerkt William Lowell Putnam dazu trocken: »Vielleicht gibt<br />
es gelegentlich irgendwo an einem gottverlassenen Ort auf dem Planeten<br />
Erde schlechteres Wetter, aber das muß erst noch korrekt gemessen werden.«<br />
Zu den Rekorden der Wetterstation auf dem Mount Washington<br />
kommen noch weitere hinzu: die meisten zerstörten Wettermeßinstrumente,<br />
der meiste Wind innerhalb von 24 Stunden (fast 5.000 Kilometer insgesamt),<br />
und die extremste Windkälte (eine Kombination aus einer Windgeschwindigkeit<br />
von 160 Stundenkilometern und einer Außentemperatur von -<br />
40 Grad Celsius; das wird selbst in der Antarktis nicht übertroffen).<br />
Der Mount Washington verdankt seine extremen Wetterverhältnisse nicht<br />
so sehr der Höhe oder dem Breitengrad, obwohl beide Faktoren eine Rolle<br />
spielen, sondern vielmehr seiner Lage an einer Stelle, wo zwei von ihrer<br />
Höhe bestimmte Wettersysteme aus Kanada und von den Großen Seen auf<br />
feuchte, relativ warme Luft vom Atlantik beziehungsweise aus dem Süden<br />
der Vereinigten Staaten treffen. In der Folge fallen im Jahresdurchschnitt<br />
625 Zentimeter Schnee. Während eines besonders denkwürdigen Sturms im<br />
Jahr 1969 fielen innerhalb von drei Tagen zweieinhalb Meter Schnee auf<br />
dem Gipfel. Der Wind ist ein zusätzliches, spezielles Merkmal: Im Winter
weht er an zwei von drei Tagen <strong>mit</strong> durchschnittlicher Hurrikanstärke (das<br />
sind 120 Stundenkilometer); auf das ganze Jahr gerechnet, bläst er an 40<br />
Prozent aller Tage <strong>mit</strong> dieser Geschwindigkeit. Wegen der Dauer und der<br />
Strenge des Winters beträgt die durchschnittliche Jahrestemperatur schlappe<br />
-2 Grad Celsius. Das sommerliche Mittel liegt bei etwa zehn Grad Celsius,<br />
gute fünf Grad niedriger als am Fuß des Berges. Es ist ein grausamer Berg,<br />
aber dennoch steigen die Menschen hinauf, manche sogar im Winter.<br />
In ihrem Buch Into the Mountains berichten Maggie Stier und Ron Mc<br />
Adow von zwei Studenten der University of New Hampshire, Derek Tinkham<br />
und Jeremy Haas, die sich vorgenommen hatten, im Januar 1994 den<br />
gesamten Presidential Range abzugehen – sieben Gipfel, einschließlich des<br />
Mount Washington, die alle nach amerikanischen Präsidenten benannt sind.<br />
Beide waren erfahrene Winterwanderer und verfügten über eine gute Ausrüstung,<br />
trotzdem hätten sie sich niemals vorstellen können, worauf sie sich<br />
da eingelassen hatten. In der zweiten Nacht stieg die Windgeschwindigkeit<br />
auf 145 Stundenkilometer, und die Temperatur sank auf -35 Grad Celsius.<br />
Ich habe -30 Grad Celsius erlebt, bei ruhigen Verhältnissen wohlgemerkt,<br />
und ich kann nur sagen, selbst wenn man gut eingepackt ist und noch Restwärme<br />
von der Hütte in sich hat, kann es sehr schnell sehr ungemütlich<br />
werden. Irgendwie überlebten die beiden die Nacht, aber am nächsten Tag<br />
verkündete Haas, er könne keinen Schritt mehr weitergehen. Tinkham half<br />
ihm in den Schlafsack und schleppte sich selbst zur drei Kilometer entfernten<br />
Wetterstation. Er schaffte es gerade noch, trug allerdings schwere Erfrierungen<br />
davon. Seinen Freund fand man am nächsten Tag, »halb aus dem<br />
Schlaf sack gekrochen und steif gefroren«.<br />
Viele andere sind schon bei weniger widrigen Verhältnissen am Mount<br />
Washington umgekommen. Eine der frühesten Katastrophen <strong>mit</strong> grausiger<br />
Berühmtheit war der Tod einer jungen Frau namens Lizzie Bourne, die<br />
1855, kurz nachdem am Mount Washington der Tourismus begonnen hatte,<br />
an einem sommerlichen Septembernach<strong>mit</strong>tag in Begleitung zweier Männer<br />
versuchte, den Berg zu erklimmen. Wie man sich denken kann, schlug das<br />
Wetter um, und die drei verirrten sich im Nebel und wurden getrennt. Die<br />
Männer schafften es noch bis zum Hotel am Gipfel, aber auch erst nach<br />
Einbruch der Dunkelheit. Lizzie Bourne wurde am nächsten Tag nur 50<br />
Meter vom Hoteleingang entfernt gefunden, tot.<br />
Insgesamt haben bisher 122 Menschen ihr Leben am Mount Washington<br />
verloren. Bis vor kurzem, als der Mount Denali in Alaska die traurige Führung<br />
übernahm, war er der »mörderischste« Berg Nordamerikas. Ich hatte<br />
daher, als der unerschrockene Dr. Abdu und ich ein paar Tage später zu<br />
unserem zweiten großen Aufstieg am Fuß des Berges vorfuhren, genug<br />
Reservekleidung dabei, um die Arktis zu durchqueren – Regencape, Woll-
pullover, Jacke, Handschuhe, eine Ersatzhose und lange Unterwäsche. Ich<br />
wollte mich nicht noch einmal halb zu Tode frieren.<br />
Am Mount Washington, <strong>mit</strong> ansehnlichen 1.916 Metern der höchste Berg<br />
nördlich der Smokies und östlich der Rockies, gibt es nur wenige klare Tage<br />
im Jahr, und heute war so ein Tag, weshalb die Menschen in Massen herbeiströmten.<br />
Ich zählte bereits über 70 Autos am Pinkham Notch Visitor<br />
Center, als wir dort morgens um zehn nach acht ankamen, und <strong>mit</strong> jeder<br />
Minute wurden es mehr. Mount Washington ist der beliebteste Gipfel in den<br />
White Mountains und der Tuckerman Ravine Trail, die Route, für die wir<br />
uns entschieden hatten, der beliebteste Wanderweg. Schätzungsweise<br />
60.000 Hiker wählen jährlich die Tuckerman-Route, allerdings lassen viele<br />
sich bis nach oben fahren und gehen dann zu Fuß hinunter, weshalb die<br />
Zahl vielleicht ein etwas schiefes Bild ergibt. Jedenfalls war es für einen<br />
schönen, warmen, vielversprechenden Tag <strong>mit</strong> strahlend blauern Himmel<br />
Ende Juli nicht überdurchschnittlich voll.<br />
Der Aufstieg war einfacher, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ich konnte mich<br />
immer noch nicht so recht an das Bergwandern ohne schweres Gepäck<br />
gewöhnen. Das macht enorm viel aus. Ich möchte nicht behaupten, daß wir<br />
hinaufrannten, aber wenn man bedenkt, daß wir auf knapp 5.000 Metern<br />
Anstieg einen Höhenunterschied von l .370 Metern zu bewältigen hatten,<br />
gingen wir ein ziemlich flottes Tempo. Wir brauchten zwei Stunden und<br />
vierzig Minuten (<strong>Bill</strong>s Wanderführer für die White Mountains veranschlagt<br />
eine Gehzeit von vier Stunden und 15 Minuten), worauf wir ziemlich stolz<br />
waren.<br />
Sicher gibt es anspruchsvollere und faszinierendere Gipfel entlang des Appalachian<br />
Trail zu erklimmen als den Mount Washington, aber bei keinem<br />
erlebt man solche Überraschungen. Man kämpft sich den letzten Abschnitt<br />
des steinigen Steilhangs dieser insgesamt doch recht ansehnlichen Erhebung<br />
hoch, guckt über den Rand und wird ausgerechnet von einem riesigen, asphaltierten<br />
Parkplatz, voller in der heißen Sonne schimmernder Autos, empfangen.<br />
Dahinter liegen verstreut einige Gebäude, zwischen denen sich<br />
Massen von Menschen in Shorts und Baseballkappen tummeln. Es herrscht<br />
eine Atmosphäre wie auf einem Jahrmarkt, den man groteskerweise auf<br />
einen Berggipfel verlegt hat. Man gewöhnt sich daran, auf den Gipfeln<br />
entlang des AT keinen Menschen anzutreffen, und wenn, dann sind es immer<br />
nur wenige, die sich außerdem alle genau wie man selbst abgerackert<br />
haben, um es bis nach oben zu schaffen. Im Vergleich dazu war dieser<br />
Menschenauflauf hier einfach überwältigend. Mount Washington läßt sich<br />
bequem <strong>mit</strong> dem Auto über eine Mautstraße erreichen, die in Serpentinen<br />
am Hang verläuft, oder <strong>mit</strong> einer Zahnradbahn von der anderen Seite, und<br />
Hunderte Menschen – Aberhunderte, wie mir schien – hatten von diesen
eiden Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Überall wimmelte es von Leuten.<br />
Sie sonnten sich, beugten sich über das Geländer der Aussichtsterrassen,<br />
schlenderten zwischen den Souvenirläden und den Fastfood-Restaurants hin<br />
und her. Ich kam mir vor wie ein Besucher von einem anderen Stern und<br />
fand es wunderbar. Es war natürlich der reinste Alptraum und eine Schändung<br />
des höchsten Berges im Nordosten der Vereinigten Staaten, aber ich<br />
war froh, daß sich das alles wenigstens nur an einem Ort abspielte. Das<br />
machte den Rest des Trails perfekt.<br />
Das Zentrum der Aktivität bildete ein scheußlicher Betonbau, das Sum<strong>mit</strong><br />
Information Center, <strong>mit</strong> großen Fenstern, breiten Aussichtsplattformen und<br />
einer ausgesprochen gut besuchten Cafeteria. Gleich hinter dem Eingang<br />
hing eine lange Liste all derer, die am Berg umgekommen waren, dazu<br />
jeweils die Ursache, angefangen <strong>mit</strong> einem gewissen Frederick Strickland<br />
aus Bridlington, Yorkshire, der sich im Oktober 1849 während eines Sturms<br />
verirrt hatte, gefolgt von einer imposanten Aufzählung aller Unglücksfälle,<br />
die <strong>mit</strong> dem Lawinentod zweier Hiker vor gerade einmal drei Monaten<br />
endete. 1996 waren bereits drei Menschen an den Hängen des Mount Washington<br />
ums Leben gekommen, und das Jahr war noch nicht vorbei – eine<br />
ernüchternde Bilanz. Es gab auf der Tafel noch reichlich Platz für weitere<br />
Todesfälle.<br />
Im Kellergeschoß befand sich ein kleines Museum, das über Klima, geologische<br />
Beschaffenheit und die einzigartige Pflanzenwelt des Mount Washington<br />
informierte; meine besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch ein<br />
witziger Kurzfilm <strong>mit</strong> dem Titel »Frühstück der Champions«, den die Meteorologen<br />
wahrscheinlich zu ihrem eigenen Vergnügen gedreht hatten. Er<br />
war <strong>mit</strong> einer fixierten Kamera auf der Gipfelterrasse aufgenommen worden.<br />
Man sieht darin einen Herrn bei einer der berüchtigten Sturmböen am<br />
Tisch sitzen, so als befände er sich in einem Gartenlokal. Während der Gast<br />
versucht, <strong>mit</strong> den Armen den Tisch festzuhalten, nähert sich ein offensichtlich<br />
<strong>mit</strong> äußerster Anstrengung gegen den Wind ankämpfender Kellner. Es<br />
sieht aus, als würde er in 10.000 Meter Höhe auf der Tragfläche eines Flugzeugs<br />
wandeln. Er versucht, dem Gast Cornflakes in eine Schale zu schütten,<br />
aber alles fliegt waagrecht aus der Pappschachtel heraus. Dann fügt der<br />
Kellner Milch hinzu, aber die spritzt ebenfalls seitlich weg und landet auf<br />
dem Gast – ein besonders lustiger Moment. Dann fliegt die Schale davon,<br />
danach das Besteck, wenn ich mich recht entsinne, schließlich macht sich<br />
der Tisch selbständig, und da<strong>mit</strong> endet der Film. Er war so nett, daß ich ihn<br />
mir zweimal anschaute; dann begab ich mich auf die Suche nach <strong>Bill</strong>, da<strong>mit</strong><br />
er ihn sich auch ansah. Ich konnte ihn in dem Gewimmel nicht entdecken,<br />
also ging ich nach draußen auf die Plattform und schaute zu, wie die Zahnradbahn<br />
schnaufend den Berg hinauf kroch und auf ihrer Fahrt schwarzen
Qualm ausstieß. An der Gipfelstation machte sie Halt, und weitere Hundertschaften<br />
zufriedener Touristen stiegen aus.<br />
Die Geschichte des Tourismus auf dem Mount Washington reicht weit<br />
zurück. Schon im Jahre 1852 befand sich auf dem Gipfel ein Restaurant,<br />
und die Besitzer hatten pro Tag an die hundert zahlende Gäste. 1853 wurde<br />
ein kleines Hotel aus Stein auf dem Berg errichtet, es nannte sich Tip-Top-<br />
House, und es war sofort ein durchschlagender Erfolg. 1869 baute ein ortsansässiger<br />
Unternehmer namens Sylvester March eine Zahnradbahn, die<br />
erste der Welt. Alle hielten ihn für verrückt, und niemand glaubte, daß für<br />
so etwas ein Bedarf bestünde, selbst wenn sie funktionieren sollte, was man<br />
ohnehin bezweifelte. Die aus ihr hervorquellenden Massen unter mir waren<br />
der Beweis des Gegenteils.<br />
Fünf Jahre nach Eröffnung der Zahnradbahn wurde das alte Tip-Top-House<br />
vom größeren und vornehmeren Sum<strong>mit</strong> House Hotel abgelöst, das wiederum<br />
einem zwölf Meter hohen Bettenturm weichen mußte, auf dessen Dach<br />
sich ein mehrfarbiger Scheinwerfer befand, der in ganz New England und<br />
sogar vom Meer aus zu sehen war. Bis Ende des Jahrhunderts erschien als<br />
neue Sommerattraktion täglich eine Gipfelzeitung, und American Express<br />
eröffnete eine Filiale dort oben.<br />
Auch am Fuß des Berges herrschte Hochkonjunktur. Die moderne Tourismusindustrie<br />
– in der Form, daß Menschen in Massen an einen schönen Ort<br />
reisen und dort bei ihrer Ankunft Zerstreuungen aller Art vorfinden – ist im<br />
wesentlichen eine Erfindung, die in den White Mountains ihren Ursprung<br />
hat. In jedem Tal schössen gigantische Hotels <strong>mit</strong> bis zu 250 Zimmern wie<br />
Pilze aus dem Boden. Sie waren in dem hübschen, hiesigen Stil entworfen<br />
und sahen aus – wie auf die Größe eines Krankenhauses oder Sanatoriums<br />
aufgeblasene Berghütten – sehr kunstvolle und reich verzierte Häuser, die<br />
zu den größten und kompliziertesten Holzbauten zählen, die je errichtet<br />
wurden, <strong>mit</strong> Türmchen und Erkern und allem erdenklichen architektonischen<br />
Schmuck, den das viktorianische Zeitalter zu bieten hatte. Sie verfügten<br />
über Wintergärten und Salons, Speisesäle für 200 Personen und Veranden,<br />
die wie die Promenadendecks von Kreuzfahrtschiffen aussahen und auf<br />
denen die Hotelgäste in der gesunden Luft bei einem Gläschen sitzend die<br />
zerklüftete felsige Pracht der Natur bestaunen konnten.<br />
Die feineren Hotels waren noch besser dran. Das Profile House in Franconia<br />
Notch zum Beispiel besaß einen eigenen Bahnanschluß zur knapp 13 Kilometer<br />
entfernten Bethlehem Junction. Auf dem Hotelgelände standen 21<br />
Cottages, jedes <strong>mit</strong> zwölf Schlafzimmern. Das Maplewood betrieb ein eigenes<br />
Casino, und die Gäste im Crawford House konnten zwischen zwölf<br />
Zeitungen wählen, die extra täglich aus New York und Boston herangeschafft<br />
wurden. Bei allem, was neu und interessant war – Aufzügen, Gasbe-
leuchtung, Swimmingpools, Golfplätzen –, hatten die White-Mountain-<br />
Hotels immer die Nase vorn. 1890 lagen 200 Hotels in den White Mountains<br />
verstreut. Nie zuvor hatte es eine solche Dichte von erstklassigen Hotels<br />
an einem Ort gegeben, schon gar nicht in den Bergen. Heute sind diese<br />
Häuser praktisch alle verschwunden.<br />
1902 eröffnete das größte von ihnen in Bretton Woods in einem weiten<br />
parkähnhchen Areal vor der Kulisse des Presidential Range. In einem imposanten<br />
Stil errichtet, den der Architekt selbst bescheiden als »spanische<br />
Renaissance« bezeichnete, stellte das Mount Washington Hotel den Gipfel<br />
an Eleganz und Opulenz dar. Es stand in einem über 1.000 Hektar großen<br />
Landschaftsgarten und hatte 235 Zimmer, die <strong>mit</strong> allen Finessen ausgestattet<br />
waren, die man <strong>mit</strong> Geld kaufen konnte. Allein für die Stuckarbeiten<br />
ließ man 250 Meister aus Italien anreisen. Bei seiner Fertigstellung war<br />
das Hotel jedoch bereits ein Anachronismus.<br />
Der Trend ging woandershin. Die amerikanischen Urlauber hatten das Meer<br />
entdeckt. Die White-Mountain-Hotels waren ein bißchen zu langweilig, ein<br />
bißchen zu abgelegen und für bescheidene Ansprüche ein bißchen zu teuer.<br />
Und was noch schlimmer war, die Hotels zogen das falsche Publikum an –<br />
Neureiche aus Boston und New York. Den Todesstoß aber versetzte ihnen<br />
das Automobil. Die Hotels waren dafür gebaut worden, daß die Gäste mindestens<br />
zwei Wochen blieben, aber das Auto verlieh den Menschen dauerhafte<br />
Mobilität. In der 1924er Ausgabe von New England Highways and<br />
Byways from a Motor Car schwärmt der Autor von der unvergleichlichen<br />
Pracht der White Mountains – den tosenden Wasserfällen in Franconia, der<br />
Alabasterherrlichkeit des Mount Washington, dem intimen Charme der<br />
kleinen Städte Lincoln und Bethlehem – und legt den Besuchern dringend<br />
ans Herz, sich für die Berge einen ganzen Tag Zeit zu nehmen. In Amerika<br />
begann das Zeitalter des Automobils und der beschränkten Aufnahmefähigkeit.<br />
Ein Hotel nach dem anderen wurde geschlossen, die Häuser wurden baufällig<br />
oder – was häufiger geschah – brannten bis auf die Grundmauern ab<br />
(wobei nicht selten die Versicherungspolice das Einzige war, was den<br />
Brand überstand), und der Wald eroberte sich das Gelände zurück. Früher<br />
konnte man vom Gipfel aus an die 20 Hotels sehen, heute ist nur noch eins<br />
davon übriggeblieben, das Mount Washington, <strong>mit</strong> seinem feschen roten<br />
Dach noch immer beeindruckend und irgendwie feierlich, aber in seiner<br />
einsamen Pracht und Herrlichkeit auch unwiederbringlich verloren. Selbst<br />
dieses Haus ist mehrmals nur knapp einer Pleite entkommen. An anderen<br />
Stellen tief unten im Tal, da, wo sich früher das Fabyan, das Mount Pleasant,<br />
das Crawford House und viele andere Hotels stolz erhoben, sind heute<br />
nur noch Bäume, Highways und Motels zu erkennen.
Die Ära der großen Hotels in den White Mountains dauerte insgesamt nur<br />
50 Jahre. Was wieder einmal die Altehrwürdigkeit des Appalachian Trail<br />
beweist. Mit diesem Gedanken begab ich mich auf die Suche nach meinem<br />
Freund <strong>Bill</strong>, um unsere gemeinsame Wanderung fortzusetzen.
19. Kapitel<br />
»Ich habe eine phantastische Idee«, sagte Stephen Katz. Wir saßen bei mir<br />
zu Hause in Hanover. Es war zwei Wochen später, und am nächsten Morgen<br />
wollten wir nach Maine aufbrechen.<br />
»Und die wäre?« sagte ich und versuchte, nicht allzu genervt zu klingen,<br />
denn phantastische Ideen sind nicht gerade Katz’ Stärke.<br />
»Du weißt doch, wie schrecklich schwer diese Rucksäcke immer sind.«<br />
Ich nickte. Davon konnte ich ein Lied singen.<br />
»Ich habe mir da nämlich etwas überlegt. Das heißt, eigentlich überlege ich<br />
da schon sehr lange. Denn um die Wahrheit zu sagen, <strong>Bryson</strong>, vor diesem<br />
Rucksackgeschleppe habe ich« – er senkte die Stimme – »einen Scheißhorror.«<br />
Er nickte feierlich und wiederholte das Schlüsselwort. »Und da kam<br />
mir eine geniale Idee. Eine echte Alternative. Mach die Augen zu.«<br />
»Warum?«<br />
»Es soll eine Überraschung sein.«<br />
Ich mache nicht gern die Augen zu, wenn man mich <strong>mit</strong> etwas überraschen<br />
will. Das konnte ich noch nie ausstehen. Aber ich tat ihm den Gefallen.<br />
Ich hörte, wie er in seinem ausrangierten Armeesack kramte. »Wer trägt<br />
ständig schwere Lasten <strong>mit</strong> sich herum?« fuhr er fort. »Das war die Frage,<br />
die ich mir gestellt habe. Wer muß jeden Tag viel <strong>mit</strong> sich herumschleppen?<br />
He, noch nicht gucken. Und dann kam mir die Idee.« Er schwieg einen<br />
Moment lang, als würde er noch ein paar entscheidende Veränderungen<br />
vornehmen, da<strong>mit</strong> seine Präsentation auch einen perfekten Eindruck machte.<br />
»Gut. Jetzt kannst du gucken.«<br />
Ich nahm die Hände von den Augen. Katz strahlte vor Stolz und hatte sich<br />
eine Zeitungstasche des Des Moines Register umgehängt – einen von den<br />
gelben Säcken, die Zeitungsboten sich über die Schulter werfen, bevor sie<br />
sich aufs Rad schwingen und ihre Runde machen.<br />
»Das ist doch nicht dein Ernst«, sagte ich leise.<br />
»Es war mir noch nie so ernst <strong>mit</strong> etwas, mein lieber Wanderfreund. Ich<br />
habe dir auch eine <strong>mit</strong>gebracht.« Er zog die für mich gedachte Tasche aus<br />
seinem Armeesack, sie war zusammengefaltet und noch originalverpackt in<br />
einer durchsichtigen Plastiktüte.<br />
»Du kannst doch nicht <strong>mit</strong> so einer Zeitungstasche durch die Wildnis von<br />
Maine marschieren, Stephen.«<br />
»Wieso nicht? Sie ist bequem, sie ist geräumig, sie ist wasserdicht – fast<br />
jedenfalls –, und sie wiegt nur ein paar Gramm. Das ist die ideale Wanderausrüstung.<br />
Sag mir eins: Wann hast du das letzte Mal einen Zeitungsboten<br />
<strong>mit</strong> einem Knochenbruch gesehen?« Er nickte einmal knapp und energisch<br />
<strong>mit</strong> dem Kopf in meine Richtung, als würde das jedes Gegenargument zu-
nichte machen.<br />
Ich bewegte meine Lippen, als Andeutung, daß ich etwas sagen wollte, aber<br />
Katz plapperte weiter, bevor ich auch nur einen klaren Gedanken fassen<br />
konnte.<br />
»Und hier ist mein Plan«, fuhr er fort. »Wir beschränken unser Gepäck auf<br />
das Allernotwendigste – kein Kocher, keine Gaskartuschen, keine Nudeln,<br />
kein Kaffee, keine Zelte, keine Packbeutel. Wir wandern und kampieren<br />
wie richtige Gebirgsburschen. Hatte Daniel Boone vielleicht einen Kunstfaserschlafsack<br />
für drei Jahreszeiten? Nicht, daß ich wüßte. Wir nehmen nur<br />
Trockennahrung <strong>mit</strong>, Wasserflaschen und höchstens eine Garnitur Ersatzkleidung.<br />
Wir können unser Gepäck auf zwei bis drei Kilo reduzieren. Und<br />
alles« – er wedelte hocherfreut <strong>mit</strong> der Hand in dem leeren Beutel –<br />
»kommt hier rein.« Sein Gesichtsausdruck war ein stilles Flehen, ihn <strong>mit</strong><br />
Beifall zu überschütten.<br />
»Hast du je einen Gedanken daran verschwendet, wie lächerlich du <strong>mit</strong><br />
dieser Tasche aussiehst?«<br />
»Ja. Aber das ist mir egal.«<br />
»Hast du je in Erwägung gezogen, was für ein nie versiegender Quell der<br />
Heiterkeit du für alle Menschen zwischen hier und Katahdin darstellen<br />
wirst?«<br />
»Mir alles scheißegal.«<br />
»Also gut. Hast du je daran gedacht, was ein Ranger wohl dazu sagen wird,<br />
wenn er dich <strong>mit</strong> einer Zeitungstasche auf den langen Marsch durch die<br />
Hundred Mile Wilderness aufbrechen sieht? Weißt du, daß sie das Recht<br />
haben, jeden zurückzuweisen, den sie physisch und psychisch für ungeeignet<br />
halten?« Das war eine glatte Lüge, aber es zeichnete sich eine vielversprechende<br />
Falte auf Katz’ Stirn ab. »Und hast du dir auch mal überlegt,<br />
daß der Grund dafür, warum Zeitungsboten keine Knochenbrüche haben,<br />
vielleicht darin liegt, daß sie die Tasche nur ungefähr eine Stunde pro Tag<br />
tragen müssen? Daß es vielleicht nicht allzu bequem sein dürfte, sie zehn<br />
Stunden am Stück bergauf zu tragen? Daß sie unentwegt gegen deine Beine<br />
schlackert und daß der Gurt dir deine Schultern wundscheuert? Guck doch<br />
mal, er kratzt dir ja jetzt schon am Hals.«<br />
Er blickte verstohlen hinunter zu dem Gurt. Das einzig Positive an Katz’<br />
großartigen Ideen ist, daß man sie ihm sehr schnell wieder ausreden kann.<br />
Er zog den Gurt über seinen Kopf und legte die Tasche wieder hin. »Also<br />
gut«, räumte er ein, »scheiß auf die Taschen. Aber diesmal nehmen wir nur<br />
leichtes Gepäck <strong>mit</strong>.«<br />
Da<strong>mit</strong> war ich einverstanden. Mehr noch, es war sogar ein absolut vernünftiger<br />
Vorschlag. Wir packten mehr ein, als Katz sich gewünscht hatte – ich<br />
bestand darauf, daß wir Schlafsäcke, warme Kleidung und unsere Zelte
<strong>mit</strong>nahmen, auch wenn das eine größere Belastung für Katz darstellte, als<br />
ihm lieb war –, aber ich erklärte mich da<strong>mit</strong> einverstanden, den Kocher, die<br />
Gaskartuschen, Töpfe und Pfannen zu Hause zu lassen. Wir konnten uns<br />
von mir aus von Trockennahrung ernähren – hauptsächlich Snickers, Rosinen<br />
und einer unverderblichen Salami, die sich Slim Jim nannte. Wir würden<br />
in den 14 Tagen schon nicht verhungern. Außerdem konnte ich keinen<br />
Nudeleintopf mehr sehen. Alles in allem sparten wir da<strong>mit</strong> ungefähr zwei<br />
bis zweieinhalb Kilo pro Person ein, eigentlich lächerlich, aber Katz freute<br />
sich kindisch. Es kam nicht oft vor, daß er seinen Willen bekam, wenn auch<br />
nur teilweise.<br />
Und so brachte uns meine Frau am nächsten Tag <strong>mit</strong> dem Auto bis tief in<br />
den schier endlosen Wald im Norden von Maine, von wo aus Katz und ich<br />
zu unserer Hundred-Mile-Wilderness-Tour aufbrechen wollten. Maine ist<br />
trügerisch. Es ist der zwölftkleinste Bundesstaat, aber er hat mehr unbesiedeltes<br />
Waldgebiet – vier Millionen Hektar – als jeder andere Bundesstaat<br />
außer Alaska. Auf Fotos sieht es immer friedlich und verlockend aus, wie<br />
ein einziger großer Park, <strong>mit</strong> Hunderten kühlen, tiefen Seen und einer welligen,<br />
nebelverhangenen Gebirgslandschaft, so weit das Auge reicht. Nur<br />
der Katahdin bietet <strong>mit</strong> seinen nackten Felshängen unterhalb des Gipfels<br />
und seiner überraschend brachialen Erscheinung einen einschüchternderen<br />
Anblick. In Wahrheit ist aber alles ziemlich anstrengend.<br />
Die Waldhüter in Maine haben eine gewisse natürliche Begabung dafür, die<br />
steinigsten Anstiege und die gefährlichsten Hänge für den Trail auszusuchen,<br />
und von denen besitzt Maine eine atemberaubende Menge. Auf seinen<br />
455 Kilometern durch Maine verlangt der Appalachian Trail von dem Wanderer,<br />
der von Süden nach Norden geht, 30.000 Höhenmeter Kletterei, also<br />
dreimal den Everest rauf und runter. Mittendrin liegt die berühmte Hundred<br />
Mile Wilderness, die von dem kleinen Ort Monson bis zu einem Campingplatz<br />
in Abol Bridge reicht, ein Stück hinter dem Mount Katahdin. Es sind<br />
genau 160,44 Kilometer Waldwanderweg, ohne ein Haus, einen Laden, ein<br />
Telefon oder eine asphaltierte Straße – der abgelegenste Abschnitt des gesamten<br />
AT. Wenn einem hier etwas passiert, ist man auf sich allein gestellt<br />
und kann schon an einer infizierten Blutblase sterben.<br />
Die meisten brauchen eine Woche bis zehn Tage, um diese berüchtigte<br />
Wildnis zu durchqueren. Da wir zwei Wochen zur Verfügung hatten, ließen<br />
wir uns von meiner Frau in Caratunk absetzen, einem abgeschiedenen Ort<br />
am Kennebec River, 61 Kilometer vor Monson und dem offiziellen Ausgangspunkt<br />
der Strecke. So blieben uns drei Tage, um uns einzustimmen,<br />
und wir hatten Gelegenheit, uns in Monson noch einmal <strong>mit</strong> dem Nötigsten<br />
einzudecken, bevor wir uns endgültig in die Waldwildnis begaben. Ich war
ereits in der Woche, bevor Katz dazustieß, zur Erkundung weiter westlich,<br />
um den Rangeley und den Flagstaff Lake, ein bißchen gewandert, und ich<br />
hatte das Gefühl, als würde ich das Gelände einigermaßen kennen. Trotzdem<br />
war es der reinste Schock.<br />
Es war das erste Mal seit vier Monaten, daß ich wieder einen vollbepackten<br />
Rucksack aufsetzte. Ich konnte kaum fassen, wie schwer das Ding war,<br />
konnte kaum fassen, daß ich es je hatte fassen können. Der Druck war unausweichlich<br />
und entmutigend. Aber wenigstens war ich zwischendurch<br />
mal gewandert. Katz, das war sofort zu sehen, fing wieder bei Null an –<br />
eigentlich noch davor, genauer gesagt. Von Caratunk aus führte ein sanfter,<br />
acht Kilometer langer Anstieg zu einem großen See, dem Pleasant Pond.<br />
Das sollte eigentlich kein Problem sein, aber ich bemerkte gleich, daß Katz<br />
<strong>mit</strong> unglaublicher Anstrengung einen Fuß vor den anderen setzte und<br />
schwer atmete. Sein Gesicht zeigte einen entsetzten Ausdruck, als würde er<br />
sich fragen: Wo bin ich hier bloß gelandet?<br />
Wenn ich mich nach seinem Befinden erkundigte, konnte er immer nur in<br />
höchst erstauntem Tonfall »Mann, oh Mann!« von sich geben, und als er bei<br />
der ersten Pause nach einer Dreiviertelstunde den Rucksack auf den Boden<br />
plumpsen ließ, entfuhr ihm ein aus tiefster Seele kommendes »Schaaaaaaeiße!«<br />
– keuchend und schleppend, ein Geräusch, als würde sich jemand auf<br />
einem prallen Kissen niederlassen. Es war ein schwüler Nach<strong>mit</strong>tag, und<br />
Katz war schweißüberströmt. Er holte eine Wasserflasche hervor und trank<br />
sie zur Hälfte aus. Dann sah er mich <strong>mit</strong> einem leicht verzweifelten Blick<br />
an, setzte den Rucksack wieder auf und tat wortlos seine Pflicht.<br />
Pleasant Pond ist ein Ferienort. Man hörte das vergnügte Kreischen von<br />
Kindern, die keine hundert Meter entfernt im Wasser planschten und<br />
schwammen – obwohl wir von dem See selbst durch die Bäume hindurch<br />
nichts erkennen konnten. Ohne den Lärm hätten wir gar nicht gemerkt, daß<br />
es dort einen See gab, eine ernüchternde Erinnerung daran, wie beklemmend<br />
dicht ein Wald sein kann. Hinter dem See erhob sich der Middle<br />
Mountain, schlappe 760 Meter hoch, aber in einem steilen Winkel – bei<br />
heißem Wetter und einem klobigen Sack hinten drauf, der auf die schwachen<br />
Schultern drückt, ist das doppelt so anstrengend. Ich trabte lustlos<br />
weiter bis zum Gipfel. Katz fiel sehr schnell weit zurück und kam <strong>mit</strong> unendlicher<br />
Langsamkeit hinterhergeschlurft.<br />
Es war bereits nach sechs, als ich auf der anderen Seite am Fuß des Berges<br />
ankam und an einem Flüßchen namens Baker Stream, neben einem grasbewachsenen,<br />
kaum benutzten Forstweg, einen guten Lagerplatz für uns fand.<br />
Ich wartete ein paar Minuten auf Katz und schlug dann mein Zelt auf. Als er<br />
nach 20 Minuten immer noch nicht kam, machte ich mich auf die Suche<br />
nach ihm. Es dauerte fast eine Stunde, bis ich ihn schließlich fand; seine
Augen waren ganz glasig.<br />
Ich nahm ihm den Rucksack ab und stöhnte bei der nicht ganz unerwarteten<br />
Feststellung, daß er einigermaßen leicht war.<br />
»Was ist <strong>mit</strong> deinem Rucksack passiert?«<br />
»Hab’ ein paar Sachen weggeworfen«, erwiderte er mißmutig.<br />
»Was für Sachen?«<br />
»Klamotten und so.« Er war unsicher, ob er beschämt oder aggressiv reagieren<br />
sollte. Er entschied sich für letzteres. »Als erstes diesen blöden Pullover«<br />
Wir hatten uns beim Packen etwas über die Notwendigkeit von Wollsachen<br />
gestritten.<br />
»Aber es könnte kalt werden. Das Wetter ist wechselhaft in den Bergen.«<br />
»Ja, ja. Wir haben August, <strong>Bryson</strong>. Falls dir das noch nicht aufgefallen sein<br />
sollte.«<br />
Es hatte nicht viel Zweck, <strong>mit</strong> ihm zu diskutieren. Als wir das Lager erreichten<br />
und er sein Zelt aufschlug, warf ich einen Blick in seinen Rucksack.<br />
Er hatte fast seine ganze Ersatzkleidung weggeworfen und anscheinend<br />
auch einigen Proviant.<br />
»Wo sind die Erdnüsse geblieben?« fragte ich ihn. »Und deine , Salami?«<br />
»Wir brauchen den ganzen Scheiß nicht. Es sind doch nur drei Tage bis<br />
Monson.«<br />
»Der Proviant war hauptsächlich für die Hundred Mile Wilderness gedacht,<br />
Stephen. Wir wissen doch gar nicht, was es für Lebens<strong>mit</strong>tel in Monson<br />
gibt.«<br />
»Ach so.« Er sah mich erschrocken und reumütig an. »Ich fand, es war<br />
einfach zu viel für drei Tage.«<br />
Ich wühlte verzweifelt in seinem Rucksack, dann suchte ich den Boden ab.<br />
»Wo ist deine zweite Wasserflasche?«<br />
Er setzte eine dämliche Miene auf. »Die habe ich weggeworfen. «<br />
»Hast du wirklich deine Wasserflasche weggeworfen?« Das war der reinste<br />
Wahnsinn. Wenn man eins beim Wandern im August absolut braucht, dann<br />
literweise Trinkwasser.<br />
»Sie war zu schwer.«<br />
»Natürlich ist die schwer. Wasser ist immer schwer. Aber es ist nun mal<br />
lebensnotwendig, findest du nicht?«<br />
Er sah mich wieder hilflos an. »Ich mußte etwas Gewicht loswerden. Ich<br />
war verzweifelt.«<br />
»Nein. Saublöd.«<br />
»Ja, das auch«, pflichtete er mir bei.<br />
»Wenn du nur nicht immer solchen Scheiß machen würdest, Stephen.«<br />
»Ich weiß«, sagte er bußfertig.<br />
Während Katz weiter sein Zelt aufbaute, ging ich los, um für den nächsten
Morgen Wasser zu filtern. Baker Stream war eigentlich ein richtiger Fluß –<br />
breit, flach, klar – und sah im Licht des Sommerabends, <strong>mit</strong> den überhängenden<br />
Zweigen im Hintergrund und den letzten Sonnenstrahlen, die auf<br />
der Wasseroberfläche funkelten, sehr malerisch aus. Als ich so am Ufer<br />
kniete, spürte ich irgend etwas Merkwürdiges – ich weiß nicht was – zwischen<br />
den Bäumen links hinter mir, das mich veranlaßte aufzustehen und<br />
durch das Gestrüpp am Ufer zu schauen. Weiß der Himmel, was mich dazu<br />
trieb, mich umzusehen, denn bei dem melodischen Geplätscher des Flußwassers<br />
hätte ich gar nichts hören können – jedenfalls starrte mich aus dem<br />
dunklen Unterholz knapp fünf Meter von mir entfernt <strong>mit</strong> haßerfülltem<br />
Blick ein Elch an, voll ausgewachsen, ein Weibchen, wie ich vermutete, da<br />
es kein Geweih trug. Offenbar war es auf dem Weg zu seiner Wasserstelle<br />
gewesen, als es durch meine Anwesenheit aufgehalten worden war. Jetzt<br />
schien es unentschlossen, was es tun sollte.<br />
Mitten im Wald einem wilden Tier, das größer ist als man selbst, von Angesicht<br />
zu Angesicht gegenüberzustehen ist eine außergewöhnliche Erfahrung.<br />
Man weiß natürlich, daß diese Tiere dort leben, aber man erwartet in keinem<br />
Moment, tatsächlich einem zu begegnen, und schon gar nicht, eines aus<br />
so un<strong>mit</strong>telbarer Nähe zu sehen. Dieses hier war so nah, daß ich den<br />
Schwärm fliegenähnlicher Insekten erkennen konnte, die seinen Kopf umkreisten.<br />
Wir schauten uns minutenlang in die Augen, beide unsicher, wie<br />
wir uns verhalten sollten. Es lag etwas Abenteuerliches in dieser Begegnung,<br />
das war deutlich zu spüren, aber auch etwas Tiefgründiges und Elementares<br />
– eine Art gegenseitige Anerkennung, die ein dauerhafter Blickkontakt<br />
<strong>mit</strong> sich bringt. Das war das Aufregende daran – das Gefühl, daß in<br />
unserer behutsamen, gegenseitigen Respektbezeugung gewissermaßen eine<br />
Begrüßung zum Ausdruck kam. Ich war hingerissen.<br />
Kurz zuvor hatte ich irgendwo zu meinem Ärger gelesen, daß man in New<br />
England wieder angefangen hat, Jagd auf Elche zu machen. Es ist mir ein<br />
Rätsel, wie man auf so ein harmloses und zurückhaltendes Tier wie einen<br />
Elch schießen kann, aber Tausende von Menschen finden Vergnügen daran,<br />
offenbar sogar so viele, daß einige Bundesstaaten dazu übergegangen sind,<br />
die Jagdlizenzen zu verlosen. 1996 gingen für die 1.500 in Maine zu vergebenden<br />
Jagdscheine 82.000 Anträge ein, und über 12.000 Antragsteller aus<br />
anderen Bundesstaaten zahlten bereitwillig 20 Dollar Gebühr nur für die<br />
Erlaubnis, überhaupt an der Verlosung teilnehmen zu dürfen.<br />
Die Jäger wollen einem weismachen, Elche seien wilde und bösartige Tiere.<br />
Unsinn. Elche sind friedlich wie Kühe, die von einem Dreijährigen am<br />
Strick herumgeführt werden. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Elche sind<br />
die seltsamsten Geschöpfe, die je in der Wildnis gelebt haben, und sie sind<br />
auf liebenswerte Weise hilflos. Alles an einem Elch – die spindeldürren
Beinchen, der typische, unentwegt verwirrte Gesichtsausdruck, das komische,<br />
wie zwei Topfhandschuhe geformte Geweih – -wirkt wie ein einziger<br />
possierlicher Witz der Evolution. Das Tier ist erstaunlich unbeholfen: Es<br />
läuft, als wüßte ein Bein nicht, was das andere macht. Was den Elch jedoch<br />
besonders auszeichnet, ist der unübertreffliche Mangel an Intelligenz. Wenn<br />
man auf einem Highway fährt und unterwegs tritt ein Elch aus dem Wald<br />
und stellt sich in den Weg, starrt einen das Tier erstmal minutenlang an -<br />
Elche sind bekannt für ihre Kurzsichtigkeit –, dann, urplötzlich, versucht es<br />
wegzurennen, jedes Bein in eine andere Richtung. Es spielt keine Rolle, daß<br />
sich zu beiden Seiten des Highway Zigtausende Hektar Wald erstrecken.<br />
Dem Elch ist das egal. Ahnungslos läuft er zuerst Richtung New Brunswick,<br />
bevor ihn seine ungelenken Schritte auf halbem Weg zurück in den<br />
Wald treiben, wo er, kaum angekommen, sofort wieder stehenbleibt und<br />
seinen gewohnt verwirrten Gesichtsausdruck aufsetzt, als sagte er sich:<br />
Hallo, Wald. Wie bin ich bloß hierher gekommen? Elche sind dermaßen<br />
konfus im Kopf, daß sie, sobald das Geräusch eines sich nähernden Autos<br />
oder Lastwagens zu hören ist, sogar aus dem Wald heraus auf den Highway<br />
stürmen, in der Hoffnung, dort vor dem Verkehr sicher zu sein.<br />
Erstaunlicherweise gehört der Elch, trotz seines exorbitanten Mangels an<br />
Grips und des eigenartig getrübten Überlebensinstinkts, zu den Tieren in<br />
Nordamerika, die am längsten überlebt haben. Außer Elchen tummelten<br />
sich früher noch Mastodons, Säbelzahntiger, Wölfe, Karibus, Wildpferde<br />
und sogar Kamele im Osten der Vereinigten Staaten, aber alle gingen allmählich<br />
ihrer Ausrottung entgegen, während die Elche einfach weiter durch<br />
die Lande trabten. Das war nicht immer so. Schätzungen zufolge lebten um<br />
die Jahrhundertwende nur noch ein Dutzend Elche in New Hampshire und<br />
in Vermont vermutlich kein einziges Exemplar mehr. Heute gibt es in New<br />
Hampshire ungefähr 5.000 Elche, in Vermont etwa 1.000 und in Maine an<br />
die 30.000. Diese konstanten beziehungsweise steigenden Zahlen sind der<br />
Grund dafür, daß die Tiere wieder zur Jagd freigegeben worden sind. Hierbei<br />
gilt es jedoch zweierlei zu bedenken: Zunächst einmal sind die Zahlen<br />
reine Spekulation. Elche treten nicht zum Zählappell an. Manche Biologen<br />
sind der Ansicht, die Schätzungen könnten bis zu 20 Prozent zu hoch liegen,<br />
was bedeuten würde, daß die Jagd keine Auslese wäre, sondern eine pure<br />
Metzelei. Nicht weniger relevant ist das Argument, daß es zutiefst und unzweifelhaft<br />
unrecht ist, ein so einfältiges und anspruchsloses Tier wie den<br />
Elch zu töten. Dieses hier hätte ich <strong>mit</strong> einer Schleuder erlegen können, <strong>mit</strong><br />
einem Stein oder einem Stock -wahrscheinlich sogar <strong>mit</strong> einer zusammengefalteten<br />
Zeitung –, dabei wollte es doch nur einen Schluck Wasser trinken.<br />
Da kann man doch gleich Jagd auf Kühe machen.<br />
Vorsichtig, um das Tier nicht aufzuschrecken, schlich ich davon, um Katz
Bescheid zu sagen. Als wir wiederkehrten, war der Elch ans Wasser getreten<br />
und trank ungefähr sieben Meter flußaufwärts. »Meine Güte«, keuchte<br />
Katz. Er war begeistert, wie ich zufrieden feststellte. Der Elch schaute zu<br />
uns herüber, kam zu dem Schluß, daß wir ihm nichts Böses wollten, und<br />
trank weiter. Wir beobachteten das Weibchen noch ein paar Minuten lang,<br />
aber die Stechmücken fraßen uns dabei fast auf. Also rissen wir uns von<br />
dem Anblick los und kehrten <strong>mit</strong> einem erhabenen Gefühl zu unserem Zeltlager<br />
zurück. Es war wie eine Bestätigung – wir waren jetzt wirklich in der<br />
Wildnis angekommen -und eine erfreuliche und angemessene Belohnung<br />
für einen Tag der Schinderei.<br />
Wir nahmen unser Abendessen ein, Slim Jims, Rosinen und Snickers, und<br />
zogen uns anschließend vor den Dauerattacken der Mücken in unsere Zelte<br />
zurück. Während wir so dalagen, sagte Katz ziemlich fröhlich: »Anstrengender<br />
Tag heute. Ich bin geschafft.« Redseligkeit zur Schlafenszeit sah<br />
ihm gar nicht ähnlich.<br />
Ein zustimmendes Räuspern meinerseits.<br />
»Ich hatte vergessen, wie anstrengend es ist.«<br />
»Ja, ich auch.«<br />
»Aber die ersten Tage sind immer anstrengend, oder?«<br />
»Ja.«<br />
Er stieß zum Abschluß einen Seufzer aus und gähnte herzhaft. »Morgen<br />
wird es besser«, sagte er, immer noch gähnend. Wahrscheinlich sollte das<br />
heißen, daß er morgen keine Sachen wegwerfen würde. »Also dann, gute<br />
Nacht«, fügte er hinzu.<br />
Ich sah wie gebannt in die Richtung, aus der die Stimme kam. In all den<br />
Wochen unserer gemeinsamen Zeltlager war dies das erste Mal, daß er mir<br />
eine gute Nacht wünschte.<br />
»Gute Nacht«, sagte ich.<br />
Ich drehte mich auf die andere Seite. Er hatte natürlich recht. Die ersten<br />
Tage sind immer schlimm. Morgen würde es bestimmt besser. Minuten<br />
später waren wir beide eingeschlafen.<br />
Wir hatten uns beide geirrt. Der nächste Tag fing ganz gut an, <strong>mit</strong> einem<br />
Morgenrot, das heiße Temperaturen versprach. Es war das erste Mal während<br />
unserer Wanderung, daß wir bei warmem Wetter aufstanden, und wir<br />
freuten uns über diese Premiere. Wir packten unsere Zelte ein, frühstückten<br />
Rosinen und Snickers und brachen auf. Um neun Uhr stand die Sonne bereits<br />
hoch und knallte erbarmungslos auf uns nieder. Normalerweise ist es<br />
im Wald selbst an heißen Tagen einigermaßen kühl, aber heute war die Luft<br />
stickig und feucht, geradezu tropisch. Zwei Stunden nach unserem Aufbruch<br />
kamen wir an eine schätzungsweise knapp einen Hektar große Lagune<br />
voller Schilf, umgestürzter Baumstämme und den nackten Rümpfen
abgestorbener Bäume. Libellen tanzten auf der Wasseroberfläche. Am anderen<br />
Ufer erhob sich ein gigantischer Koloß, der Moxie Bald Mountain, und<br />
wartete auf uns. Aber zunächst stellten wir <strong>mit</strong> großer Beunruhigung fest,<br />
daß der Weg am Rand des Sees abrupt endete. Katz und ich sahen uns an –<br />
hier konnte etwas nicht stimmen. Zum ersten Mal seit damals in Georgia<br />
fragten wir uns ernsthaft, ob wir uns verirrt hatten. (Wer weiß, wie sich<br />
Chicken John in so einer Situation verhalten hätte.) Wir gingen den gleichen<br />
Weg ein gutes Stück zurück, überprüften irritiert unsere Karte und unseren<br />
Trail-Führer, suchten nach einer Alternativroute um den See herum, durch<br />
das dichte, die Haut aufschürfende Unterholz, und gelangten schließlich zu<br />
der Erkenntnis, daß man offenbar von uns erwartete, daß wir den See<br />
durchquerten. Katz entdeckte auf der gegenüberliegenden Seite, knapp 80<br />
Meter entfernt, die Fortsetzung des Wegs und das typische weiße Wanderzeichen<br />
des Appalachian Trail. Wir mußten also durch das Wasser waten.<br />
Katz ging voraus, barfuß und in Boxershorts, nahm einen langen Stock zur<br />
Hilfe und stakte da<strong>mit</strong> durch das Gewirr von halb unter, halb über Wasser<br />
liegenden Baumstämmen. Ich folgte ihm in gebührendem Abstand auf die<br />
gleiche Weise und achtete darauf, daß ich <strong>mit</strong> meinem Gewicht nicht einen<br />
Baumstamm belastete, auf dem er gerade ging. Die Stämme waren <strong>mit</strong> einer<br />
dicken Moosschicht bedeckt und schnellten hoch oder drehten sich, wenn<br />
man auf sie trat. Zweimal wäre Katz beinahe gestürzt. Nach ungefähr 25<br />
Metern verlor er gänzlich den Halt und fiel platschend, <strong>mit</strong> rudernden Armen<br />
und lautem Wehgeschrei in das trübe Wasser. Er tauchte vollständig<br />
unter, tauchte auf, ging wieder unter und kam heftig strampelnd und <strong>mit</strong> den<br />
Armen fuchtelnd hoch, so daß ich im ersten Moment dachte, er würde ertrinken.<br />
Das Gewicht seines Rucksacks zog ihn nach hinten und hinderte<br />
ihn daran, sich aufzurichten oder wenigstens den Kopf über Wasser zu halten.<br />
Ich wollte gerade meinen eigenen Rucksack absetzen und mich in die<br />
Fluten stürzen und ihm zur Hilfe eilen, als Katz einen Baumstamm zu fassen<br />
bekam und sich an ihm in eine aufrechte Haltung hochzog. Das Wasser<br />
reichte ihm bis zur Brust. Er klammerte sich an den Baumstamm, keuchte<br />
schwer vor Anstrengung, wieder zu Atem zu kommen und sich zu beruhigen.<br />
Er hatte offenbar einen gehörigen Schrecken bekommen.<br />
»Geht es wieder?« fragte ich ihn.<br />
»Alles prima«, erwiderte er. »Alles prima. Ich frage mich nur, warum sie<br />
hier keine Krokodile ausgesetzt haben, dann wäre es wenigstens ein richtiger<br />
Abenteuerurlaub.«<br />
Ich kämpfte mich weiter vorwärts, aber nach wenigen Schritten fiel ich auch<br />
ins Wasser. Es gab ein paar Momente, da sah ich die Welt, surreal und wie<br />
in Zeitlupe, aus der ungewöhnlichen Perspektive eines Tauchers, während<br />
sich meine Hand verzweifelt nach einem Baumstamm ausstreckte, ihn aber
knapp verfehlte – all das geschah in einer seltsamen Stille, wie in einer<br />
Blase –, bevor Katz mir <strong>mit</strong> schaufelnden Bewegungen zur Hilfe eilte, mich<br />
zurück in die Welt des Lichts und der Geräusche zog und auf die Beine<br />
stellte. Ich war erstaunt, wie kräftig er war.<br />
»Danke«, prustete ich.<br />
»Keine Ursache.«<br />
Wir wateten <strong>mit</strong> schweren Schritten ans andere Ufer, fielen abwechselnd<br />
hin und halfen uns gegenseitig wieder auf die Beine, krochen die matschige<br />
Böschung hoch, halb verrottete Pflanzen im Schlepptau und <strong>mit</strong> triefenden<br />
Rucksäcken. Wir setzten unsere Last ab und ließen uns völlig durchnäßt und<br />
erledigt auf dem Boden nieder und schauten hinaus auf die Lagune, als hätte<br />
diese uns soeben einen bitterbösen Streich gespielt. Ich wüßte nicht, wann<br />
ich mich je so früh am Tag so erschöpft gefühlt hatte. Plötzlich hörten wir<br />
Stimmen, und zwei junge Hiker, locker, flockig und ziemlich sportlich,<br />
traten aus dem Wald hervor. Sie begrüßten uns <strong>mit</strong> einem Kopfnicken und<br />
schauten abschätzend auf das Wasser.<br />
»Da müßt ihr wohl oder übel durch«, sagte Katz.<br />
Einer der beiden sah ihn erstaunt, aber nicht unfreundlich an. »Seid ihr das<br />
erste Mal in dieser Gegend?« fragte er.<br />
Wir nickten.<br />
»Ich will euch ja nicht den Mut nehmen, aber ihr habt gerade erst da<strong>mit</strong><br />
angefangen, naß zu werden.«<br />
Mit diesen Worten hoben die beiden ihre Rucksäcke über den Kopf,<br />
wünschten uns alles Gute und stiegen ins Wasser. Sie wateten geschickt in<br />
knapp 30 Sekunden hindurch – Katz und ich hatten dafür die gleiche Anzahl<br />
von Minuten gebraucht-, stiegen am anderen Ufer heraus, als hätten sie ein<br />
Fußbad genommen, setzten die trockenen Rucksäcke wieder auf, winkten<br />
kurz zu uns herüber und verschwanden.<br />
Katz holte einmal tief und bedächtig Luft – es war teils ein Seufzer, teils die<br />
Freude über die Fähigkeit, wieder atmen zu können. »Ich will nicht destruktiv<br />
sein, <strong>Bryson</strong>, wirklich nicht, das schwöre ich dir, aber ich weiß nicht, ob<br />
ich für so etwas der Richtige bin. Könntest du deinen Rucksack einfach so<br />
über den Kopf halten?«<br />
»Nein.«<br />
Mit dieser Vorahnung setzten wir uns die Rucksäcke wieder auf und stapften<br />
klatschnaß den Moxie Bald Mountain hinauf.<br />
Die Wanderung entlang des Appalachian Trail ist das Anstrengendste, was<br />
ich je unternommen habe, und der Abschnitt in Maine war bei weitem der<br />
anstrengendste Teil. Das lag zum einen an der Hitze. Maine, das zu den<br />
Bundesstaaten <strong>mit</strong> eher gemäßigtem Klima zählt, wurde gerade von einer
mörderischen Hitzewelle überrollt. In der sengenden Sonne strahlten die<br />
schattenlosen Granitflächen des Moxie Bald eine wahre Gluthitze ab, und<br />
selbst im Wald war die Luft drückend und feucht, als hauchten uns die<br />
Bäume und Blätter ihren heißen Atem entgegen. Wir schwitzten wie die<br />
Tiere und schütteten Unmengen von Wasser in uns hinein, hatten aber<br />
trotzdem permanent Durst. Manchmal war Wasser im Überfluß vorhanden,<br />
aber meistens gab es über weite Strecken keinen einzigen Tropfen, so daß<br />
wir nie sicher sein konnten, wieviel wir vernünftigerweise zu uns nehmen<br />
konnten, ohne später knapp dran zu sein. Selbst bei vollem Vorrat machte es<br />
sich jetzt bemerkbar, daß Katz eine Flasche weggeworfen hatte. Zu alldem<br />
kamen noch die erbarmungslosen Insekten, das beunruhigende Gefühl der<br />
Abgeschiedenheit und das schwierige Gelände hinzu.<br />
Katz reagierte darauf so, wie ich es vorher noch nicht bei ihm erlebt hatte.<br />
Er zeigte eine verbissene Entschlossenheit, als gäbe es nur eine Möglichkeit,<br />
<strong>mit</strong> diesem Problem fertig zu werden: Augen zu und durch.<br />
Am nächsten Morgen gelangten wir in aller Frühe an den ersten von mehreren<br />
Wasserläufen, die wir durchqueren mußten. Er hieß Bald Mountain<br />
Stream, aber in Wahrheit handelte es sich um einen richtigen Fluß – breit,<br />
bewegt und im Flußbett übersät <strong>mit</strong> großen Steinbrocken. Er hatte etwas<br />
sehr Einnehmendes an sich – die Oberfläche glitzerte in der Morgensonne<br />
wie Tausende von Pailletten, und das Wasser war unglaublich klar –, aber<br />
es herrschte eine starke Strömung, und vom Ufer aus konnte man nicht<br />
erkennen, wie tief er in der Mitte war. Es gab einige größere Flüsse in der<br />
Nähe, zu denen mein Appalachian Trail Guide to Maine naiv meinte, es sei<br />
»schwierig oder gefährlich, sie bei Hochwasser zu durchqueren«. Ich beschloß,<br />
diese Information lieber nicht an Katz weiterzugeben.<br />
Wir zogen Schuhe und Strümpfe aus, krempelten die Hosenbeine hoch und<br />
stiegen vorsichtig in das eisige Wasser. Die Steine auf dem Grund hatten<br />
alle möglichen Größen und Formen -flach, eiförmig, rund – und drückten<br />
hart gegen die Fußsohlen, sie waren <strong>mit</strong> einer glitschigen, grünlichen<br />
Schicht bedeckt, die unglaublich rutschig war. Ich hatte noch keine drei<br />
Schritte getan, als ich ausglitt und schmerzhaft auf dem Hintern landete. Ich<br />
rappelte mich halbwegs hoch, rutschte aber wieder aus und stürzte erneut,<br />
taumelte ein, zwei Meter seitwärts, kippte dann hilflos vornüber, konnte<br />
mich <strong>mit</strong> den Händen auffangen und hockte schließlich auf allen vieren wie<br />
ein Hund im Wasser. Beim Aufprall rutschte mir der Rucksack über den<br />
Kopf, und die Schuhe, die ich <strong>mit</strong> den Schnürsenkeln an das Rucksackgestell<br />
gebunden hatte, wurden in eine Art Umlaufbahn geschleudert. Sie<br />
flogen in einem großen eleganten Bogen seitlich am Rucksack vorbei, stießen<br />
gegen meinen Schädel, knallten aufs Wasser auf und schaukelten dann<br />
in der Strömung. Während ich dasaß und mir einredete, daß dies alles eines
schönen Tages nur noch Erinnerung sein würde, kamen zwei Burschen, die<br />
aussahen wie Klone der beiden jungen Männer vom Vortag, selbstsicheren<br />
Schrittes und Wasser spritzend vorbeigeschlendert, ihre Rucksäcke über<br />
ihre Köpfe haltend.<br />
»Hingefallen?« sagte der eine munter.<br />
»Nein. Ich wollte mir nur mal das Wasser von unten ansehen.« Schlaumeier.<br />
Ich ging zurück ans Ufer, zog meine durchweichten Schuhe an und stellte<br />
fest, daß es deutlich einfacher war, den Fluß <strong>mit</strong> festem Schuhwerk statt<br />
barfuß zu durchqueren. Ich konnte mich einigermaßen aufrecht halten, und<br />
die Steine schmerzten auch nicht mehr so wie vorhin an den nackten Füßen.<br />
Ich ging vorsichtig, überrascht von der starken Strömung in der Mitte –<br />
jedesmal, wenn ich ein Bein hob, wollte der Wasserdruck es weiter stromabwärts<br />
absetzen, so als gehörte es zu einem Klapptisch –, aber der Fluß<br />
war an keiner Stelle tiefer als einen knappen Meter, und ich gelangte ohne<br />
einen weiteren Sturz ans andere Ufer.<br />
Katz hatte in der Zwischenzeit eine andere Methode entdeckt, den Fluß zu<br />
durchqueren. Er benutzte die Brocken im Wasser als Trittsteine, fiel aber<br />
zum Schluß <strong>mit</strong>ten in einen tosenden Strudel an einer Stelle, die ziemlich<br />
tief aussah. Er stand da, die Stirn in Falten. Ich konnte mir beim besten<br />
Willen nicht erklären, wie er dahingeraten war – der Brocken ragte einsam<br />
aus der weiten Wasserfläche heraus, um ihn herum lauter gefährliche<br />
Stromschnellen. Katz wußte nicht ein noch aus. Er versuchte, sich langsam<br />
in das silbrig schimmernde Wasser hinabzulassen und die letzten zehn Meter<br />
zum Ufer zu waten, wurde aber auf der Stelle wie ein Spielzeugboot<br />
weggeschwemmt. Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden dachte ich,<br />
er würde ertrinken – er machte jedenfalls einen ziemlich hilflosen Eindruck<br />
–, aber die Strömung trieb ihn zu einer seichten Stelle <strong>mit</strong> glitzernden Kieselsteinen<br />
sechs Meter stromabwärts, wo er Wasser spuckend auf alle viere<br />
kam, ans Ufer kroch und gleich weiter in den Wald stiefelte, ohne einen<br />
Blick zurückzuwerfen, als handele es sich um die normalste Sache der Welt.<br />
Und so ging es im Eiltempo bis nach Monson, über einen beschwerlichen<br />
Pfad und durch noch mehr Flüsse. Unterwegs sammelten wir Narben und<br />
Schrammen auf unserer Haut, und die Insektenstiche verwandelten unseren<br />
Rücken in eine Reliefkarte. Am dritten Tag kamen wir wie benommen vor<br />
lauter Wald und verdreckt an eine sonnenbeschienene Straße, die erste seit<br />
Caratunk. Das letzte Stück bis zu dem verlassenen Flecken Monson war ein<br />
Sommerspaziergang. Unweit vom Zentrum des Städtchens befand sich ein<br />
altes, <strong>mit</strong> Schindeln verkleidetes Haus. Im Vorgarten stand eine bemalte<br />
Holzskulptur, ein bärtiger Hiker, der ein Schild trug: »Willkommen bei<br />
Shaw’s.«
Das Shaw’s ist das berühmteste Gästehaus am Appalachian Trail, zum einen,<br />
weil es die letzte zivilisierte Rast für jeden ist, der sich auf die Hundred-Mile-Wilderness-Tour<br />
begibt, und umgekehrt die erste, für alle, die sie<br />
gerade hinter sich gelassen haben, zum anderen aber auch, weil in dem<br />
Haus eine freundliche Atmosphäre herrscht und es preisgünstig ist. Für 28<br />
Dollar pro Person bekamen wir ein Zimmer, Abendessen und Frühstück und<br />
konnten dazu kostenlos Dusche, Waschmaschine und den Aufenthaltsraum<br />
benutzen. Das Haus wird von Keith und Pat Shaw geführt. Die Gründung<br />
ihrer Herberge vor 20 Jahren verdankten die beiden einem Zufall. Keith<br />
brachte eines Tages einen ausgehungerten Wanderer <strong>mit</strong> nach Hause, der<br />
später weitererzählte, wie nett man ihn hier aufgenommen hatte. Bereits<br />
wenige Wochen danach, berichtete Keith stolz, als wir uns ins Gästebuch<br />
eintrugen, hätten sie den zwanzigtausendsten Hiker begrüßen können.<br />
Es war noch eine Stunde Zeit bis zum Abendessen. Katz lieh sich fünf Dollar<br />
von mir – für Limonade, wie ich annahm – und verschwand auf sein<br />
Zimmer. Ich duschte, stopfte einen Haufen Wäsche in die Maschine und<br />
ging nach draußen auf den Rasen vor dem Haus, wo ein paar robuste Gartenstühle<br />
standen, auf die ich meinen müden Leib zu betten gedachte. Ich<br />
wollte mir eine Pfeife anzünden und mich der glückseligen Behaglichkeit<br />
eines sommerlichen Spätnach<strong>mit</strong>tags und der angenehmen Vorfreude auf<br />
ein wohlverdientes Abendessen hingeben. Aus einem Fenster in der Nähe<br />
hörte ich das Klappern von Pfannen, wenig später ein Brutzeln. Ich wußte<br />
nicht, was dort gebraten wurde, aber es roch lecker.<br />
Nach einer Minute trat Keith vor die Tür und setzte sich zu mir. Keith war<br />
ein alter Mann, weit über 60, er hatte fast keine Zähne mehr und einen Körper,<br />
der so aussah, als hätte er schon so manches aushaken müssen. Keith<br />
war ziemlich nett.<br />
»Du hast doch hoffentlich nicht den Hund gestreichelt, oder?« sagte er.<br />
»Nein.« Ich hatte das Tier vom Fenster aus gesehen, ein häßlicher, bösartiger<br />
Mischling, der auf der Rückseite des Hauses angebunden war und sich<br />
bei jedem Geräusch und jeder kleinsten Bewegung im Umkreis von 100<br />
Metern unangemessen in Rage kläffte.<br />
»Nicht, daß du auf die Idee kommst, ihn zu streicheln. Laß dir das gesagt<br />
sein: bloß nicht den Hund streicheln. Gerade letzte Woche hat einer ihn<br />
gestreichelt, obwohl ich ihn gewarnt hatte. Der Hund hat ihm in die Eier<br />
gebissen.«<br />
»Wirklich?«<br />
Er nickte. »Er wollte gar nicht wieder loslassen. Du hättest den Kerl jaulen<br />
hören sollen.«<br />
»Wirklich?«<br />
»Ich mußte dem Hund eins <strong>mit</strong> der Hake überbraten, da<strong>mit</strong> er losließ. Glaub
mir, das ist der gemeinste Scheißköter, den ich je gesehen habe.«<br />
»Und wie ist es dem armen Kerl ergangen?«<br />
»Na ja, gefreut hat er sich nicht gerade darüber, das kann ich dir sagen.« Er<br />
kratzte sich nachdenklich am Hals, als fiele ihm ein, daß er sich demnächst<br />
mal wieder rasieren müßte. »War auch noch ein Weitwanderer. Ist den<br />
ganzen Weg von Georgia bis hierher zu Fuß gegangen. Ziemlich weit, um<br />
sich seine Eier anknabbern zu lassen.« Mit diesen Worten stand er auf, um<br />
nach dem Abendessen zu sehen.<br />
Das Abendessen wurde an einem langen Eßtisch serviert, und es wurde<br />
großzügig aufgetragen, Platten <strong>mit</strong> Fleisch, Schüsseln <strong>mit</strong> Kartoffelpüree<br />
und Maiskolben, ein windschiefer Holzteller <strong>mit</strong> Brot und ein Napf <strong>mit</strong><br />
Butter. Katz kam etwas später dazu, frisch geduscht und rundum zufrieden.<br />
Er wirkte außergewöhnlich, fast übertrieben energiegeladen und kitzelte<br />
mich beim Vorübergehen spontan am Rücken, was überhaupt nicht seine<br />
Art war.<br />
»Geht’s gut?« fragte ich.<br />
»Mir ist es noch nie so gut gegangen, mein alter Wanderfreund, noch nie.«<br />
Es setzten sich noch zwei andere Gäste zu uns an den Tisch, ein niedliches,<br />
etwas verschüchtert wirkendes und irgendwie züchtiges Pärchen, beide<br />
sonnengebräunt und kräftig und ebenfalls frisch geduscht. Katz und ich<br />
begrüßten sie <strong>mit</strong> einem Lächeln und fingen an, unsere Teller vollzuladen,<br />
als wir merkten, daß die beiden ein Tischgebet murmelten. Es schien kein<br />
Ende zu nehmen. Wir fingen trotzdem an zu essen.<br />
Es schmeckte phantastisch. Keith agierte als Kellner und bestand darauf,<br />
daß wir reichlich aßen. »Wenn ihr es nicht eßt, kriegt es der Hund«, sagte<br />
er. Das Vieh ließ ich nur zu gern hungern.<br />
Die beiden jungen Leute waren Weitwanderer aus Indiana und am 28. März<br />
am Springer Mountain aufgebrochen – ein Datum, das jetzt, in der sommerlichen<br />
Hitze eines Augustabends, unendlich weit entfernt war und irgendwie<br />
nach Schnee roch – und waren 141 Tage am Stück gewandert. Sie hatten<br />
3.291,82 Kilometer zurückgelegt und noch 184,9 Kilometer vor sich.<br />
»Dann habt ihr es ja bald geschafft«, sagte ich, nur um ein Gespräch anzuknüpfen.<br />
»Ja«, antwortete die Frau. Sie sagte es betont langsam, fast in zwei Silben,<br />
als wäre ihr der Gedanke noch nie vorher gekommen. Ihre Art hatte etwas<br />
heiter Unbekümmertes an sich.<br />
»Habt ihr je daran gedacht aufzugeben?«<br />
Die Frau überlegte einen Moment lang. »Nein«, lautete die schlichte Antwort.<br />
»Wirklich nicht?« Ich fand das erstaunlich. »Habt ihr nie gedacht: meine<br />
Güte, es reicht. Ich kann einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe
keine Lust mehr?«<br />
Sie überlegte wieder, wobei leichte Panik sie erfaßte. Das waren Fragen,<br />
über die sie sich offenbar bisher noch nie den Kopf zerbrochen hatte.<br />
Ihr Freund eilte ihr zur Hilfe. »Es gab am Anfang ein paar schwierige Phasen«,<br />
sagte er, »aber wir haben unser ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt, und<br />
Sein Wille geschah.«<br />
»Lobet den Herrn«, flüsterte die Frau fast unhörbar.<br />
»Ach so«, sagte ich und nahm mir vor, unbedingt meine Zimmertür abzuschließen,<br />
wenn ich nachher ins Bett ging.<br />
»Und gesegnet sei Allah für das Kartoffelpüree«, sagte Katz vergnügt und<br />
lud sich zum dritten Mal auf.<br />
Nach dem Abendessen schlenderten Katz und ich ein Stück die Straße hinunter<br />
zu einem kleinen Lebens<strong>mit</strong>telladen, um Proviant für die Hundred-<br />
Mile-Wilderness-Tour zu kaufen, zu der wir morgen aufbrechen wollten.<br />
Katz benahm sich irgendwie komisch in dem Laden. Er wirkte einigermaßen<br />
munter, aber auch abwesend und unruhig. Wir mußten immerhin für<br />
zehn Tage in der Wildnis einkaufen, eine ziemlich ernste Angelegenheit,<br />
aber er war nicht gewillt, sich zu konzentrieren, und spazierte einfach weiter<br />
oder holte lauter unpassende Sachen aus den Regalen, wie Chilisoße und<br />
Büchsenöffner.<br />
»He, wie war’s <strong>mit</strong> einem Sechserpack Bier«, sagte er plötzlich in Partylaune.<br />
»Komm, Stephen, bleib doch mal bei der Sache«, sagte ich. Ich begutachtete<br />
gerade die Käsesorten.<br />
»Ich bin bei der Sache.«<br />
»Willst du lieber Cheddar oder Colby?«<br />
»Mir egal.« Er schlenderte zum Bierregal und kam <strong>mit</strong> einem Sechserpack<br />
Budweiser unterm Arm zurück.<br />
»Na, was hältst du von einem Sechserpack Budweiser. Ein Sechserpack<br />
Bud, Buddy?« Er stupste mich in die Seite, um mich auf seinen Wortwitz<br />
aufmerksam zu machen.<br />
Ich zuckte vor dem Stupser zurück, abgelenkt von anderen Dingen. »Hör<br />
auf, so rumzualbern, Stephen.« Ich war zu dem Regal <strong>mit</strong> Süßigkeiten und<br />
Plätzchen weitergegangen und überlegte, was wohl zehn Tage halten würde,<br />
ohne daß es unterwegs zu einer klebrigen Masse zerschmolz oder völlig<br />
zerbröselt würde. »Willst du Snickers, oder möchtest du mal was anderes<br />
ausprobieren?« fragte ich.<br />
»Ich will Budweiser.« Er grinste, doch als er merkte, daß ich nicht darauf<br />
eingehen würde, bekam seine Stimme plötzlich einen eindringlichen, flehentlicheren<br />
Tonfall. »Bitte, <strong>Bryson</strong>, kannst du mir« – er sah auf das Preis-
schild – »vier Dollar und 79 Cents leihen? Ich bin pleite.«<br />
»Was ist denn <strong>mit</strong> dir los, Stephen? Stell das Bier weg. Was ist überhaupt<br />
<strong>mit</strong> den fünf Dollar, die ich dir eben gegeben habe?«<br />
»Schon ausgegeben.«<br />
»Wofür?« Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. »Du hast<br />
wieder getrunken, stimmt’s?«<br />
»Nein«, sagte er entrüstet, als müßte er eine ungeheuerliche und verleumderische<br />
Unterstellung zurückweisen.<br />
Er war betrunken, jedenfalls fast. »Doch, das stimmt«, sagte ich völlig baff.<br />
Er seufzte und verdrehte leicht die Augen. »Vier halbe Michelob. Was ist<br />
das denn schon?«<br />
»Du hast wieder getrunken.« Ich war bestürzt. »Wann hast du wieder da<strong>mit</strong><br />
angefangen?«<br />
»In Des Moines. Nur ein bißchen. Ein paar Bierchen nach der Arbeit, mehr<br />
nicht. Kein Grund zur Aufregung.«<br />
»Du weißt doch, daß du nicht trinken darfst, Stephen.«<br />
Das wollte er nicht hören. Er sah aus wie ein vierzehnjähriger Junge, dem<br />
man gesagt hat, er soll sein Zimmer aufräumen. »Erspar dir deine Belehrungen,<br />
<strong>Bryson</strong>.«<br />
»Ich kaufe dir kein Bier«, sagte ich ruhig.<br />
Er grinste wieder, als sei ich die Tugend in Person. »Mach schon. Ich will<br />
doch nur ein Sechserpack.«<br />
»Nein!«<br />
Ich war wütend, stinksauer – seit Jahren war ich nicht mehr so wütend über<br />
etwas gewesen. Ich konnte nicht fassen, daß er wieder angefangen hatte zu<br />
trinken. Es kam mir vor wie ein gemeiner, törichter Verrat- an sich selbst,<br />
an mir, an unserer gemeinsamen Unternehmung.<br />
Katz sah mich immer noch <strong>mit</strong> einem schelen Grinsen an, aber es stimmte<br />
nicht mehr <strong>mit</strong> seinen Gefühlen überein. »Du willst mir also kein Bier ausgeben<br />
– nach allem, was ich für dich getan habe?«<br />
Das war ein ziemlicher Tiefschlag. »Nein.«<br />
»Dann leck mich doch am Arsch«, sagte er, machte auf dem Absatz kehrt<br />
und ging raus.
20. Kapitel<br />
Das trübte natürlich die Stimmung, wie man sich vorstellen kann. Wir sprachen<br />
nicht mehr darüber, aber es stand immer zwischen uns. Beim Frühstück<br />
wünschten wir uns gegenseitig guten Morgen, wie üblich, aber ansonsten<br />
wechselten wir kein Wort <strong>mit</strong>einander. Als wir uns kurz darauf neben<br />
dem Wagen von Keith einfanden, der versprochen hatte, uns zum Startpunkt<br />
des Trails zu bringen, standen wir verlegen schweigend da, wie zwei Kontrahenten<br />
in einem Rechtsstreit, die gleich vor ihren Richter geführt werden<br />
sollen.<br />
Am Waldrand, wo wir ausstiegen, war ein Schild aufgestellt, das besagte,<br />
hier sei der Anfang der Hundred Mile Wilderness, und es folgte eine ausführliche,<br />
sehr nüchtern formulierte Warnung, daß das, was vor einem läge,<br />
kein gewöhnlicher Abschnitt des Appalachian Trail sei und daß man nur<br />
weitermachen solle, wenn man Proviant für zehn Tage dabeihabe und sich<br />
fühle wie die Leute in einem Patagonia-Werbespot.<br />
Die Warnung verlieh dem Wald etwas Geheimnisvolles, Düsteres. Er war<br />
zweifellos anders als die Wälder weiter südlich -dunkler, schattiger, eher<br />
schwarz als grün. Hier standen auch andere Bäume – in den tieferen Lagen<br />
mehr Nadelbäume und sehr viel mehr Birken –, und verstreut im Unterholz<br />
lagen runde, schwarze Felsen, wie schlafende Tiere, die den stillen Schlupfwinkeln<br />
etwas Gespenstisches gaben. Als Walt Disney aus der Geschichte<br />
von Bambi einen Film machte, sollen die Bilder nach Vorlagen der Great<br />
North Woods in Maine entstanden sein, aber das hier war eindeutig kein<br />
Wald a la Disney, <strong>mit</strong> weiten Tälern und niedlichen Tieren. Dieser Wald<br />
erinnerte eher an den aus dem Film Der Zauberer von Oz, wo die Bäume<br />
häßliche Fratzen tragen und einem feindselig gesonnen sind und wo jeder<br />
Schritt Gefahr bedeutet. Das hier war ein Wald wie geschaffen für Bären,<br />
die hinter Bäumen lauern, Schlangen, die von Ästen herabbaumeln, Wölfen<br />
<strong>mit</strong> laserstrahlroten Augen, ein Wald voller seltsamer Geräusche, voller<br />
Schrecken – ein Ort, »an dem die Nacht haust«, wie Thoreau es so treffend<br />
ausgedrückt hat.<br />
Wie üblich war der Trail sehr gut markiert, nur an manchen Stellen war er<br />
fast überwuchert von Farnkräutern und Buschwerk, das von den Wegrändern<br />
auf die Mitte hin zuwuchs und den eigentlichen Pfad auf eine kaum<br />
erkennbare Linie am Waldboden reduzierte. Da nur 10 Prozent der Weitwanderer<br />
es bis hierher schaffen und dieser Abschnitt für eine Tagestour zu<br />
weit entfernt ist, wird der Trail in Maine kaum frequentiert, so erobern die<br />
Pflanzen ihn wieder zurück. Was diesen Abschnitt des Trails allerdings<br />
besonders von den anderen unterscheidet, ist das Gelände. Im Profil sieht<br />
die Topographie des AT auf dem 29 Kilometer langen Abschnitt zwischen
Monson und Barren Mountain recht anspruchslos aus, zieht sich in einer<br />
mehr oder weniger gleichbleibenden Höhe von 365 Metern hin, <strong>mit</strong> nur<br />
wenigen steilen An- und Abstiegen. In Wahrheit ist der Weg die Hölle.<br />
Bereits nach einer halben Stunde kamen wir an eine Felswand, die erste von<br />
vielen, ungefähr 120 Meter hoch. Der Weg führte an der Vorderseite über<br />
eine Art Rinne nach oben, die wie ein Aufzugschacht aussah. Der Hang<br />
ragte fast senkrecht auf. Ein Grad mehr, und man hätte von einer Kletterwand<br />
sprechen müssen. Langsam und mühselig bahnten wir uns den Weg<br />
über Streinbrocken und zwischen ihnen hindurch, wobei wir Hände und<br />
Füße benutzten. Zu den Strapazen kam noch die schier unerträgliche Hitze.<br />
Ich mußte alle zehn, zwölf Meter anhalten, verschnaufen und mir den beißenden<br />
Schweiß aus den Augen wischen. Mir war schrecklich heiß, ich war<br />
schweißgebadet, geradezu in Schweißtücher gewickelt. Ich trank während<br />
des Aufstiegs meine Wasserflasche dreiviertel leer und benetzte <strong>mit</strong> dem<br />
Rest mein Stirnband, das ich mir zur Kühlung meines Kopfes, in dem es<br />
wie rasend hämmerte, umgebunden hatte. Ich fühlte mich überhitzt, und mir<br />
war schwindlig. Das konnte gefährlich werden. Ich legte häufigere und<br />
längere Ruhepausen ein, um mich zu erfrischen, aber jedesmal, wenn ich<br />
mich wieder erhob, kam die nächste Hitzewelle über mich. Ich hatte noch<br />
nie so hart und mühsam ackern müssen, um ein Hindernis auf dem Appalachian<br />
Trail zu überwinden, und das war gerade mal das erste von vielen, die<br />
noch folgen sollten.<br />
Oben lag ein mehrere hundert Meter langer, kahler, sanft abfallender Granitfels<br />
vor uns. Es war, als würde man auf dem Rücken eines Wals Spazierengehen.<br />
Von jedem Gipfel aus bot sich ein sensationeller Ausblick – ein<br />
wogender grüner Wald, klare blaue Seen und einsame erhabene Berge,<br />
soweit das Auge reichte. Viele Seen waren riesig, und in den meisten hatte<br />
vermutlich noch nie ein Mensch gebadet. Ich hatte das wohlige Gefühl, in<br />
einen verborgenen Winkel der Erde einzudringen, aber bei dieser mörderischen<br />
Hitze konnte man sich diesem Gefühl unmöglich ganz hingeben.<br />
Danach folgte ein schwieriger und zermürbender Abstieg über eine Felsklippe<br />
auf der anderen Seite, dann ein kurzer Gang durch ein dunkles Tal,<br />
das uns zur nächsten Felswand brachte. So verging der Tag <strong>mit</strong> gewaltigen<br />
Kletterpartien und der Hoffnung auf Wasser hinter dem nächsten Berg.<br />
Hauptsächlich diese Hoffnung hielt uns aufrecht. Katz hatte sein Wasser<br />
sehr schnell aufgebraucht; ich bot ihm von meinem an, was er dankbar und<br />
<strong>mit</strong> einem Blick, der um Waffenstillstand bat, annahm. Aber es lag noch<br />
immer etwas Unausgesprochenes zwischen uns, das schale Gefühl, daß sich<br />
etwas verändert hatte und daß es nie wieder so sein würde wie vorher.<br />
Es war meine Schuld. Ich ging stur weiter, viel weiter als wir normalerweise<br />
gegangen wären und ohne mich <strong>mit</strong> ihm abzusprechen. Es war die heimli-
che Strafe dafür, daß er das Gleichgewicht zwischen uns zerstört hatte, und<br />
Katz ertrug sie schweigend und bußfertig. Wir legten 22,5 Kilometer zurück,<br />
eine ungewöhnlich weite Strecke unter diesen Umständen. Wir hätten<br />
auch noch weiter gehen können, aber um halb sechs kamen wir an einen<br />
breiten Fluß, Wilber Brook, wo wir Halt machten. Wir waren zu müde, um<br />
ihn zu durchqueren – das heißt, ich war zu müde –, und es wäre nicht klug<br />
gewesen, die Gefahr einzugehen, so kurz vor Sonnenuntergang noch einmal<br />
ganz naß zu werden. Wir schlugen unser Lager auf und verzehrten unseren<br />
Proviant ohne Freude und <strong>mit</strong> bemühter Höflichkeit. Selbst wenn keine<br />
Verstimmung zwischen uns geherrscht hätte, wäre kaum gesprochen worden,<br />
dazu waren wir viel zu müde. Es war ein langer Tag gewesen, der<br />
anstrengendste der ganzen Tour, und der Gedanke, daß wir noch 136 Kilometer<br />
vor uns hatten, bis wir den Laden am Zeltplatz von Aböl Bridge erreichen<br />
würden, und 160 Kilometer bis zu dem herausfordernden Massiv<br />
von Katahdin, schwebte wie ein Damoklesschwert über uns.<br />
Aber auch dort gab es keine Aussicht auf irgendwelche Annehmlichkeiten.<br />
Katahdin liegt im Baxter State Park, der sich <strong>mit</strong> trotzigem Stolz dem Ideal<br />
der Ursprünglichkeit und Entbehrung verschrieben hat. Es gibt keine Restaurants<br />
und keine Hütten, keine Souvenirläden und Imbißstände, nicht mal<br />
eine asphaltierte Straße oder einen öffentlichen Fernsprecher. Der Park<br />
selbst liegt in einer gottverlassenen Gegend, einen Zwei-Tages-Marsch von<br />
Millinocket, der nächsten Stadt, entfernt. Es konnte zehn bis elf Tage dauern,<br />
bis wir wieder eine richtige Mahlzeit zu uns nehmen und in einem<br />
richtigen Bett schlafen würden. Das war noch ganz schön lange hin.<br />
Am nächsten Morgen wateten wir schweigend durch den Fluß – <strong>mit</strong>tlerweile<br />
hatten wir Übung darin – und machten uns an den langen, sanften Aufstieg<br />
zum Dach der Barren-Chairback-Range, einer sich über 24 Kilometer<br />
hinziehenden zerklüfteten Gipfelkette, die wir überqueren mußten, um zu<br />
dem etwas sanfteren Abschnitt im Tal des Pleasant River dahinter zu gelangen.<br />
Auf der Karte waren nur drei kleine Gletscherseen eingezeichnet,<br />
Überreste der Eiszeit, allesamt abseits des Trails; sonst gab es nicht den<br />
geringsten Hinweis auf andere Wasserreservoirs. Mit nicht einmal vier<br />
Litern für uns beide und bei den hohen Temperaturen bereits am frühen<br />
Morgen versprach die Kraxelei von einer Wasserquelle zur nächsten recht<br />
ungemütlich zu werden.<br />
Der Aufstieg zum Barren Mountain war eine mühselige Schinderei, auf<br />
weiten Strecken steil, und es war heiß, aber wir beide schienen auch an<br />
Kraft zu gewinnen. Selbst Katz ging die Sache relativ beschwingt an. Dennoch<br />
brauchten wir fast den ganzen Morgen für die 7,24 Kilometer dort<br />
hinauf. Ich erreichte den Gipfel etwas eher als Katz. Der Granitstein war<br />
von der Sonne so aufgewärmt, daß er zu heiß zum Sitzen war, aber es ging
ein leichter Wind – der erste seit Tagen –, und ich fand eine schattige Stelle<br />
unter einem ausgedienten Beobachtungsturm. Es war das erste Mal seit<br />
Wochen, wenigstens kam es mir so vor, daß ich mal wieder einen einigermaßen<br />
bequemen Platz gefunden hatte. Ich lehnte mich zurück und hatte ein<br />
Gefühl, als könne ich monatelang schlafen. Katz kam zehn Minuten später,<br />
schwer keuchend, aber zufrieden, daß er es bis hier geschafft hatte. Er ließ<br />
sich auf einem Stein neben mir nieder. Ich hatte noch ein Restchen Wasser<br />
übrig und reichte Katz meine Flasche. Er trank einen bescheidenen Schluck<br />
und wollte mir die Flasche zurückgeben.<br />
»Trink aus«, sagte ich, »du hast sicher Durst.«<br />
»Danke.« Er trank einen noch bescheideneren Schluck als vorher und stellte<br />
die Flasche ab. Er blieb eine Weile ruhig sitzen und holte dann ein Snickers<br />
hervor, brach den Riegel in zwei Stücke und gab mir die eine Hälfte. Es war<br />
eine komische Geste. Ich hatte selbst genug Snickers dabei, und das wußte<br />
er auch, aber er hatte sonst nichts, was er <strong>mit</strong> mir teilen konnte.<br />
»Danke«, sagte ich.<br />
Er biß einen Happen von dem Riegel ab, kaute eine Minute lang und sagte<br />
dann ganz unver<strong>mit</strong>telt: »Freundin und Freund unterhalten sich. Sagt die<br />
Freundin zu dem Freund, >Wie schreibt man eigentlich Pädophilie, Jimmy?<<br />
Der Freund sieht sie erstaunt an. >Meine Güte
sage dir, wenn man das jeden Tag macht, fällt es einem schwer, sich einzureden,<br />
man würde ein ausgefülltes und aufregendes Leben führen. Das persönliche<br />
Stimmungsbarometer schlägt nicht gerade bis zum orgiastischen<br />
Bereich aus, nur weil man sich sein eigenes Fertiggericht kocht. Verstehst<br />
du, was ich meine?«<br />
Er warf mir einen Blick zu und sah, daß ich nickte.<br />
»Und so kam es, daß mich die Kollegen eines Tages wieder zum x-ten Mal<br />
einluden, und ich dachte: Ach, Scheiße, was soll’s, kein Gesetz verbietet<br />
mir, so wie jeder andere auch in eine Kneipe zu gehen. Also ging ich <strong>mit</strong>,<br />
trank meine Cola, und alles war in Ordnung. Es war schön, einfach mal<br />
wieder auszugehen. Es gab nur einen Spinner unter den Kollegen, Dwayne,<br />
der mich ständig blöd anmachte. >Na los, bestell dir schon ein Bier. Du<br />
weißt doch, daß du eins trinken willst. Ein kleines Bierchen kann nicht<br />
schaden. Du hast seit drei Jahren keinen Schluck mehr getrunken. Du<br />
kriegst das schon hin.
Ich lächelte ihn kurz an. »Wie das allerletzte Arschloch«, sagte ich.<br />
Er schnäuzte sich und lachte dabei. »Ja, schon möglich.«<br />
Ich beugte mich zu ihm hinüber und klopfte ihm verlegen, aber liebevoll auf<br />
die Schulter. Er ließ es <strong>mit</strong> einem Anflug von Dankbarkeit geschehen.<br />
»Und weißt du, was das Schlimmste ist?« sagte er plötzlich in einem Ton,<br />
als müsse er sich <strong>mit</strong> Gewalt am Riemen reißen. »Was gäbe ich jetzt für ein<br />
Fertiggericht! Ich könnte jetzt glatt jemanden dafür umlegen. Wirklich.«<br />
Wir lachten.<br />
»Truthahnbraten für den großen Hunger, <strong>mit</strong> künstlichen Innereien und 40<br />
Prozent Fettanteil. Hmmm. Lecker. Für einmal dran schnuppern würde ich<br />
dich glatt im Stich lassen.« Dann wischte er sich etwas aus den Augenwinkeln,<br />
sagte: »Ach, Scheiße«, stand auf und pinkelte über den Rand der<br />
Klippe.<br />
Ich sah ihm hinterher, er wirkte alt und müde, und für einen Moment fragte<br />
ich mich, was wir hier oben eigentlich verloren hatten. Wir waren keine<br />
kleinen Jungs mehr.<br />
Ich schaute auf die Karte. Wir hatten praktisch kein Wasser mehr, aber es<br />
war nur etwas über einen Kilometer bis zum Cloud Pond, wo wir unsere<br />
Flaschen auffüllen konnten. Wir teilten uns den allerletzten Schluck, und<br />
ich sagte Katz, ich würde schon mal vorausgehen zu dem See und Wasser<br />
filtern, dann sei es fertig, wenn er dazustoße.<br />
Es war ein netter Spaziergang von 20 Minuten entlang einer grasbewachsenen<br />
Kammlinie. Cloud Pond lag am Ende eines steilen Seitenwegs, ungefähr<br />
400 Meter neben dem eigentlichen Trail. Ich lehnte meinen Rucksack<br />
gegen einen Baum oben am Wegesrand und ging <strong>mit</strong> unseren Wasserflaschen<br />
und dem Filter runter zum Seeufer.<br />
Ich brauchte ungefähr 20 Minuten, um an den See zu gelangen, die drei<br />
Flaschen zu füllen und auf den AT zurückzukehren, so daß insgesamt etwa<br />
40 Minuten vergangen waren, seit ich Katz zuletzt gesehen hatte. Eigentlich<br />
hätte er längst da sein müssen, selbst wenn er noch etwas auf dem Gipfel<br />
verweilt hätte und auch, wenn man sein langsames Tempo berücksichtigte.<br />
Außerdem war es ein leichter Weg, und ich wußte, daß er Durst hatte, ich<br />
fand es daher seltsam, daß er nicht schneller war. Ich wartete 15 Minuten,<br />
20 Minuten, 25 Minuten, schließlich ließ ich meinen Rucksack stehen und<br />
ging zurück, um nach ihm zu suchen. Es war über eine Stunde her, daß wir<br />
uns zuletzt gesehen hatten, als ich den Gipfel jetzt wieder erreichte – aber<br />
Katz war nicht da.<br />
Ich stand einigermaßen verwirrt an der Stelle, wo wir eben noch gesessen<br />
hatten. Seine Sachen waren weg. Offenbar war er losgegangen, aber er war<br />
weder auf dem Barren Mountain noch am Cloud Pond und auch nicht auf<br />
dem Weg dazwischen – wo steckte er bloß? Die einzige Erklärung war, daß
er in die andere Richtung gegangen war. Eigentlich unmöglich. Katz hätte<br />
mich niemals ohne eine Erklärung im Stich gelassen. Nie. Oder war er irgendwo<br />
unterwegs auf dem Grat gestürzt? Es war ein absurder Gedanke,<br />
denn der Weg war nicht im mindesten schwierig oder gar gefährlich, aber<br />
man konnte ja nie wissen. John Connolly hatte uns vor einigen Wochen von<br />
einem Freund berichtet, der bei großer Hitze ohnmächtig geworden war, auf<br />
einem sicheren und ebenen Weg gestürzt war und stundenlang ein paar<br />
Meter neben dem Weg in der brütenden Sonne gelegen hatte, bis er langsam<br />
austrocknete. Ich suchte den ganzen Trail bis zur Abzweigung zum Cloud<br />
Pond nach frischen Spuren ab, besonders den Wegrand, und schaute in<br />
Abständen über den Kamm, jedesmal in Angst, Katz in verrenkter Haltung<br />
unten auf einem Stein liegend zu entdecken. Ich rief mehrere Male laut<br />
seinen Namen, aber bekam nur das Echo meiner eigenen schwächer werdenden<br />
Stimme zur Antwort.<br />
Als ich zur Abzweigung kam, waren es zwei Stunden, seit ich Katz zuletzt<br />
gesehen hatte. Langsam wurde mir die Sache unheimlich. Die einzige noch<br />
verbliebene Möglichkeit war, daß er an der Abzweigung vorbeigegangen<br />
war, als ich gerade unten am See das Wasser filterte, aber auch das war<br />
eigentlich höchst unwahrscheinlich. Oben am Trail hing deutlich sichtbar<br />
ein Pfeil, auf dem »Cloud Pond« stand, und mein Rucksack hatte darunter<br />
am selben Baum gelehnt. Selbst wenn ihm beides nicht aufgefallen wäre,<br />
hätte er doch gewußt, daß Cloud Pond nur anderthalb Kilometer vom Barren<br />
Mountain entfernt war. Wenn man den AT über so lange Zeit abgewandert<br />
war wie wir, kann man einen Kilometer ziemlich genau abschätzen. Er<br />
konnte nicht allzu weit über die Abzweigung hinaus gegangen sein, ohne<br />
daß er seinen Fehler bemerkt hätte und zurückgekommen wäre. Das ergab<br />
keinen Sinn.<br />
Katz war allein da draußen in der Wildnis, ohne Wasser, ohne Karte, ohne<br />
eine genaue Vorstellung von der Beschaffenheit des Geländes vor ihm,<br />
wahrscheinlich ohne irgendeine Vorstellung davon, wie es mir erging, und<br />
<strong>mit</strong> einem beängstigenden Mangel an Gespür für das Richtige. Wenn es<br />
jemanden gab, der in dem Fall, daß er sich verirrte, den Weg verlassen und<br />
eine Abkürzung suchen würde, dann war es Katz. Allmählich machte ich<br />
mir ernsthaft Sorgen. Ich hinterließ einen Zettel auf meinem Rucksack und<br />
ging den Trail weiter. Nach ungefähr 800 Metern führte der Weg fast 180<br />
Meter senkrecht bergab in ein einsames namenloses Hochtal. Er hätte sicher<br />
längst gemerkt, daß er falsch gegangen war. Ich hatte ihm gesagt, der Weg<br />
zum Cloud Pond führe über leichtes und ebenes Gelände.<br />
Ich kletterte vorsichtig den Hang hinunter, rief in Abständen Katz’ Namen<br />
und befürchtete das Schlimmste – es war eine Klippe, die man leicht hinunterstürzen<br />
konnte, besonders, wenn man <strong>mit</strong> einem schweren sperrigen
Rucksack beladen war und <strong>mit</strong> den Gedanken woanders war, aber ich entdeckte<br />
keine Spur von Katz. Ich folgte dem Trail noch drei Kilometer weiter<br />
durch das Tal und wieder hinauf zu einem hohen Felsgipfel, der sich<br />
Fourth Mountain nannte. Oben bot sich ein unglaublich weiter Ausblick in<br />
alle Richtungen, die Wildnis war mir noch nie so riesig erschienen. Ich rief<br />
wieder mehrmals laut Katz’ Namen, aber ich erhielt keine Antwort.<br />
Mittlerweile war es später Nach<strong>mit</strong>tag, Katz war jetzt schon vier Stunden<br />
ohne einen Tropfen Wasser. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ein Mensch<br />
bei dieser Hitze ohne Wasser auskommen konnte, aber ich wußte aus eigener<br />
Erfahrung, daß es nach einer halben Stunde Marschierens ziemlich<br />
ungemütlich werden konnte. Mir sank der Mut bei dem Gedanken, daß er<br />
von oben vielleicht einen anderen See entdeckt hatte – in dem Tal, über 600<br />
Meter unter uns, lag verstreut ein halbes Dutzend Seen – und in seiner Verwirrung<br />
beschlossen hatte, querfeldein zu gehen. Auch wenn er nicht verwirrt<br />
war, hatte ihn vielleicht der Durst dazu getrieben, sich auf den Weg zu<br />
einem dieser Seen zu machen. Sie sahen herrlich und einladend aus. Der<br />
nächste war nur drei Kilometer weit entfernt, aber es gab keinen angelegten<br />
Pfad dorthin, und man hätte einen gefährlichen Abhang im Wald hinunterklettern<br />
müssen. Mitten im Wald, ohne jede Orientierung, kann man einen<br />
Weg leicht um 1.000 Meter verfehlen. Andererseits konnte es auch passieren,<br />
daß man nur 50 Meter davon entfernt war und es nicht wußte, so wie es<br />
uns ein paar Tage vorher <strong>mit</strong> dem Pleasant Pond ergangen war. Und wenn<br />
man sich in diesen riesigen Wäldern erstmal richtig verirrt hatte, konnte<br />
man ohne weiteres darin den Tod finden. So einfach war das. Es würde<br />
niemand kommen, um einen zu retten. Kein Hubschrauber würde einen<br />
durch die dichte Blätterdecke hindurch von oben sehen. Keine Rettungsmannschaften<br />
würden einen finden. Wahrscheinlich würde nicht mal eine<br />
aufbrechen, um nach einem zu suchen. Es gab Bären in dieser Gegend,<br />
Bären, die wahrscheinlich noch nie einen Menschen gesehen hatten. Ich<br />
bekam regelrecht Kopfschmerzen bei dem Gedanken, was Katz alles zugestoßen<br />
sein konnte.<br />
Ich ging zurück zu der Abzweigung zum Cloud Pond und hoffte, inständiger<br />
als ich je in meinen Leben etwas gehofft hatte, daß er auf seinem Rucksack<br />
saß und es eine witzige, von mir bisher nur noch nicht berücksichtigte<br />
Erklärung für alles gab, etwa, daß wir permanent aneinander vorbeigelaufen<br />
waren, wie in einer Slapstick-Komödie: Er wartet verdutzt neben meinem<br />
Rucksack, geht dann los und sucht mich, ich komme eine Sekunde später,<br />
warte verwundert auf ihn und gehe dann auch los – aber ich ahnte, daß er<br />
nicht da sein würde, und so war es auch. Es war fast dunkel, als ich an die<br />
Stelle kam. Ich schrieb nochmal eine Nachricht und legte sie unter einen<br />
Stein <strong>mit</strong>ten auf dem Trail – nur für den Fall –, setzte den Rucksack auf und
ging runter zum See, wo eine Hütte stand.<br />
Ironischerweise handelte es sich um den schönsten Lagerplatz, den ich je<br />
am Appalachian Trail gesehen hatte, und ausgerechnet hier war Katz nicht<br />
dabei. Cloud Pond war ein zirka 80 Hektar großes, ruhiges Gewässer, umgeben<br />
von einem dunklen Wald aus Nadelbäumen, deren Wipfel wie spitze,<br />
schwarze Silhouetten in den fahlen, blauen Abendhimmel ragten. Die Hütte,<br />
die ich ganz für mich allein hatte, stand 30 bis 40 Meter vom Seeufer entfernt<br />
und etwas erhöht. Sie war ziemlich neu und absolut sauber. Nebenan<br />
gab es ein Plumpsklo. Es war perfekt. Ich legte meine Sachen auf das<br />
Schlafpodest und ging ans Ufer, um Wasser zu filtern, da<strong>mit</strong> ich das nicht<br />
morgen früh machen mußte. Dann zog ich mich bis auf die Shorts aus,<br />
stapfte ein paar Schritte in das dunkle Wasser hinein und wusch mich <strong>mit</strong><br />
meinem Stirnband. Wenn Katz hier gewesen wäre, hätte ich mich auch<br />
getraut zu schwimmen. Ich versuchte, nicht an ihn zu denken, versuchte zumindest,<br />
mir nicht vorzustellen, wie er einsam im Wald umherirrte. Ich<br />
konnte jetzt ohnehin nichts für ihn tun.<br />
Statt dessen setzte ich mich auf einen Stein und schaute mir den Sonnenuntergang<br />
an. Der See war sagenhaft schön. Im Licht der langen Strahlen der<br />
untergehenden Sonne schimmerte die Wasseroberfläche golden. In Ufernähe<br />
kreisten zwei Seetaucher, als machten sie sich nach dem Abendessen<br />
noch zu einem kleinen Spazierflug auf. Ich beobachtete sie eine ganze Weile,<br />
und mir fiel ein Naturfilm ein, den ich vor einiger Zeit auf BBC gesehen<br />
hatte.<br />
Seetaucher sind keine geselligen Tiere. Nur gegen Ende des Sommers, kurz<br />
bevor sie zum Nordatlantik zurückfliegen, wo sie auf stürmischen Wellen<br />
reitend den Winter verbringen, laden sie sich gegenseitig zu kleinen Versammlungen<br />
ein. Ein Dutzend oder mehr Seetaucher von den Nachbarseen<br />
fliegen herbei, und alle schwimmen ein paar Runden im Wasser. Es gibt<br />
keinen ersichtlichen Grund dafür, außer der puren Freude am Zusammensein.<br />
Der jeweilige Gastgeber führt seinen Gästen stolz, aber doch zurückhaltend<br />
sein Territorium vor – zuerst geht es zu seiner Lieblingsbucht, dann<br />
vielleicht zu einem umgestürzten Baum, dann weiter zu einem weichen<br />
Teppich aus Wasserlilien. »Hier gehe ich morgens immer gern auf Fischfang«,<br />
teilt er den anderen <strong>mit</strong>. »Und an dieser Stelle da wollen wir nächstes<br />
Jahr unser Nest bauen.« Die anderen Seetaucher folgen ihm emsig und<br />
zeigen sich höflich interessiert. Man weiß nicht, warum sie das tun (so wenig,<br />
wie man weiß, warum ein Mensch einem anderen Menschen gern sein<br />
renoviertes Badezimmer zeigen will) oder wie sie diese Zusammenkünfte<br />
organisieren, dennoch finden sich die Tiere jeden Abend zur rechten Zeit<br />
am richtigen See ein, <strong>mit</strong> einer Gewißheit, als hätte man ihnen eine Einladung<br />
geschickt: »Wir feiern ein Fest!« Ich finde so etwas wundervoll. Mei-
ne Freude wäre noch größer gewesen, wenn ich nicht andauernd an Katz<br />
hätte denken müssen, der jetzt bei Mondlicht keuchend durch die Nacht irrte<br />
und einen See suchte.<br />
Ach, übrigens: Die Seetaucher verschwinden zunehmend, weil die Seen am<br />
sauren Regen sterben.<br />
Die Nacht war natürlich entsetzlich, und ich war vor fünf Uhr auf den Beinen<br />
und beim ersten Dämmerlicht wieder auf dem Trail. Ich ging weiter<br />
nach Norden, die Richtung, in die Katz ebenfalls gegangen war, wie ich<br />
vermutete, aber es beschlich mich das Gefühl, daß ich mich nur noch tiefer<br />
in die Hundred Mile Wilderness begab – nicht der allerbeste Weg, wenn<br />
Katz vielleicht ganz in der Nähe war und Probleme hatte. Gelegentlich<br />
erfüllte mich der Gedanke, daß ich hier, am Ende der Welt, ganz allein auf<br />
mich gestellt war, <strong>mit</strong> einer gewissen Unruhe – einer Unruhe, die kurzzeitig<br />
noch heftig verstärkt wurde, als ich beim Abstieg zurück in das namenlose<br />
Tal in meiner Eile stolperte und beinahe 15 Meter tief gestürzt und unten in<br />
der Schlucht aufgeprallt wäre. Das hätte eine ziemliche Schweinerei gegeben.<br />
Ich hoffte nur, daß ich das Richtige tat.<br />
Selbst in Hochform würde ich drei, vielleicht sogar vier Tage bis Aböl<br />
Bridge und zum Campingplatz brauchen. Bis ich dann die Polizei oder<br />
Rettungsmannschaften benachrichtigt hätte, wäre Katz bereits vier bis fünf<br />
Tage vermißt gewesen. Wenn ich andererseits jetzt umkehren und den Weg<br />
zurückgehen würde, den wir gekommen waren, könnte ich morgen nach<strong>mit</strong>tag<br />
schon in Monson sein. Das Beste wäre, es käme mir jemand entgegen,<br />
der Richtung Süden ging und mir sagen könnte, ob er Katz begegnet war<br />
oder nicht, aber außer mir war niemand auf dem Trail. Es war jetzt kurz<br />
nach sechs. In Chairback Gap, neuneinhalb Kilometer weiter, gab es einen<br />
Unterstand. Den würde ich gegen acht Uhr erreichen. Wenn ich Glück hatte,<br />
würde ich vielleicht noch jemanden antreffen. Ich zog entschlossen weiter,<br />
<strong>mit</strong> etwas mehr Bedacht und einem unangenehmen Gefühl der Unsicherheit.<br />
Ich kletterte über den Gipfel des Fourth Mountain – was <strong>mit</strong> einem Rucksack<br />
auf dem Rücken sehr viel schwerer fällt – und stieg in das nächste<br />
bewaldete Tal dahinter ab. Sechseinhalb Kilometer hinter dem Cloud Pond<br />
gelangte ich an einen kleinen Bach, den man kaum als solchen bezeichnen<br />
konnte – eigentlich war es nur ein Schlammloch. Aufgespießt auf einen<br />
Zweig neben dem Trail, an einer absichtlich unübersehbaren Stelle, steckte<br />
eine leere Packung Old-Gold-Zigaretten. Katz war kein starker Raucher,<br />
aber er hatte immer eine Packung Old Golds dabei. Im Schlamm neben<br />
einem umgestürzten Baumstamm lagen drei Zigarettenkippen. Offenbar<br />
hatte Katz hier gewartet. Er war also am Leben, hatte den Trail nicht verlassen<br />
und war eindeutig hier entlanggekommen. Ich spürte gleich ein Gefühl
unermeßlicher Erleichterung. Wenigstens ging ich in die richtige Richtung.<br />
Solange er auf dem Trail blieb, würde ich ihn irgendwann unweigerlich<br />
überholen.<br />
Ich fand ihn vier Stunden nachdem ich losgegangen war. Er saß auf einem<br />
Stein an der Abzweigung zum West Chairback Pond, das Gesicht der Sonne<br />
zugewandt, als wollte er sich bräunen. Er hatte ziemlich viele Schrammen<br />
und Kratzer abbekommen und war schmutzig, aber ansonsten sah er gesund<br />
aus. Er war natürlich hocherfreut, als er mich sah.<br />
»<strong>Bryson</strong>, altes Haus. Tut das gut, dich zu sehen. Wo warst du die ganze<br />
Zeit?«<br />
»Das habe ich mich auch gefragt. Was dich betrifft.«<br />
»Ich muß wohl die letzte Wasserstelle verpaßt haben, oder?«<br />
Ich nickte.<br />
Er nickte ebenfalls. »Das habe ich mir schon gedacht. Als ich an den Fuß<br />
der großen Klippe kam, hatte ich so ein Gefühl. Scheiße, dachte ich, das<br />
kann nicht richtig sein.«<br />
»Warum bist du nicht umgekehrt?«<br />
»Das weiß ich auch nicht. Ich war davon ausgegangen, daß du bestimmt<br />
schon weitergewandert bist. Ich hatte echt Durst. Vielleicht hat mich das<br />
etwas verwirrt – vielleicht war ich auch nur denkfaul. Wirklich, ich hatte<br />
irren Durst.«<br />
»Und was hast du gemacht?«<br />
»Ich bin weitermarschiert und habe mir gedacht, daß ich irgendwann schon<br />
auf Wasser stoßen müßte, und schließlich kam ich an diese Schlammgrube.«<br />
»Wo du die Zigarettenpackung liegengelassen hast.«<br />
»Hast du sie gefunden? Darauf war ich so stolz. Ich habe etwas Wasser <strong>mit</strong><br />
meinem Stirnband aufgesogen, das hat Fess Parker mal in der Dave-<br />
Crockett-Show vorgeführt.«<br />
»Gewagt.«<br />
Er nahm das Kompliment <strong>mit</strong> einem Kopfnicken entgegen. »Das hat ungefähr<br />
eine Stunde gedauert, und dann habe ich noch eine Stunde auf dich<br />
gewartet und ein paar Zigaretten geraucht. Dann wurde es dunkel, und ich<br />
habe mein Zelt aufgeschlagen, ein bißchen von meiner Salami gegessen und<br />
bin schlafen gegangen. Heute morgen dann habe ich nochmal etwas Wasser<br />
<strong>mit</strong> dem Tuch aufgesogen und bin bis hierher gewandert. Ein hübscher See<br />
da unten, habe ich mir gedacht, und bin auf die Idee gekommen, hier auf<br />
dich zu warten, wo es Wasser gibt, und habe darauf gehofft, daß du vorbeikommst.<br />
Ich habe zwar nicht da<strong>mit</strong> gerechnet, daß du mich hier versauern<br />
läßt, aber du bist so ein Tagträumer beim Wandern, <strong>Bryson</strong>. Ich konnte mir<br />
gut vorstellen, daß du den ganzen Weg bis auf den Katahdin durchmar-
schiert wärst, bevor dir aufgefallen wäre, daß ich gar nicht mehr hinter dir<br />
bin.« Er nahm einen affektierten Tonfall an. »Oh, was für eine herrliche<br />
Aussicht, findest du nicht auch, Stephen? Stephen…? Stephen…? Also, wo<br />
steckt der Kerl denn bloß wieder?« Er lachte mich an. Sein altes, vertrautes<br />
Lachen. »Insofern bin ich froh, dich wiederzusehen.«<br />
»Wo hast du die ganzen Kratzer her?«<br />
Er sah auf seinen Arm, der <strong>mit</strong> blutverkrusteten Schrammen im Zickzackmuster<br />
bedeckt war. »Ach, die? Das weiß ich auch nicht.«<br />
»Das weißt du nicht? Das sieht aus, als hättest du dich <strong>mit</strong> einem Skalpell<br />
traktiert.«<br />
»Na ja, ich wollte dich nicht erschrecken, aber ich habe mich außerdem ein<br />
bißchen verlaufen.«<br />
»Wie ist das passiert?«<br />
»Nachdem ich dich aus den Augen verloren hatte und bevor ich an das<br />
Schlammloch gekommen war, wollte ich an einen See, den ich von oben<br />
aus gesehen hatte.«<br />
»Das ist nicht wahr, Stephen.«<br />
»Mann, ich hatte wahnsinnigen Durst, und so weit sah es nun auch wieder<br />
nicht aus. Also stieg ich in den Wald ab. Das war wohl nicht sehr klug,<br />
was?«<br />
»Nein.«<br />
»Tja, das habe ich auch sehr schnell begriffen. Kaum war ich ein paar hundert<br />
Meter weit gegangen, hatte ich mich auch schon verlaufen. Total verlaufen.<br />
Es ist komisch, weil man glaubt, daß man nur runter an den See zu<br />
gehen braucht und denselben Weg wieder rauf. Das dürfte nicht allzu<br />
schwierig sein, wenn man ein bißchen acht gibt, denkt man. Aber die Sache<br />
ist die: Es gibt überhaupt nichts, auf das man acht geben kann. Ein Baum ist<br />
wie der andere. Es gibt nur einen einzigen riesigen Wald. Als ich dann begriff,<br />
daß ich absolut keine Ahnung mehr hatte, wo ich mich befand, dachte<br />
ich, na gut, du hast dich beim Absteigen verlaufen, also geh jetzt besser<br />
bergauf. Aber plötzlich sind da tausend Möglichkeiten, bergauf oder bergab<br />
zu gehen. Es ist total verwirrend. Ich latsche also einfach los, und latsche<br />
und latsche, bis mir klar war, daß ich schon viel weiter rauf gegangen war<br />
als vorher runter. Scheiße, Stephen, dachte ich, du dämlicher Trottel. Ich<br />
war <strong>mit</strong>tlerweile schon stinksauer auf mich selbst, kann ich dir sagen. Du<br />
mußt zu weit gegangen sein, du Hornochse, dachte ich. Also bin ich wieder<br />
ein Stück runter gegangen, aber das half auch nichts, dann ein Stück seitwärts,<br />
und dann – na ja, du siehst, was ich meine.«<br />
»Man soll nie vom Weg abgehen, Stephen.«<br />
»Vielen Dank auch. Kommt nur ein bißchen spät, dem Ratschlag, <strong>Bryson</strong>.<br />
Das ist so, als würde man einem Verkehrstoten sagen: >Von jetzt an fahr
vorsichtig.«<br />
»Entschuldige.«<br />
»Schon verziehen. Ich glaube, ich bin nur noch ein bißchen aus dem<br />
Gleichgewicht. Ich dachte wirklich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen.<br />
Im Wald verirrt, ohne Wasser, während du die ganzen Schokoladenkekse<br />
hast.«<br />
»Wie hast du den Trail dann wieder gefunden?«<br />
»Durch ein Wunder, ich schwöre es dir. Ich wollte mich gerade den Wölfen<br />
und Bären zum Fraß vorwerfen, da schaue ich auf und sehe das weiße Wanderzeichen<br />
an einem Baum, und dann gucke ich an mir runter, und siehe da,<br />
ich stehe direkt auf dem Trail. Neben dem Schlammloch auch noch. Ich<br />
setzte mich hin und rauchte drei Zigaretten hintereinander, um mich zu<br />
beruhigen, und dann dachte ich: Scheiße. <strong>Bryson</strong> ist hier bestimmt schon<br />
vorbeigekommen, während ich draußen im Wald herumgetappt bin. Der<br />
kommt nicht mehr zurück, denn diesen Abschnitt des Trails hat er schon<br />
abgesucht. Dann fing ich an mir Sorgen zu machen, daß ich dich nie wiedersehen<br />
würde. Deswegen war ich wirklich überfroh, als du dann aufgekreuzt<br />
bist. Um die Wahrheit zu sagen, <strong>Bryson</strong>, ich war in meinem Leben<br />
noch nie so froh, einen Menschen zu sehen.«<br />
Etwas Flehendes lag in seinem Blick.<br />
»Willst du nach Hause?« fragte ich.<br />
Er überlegte einen Moment. »Ja.«<br />
»Ich auch.«<br />
Wir beschlossen, den Trail zu verlassen und uns nicht weiter vorzumachen,<br />
wir wären echte Bergmenschen, das waren wir nämlich nicht. Am Fuß des<br />
Chairback Mountain, sechseinhalb Kilometer weiter, befand sich eine befestigte<br />
Forststraße. Wir wußten nicht, wohin sie führte, aber irgendwohin<br />
mußte sie ja führen. Ein Pfeil am Rand meiner Karte wies südlich zu den<br />
Katahdin Iron Works, einer seltsamen Fabrikanlage aus dem 19. Jahrhundert,<br />
heute ein Denkmal der Industriegeschichte. Nach meinem Trail -<br />
Führer befand sich vor dem Eisenwerk ein öffentlicher Parkplatz, es mußte<br />
also auch eine Straße dorthin führen. Am Fuß des Berges füllten wir unsere<br />
Flaschen in einem Bach auf und marschierten dann die Forststraße entlang.<br />
Wir waren erst wenige Minuten unterwegs, als in der Nähe Lärm zu hören<br />
war. Wir drehten uns um und sahen hinter uns eine Staubwolke auf uns<br />
zurollen, die von einem uralten Pick-up verursacht wurde, der <strong>mit</strong> großer<br />
Geschwindigkeit heranraste. Ich hielt instinktiv meinen Daumen raus, und<br />
zu meinem großen Erstaunen bremste der Wagen zehn Meter vor uns ab.<br />
Wir liefen hin und steckten unsere Köpfe durch die heruntergekurbelte<br />
Fensterscheibe. In dem Wagen saßen zwei Männer <strong>mit</strong> Schutzhelmen und<br />
ziemlich verdreckt – offenbar Waldarbeiter.
»Wo wollen Sie hin?« fragte der Fahrer.<br />
»Egal«, sagte ich. »Hauptsache weg von hier.«
21. Kapitel<br />
Wir bekamen den Katahdin Mountain also nicht zu sehen. Wir bekamen<br />
nicht einmal die Katahdin Iron Works zu sehen, erhaschten nur einen verschwommenen<br />
Blick von ihnen, weil wir <strong>mit</strong> 100 Stundenkilometern daran<br />
vorbeirasten. Es war die schrecklichste, holprigste Fahrt, die ich je in meinem<br />
Leben über eine Schotterpiste, hinten auf der offenen Ladefläche eines<br />
Pick-up <strong>mit</strong>gemacht habe. Nie wieder.<br />
Wir hielten uns fest, so gut wir konnten, mußten aber zwischendurch die<br />
Beine hochreißen, um den Motorsägen und anderen gefährlich aussehenden<br />
Gerätschaften auszuweichen, die auf der Ladefläche hin und her rutschten.<br />
Der Wald flog an uns vorbei, denn der Fahrer donnerte rücksichtslos die<br />
Straße entlang und fuhr <strong>mit</strong> Begeisterung durch Schlaglöcher, so daß wir<br />
hochgeschleudert wurden, und legte sich gleich anschließend, um unsere<br />
Marter noch zu erhöhen, <strong>mit</strong> Freude in die Kurve. Wir standen auf wackligen<br />
Beinen, als wir in dem kleinen Ort Milo ausstiegen, 32 Kilometer weiter<br />
südlich. Wir waren maßlos erstaunt, <strong>mit</strong> welcher Geschwindigkeit sich<br />
unsere Umgebung verändert hatte. Eben noch <strong>mit</strong>ten in der Wildnis, vor uns<br />
mindestens ein Zwei-Tages-Marsch zurück in die Zivilisation, und jetzt<br />
standen wir auf dem Gelände einer Tankstelle am Rand einer Kleinstadt.<br />
Wir sahen dem Pick-up hinterher, als er wegfuhr, und mußten uns erstmal<br />
orientieren.<br />
»Willst du eine Cola?« sagte ich zu Katz. Neben dem Eingang zur Tankstelle<br />
stand ein Automat.<br />
Er überlegte einen Moment. »Nein«, sagte er. »Nachher vielleicht.«<br />
Es war ungewöhnlich für Katz, normalerweise stürzte er sich bei jeder sich<br />
bietenden Gelegenheit <strong>mit</strong> überschwenglicher Begeisterung auf Cola und<br />
Fastfood, aber ich konnte ihn ganz gut verstehen. Es ist immer wie ein<br />
leichter Schock, wenn man den Trail verläßt und kurzzeitig in die Welt der<br />
Bequemlichkeit hineinversetzt wird, in der es Wahlmöglichkeiten gibt.<br />
Diesmal aber war es anders. Diesmal sollte es für immer sein. Wir wollten<br />
unsere Wanderschuhe an den Nagel hängen. Von jetzt ab sollte es immer<br />
Cola geben, ein weiches Bett, eine heiße Dusche und was man sich sonst<br />
noch so wünscht. Jetzt herrschte keine Not mehr. Eine überwältigende Vorstellung.<br />
Es gab kein Motel in Milo, aber man empfahl uns eine Pension, die sich<br />
Bishop’s Boarding House nannte, ein großes, weißes Haus in einer hübschen,<br />
baumbestandenen Straße <strong>mit</strong> breiten Vorgärten und soliden alten<br />
Villen – die Sorte, bei denen die ehemaligen Kutscherhäuser <strong>mit</strong> Quartier<br />
für die Hausangestellten im ersten Stock in Garagen umgewandelt worden<br />
waren.
Die Besitzerin, Joan Bishop, begrüßte uns herzlich und <strong>mit</strong> einer freundlichen<br />
Geschäftigkeit. Sie war eine muntere, weißhaarige Dame <strong>mit</strong> einem<br />
schweren Ostküstendialekt, und als sie an die Tür kam, wischte sie sich die<br />
mehlbestaubten Hände an der Schürze ab und bat uns <strong>mit</strong> unseren verdreckten<br />
Rucksäcken ohne einen Anflug von Mißbilligung in ihre blitzsaubere<br />
Diele.<br />
Es roch nach selbstgebackenem Kuchen, nach selbstgezüchteten Tomaten<br />
und nach frischer, von Ventilatoren und Klimaanlagen verschonter Luft –<br />
altmodische Sommergerüche. Sie nannte uns »Jungs« und benahm sich, als<br />
hätte sie uns seit Tagen, ja seit Jahren erwartet.<br />
»Meine Güte, Jungs, wie seht ihr denn aus!« gluckste sie vor Erstaunen und<br />
Freude. »Als hättet ihr schwer <strong>mit</strong> Bären gekämpft.«<br />
Wir müssen wirklich einen hübschen Anblick geboten haben. Katz war von<br />
seinem angstvollen Herumirren im Wald geradezu blutüberströmt, und die<br />
Erschöpfung stand uns ins Gesicht geschrieben.<br />
»Geht erst mal nach oben, Jungs, und wascht euch. Dann kommt runter auf<br />
die Veranda, und ich mache euch in der Zwischenzeit einen Eistee. Oder<br />
wollt ihr lieber Limonade? Egal, ich stelle beides hin. Und jetzt ab <strong>mit</strong><br />
euch!« Mit diesen Worten scheuchte sie uns nach oben.<br />
»Danke, Mom«, murmelten wir ein bißchen verwirrt, aber dankbar.<br />
Katz war augenblicklich wie verwandelt – so daß er sich vielleicht ein bißchen<br />
zu sehr wie zu Hause fühlte. Ich kramte gerade müde ein paar Sachen<br />
aus meinem Rucksack, als er plötzlich ohne anzuklopfen in meinem Zimmer<br />
stand und schnell die Tür schloß. Er war ganz aus der Fassung. Er war<br />
nur <strong>mit</strong> einem in der Eile um die Hüften gewickelten Handtuch bekleidet.<br />
»Eine kleine alte Dame«, sagte er völlig verdutzt.<br />
»Wie bitte?«<br />
»Im Flur ist eine kleine alte Dame«, sagte er.<br />
»Das ist schließlich eine Pension«, sagte ich.<br />
»Ach ja, das hatte ich ganz vergessen.« Er öffnete die Tür einen Spalt breit,<br />
spähte hinaus und verschwand, ohne sich weiter darüber auszulassen.<br />
Nachdem wir geduscht und uns umgezogen hatten, setzten wir uns zu Mrs.<br />
Bishop auf die Veranda, sanken dankbar in die großen alten Gartenstühle<br />
und streckten die Beine von uns, so wie man es eben macht, wenn es heiß<br />
ist und man müde ist. Ich hoffte, Mrs. Bishop würde uns erzählen, wie viele<br />
Wanderer sie schon bei sich aufgenommen hätte, die sich dem Appalachian<br />
Trail ebenfalls geschlagen gegeben hatten, aber soweit sie sich erinnerte,<br />
waren wir die ersten.<br />
»Gestern stand in der Zeitung, ein Mann aus Portland ist auf den Katahdin<br />
geklettert, um auf dem Gipfel seinen achtundsiebzigsten Geburtstag zu<br />
feiern«, sagte sie, um ein Gespräch anzufangen.
Wie man sich vorstellen kann, baute mich das unglaublich auf.<br />
»Bis dahin werde ich es wohl auch nochmal versuchen«, sagte Katz und<br />
fuhr sich <strong>mit</strong> dem Finger über die Schrammen auf seinem Unterarm.<br />
»Der Berg läuft jedenfalls nicht davon, Jungs«, sagte sie. Da hatte sie natürlich<br />
recht.<br />
Wir aßen in der Stadt in einem beliebten Restaurant und machten anschließend<br />
einen Bummel, denn es war ein lauer, angenehmer Abend. Milo war<br />
auf reizende Weise ein hoffnungsloser Ort – wirtschaftlich gesehen aussichtslos<br />
weit ab vom Schuß, aber irgendwie liebenswert. Es gab einige sehr<br />
schöne Wohnviertel und eine imposante Feuerwache. Vielleicht kam es uns<br />
allerdings auch nur so vor, weil es unser letzter Abend war, bevor es nach<br />
Hause ging. Da wäre uns jeder Ort recht gewesen.<br />
»Und? Findest du es schade, daß du den Trail jetzt verläßt?« fragte Katz<br />
mich nach einer Weile.<br />
Ich überlegte. Ich war unsicher. Ich merkte, daß ich keine Gefühle gegenüber<br />
dem AT hegte, die nicht von Widersprüchlichkeit gekennzeichnet<br />
waren. Einerseits hatte ich den Trail satt, andererseits hatte er mich in seinen<br />
Bann geschlagen; einerseits konnte ich die endlosen Wälder hinterher<br />
nicht mehr sehen, andererseits bewunderte ich gerade diese Endlosigkeit;<br />
einerseits begab ich mich gern auf eine Flucht vor der Zivilisation, und andererseits<br />
sehnte ich mich doch nach deren Annehmlichkeiten. Ich wollte<br />
aufhören, und ich wollte ewig so weitermachen; in einem Bett schlafen und<br />
im Zelt; gucken, was hinter dem nächsten Berg lag, und nie wieder einen<br />
Berg sehen. Alles zusammen, und alles auf einmal, auf jedem Meter des<br />
Trails. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Ja und nein. Und du?«<br />
Er nickte. »Mir geht es genauso. Ja und nein.«<br />
Wir spazierten noch ein Stück weiter, gedankenverloren.<br />
»Wir haben es geschafft«, sagte Katz und schaute dabei hoch. Ihm fiel mein<br />
fragender Gesichtsausdruck auf. »Jedenfalls haben wir Maine durchwandert.«<br />
Ich sah ihn an. »Wir sind nicht einmal in die Nähe des Mount Katahdin<br />
gekommen.«<br />
Er tat das als reine Spitzfindigkeit ab. »Ist doch nur ein Berg«, sagte er.<br />
»Auf wieviel Bergen muß man denn gewesen sein, <strong>Bryson</strong>?«<br />
Ich lachte kurz auf. »So kann man das natürlich auch sehen.«<br />
»So muß man es sehen«, fuhr Katz fort, jetzt ganz ernst. »Was mich betrifft,<br />
kann ich sagen, ich bin den Appalachian Trail entlanggewandert. Bei<br />
Schnee und bei Hitze. Im Süden und im Norden. Ich bin gewandert, bis mir<br />
die Füße bluteten. Ich bin den Appalachian Trail entlanggewandert, <strong>Bryson</strong>.«<br />
»Wir haben ganz schön viel ausgelassen.«
»Nebensächlichkeiten«, bemerkte Katz naserümpfend.<br />
Ich zuckte die Achseln, nicht unzufrieden <strong>mit</strong> dem, was er sagte. »Vielleicht<br />
hast du recht.«<br />
»Natürlich habe ich recht«, sagte er, als sei nur selten das Gegenteil der<br />
Fall.<br />
Wir waren wieder an den Stadtrand gekommen, an die Tankstelle, wo uns<br />
die Holzfäller abgesetzt hatten. Sie war immer noch geöffnet.<br />
»Was hältst du von einer Cream Soda?« sagte Katz vergnügt. »Ich lade dich<br />
ein.«<br />
Ich sah ihn verdutzt an. »Du hast doch gar kein Geld mehr.«<br />
»Ich weiß. Ich lade dich <strong>mit</strong> deinem Geld ein.«<br />
Ich grinste und gab ihm fünf Dollar aus meinem Portemonnaie.<br />
»Heute abend kommt Akte X«, sagte Katz zufrieden, sehr zufrieden sogar,<br />
und verschwand in dem Laden. Ich sah ihm hinterher, schüttelte den Kopf<br />
und fragte mich, woher er das bloß immer wußte.<br />
Und so ging unsere gemeinsame Tour zu Ende – <strong>mit</strong> einem Sixpack Cream<br />
Soda in Milo, Maine.<br />
Katz kehrte nach Des Moines in seine kleine Wohnung zurück, zu seinem<br />
Job auf dem Bau und zu einem Leben eifriger Nüchternheit. Ab und zu ruft<br />
er an und redet davon, sich doch nochmal an die Hundred Mile Wilderness<br />
heranzuwagen, aber ich glaube nicht, daß wir das je machen werden.<br />
Ich bin noch den ganzen Sommer über bis weit in den Herbst hinein gewandert,<br />
mal hier, mal da. Mitte Oktober, zum Höhepunkt der Herbstsaison, bin<br />
ich zu meiner, wie sich später erwies, letzten Wanderung aufgebrochen,<br />
einer erneuten Besteigung des Killington Peak in Vermont. Es war ein Tag<br />
wie aus dem Bilderbuch, die Gegend war erfüllt von einem moschusartigen<br />
herbstlichen Duft und einer scharfen Frische, und die Luft war so rein, daß<br />
man meinte, man brauche nur die Hand auszustrecken, um sie <strong>mit</strong> den Fingern<br />
zu berühren. Selbst die Farben waren knackig frisch: stahlblauer Himmel,<br />
dunkelgrüne Felder, und Blätter in allen Schattierungen, die die Natur<br />
hervorzubringen vermag. Es ist wahrlich ein erstaunlicher Anblick, wenn<br />
jeder einzelne Baum in einem Wald auf einmal für sich steht, wenn da, wo<br />
vorher ein nahtloser grüner Teppich ausgebreitet war, plötzlich tausend verschiedene<br />
Farben leuchten.<br />
Ich schritt begeistert und energisch aus, angetrieben von der frischen Luft<br />
und der Pracht um mich herum. Vom Gipfel des Killington aus hatte ich<br />
einen Rundblick über fast ganz New England und weiter bis nach Quebec,<br />
zum fernen, bläulichen Stumpf des Mont Royal. Fast jeder bedeutendere<br />
Gipfel in New England – Washington, Lafayette, Greylock, Monadnock,<br />
Ascutney, Moosilauke – hob sich reliefartig ab und sah viel näher aus, als er
in Wirklichkeit war. Ein unvorstellbar schöner Anblick. Daß dieser unendlich<br />
weite Ausblick nur einen Ausschnitt der Appalachen darstellte, daß da<br />
unten ein für alle offener, gepflegter Trail verlief, 3.540 Kilometer durch<br />
Berge und durch Wälder von ebenso erhabener Größe, war ein Gedanke,<br />
der einen geradezu überwältigte. Ich kann mich nicht erinnern, daß mir jemals<br />
in meinem Leben stärker ins Bewußtsein gerückt war, wie sehr die<br />
Vorsehung das Land, in dem ich auf die Welt gekommen bin, begünstigt<br />
hat. Das war der ideale Ort, um die Wanderung zu beenden.<br />
Es wäre mir sowieso nichts anderes übriggeblieben. Der Herbst ist nur kurz<br />
in New England. Wenige Tage nach meiner Tour auf den Killington setzte<br />
der Winter <strong>mit</strong> aller Macht ein. Die Wandersaison war eindeutig zu Ende.<br />
Kurz darauf, an einem Sonntagnach<strong>mit</strong>tag, saß ich zu Hause am Küchentisch<br />
<strong>mit</strong> Wanderbuch und Taschenrechner und zählte die Kilometer zusammen,<br />
die ich gegangen war. Ich überprüfte die Zahlen zweimal und schaute<br />
dann <strong>mit</strong> einem Gesichtsausdruck auf, der ungefähr so ausgesehen haben<br />
mag wie der von Katz und mir in dem Moment, als uns klar wurde, daß wir<br />
den Appalachian Trail niemals ganz schaffen würden.<br />
Ich hatte l .400 Kilometer geschafft, weit weniger als die Hälfte des AT. Die<br />
ganze Mühe, der ganze Schweiß, all der Dreck, die Tage endlosen Marschierens,<br />
die Nächte auf hartem Boden – und all das belief sich zum<br />
Schluß nur auf 39,5 Prozent des Weges. Weiß der Himmel, wie andere den<br />
gesamten Trail bewältigen. Ich habe nur ungläubiges Staunen für die übrig,<br />
die die ganze Strecke gehen. Und dennoch, 1.400 Kilometer sind auch kein<br />
Pappenstiel. Es entspricht der Entfernung zwischen New York und Chicago,<br />
sogar etwas mehr. Wenn ich diese Strecke ohne eine Vorgabe zu Fuß gegangen<br />
wäre, wären jetzt alle ziemlich stolz auf mich.<br />
Ich gehe immer noch häufig auf dem Trail hinter unserem Haus wandern,<br />
meist wenn ich bei meiner Arbeit mal steckenbleibe. Meistens bin ich in<br />
Gedanken versunken, aber irgendwann kommt jedesmal der Moment, in<br />
dem ich aufschaue und um mich blicke und <strong>mit</strong> ungetrübter Bewunderung<br />
erkenne, was für ein unglaublich kompliziertes und empfindliches Gebilde<br />
der Wald ist, <strong>mit</strong> welch zwangloser Mühelosigkeit elementare Dinge sich<br />
zusammenfügen und eine Komposition bilden, die, welche Jahreszeit auch<br />
immer herrscht und wohin ich meinen berauschten Blick auch wende, perfekt<br />
ist. Nicht bloß sehr feingliedrig oder herrlich, sondern perfekt, nicht<br />
weiter zu verbessern. Man braucht nicht Berge hinaufzusteigen, sich nicht<br />
durch Schneestürme zu kämpfen, nicht im Matsch auszurutschen, nicht tagein,<br />
tagaus im wahrsten Sinne des Wortes bis an seine Grenzen zu gehen,<br />
um zu dieser Erkenntnis zu gelangen – aber glauben Sie mir, es hilft dabei.<br />
Ein paar Dinge bedaure ich natürlich. Ich bedaure, daß ich den Katahdin<br />
nicht hinaufgegangen bin. (Ich verspreche, das werde ich nachholen.) Ich
edaure, daß ich keinen Bär gesehen habe und keinen Wolf, daß ich keinen<br />
Rotluchs verscheucht und keinen verdutzten Eber aufgeschreckt habe, daß<br />
ich keinem Riesensalamander in seinen Schlupfwinkel gefolgt und keiner<br />
Klapperschlange ausgewichen bin. Ich hätte zu gern, wenigstens einmal<br />
dem Tod ins Gesicht geschaut (aber nur kurz, bitteschön, und <strong>mit</strong> der<br />
schriftlichen Garantie, daß ich überlebe). Dafür habe ich jede Menge anderer<br />
Erfahrungen gemacht. Ich weiß, wie man ein Zelt aufschlägt und was es<br />
heißt, unter freiem Himmel zu schlafen. Für kurze Zeit in meinem Leben<br />
war ich schlank und fit und stolz auf mich. Ich habe enormen Respekt vor<br />
der Wildnis und den gütigen dunklen Mächten des Waldes bekommen. Ich<br />
habe eine Ahnung von den ungeheuren Dimensionen der Erde erhalten. Ich<br />
habe Geduld und Kraft in mir gefunden, die ich vorher an mir nicht kannte.<br />
Ich habe ein Amerika entdeckt, von dessen Existenz nur wenige wissen. Ich<br />
habe einen Freund gewonnen. Ich bin nach Hause gekommen.<br />
Und das Schönste ist: Wenn ich heute einen Berg sehe, schaue ich ihn mir<br />
lange an und taxiere ihn <strong>mit</strong> einem selbstsicheren Blick aus Granitaugen.<br />
Wir sind nicht alle 3.540 Kilometer gegangen, das stimmt, aber wir haben<br />
es versucht. Katz hatte doch recht, und es ist mir egal, was andere Leute<br />
sagen. Wir sind den Appalachian Trail entlanggewandert.
Anmerkung des Autors<br />
Dieses Buch berichtet von den Erfahrungen, die der Autor bei seiner Wanderung<br />
entlang des Appalachian Trail gemacht hat, und spiegelt seine Meinung<br />
wider. Einige Namen sowie Eigenschaften, die lebenden Personen<br />
zugeschrieben werden könnten, wurden verändert, um die Privatsphäre<br />
dieser Personen zu schützen.<br />
Bibliographie<br />
Attenborough, David: Das geheime Leben der Pflanzen. Bern: Scherz-<br />
Verlag, 1995.<br />
Bailyn, Bernhard: Voyagers to the West: A Passage in the Peopling of<br />
America on the Eve of Revolution. New York: Alfred A. Knopf, 1986.<br />
Brooks, Maurice: The Appalachians. Boston: Houghton Mifflin Co. 1986.<br />
Bruce, Dan »Wingfoot«: The Thru-Hiker’s Handbook. Harpers Ferry, WV:<br />
Appalachian Trail Conference, 1995.<br />
Cruikshank, Heien Gere (Hg.): John and William Bartram’s America: Selections<br />
from the Writing of the Philadelphia Naturalists. New York:<br />
Devin-Adair Co. 1957<br />
Dale, Frank: Delaware Diary: Episodes in the Life of a River. New Brunswick,<br />
NJ: Rutgers University Press, 1996.<br />
Emblidge, David (Hg.): The Appalachian Trail Reader. New York: Oxford<br />
University Press, 1997<br />
Faragher, John Mack: Daniel Boone: The Life and Legend of an American<br />
Pioneer. New York: Henry Holt and Co. 1993.<br />
Farwell, Byron: Stonewall: A Biography of General Thomas J. Jackson.<br />
New York: W W Norton and Co. 1993.<br />
Foreman, Dave; Wolke, Howie: The Big Outside: A Descriptive Inventory<br />
of the Big Wilderness Areas of the United States. New York: Harmony<br />
Books, 1992.<br />
Herrero, Stephen: Bären: Jäger und Gejagte in Amerikas Wildnis. Cham:<br />
Müller Rüschlikon, 1992.<br />
Houk, Rose: Great Smoky Mountains National Park. Boston: Houghton<br />
Mifflin Co. 1993.<br />
Long, Priscilla: Where the Sun Never Shines: A History of America’s<br />
Bloody Coal Industry. New York: Paragon House, 1991.
Luxenberg, Larry: Walking the Appalachian Trail. Mechanicsburg, Pennsylvania:<br />
Stackpole Books, 1994.<br />
Matthiessen, Peter: Wildlife in America. New York: Penguin Books, 1995.<br />
McKibben, <strong>Bill</strong>: Das Ende der Natur München: List Verlag, 1990.<br />
Nash, Roderick: Wilderness and the American Mind. New Haven: Yale<br />
University Press, 1982.<br />
Parker, Ronald B.: Inscrutable Earth: Explosions into the Science Of Earth.<br />
New York: Charles Scribner’s Sons, 1984.<br />
Peatti, Donald Culross: A Natural History of Trees of Eastern and Central<br />
North America. Boston: Houghton Mifflin Co. 1991.<br />
Putnam, William Lowell: The Warst Weatheron Eartb: A History of the<br />
Mount Washington Observatory. New York: American Alpine Club, 1993.<br />
Quammen, David: Natural Acts: A Sidelong View of Science and Nature.<br />
New York: Avon Books, 1996.<br />
Schultz, Gwen: Ice Age Lost. New York: Anchor, 1974.<br />
Shaffer, Earl V: Walking with Spring: The First Solo Thru-Hike of the Legendary<br />
Appalachian Trail. Harpers Ferry, WV: The Appalachian Trail Conference,<br />
1996.<br />
Stier, Maggie; McAdow, Ron: Into the Mountains: Stories of New England’s<br />
Most Celebrated Peaks. Boston: Appalachian Mountain Club Books,<br />
1995.<br />
Trefil, James: Physik in der Berghütte: Von Gipfeln, Gletschern und Gesteinen.<br />
Reinbek: Wunderlich, 1992.<br />
Wilson, Edward O.: The Diversity of Life. Cambridge, MA: Belknap<br />
Press/Harvard University Press, 1992.