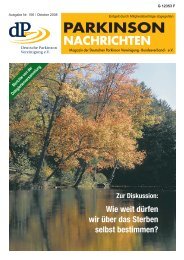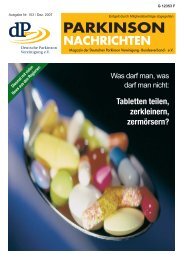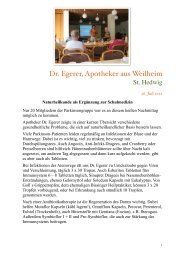dPV Aktuell 46 - Deutsche Parkinson Vereinigung eV
dPV Aktuell 46 - Deutsche Parkinson Vereinigung eV
dPV Aktuell 46 - Deutsche Parkinson Vereinigung eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
AKTUELL<br />
April/Mai 2009<br />
NR. <strong>46</strong><br />
Therapie-Optionen beim Fortschreiten der<br />
<strong>Parkinson</strong>-Krankheit<br />
von: Lutz Johner, Medizinjournalist, Hamburg; wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. med. Reiner Thümler, Mainz<br />
Die Therapie mit <strong>Parkinson</strong>-Medikamenten ist eine lebenslange Therapie. Da die grundlegende(n) Ursache(n)<br />
der <strong>Parkinson</strong>-Krankheit immer noch unbekannt ist/sind, kann die medikamentöse Therapie (um<br />
die es sich in diesem Beitrag handelt), die Symptome der Krankheit nur verringern bzw. lindern. Allerdings<br />
ist in den letzten Jahren eine Reihe neuer Medikamente auf den Markt gekommen, welche die Therapiemöglichkeiten<br />
weiter verbessern. Mittlerweile stehen sieben Wirkstoffgruppen mit mehr als 100 Einzel-Medikamenten<br />
zur Verfügung (eine vollständige Darstellung und Beschreibung aller <strong>Parkinson</strong>-Medikamente<br />
gibt übrigens die Broschüre „<strong>Parkinson</strong>-Medikamente im Bild“, zu bestellen für 2,60 Euro unter www.par<br />
kinson-vereinigung.de „Interaktive Bestellungen“). So kann man sagen, dass <strong>Parkinson</strong>-Patienten bei unkompliziertem<br />
Verlauf und mit entsprechender Behandlung heute eine Lebenserwartung haben, die jener<br />
der Durchschnittsbevölkerung weitestgehend entspricht. Der Verlauf der <strong>Parkinson</strong>-Krankheit ist im Einzelfall<br />
allerdings sehr unterschiedlich. Daher können die auftretenden Symptome variieren und sich individuell<br />
verschieden stark bemerkbar machen.<br />
Therapie in der Frühphase<br />
der Krankheit<br />
Die meisten Patienten bekommen<br />
in der Anfangsphase der <strong>Parkinson</strong>-Krankheit<br />
einen Dopaminagonisten<br />
oder Levodopa verordnet.<br />
Mit dieser medikamentösen<br />
Therapie werden die Symptome<br />
für eine gewisse Zeit spürbar gebessert<br />
und sind im Tagesverlauf<br />
kaum noch zu bemerken (Honeymoon-Phase).Dopaminagonisten<br />
werden besonders in den ersten<br />
Krankheitsjahren und bei jüngeren<br />
Betroffenen eingesetzt. Sie<br />
wirken an den noch intakten Anteilen<br />
der Übertragungsstelle der motorischen<br />
Signalfortleitung (postsynaptischer<br />
Teil), haben eine längere<br />
Wirkdauer als Levodopa und erlauben<br />
somit eine kontinuierlichere<br />
Reizweiterleitung. Zudem gibt es<br />
in Studien Hinweise für eine Verlangsamung<br />
des Krankheitsverlaufs,<br />
möglicherweise durch einen<br />
Nervenzellschutz (Neuroprotek-<br />
tion). Die ersten Dopaminagonisten<br />
wurden schon Anfang der 70er<br />
Jahre eingesetzt. Um die Nebenwirkungsrate<br />
möglichst niedrig zu<br />
halten, ist eine langsame Aufdosierung,<br />
notwendig. Beim Umsetzen<br />
von L-Dopa auf einen Dopaminagonisten<br />
müssen die Betroffenen<br />
über eine Phase einer möglichen<br />
vorübergehenden Verschlechterung<br />
aufgeklärt werden, um Therapieabbrüchen<br />
vorzubeugen. Als<br />
unerwünschte Wirkung tritt nicht selten<br />
zu Beginn der Medikation eine<br />
vorübergehende Übelkeit auf, die<br />
durch Zugabe von Domperidon (z.<br />
B. Motilium ® ) gemildert werden kann.<br />
Bei älteren Patienten (die aktuellen<br />
Leitlinien der <strong>Deutsche</strong>n Gesellschaft<br />
für Neurologie/DGN setzen<br />
hier eine Grenze von 70 Jahren,<br />
wobei das biologische Alter<br />
entscheidend ist) wird die medikamentöse<br />
Therapie in der Regel<br />
nicht mit Dopaminagonisten, sondern<br />
mit Levodopa eingeleitet, da<br />
bei älteren Patienten das Risiko psychischer<br />
Nebenwirkungen (Trugbilder<br />
und Verwirrtheitszustände)<br />
sowie anderer unerwünschter Nebenwirkungen<br />
unter Dopaminagonisten<br />
höher ist.<br />
Bei Patienten über 70 Jahren<br />
oder multimorbiden Patienten wird<br />
die Behandlung also in der Regel<br />
mit Levodopa (= L-Dopa) als Mono-Therapie<br />
begonnen und diese<br />
Mono-Therapie beibehalten, solange<br />
keine Wirkungsfluktuationen<br />
oder andere Therapiekomplikationen<br />
auftreten. Das standardmäßig<br />
mit einem Dopa-Decarboxylasehemmer<br />
kombinierte Levodopa<br />
bessert so eindrucksvoll die <strong>Parkinson</strong>-Symptome,<br />
insbesondere<br />
Akinese und Rigor, dass es gleichzeitig<br />
zur Diagnosesicherung genutzt<br />
wird (L-Dopa-Test). Levodopa<br />
wird in der Regel gut vertragen.<br />
Nur gelegentlich kommt es zu<br />
Beschwerden wie leichter Benommenheit<br />
und Übelkeit, die bei Re-<br />
<strong>dPV</strong> aktuell . Nr. <strong>46</strong> . April/Mai 2009 Seite 1
duzierung der Dosis fast immer abklingen.<br />
In Abhängigkeit vom Fortschreiten<br />
der Erkrankung wird die<br />
zusätzliche Levodopa-Gabe bei<br />
anfänglicher Monotherapie mit einem<br />
Dopaminagonisten - oft schon<br />
nach wenigen Jahren - notwendig.<br />
Im Langzeitverlauf wird also nahezu<br />
jeder <strong>Parkinson</strong>-Patient irgendwann<br />
„Levodopa-pflichtig“ .<br />
Therapieoptionen beim Fortschreiten<br />
der Krankheit<br />
Leider ist es ein Kennzeichen<br />
der <strong>Parkinson</strong>-Krankheit, dass sie<br />
nicht zum Stillstand kommt, sondern<br />
weiter voranschreitet. So werden<br />
die Patienten irgendwann feststellen<br />
oder haben schon bemerkt,<br />
dass im Tagesverlauf Symptome<br />
wieder auftreten oder stärker ausgeprägt<br />
sind, noch bevor sie die<br />
reguläre nächste Medikamenten-<br />
Dosis einnehmen. Dieses Phänomen<br />
der vorzeitig nachlassenden<br />
Medikamenten-Wirkung nennt man<br />
im medizinischen Sprachgebrauch<br />
Wearing-off.<br />
Wearing-off-Symptome können<br />
sich von Patient zu Patient ganz<br />
unterschiedlich zeigen. So können<br />
sowohl das (Wieder-)Auftreten von<br />
Bewegungsverlangsamung und<br />
Zittern (Tremor) ebenso Zeichen<br />
des Wearing-off sein, wie zunehmende<br />
Steifigkeit der Muskulatur<br />
oder eine verminderte Geschicklichkeit.<br />
Zu den Wearing-off-Episoden<br />
zählt auch die nächtliche bzw.<br />
frühmorgendliche oder nachmittägliche<br />
Akinese. Es können jedoch<br />
auch nicht-motorische Symptome<br />
wie Stimmungsschwankungen,<br />
Angstgefühle oder Schmerzen<br />
im Rahmen des Wearing-off<br />
auftreten (siehe dazu auch <strong>dPV</strong><br />
aktuell Nr. 41, April 2008, kostenloser<br />
Download unter www.parkin<br />
son-vereinigung.de „Interaktive<br />
Bestellungen“).<br />
Selbst für den Arzt ist es oft nicht<br />
ganz leicht, die mitunter diskreten<br />
Wearing-off-Symptome frühzeitig<br />
zu diagnostizieren und richtig einzuordnen.<br />
Wenn Sie daher das Gefühl<br />
haben, dass Ihre Medikamen-<br />
te nicht mehr so gut und so lange<br />
wirken oder dass eventuell neuartige<br />
Symptome auftreten, sollten<br />
Sie dies auf jeden Fall mit Ihrem<br />
Arzt besprechen. Er wird überprüfen,<br />
ob die Medikamente, die Sie<br />
einnehmen, noch richtig für Sie sind<br />
und eventuell eine Umstellung Ihrer<br />
Medikation vornehmen. Sie können<br />
Ihren Arzt unterstützen, indem<br />
Sie beispielsweise einen von <strong>Parkinson</strong>-Spezialisten<br />
entwickelten<br />
Wearing-off-Fragebogen (WOQ-9)<br />
ausfüllen. Diesen erhalten Sie bei<br />
Ihrem Neurologen oder im Internet<br />
unter www.stalevo.de.<br />
Neben dem Ausfüllen des Wearing-off-Fragebogens<br />
ist beim Auftreten<br />
von motorischen und nichtmotorischen<br />
Fluktuationen eine Dokumentation<br />
des Tagesablaufes<br />
(Beweglichkeitsprofil) sinnvoll, um<br />
die Dauer der „Off“-Phasen und<br />
den zeitlichen Verlauf von Überbewegungen<br />
(Dyskinesien) zu dokumentieren<br />
(Vorlagen werden<br />
von verschiedenen Pharmafirmen,<br />
so auch unter der o.g. Internetadresse<br />
www.stalevo.de angeboten).<br />
Für den Patienten ist darüber hinaus<br />
ein konsequentes Einhalten<br />
der Einnahmezeiten wichtig, notfalls<br />
sind technische Hilfsmittel wie<br />
elektronische Wecker und ähnliches<br />
zur Erinnerung an die Medikamenteneinnahme<br />
erforderlich.<br />
Bei Patienten, die zu Vergesslichkeit<br />
neigen, ist auf jeden Fall die<br />
Hilfe von Angehörigen notwendig.<br />
Um Wearing-off-Symptome zu<br />
verhindern oder zu verringern, gibt<br />
es eine Reihe von Strategien, die<br />
Ihr Arzt mit Ihnen besprechen wird.<br />
Er wird Ihre bisherige Medikation<br />
wahrscheinlich ändern oder zusätzliche<br />
<strong>Parkinson</strong>-Medikamente<br />
verordnen. Um ein für den Patienten<br />
befriedigendes Ergebnis zu<br />
erreichen, braucht es Geduld und<br />
gelegentlich eine erneute Veränderung<br />
der Medikation.<br />
Am einfachsten durchzuführen<br />
und mit den wenigsten Nebenwirkungen<br />
behaftet ist die Verkürzung<br />
der L-Dopa-Einnahmeintervalle<br />
bei gleichzeitiger Reduktion der<br />
Einzeldosen. Führt jedoch die reduzierte<br />
Einzeldosis nicht mehr zu<br />
einer ausreichenden Wirkung, wird<br />
eine Erhöhung der Einzeldosen<br />
und damit auch die Erhöhung der<br />
Gesamttagesdosis notwendig.<br />
Eine andere Strategie ist der Einsatz<br />
von L-Dopa-Retard-Präparaten<br />
(z. B. Nacom ® retard oder Madopar<br />
Depot ® ). Levodopa Retard<br />
ist eine Darreichungsform, aus der<br />
Levodopa über einen längeren Zeitraum<br />
als bei herkömmlichen Levodopa-Präparaten<br />
in das Blut abgegeben<br />
wird. Nachteil von Levodopa<br />
Retard am Tage ist die schlechte<br />
Steuerbarkeit wegen der variablen<br />
Resorption (s. u.), kann jedoch<br />
bei Patienten mit nächtlicher oder<br />
frühmorgendlicher Akinese sowie<br />
als Add-on-Therapie zum unretardiertem<br />
L-Dopa während des Tages<br />
eingesetzt werden. Wenn beide<br />
Vorgehensweisen zu keinem<br />
ausreichenden Erfolg führen, kann<br />
die zusätzliche Gabe des seit Jahrzehnten<br />
bewährten MAO-B-Hemmers<br />
Selegilin (z. B. Movergan ® )<br />
oder des neueren MAO-B-Hemmers<br />
Rasagilin (Azilect ® ) versucht<br />
werden. Amantadin kann kurzfristig<br />
Dyskinesien bessern.<br />
Ziel der modernen Levodopa-<br />
Therapie ist eine möglichst konstante<br />
Versorgung des Gehirns mit<br />
Levodopa, damit das Gehirn kontinuierlich<br />
Dopamin bilden kann.<br />
Eine der möglichen medikamentösen<br />
Maßnahmen dafür ist die Verbesserung<br />
der L-Dopa-Absorption<br />
im Darm und des aktiven Transportsystems<br />
an der Blut-Hirnschranke.<br />
Levodopa wird im Duodenum (Dünndarm)<br />
und proximalen Jejunum<br />
(schließt an den Dünndarm an)<br />
aufgenommen. Eine verzögerte<br />
Magenentleerung und eine mangelnde<br />
Aufnahme aufgrund großer<br />
Aminosäuren, die mit L-Dopa um<br />
diese Aufnahme konkurrieren, stellen<br />
wichtige Faktoren in der Entstehung<br />
motorischer Fluktuationen<br />
dar. Die gastrointestinale Absorption<br />
kann dadurch verbessert werden,<br />
dass die Nahrungsaufnahme<br />
zeitlich deutlich von der L-Dopa-Ein-<br />
<strong>dPV</strong> aktuell . Nr. <strong>46</strong> . April/Mai 2009 Seite 2
nahme abgegrenzt und wird. Durch<br />
die Gabe von Domperidon und Antazida<br />
kann die Magenentleerung<br />
beschleunigt werden. Durch das Auflösen<br />
der L-Dopa-Tablette in Wasser<br />
gelangt das Medikament rascher<br />
in den Dünndarm und wird<br />
dadurch schneller wirksam. In der<br />
Praxis eignet sich die Gabe von<br />
löslichem L-Dopa ( Madopar LT ® ),<br />
aber auch der Auflösung von herkömmlichen<br />
L-Dopa in Wasser (Isicom<br />
® , Nacom ® ). Gelöstes L-Dopa<br />
wird vor allem zur rascheren Überwindung<br />
von Off-Phasen eingesetzt,<br />
da mit einem Wirkungseintritt<br />
schon nach 30 Minuten gerechnet<br />
werden darf.<br />
Der COMT-Hemmer Entacapon<br />
(Comtess ® ) erhöht durch die periphere<br />
Hemmung des Abbaus von<br />
L-Dopa die Plasmakonzentration<br />
und somit die Bioverfügbarkeit und<br />
Wirkdauer von L-Dopa. Zahlreiche<br />
Therapiestudien belegen eine deutliche<br />
Reduktion der täglichen Off-<br />
Phasen bzw. eine entsprechende<br />
Zunahme der On-Zeiten bei <strong>Parkinson</strong>-Patienten<br />
mit Fluktuationen.<br />
Die pharmakologischen Eigenschaften<br />
von L-Dopa und Entacapon sind<br />
vergleichbar, so dass eine kombinierte<br />
Einnahme mit jeder Einzeldosis<br />
sinnvoll ist (die Maximaldosis<br />
beträgt 2000 mg pro Tag, entsprechend<br />
10 Dosen pro Tag). Vorteilhaft<br />
ist, dass schon innerhalb<br />
weniger Tage der Erfolg zu überprüfen<br />
ist. Die tägliche On-Zeit<br />
kann um durchschnittlich 20% verlängert<br />
werden. Zu den unerwünschten<br />
Wirkungen zählen Übelkeit und<br />
Durchfälle. Die Gelbverfärbung des<br />
Urins ist harmlos. Das Auftreten<br />
oder/und die Verstärkung vorbestehender<br />
Dyskinesien weisen auf<br />
die verstärkte L-Dopa-Wirkung hin<br />
und können durch eine entsprechende<br />
Abdosierung von L-Dopa<br />
aufgefangen werden.<br />
Neben der klinisch relevanten<br />
peripheren, also außerhalb des Gehirns<br />
aktiven Wirkung des COMT-<br />
Hemmers Entacapon hat der<br />
COMT-Hemmer Tolcapon (Tasmar ® )<br />
auch eine geringe zentrale Wir-<br />
kung. Tolcapon darf jedoch erst<br />
verordnet werden, wenn vorher ein<br />
Therapieversuch mit Entacapon<br />
erfolglos war. Aufgrund des potenziellen<br />
Risikos von Leberschädigungen<br />
erfolgt eine Tolcapon-Therapie<br />
unter strenger kontinuierlicher<br />
Kontrolle der Leberwerte. Für<br />
Entacapon ist ein solches Risiko<br />
nicht bekannt.<br />
In vielen Fällen ist es sinnvoll die<br />
drei Wirkstoffe Levodopa, Carbidopa<br />
und Entacapon kombiniert in<br />
einer Tablette als Stalevo ® zu verabreichen<br />
(Stalevo ® steht in vier<br />
verschiedenen Wirkstärken zur<br />
Verfügung). In zahlreichen Untersuchungen<br />
konnte gezeigt werden,<br />
dass sich mit dieser Triple-Tablette<br />
Wearing-off-Symptome erfolgreich<br />
und vergleichsweise gut<br />
verträglich behandeln lassen.<br />
Langzeitkomplikationen in Form<br />
motorischer Fluktuationen und Dyskinesien<br />
können durch den Einsatz<br />
von Dopaminagonisten in der Mono-<br />
oder Kombinationstherapie verzögert<br />
und gemildert werden. Die<br />
Entscheidung für einen bestimmten<br />
Dopaminagonisten ist einfacher<br />
geworden, seit die so genannten<br />
ergolinen Dopaminagonisten<br />
(Bromocriptin, Lisurid, Alpha-Dihydroergocrptin,<br />
Pergolid, Cabergolin)<br />
wegen Herzklappenveränderungen<br />
nur noch als Medikamente<br />
der 2. Wahl eingesetzt werden.<br />
Dopaminagonisten der 1. Wahl<br />
umfassen die Nicht-ergolinen-Dopaminagonisten<br />
Piribedil, Pramipexol,<br />
Ropinirol (Standard- und retardierte<br />
Freisetzungsform) sowie das als<br />
Pflaster applizierbare Rotigotin und<br />
das über die Haut zu injizierende<br />
Apomorphin. Off-Phasen unter der<br />
L-Dopa-Monotherapie können durch<br />
die Kombinationstherapie mit Dopaminagonisten<br />
verringert werden.<br />
Ein neuerer Therapieansatz für<br />
motorische Symptome beim fortgeschrittenem<br />
M. <strong>Parkinson</strong> ist die<br />
Zusatztherapie mit retardiertem<br />
Ropinirol (ReQuip ® modutab) zu<br />
einer L-Dopa-Therapie. In der beim<br />
diesjährigen <strong>Parkinson</strong>-Kongress<br />
in Marburg vorgestellten Studie<br />
PREPARED wurden mit der Retardformulierung<br />
bei 66 Prozent<br />
der 343 Studien-Patienten (durchschnittliche<br />
Erkrankungsdauer 8<br />
Jahre) die täglichen Off-Zeiten um<br />
mindestens 20 Prozent reduziert.<br />
Bei der Gruppe mit nicht-retardiertem<br />
Ropinirol waren es immerhin<br />
noch bei 51 Prozent, wobei die Tagesdosierungen<br />
bei der Retardgruppe<br />
allerdings auch höher waren<br />
(18,6 mg/d versus10,4 mg/d). Die<br />
motorische Leistung (gemessen<br />
mit der UPDRS-III-Skala) hatte<br />
sich mit der retardierten Form deutlicher<br />
gebessert . Außerdem konnte<br />
mit retardiertem Ropinirol mehr<br />
L-Dopa eingespart werden (162 mg<br />
versus 113 mg ).<br />
Das 24-Stunden wirkende <strong>Parkinson</strong>-Pflaster<br />
mit dem Wirkstoff<br />
Rotigotin (Neupro ® ) ist seit Frühjahr<br />
2006 für die Therapie von<br />
<strong>Parkinson</strong>-Patienten im fortgeschrittenen<br />
Stadium der Erkrankung<br />
in Kombination mit L-Dopa<br />
zugelassen. Um eine kristalline<br />
Ausflockung zu verhindern, wurde<br />
mittlerweile eine Kühlkette eingerichtet.<br />
Es können mit den anderen<br />
Dopaminagonisten vergleichbare<br />
Wirkungen mit Reduzierung<br />
der Off-Phasen und Verlängerung<br />
der On-Phasen erreicht werden.<br />
Auftreten von Wirkungsfluktuationen<br />
und Dyskinesien<br />
Mit zunehmender Krankheitsund<br />
Behandlungsdauer können<br />
auch abnorme, unwillkürliche Bewegungen<br />
(Überbewegungen) auftreten,<br />
die häufig mit der Medikamenteneinnahme<br />
korrelieren. Beispielsweise<br />
sind so genannte Peakdose-Dyskinesien<br />
dann am stärksten<br />
ausgeprägt, wenn die Konzentration<br />
der Wirksubstanz im Blut<br />
am höchsten ist. Derartige Überbewegungen<br />
treten ebenso, wenn<br />
auch verzögert und milder, unter<br />
der Behandlung mit Dopaminagonisten<br />
auf. Nach ihrem Erscheinungsbild<br />
werden die Überbewegungen<br />
in Dyskinesien und Dysto-<br />
<strong>dPV</strong> aktuell . Nr. <strong>46</strong> . April/Mai 2009 Seite 3
nien unterteilt. Da die Therapie von<br />
Überbewegung maßgeblich von<br />
der bereits vorbestehenden <strong>Parkinson</strong>-Medikation,<br />
dem individuellen<br />
Beschwerdebild des Patienten,<br />
möglichen Begleiterkrankungen<br />
sowie der Gabe von weiteren Medikamenten<br />
abhängt, können ohne<br />
individuellen „Fall-Bezug“ an dieser<br />
Stelle keine Therapiehinweise<br />
gegeben werden. Deshalb werden<br />
im Folgenden nur die Überwegungen<br />
kurz im Einzelnen dargestellt.<br />
Dyskinesien: In der Regel treten<br />
diese Überbewegungen in der<br />
Phase guter Beweglichkeit auf, so<br />
dass die Betroffenen diese Überwegungen<br />
eher akzeptieren als deren<br />
Angehörige. Häufig wird eine<br />
Bewegungsunruhe im Gesichtsund<br />
Schulter-Nackenbereich beobachtet.<br />
Dyskinesien ereignen<br />
sich meist, wenn die höchste Levodopa-Konzentration<br />
im Blut erreicht<br />
ist (Peak-dose-Dyskinesie). So genannte<br />
Plateau-Dyskinesien können<br />
die überwiegende Zeit der<br />
guten Bewegungsphase prägen.<br />
Überbewegungen können jedoch<br />
auch in der An- und Abflutphase<br />
des Wirkstoffs als so genannte<br />
biphasische Dyskinesien auftreten,<br />
werden also jeweils eingeleitet<br />
oder abgelöst von schlechten Bewegungsphasen.<br />
Biphasische Dyskinesien,<br />
die eher durch zähflüssige,<br />
teilweise schmerzhafte Bewegungen<br />
charakterisiert sind, sind seltener<br />
als Peak-dose-Dyskinesien.<br />
Sie finden sich vor allem in fortgeschrittenen<br />
<strong>Parkinson</strong>-Stadien.<br />
Dystonien: Sie sind durch langsame<br />
und zähflüssige, teilweise<br />
drehende Bewegungen gekennzeichnet.<br />
Bei anhaltender Muskelanspannung<br />
kann daraus vorübergehend<br />
eine Fehlstellung der Arme,<br />
Beine oder des Rumpfes resultieren.<br />
Besonders in den frühen Morgenstunden<br />
können nach dem Erwachen<br />
und vor der ersten Medikamenteneinnahme<br />
schmerzhafte Muskelverkrampfungen<br />
in den Füßen<br />
bzw. Zehen auftreten (Fußdystonie,<br />
frühmorgendliche Dystonie,<br />
Off-Dystonie).<br />
Plötzliche Schwankungen der<br />
Beweglichkeit: Bei manchen Patienten<br />
kommt es nach mehreren Jahren<br />
auch zu plötzlich einsetzenden<br />
und zeitlich nicht mehr vorhersehbaren<br />
Schwankungen der Beweglichkeit.<br />
Bei den Betroffenen wirken<br />
einzelne Medikamentendosen entweder<br />
überhaupt nicht oder ihre<br />
Wirkung setzt völlig unregelmäßig<br />
ein. Diese Erscheinung nennt man<br />
On-off-Phänomen.<br />
Der Zustand, in dem die Patienten<br />
beweglich sind, häufig auch<br />
überbeweglich, wird On-Phase<br />
(englisch: an) genannt, der Zustand<br />
schlechter Beweglichkeit Off-<br />
Phase (englisch: aus). Diese Off-<br />
Phasen können Sekunden bis Minuten<br />
anhalten. Sie gehen meist mit<br />
ausgeprägter Bewegungsverlangsamung<br />
einher. Die Ursache ist ungeklärt.<br />
Vermutlich spielen eine unzureichendeMedikamentenaufnahme<br />
aus dem Darm, aber auch Veränderungen<br />
an den Nervenzellen<br />
im Gehirn eine Rolle. Typischerweise<br />
tritt das On-off-Phänomen erst<br />
im späten Krankheitsverlauf auf.<br />
Pumpen und Pen<br />
Können die Schwankungen in<br />
der Beweglichkeit trotz optimaler<br />
Behandlung mit Levodopa, Dopaminagonisten<br />
und anderen Medikamenten<br />
nicht mehr durchbrochen<br />
werden, ist der Zeitpunkt für andere<br />
Methoden gekommen. Die Substanz<br />
Apomorphin, ein Morphinabkömmling<br />
ohne Suchtpotenzial,<br />
kann dabei eine Rolle spielen. In<br />
injizierbarer Form mittels Autoinjektor<br />
in die Haut („Penject“) ist Apomorphin<br />
derzeit das am schnellsten<br />
wirkende Medikament bei Wirkungsfluktuationen.<br />
Apomorphin<br />
per Penject wird überwiegend als<br />
Akuttherapie bei Patienten mit<br />
mehrmaligen „Off“-Phasen angewendet,<br />
wenn die orale Dopamintherapie<br />
erfolglos blieb. Bei ersten<br />
Anzeichen einer „Off“-Phase wird<br />
es in die Bauchhaut oder die Oberschenkelhaut<br />
injiziert. Die Beweglichkeit<br />
bessert sich in der Regel<br />
innerhalb von 10 bis 20 Minuten,<br />
die Wirkung hält allerdings nur 45<br />
bis 90 Minuten an. Die kontinuierliche<br />
subkutane Verabreichung mittels<br />
einer kleinen Pumpe, die in einem<br />
Stoffbeutel am Körper getragen<br />
wird, führt zu gleichmäßigen<br />
Wirkstoffspiegeln im Blut (z. B.<br />
APO-go-System). So können <strong>Parkinson</strong>-Patienten,<br />
die sehr viele tägliche<br />
Off-Perioden erleben oder<br />
mehr als 10 Injektionen benötigen,<br />
auf die kontinuierliche Hautinfusion<br />
umstellen. Eine enge Kooperation mit<br />
einem Fachzentrum ist erforderlich.<br />
Für Patienten mit weit fortgeschrittener<br />
<strong>Parkinson</strong>-Erkrankung<br />
steht seit drei Jahren ferner das Behandlungskonzept<br />
einer kontinuierlichen<br />
duodenalen Infusion (Duodopa<br />
® -Pumpe) zur Verfügung. Dabei<br />
wird die bewährte Substanz<br />
Levodopa über eine portable, computergesteuerte<br />
Pumpe in individueller<br />
Dosis direkt und kontinuierlich<br />
mittels einer durch die Bauchwand<br />
führende Sonde (PEG) in den Dünndarm<br />
verabreicht. Die Duodopa-<br />
Pumpe ® ist eine therapeutische Option<br />
für Patienten mit ausgeprägten<br />
motorischen Fluktuationen und/oder<br />
Dyskinesien, bei denen die möglichen<br />
oralen Therapiestrategien ausgeschöpft<br />
sind und die sich nicht<br />
einer Tiefen Hirnstimulation unterziehen<br />
können oder wollen. Auch<br />
die Therapie mit der Duodopa-<br />
Pumpe ® bedarf der Überwachung<br />
durch ärztliche Spezialisten.<br />
<strong>dPV</strong> aktuell<br />
Organ der <strong>Deutsche</strong>n <strong>Parkinson</strong><br />
<strong>Vereinigung</strong> - Bundesverband - e.V.<br />
Moselstraße 31, 41<strong>46</strong>4 Neuss<br />
Telefon (0 21 31) 41 01 6/7<br />
Verantwortlich:<br />
Magdalene Kaminski, 1. Vorsitzende<br />
Konten:<br />
<strong>Deutsche</strong> <strong>Parkinson</strong> <strong>Vereinigung</strong><br />
- Bundesverband - e.V.<br />
SEB AG Bank<br />
170 856 99 00 (BLZ 300 101 11)<br />
Stadtsparkasse Neuss<br />
280 842 (BLZ 305 500 00)<br />
Hans-Tauber-Stiftung<br />
SEB AG Bank Neuss<br />
143 734 45 00 (BLZ 300 101 11)<br />
Die <strong>dPV</strong>-aktuell Nr. 47 ist ab<br />
Mitte Juli 2009 abrufbar.<br />
<strong>dPV</strong> aktuell . Nr. <strong>46</strong> . April/Mai 2009 Seite 4