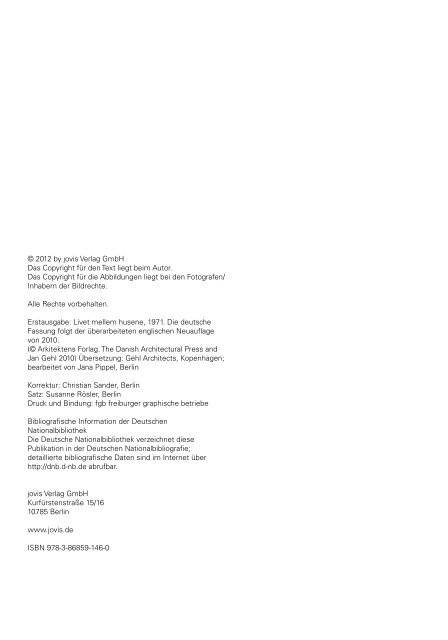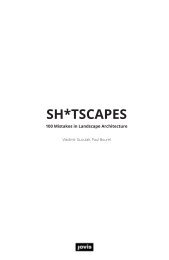Leben zwischen Häusern
978-3-86859-146-0
978-3-86859-146-0
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
© 2012 by jovis Verlag GmbH<br />
Das Copyright für den Text liegt beim Autor.<br />
Das Copyright für die Abbildungen liegt bei den Fotografen/<br />
Inhabern der Bildrechte.<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
Erstausgabe: Livet mellem husene, 1971. Die deutsche<br />
Fassung folgt der überarbeiteten englischen Neuauflage<br />
von 2010.<br />
(© Arkitektens Forlag. The Danish Architectural Press and<br />
Jan Gehl 2010) Übersetzung: Gehl Architects, Kopenhagen;<br />
bearbeitet von Jana Pippel, Berlin<br />
Korrektur: Christian Sander, Berlin<br />
Satz: Susanne Rösler, Berlin<br />
Druck und Bindung: fgb freiburger graphische betriebe<br />
Bibliografische Information der Deutschen<br />
Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese<br />
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über<br />
http://dnb.d-nb.de abrufbar.<br />
jovis Verlag GmbH<br />
Kurfürstenstraße 15/16<br />
10785 Berlin<br />
www.jovis.de<br />
ISBN 978-3-86859-146-0
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort 7<br />
1 <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong><br />
Drei Arten von Aktivitäten im Freien 9<br />
<strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> 15<br />
Aktivitäten im Freien und die Qualität von Außenräumen 31<br />
Aktivitäten im Freien und Architekturentwicklungen 39<br />
<strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> – in aktuellen sozialen Situationen 49<br />
2 Planungsvoraussetzungen<br />
Prozesse und Projekte 53<br />
Sinne, Kommunikation und Dimensionen 63<br />
Das <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> – ein Prozess 73<br />
3 Versammeln oder zerstreuen<br />
Versammeln oder zerstreuen 81<br />
Integrieren oder ausgrenzen 101<br />
Einladen oder abweisen 113<br />
Öffnen oder abschotten 121<br />
4 Räume zum Gehen – Plätze zum Verweilen<br />
Räume zum Gehen – Plätze zum Verweilen 129<br />
Gehen 133<br />
Stehen 147<br />
Sitzen 155<br />
Sehen, hören und sprechen 163<br />
Ein angenehmer Ort in jeder Hinsicht 171<br />
Sanfte Übergänge 183<br />
Bibliografie 198<br />
Bildnachweis 199
6 <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong>
Vorwort<br />
Es ist mir eine große Freude, das Vorwort zur deutschen Ausgabe<br />
von Life between Buildings zu schreiben. Die Erstausgabe dieses<br />
Buchs erschien in den 1970er Jahren und wollte die Missstände<br />
benennen, die zu jener Zeit die Stadtplanung in ganz Europa bestimmten.<br />
Das Buch forderte, endlich die Bedürfnisse der Menschen<br />
zu be rück sichtigen, die sich <strong>zwischen</strong> den Gebäuden bewegen,<br />
die den Raum <strong>zwischen</strong> den <strong>Häusern</strong> nutzen. Es warb auch um<br />
Ver ständnis für die subtilen Eigenschaften und Vorzüge, die in der<br />
gesamten Geschichte menschlichen Siedlungsbaus die öffentlichen<br />
Räume <strong>zwischen</strong> den Gebäuden bestimmten, wo die Menschen sich<br />
trafen und versammelten. Und es wies darauf hin, dass das <strong>Leben</strong><br />
<strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> eine Dimension von Architektur darstellt und als<br />
solche berücksichtigt werden muss.<br />
Vier Jahrzehnte sind seit dem Erscheinen der Erstausgabe vergangen<br />
– Dekaden, in denen architektonische Moden und Ideo logien<br />
kamen und gingen. Aber nach wie vor ist es vordringlich, die<br />
<strong>Leben</strong>digkeit, ja buchstäblich die Bewohnbarkeit von Städten zum Ziel<br />
jedes städtebaulichen Projekts zu machen. Qualitätvolle öffentliche<br />
Räume wer den heute überall auf der Welt zunehmend intensiv genutzt.<br />
Davon zeugt das wachsende allgemeine Interesse an der in<br />
den Städten und deren öffentlichen Räumen gebotenen Wohn- und<br />
<strong>Leben</strong>squalität. Wenn sich die Gesellschaft verändert, ändert sich<br />
auch der Charakter des städtischen <strong>Leben</strong>s, aber die wesentlichen<br />
Prinzipien und Qualitätskriterien für gute öffentliche Räume haben<br />
sich bemerkenswerterweise als dauerhaft gültig erwiesen.<br />
Über die Jahre hat dieses Buch zahlreiche Überarbeitungen und Über -<br />
setzungen in verschiedene Sprachen erfahren. Deshalb hat die vor liegen<br />
de deutsche Ausgabe nur noch wenig Ähnlichkeit mit den frühen<br />
Versionen des Buches, auch weil sie neu aufgenommene Materialien<br />
und Abbildungen enthält. Dennoch hat es keinerlei Gründe gegeben,<br />
die fundamentale Botschaft zu ändern, die heute genauso wichtig ist<br />
wie vor 40 Jahren. Sie lautet: Sorgt gut für die Menschen und das<br />
kostbare <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> den <strong>Häusern</strong>.<br />
Derzeit erleben viele europäische Städte tiefgreifende Veränderungen,<br />
sie wachsen oder schrumpfen, werden umgebaut und modernisiert;<br />
und ich hoffe, dass die in diesem Buch vorgestellten humanistischen<br />
Planungsgrundsätze in deutschsprachigen Ländern als Inspirationsquelle<br />
für derartige Prozesse dienen werden.<br />
Kopenhagen, im Februar 2012<br />
Jan Gehl<br />
7
<strong>Leben</strong><br />
<strong>zwischen</strong><br />
<strong>Häusern</strong><br />
Drei Arten von Aktivitäten im Freien 9<br />
<strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> 15<br />
Aktivitäten im Freien und Qualität<br />
von Außenräumen 31<br />
Aktivitäten im Freien und<br />
Architekturentwicklungen 39<br />
<strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> –<br />
in aktuellen sozialen Situationen 49<br />
8 <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong>
Drei Arten von Aktivitäten im Freien<br />
Ein StraSSenbild<br />
Eine gewöhnliche Straße an einem gewöhnlichen Tag: Fußgänger<br />
bevölkern die Gehsteige, Kinder spielen vor den Haustüren, Leute<br />
sitzen auf Bänken und Stufen, der Briefträger macht seine Runde,<br />
zwei Passanten grüßen sich im Vorbeigehen, zwei Mechaniker reparieren<br />
ein Auto, Gruppen sind ins Gespräch vertieft – eine Vielzahl<br />
von Aktivitäten im Freien. Viele Faktoren wirken sich auf diese Aktivitäten<br />
aus. Einer davon ist die physische Umgebung. Sie beeinflusst<br />
die Aktivitäten im Freien in unterschiedlichem Maß und auf verschiedene<br />
Weise. Und mit diesen Wechselwirkungen und Zusammenhängen<br />
beschäftigt sich das vorliegende Buch.<br />
Drei Arten von<br />
Aktivitäten im Freien<br />
Stark vereinfacht gesagt: Aktivitäten im öffentlichen Raum können in<br />
drei Kategorien eingeteilt werden: notwendige Aktivitäten, freiwillige<br />
Aktivitäten und soziale Aktivitäten. Jede von ihnen stellt andere Anforderungen<br />
an die physische Umgebung.<br />
Notwendige Aktivitäten –<br />
unter allen Umständen<br />
Notwendige Aktivitäten – das sind unter anderem jene Beschäftigungen,<br />
die mehr oder weniger unumgänglich sind, wie in die Schule<br />
oder zur Arbeit zu gehen, einzukaufen, auf den Bus oder eine Person<br />
zu warten, Besorgungen zu machen oder die Post auszutragen.<br />
Alltägliche Erledigungen und Freizeitbeschäftigungen gehören im<br />
Allgemeinen zu dieser Kategorie, bei der im Vergleich zu den anderen<br />
am meisten zu Fuß passiert.<br />
Weil die Aktivitäten dieser Kategorie notwendig sind, hängen sie<br />
nur wenig von den physischen Rahmenbedingungen ab. Sie finden<br />
das ganze Jahr über unter fast allen Bedingungen statt und sind im<br />
Großen und Ganzen unabhängig von der äußeren Umgebung. Die<br />
Beteiligten haben keine Wahl.<br />
Freiwillige Aktivitäten –<br />
nur unter günstigen<br />
äuSSeren Bedingungen<br />
Ganz anders verhält es sich mit den freiwilligen Aktivitäten, die nur<br />
ausgeübt werden, weil der Wunsch danach besteht und Zeit und Ort<br />
es zulassen – etwa ein Spaziergang, um frische Luft zu schnappen,<br />
der genießerische Müßiggang oder ein Sonnenbad.<br />
Drei Arten von Aktivitäten im Freien 9
Ein möglicher Anfang für vertiefte Kontakte<br />
16 <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong>
Kontakt auf niedriger Ebene<br />
<br />
<br />
<br />
die Möglichkeit der Aufrechterhaltung bereits bestehender<br />
Kontakte<br />
eine Informationsquelle über die soziale Welt außerhalb<br />
eine Quelle der Inspiration und ein Angebot anregender<br />
Erfahrungen<br />
Eine Form des Kontakts<br />
Welche Möglichkeiten sich aus flüchtigen Kontakten im öffentlichen<br />
Raum ergeben, wird deutlich, wenn man sich vorstellt, was ihr Fehlen<br />
bedeuten würde:<br />
Ohne <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> den <strong>Häusern</strong> sind Kontakte vom unteren<br />
Ende der Kontaktskala nicht mehr möglich. Die verschiedenen Übergangsformen<br />
<strong>zwischen</strong> dem Alleinsein und dem Zusammensein<br />
verschwinden. Die Grenzen <strong>zwischen</strong> Isolation und Kontakt werden<br />
schärfer – Menschen sind entweder allein oder sie sind bewusst mit<br />
anderen Menschen zusammen, auf einem relativ anspruchsvollen<br />
und hohen Level.<br />
<strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> bietet die Gelegenheit, auf entspannte<br />
und wenig anstrengende Art und Weise mit anderen zusammen zu<br />
sein. Seien es gelegentliche Spaziergänge, ein Bummel über eine<br />
Einkaufsstraße auf dem Nachhauseweg, eine kurze Pause auf einer<br />
einladenden Bank nahe einer Haustür – in jedem Fall ist man für kurze<br />
Zeit unter Leuten. Man könnte auch täglich einkaufen gehen, obwohl<br />
einmal pro Woche praktischer wäre. Schon allein ab und zu aus<br />
dem Fenster zu sehen kann lohnend sein, vorausgesetzt, man hat<br />
das Glück einer interessanten Aussicht. In Gesellschaft anderer zu<br />
sein, sie zu sehen und zu hören, von anderen Impulse zu empfangen<br />
<strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> 17
Aktivitäten und bevorzugte Sitzplätze<br />
unten: Auf der ganzen<br />
Welt sind Caféstühle auf<br />
das Straßenleben hin<br />
ausgerichtet. (Fotos von<br />
Karl Johan, Hauptstraße<br />
Oslo, Norwegen)<br />
26 <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong>
Aktivitäten und bevorzugte<br />
Sitzgewohnheiten<br />
Wenn man sich ansieht, wo im öffentlichen Raum sich die Menschen<br />
gern niederlassen, kann man ähnliche Tendenzen feststellen.<br />
Bänke, die einen guten Blick auf die Geschehnisse in der Umgebung<br />
bieten, sind beliebter als Plätze, von denen aus man nur wenig<br />
oder gar nichts von den Ereignissen rundherum mitbekommt.<br />
Eine Studie zum Kopenhagener Tivoli Park [36], die von dem Architekten<br />
John Lyle durchgeführt wurde, zeigt, dass die meistbenutzten<br />
Bänke im Park entlang des Hauptweges stehen, wo es einen<br />
guten Ausblick auf die Bereiche mit besonders reger Aktivität gibt,<br />
während die Bänke in den stillen Winkeln des Parks nur selten aufgesucht<br />
werden. An manchen Stellen des Parks stehen die Bänke<br />
Lehne an Lehne, sodass eine Bank zum Weg hin steht, während die<br />
andere dem Weg quasi „den Rücken zudreht“. In diesem Fall werden<br />
immer erstere vorgezogen.<br />
Ähnliche Resultate ergaben Untersuchungen zum Sitzverhalten auf<br />
mehreren Plätzen im Zentrum von Kopenhagen. Bänke, die einen<br />
Blick auf die besonders belebten Fußgängerbereiche bieten, werden<br />
eher genutzt als jene, die einen Ausblick auf die Grünfläche des Platzes<br />
bieten [15, 18, 27].<br />
Dasselbe gilt für Straßencafés, auch hier sind die Geschehnisse vor<br />
dem Café die Hauptattraktion. Nahezu überall auf der Welt werden<br />
die Stühle in Straßencafés zum lebhaftesten Bereich in der Umgebung<br />
gerichtet. Es ist nicht überraschend: Die Straße ist der Grund<br />
für Straßencafés.<br />
Bänke, die dem Treiben auf der<br />
Straße den Rücken zuweisen,<br />
werden gar nicht oder auf<br />
unübliche Weise genutzt.<br />
<strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> 27
denen Interessen und Bedürfnisse einzelner Bewohner in diesen<br />
Gebieten.<br />
In jedem Fall gilt, dass der physische Rahmen mehr oder weniger<br />
Einfluss auf die soziale Situation ausüben kann. Er kann so gestaltet<br />
sein, dass die gewünschten Kontakte erschwert oder gar unmöglich<br />
gemacht werden. Architektur kann, im wahrsten Sinne des Wortes,<br />
beabsichtigten Aktivitäten im Weg stehen. Andererseits kann der<br />
physische Rahmen aber auch so geplant sein, dass ein breiteres<br />
Spektrum an verfügbaren Möglichkeiten gegeben ist, sodass soziale<br />
Prozesse und Bauprojekte sich gegenseitig unterstützen können. In<br />
diesem Kontext sollte die Gestaltung öffentlicher Räume und das<br />
Eingänge, Balkone, Veranden, Vorhöfe<br />
und Gärten, die zur Straße weisen,<br />
bieten den Bewohnern Gelegenheit,<br />
das öffentliche <strong>Leben</strong> zu verfolgen<br />
und sich während ihrer täglichen<br />
Verrichtungen zu begegnen – ein<br />
wichtiger Faktor für die Bildung<br />
sozialer Netzwerke. (Sibeliusparken,<br />
Kopenhagen, Dänemark, Architekten:<br />
Fællestegnestuen)<br />
54 Planungsvoraussetzungen
Die Aufgliederung in kleinere<br />
Einheiten ist in Skandinavien<br />
bei neuen Siedlungs- und Wohnungsbauprojekten<br />
mittlerweile<br />
weitverbreitet. Insbesondere<br />
eine Einheit von etwa 15 bis<br />
30 Haushalten erwies sich<br />
als geeignet, weil sie soziale<br />
Netzwerke fördert.<br />
rechts: Skaade, Dänemark,<br />
1985 (Architekten: C.F. Møllers<br />
Tegnestue)<br />
unten: Der Nachbarschaftsblock<br />
als Organisationseinheit<br />
<strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> gesehen werden. Möglichkeiten können<br />
behindert oder bewusst geschaffen werden.<br />
Die folgenden Beispiele zeigen detailliert praktische Versuche, die Interaktion<br />
<strong>zwischen</strong> sozialen Prozessen und Bauprojekten herzustellen.<br />
Einige Prinzipien und Definitionen werden ebenso vorgestellt.<br />
Soziale Struktur<br />
Die Notwendigkeit, Unterteilungen und Gruppen zu schaffen, um<br />
demokratische Prozesse zu ermöglichen, ist am Arbeitsplatz, in Vereinen,<br />
Schulen und Universitäten offensichtlich. In Hochschulen zum<br />
Beispiel besteht eine Hierarchie <strong>zwischen</strong> Fakultäten, Instituten,<br />
Fachbereichen und schlussendlich Gruppen von Studenten, die die<br />
kleinste Einheit darstellen. Die Struktur spiegelt Entscheidungsebenen<br />
wider und dient dem Einzelnen als Orientierung in sozialer und<br />
professioneller Hinsicht.<br />
Prozesse und Projekte 55
Sinne und Kommunikation<br />
Die räumlichen Verhältnisse können<br />
visuelle und akustische Kontakte auf<br />
mindestens fünf verschiedene Arten<br />
fördern oder verhindern.<br />
kontakthemmeND<br />
visuell und akustisch<br />
kontaktfördernd<br />
visuell und akustisch<br />
1. Wände keine Wände<br />
2. große Distanzen kleine Distanzen<br />
3. hohe Geschwindigkeit niedrige Geschwindigkeit<br />
4. verschiedene Ebenen eine Ebene<br />
5. Rücken an Rücken Auge in Auge<br />
62 Planungsvoraussetzungen
Sinne, Kommunikation<br />
und Dimensionen<br />
Die Sinne – eine wichtige<br />
Komponente bei der<br />
Planung<br />
Nach vorn und horizontal<br />
orientierte Sinnesorgane<br />
Die Kenntnis von den menschlichen Sinnen – ihrer Funktions- und<br />
Wirkungsbereiche – ist eine wichtige Voraussetzung für die Gestaltung<br />
und Dimensionierung von Außenraum und Gebäudeanordnungen<br />
jeglicher Art.<br />
Das Sehen und Hören steht mit fast allen Aktivitäten im Freien intensiv<br />
in Beziehung, wodurch natürlich die visuellen und akustischen<br />
Kontakte und ihre Funktionsweisen einen zentralen Faktor bei der<br />
Planung bilden. Auch für das Verständnis aller anderen Formen unmittelbarer<br />
Kommunikation und der menschlichen Wahrnehmung<br />
von räumlichen Gegebenheiten und Dimensionen ist das Wissen<br />
von den Sinnen eine notwendige Voraussetzung.<br />
Die menschliche Bewegung ist von Natur aus vorwiegend auf die<br />
Horizontale sowie eine Geschwindigkeit von 5 km/h beschränkt –<br />
und die Sinnesorgane sind an diese Bedingungen angepasst. Sie<br />
haben im Wesentlichen eine frontale Ausrichtung, einer der bestentwickelten<br />
und besonders wichtigen Sinne, der Sehsinn, ist ausdrücklich<br />
horizontal ausgelegt. Das horizontale Gesichtsfeld ist beträchtlich<br />
größer als das vertikale. Wenn jemand geradeaus schaut, ist es<br />
möglich, das, was links und rechts in einem horizontalen Bereich von<br />
jeweils fast 90 Grad vor sich geht, flüchtig zu erkennen.<br />
Das nach unten gerichtete Sichtfeld ist viel enger als das horizontale<br />
und das nach oben blickende ist noch begrenzter. Letzteres ist<br />
reduziert, weil die Blickachse beim Gehen ungefähr 10 Grad nach<br />
unten geneigt ist, um besser zu sehen, wohin man sich bewegt.<br />
Eine Person, die eine Straße entlanggeht, sieht abgesehen vom<br />
Erdgeschoss, dem Bürgersteig und dem Geschehen auf der Straße<br />
selbst praktisch nichts. Ereignisse, die wahrgenommen werden<br />
sollen, müssen vor dem Betrachter und auf ungefähr der gleichen<br />
Höhe passieren – eine Tatsache, die sich zum Beispiel in der Gestaltung<br />
jedes Zuschauerraums widerspiegelt: in Theatern, Kinos und<br />
Hörsälen. Hier sind die Plätze in der Galerie deswegen billiger, weil<br />
die Ereignisse nicht „im richtigen Winkel“ gesehen werden können.<br />
Sinne, Kommunikation und Dimensionen 63
andere werfen, doch das <strong>Leben</strong> passiert zu Fuß. Nur wer zu Fuß unterwegs<br />
ist, kann sich Zeit nehmen, um Situationen wahrzunehmen<br />
oder daran teilzunehmen. Nur einem Fußgänger bieten sich Gelegenheiten<br />
zur Kontakt- und Informationsaufnahme.<br />
Physische Planung von<br />
Isolation und Kontakt<br />
Wenn man die Möglichkeiten und Beschränkungen im Zusammenhang<br />
mit den Sinnen zusammenfasst, wird deutlich, dass es für Architekten<br />
und Planer fünf verschiedene Mittel gibt, mit denen Isolation<br />
oder Kontakt gefördert und verhindert werden können.<br />
Isolation<br />
Kontakt<br />
Wände<br />
groSSe Distanzen<br />
hohe Geschwindigkeiten<br />
mehrere Ebenen<br />
Orientierung voneinander weg<br />
Keine Wände<br />
KLeine Distanzen<br />
Geringe Geschwindigkeiten<br />
eine Ebene<br />
Orientierung zueinander hin<br />
Indem man mit diesen fünf Prinzipien einzeln oder kombiniert arbeitet,<br />
können die entsprechenden physischen Voraussetzungen für<br />
Isolation beziehungsweise Kontakt geschaffen werden.<br />
Das <strong>Leben</strong> findet zu Fuß statt.<br />
(Fußgängerstraße, Kopenhagen,<br />
Dänemark)<br />
72 Planungsvoraussetzungen
Das <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> –<br />
ein Prozess<br />
Das <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong><br />
<strong>Häusern</strong> – ein sich selbst<br />
verstärkender Prozess<br />
Das <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> ist potenziell ein sich selbst verstärkender<br />
Prozess. Wenn jemand eine Aktion startet, so besteht die<br />
hohe Wahrscheinlichkeit, dass andere sich anschließen, sei es als<br />
selbst Handelnde oder als Beobachter. Auf diese Weise beeinflussen<br />
und stimulieren sich Individuen und Ereignisse gegenseitig. Hat<br />
dieser Prozess einmal begonnen, dann ist die Gesamtaktivität meist<br />
größer und komplexer als die Summe der ursprünglich involvierten<br />
Teilaktivitäten.<br />
Zu Hause verlagern und bewegen sich die Ereignisse und die Familienmitglieder<br />
von Raum zu Raum, je nachdem, wo sich das Zentrum<br />
der Aktivität gerade befindet. Wird in der Küche gearbeitet, dann<br />
spielen die Kinder auf dem Küchenboden usw. Auch auf Spielplätzen<br />
lässt sich dieses Phänomen beobachten. Beginnen einige Kinder zu<br />
spielen, so werden auch andere Kinder animiert, rauszukommen und<br />
sich am Spiel zu beteiligen. Die anfangs kleine Gruppe kann schnell<br />
wachsen. Ein Prozess hat begonnen. Im öffentlichen Raum können<br />
ähnliche Muster beobachtet werden. Wenn viele Menschen anwesend<br />
sind oder etwas vor sich geht, kommen für gewöhnlich weitere<br />
hinzu. Die Aktivitäten steigen sowohl im Umfang als auch in der<br />
Dauer.<br />
Eins plus eins ist drei –<br />
mindestens<br />
Der niederländische Architekt F. van Klingeren, der ganz bewusst<br />
mit der Konzentration und Kombination verschiedener Aktivitäten in<br />
den Stadtzentren von Dronten und Eindhoven in Holland gearbeitet<br />
hat [11], beobachtete, wie das gesamte Aktivitätsniveau in diesen<br />
Städten aufgrund eines solchen sich selbst verstärkenden Prozesses<br />
zugenommen hat. Van Klingeren hat diese Erkenntnis über Aktivität<br />
in der Stadt in der Formel „eins plus eins ist drei – mindestens“ zusammengefasst.<br />
Der positive Prozess:<br />
etwas passiert, weil<br />
etwas passiert<br />
Ein sehr einleuchtendes Beispiel für dieses Prinzip liefert eine Studie<br />
über Spielmuster von Kindern in Gegenden mit Einfamilienhäusern<br />
und Reihenhäusern in Dänemark [28]. In den Reihenhausgegenden<br />
Das <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> – ein Prozess 73
Lange Aufenthalte im Freien bedeuten lebendige Städte<br />
78 Planungsvoraussetzungen
Werden in Wohngebieten die Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien<br />
so angehoben, dass die durchschnittliche im Freien verbrachte Zeit<br />
von zehn auf 20 Minuten ansteigt, verdoppelt sich das Aktivitätsniveau.<br />
Verglichen mit der Zeit, die für den Transport aufgewendet<br />
wird, ist die Dauer der Aufenthalte in diesem Zusammenhang ein viel<br />
wichtigerer Faktor. Während der Wechsel von Auto- auf Fußgängerverkehr<br />
die durchschnittliche Dauer jedes Ausflugs um etwa zwei<br />
Minuten verlängert, hat eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer im<br />
Freien von zehn auf 20 Minuten einen fünfmal so großen Effekt.<br />
Längere Aufenthalte im Freien machen Wohngebiete und städtische<br />
Räume lebendig – mehr noch als langsamer Verkehr. Dieser Zusammenhang,<br />
dass die Dauer genauso wichtig ist wie die Anzahl der<br />
Ereignisse, ist eine wichtige Erklärung dafür, warum in vielen neuen<br />
Wohnprojekten so wenig Aktivität herrscht. In Gegenden mit mehrstöckigen<br />
Wohnblöcken leben eigentlich sehr viele Menschen, aber<br />
die vielen Bewohner kommen und gehen, es gibt nur dürftige Möglichkeiten,<br />
eine längere Zeit im Freien zu verbringen. Ebenso existieren<br />
keine richtigen Orte, an denen man sein kann, es gibt nichts<br />
zu tun. Daher werden die Aufenthalte im Freien kurz und das Aktivitätsniveau<br />
ist vergleichsweise niedrig. Reihenhäuser mit kleinen Vorgärten<br />
können mit wesentlich weniger Einwohnern oft viel stärkere<br />
Aktivitäten rund um die Häuser verzeichnen, weil die Zeit, die pro<br />
Einwohner im Freien verbracht wird, im Allgemeinen viel größer ist.<br />
Der dargelegte Zusammenhang <strong>zwischen</strong> dem <strong>Leben</strong> auf der Straße,<br />
der Anzahl von Leuten und Ereignissen sowie der Zeit, die im<br />
Freien verbracht wird, ist einer der wichtigsten Schlüssel zur Verbesserung<br />
der <strong>Leben</strong>sbedingungen <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> in bereits bestehenden<br />
und in neuen Wohngebieten – nämlich durch verbesserte<br />
Bedingungen für Aufenthalte im Freien.<br />
Im Sommer ist die Straße wesentlich<br />
lebendiger, weil fast jeder mehr Zeit<br />
draußen verbringt. Die Menschen<br />
stehen und sitzen und das Gehtempo<br />
ist 20 Prozent langsamer als im<br />
Winter. Sogar mit derselben Passantenzahl<br />
pro Tag sind im Sommer<br />
fünf- bis zehnmal mehr Menschen auf<br />
der Straße – je länger der Aufenthalt,<br />
desto belebter die Stadt.<br />
Das <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Häusern</strong> – ein Prozess 79
Versammeln oder zerstreuen – entlang der Fassade<br />
links: Sind Gebäude schmal, müssen<br />
kürzere Fußwege zurückgelegt werden<br />
und es gibt mehr <strong>Leben</strong> auf den<br />
Straßen. (Wettbewerbsprojekt zur<br />
Erweiterung von Rørås, Norwegen)<br />
Schmale Straßenfassaden bedeuten<br />
kurze Distanzen <strong>zwischen</strong> den Eingängen<br />
– und gerade an den Eingängen<br />
spielt sich ja fast immer das meiste<br />
<strong>Leben</strong> ab.<br />
94 Versammeln oder zerstreuen
Errichtung von Banken und Büros auf Straßenniveau einschränkt. In<br />
anderen Städten Dänemarks hat es sich bewährt, derartige Einrichtungen<br />
in der Innenstadt nur zuzulassen, solange die zur Straße hin<br />
ausgerichtete Fassade unter fünf Meter Breite bleibt.<br />
Es überrascht nicht, dass diese Praxis auch in allen vorstädtischen<br />
Einkaufsstraßen angewandt wird. Gestalter berücksichtigen, dass<br />
Fußgänger normalerweise nicht gerne weit gehen. Deshalb wird<br />
Raum für so viele Geschäfte wie möglich in kurzer Distanz geschaffen.<br />
Durch schmale, tiefe Bauparzellen und durch die effiziente Platznutzung<br />
an der Straßenfront wird das Problem von „Löchern“ und<br />
„übrig gebliebenen Flächen“ vermieden. Dies gilt ebenso für Wohngebiete.<br />
Gute Beispiele dafür findet man in vielen traditionellen Reihenhaussiedlungen<br />
und in vielen neueren Bauprojekten, wie der<br />
Siedlung Halen in Bern und in den Wohngebieten Java, Borneo und<br />
Sporenburg im Hafen von Amsterdam.<br />
Versammeln auf einer<br />
Ebene oder zerstreuen auf<br />
mehreren Ebenen<br />
Die bereits genannten Möglichkeiten der Versammlung oder Zerstreuung<br />
können auf einer oder mehreren Ebenen existieren. Das<br />
Problem ist sehr simpel. Aktivitäten, die auf derselben Ebene stattfinden,<br />
können innerhalb der Grenzen der Sinne erlebt werden. Das<br />
meint einen Radius von 20 bis 100 Metern – abhängig davon, was<br />
zu sehen ist. In dieser Situation ist es leicht, sich <strong>zwischen</strong> den Aktivitäten<br />
zu bewegen. Wenn etwas auf einer Ebene passiert, die nur<br />
ein wenig höher ist, werden die Möglichkeiten der Wahrnehmung<br />
In Stadtstraßen sollte die Länge der<br />
Fassaden sorgfältig geplant werden.<br />
Weltweit sind Einkaufsstraßen in<br />
einem Rhythmus von 15 bis 25 Einheiten<br />
pro 100 Meter gegliedert.<br />
(Straßen in der Altstadt von Stockholm,<br />
Schweden)<br />
Versammeln oder zerstreuen 95
Vier Prinzipien der Verkehrsplanung<br />
Los Angeles:<br />
Verkehrsintegration nach den Regeln<br />
des Schnellverkehrs. Ein gerade und<br />
einfach angelegtes Verkehrssystem<br />
mit geringer Verkehrssicherheit.<br />
Die Straßen sind ausschließlich für<br />
Autoverkehr geeignet.<br />
Radburn:<br />
Verkehrstrennung, wie sie 1928 in<br />
Radburn, New Jersey, eingeführt<br />
wurde: ein kompliziertes, teures<br />
System, das aus vielen Parallelstraßen<br />
und -wegen sowie vielen<br />
teuren Unterführungen besteht. In<br />
Wohnbezirken durchgeführte Umfragen<br />
zeigen, dass dieses Prinzip, das<br />
theoretisch die Verkehrssicherheit<br />
zu erhöhen scheint, in der Praxis<br />
schlecht funktioniert: Fußgänger<br />
bevorzugen kürzere gegenüber<br />
längeren, sichereren Wegen.<br />
Delft:<br />
Verkehrsintegration nach den<br />
Regeln des langsamen Verkehrs:<br />
Dieses 1969 eingeführte System ist<br />
einfach, überschaubar und sicher<br />
und erhält die Straße als wichtigsten<br />
öffentlichen Raum. Wenn Autos bis<br />
zu einem Haus vorfahren müssen,<br />
ist dieses System den zwei oben<br />
genannten weitaus überlegen.<br />
Venedig:<br />
Die Fußgängerstadt: Übergang vom<br />
schnellen zum langsamen Verkehr am<br />
Stadtrand. Ein überschaubares und<br />
einfaches Verkehrssystem mit einem<br />
beträchtlich höheren Sicherheitsgrad<br />
und -gefühl als bei den anderen<br />
Systemen.<br />
110 Versammeln oder zerstreuen
Jahren in neuen europäischen Wohngebieten immer gängiger geworden.<br />
Dies ist eine positive Entwicklung, die es ermöglicht, den<br />
örtlichen Verkehr wieder mit anderen Aktivitäten im Freien zu integrieren.<br />
Integration des<br />
örtlichen Verkehrs<br />
nach den Regeln des<br />
FuSSgängerverkehrs<br />
Integration von Verkehr<br />
und Aufenthalten im Freien<br />
Auch der Versuch, den örtlichen Kfz-Verkehr nach den Regeln des Fußgängerverkehrs<br />
zu integrieren, ist eine positive Entwicklung. Dieses<br />
Prinzip wurde erstmals in Holland eingeführt, wo lokale Bereiche für<br />
langsamen Verkehr gestaltet oder erneuert wurden. In diesen sogenannten<br />
Woonerf-Gebieten dürfen Autos bis zu den Hauseingängen<br />
vorfahren, aber die Straßen sind ganz klar als Fußgängerzonen gestaltet,<br />
in denen Autos <strong>zwischen</strong> den festgelegten Aufenthaltsbereichen<br />
und Spielplätzen nur mit niedriger Geschwindigkeit fahren dürfen. Autos<br />
sind „Gäste“ im Fußgängerbereich.<br />
Konzepte zur Integration von Kfz-Verkehr nach den Regeln des Fußgängerverkehrs<br />
bieten beträchtliche Vorteile gegenüber Maßnahmen<br />
zur Verkehrstrennung. Zwar ermöglichen gänzlich autofreie<br />
Zonen sowohl einen höheren Verkehrssicherheitsgrad als auch eine<br />
bessere Gestaltung und Bemessung für Aufenthalte im Freien und<br />
Fußgängerverkehr und somit eine optimale Lösung, aber das holländische<br />
Konzept der Verkehrsintegration bietet doch in vielen Fällen<br />
eine sehr akzeptable Alternative – die zweitbeste Lösung.<br />
Unabhängig davon, ob Wohngebiete nach dem venezianischen Prinzip<br />
gebaut sind, mit einem Umstieg vom schnellen zum langsamen<br />
Verkehr am Stadtrand, oder nach dem holländischen Woonerf-Prinzip,<br />
mit multifunktionalen Straßen für den langsamen Kfz- sowie Fahrrad-<br />
und Fußgängerverkehr: Wichtig ist die Integration von Verkehr<br />
und Aktivitäten im Freien. Besteht der Verkehr aus Fußgängern oder<br />
langsam fahrenden Autos, verlieren die Argumente für eine Trennung<br />
von Aufenthaltsbereichen, Spielplätzen und Verkehrsflächen<br />
ihre Gültigkeit. Die Tatsache, dass der Verkehr zu und von <strong>Häusern</strong><br />
in Wohngebieten fast immer die umfangreichste aller Aktivitäten im<br />
Freien darstellt, ist ein guter Grund, den Verkehr mit so vielen Aktivitäten<br />
wie möglich zu verbinden. Von einer Politik des integrierten<br />
Verkehrs werden alle profitieren – ob sie unterwegs oder mit alltäglichen<br />
häuslichen Erledigungen beschäftigt sind, ob Autofahrer oder<br />
spielende Kinder.<br />
Viele Aktivitäten, wie spielen, sich im Freien aufhalten und miteinander<br />
plaudern, beginnen, wenn man eigentlich mit einer anderen<br />
Tätigkeit beschäftigt ist oder auf dem Weg von einem Ort zum anderen<br />
ist.<br />
Integrieren oder ausgrenzen 111
132 Räume zum Gehen – Plätze zum Verweilen
Gehen<br />
Gehen<br />
Platz zum Gehen<br />
Gehen ist in erster Linie eine Art der Fortbewegung, eine Möglichkeit<br />
herumzukommen, aber auch eine ungezwungene und unkomplizierte<br />
Möglichkeit, im öffentlichen Raum anwesend zu sein. Man<br />
geht, um Besorgungen zu machen, um die Umgebung zu sehen<br />
oder einfach ohne Grund. Alle drei Motive können zusammenfallen<br />
oder einzeln vorliegen. Das Gehen ist oft eine notwendige Handlung,<br />
manchmal aber auch schlicht eine Entschuldigung für Anwesenheit –<br />
„kurz bei jemandem vorbeigehen“.<br />
Alle Arten von Fußverkehr stellen bestimmte physisch und physiologisch<br />
bedingte Anforderungen an die Umgebung.<br />
Gehen erfordert Platz. Es ist wichtig, einigermaßen frei gehen zu<br />
können, ohne gestört oder gestoßen zu werden und ohne allzu viel<br />
ausweichen zu müssen. Das Problem hierbei ist, den richtigen Toleranzbereich<br />
zu finden, sodass Räume klein genug sind und genügend<br />
Anreize bieten, gleichzeitig jedoch genügend Bewegungsfreiheit<br />
vorhanden ist. Toleranz und Raumanforderungen sind von<br />
Person zu Person, innerhalb von Gruppen und von Situation zu Situation<br />
verschieden. Diese Beziehung wird durch Beobachtung des<br />
traditionellen abendlichen Spaziergangs auf dem Platz in Ioannina,<br />
einer Stadt in Nordgriechenland, veranschaulicht. Am Spätnachmittag<br />
ist die Anzahl der Beteiligten noch gering; vor allem Eltern mit<br />
Kindern und ältere Menschen bewegen sich auf dem Platz auf und<br />
ab. Allmählich wird es dunkel und immer mehr Menschen kommen<br />
heraus, dafür verschwinden zuerst die Kinder und dann die älteren<br />
Menschen. Später, wenn die Menge anwächst, ziehen sich vor allem<br />
Erwachsene mittleren Alters aus dem regen Treiben zurück.<br />
Am Abend bummeln eigentlich nur noch die jungen Bewohner der<br />
Stadt auf dem Platz.<br />
Gehen 133
sekundäre Sitzgelegenheiten<br />
160 Räume zum Gehen – Plätze zum Verweilen
Sitzlandschaften<br />
Treppen, Fassadendetails und<br />
alle Arten von Stadtmöbeln<br />
sollten in der Regel ein breites<br />
Spektrum an zusätzlichen,<br />
sekundären Sitzgelegenheiten<br />
bieten.<br />
rechts: Sitzlandschaften an der<br />
Oper in Sydney, Australien, und<br />
auf dem Pioneer Courthouse<br />
Square, Portland, USA<br />
Eine Gestaltung des Raumes, bei der eine relativ beschränkte Anzahl<br />
primärer mit einer großen Anzahl sekundärer Sitzgelegenheiten kombiniert<br />
wird, hat zudem den Vorteil, dass der Raum auch in Zeiten<br />
mit geringer Benutzerzahl ziemlich gut zu funktionieren scheint. Umgekehrt<br />
können viele leere Bänke und Stühle, wie sie während der<br />
Nebensaison in Straßencafés und Ferienhotels zu finden sind, leicht<br />
den deprimierenden Eindruck vermitteln, dass der Platz abgelehnt<br />
und verlassen wurde.<br />
Sitzlandschaften –<br />
Städtische MehrzwecKeinrichtungen<br />
Eine besondere Art von sekundären Sitzgelegenheiten stellen Sitzlandschaften<br />
dar – Mehrzweckelemente in städtischen Räumen,<br />
wie große Treppenaufgänge, Monumente oder Brunnen mit einem<br />
breiten Stufensockel sowie andere große Raumelemente, die dafür<br />
entworfen wurden, gleichzeitig mehrere Zwecke zu erfüllen. Die Ge-<br />
Sitzen 161
Sehen<br />
Alle, egal wie alt, sollten sehen<br />
können, was passiert. Fenster in<br />
Kinderhöhe in einem Kindergarten und<br />
ein Fenster für junge Passagiere auf<br />
einer Fähre<br />
Sehen ist eine Frage von guter Aussicht<br />
und ungehinderten Sichtlinien. Platz vor<br />
der Kathedrale, Straßburg, Frankreich<br />
164 Räume zum Gehen – Plätze zum Verweilen
Madrid, Spanien<br />
oft Fußgängerzonen, die zwei oder drei Stufen höher liegen als die<br />
Zonen des Kraftfahrzeugverkehrs.<br />
Auf der Piazza del Campo in Siena kommt dieses Prinzip besonders<br />
ausgefeilt zum Tragen. Der ganze Platz ist wie eine Tribüne gebaut –<br />
eine konkave Muschel mit Plätzen zum Stehen und Sitzen am oberen<br />
Rand und entlang der Fassaden. Diese Gestaltung bietet optimale<br />
Gelegenheiten zum Stehen und Sitzen in den Randzonen, neben<br />
Pollern und in Straßencafés. Sie sind gut definiert, der Rücken der<br />
Menschen ist geschützt und man hat einen wunderbaren Blick über<br />
die gesamte städtische Arena.<br />
Sehen – eine Frage des<br />
Lichts<br />
Hören<br />
Möglichkeiten zum Sehen sind auch eine Frage von angemessenem<br />
Licht auf die zu sehenden Objekte. Da öffentliche Räume ja auch<br />
im Dunkeln funktionieren sollen, kommt der Beleuchtung eine wesentliche<br />
Rolle zu, besonders der von Mitmenschen und Gesichtern.<br />
Um ein allgemeines Gefühl von Behagen und Sicherheit zu gewährleisten<br />
und es möglich zu machen, Menschen und Geschehnisse zu<br />
sehen, ist es wünschenswert, dass die Beleuchtung von Fußgängerzonen<br />
immer ausreichend und gut ausgerichtet ist. Bessere Beleuchtung<br />
bedeutet hier nicht zwangsläufig helleres Licht, sondern eine<br />
angemessene Helligkeit, die auf die vertikalen Oberflächen gerichtet<br />
oder reflektiert wird: Gesichter, Mauern, Straßenschilder, Briefkästen<br />
usw. – im Gegensatz zur Beleuchtung von Straßen. Bessere Beleuchtung<br />
bedeutet auch warmes und freundliches Licht.<br />
Jedes Mal, wenn eine Straße mit Autoverkehr in eine Fußgängerzone<br />
umgewandelt wird, bedeutet das auch, dass wir unsere Mitmen-<br />
Sehen, hören und sprechen 165
Aufenthaltsmöglichkeiten direkt an den <strong>Häusern</strong> – oder bloSSes kommen und gehen<br />
Zwei parallele Straßen in Kopenhagen<br />
oben: Klar begrenzte Straße, hier<br />
ist nur kurzes Kommen und Gehen<br />
möglich.<br />
Mitte und unten: Weiche Übergänge:<br />
An einem gewöhnlichen Tag finden<br />
hier dreimal mehr Aktivitäten als auf<br />
der oberen Straße statt. [19]<br />
186 Räume zum Gehen – Plätze zum Verweilen
Fließender, lebendiger Austausch<br />
<strong>zwischen</strong> öffentlichen und privaten<br />
Räumen (Sporenburg Eiland, Amsterdam,<br />
Holland)<br />
Die Verbindung von innen<br />
und auSSen – funktionell<br />
und psychologisch<br />
Geeignete Rastplätze direkt<br />
vor der Haustür<br />
Sitzbänke vor der Tür<br />
Viele Details bei der Gestaltung des Wohn- und Außenbereichs sowie<br />
des Eingangs selbst können für die Nutzung des Raums im Freien<br />
von Bedeutung sein. Es reicht nicht aus, dass Wohnhäuser niedrig<br />
sind. Der Plan eines Wohnbereichs muss so gestaltet sein, dass die<br />
Aktivitäten im Haus frei nach außen fließen können. Das kann zum<br />
Beispiel durch Türen von der Küche, dem Ess- oder Wohnzimmer<br />
direkt in den Außenbereich auf die öffentlich zugängliche Seite des<br />
Hauses gefördert werden. Dementsprechend müssen auch die Außenräume<br />
arrangiert werden – unmittelbar neben den Wohnräumen.<br />
Der Eingang selbst sollte so gestaltet sein, dass man so einfach wie<br />
möglich hindurchgelangen kann – funktionell und psychologisch.<br />
Mittelgänge, zusätzliche Türen und vor allem Höhenunterschiede<br />
<strong>zwischen</strong> Innen- und Außenraum sollten vermieden werden. Sie<br />
sollten sich vielmehr auf einer Ebene befinden. Nur dann können Ereignisse<br />
mühelos nach innen und außen fließen.<br />
Einer der Gründe, warum in vielen Wohngegenden vor <strong>Häusern</strong> relativ<br />
schwache Aktivitäten zu verzeichnen sind, liegt zweifellos darin,<br />
dass geeignete Orte für Aufenthalte im Freien gerade dort fehlen,<br />
wo sie am natürlichsten wären – am Eingang oder an anderen Orten,<br />
wo man mühelos eintreten und wieder gehen kann.<br />
Die Bank neben der Eingangstür, geschützt vor Regen und Wind,<br />
mit einer guten Sicht auf die Straße ist eine bescheidene, aber naheliegende<br />
Möglichkeit, das <strong>Leben</strong> vor der Tür in Schwung zu bringen.<br />
Sanfte Übergänge 187
Sanfte Übergänge – in jeder UmGebung<br />
196 Räume zum Gehen – Plätze zum Verweilen
In vielen Fällen lassen sich die Bedingungen für Aufenthalte im<br />
Freien auch vor und neben Hochhäusern verbessern, obwohl die<br />
schwierigen Übergänge <strong>zwischen</strong> dem Inneren und Äußeren die<br />
tatsächliche Inanspruchnahme der neuen Möglichkeiten einigermaßen<br />
einschränken. So können zum Beispiel halbprivate Vorgärten mit<br />
Sitz- und Spielgelegenheiten sowie Blumenbeeten an der Eingangstür<br />
eines jeden Treppenaufgangs für die jeweiligen Anwohner angelegt<br />
werden.<br />
In vielen Orten sind solche Verbesserungen an relativ neuen mehrstöckigen<br />
Wohngebäuden durchgeführt worden, wie unter anderem<br />
an den Hochhausprojekten Krocksbäck und Rosengård, die in den<br />
1960er Jahren in Malmö, Schweden, errichtet und ab den späten<br />
70ern ausgiebig verbessert wurden.<br />
In diesen und vergleichbaren Projekten bemühte man sich, die<br />
Wohngebäude unterschiedlich zu gestalten, sodass große unübersichtliche<br />
Bereiche klar in kleinere Einheiten unterteilt werden können.<br />
Diese Gliederung wird durch die Gestaltung von drei oder vier<br />
verschiedenen Kategorien öffentlicher Räume verstärkt, die klar definiert<br />
entweder zum gesamten Bauprojekt, zu einzelnen <strong>Häusern</strong>,<br />
zu den individuellen Treppenaufgängen oder zu den Wohnungen im<br />
Erdgeschoss gehören.<br />
Sanfte Übergänge –<br />
in jeder Umgebung<br />
Die Gestaltungsprinzipien, die in Wohngebieten stationäre Tätigkeiten<br />
im Freien fördern, gelten auch im Kontext anderer Gebäudetypen<br />
und städtischer Funktionen. Überall, wo sich Menschen von einer<br />
städtischen Funktion zur nächsten bewegen oder wo die Funktionen<br />
innerhalb eines Gebäudes von den Aufenthaltsmöglichkeiten<br />
im Freien profitieren können, muss eine gute Verbindung <strong>zwischen</strong><br />
Innen- und Außenraum, kombiniert mit geeigneten Ruheplätzen vor<br />
den Gebäuden, selbstverständlich sein.<br />
Eine derartige Ausweitung der Möglichkeiten für Aufenthalte im Freien<br />
– und zwar genau dort, wo die täglichen Aktivitäten stattfinden –<br />
wird fast ausnahmslos einen wertvollen Beitrag zu einer gegebenen<br />
Funktion und zum <strong>Leben</strong> <strong>zwischen</strong> den <strong>Häusern</strong> in einem Bauprojekt,<br />
in einem Stadtteil und in der Stadt darstellen.<br />
Sanfte Übergänge 197