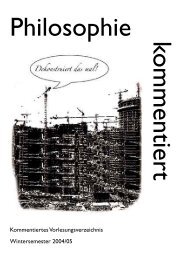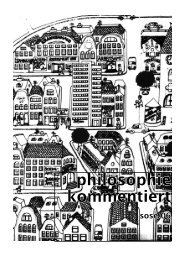ERRATUM Kovo WS 04/05
ERRATUM Kovo WS 04/05
ERRATUM Kovo WS 04/05
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>ERRATUM</strong> <strong>Kovo</strong> <strong>WS</strong> <strong>04</strong>/<strong>05</strong><br />
Esther Ramharter: Die Kommentare der beiden LVen wurden vertauscht<br />
Block:<br />
Das Siegel der Sophia. Weibliche Weisheit im Altertum<br />
Sabine Bauer<br />
SE 2 Std., HS 2G, Vorbespr.: 15.10., 18:00-20:00 (696978)<br />
Termine: Fr 5.11. und 3.12. 14:00-20:00 Uhr ; Sa 6.11. und 4.12. 9:00-14:00 Uhr, Jännertermin<br />
wird noch bekanntgegeben<br />
Fächer: (8) (4/2/2) (PP 57.6) (PPP 5/2/a/5)<br />
Kommentar: Im Seminar wird das Verhältnis von Philosophie und weiblicher Weisheit erörtert. Neben<br />
der gebräuchlichen Tradierung des philosophischen Kanons wird eine andere Gründungssituation der<br />
abendländischen Philosophie beleuchtet: Im Zentrum steht die Frage nach dem "Geist weiblicher Weisheit"<br />
- Sophia - und die Beschreibung eines Weisheitskonzeptes, das im Altertum um ein weibliches Denken<br />
gebildet wurde. Das Seminar soll einen Einblick in vergessene Weisheitstraditionen geben, zu einer<br />
Auseinandersetzung mit der Verdrängung des Weiblichen in der Geschichte der Philosophie führen und<br />
einen Beitrag zur Neubewertung der Philosophie als Liebe zur Weisheit (Philo-Sophia) leisten.<br />
Didaktik: Diskutiert und interpretiert werden Texte aus der Weisheitstradition des Alten Testaments,<br />
griechische Apophthegmensammlungen, gnostische Quellen, Ikonen und kulturwissenschaftliche<br />
Dokumente des Vorderen Orients. Besonderer Wert wird dabei auf die Frage der Weisheitsvermittlung und<br />
Weisheitsfindung gelegt. Gemeinsame Textlektüre und Kurzreferate.<br />
Zeugniserwerb:durch Referat oder schriftliche Arbeit.<br />
Zum Begriff des Ereignisses<br />
Isolde Charim<br />
VO 2 Std., Vorbesprechung 5. 10., 18:00-20:00, HS 3C (695677)<br />
Blocktermine werden in der Vorbesprechung bekanntgegeben<br />
Fächer: (8) (3/2/7) ( PPP 5/2/a/1) (PP 57.6)<br />
Kommentar: Ausgangspunkt der Lehrveranstaltung ist die Frage nach dem Umgang mit dem Erbe der<br />
Geschichtsphilosophie. In einem ersten Teil soll den verschiedenen Arten, dieses Erbe nicht anzutreten,<br />
nachgegangen werden:<br />
1. der Rede vom "Ende der Geschichte" - etwa bei A. Gehlen. Dieses Diktum ist in allen Diskursen zur<br />
Alternativlosigkeit unserer Welt nach wie vor wirksam.<br />
2. der linken Absage an den "großen, historischen Augenblick" der Veränderung, sowie an dessen<br />
privilegierten Raum. Abgelöst wurden diese Vorstellungen durch die Rede von den Nischen, den Rändern,<br />
sowie den vielen kleinen Brüchen - welche dem "paradoxen Raum" (Michel Pecheux) in dem wir leben<br />
entsprechen sollen.<br />
3. der paradoxesten Position: jene Absage, die Geschichte durch den Begriff des "Ereignisses" ersetzt - wie<br />
etwa Alain Badiou.<br />
Da Badious Hauptwerk, "Das Sein und das Ereignis" jetzt erstmals auf deutsch erscheinen soll, ergibt sich<br />
die Möglichkeit, diese Position einer nicht-geschichtsphilosophischen Geschichtsphilosophie näher zu<br />
untersuchen: Badious Begriff des Ereignisses soll in Bezug auf andere Konzepte der Veränderung gelesen<br />
werden: wie etwa der Begriff des "hegemonialen Kampfes" bei Laclau/Mouffe; oder der Begriff des "Aktes"<br />
bei Slavoj Zizek; aber auch der Begriff des "Ausnahmezustands" in dessen unterschiedlichen<br />
Formulierungen bei Carl Schmitt, Walter Benjamin und - jüngstens - bei Giorgio Agamben.<br />
Didaktik: Die Lehrveranstaltung ist als Seminar konzipiert. Sie sieht eine gründliche gemeinsame Lektüre<br />
der Texte vor, eingeleitet von einem studentischen Referat. Zeugniserwerb: Referat oder schriftliche<br />
Seminararbeit<br />
Literatur:<br />
Arnold Gehlen: Über kulturelle Evolutionen, in: Helmut Kuhn, Franz Wiedmann (Hg.): Die Philosophie und<br />
1
die Frage nach dem Fortschritt, München 1964<br />
Michel Pecheux: Ideologie - Festung oder paradoxer Raum?, in: Das Argument, Bd. 33, Berlin 1983<br />
Alain Badiou: Das Sein und das Ereignis, erscheint 20<strong>04</strong><br />
Alain Badiou: Paulus. Die Begründung des Universalismus, München 2002<br />
Ernesto Laclau/Chantal Mouffe: Hegemonie und radikale Demokratie, Wien 2000<br />
Slavoj Zizek: Die Tücke des Subjekts, Frankfurt/M. 2001<br />
Giorgio Agamben: Ausnahmezustand, Frankfurt/M. 2003<br />
Natur und ihre Verwissenschaftlichung<br />
Reinhold Esterbauer<br />
SE 2 Std., HS 2H, NIG, 2. St., (696870)<br />
Vorbespr. Fr 15.10., 12:00-13.30, Blöcke: Fr 14.1. und 21.1 20<strong>05</strong>: 9:00-13:00 und 14.30-18.30, Sa<br />
15.1 und 22. 1. 20<strong>05</strong> 9:00-13:00<br />
Fächer: (8, 6) (4/1/6) (PP 57.3.4) (PPP 5/2/a/4)<br />
Kommentar: Im Seminar werden erkenntnistheoretische Texte gemeinsam gelesen und interpretiert, die<br />
sich mit dem Problem beschäftigen, wie Natur wissenschaftlich gefasst werden kann. Es geht darum,<br />
unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge zu Natur und Differenzierungskriterien kennen zu lernen.<br />
Ausgewählte naturwissenschaftliche und philosophische Weisen der Naturerkenntnis sollen genauer<br />
analysiert werden.<br />
Lehr-/Lernziel: Die Studierenden sollen in der Lage sein, zwischen unterschiedlichen Naturbegriffen zu<br />
differenzieren und interdisziplinär zu denken.Arbeitsweise und Anforderung: Lektüre, Referate, Diskussion;<br />
für ein Zeugnis ist eine schriftliche Seminararbeit zu verfassen.<br />
Literatur: Texte werden als Reader zur Verfügung gestellt; weitere Literatur in der Lehrveranstaltung<br />
Rationalitätsmodelle<br />
Karen Gloy<br />
VO 2 Std. (693990)<br />
Mo 18. 10., 9:00-11:00 HS 2H, 12:00-14:00 HS 3B; Di 19.10., 9:00-10:00 HS 2i, 12:00-14:00 HS<br />
2i, 14:00-15:00 HS 2G;<br />
Mi 20. 10., 10:00-12:00 HS 3C, 12:00-14:00 HS 3C; Do, Fr, Sa = 21. bis 23.10. 9:00-13:00 HS 3F<br />
Fächer: (2) (3/2/2, 4/1/2) (PP 57.3.1) (PPP 5/2/a/1)<br />
Kommentar: Seit mehr als einer PhilosophInnengeneration gehört die radikale Vernunftkritik und die<br />
Instantiierung des Anderen der Vernunft zu den Hauptthemen der Gegenwartsphilosophie, wie sie<br />
insbesondere von der Postmoderne forciert worden sind. Geprobt wird der Aufstand gegen die Vernunft und<br />
ihre angemaßte Herrschaftsrolle im Namen des unterdrückten, verachteten Anderen der Vernunft, was<br />
immer unter diesem Pauschalausdruck verstanden werden mag, ob Sinnlichkeit, Leiblichkeit, innere oder<br />
äußere Natur u. ä. Ob die Vernunft abzusetzen sei und was dies bedeute, ja überhaupt was unter Vernunft zu<br />
verstehen sei, soll Thema dieser Vorlesung sein. Konzentrieren wird sie sich auf die Themenkomplexe<br />
Einheit-Vielheit der Vernunft, Typen von Vernunft (= Rationalität), wobei insbesondere folgende erarbeitet<br />
werden sollen:<br />
- die Listenmethode (die sumerisch-babylonische Wissenschaftsauffassung)<br />
- die Dihairesies (die seit Platon und dem klassischen Griechentum die europäische Tradition bestimmt) die<br />
Dialektik (Platon, Fichte, Hegel)<br />
- das Analogiedenken (das in der Hermetik und heute in der fraktalen Geometrie und Chaostheorie eine<br />
Rolle spielt).<br />
Literatur:<br />
K. Gloy: Vernunft und das Andere der Vernunft, Freiburg, München 2001<br />
K. Gloy (Hrsg.): Rationalitätstypen, Freiburg, München 1999<br />
K. Gloy / M. Bachmann (Hrsg.): Das Analogiedenken. Vorstöße in ein neues Gebiet der<br />
Rationalitätstheorie, Freiburg, München 2000<br />
2
Alter - Krankheit - Sterben Philosophisch-medizinische und ethische Probleme in der<br />
Geriatrie<br />
Peter Kampits, Wolfgang Wlk<br />
SE 2 Std. (694693)<br />
Fächer: (4) (§4/1/3) (PP § 57.3.3) (PPP 52/a/2), Vorbesprechungstermin am Institut für<br />
Philosophie wird bekanntgegeben Blocktermine im SMZ-Ost (Geriatriezentrum Donaustadt), 1220<br />
Wien, Langobardenstraße 122<br />
Pers. Anmeldung Sekr. Prof. Kampits<br />
Philosophie in Lateinamerika.Identität, Vergleich, Wechselwirkung zwischen<br />
lateinamerikanischen und ... (LV-Titel unvollst.)<br />
Heinz Krumpel<br />
VO 2 Std. persönl. Anmeldung erforderlich beim ersten Termin (601370)<br />
Fächer: (8) (4/1/7, 4/2/4) (PPP § 5/2/a/5 )(PP § 57.3.4.)<br />
Termine: HS 3C, Fr 5.11. 16.00-20.00, Sa 6. 11. 9.00-14.00; Do 13.1. 16.00-20.00, Fr 14.1. 16.00-<br />
20.00 und Sa 15.1. 9.00-14.00<br />
Seminar Kulturphilosophie: Wittgenstein's Aesthetics<br />
(8) (§4/2/4) (PP 57.6.1) (PPP 5/2/a/2)<br />
Allan Janik<br />
Fr 16:00-19:00 Hs. 3E (NIG), 14-tägig geblockt (601399)<br />
ab 15.10.20<strong>04</strong> Fr 16:00-19:00 Hs. 3E NIG<br />
Kommentar: Both the place of the aesthetic moment in knowing in Wittgenstein’s thought and the<br />
implications of Wittgenstein’s explicit views about aesthetics have received increasing attention by<br />
philosophers and provided considerable stimulus to art historians in recent years.<br />
On the basis of lectures, reports and discussion the course will explore Wittgenstein’s most important texts<br />
on the subject including Philosophical Investigations II, xi and the Lectures on Aesthetics as well the<br />
implications of these views for understanding pictures generally art in particular (painting will be<br />
particularly emphasized) as developed within the Bergen School of Aesthetics (Norway).<br />
Philosophische Anthropologie<br />
Rudolf Langthaler<br />
VO 4 Std., ab 7.10.20<strong>04</strong> Do, Fr 10:00-12:00 Hs. 47 HG (117528)<br />
Kommentar: Die Frage nach der besonderen Weltstellung und der "Bestimmung des Menschen"<br />
("Was ist der Mensch?) ist ein zentrales Thema der Philosophie. In dieser 4-stündigen Vorlesung<br />
sollen nach einem Überblick über die philosophische Lehre vom Menschen in der europäischen<br />
Philosophie die Grundzüge einer philosophischen Anthropologie in systematischer Absicht entfaltet<br />
werden. In einem abschließenden Teil dieser Vorlesung werden spezielle Themen einer<br />
philosophischen Anthropologie vor dem Hintergrund gegenwärtiger wissenschaftlicher und<br />
geselllschaftlicher Herausforderungen (moderne Bio-Wissenschaften, Neurobiologie) beleuchtet.<br />
Konversatorium zur Vorlesung<br />
Rudolf Langthaler<br />
KO 1 Std., ab 8.10.20<strong>04</strong> Fr 12:00-13:00 Hs. 47 HG (102075)<br />
3
Ethik: Medizinethik unter den Bedingungen einer pluralistischen Gesellschaft<br />
Günther Pöltner SE 2 Std. (696894)<br />
Vorbesprechung: 8.10.20<strong>04</strong>, 10-11 HS 3B NIG<br />
Blocktermine: 14./15.1.20<strong>05</strong> und 21./22.1.20<strong>05</strong><br />
Freitag, 13-18 Uhr, Samstag: 9-13 Uhr HS 3B NIG<br />
Fächer: (4) (4/1/3) (PP 57.2.5) (PPP 5/2/a/2)<br />
Kommentar: Wie steht es um den Grundkonsens in unserer vom Pluralismus der Werte und<br />
Wertbegründungen bestimmten Gesellschaft, der seinen Ausdruck in der Anerkennung von Freiheit,<br />
Gleichheit, Menschenwürde und den daraus ableitbaren Grundrechten findet? Grund und Reichweite der<br />
Menschenwürde, Anfang und Ausmaß des Lebensschutzes werden ebenso kontrovers diskutiert wie die<br />
Frage nach Inhalt und Umfang des Begriffs ‚Mensch’. Diese Probleme sollen anhand medizinethischer<br />
Beispiele diskutiert werden. Literaturangaben in der Vorbesprechung<br />
Zeugniserwerb: schriftliche Seminararbeit<br />
Aristoteles: Nikomachische Ethik<br />
Markus Riedenauer<br />
VO 1 Std., 12:00-14:00, Hs. 2i NIG (601693)<br />
Termine: 4.10., 8.11., 15.11. und 6.12.20<strong>04</strong>-31.1.20<strong>05</strong><br />
Fächer: (2) (3/2/1, 4/1/1) (PP 57.2.5) (5/2/a/2)<br />
Strukturtypen der Logik. Für mäßig Fortgeschrittene<br />
Claudia Thome<br />
VO 2 Std., (696995) Hs. 7<br />
Fr 15.10., 19.11., 10.12.20<strong>04</strong> und 14.1.20<strong>05</strong> 18:30-20:00; Sa 16.10., 20.11., 11.12.20<strong>04</strong> und<br />
15.1.20<strong>05</strong> 10:00-13:30<br />
Fächer: (7) (4/1/5) (PP 57.2.3) (PPP 4/2/c/2)<br />
Wie funktioniert Wissenschaft?<br />
Friedrich Wallner<br />
SE 2 Std., Prominentenzimmer (neben Audimax, HG), (6969<strong>05</strong>)<br />
Vorbesprechung: 13. Oktober, 16 Uhr im Prominentenzimmer<br />
Zeit: Do 18-20 Uhr, außer am 18.11. von 16-20 Uhr<br />
Termine:21.10., 28.10, 4.11., 18.11, 25.11., 2.12., 9.12., 16.12.,13.1., 20.1., 27.1.<br />
Fächer: (5) (4/2/3) (PP 57.2.4) (PPP 4/2/c/3)<br />
Kommentar: Welche Ansprüche stellt die Wissenschaft als Wissenschaft? Was sind ihre impliziten<br />
Voraussetzungen? Wo liegen ihre Grenzen? Was sind ihre Ideale und sind diese überhaupt praktizierbar?<br />
Diese und ähnliche Fragen sind Teil des Seminars, sie sollen anhand eines konstruktivistischen Ansatzes<br />
behandelt und diskutiert werden. Weiters liegt der Schwerpunkt auf den Bereichen "Wissenschafts-<br />
Coaching" und "epistemologische Supervision": Theorie und Praxis der Wissenschaft scheinen oft nicht<br />
miteinander verbindbar; durch den Konstruktiven Realismus sollen jedoch Wege aufgezeigt werden, wie<br />
dies dennoch möglich wird.<br />
Die wissenschaftliche Struktur der chinesischen Medizin<br />
Friedrich Wallner<br />
SE 4 Std., Prominentenzimmer (696901)<br />
Fächer: (5) (4/2/4) (PP 57.2.4) (PPP 4/2/c/3)<br />
Vorbespr.: 13. Oktober, 17 Uhr im ProminentInnenzimmer<br />
4
Zeit: Mi 9-13 Uhr, am 24.11., 1.12. u. 15.12. v. 9-13 Uhr u. v. 16-20<br />
Uhr, Termine: 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 15.12.<br />
Kommentar: Die chinesische Medizin ist geprägt von der Kultur, in die sie eingebettet ist. Für westlich<br />
Denkende scheint die Andersartigkeit oft unwissenschaftlich. Die Fremdartigkeit der chinesischen Medizin<br />
soll näher beleuchtet, Unterschiede aus dem Blickwinkel der Wissenschaft aufgezeigt werden, um ein<br />
besseres Verständnis für eine "andere" Wissenschaftlichkeit<br />
zu erlangen.<br />
Konstruktion und Wirklichkeit . Die Kulturabhängigkeit der Wissenschaft: Wissenschaft,<br />
Erkenntnis und Kultur Kampf der Kulturen?<br />
Friedrich Wallner<br />
SE 4 Std., ProminentInnenzimmer (6969<strong>04</strong>)<br />
Vorbespr.: 13. Oktober, 18 Uhr im Prominentenzimmer<br />
Zeit: Do 14-18 Uhr, außer am 18.11. von 9-16 Uhr<br />
Termine: 21.10., 28.10, 4.11., 18.11, 25.11., 2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1.<br />
Fächer: (5) (4/2/3) (PP 57.2.4) (PPP 4/2/c/3)<br />
Kommentar: Durch den Terroranschlag vom 11.9.2001 wurde Samuel P. Huntingtons Buch "Kampf der<br />
Kulturen", das bereits 1996 erschienen ist, wieder aktuell. Um die politische bzw. geschichtsphilosophische<br />
Aussagekraft seiner zentralen Thesen beurteilen zu können, soll in diesem Seminar vor allem der<br />
Kulturbegriff, auf den sich Huntington stützt, einer eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die<br />
Diskussion verschiedener heute gehandelter Kulturtheorien sowie der wissenschaftstheoretische<br />
Hintergrund bei den Fragen des Verstehens, der Kulturbeschreibungen etc. steht im Mittelpunkt des ersten<br />
Seminarteils. In einem zweiten Schritt sollen dann die Konsequenzen, welche sich aus den konkurrierenden<br />
Konzepten ergeben, verglichen und schließlich alternative konstruktivistische Ansätze erörtert werden.<br />
Literatur:<br />
Huntington, Samuel P.: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert .<br />
Hamburg 1996.<br />
ders.: Streit um Werte: wie Kulturen den Fortschritt prägen. Hamburg 2002.<br />
Tibi, Bassam: Krieg der Zivilisationen. München 1998.<br />
Achcar, G.: Der Schock der Barbarei. Der 11. Sept und die "neue Weltordnung". Karlsr. 2002.<br />
Çaglar, G.: Der Mythos vom Krieg der Zivilisationen. Der Westen gegen den Rest der Welt; eine Replik auf<br />
Huntington. Münster 2002 .<br />
Metzinger, U. M.: Die Huntington-Debatte ... in der Publizistik. Köln 2000.<br />
Meyer, Th.: Identitätspolitik: vom Missbrauch kultureller Unterschiede. Ffm 02 (es 2272)<br />
Mohrs, T.: Interkulturalität als Anpassung: eine evolutionstheor. Kritik an Hunt. Ffm 00.<br />
Müller, H.: Das Zusammenleben der Kulturen: ein Gegenentwurf zu Huntington.Ffm: 2001 (Fischer-Tb<br />
13915).<br />
Müller, H.: Amerika schlägt zurück: die Weltordnung nach dem 11. Sept. Ffm 2003.<br />
Cassirer, E.: Versuch über den Menschen. Einführung in die Philos. Der Kultur. Hamburg 96<br />
Köhler, W.R.: Intentionalität und Personenverstehen, Ffm. 1990, stw 856 Kambartel, F.: Versuch über das<br />
Verstehen. Ffm 1991, stw 866<br />
Stegmaier, W.: Diplomatie der Zeichen. Orientierung im Dialog eigener und fremder Vernunft. Ffm 1998,<br />
stw 1367<br />
Wallner, Fritz: Culture and Science. Wien 2002<br />
Geschichte der Philosophie: Antike<br />
Michael Wladika<br />
VO 2 Std. (696959)<br />
Anmerkung: Termine entnehmen Sie bitte den Aushängen<br />
Fächer: (2) (3/2/1, 4/1/1) (PP 57.3.1) (PPP 5/2/a/1)<br />
Kommentar: Diese Vorlesung soll im Sinne eines Grundkurses einen Überblick über die Geschichte der<br />
Philosophie der Antike geben, beginnend mit den ersten Denkern, bis hin zu einigen Filiationen spätantiker<br />
5
neuplatonischer Systembildung. Dies allerdings aus Zeitgründen freilich nur auf sehr grobe,<br />
holzschnittartige Weise. Daher und auch aus Gründen des sachlichen Gewichts und auf dass ein Eindruck<br />
von der Größe antiken Denkens empfangen werden kann, ist eine klare Konzentration auf Platon und<br />
Aristoteles erforderlich. Einerseits wird also ein Gesamtüberblick gegeben, in dem das Doxographische, ja<br />
bisweilen gar das Prosopographische notwendigerweise in den Vorder-, das im eigentlichen Sinne<br />
Philosophische in den Hintergrund tritt, andererseits das Entgegengesetzte, also gründliches Nachvollziehen<br />
zentraler Lehrstücke und Argumentationsformen bei der Vorstellung des Werkes Platons und desjenigen des<br />
Aristoteles. Es soll sehr stoffreich Geschichte der Philosophie betrieben, ebenso aber auf systematische<br />
Zusammenhänge und Denkformen aufmerksam gemacht werden, die historischer Relativierung widerstehen<br />
und von exemplarischer Bedeutung sind. Das Bemühen wird sein, Geschichte der Philosophie auf<br />
philosophische und d. h. nach Überzeugung des Lehrveranstaltenden: auf systematische Weise zu betreiben.<br />
Es könnte so die Einsicht bewirkt werden, dass wir ohne die Griechen in der Philosophie nirgends<br />
hinkommen.<br />
Didaktik:Vorlesung. Blockveranstaltung. Zeugniserwerb durch schriftliche Prüfung.<br />
Literatur: Die Darstellung wird so weitgehend wie möglich aus den Quellen erarbeitet, Sekundärliteratur<br />
wird jeweils zu den einzelnen Denkern im Laufe der Vorlesung angegeben.<br />
Fichte: "Die Anweisung zum seligen Leben"<br />
Michael Wladika<br />
PS 2 Std. (696880)<br />
Anmerkung: Termine entnehmen Sie bitte den Aushängen<br />
Fächer: (3) (3/2/2)<br />
Kommentar: Diese Lehrveranstaltung begreift sich als zugleich systematisch und geschichtlich orientiert,<br />
auf die historische Bedeutung Fichtes ebenso wie auf die gegenwartsrelative systematische Relevanz der<br />
großen Texte des Deutschen Idealismus blickend. Kein Werk des Deutschen Idealismus denkt einfach an der<br />
transzendentalphilosophischen Revolution Kants vorbei. Die Werke des späten Fichte stellen eine der ganz<br />
wenigen geschichtlich verwirklichten Möglichkeiten dar, keine der Errungenschaften von<br />
Transzendentalphilosophie zurückzunehmen und doch wieder von Existenz des Ichs, Existenz Gottes,<br />
Existenz der Welt zu sprechen. So sind diese Werke von eminenter transzendentalphilosophischer<br />
Bedeutung. Weiter gilt Die Anweisung zum seligen Leben als das bedeutendste religionsphilosophische<br />
Werk Fichtes. Hier findet sich die zentrale Rede vom ‘Bild des Absoluten’, zu welchem sich die Freiheit zu<br />
machen, als welches sie sich zu erfassen hat. Und es zeigt sich, was mit dieser Konzeption hinsichtlich<br />
vieler allgemein als religionsphilosophisch grundlegend aufgefasster Bestimmungen wie Offenbarung,<br />
Gesetz, Unsterblichkeit usf. verknüpft ist. Wir haben hier einen Entwurf von Religionsphilosophie, der<br />
immer noch an den äußersten Rändern des zu Denkenden steht.<br />
Didaktik: Proseminar. Blockveranstaltung. Zeugniserwerb durch schriftliche Prüfung.<br />
Literatur:<br />
a) Empfohlene Ausgabe: Fichte, Johann Gottlieb, Die Anweisung zum seligen Leben, hrsg. H. Verweyen,<br />
Hamburg 3 1983<br />
b) Zur Einführung geeignet beispielsweise: Gamm, Gerhard, Der Deutsche Idealismus. Eine Einführung in<br />
die Philosophie von Fichte, Hegel und Schelling, Stuttgart 1997, 35-76<br />
Rohs, Peter, Johann Gottlieb Fichte, München 1991<br />
Daseinsanalyse - Grundfragen in Theorie und Praxis: Zeit und Sein (Interdisziplinäres<br />
Seminar VIII): Einführung in die Daseinsanalyse unter besonderer Berücksichtigung des<br />
Gestimmtseins<br />
Karl Augustinus Wucherer<br />
SE 1 Std., ab 8.10.20<strong>04</strong> Fr 18:00-20:00 Hs. 48 HG (600090)<br />
Fächer: (4) (§4/1/3) (PPP §5/2/a/5) (PP §57.6)<br />
Kommentar: 12. Nov. (Beginn) W u c h e r e r<br />
3. Dez.:Univ.-Ass. Dr. med. Christian A. Plass<br />
Inwiefern sind die Organsysteme des Bauches als »zweites Gehirn« ein physiologisches Korrelat des<br />
6
gestimmten und affektiven Weltbezugs? Ein Beitrag zur daseinsgemäßen Psychosomatik<br />
Lit.: Michael Gershon, Der kluge Bauch. Die Entdeckung des zweiten Gehirns, München 2001.<br />
14. Jän.:Univ.-Prof. Dr. phil. István M. Fehér (Budapest).<br />
Heideggers ontologische Neuinterpretation und Aufwertung der Stimmungen im Zusammenhang seiner<br />
phänomenologischen Radikalisierung der Lebensphilosophie und der hermeneutischen Destruktion der<br />
abendländischen Metaphysik<br />
21. Jän.:Ass.-Prof. Mag. theol. Dr. phil. Karl Baier: Seinsverständnis in Stimmung und Gefühl.<br />
Daseinsanalyse ist eine psychotherapeutische Methode und Forschungsrichtung, in der es um die Befreiung<br />
des Menschen zu angemessener Offenheit und zu selbst verantwortetem Handeln geht. Sie ist aus der<br />
Begegnung psychoanalytischer Theorie und Praxis (Freud, C.G. Jung u.a.) mit dem phänomenologischhermeneutischen<br />
Denken (Husserl, Heidegger) erwachsen. Geleitet ist sie vom Respekt und der Ehrfurcht<br />
vor den Phänomenen. Sie hinterfragt theoretische Konstrukte auf ihre Phänomennähe und deklariert für ihr<br />
Menschen- und Therapieverständnis ihre phänomenologisch erarbeiteten philosophischen Grundlagen und<br />
neuen Forschungen. In der Seminarveranstaltung überschneiden sich die Bereiche der Ontologie, Ethik und<br />
Anthropologie, besonders die des seelisch leidenden Menschen, sowie der psychotherapeutischen<br />
Praxis.Hauptthemen im <strong>WS</strong> sind Gefühle (Affekte, Leidenschaften, besonders Stimmungen als länger<br />
dauernde Gesamtbefindlichkeiten). Psychologisch werden sie als subjektive Erlebnisqualitäten und innere<br />
Seelenzustände beschrieben; daseinsanalytisch werden sie erfahrungsnäher als Seinsmöglichkeiten<br />
verstanden, welche die Art und Weise unseres offenständigen Da-seins (Anwesens) im Bezug zur Mit- und<br />
Umwelt unmittelbar erschließen, aber auch verschließen. Das Seminar ist auch als Einführung in den<br />
Grundgedanken der Daseinsanalyse geeignet.<br />
Einführende Literatur in die Daseinsanalyse:<br />
M. Heidegger, Zollikoner Seminare, hrsg. von M. Boss, Frankfurt/M. 2 1994<br />
M. Boss, Grundriß der Medizin und der Psychologie, Bern 3 1999;<br />
H. Helting, Einführung in die philosophischen Dimensionen der psychotherapeutischen Daseinsanalyse,<br />
Aachen 1999.<br />
Weitere Informationen über Daseinsanalyse: www.daseinsanalyse.at<br />
Philosophisch-biologisches Seminar: Was ist der Mensch? Vom nackten Affen bis zu Gottes<br />
Ebenbild.<br />
Ludwig Huber, Georg Janauer, Peter Kampits, Ulrich Kattmann, Rudolf Langthaler, Peter Markl,<br />
Hannes Paulus, Marianne Popp, Erwin Lengauer und Dr.Maria Woschnak.<br />
SE 2 Std. (859761),Vorbesprechung und Anmeldung am Do, 7.Oktober 20<strong>04</strong> um 18.00 Uhr im HS<br />
II, Biozentrum.<br />
Blockveranstaltung: Bildungshaus Stift Zwettl - vom 5. - 7. November 20<strong>04</strong>; Vorträge: 14. 10.;<br />
21.10.; 28.10.; 4.11.<strong>04</strong><br />
Fächer: (5)(§4/1/6)(PPP§5/2/a/4) (PP§57.3.5).<br />
Kommentar: Ziel dieser Lehrveranstaltung ist es in einem interdisziplinären Diskurs Themenkreise zu<br />
erörtern, die Philosophie und Biologie verbinden. In den vergangenen Studienjahren lauteten die Titel etwa<br />
'Gentechnik und Ethik' oder 'Neurobiologie - Bewusstsein - Willensfreiheit'.<br />
Themenkreise:<br />
1. Langthaler (Gottes Ebenbild)<br />
2. Paulus (Tiersprachen- Menschensprachen)<br />
3. Atzwanger (Evolutionaere Anthropologie)<br />
4. Kampits/Lengauer (Philos. anthropologische Konzepte)<br />
weiter Info Ende September unter www.univie.ac.at/ethik/philo_biologie/<br />
7
Freud, Lacan, Derrida<br />
Michael Turnheim<br />
VO 1 Std.: Fr 16.00-18.00 Uhr, Hörsaal B der Hörsäle am Südgarten,<br />
Allgemeines Krankenhaus, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien;<br />
Erste Vorlesung: 8. Oktober 20<strong>04</strong>, die weiteren Termine werden noch bekannt gegeben, circa pro<br />
Monat ein Freitag<br />
Kommentar: Es geht um die Untersuchung von Phänomenen, die mit "Virtualität" und<br />
"Gespenstigem" zu tun haben. Beispiel: der verrückte Präsident Schreber wird nicht nur von "Wundern"<br />
heimgesuchte, sondern ist auch imstande, der Realität nahestehende Phänomene selbst zu produzieren.<br />
Solche "sinnlich übersinnliche" Erscheinungen kommen nicht nur bei Verrückten vor, sondern bestimmen<br />
mehr den je unseren Alltag. Sie lassen sich durch Bezug auf Karl Marx, den lang verkannten Spezialisten<br />
des Gespenstigen, erhellen. Von der marxistischen Theorie über den "Fetischcharakter der Ware"<br />
ausgehend, sollen im weiteren Texte von Derrida und der Frankfurter Schule studiert werden.<br />
Erfahrung und Evidenz: Wie argumentiert man in der Philosophie und in anderen<br />
Wissenschaften?,<br />
SE, 2St, 901697<br />
Termine: 14-tägig jeweils Donnerstag 14-18 Uhr, Vorbesprechung: 7.10.20<strong>04</strong>, Ort: SR 6, IFF,<br />
Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien<br />
Fächer: (5, 6) (§ 3/2/4) (PPP § 5/2/a/4) (PP § 57.6)<br />
Kommentar: Jedes Wissen legitimiert sich aus Erfahrung und beruft sich auf Evidenzen. Das trifft<br />
sowohl auf Naturwissenschaften, Kulturwissenschaften wie auch auf die nicht-empirische Philosophie zu.<br />
Wie argumentieren Wissenschaften und die Philosophie? Welche Argumente gelten innerhalb der<br />
jeweiligen scientific community als überzeugend? Welche Arten der "Erfahrung" werden genutzt, welche<br />
werden als täuschend zurückgewiesen? Und warum sind sich die Wissenschaften oft nicht einig, welche<br />
Erfahrung zur Grundlage einer Erkenntnis herangezogen werden kann?<br />
Ziel des Seminars ist es, durch einen Vergleich der unterschiedlichen Praktiken des Beweisens und des<br />
Überzeugens ein besseres Verständnis für die sozialen und erkenntnistheoretischen Normen sowohl des<br />
wissenschaftlichen wie auch des philosophischen Argumentierens zu entwickeln.<br />
Zeugniserwerb: Aktive Mitarbeit zusammen mit einer mündlichen Prüfung oder einer schriftlichen<br />
Seminararbeit<br />
Literatur:Literatur wird am Beginn der Lehrveranstaltung gegeben, aus der einzelne Artikel für die<br />
Diskussion ausgewählt werden können<br />
Anmeldung: markus.arnold@univie.ac.at<br />
8