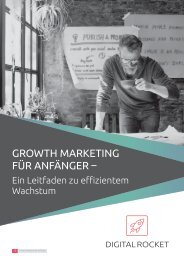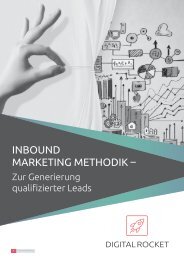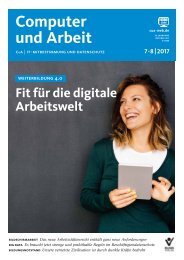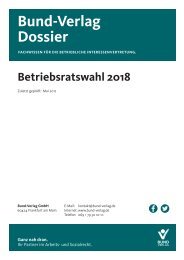Leseprobe Soziale Sicherheit 6_2016
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seiten 209– 252/ www.sozialesicherheit.de / 65. Jahrgang / ISSN 0490-1630 / D 6364<br />
<strong>Sicherheit</strong><br />
Zeitschrift für Arbeit und <strong>Soziale</strong>s<br />
6<br />
<strong>2016</strong><br />
sozialesicherheit.de<br />
Betriebsrente und<br />
Krankenversicherung:<br />
Der Streit um doppelte<br />
Beiträge für Rentner<br />
Bedingungsloses<br />
Grundeinkommen:<br />
Eine sozialpolitische<br />
Alternative?<br />
Rehabilitation:<br />
Ohne Nachsorge<br />
keine erfolgreiche Reha<br />
Pflege und Altenhilfe:<br />
Was Skandinavien<br />
anders und besser<br />
macht<br />
Für Sie beigelegt:<br />
Betriebliche Altersversorgung:<br />
Welche Reform ist notwendig?
Position<br />
Bedingungsloses Grundeinkommen –<br />
sozialpolitisch keine Alternative<br />
Am 5. Juni hat die Schweiz in einer Volksabstimmung die<br />
Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens<br />
(BGE) mit großer Mehrheit abgelehnt. Aber immerhin 23 %<br />
stimmten dafür. Auch in Deutschland hat die Diskussion<br />
über das BGE einen neuen Schub bekommen. Insbesondere<br />
viele Langzeiterwerbslose, die unter dem Hartz-IV-<br />
Regime leiden, und unter prekären Einkommensverhältnissen<br />
lebende Solo-Selbstständige erhoffen sich davon<br />
eine Lösung ihrer Probleme. Doch sind diese Hoffnungen<br />
berechtigt?<br />
Zur Bekämpfung von Armut und Unterversorgung wären<br />
verbesserte bedarfsabhängige Leistungen naheliegender<br />
und geeigneter als ein pauschales BGE für alle. Verdeckte<br />
Armut könnte weitgehend abgebaut werden, wenn<br />
auf gefährdete Bevölkerungsgruppen aktiv zugegegangen<br />
würde. Das Niveau der bestehenden sozialpolitischen Leistungen<br />
zu verbessern und Repressionen zu beseitigen, ist<br />
sicherlich nicht leicht durchzusetzen, aber allemal realistischer<br />
als es die verschiedenen Versionen eines BGE sind.<br />
Unter dem Titel BGE werden nämlich sehr unterschiedliche<br />
Konzepte diskutiert. Eher links und sozial ausgerichtete<br />
Konzepte sollen ein akzeptables Lebensniveau<br />
ermöglichen – mit geforderten bis zu 1.500 Euro Grundeinkommen<br />
im Monat. Darüber hinausgehende Sozialleistungen<br />
sollen erhalten bleiben, auch erhöhte Mindestlöhne<br />
werden gerne zusätzlich gefordert.<br />
Neoliberal geprägte Varianten liegen dagegen nur auf<br />
oder unter Hartz-IV-Niveau, zugleich sollen weitere Sozialleistungen<br />
und Arbeitnehmerrechte abgebaut werden.<br />
Im Besonderen richten sich diese Modelle gegen die an<br />
der Lebensstandardsicherung ausgerichteten Sozialversicherungen.<br />
Die Absicherung von Risiken und Ansprüchen,<br />
die über das BGE hinausgehen, soll der privaten Versicherungswirtschaft<br />
überlassen werden.<br />
Diese neoliberalen Modelle eines BGE sind aber die<br />
einzigen, die eine reale Aussicht auf Umsetzung haben<br />
könnten. So will in Finnland die konservativ-rechte Regierung<br />
2017 ein Pilotprojekt starten. Das BGE soll zunächst<br />
erheblich unter dem Existenzminimum liegen, Sozialleistungen<br />
sollen entsprechend gegengerechnet, also gestrichen<br />
werden. Ziel soll sein, die Anreize zu erhöhen, dass<br />
Menschen Jobs in Teilzeit und auch mit schlechter Bezahlung<br />
annehmen.<br />
Die auch in manchen gewerkschaftlichen Kreisen als<br />
attraktiv angesehenen Konzepte eines BGE beruhen dagegen<br />
auf einer Logik des »Wünsch dir was«. Sie werfen nicht<br />
nur enorme ökonomische Schwierigkeiten und Widersprüche<br />
auf, es gibt auch keine machtvollen gesellschaftlichen<br />
Interessen und Kräfte dafür. Denn der großen Mehrheit der<br />
Beschäftigten müsste das Geld, das ihnen als BGE in die<br />
eine Tasche hereingesteckt wird, aus der anderen Tasche<br />
wieder herausgezogen werden, um dies finanzieren zu können.<br />
Erforderlich wären dazu massiv erhöhte Steuersätze<br />
und extrem verschärfte Kontrollen von Erwerbsarbeit und<br />
Einkommen, um unter diesen Bedingungen »schwarze«<br />
Geschäfte und Steuer- und Sozialbeitragshinterziehung<br />
zu bekämpfen. Die Vorstellung, statt auf Arbeit könnte die<br />
Finanzierung eines BGE darauf beruhen, dass die Maschinen<br />
oder Roboter die Steuern zahlen, ist irreführend. Denn<br />
Steuern werden immer aus Einkommen gezahlt, bei »Maschinensteuern«<br />
aus dem ihrer Eigentümer. Eine allgemeine<br />
Entkopplung von Arbeit und Einkommen ist nicht möglich.<br />
Die Wertschöpfung und damit auch die Finanzierung eines<br />
BGE beruht gesamtwirtschaftlich immer auf Erwerbsarbeit.<br />
Diese produziert die Güter und Dienstleistungen, die mit<br />
Geld gekauft werden, und damit zugleich die Werte, aus denen<br />
Arbeits- und Kapitaleinkommen entstehen, aus denen<br />
letztlich alles finanziert werden muss.<br />
Das BGE könnte daher auch nicht als Ausweg funktionieren,<br />
wenn uns aufgrund der Digitalisierung vermeintlich<br />
»die Arbeit ausgeht«. Dies wird auch nicht passieren. Die<br />
gesamtwirtschaftlichen Produktivitätssteigerungen sind<br />
in den letzten Jahrzehnten immer geringer geworden. Die<br />
Erwerbstätigkeit nimmt zu. Auch künftig wird es zwar in<br />
kapitalistischen Systemen Massenerwerbslosigkeit und<br />
Prekarisierung geben – aber als Folge von ökonomischen<br />
Krisenprozessen, neoliberaler (De-)Regulierung und ungünstigen<br />
Kräfteverhältnissen, nicht aber infolge von beschleunigten<br />
Produktivitätszuwächsen.<br />
Ein BGE birgt große Risiken, dass die Einkommensverteilung<br />
und die Kräfteverhältnisse noch mehr zugunsten<br />
des Kapitals verschoben würden. Jeder Verdienst hätte<br />
den Charakter eines Zuverdienstes zum BGE, dieses wäre<br />
faktisch der universelle Kombilohn als Lohnsubvention<br />
für das Kapital. Viele prekär Selbstständige bieten heute<br />
schon notgedrungen, weil sie sonst keine Aufträge bekommen,<br />
ihre Leistungen zu Dumpingbedingungen an. Der<br />
Spielraum dafür wäre mit einem BGE noch viel größer. Der<br />
zerstörerische Konkurrenzdruck auf Betriebe, die zu tariflichen<br />
Bedingungen beschäftigen, würde massiv verschärft.<br />
Profitansprüche von Unternehmen und Anlegern würden<br />
dagegen durch ein BGE nicht gemindert.<br />
Das zentrale Interesse der Beschäftigten wie der Erwerbslosen<br />
ist und bleibt eine gute und gut bezahlte Arbeit.<br />
Es geht um soziale Einbindung, Anerkennung und<br />
Selbstbestätigung und ein Einkommen, das höher als ein<br />
noch so komfortables BGE läge. Es besteht großer Bedarf<br />
an mehr öffentlichen Investitionen und mehr qualifizierter<br />
Erwerbsarbeit in Bereichen wie Bildung, Erziehung oder<br />
öffentlicher Daseinsvorsorge. Dies zu gestalten und zu<br />
finanzieren ist die zentrale politische Aufgabe. Die BGE-<br />
Forderung führt in die Irre.<br />
Ralf Krämer<br />
arbeitet beim ver.di-Bundesvorstand<br />
im Bereich Wirtschaftspolitik,<br />
ausführlicher zum Thema<br />
schrieb er am 23. Mai <strong>2016</strong> unter<br />
www.gegenblende.de<br />
212<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Sicherheit</strong> 6/<strong>2016</strong>
Magazin<br />
Jetzt endlich: Recht auf Girokonto für jeden<br />
Am 19. Juni endete eine über 10-jährige Auseinandersetzung: Seitdem hat jeder<br />
das Recht auf ein Girokonto – auch Menschen, die keinen festen Wohnsitz<br />
haben oder sich in einer finanziell schwierigen Situation befinden. Vielen von<br />
ihnen wurde bisher ein Konto verwehrt. Nach Schätzungen sind davon knapp<br />
eine Million Menschen in Deutschland betroffen.<br />
Wer kein Konto hat, bekommt schwieriger einen Job und hat große Probleme<br />
beim Zahlen laufender Beträge für Miete, Strom oder Telefon. Zwar hatte sich<br />
die Kreditwirtschaft schon 1995 in einer freiwilligen Selbstverpflichtung bereit erklärt,<br />
Guthabenkonten für jeden zu eröffnen. Das hat aber nicht flächendeckend<br />
geklappt – auch wenn etliche Sparkassen seit 2012 diese Selbstverpflichtung umgesetzt<br />
haben. Vorwärts brachte das »Jedermannkonto« erst die Zahlungskontenrichtlinie<br />
der EU vom 23. Juli 2014. Sie verpflichtete die EU-Mitgliedstaaten,<br />
solche Konten bis zum 18. September <strong>2016</strong> in nationales Recht umzusetzen. Das<br />
geschieht in Deutschland nun mit dem Zahlungskontengesetz (s. auch SozSich<br />
12/2015, S. 432), das am 19. Juni in Kraft trat.<br />
Alle Kreditinstitute, die Konten für Verbraucher anbieten, sind danach jetzt verpflichtet,<br />
jedem EU-Bürger ab 18 Jahren ein so genanntes Basiskonto anzubieten.<br />
Außerdem haben auch Asylsuchende und Personen mit einer Duldung, die nicht<br />
abgeschoben werden können, einen Anspruch darauf.<br />
Leistungen: Mit dem Basiskonto können Ein- und Auszahlungen, Lastschriften,<br />
Geldkartengeschäfte und Online-Überweisungen getätigt werden. Grundsätzlich<br />
handelt es sich um Guthabenkonten ohne Kreditrahmen, es ist aber auch möglich,<br />
einen Überziehungsrahmen zu vereinbaren. Die Bank ist dazu aber nicht<br />
verpflichtet.<br />
Gebühren: Diese können auch für das Basiskonto anfallen. Allerdings müssen<br />
sie »angemessen« sein. Die Aufsichtsbehörden sollen darauf achten, dass keine<br />
überhöhten Gebühren gefordert werden. Außerdem haben die Kontoinhaber<br />
das Recht, schnell und einfach zu einem anderen kostengünstigeren Institut zu<br />
wechseln<br />
Antrag: Beantragt werden kann das Basiskonto kostenlos in einer Bankfiliale oder<br />
im Internet. Ein Formular dazu gibt’s auch unter www.bafin.de. Die Bank muss den<br />
Eingang des Antrags bestätigen. Entscheidet sie darüber nicht innerhalb von zehn<br />
Arbeitstagen, können sich Betroffene bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen<br />
(BaFin) in Bonn beschweren. Diese hat dazu das »Beschwerdeformular –<br />
Basiskonto« ins Internet eingestellt.<br />
Dokumente: EU-Bürger/innen müssen bei der Kontoeröffnung ihren Pass oder<br />
Personalausweis vorlegen. Personen, die keinen Pass besitzen (z. B. weil dieser<br />
bei einer Flucht verloren wurde), benötigen laut BaFin ein amtliches Dokument mit<br />
Lichtbild, das den Briefkopf und das Siegel einer inländischen Ausländerbehörde<br />
trägt. Für Geflüchtete ist das die Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender<br />
(BüMA), der neue Auskunftsnachweis oder die Aufenthaltsgestattung und für<br />
Geduldete die Duldungsbescheinigung.<br />
Ablehnung: Ablehnen darf die Bank einen Antrag nur in wenigen Fällen, z. B.<br />
wenn Antragsteller bereits bei einem anderen Kreditinstitut ein funktionsfähiges<br />
Zahlungskonto besitzen oder sich der Bank gegenüber strafbar gemacht haben.<br />
Eine Ablehnung wegen einer schlechten Schufa-Auskunft oder fehlenden Sprachkenntnissen<br />
ist nicht erlaubt. Gegen ungerechtfertigt erscheinende Ablehnungen<br />
sind kostenlose Überprüfungsanträge bei der BaFin möglich.<br />
Kontokündigung und Pfändung: Das Basiskonto darf nur selten gekündigt werden,<br />
z. B. wenn die Gebühren nicht bezahlt wurden oder Geldwäsche betrieben<br />
wird. Es kann durch Gläubiger gepfändet werden. Zur Sicherung des Existenzminimums<br />
besteht aber die Möglichkeit, das Basiskonto gleich bei der Eröffnung<br />
als Pfändungsschutzkonto (s. dazu SoSiplus 11/2011, S. 8) zu versehen oder<br />
auch den Pfändungsschutz nachträglich einrichten zu lassen. Vor der Pfändung<br />
geschützt ist dann der pfändungsfreie Betrag nach den jeweiligen Pfändungsfreigrenzen<br />
(s. dazu SozSich 7/2015, S. 294). o<br />
Prognos zu Rentenniveau:<br />
2040 nur noch bei 41,7 %<br />
Das gesetzliche Rentenniveau droht<br />
auch nach 2030 erheblich weiter zu<br />
sinken. Das geht aus einer Kurzstudie<br />
des Prognos-Instituts für den<br />
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft<br />
(GDV) hervor. Das<br />
Rentenniveau vor Steuern bezieht sich<br />
auf einen Durchschnittsverdiener mit<br />
45 Beitragsjahren. Es beschreibt das<br />
Verhältnis seiner (späteren) gesetzlichen<br />
Nettorente zum Durchschnittseinkommen<br />
(ohne Berücksichtigung<br />
der anfallenden Steuern).<br />
Die Bundesregierung hat bisher nur<br />
Berechnungen bis zum Jahr 2029 veröffentlicht.<br />
Danach wird das jetzige<br />
Niveau von 47,7 % bis 2029 auf 44,6 %<br />
sinken. Bis 2040 könnte es nach den<br />
Berechnungen von Prognos weiter auf<br />
41,7 % fallen. Die Forscher nahmen für<br />
dieses (nicht unrealistische) Szenario<br />
an, dass das durchschnittliche tatsächliche<br />
Renteneintrittsalter im Takt<br />
mit der Anhebung der gesetzlichen<br />
Regelaltersgrenze weiter zunimmt<br />
und von heute 64,2 auf 65 Jahre ansteigt<br />
– also weiterhin um zwei Jahre<br />
unter der Altersgrenze von 67 liegt,<br />
die ab 2031 als Regelaltersgrenze für<br />
alle Neurentner gilt. Der prognostizierte<br />
Beitragssatz läge bei diesem<br />
Modell im Jahr 2040 bei 23,7 %.<br />
In einem weiteren Szenario nahmen<br />
die Prognos-Volkswirte an, dass die<br />
Älteren tatsächlich bis 67 am Arbeitsplatz<br />
bleiben. Dann läge das Rentenniveau<br />
im Jahr 2040 mit 42,1 %<br />
etwas höher und der Beitragssatz<br />
mit 23,4 % etwas niedriger. Schließlich<br />
berechneten die Forscher auch<br />
noch das Szenario »Lebensarbeitszeit<br />
plus«. Dabei wird die Regelaltersrente<br />
ab 2029 systematisch an die steigende<br />
Lebenserwartung gekoppelt<br />
– verschiebt die Renteneintritte mit<br />
steigender Lebenserwartung also ins<br />
höhere Alter. Das Netto-Rentenniveau<br />
2040 läge dann bei 42,5 %, der Beitragssatz<br />
bei 23,4 %.<br />
Die Auswirkungen eines höheren Rentenalters<br />
sind also nicht besonders<br />
groß. »Das Rentenalter anzuheben<br />
bringt praktisch nichts für die Rente«,<br />
so DGB-Vorstandsmitglied Annelie<br />
Buntenbach. »Trotz längerem Arbeiten<br />
bliebe das Rentenniveau auf Talfahrt«.<br />
o<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Sicherheit</strong> 6/<strong>2016</strong><br />
213
Magazin<br />
TERMINE<br />
Juli <strong>2016</strong><br />
4./5. 7.: Telemed <strong>2016</strong>, 21. Nationales Forum für Gesundheitstelematik und Telemedizin<br />
• Ort: Berlin, Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund • Veranst.:<br />
Berufsverband Medizinischer Informatiker (BVMI) e. V. • s 030/22 00 24-<br />
7 90 • info@telemed-berlin.de • www.telemed-berlin.de<br />
6. 7.: Tagung »Medikationsplan und Co.: Was bringt das eHealth-Gesetz?« •<br />
Ort: Berlin, Haus der Kassenärztlichen Bundesvereinigung • Veranst.: Kassenärztliche<br />
Bundesvereinigung • s 0 30 /40 05 22 40 • www.kbv.de<br />
7./8. 7.: Armutskongress <strong>2016</strong> • Ort: Berlin, Langenbeck-Virchow-Haus • Veranst.:<br />
Paritätischer Gesamtverband, DGB u. a. • www.armutskongress.de<br />
13./14. 7.: Konferenz »Mindestlohn, Niedriglohn und Beschäftigung – Chancen,<br />
Risiken und Handlungsansätze« • Ort: Nürnberg, Verwaltungszentrum der<br />
Bundesagentur für Arbeit • Veranst.: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung<br />
und Bundesagentur für Arbeit • iab.mindestlohn@iab.de • www.iab.de<br />
14. 7.: Selbstverwalter-Tagung zur gesetzlichen Krankenversicherung »Transparenz<br />
und Solidarität« • Ort: Kassel, Bundessozialgericht • Veranst.: ver.di<br />
Bundesverwaltung, Ressort 5 • s 0 30 /69 56-21 40 • Ressort05.BuV@verdi.de<br />
• www.sopo.verdi.de<br />
21./22. 7.: Tagung »Einkommensungleichheit und Armut in Deutschland: Messung,<br />
Befunde und Maßnahmen« • Ort: Bamberg, Aula der Universität • Veranst.:<br />
Bayerisches Landesamt für Statistik • s 09 11 /9 82 08-2 18 • statistiktage@statistik.bayern.de<br />
• www.iab.de<br />
21./22. 7.: 15. Graduiertenkolloquium des Forschungsnetzwerkes Alterssicherung<br />
• Ort: Berlin, Deutsche Rentenversicherung Bund • Veranst.: Forschungsnetzwerk<br />
Alterssicherung (FNA) der Deutschen Rentenversicherung Bund •<br />
s 0 30/86 58 93 69 • fna@drv-bund.de • www.fna-rv.de<br />
September <strong>2016</strong><br />
1./2. 9.: Demografiekongress <strong>2016</strong> • Ort: Berlin, Hotel InterContinental • Veranst.:<br />
Gesundheitsstadt Berlin GmbH • s 0 30/7 00 11 76-00 • office@gesundheitsstadt-berlin.de<br />
• www.der-demografiekongress.de<br />
5.–7. 9.: Deutscher Suchtkongress <strong>2016</strong> • Ort: Berlin, Technische Universität<br />
• Veranst.: Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e. V.<br />
und Deutsche Gesellschaft für Suchtpsychologie e. V. • s 0 23 81/41 79 98 •<br />
dg-sucht@t-online.de • www.deutschersuchtkongress.de<br />
8. 9.: Tagung der aba Fachvereinigung Pensionskassen • Ort: Mannheim, Dorint<br />
Hotel • Veranst.: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge e. V.<br />
(aba) • s 0 30/3 38 58 11-12 • tagungen@aba-online.de • www.aba-online.de<br />
14.– 17. 9.: 4. Weltkongress Betreuungsrecht »Keine Angst vor rechtlicher Betreuung«<br />
• Ort: Erkner bei Berlin, Bildungszentrum • Veranst.: Betreuungsgerichtstag<br />
e. V. in Zusammenarbeit mit International Guardianship Network (IGN)<br />
• s 02 34 /6 40 65 72 • bgt-ev@bgt-ev.de • www.bgt-ev.de<br />
19.– 21. 9.: Konferenz »Work, age, health and employment – evidence from<br />
longitudinal studies« • Ort: Wuppertal, Universität • Veranst.: International<br />
Commission on Occupational Health (ICOH), Uni Wuppertal und Institut für Arbeitsmarkt-<br />
und Berufsforschung • wahe<strong>2016</strong>@uni-wuppertal.de • www.iba.de<br />
22./23. 9.: Tarifpolitische Tagung <strong>2016</strong>: Tarifrunde <strong>2016</strong> – Mindestlohn – Stärkung<br />
der Tarifbindung • Ort: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut<br />
der Hans-Böckler-Stiftung • Ort: Düsseldorf, Hotel NH D.-City • s 02 11/77 78-<br />
6 33 • Rene-Siepen@boeckler.de • www.boeckler.de<br />
22./23. 9.: 13. Workshop zur Arbeitsmarktpolitik: »Lohn- und Einkommensungleichheit<br />
– Ausmaß und Entwicklung, Ursachen und Konsequenzen« • Ort:<br />
Halle a. d. Saale, IWH • Veranst.: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung<br />
und Bundesagentur f. Arbeit (IAB) und Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung<br />
Halle (IWH) • s 03 45/77 53-8 18 • birgit.schultz@iwh-halle.de • www.iab.de<br />
Sozialversicherungsbeiträge:<br />
Hohe Nachforderungen an Firmen<br />
Seit zweieinhalb Jahren nehmen die<br />
Prüfdienste der Deutschen Rentenversicherung<br />
(DRV) Bund Arbeitgeber<br />
unter die Lupe, die die (Dumping-)<br />
Tarifverträge der Tarifgemeinschaft<br />
Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit<br />
und Personalservice-Agenturen<br />
(CGZP) angewendet hatten. Wegen<br />
fehlender Tariffähigkeit der CGZP<br />
hatte das Bundesarbeitsgericht diese<br />
Tarifverträge für ungültig erklärt (s.<br />
auch SozSich 7/2013, S. 271 ff.). Die<br />
Folge: Die betroffenen Unternehmen<br />
müssen sich Betriebsprüfungen unterziehen<br />
und in vielen Fällen Sozialversicherungsbeiträge<br />
nachzahlen,<br />
weil sie zu geringe Löhne und damit<br />
auch zu wenig Sozialversicherungsbeiträge<br />
entrichtet hatten.<br />
Bis Ende 2015 waren über 1.500 dieser<br />
Prüfungen abgeschlossen. Dabei<br />
umfasst der Prüfzeitraum rückwirkend<br />
die Zeit ab 1. Januar 2010. In 565 Fällen<br />
wurden laut dem gerade veröffentlichten<br />
Geschäftsbericht 2015 von der<br />
DRV Bund im letzten Jahr erneut Gesamtsozialversicherungsbeiträge<br />
in<br />
Höhe von rund 25,1 Mio. Euro nachgefordert.<br />
Schon 2014 waren rund 13,5<br />
Mio. und 2013 mehr als 35,4 Mio. (s.<br />
SozSich 8–9/2014, S. 300) nachgefordert<br />
worden. Wie viel davon allerdings<br />
tatsächlich gezahlt wurden, geht aus<br />
dem Geschäftsbericht nicht hervor.<br />
Die Betriebsprüfer der DRV Bund haben<br />
2015 auch rund 206.000 Prüfungen<br />
bei Unternehmen durchgeführt,<br />
die Werke selbstständiger Künstler<br />
oder Publizisten verwerten. Dabei<br />
wurden in über 17.000 Fällen rund<br />
15,7 Mio. Euro an Abgaben zur Künstlersozialkasse<br />
(KSK) nacherhoben.<br />
Seit einer Gesetzesänderung von Anfang<br />
2015 muss die DRV den Einzug<br />
der KSK-Abgabe im Rahmen der mindestens<br />
alle vier Jahre stattfinden Arbeitgeberprüfung<br />
mitprüfen (s. Soz-<br />
Sich 1/2015, S. 23). Das habe »mehr<br />
Ehrlichkeit und Transparenz« bei der<br />
Zahlung bewirkt und zusammen mit<br />
den Nachforderungen aus den Betriebsprüfungen<br />
zu Mehreinnahmen<br />
von rund 30 Mio. Euro geführt, berichtete<br />
das Bundessozialministerium.<br />
Deshalb könne der Abgabesatz zur<br />
KSK ab 2017 von bisher 5,2 auf 4,8 %<br />
gesenkt werden. o<br />
216<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Sicherheit</strong> 6/<strong>2016</strong>
Alterssicherung<br />
Reform der betrieblichen Altersversorgung steht bevor<br />
Im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode<br />
vom Dezember 2013 haben die Regierungsparteien vereinbart,<br />
die betriebliche Altersversorgung (bAV) zu stärken<br />
und die Forderung festgeschrieben, dass die bAV auch für<br />
Beschäftigte in Klein- und Mittelbetrieben (KMU) selbstverständlich<br />
werden muss. Mögliche Hemmnisse dazu sollen<br />
abgebaut werden.<br />
Ende Januar 2015 stellte das Bundesministerium für<br />
Arbeit und <strong>Soziale</strong>s (BMAS) seine Überlegungen zu einem<br />
»Neuen Sozialpartnermodell Betriebsrente« vor. 1 Sie stießen<br />
weder bei den Sozialpartnern noch bei den weiteren<br />
Akteuren der bAV auf viel Sympathie. Sowohl das BMAS<br />
als auch das Bundesfinanzministerium (BMF) reagierten.<br />
Sie gaben zwei Gutachten in Auftrag, in denen aufgezeigt<br />
werden sollte, wie eine größere Verbreitung von Betriebsrenten<br />
erreicht werden kann. Mitte April wurden diese<br />
Gutachten veröffentlicht. Noch vor der Sommerpause wollen<br />
die beteiligten Ministerien nun ein »Eckkonzept« zur<br />
Reform der bAV erstellen und noch in diesem Jahr soll es<br />
einen Beschluss der Bundesregierung dazu geben. Das<br />
kündigte Yasmin Fahimi, Staatssekretärin im BMAS, am 2.<br />
Juni auf einer Tagung der IG Metall zur Reform der bAV in<br />
Berlin an.<br />
Die ersten beiden Artikel im Titelthema dieser Ausgabe<br />
beleuchten den derzeitigen Stand und zentrale Schwachstellen<br />
der bAV sowie die wichtigsten Reformvorschläge<br />
aus den vorliegenden Gutachten und Einschätzungen<br />
und Positionen von IG Metall und ver.di zur anstehenden<br />
Reform. Der dritte Beitrag setzt sich kritisch mit der bAV<br />
auseinander und fragt skeptisch: Warum soll die betriebliche<br />
Altersversorgung eigentlich gestärkt werden? Im<br />
letzten Artikel zum Titelthema geht es um ein wichtiges<br />
sozialrechtliches Problem: die Auseinandersetzung um die<br />
(doppelte) Beitragszahlung zur gesetzlichen Kranken- und<br />
Pflegeversicherung für Betriebsrentner.<br />
Hans Nakielski<br />
1 vgl. »Betriebsrente: Neues Modell geplant«, in: SozSich 3/2015, S. 89<br />
Reform der betrieblichen Altersversorgung:<br />
Einschätzungen und Positionen aus Sicht der IG Metall<br />
Von Kerstin Schminke<br />
Selten war die betriebliche Altersversorgung (bAV) so in der Diskussion wie in den letzten beiden Jahren. Auslöser<br />
war insbesondere der Vorschlag des Bundesministeriums für Arbeit und <strong>Soziale</strong>s (BMAS) für ein »Sozialpartnermodell<br />
Betriebsrente«, der Anfang 2015 veröffentlicht wurde. Was steckt dahinter? Wie steht es um die<br />
Verbreitung und Finanzierung der bAV? Welche Rahmenbedingungen müssen vor der anstehenden Reform geklärt<br />
werden und wie sollte die Weiterentwicklung der bAV aus Sicht der IG Metall aussehen? Diesen Fragen geht der<br />
folgende Beitrag nach.<br />
Aus Sicht der Bundesregierung ist die Stärkung der bAV<br />
wegen des sinkenden Leistungsniveaus in der ersten Säule<br />
der Alterssicherung – der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
(GRV) – und der zu geringen und selektiven Verbreitung<br />
der bAV notwendig. So wurde im Koalitionsvertrag der Auftrag<br />
für die Bundesregierung festgehalten, die Verbreitung<br />
in kleinen und mittleren Unternehmen sowie bei den Geringverdienern<br />
zu fördern und dadurch die bAV zu stärken.<br />
1. Verbreitung und Finanzierung der bAV heute<br />
Nach den Ergebnissen der letzten Umfrage zur Verbreitung<br />
der bAV, die TNS Infratest Sozialforschung 2013 im Auftrag<br />
des BMAS vorgenommen hat, haben 59,5 % aller sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten eine Anwartschaft<br />
auf eine bAV nach einem der fünf Durchführungswege<br />
(s. dazu Infokasten). 1 Dieser Verbreitungsgrad sagt aber<br />
noch nichts über die Qualität, die laufende Fortführung/<br />
Beitragsfreistellung oder die Finanzierung dieser Anwartschaften<br />
aus.<br />
Die fünf Durchführungswege der baV<br />
Der Arbeitgeber (AG) kann zwischen fünf Formen der<br />
bAV wählen. 2 Die Durchführung kann entweder unmittelbar<br />
über den Arbeitgeber oder mittelbar über einen<br />
externen Versorgungsträger erfolgen:<br />
Direktzusage: Dabei verpflichtet sich der AG, die Betriebsrente<br />
direkt aus dem Betriebsvermögen zu zahlen<br />
(unmittelbare Versorgungszusage). Hierfür muss<br />
er Pensionsrückstellungen bilden. Direktzusagen sind<br />
meist reine AG-Leistungen. Eine Entgeltumwandlung ist<br />
jedoch – wie in allen Durchführungswegen – grundsätzlich<br />
möglich. Direktzusagen beruhen auf einer Zweierbeziehung<br />
zwischen AG und Arbeitnehmer (AN).<br />
1 vgl. BMAS (Hrsg.): Forschungsbericht 449/1. Trägerbefragung zur betrieblichen<br />
Altersversorgung 2013 von TNS Sozialforschung, Endbericht, Januar<br />
2015, S. 12; s. dazu auch »Neue Zahlen zur betrieblichen Altersversorgung:<br />
Kein Grund zum Jubeln«, in: SozSich 1/2015, S. 5<br />
2 vgl. dazu auch Deutsche Rentenversicherung Bund: Betriebliche Altersversorgung,<br />
9. Auflage (5/2015), Berlin, S. 8 ff.<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Sicherheit</strong> 6/<strong>2016</strong><br />
217
Alterssicherung<br />
Bei den anderen – mittelbaren – Durchführungswegen<br />
handelt es sich um Dreierbeziehungen zwischen dem<br />
AG, AN und einem externen Versorgungsträger, der für<br />
den AG die bAV abwickelt. Zahlt dieser Versorgungsträger<br />
die von ihm zugesagte Leistung nicht, so hat der<br />
AN einen unmittelbaren Anspruch gegen den AG (so genannte<br />
Durchgriffs- oder Subsidiärhaftung 3 ).<br />
Direktversicherung: Sie ist eine Lebens- oder Rentenversicherung,<br />
die der AG als Versicherungsnehmer<br />
zugunsten des AN abschließt. Die Beiträge dazu kann<br />
der AG allein zahlen, sie können aber auch zwischen<br />
AG und AN aufgeteilt oder im Rahmen einer Entgeltumwandlung<br />
allein vom AN aufgebracht werden.<br />
Pensionskasse: Dies ist eine Versorgungseinrichtung,<br />
die von einem oder mehreren Unternehmen gebildet<br />
wird. Es handelt sich dabei um eine Versicherungsgesellschaft,<br />
die als externer Versicherungsträger<br />
ausschließlich bAV betreibt. Die Beiträge zahlen die AG,<br />
die AN haben jedoch die Möglichkeit, sich zu beteiligen.<br />
Pensionsfonds: Dies ist eine rechtlich selbstständige<br />
Versorgungseinrichtung, die dem AN einen Rechtsanspruch<br />
auf zugesagte Leistungen einräumt. Pensionsfonds<br />
sind freier in der Wahl ihrer Geldanlage als<br />
Direktversicherungen und Pensionskassen. Ein Fonds<br />
kann sein Vermögen zu 100 % in Aktien anlegen. Damit<br />
sind höhere Renditen möglich, aber auch größere Risiken,<br />
Verluste zu machen. Pensionsfonds sind erst seit<br />
2002 als fünfter Durchführungsweg zugelassen worden.<br />
AN können sich mit Beiträgen aus einer Entgeltumwandlung<br />
am Fonds beteiligen.<br />
Unterstützungskasse: Sie kann von einem oder<br />
mehreren Unternehmen gebildet werden und soll das<br />
von den beteiligten Unternehmen eingezahlte Kapital<br />
möglichst gewinnbringend anlegen. Die Kasse dient<br />
dem AG zur Finanzierung und Erfüllung seiner Versorgungszusage<br />
an den AN. Reichen die Mittel der Unterstützungskasse<br />
nicht zur Finanzierung der Betriebsrenten<br />
aus, muss der AG einspringen (Durchgriffsanspruch<br />
des AN). Der AN selbst hat keinen Anspruch gegenüber<br />
der Kasse, sondern nur gegenüber seinem AG. H. N.<br />
Dazu kommt noch, dass in den vorgenannten Verbreitungsgrad<br />
auch die Leistungen aus den Zusatzversorgungskassen<br />
des öffentlichen Dienstes einbezogen wurden. Von den<br />
rund 20 Mio. aktiv Versicherten mit baV-Anwartschaften im<br />
Jahr 2013 hatten immerhin 5,3 Mio. – und damit mehr als<br />
ein Viertel – Anwartschaften aus der Zusatzversorgung des<br />
öffentlichen Dienstes (ZÖD) 4 (s. Tabelle auf der folgenden<br />
Seite). So täuscht der ggf. zunächst recht hoch wirkende<br />
Wert eines Verbreitungsgrades von knapp 60 % über die<br />
Selektivität und die dadurch entstehende Notwendigkeit<br />
einer weiteren Verbreitung der bAV hinweg.<br />
Die bAV ist in Bezug auf ihre Verbreitung in diverser<br />
Hinsicht selektiv 5 :<br />
• Sie ist in größeren Betrieben stärker verbreitet als in<br />
kleinen und mittleren Unternehmen. 6<br />
• Frauen haben durchschnittlich eine geringere Betriebsrente<br />
als Männer.<br />
• Im Osten gibt es weniger Betriebsrentenanwartschaften<br />
als im Westen der Bundesrepublik.<br />
• Beschäftigte mit höherem Einkommen haben meist<br />
auch eine höhere Betriebsrente als Beschäftigte mit<br />
niedrigerem Einkommen (s. Abb. 1). 7<br />
Hinzu kommt eine Verschiebung in der Finanzierung der<br />
bAV: Die klassische arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente<br />
hat erheblich an Bedeutung verloren. Sie weicht immer<br />
öfter Systemen der Mischfinanzierung oder der reinen Entgeltumwandlung,<br />
die entweder zum Teil oder ganz durch<br />
die Arbeitnehmer/innen selbst finanziert werden (s. Abb. 2<br />
auf der folgenden Seite). 8<br />
3 s. dazu auch weiter unten Kapitel 2.<br />
4 vgl. ebenda, S. 10<br />
5 vgl. auch Florian Blank: Die betriebliche Altersversorgung. Ihre Verbreitung,<br />
ihre Finanzierung, ihre Leistungen und Reformbedarfe, in: SozSich<br />
6/2013, S. 205–213<br />
6 vgl. Judith Kerschbaumer: Reform der betrieblichen Altersversorgung: Einschätzungen<br />
und Positionen aus Sicht von ver.di, S. 226 in diesem Heft<br />
7 vgl. BMAS (Hrsg.): Forschungsbericht 430. Verbreitung der Altersvorsorge<br />
2011 von TNS Infratest Sozialforschung, Endbericht, Dezember 2012<br />
8 vgl. Florian Blank/Sabrina Wiecek: Die betriebliche Altersversorgung in<br />
Deutschland: Verbreitung, Durchführung und Finanzierung, Auswertung<br />
von Daten der WSI-Betriebsrätebefragung 2010, WSI-Diskussionspapier<br />
Nr. 181; Düsseldorf, September 2012, S. 16 f.; Florian Blank (2013), a. a. O.,<br />
S. 210<br />
Abbildung 1:<br />
Verbreitung der<br />
betrieblichen Altersversorgung<br />
(ohne ZÖD)<br />
Männer und Frauen nach<br />
Einkommenshöhe<br />
Bruttolohn/-gehalt<br />
(Euro/Monat)<br />
Quelle: TNS Infratest<br />
Sozialforschung;<br />
Endbericht BMAS 2012<br />
218<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Sicherheit</strong> 6/<strong>2016</strong>
Alterssicherung<br />
Tabelle: Entwicklung der Zahl der aktiven bAV-Anwartschaften nach Durchführungswegen von 2001 bis 2013*<br />
(Angaben in Mio.)<br />
Direktzusagen und<br />
Unterstützungskassen<br />
Dez. 2001 Dez. 2009 Dez. 2010 Dez. 2011 Dez. 2012 Dez. 2013<br />
3,86 4,50 4,59 4,60 4,62 4,63<br />
Direktversicherungen 4,21 4,34 4,44 4,72 4,81 4,92<br />
Pensionsfonds – 0,34 0,36 0,38 0,44 0,45<br />
Pensionskassen 1,39 4,51 4,56 4,63 4,79 4,79<br />
Privatwirtschaft insgesamt 9,46 13,69 13,95 14,33 14,64 14,79<br />
Zusatzversorgung<br />
im öffentlichen Dienst<br />
5,11 5,06 5,11 5,17 5,24 5,29<br />
Insgesamt 14,56 18,75 19,05 19,50 19,88 20,09<br />
* Ohne Mehrfachanwartschaften innerhalb der Durchführungswege, aber einschließlich Mehrfachzählungen aufgrund von<br />
Anwartschaften in mehreren Durchführungswegen.<br />
Quelle: BMAS (Hrsg.): Forschungsbericht 449/1. Trägerbefragung zur betrieblichen Altersversorgung 2013 von TNS Sozialforschung,<br />
Endbericht, November 2014, S. 10<br />
2. Das Sozialpartnermodell<br />
Aufgrund der hier dargestellten Gesamtsituation in der<br />
bAV hat auch das BMAS während der vorherigen schwarzgelben<br />
Bundesregierung in einer von ihm in Auftrag gegebenen<br />
Machbarkeitsstudie Ende 2012 9 die entscheidenden<br />
Hemmnisse für eine Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung<br />
zu analysieren versucht. Einige besonders zu<br />
erwähnende Hemmnisse waren<br />
• die Angst des Arbeitgebers vor hohem Verwaltungsund<br />
Informationsaufwand,<br />
• fehlendes Engagement des Arbeitgebers für eine bAV,<br />
• das Fehlen von bAV-Spezialisten/Personalressourcen<br />
im Unternehmen,<br />
• geringes Einkommen der Mitarbeiter,<br />
• fehlendes Engagement eines Betriebsrates<br />
• und schließlich eine zu hohe Komplexität des Themas<br />
»bAV«.<br />
Insbesondere von Arbeitgebern kleinerer und mittlerer<br />
Unternehmen wurde immer wieder die Angst vor der langfristigen<br />
Bindung an die bAV und vor allem die Subsidiärhaftung<br />
aus § 1 Abs. 1 Satz 3 des Betriebsrentengesetzes<br />
(BetrAVG) 10 als Hemmnis genannt. Dort heißt es »Der Arbeitgeber<br />
steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten<br />
Leistungen auch dann ein, wenn die Durchführung nicht<br />
unmittelbar über ihn erfolgt.«<br />
Mit der Bestandsaufnahme aus der Machbarkeitsstudie<br />
im Rücken will nun die derzeitige schwarz-rote Bundesregierung<br />
ihre Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag<br />
in Bezug auf die bAV umsetzen und die gesetzlichen Vor-<br />
9 BMAS (Hrsg.): Forschungsbericht 444; Machbarkeitsstudie für eine empirische<br />
Analyse von Hemmnissen für die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung<br />
in kleinen und mittleren Unternehmen (Machbarkeitsstudie<br />
bAV in KMU); Endbericht, Juni 2014<br />
10 BetrAVG: Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz)<br />
Abbildung 2:<br />
Finanzierung der<br />
betrieb lichen Altersversorgung<br />
nach<br />
Durchführungswegen<br />
in 2010<br />
(in %)<br />
Quelle: Blank/ Wiecek (2012);<br />
Die betriebliche Altersversorgung<br />
in Deutschland:<br />
Verbreitung, Durchführungswege<br />
und Finanzierung;<br />
Auswertung der Daten der<br />
WSI-Betriebsrätebefragung<br />
2010; WSI Diskussionspapier<br />
Nr. 181; S. 16 f. Abb. 11<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Sicherheit</strong> 6/<strong>2016</strong><br />
219
<strong>Soziale</strong>s im Fokus.<br />
Seiten 209– 252/ www.sozialesicherheit.de / 65. Jahrgang / ISSN 0490-1630 / D 6364<br />
<strong>Sicherheit</strong><br />
Zeitschrift für Arbeit und <strong>Soziale</strong>s<br />
Neuaulage!<br />
6<br />
<strong>2016</strong><br />
sozialesicherheit.de<br />
Betriebsrente und<br />
Krankenversicherung:<br />
Der Streit um doppelte<br />
Beiträge für Rentner<br />
Bedingungsloses<br />
Grundeinkommen:<br />
Eine sozialpolitische<br />
Alternative?<br />
Rehabilitation:<br />
Ohne Nachsorge<br />
keine erfolgreiche Reha<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Sicherheit</strong><br />
Zeitschrift für Arbeit und <strong>Soziale</strong>s<br />
Mit Rechtsprechungsdienst<br />
Mit Online-Ausgabe und -Archiv<br />
Mit Redaktions-Service Online<br />
Betriebliche Altersversorgung:<br />
Welche Reform ist notwendig?<br />
Plege und Altenhilfe:<br />
Was Skandinavien<br />
anders und besser<br />
macht<br />
Für Sie beigelegt:<br />
Machen Sie jetzt<br />
den Gratis-Test!<br />
§<br />
Ihr gutes Recht:<br />
§<br />
Nach § 41 Abs. 1 SGB IV muss der Versicherungsträger den Mitgliedern<br />
der Selbstverwaltung sowie den Versichertenältesten und den Vertrauenspersonen<br />
ihre baren Ausgaben erstatten. Bare Auslagen sind alle im Zusammenhang<br />
mit der Ausübung des Ehrenamtes anfallenden Kosten, so auch die Ausgaben<br />
für notwendige Fachliteratur wie z.B. »<strong>Soziale</strong> <strong>Sicherheit</strong>«.<br />
Ganz nah dran.<br />
Ihr Partner im Arbeits- und Sozialrecht.