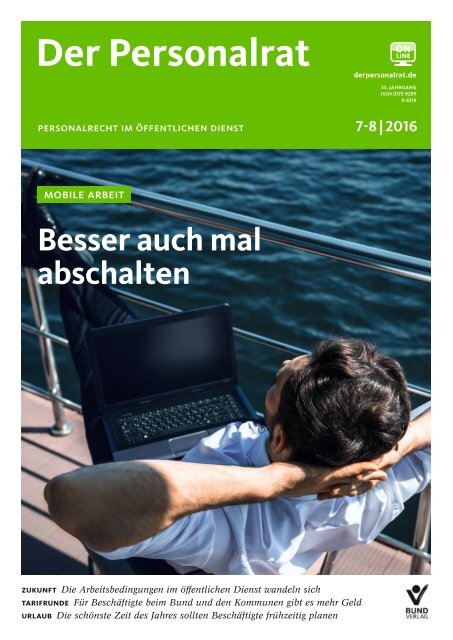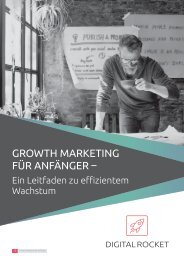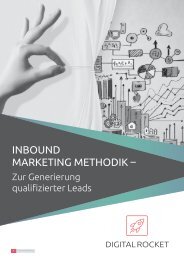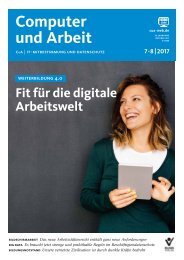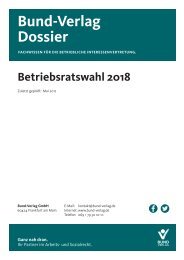Leseprobe Personalrat 7-8_2016
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der <strong>Personalrat</strong><br />
derpersonalrat.de<br />
33. JAHRGANG<br />
ISSN 0175-9299<br />
D 8319<br />
PERSONALRECHT IM ÖFFENTLICHEN DIENST<br />
7-8 | <strong>2016</strong><br />
MOBILE ARBEIT<br />
Besser auch mal<br />
abschalten<br />
zukunft Die Arbeitsbedingungen im öf entlichen Dienst wandeln sich<br />
tarifrunde Für Beschäftigte beim Bund und den Kommunen gibt es mehr Geld<br />
urlaub Die schönste Zeit des Jahres sollten Beschäftigte frühzeitig planen
titelthema<br />
mobile arbeit<br />
Der <strong>Personalrat</strong> 7-8 | <strong>2016</strong><br />
Besser »sometimes<br />
of« als »always on«<br />
erreichbarkeit Wer ständig für Arbeitsbelange erreichbar ist, kann sich<br />
nicht so gut erholen. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Studie.<br />
VON HILTRAUT PARIDON<br />
8
Der <strong>Personalrat</strong> 7-8 | <strong>2016</strong><br />
mobile arbeit<br />
titelthema<br />
Viel geschrieben wurde bereits über<br />
das Thema »Ständige Erreichbarkeit«.<br />
In bisherigen Untersuchungen<br />
stand dabei vor allem die<br />
Verbreitung des Phänomens »Erreichbarkeit«<br />
im Vordergrund. Über die Folgen der Erreichbarkeit<br />
gab es bisher nur wenige Erkenntnisse.<br />
Diese Forschungslücke wollte ein Projekt der<br />
Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) weiter<br />
schließen. Darüber hinaus sollten Möglichkeiten<br />
zum guten Umgang mit Erreichbarkeit<br />
entwickelt werden. Die Ergebnisse der Studie<br />
sind im iga.Report 23 Teil 2 1 veröfentlicht.<br />
Phänomen ständiger Erreichbarkeit<br />
Unter dem Schlagwort »Ständige Erreichbarkeit«<br />
wird seit einigen Jahren das Phänomen<br />
diskutiert, dass Beschäftigte auch außerhalb<br />
der regulären Arbeitszeiten für Arbeitsanforderungen<br />
verfügbar sind oder sein sollen.<br />
Das gibt es nicht nur in der Privatwirtschaft,<br />
sondern auch im öfentlichen Dienst. Diese<br />
arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit ist<br />
durch die Entwicklung und Verbreitung von<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
möglich geworden, so dass zu jeder Zeit<br />
an jedem Ort gearbeitet werden kann. Mit der<br />
Erreichbarkeit werden Chancen und Risiken<br />
verbunden: Auf der einen Seite eine bessere<br />
Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben und<br />
auf der anderen Seite mögliche negative Auswirkungen<br />
auf die Gesundheit.<br />
Hinsichtlich der Verbreitung der Erreichbarkeit<br />
zeigt sich, dass viele Beschäftigte –<br />
nämlich bis zu 90 Prozent – für Arbeitsbelange<br />
auch in ihrer Freizeit erreichbar sind. 2<br />
Allerdings ist hierbei nicht immer klar, ob die<br />
Erreichbarkeit tatsächlich vom Arbeitgeber erwartet<br />
wird. Das iga.Barometer von 2013 hat<br />
gezeigt, dass Arbeitgeber von knapp einem<br />
Viertel der Erwerbstätigen ausdrücklich erwarten,<br />
auch im Privatleben für dienstliche Angelegenheiten<br />
erreichbar zu sein.<br />
Die Initiative Gesundheit und Arbeit hat<br />
sich bereits 2013 mit dem Thema »Erreichbarkeit«<br />
beschäftigt und eine Interview-Studie mit<br />
16 Expertinnen und Experten durchgeführt. 3<br />
Aufbauend auf den Ergebnissen wurden nun<br />
in einem weiteren Projekt gemeinsam mit Prof.<br />
Renate Rau von der Martin-Luther-Universität<br />
darum geht es<br />
1. Ständige Erreichbarkeit<br />
kann das Privatund<br />
Familien leben<br />
beeinträchtigen und die<br />
Gesundheit schädigen.<br />
2. Betrofene berichten<br />
häuiger als andere von<br />
Schlafstörungen und dass<br />
sie nicht so gut abschalten<br />
könnten.<br />
3. Um das zu vermeiden,<br />
sind betriebliche<br />
Regelungen notwendig.<br />
Zugleich müssen auch<br />
die Beschäftigten einen<br />
guten Umgang mit der<br />
Erreichbarkeit lernen.<br />
1 Teil 2: Eine wissenschaftliche Untersuchung zu potenziellen<br />
Folgen für Erholung und Gesundheit und Gestaltungsvorschläge<br />
für Unternehmen. Der Report kann unter www.iga-info.de<br />
heruntergeladen werden.<br />
2 Vgl. BITKOM, Netzgesellschaft. Eine repräsentative Untersuchung<br />
zur Mediennutzung und dem Informationsverhalten der<br />
Gesellschaft in Deutschland, 2011; DGUV (Hrsg.), IAG Report<br />
1/2012, Ständige Erreichbarkeit: Wie belastet sind wir?<br />
3 Auswirkungen von ständiger Erreichbarkeit und Präventionsmöglichkeiten.<br />
Teil 1: Überblick über den Stand der Wissenschaft<br />
und Empfehlungen für einen guten Umgang in der Praxis. Autor:<br />
Hannes Strobel. iga.Report 23, 2013. Download: www.iga.info.de.<br />
9
titelthema<br />
mobile arbeit<br />
Der <strong>Personalrat</strong> 7-8 | <strong>2016</strong><br />
Ständige Erreichbarkeit<br />
und Unfallversicherung<br />
arbeitsunfall Auch in der Freizeit dienstliche Angelegenheiten<br />
erledigen, das kommt inzwischen häuig vor. Erleiden Beschäftigte<br />
dabei einen Unfall, kann das ein Arbeitsunfall sein. Dabei können<br />
sich aber knilige Fragen ergeben.<br />
VON ROBERT NAZAREK<br />
darum geht es<br />
1. Wenn Beschäftigte<br />
während ihrer Freizeit<br />
dienstliche Aufgaben<br />
erledigen, zum Beispiel<br />
durch Telefonieren,<br />
und dabei einen Unfall<br />
erleiden, ist die Frage zu<br />
beantworten, ob das ein<br />
Arbeitsunfall ist.<br />
2. Werden Beschäftigte<br />
dabei verletzt, muss<br />
entschieden werden, ob<br />
der gesetzliche Unfallversicherungsträger<br />
eintritt.<br />
3. Ob das der Fall ist,<br />
muss im Einzelfall genau<br />
geprüft werden.<br />
Sind Beschäftigte außerhalb der üblichen<br />
Arbeitszeit und damit auch<br />
außerhalb der Dienststelle für ihren<br />
Arbeitsgeber erreichbar, wirft das<br />
Fragen zum gesetzlichen Unfallversicherungsschutz<br />
auf. Sind sie beispielsweise versichert,<br />
wenn sie in ihrer Freizeit dienstliche Aufgaben<br />
erledigen und dabei einen Unfall erleiden?<br />
Der für die Unfallversicherung zuständige 2.<br />
Senat des BSG musste sich bisher nur einmal<br />
mit dieser Problematik befassen. 1 Es ging um<br />
die Frage, ob ein Arbeitsunfall als solcher anerkannt<br />
werden musste. Lösungen konnten vom<br />
BSG nur soweit gefunden werden, wie es der<br />
dem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt<br />
zuließ. Die Verletzte erlitt während eines Telefonats<br />
aufgrund einer arbeitsvertraglich vereinbarten<br />
Rufbereitschaft einen Unfall und machte<br />
geltend, dass es sich um einen gesetzlich versicherten<br />
Arbeitsunfall handelte. Im Ergebnis<br />
sind die sich in der Praxis ergebenden Probleme<br />
auch nach der Entscheidung des BSG nicht weniger<br />
geworden und es werden sich im Einzelfall<br />
möglicherweise Schwierigkeiten ergeben,<br />
ein Unfallereignis der gesetzlichen Unfallversicherung<br />
(SGB VII) zuordnen zu können.<br />
Schwierige Prüfung<br />
Die Schwierigkeiten ergeben sich aus der in drei<br />
Schritten erforderlichen Prüfung, um ein Unfallereignis<br />
als Arbeitsunfall feststellen zu können.<br />
Das BSG führt dazu aus, ein Arbeitsunfall setze<br />
voraus, dass die oder der Verletzte durch eine<br />
Verrichtung vor dem fraglichen Unfallereignis<br />
den gesetzlichen Tatbestand einer versicherten<br />
Tätigkeit erfüllt habe und deshalb »Versicherte«<br />
oder »Versicherter« im Sinne der gesetzlichen<br />
Unfallversicherung sei (Voraussetzung 1), dass<br />
diese versicherte Verrichtung zu einem zeitlich<br />
begrenzten, von außen auf den Körper einwirkenden<br />
Ereignis geführt habe (Voraussetzung<br />
2) und dieses Unfallereignis einen Gesundheitserstschaden<br />
oder den Tod des Versicherten verursacht<br />
habe (Voraussetzung 3).<br />
Versicherteneigenschaft als<br />
1. Voraussetzung<br />
Versicherte oder Versicherter im Sinne der gesetzlichen<br />
Unfallversicherung 2 sind Beschäftigte<br />
nur, wenn, solange und soweit sie den Tatbestand<br />
einer versicherten Tätigkeit durch eigene<br />
Verrichtungen erfüllen. Das dieser Verrichtung<br />
zugrundeliegende konkrete Handeln der oder<br />
des Verletzten muss ursächlich in einem Zusammenhang<br />
mit der versicherten Tätigkeit<br />
stehen (subjektive Komponente) und seiner<br />
Art nach von Dritten beobachtbar sein (objektive<br />
Komponente). 3<br />
Steht die oder der Verletzte in einem Arbeitsverhältnis<br />
und verrichtet eine Tätigkeit,<br />
die eine sich aus diesem Vertragsverhältnis<br />
ergebende Plicht erfüllt – und sei diese nur<br />
1 BSG 26.6.2014 – B 2 U 4/13 R –, juris (Rn. 22). 2 § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII.<br />
3 BSG 26.6.2014, a.a.O. (Rn. 14).<br />
28
Der <strong>Personalrat</strong> 7-8 | <strong>2016</strong><br />
mobile arbeit<br />
titelthema<br />
subjektiv angenommen –, sind die Voraussetzungen<br />
einer versicherten Beschäftigung im<br />
Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung<br />
gegeben. 4 Die möglichen Schwierigkeiten<br />
werden sich dabei zumeist weniger aus der<br />
Zuordnung der Tätigkeit zu einem (sozialversicherten)<br />
Beschäftigungsverhältnis ergeben, als<br />
daraus, ob die für den Unfall als ursächlich benannte<br />
Verrichtung tatsächlich arbeitsvertraglich<br />
geschuldet war. Das BSG hat es in seiner<br />
Entscheidung ofen gelassen, wie eng hier die<br />
Grenzlinien gezogen werden. Vor allem hat es<br />
nicht eindeutig geklärt, wie hoch die Anforderungen<br />
an die Beweislast für das Vorliegen<br />
einer solchen Plicht sind, die im Grundsatz<br />
immer von der oder dem Verletzten zu erfüllen<br />
ist. Im zu entscheidenden Verfahren bedurfte<br />
es derartiger Überlegungen auch nicht. Die<br />
Verplichtung der Verletzten, während ihrer<br />
Rufbereitschaft auf dem Rufbereitschaftshandy<br />
eingehende Anrufe anzunehmen, war unzweifelhaft<br />
vom LSG festgestellt worden. Mit<br />
der Entgegennahme des Anrufs ist sie damit<br />
der sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden<br />
Plicht nachgekommen 5 . Die Erfüllung des<br />
Versicherungstatbestandes der Beschäftigung<br />
lag damit subjektiv vor 6 , und diese unwidersprochene<br />
Feststellung des LSG war vom BSG<br />
seiner Entscheidung zugrunde zu legen.<br />
Das notwendige objektive Kriterium, dass<br />
ein von außen beobachtbares Handeln an einem<br />
bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit<br />
vorliegen muss, wird in der Praxis kaum Probleme<br />
bereiten, da dem Unfall notwendig ein<br />
solches vorausgehen muss. Schwierigkeiten<br />
ergeben sich, wenn – wie im vom BSG entschiedenen<br />
Verfahren – zum Unfallzeitpunkt<br />
zwei Handlungen vorliegen, die jede für sich<br />
in unterschiedlichem Zusammenhang zur<br />
versicherten Tätigkeit und Feststellung eines<br />
Arbeitsunfalles zu bewerten sind (gemischte<br />
Tätigkeit). In diesem Verfahren hat die Verletzte<br />
einerseits telefoniert und andererseits ihren<br />
Spaziergang mit dem Hund fortgesetzt. Nach<br />
den Ausführungen des BSG hatte die Verletze<br />
spätestens mit der Entgegennahme des Anrufs<br />
die tatbestandlichen Voraussetzungen einer<br />
Beschäftigung im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung<br />
erfüllt. 7<br />
Soweit sich das BSG mit Abgrenzungsfragen<br />
zur gemischten Motivationslage (eine einzige<br />
Verrichtung mit unterschiedlichen Handlungstendenzen)<br />
auseinandersetzt 8 , hat dies<br />
für die Frage, ob ein Unfall während der ständigen<br />
Erreichbarkeit die Voraussetzungen der<br />
gesetzlichen Unfallversicherung bildet, keine<br />
Bedeutung und diente lediglich der Klarstellung.<br />
Während der Zeiten der ständigen Erreichbarkeit<br />
kommen praktisch nur Konstellationen<br />
einer gemischten Tätigkeit in Betracht.<br />
Die gemischte Tätigkeit ist gerade dadurch gekennzeichnet,<br />
dass mindestens eine von mehreren<br />
gerade ausgeübten Verrichtungen den<br />
Tatbestand einer versicherten Tätigkeit erfüllt.<br />
arbeitsunfall<br />
Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB<br />
VII sind Arbeitsunfälle<br />
Unfälle von Versicherten<br />
infolge einer den Versicherungsschutz<br />
nach<br />
§§ 2, 3 oder 6 SGB VII<br />
begründenden Tätigkeit<br />
(versicherte Tätigkeit).<br />
Unfälle sind nach § 8<br />
Abs. 1 Satz 2 SGB VII<br />
zeitlich begrenzte, von<br />
außen auf den Körper einwirkende<br />
Ereignisse, die<br />
zu einem Gesundheitsschaden<br />
oder zum Tod<br />
führen. Ein Arbeitsunfall<br />
setzt voraus, dass der<br />
Verletzte durch eine<br />
Verrichtung vor dem<br />
fraglichen Unfall ereignis<br />
den gesetzlichen Tatbestand<br />
einer versicherten<br />
Tätigkeit erfüllt hat und<br />
deshalb »Versicherter«<br />
ist. Die Verrichtung muss<br />
ein zeitlich begrenztes,<br />
von außen auf den Körper<br />
einwirkendes Ereignis<br />
sein und einen Gesundheitserstschaden<br />
oder<br />
den Tod des Versicherten<br />
objektiv und rechtlich<br />
wesent lich verursacht<br />
haben (Unfallkausalität<br />
und haftungsbegründende<br />
Kausalität).<br />
Erledigen Beschäftigte<br />
während ihrer Freizeit<br />
dienstliche Aufgaben und<br />
verunfallen dabei, kann<br />
das ein Arbeitsunfall sein.<br />
4 § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII; BSG 26.6.2014, a.a.O. (Rn. 16).<br />
5 BSG 26.6.2014, a.a.O. (Rn. 17).<br />
6 BSG 26.6.2014, a.a.O. (Rn. 18).<br />
7 § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII; BSG 26.6.2014, a.a.O. (Rn. 15).<br />
8 BSG 26.6.2014, a.a.O. (Rn. 19 ff.).<br />
29
personalratsarbeit LPVG-Entwicklung im Jahr 2015<br />
Der <strong>Personalrat</strong> 7-8 | <strong>2016</strong><br />
LPVG-Entwicklung<br />
im Jahr 2015<br />
gesetzgebung Niedersachsen und Sachsen haben ihre Personalvertretungsgesetze<br />
umfassend novelliert. In anderen Ländern sind<br />
die Änderungen hingegen zurückhaltender ausgefallen.<br />
VON LOTHAR ALTVATER<br />
darum geht es<br />
1. Auch im letzten Jahr<br />
gab es zahlreiche Änderungen<br />
des jeweiligen<br />
Personalvertretungsrechts.<br />
2. Sie inden sich in<br />
Gesetzen zur Änderung<br />
der Landespersonalvertretungsgesetze<br />
und<br />
in anderen Regelwerken<br />
einschließlich Staatsverträgen.<br />
3. Die Personalräte<br />
sollten die Neuerungen<br />
kennen und in ihrer Arbeit<br />
berücksichtigen.<br />
Der folgende Bericht dokumentiert<br />
die im Jahr 2015 erlassenen<br />
Rechtsvorschriften des Landespersonalvertretungsrechts.<br />
Er<br />
informiert über die Entwicklung in jenen 12<br />
Ländern, in denen im Landespersonalvertretungsgesetz<br />
oder an anderer Stelle personalvertretungsrechtlich<br />
bedeutsame Neuregelungen<br />
oder Änderungen erfolgt sind. Zweiseitige<br />
Staatsverträge mit personalvertretungsrechtlich<br />
relevanten Vereinbarungen sind in die<br />
Abschnitte zu Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz<br />
eingearbeitet. Der Bericht setzt die<br />
in dieser Zeitschrift bereits erschienenen Berichte<br />
zur Entwicklung der landespersonalvertretungsrechtlichen<br />
Vorschriften in den Jahren<br />
2003 bis 2014 fort. 1<br />
Baden-Württemberg<br />
} Neubekanntmachungen<br />
Nach den umfassenden Änderungen des<br />
Landespersonalvertretungsrechts durch das<br />
Änderungsgesetz v. 3.12.2013 2 und die Änderungsverordnung<br />
v. 28.1.2014 3 hat das Innenministerium<br />
jeweils unter dem 12.3.2015<br />
amtliche Neubekanntmachungen des Landespersonalvertretungsgesetzes<br />
(LPVG) und<br />
der Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz<br />
(LPVGWO) 4 vorgenommen. 5<br />
} Schulgesetz und LPVG<br />
Das Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes<br />
und anderer Vorschriften v. 21.7.2015 6 dient<br />
der weiteren schrittweisen Verwirklichung der<br />
Ziele der Behindertenrechtskonvention der<br />
Vereinten Nationen v. 13.12.2006 7 . Danach<br />
soll Inklusion integraler Bestandteil des Bildungssystems<br />
sein. 8 Die bisherigen Sonderschulen<br />
sollen zu sonderpädagogischen Bildungs-<br />
und Beratungszentren weiterentwickelt<br />
werden. Dies kommt im Schulgesetz in einer<br />
entsprechenden neuen Schulartbezeichnung<br />
zum Ausdruck. Die schulspeziischen Regelungen<br />
im LPVG sind ggf. durch Art. 4 des Änderungsgesetzes<br />
redaktionell angepasst worden<br />
(Änderungen von § 75 Abs. 6 Nr. 1 Buchst. b<br />
und § 98 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 LPVG).<br />
} Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz<br />
sowie LPVG<br />
Abweichend vom BPersVG, aber im Einklang<br />
mit den meisten Landespersonalvertretungsgesetzen<br />
9 sind nicht nur Richter, sondern auch<br />
Staatsanwälte grundsätzlich keine Beschäftigten<br />
i.S. d. LPVG BW. 10 Ihre Interessenvertretung<br />
ist im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz<br />
(LRiStAG) i.d.F. v. 22.5.2000 11 geregelt.<br />
Dieses Gesetz, das zuletzt durch Art. 2 des<br />
Gesetzes v. 3.12.2013 12 geändert worden war,<br />
34<br />
1 Vgl. die Beiträge des Verfassers in: PersR, Beilage 1/2006 (zu<br />
Heft 7/2006), 1 ff. (nachfolgend: Bericht 2003 – 2005); PersR<br />
2007, 279 ff. (nachfolgend: Bericht 2006); PersR 2008, 290 ff.<br />
(nachfolgend: Bericht 2007); PersR 2009, 297 ff. (nachfolgend:<br />
Bericht 2008); PersR 2010, 287 ff. (nachfolgend: Bericht 2009);<br />
PersR 2011, 309 ff. (nachfolgend: Bericht 2010); PersR 2012, 301<br />
ff. (nachfolgend: Bericht 2011); PersR 2013, 303 ff. (nachfolgend:<br />
Bericht 2012); PersR 7-8/2014, 23 ff. (nachfolgend: Bericht 2013);<br />
PersR 7-8/2015, 33 ff. (nachfolgend: Bericht 2014).<br />
2 GBl. S. 329, ber. 2014 S. 76. Vgl. Bericht 2013 (Fn. 1), 23, 25 ff.<br />
3 GBl. S. 67. Vgl. Bericht 2014 (Fn. 1), 33.<br />
4 GBl. S. 221 bzw. 260.<br />
5 Näher dazu bereits Bericht 2014 (Fn. 1), 33.<br />
6 GBl. S. 645, ber. 839. Nach Art. 6 am 1.8.2015 in Kraft getreten.<br />
7 Zustimmung zum Übereinkommen und Fakultativprotokoll<br />
durch Gesetz v. 21.12.2008 (BGBl. II S. 1419, 1420, 1453). In Kraft<br />
getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 26.3.2009 (Bek.<br />
v. 5.6.2009; BGBl. II S. 812).<br />
8 Vgl. hierzu und zum Folgenden LT-Drs. 15/6963, S. 25 ff., 27, 34 (zu<br />
Art. 1 Nr. 2) und 44 (zu Art. 4).<br />
9 Vergleichende Anmerkungen zu den landesrechtlichen Regelungen<br />
bei Altvater in: Altvater/Baden/Berg/Kröll/Noll/Seulen,<br />
BPersVG, 9. Aufl., § 95 Rn. 10 f.<br />
10 Vgl. hierzu und zu den Ausnahmen § 4 Abs. 2 Nr. 2 LPVG.<br />
11 GBl. S. 504.<br />
12 GBl. S. 329, 359. Redaktionelle Änderungen aufgrund der Novellierung<br />
des LPVG durch Art. 1 des ÄndG; vgl. LT-Drs. 15/4224,<br />
S. 167 (zu Art. 2) .
Der <strong>Personalrat</strong> 7-8 | <strong>2016</strong><br />
LPVG-Entwicklung im Jahr 2015<br />
personalratsarbeit<br />
ist durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des<br />
LRiStAG v. 6.10.2015 13 erneut geändert worden.<br />
14 Dabei handelt es sich um eine grundlegende<br />
Novellierung der bisherigen Regelungen<br />
zu den Richter- und Staatsanwaltsräten, mit<br />
denen ein den Besonderheiten der baden-württembergischen<br />
Justiz Rechnung tragendes, eizientes<br />
System der Beteiligung an allgemeinen<br />
und sozialen Angelegenheiten geschafen werden<br />
soll. 15 Das Änderungsgesetz sieht in Art. 1<br />
dazu unter anderem vor: 16<br />
· Neufassung der Bestimmungen zu den örtlichen<br />
Richter- und Staatsanwaltsräten;<br />
· Bildung von Stufenvertretungen auf der<br />
Ebene der Obergerichte und der Generalstaatsanwaltschaften;<br />
· Einrichtung von Einigungsstellen auf Bezirksebene;<br />
· Errichtung eines Landesrichter- und -staatsanwaltsrats<br />
auf der Ebene des Justizministeriums.<br />
Art. 2 des Änderungsgesetzes v. 6.10.2015<br />
normiert anpassende Änderungen des LPVG,<br />
Art. 3 enthält Übergangsbestimmungen.<br />
Für das Personalvertretungsrecht im engeren<br />
Sinne sind die Regelungen über »gemeinsame<br />
Angelegenheiten« der Richterräte und<br />
Personalräte von besonderem Interesse. 17 Die<br />
bisherigen Bestimmungen in § 20 Nr. 2 und<br />
den §§ 28 und 30 LRiStAG a.F. sind (inhaltlich<br />
im Wesentlichen unverändert) in § 30<br />
LRiStAG n.F. zusammengeführt worden. 18 § 30<br />
Abs. 4 LRiStAG n.F. sieht vor, dass die allgemeinen<br />
Regeln über die gemeinsamen Angelegenheiten<br />
der örtlichen Richterräte und<br />
der örtlichen Personalräte für die gemeinsamen<br />
Aufgaben der neuen Bezirksrichterräte<br />
und der Bezirkspersonalräte sowie des neuen<br />
Landesrichter- und -staatsanwaltsrats und des<br />
Hauptpersonalrats beim Justizministerium<br />
entsprechend gelten. 19 Außerdem inden die<br />
Vorschriften des § 30 LRiStAG n.F. auf den<br />
Gesamtrichterrat entsprechende Anwendung<br />
(§ 31 Abs. 4 Satz 1, 5 LRiStAG n.F.). Sie gelten<br />
auch für die Staatsanwaltsräte und die neuen<br />
Bezirksstaatsanwaltsräte entsprechend (§ 88<br />
Abs. 1 Satz 2 LRiStAG n.F.).<br />
Das LPVG ist durch Art. 2 des Änderungsgesetzes<br />
v. 6.10.2015 an die genannten<br />
Änderungen des LRiStAG angepasst worden.<br />
§ 31 LPVG, der ergänzende Bestimmungen<br />
für »gemeinsame Aufgaben von <strong>Personalrat</strong>,<br />
Richterrat und Staatsanwaltsrat« enthält, ist<br />
redaktionell dadurch geändert worden, dass in<br />
Abs. 1 nicht mehr auf § 28, sondern auf § 30<br />
LRiStAG Bezug genommen wird. Außerdem<br />
wird dieser Paragraf in den Vorschriften über<br />
den Gesamtpersonalrat und die Stufenvertretungen<br />
(durch Verweisungen in § 54 Abs. 4<br />
Satz 1 und § 55 Abs. 3 Satz 1 LPVG) für entsprechend<br />
anwendbar erklärt. 20<br />
} Übergangsregelungen außerhalb<br />
des LPVG<br />
Das Gesetz zur Errichtung der Landesoberbehörde<br />
IT Baden-Württemberg und Änderung<br />
anderer Vorschriften v. 12.5.2015 21 enthält<br />
in Art. 1 das »Gesetz zur Errichtung der<br />
Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg<br />
(Errichtungsgesetz BITBW – BITBWG)«. Es<br />
trift in Art. 2 Übergangsregelungen zum Errichtungsgesetz<br />
und sieht in Art. 3 bis 8 anpassende<br />
Änderungen anderer, von der Errichtung<br />
berührter Gesetze und Verordnungen vor.<br />
Nach Art. 9 ist das Gesetz im Wesentlichen am<br />
1.7.2015 in Kraft getreten.<br />
Wesentlicher Inhalt des BITBWG ist die<br />
Errichtung der neuen Landesoberbehörde mit<br />
der Kurzbezeichnung BITBW. Die Behörde<br />
gehört zum Geschäftsbereich des Innenministeriums,<br />
hat ihren Sitz in Stuttgart und wird<br />
als »Landesbetrieb gemäß §§ 26 und 74 der<br />
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg«<br />
geführt 22 (§ 1 Abs. 1 und 2 BITBWG).<br />
Die BITBW hat sämtliche nicht fachspeziische<br />
Aufgaben der informationstechnischen<br />
Grundversorgung ressortübergreifend für die<br />
gesamte Landesverwaltung zu erfüllen (§ 2<br />
Abs. 1 BITBWG). 23 Gleichzeitig mit der Errichtung<br />
der BITBW ist die Aulösung des bisherigen<br />
»Informatikzentrums Landesverwaltung<br />
Baden-Württemberg« und die Übertragung<br />
seiner Aufgaben und Dienstleistungen auf die<br />
BITBW erfolgt (§ 1 Abs. 4 BITBWG). Spätestens<br />
ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes<br />
gehen Aufgaben weiterer Dienststellen und<br />
Einrichtungen auf die BITBW über (§ 2 Abs. 2,<br />
§ 7 Abs. 1 BITBWG).<br />
Die Übergangsregelungen zum Errichtungsgesetz<br />
BITBW sehen die Bildung eines<br />
Übergangspersonalrats und einer Über-<br />
13 GBl. S. 842. Nach Art. 4 am 15.10.2015 in Kraft getreten.<br />
14 Nachfolgende Änderungen des LRiStAG durch Art. 7 des Gesetzes<br />
v. 1.12.2015 (GBl. S. 1030, 1031) und durch Art. 5 des Gesetzes<br />
v. 1.12.2015 (GBl. S. 1035, 1038).<br />
15 LT-Drs. 15/7135, S. 1 (zu A) und 26 (zu A 1).<br />
16 Vgl. LT-Drs. 15/7135, S. 2 (zu B) und 26 ff. (zu A 2 a).<br />
17 Ansonsten werden die (überwiegend neugefassten) Vorschriften<br />
über Organisation und Aufgaben der Richter- und Staatsanwaltsvertretungen<br />
aus Platzgründen hier nicht behandelt.<br />
18 Vergleichbar mit § 30 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 LRiStAG ist die<br />
bundesrechtliche Regelung in § 53 DRiG. Näher dazu Altvater in:<br />
Altvater/Baden/Berg/Kröll/Noll/Seulen, a.a.O., Anh. II Rn. 10 ff.<br />
19 Vgl. LT-Drs. 15/7135, S. 59 (zu § 30 Abs. 4).<br />
20 Vgl. LT-Drs. 15/7135, S. 61 f. (zu Art. 2).<br />
21 GBl. S. 326.<br />
22 Die damit zugelassene kaufmännische Wirtschaftsführung soll<br />
die Grundlage für wirtschaftlich optimiertes Handeln bieten<br />
(LT-Drs. 15/6654, S. 19 [zu Art. 1 § 1 Abs. 1 und 2]).<br />
23 Näher dazu LT-Drs. 15/6654, S. 20 ff. (zu § 2 Abs. 1).<br />
35
Die Nr. 1 für Personalräte.<br />
Der <strong>Personalrat</strong><br />
PERSONALRECHT IM ÖFFENTLICHEN DIENST<br />
MOBILE ARBEIT<br />
Besser auch mal<br />
abschalten<br />
derpersonalrat.de<br />
33. JAHRGANG<br />
ISSN 0175-9299<br />
D 8319<br />
7-8 | <strong>2016</strong><br />
Der <strong>Personalrat</strong><br />
PERSONALRECHT IM<br />
ÖFFENTLICHEN DIENST<br />
Mit Online-Archiv<br />
Neuaulage!<br />
Mit Redaktions-Service Online<br />
Mit E-Newsletter<br />
zukunft Die Arbeitsbedingungen im öf entlichen Dienst wandeln sich<br />
tarifrunde Für Beschäftigte beim Bund und den Kommunen gibt es mehr Geld<br />
urlaub Die schönste Zeit des Jahres sollten Beschäftigte frühzeitig planen<br />
Machen Sie jetzt<br />
den Gratis-Test!<br />
§<br />
Ihr gutes Recht:<br />
§<br />
Der Bezug der Zeitschrift »Der <strong>Personalrat</strong>« gehört zum Bedarf<br />
der laufenden Geschäftsführung nach § 44 Abs. 2 BPersVG<br />
sowie den entsprechenden Vorschriften der LPersVG.<br />
Ganz nah dran.<br />
Ihr Partner im Arbeits- und Sozialrecht.