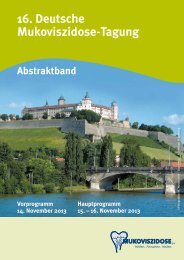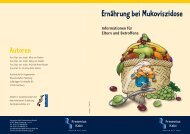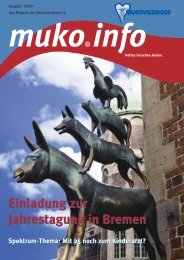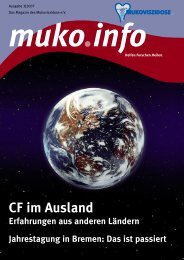Finale Druckvorlage 08_10_23 - Mukoviszidose e.V.
Finale Druckvorlage 08_10_23 - Mukoviszidose e.V.
Finale Druckvorlage 08_10_23 - Mukoviszidose e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Mukoviszidose</strong> e.V.<br />
Forschungsgemeinschaft <strong>Mukoviszidose</strong> (FGM)<br />
Arbeitsgemeinschaft der Ärzte im <strong>Mukoviszidose</strong> e.V. (AGAM)<br />
Abstraktband<br />
11. Deutsche<br />
<strong>Mukoviszidose</strong>-Tagung<br />
Vorprogramm<br />
13. November 20<strong>08</strong><br />
Hauptprogramm<br />
14. – 15. November 20<strong>08</strong>
Zertifizierung<br />
Die 11. Deutsche <strong>Mukoviszidose</strong>-Tagung ist als Fortbildungsmaßnahme<br />
der Kategorie A von der Bayerischen Landesärztekammer<br />
anerkannt.<br />
Die einzelnen Veranstaltungstage werden wie folgt zertifierziert:<br />
Donnerstag, 13. November 20<strong>08</strong> 8 Punkte<br />
Freitag, 14. November 20<strong>08</strong> 7 Punkte<br />
Samstag, 15. November 20<strong>08</strong> 5 Punkte<br />
- 2 -
Inhalt<br />
GRUßWORT 5<br />
RAUMÜBERSICHT 6<br />
PROGRAMMÜBERSICHT 8<br />
AGAM-FORTBILDUNGSTAG<br />
SEMINAR CF-KOMPAKT 15<br />
SYMPOSIUM 1<br />
(Keine Angst) vor dem Zahnarzt 15<br />
SYMPOSIUM 2<br />
Präimplantationsdiagnostik, Polkörperchendiagnostik: Ist das Wunschkind machbar? 16<br />
HAUPTPROGRAMM<br />
PLENUM 1<br />
Versorgungsqualität: Wunschdenken und Realität; AK Pflege 17<br />
Versorgungsqualität in der Physiotherapie Realität und Anspruch 17<br />
PLENUM 3<br />
Zeigt die Medikation bei <strong>Mukoviszidose</strong> Wechselwirkungen? 17<br />
POSTERWALK<br />
Analyse der Arzneimittelkosten und möglicher Einsparpotenziale bei der ambulanten<br />
Versorgung von Patienten mit <strong>Mukoviszidose</strong> 18<br />
Praktikabilität und Nützlichkeit des kontinuierlichen Glukose-Monitorings bei Patienten mit<br />
<strong>Mukoviszidose</strong> und pathologischer Glukosetoleranz 18<br />
Die Oberflächenexpression von TLR-4 ist bei CF Bronchialepithelzellen reduziert 19<br />
Seltene Komplikationen von Sport bei <strong>Mukoviszidose</strong> 20<br />
Anämie bei erwachsenen <strong>Mukoviszidose</strong> (CF) –Patienten 20<br />
CF-Ernährungswürfel ein neues Medium in der Ernährungsberatung 21<br />
Resistenzverhalten bedeutender gramnegativer Bakterien aus den Atemwegsmaterialien<br />
von <strong>Mukoviszidose</strong> Patienten während eines <strong>10</strong>-jährigen Zeitraums 21<br />
Einfluss von Taurin und Ursodeoxycholsäure auf den Gallensäurenmetabolismus bei<br />
Patienten mit Zystischer Fibrose 22<br />
Angst und Depression bei <strong>Mukoviszidose</strong>patienten und ihren Eltern 22<br />
CMV-Infektion bei einer 33-jährigen Patientin mit <strong>Mukoviszidose</strong> <strong>23</strong><br />
Beidseitige Hilusschwellung bei einem <strong>10</strong>jährigen Jungen mit Zystischer Fibrose:<br />
Erstmanifestation einer Akuten lymphoblastischen Leukämie. Fallbericht <strong>23</strong><br />
Vergleich der erwarteten Lungendosis bei einem Vernebler für adaptive Aerosolverabreichung<br />
gegenüber dem konventionellen Druckluftvernebler 24
WORKSHOPS<br />
Arbeitskreis Ernährung<br />
Mineralien und Spurenelemente bei CF 25<br />
Arbeitskreis Physiotherapie<br />
Chronischer Husten und Beckenboden - Funktionelle Zusammenhänge 25<br />
Psychosoziales Forum<br />
Bericht über den europäischen Kongress in Prag 26<br />
Mitgliederversammlung Forschungsgemeinschaft <strong>Mukoviszidose</strong> (FGM)<br />
DFG-Nachwuchsakademie Klinische Studien 26<br />
FRÜHSTÜCKSRUNDEN<br />
Frühstücksrunde 2<br />
Qualitätssicherung durch Dokumentation 27<br />
SEMINARE<br />
Seminar 1<br />
Motivation und Ambivalenz in der medizinischen Praxis 28<br />
Kommunikationstechnik und „Werkzeuge“ 28<br />
Seminar 2<br />
Körperliche Aktivität und Sport im häuslichen Umfeld aus Sicht der Physiotherapie 29<br />
Seminar 3a<br />
Problemkeime<br />
Interaktive Falldarstellung: 35 jährige CF Patientin mit unklaren bilateralen Infiltraten 29<br />
Schimmelpilze der Gattung Scedosporium bzw. Pseudallescheria bei CF-Patienten 30<br />
FREIE VORTRÄGE<br />
Versorgungsqualität: Wunschdenken und Realität<br />
Sozialoffensive - Die Realität verändern! 31<br />
Einfach gemacht - Qualitätsmanagement für die CF-Ambulanz 31<br />
Orale Infektion mit Pseudomonas aeruginosa im Mausmodell 32<br />
<strong>Mukoviszidose</strong> eine Immunerkrankung? 33<br />
Körperliche Aktivität bei Kindern und Jugendlichen mit Cystischer Fibrose (CF) 33<br />
Entwicklung von einem gestörten Kohlenhydratstoffwechsel zum Diabetes mellitus<br />
bei Patienten mit Cystischer Fibrose 34<br />
REFERENTEN UND MODERATOREN 35<br />
- 4 -
Grußwort<br />
Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher der „Würzburg-Tagung 20<strong>08</strong>“!<br />
Im Namen der Forschungsgemeinschaft <strong>Mukoviszidose</strong> (FGM) im <strong>Mukoviszidose</strong> e.V. begrüßen<br />
wie Sie herzlich zur <strong>Mukoviszidose</strong>-Tagung 20<strong>08</strong>. Wir haben erneut ein umfangreiches<br />
Programm zusammengestellt, in dem das breite Spektrum unseres Fachgebietes widergespiegelt<br />
wird. In über 30 Einzelveranstaltungen haben Sie die Möglichkeit, sich über<br />
die erreichten Standards und die zukünftigen Entwicklungen im Bereich <strong>Mukoviszidose</strong> zu<br />
informieren.<br />
Wie bereits im letzten Jahr realisiert, startet die Tagung am Donnerstag, 13.11.20<strong>08</strong> mit<br />
einem Fortbildungstag der Arbeitsgemeinschaft der Ärzte im <strong>Mukoviszidose</strong> e.V. (AGAM).<br />
Dieser Teil besteht aus „CF kompakt“, einem Einsteiger-Seminar, das sowohl für Ärzte als<br />
auch für nicht-ärztliche Mitarbeiter offen steht, und aus jeweils einem Symposium zum<br />
Thema Lungentransplantation und Schwangerschaft.<br />
Am Freitag-Vormittag wird die immer schwierigere Situation im klinischen Alltag beleuchtet,<br />
die geforderten Standards in der Versorgung von Menschen mit <strong>Mukoviszidose</strong> und die<br />
tatsächlich realisierbaren Möglichkeiten einander anzunähern. Beleuchtet wird nicht nur die<br />
ärztliche, sondern auch die Perspektive der nicht-ärztlichen Mitarbeiter. Ziel ist die Diskussion<br />
von Strategien zum Umgang mit dieser Situation in den kommenden Jahren.<br />
Das zweite Hauptplenum am Freitag diskutiert „den schwierigen Fall“, wobei auch hier die<br />
Funktion des gesamten CF-Teams in den Vordergrund gestellt werden soll. Das Hauptplenum<br />
am Samstag thematisiert zwei sehr häufige Probleme in der Versorgung von CF-<br />
Patienten, nämlich Fettstoffwechselstörungen, und das leider sehr reale Thema Pharmakologie<br />
und Arzneimittelinteraktionen.<br />
In bewährter Form werden auch 20<strong>08</strong> Seminare, Workshops, Frühstücksrunden, Industriesymposien,<br />
Posterwalk, Treffen der Arbeitskreise und selbstverständlich auch der Gesellschaftsabend<br />
stattfinden.<br />
Wir wünschen diesem Kongress eine repräsentative Darstellung der einzelnen Aspekte unserer<br />
Arbeit mit innovativen, interdisziplinären Diskussionen, kritischen Kommentaren und<br />
konstruktivem Gedankenaustausch innerhalb des gesamten Teams der <strong>Mukoviszidose</strong>-<br />
Versorgung.<br />
Herzlich willkommen in Würzburg!<br />
Hans-Georg Posselt Thomas Köhnlein<br />
Frankfurt/Main Hannover<br />
- 5 -
Raumübersicht<br />
Donnerstag, 13. November 20<strong>08</strong><br />
9:00 – 13:00 Uhr Seminar „CF kompakt“ Salon Echter<br />
13:00 – 13:30 Uhr Mittagessen Zwischenfoyer<br />
13:30 – 14:30Uhr Symposium 1 Salon Balthasar Neumann/Tiepolo<br />
14:30 – 15:00 Uhr Kaffeepause Zwischenfoyer<br />
15:00 – 17:00 Uhr Symposium 2 Salon Balthasar Neumann/Tiepolo<br />
17:00 – 17:30 Uhr Pause Zwischenfoyer<br />
17:30 – 19:30 Uhr<br />
AGAM Forum und Mitgliederversammlung<br />
Salon Balthasar Neumann/Tiepolo<br />
20:00 Uhr Abendveranstaltung der Firma Novartis Barbarossa Saal<br />
- 6 -
Freitag, 14. November 20<strong>08</strong><br />
7:30 – 8:30 Uhr<br />
Industriesymposium Solvay/InfectoPharm<br />
Barbarossa Saal<br />
7:30 – 8:30 Uhr Industriesymposium Roche Salon Balthasar Neumann/Tiepolo<br />
8:45 – 9:45 Uhr Industriesymposium Novartis Salon Balthasar Neumann/Tiepolo<br />
8:45 – 9:45 Uhr Industriesympoisum Grünenthal Barbarossa Saal<br />
<strong>10</strong>:00 – <strong>10</strong>:15 Uhr Begrüßung Frankonia Saal<br />
<strong>10</strong>:15 – 11:45 Uhr Plenum 1 Frankonia Saal<br />
11:45 – 12:00 Uhr Kaffeepause Foyer<br />
12:00 – 13:00 Uhr Posterwalk<br />
Untergeschoss im Bereich vor der<br />
Garderobe<br />
13:00 – 14:00 Uhr Mittagspause Foyer<br />
14:00 – 15:30 Uhr Plenum 2 Frankonia Saal<br />
15:30 – 16:00 Uhr Kaffeepause Foyer<br />
16:00 – 17.30 Uhr Workshops<br />
17:45 – 19:45 Uhr<br />
FGM Barbarossa-Saal<br />
AK Ernährung Salon Beatrix<br />
AK Pflege Salon Balthasar Neumann<br />
AK Physiotherapie Salon Echter<br />
AK Psychosoziales Forum Salon Peter Wagner/Bossi/Auwera<br />
AK Sport Salon Tiepolo<br />
Mitgliederversammlungen der<br />
Arbeitskreise<br />
FGM Barbarossa Saal<br />
AK Ernährung Salon Beatrix<br />
AK Pflege Salon Balthasar Neumann<br />
AK Physiotherapie Salon Echter<br />
AK Psychosoziales Forum Salon Peter Wagner/Bossi/ Auwera<br />
AK Reha Salon Petrini<br />
AK Sport Salon Tiepolo<br />
19:00 Uhr<br />
Jubiläumsveranstaltung des<br />
AK Physiotherapie<br />
Salon Echter<br />
20:00 Uhr Gesellschaftsabend Frankonia Saal<br />
Samstag, 15. November 20<strong>08</strong><br />
7:30 – 8:45 Uhr Frühstücksrunden Barbarossa Saal<br />
9:00 – <strong>10</strong>:30 Uhr Seminar 1 Salon Balthasar Neumann/Tiepolo<br />
9:00 – <strong>10</strong>:30 Uhr Seminar 2 Salon Beatrix<br />
9:00 – <strong>10</strong>:30 Uhr Seminar 3 Salon Echter<br />
9:00 – <strong>10</strong>:30 Uhr Freie Vorträge Salon Peter Wagner/Bossi/ Auwera<br />
<strong>10</strong>:30 – 11:00 Uhr Kaffeepause Foyer<br />
11:00 – 13:45 Uhr Plenum 3 Frankonia Saal<br />
13:45 Uhr Ende der Tagung<br />
- 7 -<br />
Raumübersicht
Programmübersicht<br />
Donnerstag, 13. November 20<strong>08</strong><br />
Vorprogramm<br />
9.00 – 13.00 SEMINAR „CF KOMPAKT“<br />
Moderation: Jutta Hammermann (Dresden)<br />
13.00 – 13.30 Mittagessen<br />
• Diagnosestellung<br />
Jutta Hammermann mit Karin Ulbrich und Antje Böhm (Dresden)<br />
• Kindheit und Jugend<br />
Thomas Nüßlein (Koblenz) mit Jürgen Pollok (Bochum)<br />
• Erwachsenenalter<br />
Christina Smaczny (Frankfurt) mit Gabriele Becker (Essen) und Annette Bouquet (Wörth am<br />
Rhein)<br />
13.30 – 14.50 SYMPOSIUM 1:<br />
Vorsitz: Christina Smaczny (Frankfurt)<br />
13.30 – 14.<strong>10</strong> (Keine) Angst vor dem Zahnarzt?<br />
Michael Sies (Darmstadt)<br />
14.<strong>10</strong> – 14.50 Pro- und Contra Diskussion Lungentransplantation<br />
Manfred Ballmann (Hannover) und Thomas Frischer (Wien)<br />
14.50 – 15.20 Kaffeepause<br />
15.20 – 17.00 SYMPOSIUM 2<br />
17.00 – 17.30 Pause<br />
Verhütung, Kinderwunsch und Schwangerschaft bei CF Patienten<br />
Vorsitz: Doris Staab (Berlin)<br />
Verhütung (Probleme, Methoden, Komplikationen)<br />
Anja-Undine Stücker (Frankfurt)<br />
Kinderwunsch (Methoden, Erfolgsaussichten)<br />
Jörg B. Engel (Würzburg)<br />
Präimplantationsdiagnostik, Polkörperchendiagnostik: Ist das Wunschkind machbar?<br />
Ute Hehr (Regensburg)<br />
Schwangerschaft bei CF Patientinnen<br />
Doris Staab (Berlin)<br />
17.30 – 19.30 AGAM-FORUM UND MITGLIEDERVERSAMMLUNG<br />
ABENDVERANSTALTUNG*<br />
DER NOVARTIS PHARMA GMBH<br />
ab 20.00 Designing Your CF Care Program to Result in Best Patient Outcomes: How and Why<br />
Michael P. Boyle (Baltimore)<br />
*mit Abendessen<br />
- 8 -
Freitag, 14. November 20<strong>08</strong><br />
7.30 – 8.30 Industriesymposium<br />
ausgerichtet von<br />
und<br />
Neueste Aspekte der Antibiotikainhalation und Ernährung: Wie effizient sind die aktuellen<br />
Inhalationssysteme? Erste Studienergebnisse zur Therapie der oberen Atemwege.<br />
Ernährung bei Diabetes.<br />
Moderation: Hans-Eberhard Heuer (Hamburg)<br />
1. Effiziente Medikamentennutzung, hohe Dosiergenauigkeit und Reduktion der Therapiekosten:<br />
Was können CF-Inhalationssysteme leisten?<br />
Hans-Eberhard Heuer (Hamburg)<br />
2. Chancen und Grenzen der konservativen und operativen HNO-Behandlung bei CF<br />
Jochen Mainz (Jena)<br />
3. <strong>Mukoviszidose</strong> und Diabetes<br />
Manfred Ballmann (Hannover)<br />
7.30 – 8.30 Industriesymposium<br />
ausgerichtet von<br />
Kann Sport die Physiotherapie für CF-Patienten ersetzen?<br />
Durch positive Auswirkungen auf Psyche und Persönlichkeit scheinen viele Patienten ermutigt, die<br />
Physiotherapie zugunsten des Sports aufzugeben. Ist das wirklich so? Mit ihren Plädoyers wollen sich<br />
die Referenten dieser und anderen Fragen stellen.<br />
Eine Diskussion zum Spannungsfeld der beiden Disziplinen<br />
Moderation: Ernst Rietschel (Köln)<br />
1. Ja – Pro Sport<br />
Helge Hebestreit (Würzburg)<br />
2. Nein – Pro Physiotherapie<br />
Sonja Biet (Köln)<br />
anschließend Diskussion<br />
- 9 -<br />
Programmübersicht
8.45- 9.45 Industriesymposium<br />
ausgerichtet von<br />
Rechtzeitig vorbeugen, optimal eradizieren: Frühe Therapie der Lungenerkrankung bei CF<br />
Moderation: Hans-Georg-Posselt (Frankfurt)<br />
1. Hygiene: Was ist sinnvoll, wie viel ist notwendig?<br />
Dieter Worlitzsch (Halle)<br />
2. Möglichkeiten der Prävention<br />
Thomas Nüßlein (Koblenz)<br />
3. Die Therapie der Erstinfektion mit P. aeruginosa: Was lernen wir aus der ELITE Studie?<br />
Manfred Ballmann (Hannover)<br />
8.45 – 9.45 Industriesymposium<br />
ausgerichtet von<br />
Optimierte Behandlung der chronischen Pseudomonas-Infektion bei CF – die richtige Mischung:<br />
Sport, Ernährung, Antibiotika<br />
Moderation: Matthias Griese (München)<br />
1. Efficacy of Colistin in Pseudomonas<br />
infected CF Patients<br />
Diana Bilton (London)<br />
2. Richtige Ernährung und Lungenfunktion – ist dicker wirklich besser?<br />
Matthias Kappler (München)<br />
3. Verbesserung der körperlichen Fitness und deren positive Auswirkungen<br />
Wolfgang Gruber (Nebel)<br />
- <strong>10</strong> -
Hauptprogramm<br />
<strong>10</strong>.00 – <strong>10</strong>.15 BEGRÜßUNG<br />
Horst Mehl (1. Vorsitzender des <strong>Mukoviszidose</strong> e.V.) und Tagungsleitung<br />
<strong>10</strong>.15 – 11.45 PLENUM 1<br />
Versorgungsqualität: Wunschdenken und Realität<br />
Moderation: Rainald Fischer (München), Uwe Mellies (Essen) und Matthias Wiebel (Heidelberg)<br />
11.45 – 12.00 Kaffeepause<br />
12.00 – 13.00 POSTERWALK<br />
Referenten: Thomas O. F. Wagner (Frankfurt), Christina Smaczny (Frankfurt), Katrin Schlüter<br />
(Hannover), Brigitte Roos-Liegmann (Frankfurt), Stefanie Rosenberger-Scheuber (Gerlingen),<br />
Lutz Goldbeck (Ulm) und Gerd Hüls (Hamburg)<br />
1. Analyse der Arzneimittelkosten und möglicher Einsparpotenziale bei der ambulanten<br />
Versorgung von Patienten mit <strong>Mukoviszidose</strong><br />
Christoph T.H. Baltin (Hannover)<br />
2. Praktikabilität und Nützlichkeit des kontinuierlichen Glukose-Monitorings bei Patienten<br />
mit <strong>Mukoviszidose</strong> und pathologischer Glukosetoleranz<br />
Jörg Große-Onnebrink (Essen)<br />
3. Die Oberflächenexpression von TLR-4 ist bei CF Bronchialepithelzellen reduziert<br />
Gerrit John (Marburg)<br />
4. Seltene Komplikationen von Sport bei <strong>Mukoviszidose</strong><br />
Katharina Ruf (Würzburg)<br />
5. Anämie bei erwachsenen <strong>Mukoviszidose</strong> (CF) –Patienten<br />
Annette Sauer-Heilbronn (Hannover)<br />
6. CF Ernährungswürfel – ein neues Medium in der Ernährungsberatung<br />
Katrin Schlüter (Hannover)<br />
7. Resistenzverhalten bedeutender gramnegativer Bakterien aus den Atemwegsmaterialien<br />
von <strong>Mukoviszidose</strong>-Patienten während eines <strong>10</strong>-jährigen Zeitraums<br />
Barbara Kahl (Münster)<br />
8. Einfluss von Taurin und Ursodeoxycholsäure auf den Gallensäurenmetabolismus<br />
bei Patienten mit Zystischer Fibrose<br />
Jochen Schneider (Jena)<br />
9. Angst und Depression bei <strong>Mukoviszidose</strong>patienten und ihren Eltern<br />
Lutz Goldbeck (Ulm)<br />
<strong>10</strong>. CMV-Infektion bei einer 33-jährigen Patientin mit <strong>Mukoviszidose</strong><br />
Andrea Jobst (Berlin)<br />
11. Beidseitige Hilusschwellung bei einem <strong>10</strong>-jährigen Jungen mit Zystischer Fibrose:<br />
Erstmanifestation einer Akuten lymphoblastischen Leukämie. Fallbericht<br />
Christian Dopfer (Jena)<br />
12. Vergleich der erwarteten Lungendosis bei einem Vernebler für adaptive Aerosolverarbeitung<br />
gegenüber dem konventionellen Druckluftvernebler<br />
Jens Stegemann (Heppenheim)<br />
13.00 – 14.00 Mittagspause<br />
(Parallel zur Mittagspause finden ein Treffen der AG <strong>Mukoviszidose</strong> der GPP und ein Prüfertreffen<br />
zur Diabetesstudie statt; nähere Informationen siehe Aushang am Tagungsbüro)<br />
14.00 – 15.30 PLENUM 2<br />
Der komplizierte Fall: Therapieentscheidung jenseits von Leitlinien<br />
Moderation: Thomas Nüßlein (Koblenz) und Thomas Köhnlein (Hannover)<br />
15.30 – 16.00 Kaffeepause<br />
Referenten: Rainald Fischer (München), Matthias Wiebel (Heidelberg), Helmut Ellemunter<br />
(Innsbruck) und Jochen Mainz (Jena)<br />
- 11 -<br />
Programmübersicht
16.00 – 17.30 WORKSHOPS<br />
der einzelnen Berufsgruppen im Behandlerteam<br />
Workshop FGM<br />
Moderation: Matthias Griese (München)<br />
1. Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit der Inhalation von Glutathion<br />
(GSH) – Phase II Studie<br />
Matthias Griese (München)<br />
2. Frühe Behandlung des Diabetes mellitus bei CF<br />
Manfred Ballmann (Hannover)<br />
3. Untersuchung der Muskel-Knochen-Einheit bei Kindern und Jugendlichen mit<br />
Cystischer Fibrose<br />
Frank Michael Müller (Heidelberg)<br />
4. Anti-inflammatorische pulmonale Therapie von CF-Patienten mit Amitriptylin -<br />
Phase II Studie<br />
Joachim Riethmüller (Tübingen)<br />
5. Adaptation und Selektion von P. aeruginosa an die CF-Lunge: Untersuchungen zu<br />
Metabolismus, Pathogenität und Antibiotikaresistenz von P. aeruginosa unter<br />
simulierten Respirationstraktbedingungen<br />
Susanne Häußler (Braunschweig)<br />
6. Characterization and application of garlic-derived anti-microbials for treatment<br />
of CF patients<br />
Michael Givskov (Kopenhagen)<br />
(Der Vortrag erfolgt in englischer Sprache ohne Übersetzung)<br />
AK Ernährung<br />
Moderation: Bärbel Palm (Homburg)<br />
1. Mineralien und Spurenelemente bei CF<br />
Olaf Sommerburg (Heidelberg)<br />
2. Fettlösliche Vitamine bei CF<br />
Klaus-Michael Keller (Wiesbaden)<br />
AK Pflege<br />
Inhalationstherapie - Wie zeige ich es meinen Patienten?<br />
Ulrike Erdmann und Monika Brandert (Bonn), Jovita Zerlik (Hamburg)<br />
AK Physiotherapie<br />
Chronischer Husten und Beckenboden – funktionelle Zusammenhänge<br />
Birgit Borges-Lüke (Hannover) und Gabriele Henschel (Hannover)<br />
Psychosoziales Forum<br />
1. Zum aktuellen Stand des Arbeitskreises<br />
Maria Schon (Osnabrück), Lutz Goldbeck (Ulm) und Gudrun Hausmann (Wittdün)<br />
2. Bericht über den europäischen Kongress in Prag<br />
Gerald Ullrich (Hannover)<br />
3. Psychosoziale Kasuistiken<br />
Christa Weiss (Berlin)<br />
AK Sport<br />
Training zu Hause<br />
Wolfgang Gruber (Nebel), Alexandra Hebestreit, Helge Hebestreit und Katharina Ruf (Würzburg)<br />
17.45 – 19.45 Mitgliederversammlung der Arbeitskreise<br />
Mitgliederversammlung der FGM mit Vortrag:<br />
Nachwuchsakademie Klinische Studien<br />
Frank Wissing (Bonn)<br />
ab 20.00 Uhr Gesellschaftsabend<br />
- 12 -
Samstag, 15. November 20<strong>08</strong><br />
7.30 – 8.45 FRÜHSTÜCKSRUNDEN<br />
Diskussionsrunden für das gesamte Team (Begrenzte Teilnehmerzahl; die Zuordnung erfolgt<br />
nach der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen)<br />
R1 „Erwachsenenrehabilitation“ – Vom Antrag bis zur sozialmedizinischen Beurteilung<br />
Hartmut Kronenberger und Stefan Dewey (Borkum)<br />
R2 Qualitätssicherung durch Dokumentation<br />
Kathrin Könecke (Edemissen)<br />
R3 Patientenschulung: Ambulante intravenöse Antibiotikatherapie, Pflege des peripheren<br />
und zentralen Venenzugangs<br />
Stephanie Eckhardt (Frankfurt)<br />
R4 Nicht-invasive Beatmung (Grundlagen, Technik und praktische Anwendung)<br />
Thomas Köhnlein (Hannover)<br />
R5 Neue Inhalationsgeräte<br />
Daniel Schüler (Gießen)<br />
R6 Induziertes Sputum<br />
Andreas Hector (München)<br />
R7 Hygiene in der CF-Ambulanz<br />
Matthias Kappler (München)<br />
R8 Ist die Essenskrise lösbar? – Psychosoziale Aspekte<br />
Doris Caroli und Birgit Merten (München)<br />
R9 Neugeborenen Screening<br />
Manfred Ballmann (Hannover)<br />
R<strong>10</strong> Qualitätskontrolle der Sputumanalytik<br />
Michael Hogardt (München)<br />
Seminare und Freie Vorträge<br />
9.00 – <strong>10</strong>.30 SEMINAR 1<br />
Therapie, Motivation, Verantwortung<br />
1. Grundzüge der „motivierenden Gesprächsführung“<br />
Maria Etzkorn (Trier)<br />
2. Kommunikationstechnik und „Werkzeuge“<br />
Gerald Ullrich (Hannover)<br />
3. Therapiemotivation, Entscheidungsfreiheit, Verantwortung<br />
Lutz Goldbeck (Ulm)<br />
9.00 – <strong>10</strong>.30 SEMINAR 2<br />
Körperliche Aktivität und Sport im häuslichen Umfeld aus der Sicht der Physiotherapie<br />
und des Sports<br />
Kathrin Könecke (Edemissen) und Wolfgang Gruber (Nebel)<br />
9.00 – 9.45 SEMINAR 3a<br />
Problemkeime<br />
Moderation: Doris Staab (Berlin)<br />
Referenten: Carsten Schwarz und Kathrin Tintelnot (Berlin)<br />
9.45 – <strong>10</strong>.30 SEMINAR 3b<br />
Kontinuierliche Qualitätsverbesserung in Deutschland<br />
Moderatoren: Martin Stern (Tübingen) und Andreas Reimann (Bonn)<br />
Benchmarking in der <strong>Mukoviszidose</strong>: Aktueller Stand nach Ausweitung des Projektes<br />
Paul Wenzlaff und Nadja Niemann (Hannover), Martin Stern (Tübingen)<br />
Multiprofessionelle Intervention<br />
Horst von der Hardt (Hannover)<br />
- 13 -<br />
Programmübersicht
9.00 – <strong>10</strong>.30 FREIE VORTRÄGE<br />
<strong>10</strong>.30 – 11.00 Kaffeepause<br />
11.00 – 13.45 PLENUM 3<br />
Versorgungsqualität: Wunschdenken und Realität<br />
Sozialoffensive - Die Realität verändern!<br />
Horst von der Hardt (Hannover)<br />
Einfach gemacht - Qualitätsmanagement für die CF-Ambulanz<br />
Paul Wenzlaff (Hannover)<br />
Orale Infektion mit Pseudomonas aeruginosa im Mausmodell<br />
Imke Glass (Hannover)<br />
<strong>Mukoviszidose</strong> eine Immunerkrankung?<br />
Markus Oliver Henke (Marburg)<br />
Körperliche Aktivität bei Kindern und Jugendlichen mit Cystischer Fibrose (CF)<br />
Sibylle Junge (Hannover)<br />
Entwicklung von einem gestörten Kohlenhydratstoffwechsel zum Diabetes mellitus<br />
bei Patienten mit Cystischer Fibrose<br />
Christine Kämpfert (Hannover)<br />
Moderation: Burkhard Tümmler (Hannover) und Ernst Rietschel (Köln)<br />
11.00 – 11.45 a) Neue Aspekte der Grundlagenforschung bei CF: Implikationen für die Therapie<br />
Burkhard Tümmler (Hannover)<br />
11.45 – 12.30 Pharmakologie<br />
b) Basics<br />
Ruxandra Sabau (Hannover)<br />
12.30 – 12.45 Pause<br />
12.45 – 13.15 c) Therapieoptimierung und praktische Umsetzung<br />
MUKO.dok: Eine neue Ära der qualitätsorientierten Dokumentation – ein<br />
Überblick<br />
Lutz Nährlich (Erlangen)<br />
13.15 – 13.45 Highlights aus der Forschung<br />
Marcus Mall (Heidelberg)<br />
13.45 Ende der Tagung<br />
- 14 -
AGAM-Fortbildungstag<br />
Seminar CF-kompakt<br />
Autoren: Jutta Hammermann und Karin Ulbrich, Dresden, Thomas Nüsslein, Koblenz, Jürgen Pollok,<br />
Bochum, Christina Smaczny, Frankfurt, und Gabriele Becker, Essen<br />
„CF kompakt" soll als ein Seminar<br />
für Neu- und Wiedereinsteiger aller<br />
Berufsgruppen in der Behandlung<br />
und Betreuung von <strong>Mukoviszidose</strong>-<br />
Patienten verstanden werden. Die<br />
Vortragenden wollen einen praxisrelevanten<br />
Abriss über die Betreuung<br />
von Patienten vom Säuglings-<br />
bis zum Erwachsenenalter geben,<br />
ohne den Anspruch, alle Belange<br />
von <strong>Mukoviszidose</strong>-Patienten ansprechen<br />
zu können. Neben der<br />
ärztlichen Sicht soll auch die Perspektive<br />
anderer beteiligter Be-<br />
Symposium 1<br />
(Keine) Angst vor dem Zahnarzt?<br />
Autor: Michael Sies, Darmstadt<br />
Spezielle Hygieneempfehlungen für<br />
die Behandlung von <strong>Mukoviszidose</strong>patienten<br />
in der zahnärztlichen<br />
Praxis<br />
• Betrieb einer Desinfektionsanlage<br />
in den Behandlungsstühlen<br />
• Regelmäßige mikrobiologische<br />
Kontrollen des Wassers<br />
• Vor der Behandlung alle wasserführende<br />
Systeme 1-2 Min.<br />
durchspülen<br />
• Mundspülbecher nicht an der<br />
Behandlungseinheit, sondern aus<br />
dem Wasserhahn im Waschbecken<br />
füllen<br />
• Verwendung steriler Kochsalzlösung<br />
bei der Behandlung z.B.<br />
Präparation („Bohren“); geht nur<br />
mit einem „Chirurgiemotor“<br />
• Entfernung von Zahnstein und<br />
Belägen bevorzugt mit Handin-<br />
rufsgruppen dargestellt werden,<br />
die in die Betreuung von <strong>Mukoviszidose</strong>-Patienten<br />
eingebunden<br />
sind. Inhaltlich werden im Säuglings-<br />
und Kleinkindesalter die<br />
Diagnosestellung, Initial- und Verlaufsdiagnostik<br />
behandelt. Ein weiterer<br />
Schwerpunkt soll das Neugeborenenscreening<br />
auf <strong>Mukoviszidose</strong><br />
und das Diagnose-Erstgespräch,<br />
sowie besondere Probleme des<br />
Säuglingsalters sein.<br />
Kindheit und Jugend betreffend<br />
wird auf die Versorgungsstruktur<br />
strumenten; Ultraschall nur<br />
wenn nötig<br />
• Statt Multifunktionsspritze, Einmalspritze<br />
und großlumige Kanüle<br />
mit Kochsalzlösung verwenden<br />
• Bei Füllungstherapie eventuell<br />
Kofferdam verwenden, (Isolierung<br />
der behandelten Zähne mit<br />
einem Gummituch)<br />
Was kann ich, was kann mein Kind<br />
selber tun, um Zähne und Zahnfleisch<br />
gesund zu erhalten?<br />
• 2-3 x täglich 2-3 Minuten sorgfältig<br />
die Zähne putzen<br />
• Nach dem abendlichen Zähneputzen<br />
nichts mehr essen,<br />
nachts nur Wasser trinken<br />
• Fluoride anwenden (Zahnpasta,<br />
Speisesalz, Gele)<br />
• nicht zuviel Süßkram (Achtung:<br />
- 15 -<br />
in Deutschland, Therapieoptionen,<br />
Physiotherapie bei <strong>Mukoviszidose</strong>,<br />
Mikrobiologie und Hygiene, sowie<br />
ärztliche Beratung bei der Berufswahl<br />
eingegangen werden. Im<br />
Erwachsenenalter werden in dieser<br />
Altersgruppe spezifische medizinische<br />
und soziale Probleme dargestellt,<br />
mit dem Schwerpunkt Lungentransplantation,<br />
sowohl aus<br />
ärztlicher, als auch aus Patientensicht<br />
und vor dem Hintergrund der<br />
Sozialarbeit.<br />
Getränke!)<br />
• Reinigen Sie regelmäßig (3 -4 x<br />
in der Woche) die Zahnzwischenräume<br />
• Gehen Sie mindestens einmal,<br />
besser zweimal im Jahr zu ihrem<br />
Zahnarzt/ihrer Zahnärztin zur<br />
Vorsorgeuntersuchung!<br />
• Informieren Sie ihren Zahnarzt/ihre<br />
Zahnärztin über Ihre<br />
Grunderkrankung und Ihren aktuellen<br />
Gesundheitszustand!<br />
• Vertrauen Sie auf den mittlerweile<br />
erreichten hohen Hygienestandard<br />
in deutschen Zahnarztpraxen<br />
• Besprechen Sie mit ihr/ihm vorbeugende<br />
Maßnahmen, insbesondere<br />
die Wasserproblematik<br />
AGAM Fortbildungstag
Symposium 2<br />
Präimplantationsdiagnostik, Polkörperchendiagnostik: Ist das Wunschkind<br />
machbar?<br />
Autor: Ute Hehr, Regensburg<br />
Die Polkörperdiagnostik (PKD)<br />
kann als derzeit einzige in<br />
Deutschland legale Form der Präimplantationsdiagnostik<br />
(PID) für<br />
Paare mit hohem Risiko für eine<br />
bestimmte, monogen vererbte<br />
Erkrankung eine Alternative zur<br />
Realisierung ihrer Familienplanung<br />
darstellen. Nach umfassender Beratung<br />
wird sich ein nicht unerheblicher<br />
Teil der initial interessierten<br />
Paare aufgrund der Nachteile (assistierte<br />
Reproduktion, persönlicher<br />
und finanzieller Aufwand etc.)<br />
gegen eine PKD entscheiden.<br />
Nachfolgend sollen anhand der<br />
eigenen Erfahrungen an unserem<br />
Zentrum seit dem Jahr 2000 am<br />
Beispiel der <strong>Mukoviszidose</strong> die<br />
Voraussetzungen, Möglichkeiten<br />
und Grenzen der PKD sowie der<br />
konkrete Ablauf dargestellt werden.<br />
Voraussetzungen sind (1) der<br />
Nachweis der CFTR-Mutation bei<br />
beiden Partnern und eine (2) humangenetische<br />
Beratung des Paa-<br />
.<br />
res zu den bestehenden Optionen<br />
im Rahmen der Familienplanung<br />
incl. der konventionellen vorgeburtlichen<br />
Diagnostik. (3) Die<br />
Durchführung einer PKD erfordert<br />
eine in vitro-Fertilisation (IVF) mit<br />
intrazytoplasmatischer Spermieninjektion<br />
(ICSI). (4) Vor Behandlungsbeginn<br />
sollte parallel<br />
eine reproduktionsmedizinische<br />
Diagnostik zum Ausschluss von<br />
Fertilitätsstörungen sowie eine<br />
umfassende Beratung des Paares<br />
zu Ablauf, Risiken und Schwangerschaftsraten<br />
nach IVF/ICSI erfolgen.<br />
Nach Vorliegen der schriftlichen<br />
Einverständniserklärung wird mit<br />
der Etablierung eines familienspezifischen<br />
PKD-Testsystems begonnen.<br />
Dieses beinhaltet möglichst<br />
einen direkten Mutationsnachweis<br />
und die Detektion von mindestens<br />
2 eng gekoppelten, für die Ratsuchende<br />
informativen Markern. Alle<br />
zu untersuchenden Regionen werden<br />
in PCR-Produkten einer maxi-<br />
- 16 -<br />
malen Länge von 300bp amplifiziert<br />
und die Reaktionen so optimiert,<br />
dass eine stabile Amplifikation<br />
in einer Einschritt-Multiplex-<br />
PCR an Einzelzellen und anschließende<br />
Detektion möglich sind.<br />
Nach Fertigstellung des familienspezifischen<br />
Testsystems incl. Prüfung<br />
der Allel-drop-out-Rate an<br />
sortierten Einzelzellen einer frischen<br />
Blutprobe der Ratsuchenden<br />
kann, ggf. in Kooperation mit einem<br />
Kinderwunschzentrum in<br />
Wohnortnähe, der PKD-Zyklus<br />
beginnen. Zur Eizellpunktion mit<br />
anschließender PKD und Transfer<br />
kommt die Patientin zum PKD-<br />
Zentrum, die gynäkologische<br />
Nachbetreuung kann dann erneut<br />
in Wohnortnähe erfolgen. Die „baby-take-home“-Rate<br />
pro Transfer-<br />
Zyklus liegt an unserem Zentrum<br />
aktuell bei <strong>23</strong>%, insgesamt wurden<br />
bei uns bisher 8 Kinder nach PKD<br />
geboren, eine weitere Schwangerschaft<br />
besteht.
Hauptprogramm<br />
Plenum 1<br />
Moderation: Thomas Köhnlein, Hannover, und Hans-Georg Posselt, Frankfurt<br />
Versorgungsqualität: Wunschdenken und Realität; AK Pflege<br />
Autorin: Brigitte Roos-Liegmann, Frankfurt<br />
Im Rahmen der Qualitätssicherung<br />
werden an zertifizierte CF-Ambulanzen<br />
neben der umfassenden<br />
diagnostischen und therapeutischen<br />
Ausstattung besondere personelle<br />
Anforderungen gestellt.<br />
Dem interdisziplinären Team müssen<br />
ein Facharzt für Pädiatrie oder<br />
Innere Medizin, ein psychosozialer<br />
Dienst, ein Physiotherapeut, ein<br />
Ernährungsberater und eine spezialisierte<br />
Pflegekraft angehören.<br />
Diskutiert werden die Ergebnisse<br />
eines Fragebogens, der den Ist-<br />
Zustand des Pflegepersonals in<br />
Versorgungsqualität in der Physiotherapie Realität und Anspruch<br />
Autorin: Stefanie Rosenberger-Scheuber, Gerlingen<br />
Im Vortrag werden Strukturen wie,<br />
der AK-Physiotherapie, Qualitätssicherung<br />
bei der Weiterbildung von<br />
Physiotherapeuten, sowie räumliche,<br />
hygienische und lokale Bedingungen<br />
bei der physiotherapeutischen<br />
Betreuung von CF-Patienten<br />
betrachtet.<br />
Anhand der Darstellung des Angebots<br />
der KSH in Gerlingen wird<br />
aufgezeigt, wie umfangreich sowohl<br />
für den Therapeuten als auch<br />
den Patienten das Angebot sein<br />
sollte, um befundorientierte Physiotherapie<br />
anzubieten.<br />
Plenum 3<br />
Moderation: Burkhard Tümmler, Hannover, und Ernst Rietschel, Köln<br />
Zeigt die Medikation bei <strong>Mukoviszidose</strong> Wechselwirkungen?<br />
Autorin: Ruxandra Sabau, Hannover<br />
Wechselwirkungen sind immer<br />
dann zu erwarten, wenn die Pharmakokinetik<br />
eines Arzneistoffs<br />
durch einen zweiten verändert wird<br />
oder wenn sich die pharmakodynamischen<br />
Wirkungen zweier Arzneistoffe<br />
gegenseitig verstärken<br />
oder aufheben. Klinisch kann sich<br />
eine Interaktion als ein vermindertes<br />
oder verstärktes Ansprechen<br />
auf eine Therapie bemerkbar<br />
machen.<br />
Die <strong>Mukoviszidose</strong>medikation zeigt<br />
relevante Interaktionen auf<br />
1. pharmazeutischer (Inkompatibilitäten)<br />
2. pharmakokinetischer und<br />
3. pharmakodynamischer Ebene.<br />
So bewirkt Piperacillin eine mehr<br />
als <strong>10</strong>%-ige Inaktivierung von<br />
Tobramycin in vitro und in vivo.<br />
Tobramycin und Ceftazidim Lösungen<br />
sind ebenfalls nicht miteinander<br />
kompatibel.<br />
Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium,<br />
Eisen, Zink und Aluminium<br />
führen sowohl zur Komplexbildung<br />
mit Fluorchinolonen und Makroliden,<br />
als auch zum Anstieg des pH-<br />
Wertes im Magen und Dünndarm<br />
und damit zur Absorptionsminderung<br />
von Azolantimykotika.<br />
Das Cytochrom P450 (CYP) System<br />
in der Leber ist verantwortlich für<br />
die oxidativen Reaktionen von<br />
Arzneistoffen (Phase-I-Metabolismus).<br />
Die wichtigsten dabei beteiligten<br />
Enzyme sind CYP 1A2, 3A4,<br />
2D6, 2C9 und 2C19.<br />
- 17 -<br />
zertifizierten CF-Einrichtungen<br />
ermittelt hat. Erörtert wurden die<br />
Aufgaben und die Qualifikation des<br />
Pflegepersonals. Die Arbeitssituation,<br />
die Wünsche nach Veränderung/Verbesserung<br />
werden aufgezeigt.<br />
Gleichzeitig soll verdeutlicht werden,<br />
dass moderne Physiotherapie<br />
bedeutet, unter Berücksichtigung<br />
des Zeitbudgets des Patienten und<br />
auch der Wirtschaftlichkeit ein<br />
individuelles Programm für den<br />
Einzelnen auszuarbeiten.<br />
Als Beispiel seien der rasche Anstieg<br />
des Omeprazolspiegels (Substrat<br />
2C19, 3A4) unter Voriconazol<br />
(Hemmstoff 2C19, 3A4), sowie die<br />
erhöhten Theophyllin-<br />
Plasmakonzentrationen (Substrat<br />
1A2,3A4) bei gleichzeitiger Medikation<br />
mit Ciprofloxacin (Hemmstoff<br />
1A2) genannt.<br />
Grundsätzlich ist bei Substanzen<br />
mit geringer therapeutischer Breite<br />
und steiler Konzentrations-<br />
Wirkungs-Kurve mit Wechselwirkungen<br />
zu rechnen.<br />
Die sorgfältige Auswahl und Dosierung<br />
von Arzneimitteln ist die<br />
wichtigste Maßnahme zur Vermeidung<br />
von Interaktionen.<br />
Plenen
Posterwalk<br />
Analyse der Arzneimittelkosten und möglicher Einsparpotenziale bei der ambulanten<br />
Versorgung von Patienten mit <strong>Mukoviszidose</strong><br />
Hauptautor: Christoph T. H. Baltin<br />
Weitere Autoren: Christina Smaczny und Thomas O. F. Wagner, Frankfurt<br />
Hintergrund:<br />
Der Einsatz von Arzneimitteln stellt<br />
einen wesentlichen Kostenfaktor<br />
innerhalb der medizinischen Versorgung<br />
von Patienten mit <strong>Mukoviszidose</strong><br />
dar. Dabei steht den<br />
einerseits ansteigenden Medikationskosten<br />
ein zunehmender wirtschaftlicher<br />
Druck mit finanziellen<br />
Einschnitten gegenüber. Zur Aufrechterhaltung<br />
eines hohen Versorgungsniveaus<br />
ist es daher unerlässlich,<br />
die Kostenstruktur gegenwärtigerArzneimittelverschreibungen<br />
näher zu untersuchen und<br />
auf medizinisch und ökonomisch<br />
sinnvolle Effizienzsteigerungen zu<br />
prüfen.<br />
Ziel:<br />
Ziel ist die systematische Untersuchung<br />
der jährlichen Arzneimittelkosten,<br />
die gegenwärtig bei der<br />
ambulanten Behandlung von <strong>Mukoviszidose</strong>patienten<br />
anfallen.<br />
Methode:<br />
Die Analysen basieren auf 1712<br />
Medikamentenangaben von er-<br />
wachsenen Patienten (n = 143)<br />
der CF Ambulanz der Frankfurter<br />
Universitätsklinik aus dem Jahr<br />
2007. Sämtliche Tagesdosen des<br />
Untersuchungsjahres wurden patientenindividuell<br />
auf Basis der entsprechenden<br />
Preise aus der Roten<br />
Liste zur Berechnung der jährlichen<br />
Arzneimittelkosten herangezogen.<br />
Dies führte zu einer Einteilung<br />
von insgesamt 472 unterschiedlichen<br />
Arzneimitteln in <strong>10</strong><br />
unterschiedliche Medikamentenklassen.<br />
Mögliche Einsparpotenziale<br />
durch Generika wurden für jedes<br />
Medikament auf Basis der Preise<br />
aus der Datenbank der Pharmatechnik<br />
bzw. ADG geprüft und<br />
quantifiziert. Zusätzlich erfolgte<br />
eine Kostenanalyse aller bisherigen<br />
i.v. Therapien betroffener Patienten<br />
(n = 94) der Frankfurter CF<br />
Ambulanz.<br />
Ergebnisse:<br />
Die Identifikation der Hauptkostentreiber<br />
sowie eine Übersicht gruppenspezifischer<br />
Arzneimittelkosten<br />
- 18 -<br />
steigern die Transparenz bisheriger<br />
Therapiekonzepte. Darüber hinaus<br />
zeigt die Ermittlung von Einsparpotenzialen<br />
durch einen intensivierten<br />
Generikaeinsatz Ansätze für<br />
eine kostengünstigere medizinische<br />
Versorgung auf (Ergebnisse<br />
werden in Form eines Posters sowie<br />
Powerpoint-gestützter Präsentation<br />
vorgestellt).<br />
Ausblick:<br />
Die Studie ermöglicht einerseits<br />
eine sekundäre Validierung bisheriger<br />
Kostenanalysen von Arzneimittelverschreibungen<br />
bei der ambulanten<br />
Versorgung von Patienten<br />
mit <strong>Mukoviszidose</strong>. Darüber hinaus<br />
liegt ein großer Mehrwert in der<br />
Berechnung entsprechender Einsparungsmöglichkeiten.<br />
Im<br />
Bestreben um eine tragfähige medizinische<br />
Versorgung dieser seltenen<br />
Erkrankung wird daher dem<br />
effizienten Einsatz kostenintensiver<br />
Therapieelemente zukünftig ein<br />
noch größerer Stellenwert zukommen.<br />
Praktikabilität und Nützlichkeit des kontinuierlichen Glukose-Monitorings bei Patienten<br />
mit <strong>Mukoviszidose</strong> und pathologischer Glukosetoleranz<br />
Hauptautor: Jens Große-Onnebrink, Essen<br />
Weitere Autoren: Uwe Mellies, Essen<br />
Mit diesem Beitrag stellen wir die<br />
Praktikabilität und den möglichen<br />
Nutzen von Kontinuierlichen-Glukose-Monitoring-Systemen<br />
(CGMS)<br />
bei Kindern und Erwachsenen mit<br />
<strong>Mukoviszidose</strong> (CF) und pathologischer<br />
Glukosetoleranz (path. GT)<br />
anhand einer Fallserie dar.<br />
CGMS finden i.A. Anwendung, um<br />
ein engmaschiges Glukose-Monitoring<br />
von Patienten mit Diabetes<br />
Mellitus (DM) Typ I während Insulinpumpentherapie<br />
zu gewährleisten.<br />
Dabei werden über einen im<br />
Unterhautfettgewebe einliegenden<br />
Sensor in Abständen von 5 Minuten<br />
Glukosewerte bestimmt.<br />
Wir beschreiben eine Fallserie von<br />
8 Patienten (14-42J) mit CF und<br />
pathologischem oralem Glukosetoleranztest.<br />
Die Patienten führten<br />
eine CGMS-Messung (Messdauer:<br />
48-72 Stunden; CGMS® System<br />
GoldTM, Medtronic) unter Beibehaltung<br />
der individuellen Ernährungsgewohnheiten<br />
in häuslicher<br />
Umgebung vor und nach Beginn<br />
der antidiabetischen Therapie<br />
durch. Es erfolgten täglich 3 kapilläre<br />
Blutzuckermessungen zur<br />
Kalibrierung des CGMS.<br />
Die Ergebnisse des Glukose-Monitorings<br />
mittels CGMS haben zu<br />
unterschiedlichen therapeutischen<br />
Entscheidungen geführt. 2 Patienten<br />
mit DM und pathologischer<br />
Nüchternglukose (PNG) erhielten<br />
eine Insulintherapie, 3 Patienten<br />
mit DM ohne PNG erhielten eine<br />
Therapie mit Repaglinide, 1 Patient<br />
mit DM und PNG erhielt Repaglinide<br />
und 2 Pat. ohne PNG keine<br />
antidiabetische Therapie. Technischen<br />
Komplikationen traten während<br />
der Anwendung des CGMS<br />
nicht auf, sportliche Aktivitäten<br />
außer z.B. Schwimmen konnten<br />
während der Messung unverändert<br />
fortgeführt werden. Die per CGMS<br />
ermittelten Glukosewerte zeigten<br />
für jeden Patienten Anzahl und<br />
Ausprägung von Hyperglykämien<br />
(BZ>160mg/dl; AUC<br />
(BZ>160mg/dl*d) während des<br />
Messzeitraums. Es wurden Hypo-<br />
und Hyperglykämien unter antidiabetischer<br />
Therapie erfasst und die<br />
Therapie entsprechend modifiziert.<br />
Vorteile des Glukosemonitorings<br />
mittels CGMS gegenüber einem<br />
Blutzuckertagesprofil sind die reduzierte<br />
Zahl notwendiger kapillärer<br />
Blutzuckermessungen (3 vs.<br />
mind. 7) und die detailliertere Erfassung<br />
von Hypo- und Hyperglykämien.<br />
Die Auswertung der<br />
CGMS-Glukosewerte ist hilfreich<br />
hinsichtlich der Fragestellung, ob<br />
eine path. GT unter Beibehaltung
der individuellen Ernährungsgewohnheiten<br />
zu relevanten<br />
postprandialen Hyperglykämien<br />
führt und eine antidiabetische The-<br />
rapie einzuleiten ist. Nachteile sind<br />
eine gewisse Einschränkung sportlicher<br />
Betätigungen und eine mögliche<br />
Stigmatisierung durch das<br />
- 19 -<br />
kleine aber i.A. sichtbare CGMS<br />
während des Messzeitraums.<br />
Die Oberflächenexpression von TLR-4 ist bei CF Bronchialepithelzellen reduziert<br />
Hauptautor: Gerrit John , Marburg<br />
Weitere Autoren: Bruce K. Rubin, Dieter C. Gruenert, Markus O. Henke<br />
Die Epithelzellen der Atemwege<br />
sind Teil der angeborenen Immunität<br />
des Organismus und tragen<br />
zur Entzündungsreaktion der Lunge<br />
bei, insbesondere durch die<br />
Aktivierung von Toll-like Rezeptoren<br />
(TLR) und ihrer Signalwege.<br />
Da CF-Atemwege unter einer chronischen<br />
Infektion mit Bakterien<br />
leiden, wird von einer intrinsisch<br />
dysregulierten Immunantwort in<br />
CF ausgegangen. Aus diesem<br />
Grund haben wir die TLR-4-Expression<br />
sowie das inflammatorische<br />
Profil in einer bronchialen CF-<br />
sowie der entsprechenden CFTRkorrigierten<br />
Zelllinie untersucht.<br />
Die bronchiale CF-Zelllinie<br />
CFBE41o-. FTR-Mutation ∆F5<strong>08</strong>/<br />
F5<strong>08</strong>) und ihr CFTR-korrigierter<br />
Gegenpart (Wildtyp-CFTR Plasmid-<br />
Transfektante) wurden für 14 Tage<br />
unter air-liquid interface (ALI)-<br />
Bedingungen kultiviert. Die Ober-<br />
flächenexpression von TLR-4 wurde<br />
durch Immunfluoreszenz und<br />
FACS-Analyse bestimmt. Die Sekretion<br />
von Interleukin (IL)-8 unter<br />
basalen Bedingungen und nach<br />
Stimulation mit LPS von Gramnegativen<br />
Bakterien wurde mittels<br />
ELISA analysiert. Zur Inhibition<br />
LPS-stimulierter Effekte wurden<br />
die Zellen vor den Versuchen entweder<br />
mit einem anti-TLR-4 Antikörper<br />
inkubiert oder mit spezifischer<br />
siRNA gegen TLR-4 mRNA<br />
transfiziert.<br />
Immunfluoreszenz und FACS-Analyse<br />
zeigten eine signifikant reduzierte<br />
Oberflächenexpression von<br />
TLR-4 in CFBE41o-, verglichen mit<br />
den CFTR-korrigierten Zellen<br />
(8.3±1.4% vs. 16.9±2.3%), während<br />
die basale und LPSstimulierte<br />
IL-8-Sekretion um den<br />
Faktor 2 bzw. 3 im Vergleich zu<br />
corrCFBE41o- verringert war. Die<br />
Inkubation mit einem spezifischen<br />
anti-TLR-4 Antikörper vor LPS<br />
führte nur in corrCFBE41o- zu einer<br />
signifikanten Abnahme der IL-<br />
8-Sekretion. Nach Transfektion<br />
von spezifischer siRNA gegen TLR-<br />
4 mRNA kam es in beiden Zelllinien<br />
zu einer signifikant reduzierten<br />
IL-8-Antwort auf LPS. In allen<br />
Versuchen zeigte die Kontrollplasmid-Zelllinie<br />
dfCFBE41o- ähnliche<br />
Ergebnisse wie CFBE41o-.<br />
Unsere Ergebnisse deuten daraufhin,<br />
dass der Verlust der CFTR-<br />
Funktion die Immunantwort in CF,<br />
möglicherweise durch die Veränderung<br />
der Expression von TLR-4 auf<br />
Epithelzellen, modifiziert. Dies<br />
könnte zur bakteriellen Besiedlung<br />
und CF-typischen Lungenerkrankung<br />
wesentlich beitragen, während<br />
die Korrektur des CFTR einen<br />
wichtigen Signalweg der angeborenen<br />
Immunität wiederherstellt.<br />
Posterwalk
Seltene Komplikationen von Sport bei <strong>Mukoviszidose</strong><br />
Hauptautor: Katharina Ruf, Würzburg<br />
Weiter Autoren: Helge Hebestreit, Würzburg<br />
Einleitung:<br />
Körperliche Aktivität und Sport<br />
spielen in der Therapie der <strong>Mukoviszidose</strong><br />
eine wichtige Rolle. Diese<br />
Studie erfasst die Prävalenz seltener<br />
Komplikationen bei überwachter<br />
körperlicher Belastung und<br />
sportlicher Aktivität.<br />
Methode:<br />
Zur Erfassung von sportassoziierten<br />
Komplikationen im<br />
Rahmen der ambulanten und stationären<br />
Betreuung wurde ein Fragebogen<br />
zu Komplikationen während<br />
Ergometrien und während<br />
stationärer Trainingstherapie an<br />
alle deutschen Einrichtungen incl.<br />
Rehabilitationskliniken verschickt.<br />
Insgesamt wurden für das Jahr<br />
2005 die Daten von 4<strong>10</strong>7 Patienten<br />
erfasst und retrospektiv analysiert.<br />
Weiterhin berichteten 219<br />
Patienten (Al-ter 2 – 65 Jahre,<br />
FEV1 20-125%) im Rahmen einer<br />
anonymen online-Umfrage über<br />
Komplikationen beim Sport.<br />
Ergebnisse:<br />
Bei 6<strong>10</strong> Ergometrien in 31 Einrichtungen<br />
wurden keine Komplikationen<br />
berichtet. Während einer stationären<br />
Trainingstherapie, an der<br />
674 Patienten an 33 Einrichtungen<br />
teilnahmen, entwickelten 4 Patienten<br />
eine Hypoglykämie, 1 Patient<br />
Herzrhythmusstörungen; außerdem<br />
verletzten sich 15 Patienten.<br />
Nicht beobachtet wurde ein Pneumothorax.<br />
129 von 222 Patienten (59%) gaben<br />
bei der online-Umfrage keine<br />
Probleme beim Sport an. Beschwerden<br />
im Sinne von Asthma<br />
bronchiale wurden von 53 (24%)<br />
der Patienten berichtet. <strong>10</strong> (4,5%)<br />
der Patienten hatten in der Vergangenheit<br />
einen belastungsinduzierten<br />
Pneumothorax, 4 (2%)<br />
eine Hämoptoe. Immerhin 2 Pati-<br />
Anämie bei erwachsenen <strong>Mukoviszidose</strong> (CF) –Patienten<br />
Hauptautor: Annette Sauer-Heilborn, Hannover<br />
Weitere Autoren: Bernhard Vaske, Tobias Welte, Thomas Köhnlein, Hannover<br />
Bei chronischen Lungenerkrankungen<br />
besteht häufig eine durch Hypoxie<br />
bedingte Polyglobulie. Bei<br />
CF-Patienten beobachtet man<br />
jedoch häufig eine Anämie.<br />
Methoden:<br />
Wir analysierten retrospektiv die<br />
Daten von Erwachsenen CF-<br />
Patienten, die sich im ersten Halbjahr<br />
2007 in unserer Ambulanz<br />
vorstellten. In die Untersuchung<br />
aufgenommen wurden Patienten,<br />
von denen Blutbild, Lungenfunktion<br />
sowie Blutgase aus unserer<br />
Klinik verfügbar waren und die<br />
keinen klinischen Anhalt für eine<br />
Blutung außer geringen Hämoptysen<br />
zeigten. Die Patienten wurden<br />
anhand des Blutbildes in zwei<br />
Gruppen eingeteilt (Hämoglobin<br />
CF-Ernährungswürfel ein neues Medium in der Ernährungsberatung<br />
Hauptautorin: Katrin Schlüter, Hannover<br />
Weiter Autoren: Annett Hofmann, Heidelberg, Suzanne van Dullemen, Frankfurt, Frank Hellmond,<br />
Wangen, und Julia Eisenblätter, Bern<br />
Die Ernährungsberatung bei <strong>Mukoviszidose</strong><br />
(CF) hat unter anderem<br />
die Aufgabe, Patienten in der praktischen<br />
Umsetzung einer hochkalorischen<br />
Ernährung zu schulen.<br />
Bisher konnte der Ernährungsberater,<br />
durch die Berechnung von<br />
Ernährungsprotokollen retrospektiv<br />
überprüfen, ob der Patient sich<br />
hochkalorisch ernährt. Daraufhin<br />
erfolgte ein Beratungsgespräch mit<br />
individuellen Optimierungsmöglichkeiten<br />
für den Patienten. Der<br />
Patient selber hatte keine Möglichkeit,<br />
seine hochkalorische Essensform<br />
täglich zu überprüfen.<br />
Eine Arbeitsgruppe von 5 Personen<br />
aus dem AK Ernährung der <strong>Mukoviszidose</strong><br />
e.V. hat dazu ein neues<br />
Beratungsmedium erarbeitet.<br />
Um gesunden Personen eine ausgewogene<br />
Ernährung didaktisch<br />
anschaulich zu erklären, steht den<br />
Ernährungsberatern das Portionsmodell<br />
der aid – Ernährungspyramide<br />
zur Verfügung (aid: Auswertungs-<br />
und Informationsdienst).<br />
Die Pyramide besteht aus Lebensmittelsymbolen<br />
unterschiedlicher<br />
Lebensmittelgruppen. Jedes Symbol<br />
soll eine gewisse Verzehrsmenge<br />
eines Lebensmittels am Tag<br />
zeigen. So sichern 6 Getränkesymbole,<br />
5 Getreidesymbole, 3<br />
Milch- und Milchprodukt Symbole,<br />
1 Fleisch-Fisch-Ei Symbol, 2 Fettsymbole<br />
und 1 Süßigkeitensymbol<br />
die täglich optimale Energie- und<br />
Nährstoffversorgung.<br />
Die Arbeitsgruppe des AK Ernährung<br />
hat dieses Portionsmodell<br />
gesunder Personen für Patienten<br />
mit CF und erhöhtem Energiebedarf<br />
optimiert. Die Lebensmittelportionen<br />
wurden neu berechnet<br />
und die Menge der Symbole verändert.<br />
Die Getränkesymbole wurden<br />
auf <strong>10</strong> erhöht, damit der Empfehlung<br />
einer ausreichenden<br />
Trinkmenge gerecht wird. Die<br />
Symbole der Milchprodukte wurden<br />
auf 4 angehoben. Die oft knappe<br />
Calciumversorgung kann damit<br />
gesichert werden. Das Fleisch-<br />
- 21 -<br />
Fisch-Ei Symbol wurde auf 2 und<br />
die Fettsymbole wurden auf 4 angehoben.<br />
Die Fettsymbole werden<br />
als Ölflasche und Butter dargestellt,<br />
damit soll eine gute Fettsäurezusammensetzung<br />
gezeigt werden.<br />
Aus dem Dreieck der Pyramide<br />
wurde dadurch ein Quadrat, 6<br />
Tage (Quadrate) ergeben einen<br />
Würfel. Eine Energiezufuhr von<br />
130 % der altersentsprechenden<br />
Norm kann mit diesem didaktischen<br />
Modell erreicht werden.<br />
Der Patient wird durch den Ernährungsberater<br />
in der Anwendung<br />
des CF-Ernährungswürfels geschult<br />
und kann anschließend verzehrte<br />
Lebensmittelportionen im Modell<br />
abstreichen. So kann er seine tägliche<br />
Ernährung selbst, ohne Berechnungen<br />
überprüfen. Die Eigenverantwortlichkeit<br />
für das Essen<br />
wird damit unterstützt. Parallel<br />
dazu kann die restliche Familie das<br />
Portionsmodell für gesunde Personen<br />
verwenden.<br />
Resistenzverhalten bedeutender gramnegativer Bakterien aus den Atemwegsmaterialien<br />
von <strong>Mukoviszidose</strong> Patienten während eines <strong>10</strong>-jährigen Zeitraums<br />
Hauptautorin: Nadine Theimann, Münster<br />
Weitre Autoren: Barbara Ritzerfeld, Georg Peters und Dr. Barbara C. Kahl, Münster<br />
In einer retrospektiven Untersuchung<br />
wurde das Resistenzverhalten<br />
bedeutender gramnegativer<br />
Bakterien, die aus den respiratorischen<br />
Materialien von <strong>Mukoviszidose</strong><br />
Patienten isoliert wurden,<br />
gegen sieben Antibiotika über einen<br />
Zeitraum von <strong>10</strong> Jahren analysiert<br />
(1997-2006). Die Resistenztestung<br />
wurde mittels Agardiffusion<br />
durchgeführt. Zu den untersuchten<br />
Bakterien gehörten Pseudomonas<br />
aeruginosa mit normalem<br />
Phänotyp, n=2667, P. aeruginsa<br />
mit mukoidem Phänotyp,<br />
n=13<strong>08</strong>, P. aeruginosa mit small<br />
colony variant Phänotyp, n=<strong>10</strong>2,<br />
Stenotrophomonas maltophilia,<br />
n=481, Alcaligenes xylosoxidans,<br />
n=69, und Alcaligenes faecalis,<br />
n=12. Es wurden insgesamt die<br />
Resistenzergebnisse von 4639<br />
Isolaten aus diesem Zeitraum untersucht.<br />
Es wurde das Resistenzverhalten<br />
gegenüber Colistin,<br />
Tobramycin, Ciprofloxacin, Ceftazidim,<br />
Piperacillin/Tazobactam, Imipinem<br />
und Meropenem untersucht.<br />
Die besten Ergebnisse bzgl. einer<br />
Resistenz zeigte Colistin. Nur 2%<br />
aller Erreger insgesamt wies eine<br />
Resistenz gegen Colistin auf. Gegen<br />
Ciprofloxacin waren 6% der<br />
Erreger resistent, gegen Tobramycin<br />
16%, gegen Ceftazidim 18%,<br />
gegen Tazobactam <strong>23</strong>%, gegen<br />
Meropenem 25% und gegen Imipinem<br />
31% aller untersuchten Erreger.<br />
46 der Isolate waren gegenüber<br />
allen untersuchten Antibiotika<br />
resistent mit Ausnahme von Colistin<br />
(11 P. aeruginosa, 35 S. maltophilia).<br />
27 Isolate waren gegenüber<br />
sämtlichen untersuchten Antibiotika<br />
resistent (1 P. aeruginosa,<br />
26 S. maltophilia). P. aeruginosa<br />
SCVs waren zumeist resistenter als<br />
P. aeruginosa mit normalem Phänotyp,<br />
während der mukoide P.<br />
aeruginosa in der Regel noch empfindlicher<br />
war als der P. aeruginosa<br />
mit normalem Phänotyp.<br />
Posterwalk
Einfluss von Taurin und Ursodeoxycholsäure auf den Gallensäurenmetabolismus<br />
bei Patienten mit Zystischer Fibrose<br />
Hauptautor: Jochen Schneider, Jena<br />
Weitere Autoren: Astrid Barth, Eberhardt Kauf, Sabine Dornaus und Jochen Mainz, Jena<br />
Die Beachtung hepatobiliärer<br />
Komplikationen bei <strong>Mukoviszidose</strong><br />
gewinnt mit zunehmender Lebenserwartung<br />
der Patienten erheblich<br />
an Wichtigkeit. Insgesamt weisen<br />
mehr als 30% der Patienten eine<br />
hepatobiliäre Problematik auf. Mit<br />
2,5% stellt sie die wichtigste<br />
nichtpulmonale Todesursache bei<br />
CF dar. Sowohl die Diagnostik als<br />
auch die Behandlung der Leberbeteiligung<br />
bei CF gestaltet sich derzeit<br />
schwierig, da bisher keine<br />
etablierten sensitiven Methoden<br />
zum Screening und zur Verlaufskontrolle<br />
vorliegen.<br />
Die Analyse der Gallensäuren (GS)<br />
im Nüchtern-Serum mittels der<br />
Hochdruckflüssigkeits-Chromatographie<br />
ermöglicht einen Rückschluss<br />
sowohl auf die Synthese<br />
als auch auf den enterohepatischen<br />
Kreislauf und somit die Exkretionsfunktion<br />
der Leber.<br />
Im Rahmen einer Querschnittsuntersuchung<br />
wurde das GS-Profil<br />
von 47 CF-Patienten des CF-<br />
Zentrums Jena mit denen von Kontrollprobanden<br />
verglichen.<br />
In einer anschließenden Interventionsstudie<br />
erhielten 25 CF-<br />
Patienten über 1<strong>23</strong> (SD±44) Tage<br />
eine Taurin-Supplementierung mit<br />
20-30mg/kg/Tag.<br />
Es wurde untersucht, ob eine erhöhte<br />
Taurinkonjugation der GS<br />
unter Tauringabe erzielt wird und<br />
inwieweit dies einen positiven Einfluss<br />
auf das GS-Profil bei CF hat.<br />
Des Weiteren wurde bei 45 CF-<br />
Patienten mit normwertigen oder<br />
erhöhten Gesamt-GS (≤ bzw.<br />
>3000 nmol/l) die beschriebenen<br />
positiven klinischen und biochemischen<br />
Wirkungen der Ursodeoxycholsäure<br />
(UDCA, 20 mg/kg) anhand<br />
der Serum-GS beurteilt.<br />
Bei CF-Patienten liegen im Mittelwert<br />
niedrigere taurinkonjugierte<br />
GS vor (p
CMV-Infektion bei einer 33-jährigen Patientin mit <strong>Mukoviszidose</strong><br />
Hauptautor: Andrea Jobst, Berlin<br />
Weitere Autoren: Michael Barker, Ullrich Wahn, Doris Staab, Berlin<br />
Hintergrund:<br />
Infektionen mit dem Cytomegalievirus<br />
(CMV) sind bei immunkompetenten<br />
Patienten mit Cystischer<br />
Fibrose (CF) nicht vorbeschrieben.<br />
Die primäre CMV-Infektion ist in<br />
der Regel asymptomatisch. Treten<br />
jedoch Symptome auf, ähneln<br />
diese der Mononukleose. Schwere<br />
Verläufe der CMV-Infektion werden<br />
v.a. bei immunsupprimierten Patienten<br />
(z.B. nach Organtransplantation,<br />
als eine gefürchtete Komplikation<br />
und Hauptgrund für die<br />
Fehlfunktion eines transplantierten<br />
Organs) und bei intrauteriner<br />
Übertragung beobachtet. Die Bedeutung<br />
viraler Infektionen bei<br />
Patienten mit CF liegt in der Störung<br />
der Integrität und Funktion<br />
der respiratorischen Schleimhaut<br />
und somit in der Gefahr einer Exacerbation<br />
einer in der Regel bestehender<br />
chronischen pulmonalen<br />
bakteriellen Besiedelung. Das CMV<br />
kann im Blut, Urin, Gewebe und<br />
praktisch allen Sekretflüssigkeiten<br />
von Infizierten nachgewiesen werden.<br />
Therapie und Verlauf: Eine 33jährige<br />
Patientin mit CF und chronischer<br />
Pseudomonasbesiedlung<br />
wurde wegen pulmonaler Exazerbation<br />
zur intravenösen Antibiotikatherapie<br />
stationär aufgenommen.<br />
Bei Aufnahme zeigten sich<br />
Leukozyten von 5/nl und ein CrP<br />
von 6,9mg/dl. Nach 5-tägiger intravenöser<br />
Gabe von Tazobactam<br />
und Meropenem besserte sich der<br />
Allgemeinzustand nicht und es<br />
bestanden weiterhin Fieber und<br />
O 2-Bedürftigkeit. Im Vergleich zum<br />
Vorbefund zeigte sich ein deutlicher<br />
Abfall der FEV1 von 30% auf<br />
<strong>23</strong>%. Die Therapie wurde daraufhin<br />
auf Meropenem und Fosfomycin<br />
gewechselt und eine systemische<br />
Steroidtherapie eingeleitet.<br />
Zu diesem Zeitpunkt wurde ein<br />
erhöhtes CMV-IgM bei negativem<br />
IgG sowie CMV-DNA im Plasma<br />
nachgewiesen. Wir begannen daraufhin<br />
wegen fehlendem Ansprechen<br />
auf o.g. Antibiotikaumstel-<br />
- <strong>23</strong> -<br />
lung eine Therapie mit Ganciclovir<br />
(2x500mg/die). Im Lymphozytenstimulationstest<br />
zeigte sich bei<br />
normalem IgG die Antigenantwort<br />
der T-Zellen deutlich erniedrigt.<br />
Unter dem neuen Therapieregime<br />
kam es zu einer Besserung der<br />
Symptomatik. Nach 8-wöchiger<br />
Therapie konnte im peripheren<br />
Blut keine CMV-DNA mehr nachwiesen<br />
werden.<br />
Diskussion:<br />
Wir berichten erstmalig über eine<br />
akute CMV-Infektion, die bei einer<br />
Patientin mit fortgeschrittener CF<br />
und Exazerbation einer Pseudomonaspneumonie<br />
auftrat. Ob die<br />
CMV-Infektion bei der eigentlich<br />
immunkompetenten Patienten<br />
durch einen primären T-Zelldefekt<br />
gefördert wurde, oder ob die T-<br />
Zell-Antwort durch die zeitgleich<br />
laufende Steroidtherapie kompromitiert<br />
wurde, muss im weiteren<br />
Verlauf durch erneute Lymphozytenstimulationstests<br />
untersucht<br />
werden.<br />
Beidseitige Hilusschwellung bei einem <strong>10</strong>jährigen Jungen mit Zystischer Fibrose:<br />
Erstmanifestation einer Akuten lymphoblastischen Leukämie. Fallbericht<br />
Hauptautor: Christian Dopfer, Jena<br />
Weitere Autoren: Jochen Mainz, R. Dopfer, D. Fuchs, HJ Mentzel, JF Beck<br />
Wir berichten über einen <strong>10</strong>jäh-igen<br />
Jungen mit Delta-F-5<strong>08</strong>-homozygoter<br />
Zystischer Fibrose, der<br />
sich mit vermehrtem Husten, Gewichtsabnahme<br />
und verminderter<br />
körperlicher Belastbarkeit ambulant<br />
in unserem CF-Zentrum vorstellte.<br />
Bei intermittierender Besiedlung der<br />
Atemwege mit nicht-mukoiden P.<br />
aeruginosa erfolgte wenige Wochen<br />
zuvor eine 14tägige P. aeruginosawirksame<br />
i.v.-Therapie. Der aktuelle<br />
Rachenabstrich ergab keinen erneuten<br />
P. aeruginosa.-Nachweis, die<br />
Röntgenaufnahme des Thorax zeigte<br />
eine beidseitige Hilusschwellung.<br />
Unter Annahme einer infektiösen<br />
Genese wurde eine Therapie mit<br />
Clarithromycin eingeleitet, engmaschige<br />
Kontrollen wurden vereinbart.<br />
Nach zwei Wochen bestanden die<br />
Veränderungen des Röntgenbildes<br />
fort. Im Blutbild zeigten sich eine<br />
Anämie (Hb 6,1 mmol/l), Thrombozytopenie<br />
(96 Gpt/l), Lymphozytose<br />
(86%) und Granulozytopenie (4%),<br />
zusätzlich wurden 2% Blasten nachgewiesen.<br />
Die Knochenmarkpunktion<br />
führte zur Diagnose einer c-ALL,<br />
woraufhin umgehend eine Therapie<br />
nach Protokoll ALL-BFM 2000<br />
(amendment 01.07.2006) eingeleitet<br />
wurde. Der Patient zeigte ein sehr<br />
gutes Ansprechen mit kompletter<br />
Remission am Tag 33, allerdings<br />
traten im weiteren Verlauf relevante<br />
Komplikationen auf. Neben einer<br />
zytostatikabedingten Leberschädigung<br />
kam es zu einer Sinusvenenthrombose<br />
im Zusammenhang<br />
mit der Asparaginasebehandlung.<br />
Außerdem führten Steroide und die<br />
Immobilisation im Zusammenhang<br />
mit der zugrunde liegenden <strong>Mukoviszidose</strong><br />
zur schweren Osteoporose mit<br />
Wirbelkörper-Impressions-Frakturen.<br />
In der Folge bestand eine passagere,<br />
auf Schmerzattacken gerichtete phobische<br />
Angststörung. Unter Fortführung<br />
der mukoviszidose-spezifischen<br />
Dauertherapie, inklusive kontinuierlicher<br />
antibiotischer Inhalationen und<br />
wiederholten pseudomonaswirksamen<br />
i.v.-Antibiotikazyklen während<br />
immun-inkompetenter Phasen, wurde<br />
während des gesamten stationären<br />
Aufenthalts kein P. aeruginosa<br />
nachgewiesen. Nach Beendigung der<br />
intensiven stationären Therapiephase<br />
und Beginn der Erhaltungstherapie<br />
der akuten lymphoblastischen Leukämie,<br />
konnte die Familie in die<br />
vierwöchige familienorientierte Rehabilitation<br />
entlassen werden, wo<br />
sich der Zustand des Patienten insgesamt<br />
wieder auf das Niveau vor<br />
der akuten hämatologischen Erkrankung<br />
stabilisierte. Aktuell befindet er<br />
sich unter der zytostatischen Erhaltungstherapie<br />
in anhaltender Remission,<br />
ist körperlich voll belastbar bei<br />
wieder vollständig normwertigen<br />
Lungenfunktionsbefunden und weist<br />
auch jetzt keinen P. aeruginosa in<br />
den verschiedenen Atemwegssegmenten<br />
auf.<br />
Posterwalk
Vergleich der erwarteten Lungendosis bei einem Vernebler für adaptive Aerosolverabreichung<br />
gegenüber dem konventionellen Druckluftvernebler<br />
Hauptautor: Jens Stegemann, Heppenheim<br />
Weitere Autoren: S. Byrne, R.W. Potter und R.H.M. Hatley, Chichester (UK)<br />
Beim I-neb AAD-System (Respironics,<br />
Inc.) beträgt die Restmenge<br />
~ 0,05 ml und die Lungendeposition<br />
63%[1], verglichen mit einer<br />
Restmenge von ~ 1,5 ml und einer<br />
Lungendeposition von 47% beim<br />
konventionellen Vernebler<br />
(neb).[1]<br />
Wir haben einen In-Vitro-Test und<br />
ein auf veröffentlichten Daten zur<br />
Lungendeposition beruhendes Modell[1]<br />
verwendet, um die Dosis an<br />
Colistinmetamnatrium (CMS) und<br />
DNase I (DA), die über zwei Ver-<br />
Tabelle 1. Füllparameter für den Vernebler<br />
nebler-Systeme jeweils in die Lunge<br />
gelangt, festzustellen.<br />
Drei I-neb-Geräte (Einstellung auf<br />
Stufe 12, Ausstattung mit Arzneimittelbehältern<br />
ohne Maßeinteilung)<br />
und drei LC Plus (Pari GmbH,<br />
Starnberg) Vernebler mit Turbo-<br />
BOY-Kompressor (Pari GmbH)<br />
wurden mit einem Arzneimittel<br />
gefüllt (Abb. 1). Die Füllmengen<br />
der I-neb-Geräte wurden auf<br />
Grund von früher erhobenen, auf<br />
Salbutamol basierenden Daten<br />
gewählt (I-neb-Handbuch für<br />
Arzneimittel CMS DN<br />
Vernebler I-neb LC Plus I-neb LC Plus<br />
Arzneimittelkonzentration 1 MIU/1 ml 0.4 MIU/1 ml 1 kIU/1 ml 1 kIU/1 ml<br />
Füllmenge 0,4 ml 2,5 ml 0,6 ml 2,5 ml<br />
Eingefülltes Arzneimittel 0,4 MIU 1 MIU 0,6 kIU 2,5 kIU<br />
Tabelle 2. In vitro und Modell-Ergebnisse<br />
Arzneimittel CMS DN<br />
Vernebler I-neb LC Plus I-neb LC Plus<br />
Verabreichte Dosis 0,34 MIU<br />
0,43 MIU 0,46 kIU 0,74 kIU<br />
Erwartete Lungendosis 0,21 MIU 0,20 MIU 0,29 kIU 0,35 kIU<br />
- 24 -<br />
Krankenhausärzte) und entsprechend<br />
der Konzentration des Arzneimittels<br />
angepasst. Alle Vernebler<br />
wurden mit simulierter Atmung<br />
betrieben und verfügten<br />
über einen Leitungsfilter. Die verabreichte<br />
Dosis wurde für CSM<br />
mittels Bioassay ermittelt und für<br />
DA mittels Methylgrün-Assay. Die<br />
erwartete Lungendosis wurde mit<br />
Hilfe des Modells berechnet[1].<br />
Die Geräte beider Marken erbrachte für die erwartete Lungendosis vergleichbare Ergebnisse.<br />
Das I-neb AAD-System verabreicht im Vergleich zu einem konventionellen Druckluftvernebler bei sehr<br />
viel geringerem Füllvolumen eine vergleichbare Dosis an die Lunge.<br />
1] Williams K, et al. Pediatr Pulmonol. 2007;42(Suppl. 30):355-356.
Workshops<br />
Arbeitskreis Ernährung<br />
Mineralien und Spurenelemente bei CF<br />
Autor: Olaf Sommerburg, Heidelberg<br />
Mineralien und Spurenenlemente<br />
stellten lange Zeit ein eher vernachlässigtes<br />
Problem bei CF-<br />
Patienten dar, jedoch zeigt sich<br />
mehr und mehr die Wichtigkeit<br />
jedes dieser Elemente in Mangelsituationen.<br />
Kalzium spielt besonders<br />
im Zusammenhang mit der<br />
größer gewordenen Sensibilität<br />
bezüglich der hohen Prävalenz von<br />
Osteopenie und Osteoporose und<br />
dem erhöhten Frakturrisiko bei<br />
Kindern und Erwachsenen mit CF<br />
eine Rolle. Um die Skelettentwicklung<br />
zu garantieren, ist eine ausreichende<br />
Ca-Zufuhr, natürlich in<br />
Kombination mit der notwendigen<br />
Vitamin D Gabe, sicherzustellen.<br />
Zu einem Magnesium-Mangel kann<br />
es bei CF-Patienten nach längerfristiger<br />
Behandlung mit Aminoglykosiden<br />
kommen. Im Zusammenhang<br />
mit Entzündungen ist bei CF-<br />
Patienten oft auch ein Eisenmangel<br />
vorliegend. Dabei zeigt sich Ferritin<br />
als Akut-Phase-Protein eher als<br />
Arbeitskreis Physiotherapie<br />
schlechter Parameter zur Einschätzung<br />
des Eisenstatus. Der lösliche<br />
Transferrin-Rezeptor, leider in der<br />
Routine bisher kaum verfügbar, ist<br />
bei Entzündungsprozessen nicht<br />
beeinflusst und scheint deshalb ein<br />
sensitiver zur Einschätzung des<br />
Eisenstatus zu sein. Bis dieser<br />
Marker jedoch zur Verfügung<br />
steht, sollte die Transferrinsättigung<br />
als Verlaufsparameter für<br />
den Eisenstatus herangezogen<br />
werden. Bezüglich Zink konnte in<br />
mehreren Studien bei CF-Patienten<br />
ein erhöhter Verlust über den<br />
Stuhl und eine verminderte Absorption<br />
aus dem Darm gezeigt<br />
werden. Ein Zinkmangel ist schwer<br />
zu diagnostizieren, da dieser bestehen<br />
kann, auch wenn die Zink-<br />
Plasmawerte normal sind. Scheinbar<br />
scheinen aber erniedrigte<br />
Plasma-Werte der Vitamine A und<br />
E mit einem Zinkmangel zu korrelieren.<br />
Gedeiht ein Kind mit CF<br />
trotz aller therapeutischen Bemü-<br />
- 25 -<br />
hungen schlecht, so kann eine<br />
empirische Zink-Supplementation<br />
gerechtfertigt sein. In einigen südlichen<br />
Gegenden Deutschlands,<br />
aber auch in der Schweiz und Österreich<br />
scheint der Selenium-<br />
Mangel in der Bevölkerung allgemein,<br />
aber auch bei CF im Besonderen<br />
verbreitet zu sein. Eine Selenium-Substitution<br />
sollte aber<br />
trotzdem keine Routine sein, sondern<br />
muss mit Vorsicht vorgenommen<br />
werden, da der therapeutische<br />
Bereich sehr eng ist und<br />
toxische Dosen schnell erreicht<br />
sind. Die Supplementation von<br />
Natrium und Chlorid ist meist nur<br />
in Ausnahmesituationen, wie heißen<br />
klimatischen Bedingungen,<br />
notwendig. Auch erreichen gestillte<br />
Säuglinge oft nicht deren notwendige<br />
Aufnahmemengen und müssen<br />
daher zusätzlich supplementiert<br />
werden. Besonders wichtig ist<br />
dies bei vermehrtem Schwitzen<br />
aber auch Tachypnoe.<br />
Chronischer Husten und Beckenboden - Funktionelle Zusammenhänge<br />
Autorin: Gabriele Henschel, Hannover<br />
Funktionelle Zusammenhänge<br />
Starke Druckbelastungen durch<br />
teilweise jahrelanges Husten schädigen<br />
den Beckenboden. Daher ist<br />
gerade bei chronischen Erkrankungen<br />
der Atemwege die prophylaktische<br />
Beckenbodentherapie unter<br />
besonderer Berücksichtigung der<br />
Druckentlastung beim Husten<br />
schon im Kindes- und Jugendalter<br />
von großer Bedeutung. Eine dynamische<br />
aufrechte Körperhaltung<br />
ist die Basis für eine physiologische<br />
Druckverteilung und somit<br />
eine Senkungs- und Inkontinenzprophylaxe.<br />
Die Rekto-Uro-Genitalorgane ru-<br />
hen normalerweise im Unterbauch<br />
Beckenbodens und seiner bindegewebigen<br />
Anteile.<br />
in der so genannten abdominopelvinen<br />
Leibeshöhle (Richter 1985),<br />
stabilisiert von der Beckenbodenmuskulatur,<br />
indegewebigen Strukturen,<br />
dem Diaphragma pulmonale,<br />
der Bauchmuskulatur und der<br />
Wirbelsäule. Eine intraabdominale<br />
Druckerhöhung, z.B. beim Husten<br />
oder Niesen, entsteht durch die<br />
kombinierte Aktivität von Zwerchfell,<br />
Bauchmuskeln und Beckenbodenmuskeln.<br />
Der beim Hustenstoß entstandene<br />
nach kaudal gerichtete Schwingungsdruck<br />
wird bei aufgerichteter<br />
Wirbelsäule von der Bauchmuskulatur,<br />
allen voran den<br />
m.transversus und der<br />
Die Atmung und der Beckenboden-<br />
Zwerchfell-Synergismus sind eingeschränkt<br />
(Sapsford et al.2001)<br />
mm.multifidii, aufgefangen, und in<br />
der Körpermitte verarbeitet ohne<br />
den Beckenboden unnötig zu belasten.<br />
Lediglich ein Teil der Druckschwingung<br />
erreicht weiterlaufend den<br />
Beckenboden und stimuliert die<br />
dehnungsreaktive, kontinenzsichernde<br />
Kontraktion des Diaphragma<br />
pelvis (Trampolinaktivität).<br />
Insuffiziente Bauch-; Rücken- und<br />
Beckenbodenmuskulatur erzeugt<br />
keinen intraabdominalen Gegendruck<br />
und die Kraft z.B. eines<br />
Hustenstoßes wird direkt nach<br />
kaudal gelenkt. Dies führt zu einer<br />
zusätzlichen Belastung des<br />
Die physiotherapeutische Behandlung<br />
beinhaltet u.a. folgende<br />
Schwerpunkte:<br />
Workshops
- Wahrnehmungsschulung des<br />
Beckenbodens mit Hilfsmitteln,<br />
Fantasiebildern<br />
- Erarbeitung der aufrechten<br />
Körperhaltung<br />
- druckentlastendes Husten<br />
Psychosoziales Forum<br />
Bericht über den europäischen Kongress in Prag<br />
Autor: Gerald Ullrich, Hannover<br />
Gewissermaßen als "Blitzlicht" zum<br />
zurückliegenden eurpoäischen CF-<br />
Kongress in Prag sowie als thematische<br />
Übersicht über Veröffentlichungen<br />
aus dem zurückliegenden<br />
Jahr soll angedeutet werden, wie<br />
psychosoziale Themen in der internationalen<br />
Diskussion abgebildet<br />
und aufgegriffen werden. Dies<br />
- Training der Beckenbodenmuskulatur<br />
und aller stabilisierenden<br />
Muskelgruppen<br />
- Alltagsgerechtes Einbeziehung<br />
des Beckenboden<br />
kann naturgemäß in der vorgegebenen<br />
Zeit bloß den Charakter<br />
einer Übersicht in Stichworten<br />
haben. Ausführlichere schriftliche<br />
Zusammenfassungen sowohl zum<br />
eurpoäischen CF-Kongress als<br />
auch zu neuen psychosozialen<br />
Veröffentlichungen (hier jeweils als<br />
Halbjahresübersichten) sind als<br />
Mitgliederversammlung<br />
Forschungsgemeinschaft <strong>Mukoviszidose</strong> (FGM)<br />
DFG-Nachwuchsakademie Klinische Studien<br />
Autor: Dr. Frank Wissing, Bonn<br />
Wichtigste Ziele der Planung und<br />
Durchführung klinischer Studien<br />
sind nicht nur die Klärung drängender<br />
pathophysiologischer, epidemiologischer<br />
und diagnostischer<br />
Fragestellungen, sondern auch die<br />
Schaffung einer validen, evidenzbasierten<br />
Basis zur Einführung<br />
oder Änderung einer Therapieform<br />
oder von innovativen Medikamenten<br />
in die klinische Praxis. Die DFG<br />
hat in Zusammenarbeit mit dem<br />
Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung (BMBF) auf eine Reihe<br />
bestehender Defizite im Bereich<br />
klinische Studien reagiert, insbesondere<br />
durch die Initiation des<br />
Sonderprogramms Klinische Studien,<br />
welches seit 2005 mehr als<br />
60 durch Wissenschaftlerinnen und<br />
Wissenschaftler initiierte klinische<br />
Multicenterstudien zu den verschiedensten<br />
Fragestellungen fördert.<br />
Da die Art der Studien in der<br />
Regel an die klinische Problematik<br />
angepasst werden muss, wird<br />
durch die Förderinstitutionen bewusst<br />
ein möglichst breites Spektrum<br />
an kontrollierten und multizentrischen<br />
klinischen Studien<br />
abgedeckt.<br />
Die Erfahrungen in dem Programm<br />
„Klinische Studien“ haben gezeigt,<br />
dass oftmals die Umsetzung einer<br />
durchaus spannenden Projektidee<br />
in eine wissenschaftliche Fragestellung,<br />
die anhand eines fundierten<br />
Studienkonzepts klar beantwortet<br />
werden kann, eine wesentliche<br />
Hürde darstellt. Um hier frühzeitig<br />
Unterstützung zu bieten, hat die<br />
DFG eine Nachwuchsakademie<br />
zum Thema „Klinische Studien“<br />
ausgeschrieben. Diese wurde im<br />
Mai 20<strong>08</strong> unter der Leitung von<br />
Prof. Ulf Müller-Ladner durchgeführt.<br />
Mit ihr sollen interessierte<br />
junge Wissenschaftlerinnen und<br />
Wissenschaftler aus den klinischen<br />
und biometrischen Bereichen möglichst<br />
frühzeitig für patientennahe<br />
klinische Forschungsfragen gewonnen<br />
werden. Dabei soll diese<br />
Akademie medizinische Nachwuchswissenschaftlerinnen<br />
und<br />
Nachwuchswissenschaftler gezielt<br />
bei der Umsetzung ihrer sich aus<br />
der klinischen Arbeit ergebenden<br />
Ideen in wissenschaftlich hochwertige<br />
klinische Studien unterstützen.<br />
Von den 115 Bewerbern wurden 22<br />
ausgewählt, die in einer ersten<br />
Phase an einer Veranstaltung in<br />
Bad Nauheim teilgenommen haben,<br />
die Vorträge, Seminare,<br />
Workshops und Exkursionen bein-<br />
- 26 -<br />
In dem geplanten Kongress-<br />
Workshop möchte ich einen Einblick<br />
in die physiotherapeutische<br />
Behandlungsweise mit den Patienten<br />
und Anregungen zur Wahrnehmung<br />
und Druckentlastung des<br />
Beckenbodens beim Husten geben.<br />
Service für CF-Ambulanzen über<br />
die Firma Asche Chiese erhältlich,<br />
das heißt auf dem Kongress in<br />
Würzburg am Stand zu bekommen<br />
oder aber schriftlich anzufordern<br />
(über den Produktmanager, Herrn<br />
Timm: sven.timm@asche-chiesi.de.<br />
haltete. Die Teilnehmenden stellten<br />
dort ihre Projektideen vor und<br />
setzten sich mit fachlichen Themen<br />
und Fragen zu klinischen Studien<br />
auseinander. Renommierte Experten<br />
aus dem In- und Ausland gaben<br />
in Vorträgen und Diskussionen<br />
Einblick in den aktuellen Stand der<br />
Forschung, in Arbeitssitzungen<br />
wurden gemeinsame Lösungen zu<br />
verschiedenen Themen erarbeitet,<br />
und die im Laufe der Woche überarbeiteten<br />
Projektskizzen der Teilnehmenden<br />
wurden abschließend<br />
vorgestellt und im Expertenkreis<br />
diskutiert.<br />
Als zweite Phase können zum<br />
Herbst 20<strong>08</strong> Anträge der Teilnehmenden<br />
bei der DFG eingereicht<br />
werden. Diese beinhalten eine<br />
Anschubfinanzierung von 50 000<br />
Euro für ein Jahr. Diese Mittel können<br />
zur Durchführung von Vorarbeiten,<br />
Pilotstudien oder zur Freistellung<br />
von der Patientenversorgung<br />
genutzt werden. Dies soll die<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
schließlich in die Lage versetzen,<br />
aufbauend auf fundierten Vorarbeiten<br />
Anträge im Normalverfahren<br />
der DFG oder im Programm Klinische<br />
Studien einzureichen.
Frühstücksrunden<br />
Frühstücksrunde 2<br />
Qualitätssicherung durch Dokumentation<br />
Hauptautor: Kathrin Könecke, Hannover<br />
Diese Frühstücksrunde wendet sich<br />
vornehmlich an Physiotherapeuten.<br />
Wie kann es gelingen die vorhandene<br />
Qualität in der Physiotherapie-Behandlung<br />
sichtbar zu machen?<br />
Wie kann die Physiotherapie<br />
so dokumentiert werden, dass<br />
auch das übrige CF-Team erken-<br />
nen kann, was genau in der Physiotherapie-Behandlung<br />
geleistet<br />
wird und wie die Umsetzung einer<br />
befundorientierten Physiotherapie<br />
optimal gelingt?<br />
Was hilft dem Patienten wie? Die<br />
Physiotherapie therapiert (nach<br />
Befunderhebung) auf den Punkt;<br />
- 27 -<br />
die Dokumentation der Behandlungserfolge<br />
zeigt oft Lücken auf.<br />
In dieser Frühstücksrunde soll über<br />
die Möglichkeiten, Grenzen und<br />
Aussichten der Dokumentation<br />
bzw. der Behandlungsqualität in<br />
der Physiotherapie diskutiert werden.<br />
Frühstücksruden
Seminare<br />
Seminar 1<br />
Motivation und Ambivalenz in der medizinischen Praxis<br />
Autorin: Maria Etzkorn, Trier<br />
Patienten werden in der medizinischen<br />
Praxis häufig als unmotiviert<br />
und nicht veränderungswillig<br />
wahrgenommen. Stein des Anstosses<br />
kann z.B. die Ernährungssituation<br />
sein, die Veränderungen im<br />
Alltag des Patienten erforderlich<br />
macht.<br />
Wie kommt es zu den oft passiven<br />
Widerständen im Beratungsgespräch?<br />
Die psychologische Forschung geht<br />
bei der Frage der Veränderungsmotivation<br />
nicht von unmotivierten<br />
sondern von ambivalenten Patienten<br />
aus. Jede Entscheidung für<br />
eine gesundheitsbezogene Verhaltensänderung<br />
birgt auch zahlreiche<br />
Gründe, die dagegen sprechen,<br />
sich zu verändern. Umgekehrt<br />
liegen Pro-Argumente im Patienten<br />
selber begründet und er kann für<br />
sich selbst der beste Fürsprecher<br />
sein (intrinsische Motivation). Die-<br />
se Argumente zu stärken, ist Ziel<br />
einer klientenzentrierten Beratung.<br />
Die persönliche Wertigkeit (importance)<br />
sowie die Zuversicht, wie<br />
gut ein Ziel erreicht werden könnte<br />
(confidence), tragen zur Festlegung<br />
von Veränderungszielen bei.<br />
Veränderung als psychodynamischer<br />
Prozess erfolgt nach Prochaska<br />
und DiClemente in sechs<br />
Stufen, die alle Phasen von fehlendem<br />
Problembewusstsein bis hin<br />
zu Rückfallmanagement beschreiben<br />
(Transtheoretisches Modell).<br />
Diesem Modell zufolge wird erst<br />
auf der dritten Stufe über das Ziel<br />
entschieden und Wege, dies zu<br />
erreichen, geplant. Beratungsgespräche<br />
finden sehr oft früher<br />
statt, z.B. wenn der Patient entweder<br />
noch gar kein Problembewusstsein<br />
hat oder er das Problem<br />
zwar wahrgenommen, aber ambivalent<br />
bezüglich der Veränderung<br />
Kommunikationstechnik und „Werkzeuge“<br />
Autor: Gerald Ullrich, Hannover<br />
Bei der motivierenden Gesprächsführung<br />
(motivational interviewing,<br />
MI) handelt es sich nicht um eine<br />
neue Therapiemethode, sondern<br />
um eine Haltung und um eine Gesprächstechnik,<br />
die sich auf die<br />
spezifische Problematik von Entscheidungskonflikten<br />
bezogen auf<br />
persönliche Veränderungen bezieht.<br />
Charakteristisch für diesen<br />
Beratungsansatz ist die Vermei-<br />
dung direkter Einflussnahme bei<br />
gleichzeitig direktem Bezug auf<br />
den Entscheidungskonflikt.<br />
Angelehnt an das MI, das seinen<br />
Ursprung im Bereich der Betreuung<br />
Suchtkranker hat, gibt es eine<br />
Reihe verwandter Gesprächstechniken,<br />
die sich insbesondere in der<br />
Arbeit mit chronisch kranken Patienten<br />
anbieten und klinisch bewährt<br />
haben. Sie sind in einem<br />
- 28 -<br />
ist (Stufe 2). Handlungsrelevante<br />
Informationen werden in diesem<br />
Zustand zwar oft vermittelt, der<br />
Patient kann dies aber sinnvoller<br />
Weise erst nach der Entscheidungsfindung,<br />
der Handlungsplanung<br />
und dem Ausprobieren im<br />
Alltag aufnehmen und versuchen<br />
umzusetzen (Stufe 3-5). Widerstand<br />
entsteht, wenn sich der Patient<br />
gedrängt fühlt zu Zielen, zu<br />
denen er noch nicht bereit ist.<br />
Gespräche mit den Patienten, die<br />
z.B. die Pros und Contras erforschen,<br />
sind zielführend, tragen zu<br />
einer stabilen therapeutischen<br />
Beziehung bei und helfen, Widerstände<br />
zu vermeiden. Die speziellen<br />
Gesprächstechniken dieses<br />
klientenzentrierten Ansatzes wird<br />
der nachfolgende Referent genauer<br />
darlegen.<br />
wichtigen Grundlagenwerk für den<br />
Kliniker zusammengestellt (Rollnick,<br />
Mason & Butler [1999] Health<br />
behavior change. Churchill Livingstone<br />
Verlag) und einzelne<br />
dieser Techniken werden Gegenstand<br />
des Vortrags sein, der zur<br />
weiterführenden Lektüre anregen<br />
soll.
Seminar 2<br />
Körperliche Aktivität und Sport im häuslichen Umfeld aus Sicht der Physiotherapie<br />
Autoren: Kathrin Könecke, Edemissen und Wolfgang Gruber, Nebel<br />
Physiotherapie & Sport sind zwei<br />
aktive (bewegliche) Therapieformen<br />
in der Behandlung von Patienten<br />
mit <strong>Mukoviszidose</strong>, die sich<br />
optimal ergänzen. Insbesondere im<br />
häuslichen Umfeld des Patienten<br />
werden Sport und Physiotherapie,<br />
auch aus Gründen der Zeitersparnis,<br />
gerne verquickt.<br />
Grundlage für ein effektives Sportprogramm<br />
bzw. für sportliche Aktivitäten<br />
zu hause ist ein gutes<br />
Grundwissen und zeitoptimierte<br />
Durchführung von Physiotherapie.<br />
Seminar 3a<br />
Problemkeime<br />
Moderation: Doris Staab, Berlin<br />
Wichtig ist es dabei für den Patienten<br />
zu erlernen, wann er wie von<br />
welcher Therapieform mehr bzw.<br />
weniger profitiert und wann er zu<br />
welchen Zeiten (z.B. Infekte etc.)<br />
mehr Physiotherapie benötigt. Zu<br />
diesem umfangreichen Themenkomplex<br />
schult der gut ausgebildete<br />
Physiotherapeut seinen Patienten<br />
im Hinblick auf Wissen und<br />
Umsetzung.<br />
Der Einsatz von zeitoptimierter<br />
und befundorientierter Physiotherapie<br />
und von Sport wird insbe-<br />
- 29 -<br />
sondere im häuslichen Umfeld<br />
durch die richtige Führung, nämlich<br />
durch einen so genannten<br />
persönlichen Trainer (= die ambulante<br />
Physiotherapeutin / der ambulante<br />
Physiotherapeut) umgesetzt<br />
bzw. gewährleistet.<br />
In diesem Seminar geht es darum,<br />
wie man im häuslichen Umfeld die<br />
Forderungen nach mehr Sport und<br />
Physiotherapie effektiv gestalten<br />
und umsetzen kann.<br />
Interaktive Falldarstellung: 35 jährige CF Patientin mit unklaren bilateralen Infiltraten<br />
Hauptautor: Carsten Schwarz , Berlin<br />
Weitere Autoren: Ulrich Wahn, Michael Barker, Doris Staab, Berlin<br />
Eine 35 jährige Patientin präsentierte<br />
sich mit einer prolongierten<br />
Infektsymptomatik, rechtsseitigen<br />
thorakalen Schmerzen und geringen<br />
Hämoptysen. Unter der intravenösen<br />
Antibiotikatherapie mit<br />
Ceftazidim und Tobramycin konnte<br />
keine signifikante Besserung erzielt<br />
werden. Die intravenöse Therapie<br />
mit Fosfomycin und Aztreonam<br />
blieb ebenfalls ohne den erwünschten<br />
Erfolg. Das Labor ergab keine<br />
signifikant erhöhten Infektparameter.<br />
Im HR-CT zeigten sich beidseitige<br />
Infiltrate mit größter Ausprägung<br />
in der Unterlappenspitze links<br />
und in S2 rechts. Eine flexible<br />
Bronchoskopie in Lokalanästhesie<br />
mit einer bronchoalveolären Lavage<br />
aus S6 links erfolgte. Hierbei<br />
fanden sich 99% Granulozyten und<br />
1% Makrophagen. Mikrobiologisch<br />
wurden massenhaft Pseudomonas<br />
aeruginosa und massenhaft Scedosporium<br />
apiospermum nachgewiesen.<br />
Mykobakterien (tuberkulös<br />
und nicht-tuberkulös) konnten<br />
kulturell ausgeschlossen werden.<br />
Die PCR auf Nokardien und Pneumocystic<br />
jiroveci waren ebenfalls<br />
negativ.<br />
Die CF wurde im Alter von 13 Jahren<br />
mittels pathologischem<br />
Schweißtest diagnostiziert. Der<br />
Genotyp konnte im Kindesalter<br />
nicht festgestellt werden. 2006<br />
erfolgte eine erneute Untersuchung<br />
der Genetik und ergab den<br />
Genotyp R347P/<strong>10</strong>78delT. Seit<br />
dem 13. Lebensjahr ist eine chronische<br />
Pseudomonasbesiedlung<br />
vorhanden. Neben der pulmonalen<br />
Manifestation besteht eine exokrine<br />
Pankreasinsuffizienz. In den<br />
letzten Jahren waren aufgrund von<br />
pulmonalen Exacerbationen routinemäßig<br />
ca. zwei intravenöse Antibiotikatherapien<br />
jährlich durchgeführt<br />
worden. Die Basistherapie<br />
besteht aus Inhalationstherapie<br />
mit NaCl 5,85% mit Sultanol, Dornase<br />
alfa, Tobramycin, Einnahme<br />
von Pankreasenzymen, Azithromycin<br />
und Vitaminen.<br />
Mikrobiologisch nachgewiesene<br />
bakterielle Keime wie zum Beispiel<br />
der Pseudomonas aeroginosa stellen<br />
im Rahmen von pulmonalen<br />
Exacerbationen eine eindeutige<br />
Therapieindikation dar. Inwieweit<br />
der Nachweis von Pilzen eine antimykotische<br />
Therapie impliziert, ist<br />
bis heute nicht eindeutig geklärt.<br />
Interaktive Fragen:<br />
Hätten Sie auch die Patientin aufgrund<br />
des Nachweises von Scedosporium<br />
apiospermum behandelt?<br />
Wenn ja, wie lange sollte der Pilz<br />
behandelt werden und mit welchen<br />
Medikamenten?<br />
Welche Verlaufsparameter würden<br />
Sie zur Beurteilung des Therapieerfolges<br />
heranziehen?<br />
Seminare
Schimmelpilze der Gattung Scedosporium bzw. Pseudallescheria bei CF-Patienten<br />
Autor: Kathrin Tintelnot, Berlin<br />
Schimmelpilze des Pseudallescheria<br />
boydii-Komplexes und der verwandten<br />
Art Scedosporium prolificans<br />
sind opportunistische Mykose-Erreger,<br />
die bei entsprechender<br />
Immunsuppression oder posttraumatisch<br />
zu lebensbedrohlichen<br />
Infektionen führen können. Sie<br />
werden mit zunehmendem Lebensalter<br />
und laut ersten Erhebungen<br />
bei 3 - 9% der CF-Patienten<br />
im Respirationstrakt nachgewiesen.<br />
Bislang wurde die klinische<br />
Relevanz dieser Pilze für CF-<br />
Patienten eher gering eingeschätzt;<br />
dennoch nehmen Einzelfallberichte<br />
über den Nachweis von<br />
Scedosporium in Zusammenhang<br />
mit therapierefraktärer Bronchitis,<br />
als Erreger einer Spondylitis oder<br />
einer letalen Infektion nach Lungen-Transplantation<br />
zu. Umstritten<br />
ist, ob eine Besiedlung eine Kontraindikation<br />
zur Lungen-<br />
Transplantation darstellt.<br />
Standorte von Scedosporium-Arten<br />
in der Natur sind in erster Linie<br />
vom Menschen belastete Gewässer<br />
und das Erdreich, das Habitat von<br />
Scedosporium prolificans ist weitgehend<br />
unbekannt. Auffallend ist,<br />
dass diese Organismen selten in<br />
der Raumluft nachgewiesen werden<br />
können. Dem Pseudallescheria<br />
boydii-Komplex gehören 5 Arten<br />
an. Eine exakte Identifizierung<br />
dieser Pilze ist wichtig aufgrund<br />
ihrer eingeschränkten Empfindlichkeit<br />
gegenüber antimykotisch wirksamen<br />
Substanzen. Die meisten<br />
- 30 -<br />
Isolate sind resistent gegenüber<br />
Amphotericin B, alle sind 5-<br />
Flucytosin resistent, eine Monotherapie<br />
ist in der Regel erfolglos.<br />
Bei Verdacht auf ein invasives Geschehen<br />
ist bei Erregern des Pseudallescheria<br />
boydii-Komplexes eine<br />
Kombination von Voriconazol oder<br />
Posaconazol mit Caspofungin, im<br />
Falle einer Scedosporium prolificans-Infektion<br />
die Kombination<br />
von Voriconazol mit Terbinafin<br />
Therapie der Wahl.<br />
Prospektive Untersuchungen zum<br />
Nachweis von Pseudallescheria /<br />
Scedosporium bei CF-Patienten<br />
sind ebenso erforderlich wie der<br />
Aufbau einer Sero-Diagnostik.
Freie Vorträge<br />
Versorgungsqualität: Wunschdenken und Realität<br />
Sozialoffensive - Die Realität verändern!<br />
Hauptautor: Horst von der Hardt, Burgwedel<br />
Weitere Autoren: Nadja Niemann und Paul Wenzlaff, Hannover<br />
Hintergrund:<br />
Die Qualitässicherung <strong>Mukoviszidose</strong><br />
belegt eine hochwertige Versorgung<br />
von CF-Patienten in Deutschland,<br />
zeigt aber auch, dass es eine Hochrisikogruppe<br />
von Patienten gibt, die<br />
über einen längeren Zeitraum eine<br />
anhaltend schlechte Lungenfunktion<br />
(FEV1
Orale Infektion mit Pseudomonas aeruginosa im Mausmodell<br />
Hauptautorin: Imke Glass, Hannover<br />
Weitere Autoren: Britta Gewecke, Peter Valentin-Weigand, Burkhard Tümmler, Ulrich Baumann;<br />
Hannover<br />
Hintergrund<br />
In klassischen Pseudomonas aeruginosa<br />
Infektionsmodellen bei der<br />
Maus wird mit einer einmaligen<br />
Hochdosisinokulation eine chronische<br />
Infektion angestrebt. Um die Effektivität<br />
eines Pseudomonas-Impfstoffs<br />
zu prüfen, wäre ein der klinischen<br />
Realität näher stehendes Niedrigdosisinfektionsmodell<br />
mit wiederholter<br />
Erregerexposition wünschenswert.<br />
Ziel<br />
Wir untersuchten ein orales P. aeruginosa<br />
Inokulationsmodell hinsichtlich<br />
seiner Eignung zur Untersuchung<br />
der mukosalen Impfprotektion. Dieses<br />
Modell wurde erstmals von Coleman<br />
et al.( 2003) beschrieben.<br />
Methoden<br />
C57/Bl/6/J Mäusen erhielten über<br />
2,4,6,8,<strong>10</strong> oder 13 Wochen kontinuierlich<br />
P. aeruginosa im Trinkwasser<br />
(2x<strong>10</strong>^7/ml). Zusätzlich wurde das<br />
Modell an CFTR-defizienten Mäusen<br />
mit einer Woche Exposition getestet.<br />
Zu den genannten Zeitpunkten wurde<br />
die Präsenz des Erregers im Ra-<br />
chenabstrich, der bronchoalveolären<br />
Lavage (BAL), sowie Lunge, Leber<br />
und Milz bestimmt. Die BAL wurde<br />
auch auf Entzündungszellen hin untersucht.<br />
4. Ergebnisse<br />
Bei den C57Bl/6 Mäusen waren die<br />
Rachentupfer zu allen Zeitpunkten<br />
P.aeruginosa positiv. In der BAL<br />
waren keine Pseudomonaden oder<br />
neutrophile Granulozyten nachweisbar.<br />
Im Lungenhomogenat waren<br />
nach 2 Wochen 80%, nach 6 Wochen<br />
70% und nach 8 bzw. <strong>10</strong> Wochen<br />
jeweils <strong>10</strong>% der Proben P. aeruginosa<br />
positiv. Nach 13 Wochen waren in<br />
den Lungen keine Bakterien mehr<br />
nachweisbar. In der Milz waren keine,<br />
in der Leber nur vereinzelt zu<br />
den Zeitpunkten 2, 8,<strong>10</strong> und 13<br />
Wochen Pseudomonaden zu finden.<br />
Bei den CF-Mäusen waren die Rachentupfer<br />
ebenfalls bis auf zwei<br />
Ausnahmen immer P. aeruginosa<br />
positiv. In der BAL waren keine Erreger<br />
nachweisbar und in keiner der<br />
BALs waren neutrophilen Granulozy-<br />
- 32 -<br />
ten zu finden. In den Lungen waren<br />
bei 14 von 16 Tieren Pseudomonaden<br />
in geringer Anzahl nachweisbar.<br />
Die Milz war bei 11 von 16 Tieren<br />
besiedelt, während die Leber bei 13<br />
von 16 Tieren Pseudomonaden aufwies.<br />
Schlussfolgerungen und Ausblick<br />
Diese Daten weisen darauf hin, dass<br />
das Trinkwassermodell nicht zu einer<br />
bronchialen Infektion führt. Der<br />
Nachweis von Erregern im Lungenhomogenat<br />
scheint Folge einer hämatogenen<br />
Streuung nach intestinaler<br />
Aufnahme. Die mit der Zeit abnehmende<br />
Nachweisrate bei C57Bl/6<br />
spricht für eine erworbene Immunität.<br />
Möglicherweise kann die in der<br />
Literatur beschriebene längere Persistenz<br />
des Erregers auf der Rachenschleimhaut<br />
bei CFTR-defizienten<br />
Mäusen als Parameter einer Schleimhautprotektion<br />
durch Impfung eingesetzt<br />
werden.
<strong>Mukoviszidose</strong> eine Immunerkrankung?<br />
Hauptautor: Markus Henke, Marburg<br />
Weiterer Autor: Gerrit John, Marburg<br />
Bei <strong>Mukoviszidose</strong> sind endobronchiale<br />
Infektionen mit einer intensiven<br />
neutrophilen Entzündungsreaktion<br />
und einer erhöhten IL-8<br />
Sekretion assoziiert. Die Beobachtungen,<br />
dass direkt nach der Geburt<br />
die Lunge bei CF Patienten<br />
strukturell normal ist, aber bereits<br />
bei Säuglingen auch ohne klinische<br />
Hinweise für eine Infektion in der<br />
BAL eine überschießende Entzündung<br />
besteht und proinflammatorische<br />
Zytokine in ungewöhnlich<br />
hohen Konzentrationen in den CF-<br />
Atemwegen nachgewiesen werden<br />
können, lassen vermuten, dass<br />
eine verstärkte Entzündungsrektion<br />
direkt mit dem Gendefekt assoziiert<br />
ist.<br />
Bei Säuglingen mit CF konnten in<br />
der BAL erhöhte Werte für IL-8<br />
mRNA, ein Produkt der Alveolarmakrophagen,<br />
nachgewiesen werden.<br />
Auch in weiteren Studien fand<br />
man, dass bei CF eine verstärkte<br />
Entzündung einer bakteriellen Infektion<br />
folgt. In vielen BAL-Studien<br />
wurden die Probanden allerdings<br />
nur dann als „infiziert“ klassifiziert,<br />
wenn eine gewisse Menge an pathogenen<br />
Keimen überschritten<br />
wurde oder wenn als nichtpathogen<br />
betrachtete Erreger (z.B.<br />
oropharyngeale Flora) zusätzlich<br />
mit einer verstärkten Entzündung<br />
assoziiert waren. Durch Studien<br />
mittels RFLP wurde ein Profil des<br />
Sputums von CF Patienten erstellt.<br />
Dabei wurde festgestellt, dass bei<br />
CF mehr als 40 Bakterien bislang<br />
nicht identifiziert wurden. Die<br />
meisten dieser Bakterien waren<br />
metabolisch aktiv, was vermuten<br />
lässt, dass sie eine potentielle pathogene<br />
Rolle spielen. Dies könnte<br />
eine Erklärung dafür sein, warum<br />
in vielen Studien eine Entzündung<br />
anscheinend in Ermangelung einer<br />
Infektion beschrieben wurde.<br />
In 2 neueren BAL-Studien konnte<br />
bei CF Säuglingen ohne bisherige<br />
Atemwegssymptome oder ohne<br />
bisherige antibiotische Therapie<br />
kein Unterschied im Profil der Ent-<br />
- 33 -<br />
zündungsmediatoren im Vergleich<br />
zu gesunden Probanden nachgewiesen<br />
werden. Es bestand auch<br />
keine, wie bisher behauptet, verstärkte<br />
Entzündungsreaktion. Aus<br />
gepaarten jährlichen BAL-Proben<br />
kann geschlossen werden, dass<br />
auch bei CF eine Infektion die Entzündung<br />
initiiert und diese unterhält.<br />
Diese in vivo Untersuchungen<br />
lassen vermuten, dass lediglich die<br />
Kontrolle der Entzündung, sowie<br />
die Antwort auf eine Infektion bei<br />
CF beeinträchtigt ist.<br />
Unsere in vitro Daten zeigen, dass<br />
im CF-Atemwegsepithel der TLR-4<br />
Rezeptor vermindert exprimiert<br />
wird und somit die initiale Immunantwort<br />
auf Bakterien eingeschränkt<br />
ist. Dies bestätigt die in<br />
vivo Beobachtungen und gibt einen<br />
wesentlichen mechanistischen<br />
Hinweis auf die Initialisierung der<br />
chronischen Atemwegsinfektion bei<br />
CF.<br />
Körperliche Aktivität bei Kindern und Jugendlichen mit Cystischer Fibrose (CF)<br />
Hauptautor: Sibylle Junge, Hannover<br />
Weitere Autoren: L. Stein, U. Tegtbur, Manfred Ballmann, Hannover<br />
Hintergrund:<br />
Positive Effekte von körperlicher<br />
Aktivität (PA) und Sport bei Patienten<br />
mit CF wurden in vielen Studien<br />
nachgewiesen, weshalb Sport<br />
immer mehr Bedeutung bei der<br />
Therapie der CF gewinnt. In einer<br />
prospektiven Studie ermittelten wir<br />
die PA von Kindern und Jugendlichen<br />
mit CF mittels eines Aktivitätssensors.<br />
Methoden:<br />
Alle CF Patienten der Kinderklinik<br />
der MHH im Alter von 6 bis 18<br />
Jahren erhielten das Angebot zur<br />
Messung ihrer PA mit dem Aktivitätssensor<br />
(Sensewear® Armband)<br />
über 7 Tage. Während eines<br />
routinemäßigen Ambulanzbesuches<br />
wurden zusätzlich folgende Daten<br />
erhoben: Größe, Gewicht, BMI,<br />
Maximalleistung (Fahrradergometrie<br />
nach Godfrey), Lungenfunktionsdaten<br />
(FEV1, FVC, MEF25,<br />
TGV), Thorax- Röntgen (CN- Score).<br />
Ergebnisse:<br />
Von 93/ <strong>10</strong>6 (88%) Patienten (49<br />
Mädchen, 44 Knaben, Alter<br />
12,3±3,1 Jahre, Median±SD) liegen<br />
auswertbare Daten zur PA vor.<br />
Die meisten Patienten tolerierten<br />
das Sensewear® Armband gut und<br />
stuften die Bedienung als einfach<br />
ein. Die unterschiedlichen Parameter<br />
sprechen für eine gute bis sehr<br />
gute PA: 12417± 4389 Schritte<br />
pro Tag; 2.65±0,56 METs (Metabolisches<br />
Äquivalent = 1<br />
kcal/h/kg), was 257±40,3 % des<br />
Grundumsatzes (GU) entspricht<br />
(Empfehlung der WHO für Erwachsene:<br />
175% des GU); 1:41±1:16<br />
h pro Tag bei hoher körperliche<br />
Aktivität (> 6 METs). 21/93 Patienten<br />
(22,5%) lagen mit ihrer PA<br />
unter den Empfehlungen der WHO<br />
für Erwachsene. Die PA der Patienten<br />
in METs nimmt mit zunehmendem<br />
Alter ab (r=-0.63; p
Entwicklung von einem gestörten Kohlenhydratstoffwechsel zum Diabetes mellitus<br />
bei Patienten mit Cystischer Fibrose<br />
Hauptautorin: Christine Kämpfert, Hannover<br />
Weitere Autoren: Reinhard Holl, Ulm, A. Marquart, Ulm, Manfred Ballmann, Hannover<br />
Ein gestörter Kohlenhydratstoffwechsel<br />
ist eine häufige Begleiterkrankung<br />
bei Patienten mit Cystischer<br />
Fibrose. Das Ausmaß dieser<br />
Stoffwechselstörung nimmt mit<br />
dem Alter der Patienten zu. Welcher<br />
Zeitpunkt optimal für einen<br />
Therapiebeginn ist, ist Gegenstand<br />
anhaltender Diskussion. Es liegen<br />
jedoch nur wenig Daten vor, die<br />
den zeitlichen Ablauf von einem<br />
ersten pathologischen Oralen Glukose-Toleranz-Test<br />
(OGTT) bis zu<br />
einem Diabetes mellitus beschreiben.<br />
Wir untersuchten prospektiv in<br />
einer großen Patientengruppe den<br />
zeitlichen Ablauf vom ersten pathologischen<br />
OGTT bis zu einem<br />
diabetischen OGTT.<br />
Hierzu wurden bei CF-Patienten ab<br />
einem Alter von <strong>10</strong> Jahren jährlich<br />
Orale Glukose-Toleranz-Tests<br />
durchgeführt. Bei einem diabetischen<br />
Testergebnis wurde der Diabetes<br />
durch einen zweiten unabhängigen<br />
Test bestätigt.<br />
Wir verwendeten die Daten aus der<br />
Screeningphase einer multizentrischen<br />
prospektiven Therapiestudie<br />
zum Vergleich von oralen Antidiabetika<br />
(Repaglinide) und Insulin<br />
bei der Therapie von CF-Diabetes.<br />
Aus den Jahren 2002 bis 20<strong>08</strong><br />
standen 4514 OGT-Tests von 1579<br />
CF-Patienten zur Verfügung. Der<br />
zeitliche Verlauf der Stoffwechselstörung<br />
wurde mittels Kaplan-<br />
Meier-Kurven dargestellt.<br />
Das 1. Quartil für einen ersten<br />
pathologischen OGTT-Befund betrug<br />
16,4 Jahre. Das 1. Quartil für<br />
einen ersten diabetischen Test<br />
betrug 21,5 Jahre und für einen<br />
bestätigten Diabetes 26 Jahre.<br />
Nur in der letzen Gruppe fanden<br />
wir einen signifikanten Geschlechtsunterschied:<br />
Das 1. Quartil für einen bestätigten<br />
Diabetes betrug bei männlichen<br />
CF-Patienten 27,6 Jahre, bei weiblichen<br />
24,5 Jahre.<br />
Im Alter von 18 Jahren zeigten<br />
32 % der CF-Patienten einen ers-<br />
- 34 -<br />
ten pathologischen Testbefund.<br />
16,5 % hatten einen ersten diabetischen<br />
OGTT und 11,5 % einen<br />
bestätigten Diabetes mellitus. 6 %<br />
der männlichen 18jährigen Patienten<br />
hatten einen Diabetes und 16<br />
% der weiblichen.<br />
Der relativ lange Zeitraum zwischen<br />
einem ersten pathologischen<br />
OGTT und einem diabetischen<br />
OGTT könnte eine Möglichkeit zum<br />
rechtzeitigen Therapiebeginn sein.<br />
Bis jetzt gibt es keine prospektive,<br />
randomisierte kontrollierte Studie<br />
zu diesem Thema.<br />
Der Zeitraum zwischen einem pathologischen<br />
und einem diabetischen<br />
OGTT ist bei Frauen kürzer<br />
als bei Männern. Das könnte ein<br />
Beitrag zur Diskussion sein, warum<br />
in Querschnittsstudien Frauen<br />
schwerer an CF-Diabetes erkranken<br />
als Männer.<br />
Unterstützt vom <strong>Mukoviszidose</strong><br />
e.V., Bonn; und NovoNordisk<br />
Pharma GmbH, Mainz.
Referenten und Moderatoren<br />
Manfred Ballmann Medizinische Hochschule Hannover,<br />
Abteilung Kinderheilkunde, Pädiatrische<br />
Pneumologie, Carl-Neuberg-Straße 1, 30625<br />
Hannover, Ballmann.Manfred@MH-<br />
Hannover.de<br />
Christioph T. H. Baltin Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-<br />
Universität, Pneumologie/ Allergologie,<br />
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt,<br />
Christoph.baltin@hhl.de<br />
Gabriele Becker Universitätsklinikum Essen, Kinderklinik,<br />
Hufelandstraße 55, 45147 Essen,<br />
gabriele.becker@uk-essen.de<br />
Jörg B. Engel Universitäts Frauenklinik, Josef-Schneider-<br />
Straße 4, 97<strong>08</strong>0 Würzburg<br />
joergbengel@hotmail.com<br />
Sonja Biet Praxis für Krankengymnastik, Berrenrather<br />
Str. 482 b, 50937 Köln, sonja.biet@tolnline.de<br />
Diana Bilton Papworth Hospital, Aduld CF Centre,<br />
Papworth Everard Cambridge, Cambridge<br />
CB38RE, drdianabilton@aol.com<br />
Antje Böhm Zum Steinberg 29, 01920 Elstra,<br />
ava.boehm@gmx.de<br />
Birgit Borges-Lüke Mendelssohnstraße 4, 30173 Hannover,<br />
birgit.borges-lueke@t-online.de<br />
Annette Bouquet Speyerer Straße 142a, 76744 Wörth am<br />
Rhein, Stbouquet@web.de<br />
Michael P. Boyle Johns Hopkins Adult, Cystic Fibrosis Program,1830<br />
E. Monument Street, 5th<br />
Floor,Baltimore, MD 21205, USA,<br />
mboyle@jhmi.edu<br />
Monika Brandert Universitäts-Kinderklinik Bonn, CF-<br />
Ambulanz, Adenauerallee 119, 53113 Bonn,<br />
schwester.ulrike@gmx.de<br />
Doris Caroli Christiane Herzog Ambulanz, Dr. von<br />
Haunersches Kinderspital, Lindwurmstraße<br />
4, 80337 München,<br />
Doris.Caroli@med.uni-muenchen.de<br />
Stefan Dewey Nordsee Reha-Klinikum I, Fritz-Wischer-<br />
Straße 3, 25826 St Peter-Ording,<br />
s.dewey@uglielje.de<br />
Christian Dopfer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, der<br />
Universität Jena, Kochstraße 2, 07740 Jena,<br />
christian.dopfer@med.uni-jena.de<br />
Stephanie Eckhardt Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe,<br />
Universität Frankfurt Main, Pädiatrische<br />
<strong>Mukoviszidose</strong>-Ambulanz, Theodor-Stern-<br />
Kai 7, 60590 Frankfurt, zkiamb@kgu.de<br />
Jörg B. Engel Universitäts Frauenklinik Würzburg, Josef<br />
Schneider Straße 4, 97<strong>08</strong>0 Würzburg<br />
joergbengel@<br />
Helmut Ellemunter Dept. für Kinder- und Jugendheilkunde,<br />
Pädiatrie III, CF-Zentrum, Anichstraße 35,<br />
6020 Innsbruck, cf-center@i-med.ac.at<br />
Ulrike Erdmann Zentrum für Kinderheilkunde, Allergie<br />
Ambulanz, Adenauerallee 119, 53113 Bonn,<br />
schwester.ulrike@gmx.de<br />
Maria Etzkorn Villa Kunterbund Mutterhaus der<br />
Borromaerinnen Feldstraße 16 54290 Trier<br />
etzkorn@villa-kunterbunt-trier.de<br />
Rainald Fischer Klinikum Innenstadt, Medizinische<br />
Klinik/Pneumologie, Zentrum für<br />
Erwachsene CF-Patienten, Ziemssenstraße<br />
1, 80336 München,<br />
Rainald.Fischer@med.uni-muenchen.de<br />
Thomas Frischer Universitätsklinik für Kinder- und<br />
Jugendheilkunde, Währinger Gürtel 18-20,<br />
<strong>10</strong>90 Wien,<br />
thomas.frischer@meduniwien.ac.at<br />
Michael Givskov University of Copenhagen, Department of<br />
International Health,Immunology and<br />
Microbiology, Faculty of Health Panum<br />
Institute, Blegdamsvej 3B, DK 2200<br />
Copenhagen N, mgi@bio.dtu.dk<br />
Imke Glass Abteilung Pädiatrische Pneumologie und<br />
Neonatologie der Medizinischen Hochschule<br />
Hannover, Carl-Neuberg-Straße 1, 30625<br />
Hannover, Imke-glass@t-online.de<br />
Lutz Goldbeck Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder-<br />
und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie,<br />
Steinhövelstraße 5, 89075 Ulm,<br />
lutz.goldbeck@uniklinik-ulm.de<br />
- 35 -<br />
Matthias Griese Dr. von Haunersches Kinderspital der<br />
Universität München, Christiane Herzog<br />
Ambulanz/CF-Zentrum, Lindwurmstraße 4,<br />
80337 München, matthias.griese@med.unimuenchen.de<br />
Jörg Große-Onnebrink Universitätsklinikum Essen, Abteilung für<br />
Pädiatrie III, Pädiatrische Pneumologie,<br />
Hufelandstraße 55, 45122 Essen,<br />
joerg.grosse-onnebrink@uk-essen.de<br />
Wolfgang Gruber Neistigh 9, 25946 Nebel, Guber-<br />
Wolfgang@t-online.de<br />
Jutta Hammermann Universitätskinderklinik, Fetscherstraße 74,<br />
01307 Dresden,<br />
jutta.hammermann@uniklinikum-dresden.de<br />
Susanne Häußler Chronic Pseudomonas Infections, Helmholtz<br />
Center for Infection Research,<br />
Inhoffenstraße 7, 38124 Braunschweig,<br />
susanne.haeussler@helmholtz-hzi.de<br />
Gudrun Hausmann Kiefernweg 3D, 25946 Wittdün,<br />
gudrun.hausmann@gmx.de<br />
Alexandra Hebestreit Universitäts-Kinderklinik/CF-Ambulanz,<br />
Josef-Schneider-Straße 2, 97<strong>08</strong>0 Würzburg,<br />
a.hebestreit@mail.uni-wuerzburg.de<br />
Helge Hebestreit Universitäts-Kinderklinik Würzburg, Josef-<br />
Schneider-Straße 2, 97<strong>08</strong>0 Würzburg,<br />
Hebestreit@mail.uni-wuerzburg.de<br />
Andreas Hector Forschungszentrum Kubus des Haunerschen<br />
Kinderspitals, AG Pneumologie I,<br />
Lindwurmstraße 2a, 80337 München,<br />
andreas.hector@med.uni-muenchen.de<br />
Ute Hehr Zentrum für Humangenetik am<br />
Universitätsklinikum, Franz-Josef-Strauss-<br />
Allee 11, 93053 Regensburg,<br />
ute.hehr@humangenetik-regensburg.de<br />
Markus Oliver Henke Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt<br />
Pneumologie, Baldinger Straße, 5043<br />
Marburg, markus.henke@staff.unimarburg.de<br />
Gabriele Henschel Vinzenzkrankenhaus, Abteilung<br />
Physiotherapie, Lange-Feld-Straße 31,<br />
30559 Hannover, gabrieleHenschel@tonline.de<br />
Hans-Eberhard Heuer Gemeinschaftspraxis, <strong>Mukoviszidose</strong>-<br />
Ambulanz, Friesenweg 2, 22763 Hamburg,<br />
praxis@kinderaerzte-friesenweg.de<br />
Michael Hogardt Max von Pettenkofer-Institut für Hygiene<br />
und Medizinische Mikrobiologie, LMU<br />
München, Pettenkoferstraße 9a, 80336<br />
München, hogardt@mvp.uni-muenchen.de<br />
Gerd Hüls Eichenstraße 66, 20255 Hamburg, gerdhuels@hotmail.com<br />
Andrea Jobst Christiane Herzog Zentrum, Campus<br />
Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30,<br />
12200 Berlin, andrea.jobst@charite.de<br />
Gerrit John Klinik für Innere Medizin, Pneumologie,<br />
Philipps Universität Marburg, Balinger<br />
Straße 1, 35043 Marburg, john@staff.unimarburg.de<br />
Sibylle Junge Medizinische Hochschule Hannover,<br />
Kinderklinik I, Carl-Neuberg-Straße 1,<br />
30625 Hannover, junge.sibylle@mhhannover.de<br />
Barbara Kahl Universitätsklinikum Münster, Institut für<br />
Medizinische Mikrobiologie, Domagk-straße<br />
<strong>10</strong>, 48149 Münster, kahl@uni-muenster.de<br />
Matthias Kappler Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von<br />
Haunerschen Kinderspital, Christiane Herzog<br />
Ambulanz / CF-Zentrum, Lindwurmstraße 4,<br />
80337 München,<br />
matthias.kappler@med.uni-muenchen.de<br />
Christine Kämpfert Medizinische Hochschule Hannover,<br />
Kinderklinik I, Carl-Neuberg-Straße 1,<br />
30625 Hannover, kaempfert.christine@mhhannover.de<br />
Klaus-Michael Keller Stiftung Deutsche Klinik für Diagnostik<br />
GmbH - Fachbereich Kinderheilkunde - CF-<br />
Ambulanz, Aukammallee 33, 65191<br />
Wiesbaden, keller.paed@dkd-wiesbaden.de<br />
Thomas Köhnlein Medizinische Hochschule Hannover,<br />
Abteilung Pneumologie, CF-Ambulanz für<br />
Erwachsene, Carl-Neuberg-Straße 1, 30625<br />
Hannover, koehnlein.thomas@mhhannover.de<br />
Kathrin Könecke Blumenstraße 2a, 31<strong>23</strong>4 Edemissen,<br />
k.koenecke@t-online.de<br />
Referenten und Moderatoren
Hartmut Kronenberger Waterdelle <strong>23</strong>, 26757 Borkum, hartmut.kronenberger@t<br />
Jochen Mainz Friedrich-Schiller-Universität Jena,<br />
<strong>Mukoviszidose</strong>zentrum/Pädiatrische<br />
Pneumologie, Kochstraße 2, 07740 Jena,<br />
jochen.mainz@med.uni-jena.de<br />
Marcus Mall Pädiatrische Pneumolgie, <strong>Mukoviszidose</strong>-<br />
Zentrum & spez. Infektiologie, Zentrum für<br />
Kinder- und Jugendmedizin, Im<br />
Neuenheimer Feld 153, 69120 Heidelberg,<br />
Marcus.Mall@med.uni-heidelberg.de<br />
Uwe Mellies Universität Essen, Zentrum für<br />
Kinderheilkunde, Abteilung Allgemeine<br />
Kinderheilkunde/Neuropädiatrie,<br />
Hufelandstraße 55, 45122 Essen,<br />
uwe.mellies@uni-due.de<br />
Birgit Merten Herzog Ambulanz, Dr. von Haunersches<br />
Kinderspital, Lindwurmstraße 4,80337<br />
München,<br />
Birgit.Mertens@med.uni-muenchen.de<br />
Frank-Michael Müller Pädiatrische Pneumologie, <strong>Mukoviszidose</strong>-<br />
Zentrum & spez. Infektiologie, Zentrum für<br />
Kinder- und Jugendmedizin, Im<br />
Neuenheimer Feld 153, 69120 Heidelberg,<br />
Frank-Michael_Mueller@med.uniheidelberg.de<br />
Lutz Nährlich Klinik für Kinder und Jugendliche,<br />
Loschgestraße 15, 9<strong>10</strong>54 Erlangen,<br />
Lutz.Naehrlich@uk-erlangen.de<br />
Nadja Niemann Ärztekammer Niedersachsen, Zentrum für<br />
Qualität und Management im<br />
Gesundheitswesen, Berliner Allee 20, 30175<br />
Hannover, nadja.niemann@zq-aekn.de<br />
Thomas Nüßlein Gemeinschaftsklinikum Koblenz-Mayen,<br />
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,<br />
Koblenzer Straße 115-155, 56073 Koblenz,<br />
thomas.nuesslein@gemeinschaftsklinikum.de<br />
Bärbel Palm Universitätsklinik für Kinder- und<br />
Jugendmedizin, Diätassistentin/DKL,<br />
Kirrberger Straße, 66421 Homburg,<br />
Baerbel.Palm@uks.eu<br />
Jürgen Pollok Universitätskinderklinik - Krankengymnastik,<br />
Alexandrinenstraße 5, 44791 Bochum,<br />
J.Pollok@klinikum-bochum.de<br />
Hans-Georg Posselt Zentrum der Kinderheilkunde, Abteilung<br />
Allgemeine Pädiatrie I, Klinik für Pädiatrie<br />
und Jugendmedizin I, Theodor-Stern-Kai 7,<br />
60596 Frankfurt, zkiamb@kgu.de<br />
Andreas Reimann <strong>Mukoviszidose</strong> e.V., In den Dauen 6, 53117<br />
Bonn, areimann@muko.info<br />
Joachim Riethmüller Universitätskinderklinik, Abteilung I, Hoppe-<br />
Seyler-Straße 1, 72076 Tübingen,<br />
joachim.riethmueller@med.uni-tuebingen.de<br />
Ernst Rietschel <strong>Mukoviszidose</strong>zentrum Köln,<br />
Universitätskinderklinik, Kerpener Straße<br />
62, 50924 Köln,<br />
Ernst.rietschel@medizin.uni-koeln.de<br />
Brigitte Roos-Liegmann Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-<br />
Universität Frankfurt Main, Pädiatrische<br />
<strong>Mukoviszidose</strong> Ambulanz, Theodor-Stern-<br />
Kai 7, 60590 Frankfurt, zkiamb@kgu.de<br />
Stefanie Klinik Schillerhöhe, Abteilung<br />
Rosenberger-Scheuber Physiotherapie, Solitudestraße 18, 7<strong>08</strong>39<br />
Gerlingen, Stefanie.Rosenberger@klinikschillerhoehe.de<br />
Katharina Ruf Christiane-Herzog-Ambulanz für<br />
<strong>Mukoviszidose</strong>kranke, Uni-Kinderklinik,<br />
Josef-Schneider-Straße 2, 97<strong>08</strong>0 Würzburg,<br />
ruf_k@klinik.uni-wuerzburg.de<br />
Ruxandra Sabau Medizinische Hochschule Hannover, Institut<br />
für Klinische Pharmakologie, Carl-Neuberg-<br />
Straße 1, 30625 Hannover,<br />
sabau.ruxandra@mh-hannover.de<br />
Annette Sauer-Heilborn MHH Hannover, Pneumologie, CF-Ambulanz<br />
für Erwachsene, Carl-Neuberg-Straße 1,<br />
30625 Hannover, sauerheilborn.annette@mh-hannover.de<br />
Katrin Schlüter Medizinische Hochschule Hannover,<br />
Kinderklinik, Carl-Neuberg Str.1, 30625<br />
Hannover, schlueter.katrin@mhhannover.de<br />
Jochen Schneider Friedrich-Schiller-Universität Jena, Klinikum<br />
für Kinder- und Jugendmedizin, Pneumologie,<br />
Kochstraße 2, 07740 Jena,<br />
Josch_de2001@yahoo.de<br />
Maria Schon Kinderhospital, Iburger Straße 187, 49<strong>08</strong>2<br />
Osnabrück, schon@kinderhospital.de<br />
Carsten Schwarz Christiane Herzog Zentrum, Helios Klinikum<br />
Emil von Bergmann, Campus Benjamin<br />
Franklin, Hindenburgdamm 30, 12200<br />
Berlin, dr_schwarz@t-online.de<br />
- 36 -<br />
Daniel Schüler Justus-von-Liebig-Universität Gießen,<br />
Medizinisches Zentrum für Kinderheilkunde<br />
und Jugendmedizin, Feulgenstraße 12,<br />
35385 Gießen,<br />
daniel.schueler@paediat.med.uni-giessen.de<br />
Michael Sies Heinrichstraße 33, 64283 Darmstadt,<br />
siesis@web.de<br />
Christina Smaczny Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-<br />
Universität Frankfurt Main, Pneumologie und<br />
Allergologie, Theodor-Stern-Kai 7, 60590<br />
Frankfurt, Smaczny@em.uni-frankfurt.de<br />
Olaf Sommerburg Pädiatrische Pneumologie, <strong>Mukoviszidose</strong>-<br />
Zentrum & spez. Infektiologie, Zentrum für<br />
Kinder- und Jugendmedizin, Universität<br />
Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 153,<br />
69120 Heidelberg,<br />
olaf.sommerburg@med.uni-heidelberg.de<br />
Doris Staab HELIOS Kinderklinik, Christiane Herzog<br />
Zentrum, Campus Benjamin Franklin,<br />
Hindenburgdamm 30, 14020 Berlin,<br />
doris.staab@charite.de<br />
Jens Stegemann Infectopharm Arzneimittel GmbH, Von-<br />
Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim,<br />
jens.stegemann@infectopharm.com<br />
Martin Stern Universitätskinderklinik, CF-Ambulanz,<br />
Hoppe-Seyler-Straße 1, 72076 Tübingen,<br />
martin.stern@med.uni-tuebingen.de<br />
Anja-Undine Stücker Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-<br />
Universität, Frankfurt am Main, Abt.<br />
Frauenheilkunde, Theodor-Stern-Kai 7,<br />
60590 Frankfurt,<br />
astuecker@em.uni-frankfurt.de<br />
Kathrin Tintelnot Robert Koch Institut, Nordufer 20, 13353<br />
Berlin, tintelnotk@rki.de<br />
Burkhard Tümmler Medizinische Hochschule Hannover,<br />
Klinische Forschergruppe, OE 67<strong>10</strong>, Carl-<br />
Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover,<br />
tuemmler.burkhard@mh-hannover.de<br />
Karin Ulbrich Kinderärztliche Gemeinschaftspraxis, CF-<br />
Ambulanz Dresden, Angelsteg 5, 01309<br />
Dresden, karin.ulbrich@t-online.de<br />
Gerald Ullrich, Medizinische Hochschule Hannover,<br />
Kinderklinik, Abteilung Kinderheilkunde I,<br />
Carl-Neuberg Str. 1, 306<strong>23</strong> Hannover,<br />
ullrich.gerald@MH-Hannover.de<br />
Horst von der Hardt Im Wiesengrund 5, 30938 Burgwedel,<br />
hohardt@t-online.de<br />
Thomas O. F. Wagner Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe,<br />
Universität, Zentrum der inneren Medizin,<br />
Schwerpunkt Pneumologie/Allergologie,<br />
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt,<br />
T.wagner@em.uni-frankfurt.de<br />
Christa Weiss Krankenhaus Zehlendorf, Charité Campus<br />
Benjamin Franklin, Augustenburger Platz 1,<br />
14<strong>10</strong>9 Berlin, christa.weiss@charite.de<br />
Paul Wenzlaff Ärztekammer Niedersachsen, Zentrum für<br />
Qualität und Management im<br />
Gesundheitswesen, Berliner Allee 20, 30175<br />
Hannover, paul.wenzlaff@zq-aekn.de<br />
Matthias Wiebel Thoraxklinik-Heidelberg, Amalienstraße 5,<br />
69126 Heidelberg,<br />
matthias.wiebel@thoraxklinik-heidelberg.de<br />
Frank Wissing Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),<br />
Kennedyallee 40, 53175 Bonn,<br />
Frank.Wissing@dfg.de<br />
Dieter Worlitzsch Leiter der Krankenhaushygiene am<br />
Universitätsklinikum Halle, Institut für<br />
Hygiene, Johann-Andreas-Segner Straße 12,<br />
06097 Halle, dieter.worlitzsch@medizin.unihalle.de<br />
Jovita Zerlik Altonaer Kinderkrankenhaus v. 1859 e.V.,<br />
Abteilung Physiotherapie, Bleickenallee 38,<br />
22763 Hamburg,<br />
jovita.zerlik@kinderkrankenhaus.net
- 37 -<br />
NOTIZEN<br />
Referenten und Moderatoren