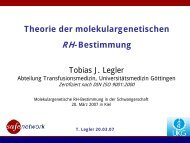Seltsam A., Legler T.J., Petershofen E.K. Rhesus D - Abteilung ...
Seltsam A., Legler T.J., Petershofen E.K. Rhesus D - Abteilung ...
Seltsam A., Legler T.J., Petershofen E.K. Rhesus D - Abteilung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Die neuen Richtlinien<br />
Dr. med. Detlev Nagl<br />
<strong>Rhesus</strong> D-Diagnostik<br />
in der Schwangerschaft<br />
Prof. Dr. med. Axel <strong>Seltsam</strong><br />
Prof. Dr. med. Tobias J. <strong>Legler</strong><br />
Dr. rer. nat. Eduard K. <strong>Petershofen</strong><br />
Kongressbericht<br />
Dr. Andreas Karl<br />
Therapie mit Erythrozytenkonzentraten<br />
bei chronischer Anämie<br />
Prof. emerit. Dr. med. Hermann Heimpel<br />
Dr. med. Britta Höchsmann<br />
Dr. med. Markus Wiesneth<br />
Anscheinend schuldig – Überlegungen<br />
zu einem BGH-Urteil<br />
Dr. med. Andre Fritzsch<br />
Die ärztlichen Aufklärungspfl<br />
ichten – Neue weitere Anforderungen<br />
bei der Verabreichung von<br />
Blutprodukten?<br />
Christoph Kleinherne, Rechtsanwalt<br />
Beiträge zur Transfusionsmedizin<br />
S ONDERAUSGABE<br />
zur DGTI-Tagung September 2006<br />
››
››<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Die Ständige Konferenz der<br />
Geschäftsführer der DRK-Blutspendedienste<br />
vertreten durch:<br />
den Sprecher:<br />
Prof. Dr. Erhard Seifried,<br />
Sandhofstr. 1,<br />
60528 Frankfurt/M<br />
beteiligte und für die<br />
Regionalteile zuständige<br />
Blutspendedienste:<br />
DRK-Blutspendedienst<br />
Baden-Württemberg -<br />
Hessen gGmbH, Mannheim<br />
Blutspendedienst des Bayerischen<br />
Roten Kreuzes, München<br />
DRK-Blutspendedienst<br />
Mecklenburg-Vorpommern gGmbH,<br />
Neubrandenburg<br />
DRK Blutspendedienst Nord gGmbH,<br />
Lütjensee<br />
Blutspendedienst der Landesverbände<br />
des DRK Niedersachsen, Sachsen-<br />
Anhalt, Thüringen, Oldenburg und<br />
Bremen gGmbH, Springe<br />
DRK-Blutspendedienst Ost gGmbH,<br />
Dresden<br />
DRK-Blutspendedienst West gGmbH,<br />
Ratingen<br />
Redaktion<br />
(verantwortlich):<br />
Dr. Detlef Nagl, München<br />
Friedrich-Ernst Düppe, Hagen<br />
Feithstraße 182, 58097 Hagen<br />
Tel.: 0 23 31/8 07-0<br />
Fax: 02331/881326<br />
Email: f.dueppe@bsdwest.de<br />
Redaktion:<br />
Dr. Jörgen Erler, Baden-Baden;<br />
Dr. Robert Deitenbeck, Hagen;<br />
PD Dr. Hermann Eichler, Ratingen;<br />
Ursula Lassen, Springe;<br />
Jens Lichte, Lütjensee;<br />
Dr. Markus M. Müller, Frankfurt/M.;<br />
Dr. Detlev Nagl, Augsburg;<br />
Prof. Dr. Hubert Schrezenmeier, Ulm;<br />
Prof. Dr. Sybille Wegener, Rostock.<br />
Mit Autorennamen gekennzeichnete<br />
Fachartikel geben die Meinung des<br />
Autors wieder und müssen nicht<br />
unbedingt die Meinung der Redaktion<br />
und der Herausgeber widerspiegeln.<br />
Der Herausgeber der „hämotherapie“<br />
haftet nicht für die Inhalte der Fachautoren.<br />
Die Fachinformationen entbinden<br />
den behandelnden Arzt nicht, sich<br />
weiterführend zu informieren.<br />
Realisation:<br />
concept-design GmbH & Co. KG<br />
deltacity.NET GmbH & Co. KG<br />
SIGMA-DRUCK GmbH<br />
www.deltacity.net<br />
Auflagen:<br />
Gesamtauflage: 36.500 Ex.<br />
ISSN-Angaben auf der Rückseite<br />
Zitierweise:<br />
hämotherapie, 7/2006, Seite ...<br />
Inhalt<br />
Editorial 7/2006<br />
Prof. Dr. med. Erhard Seifried<br />
Die neuen Richtlinien<br />
Weitere Anmerkungen zur Novelle 2005 der Richtlinien<br />
zur Hämotherapie<br />
Dr. med. Detlev Nagl<br />
<strong>Rhesus</strong> D-Diagnostik in der Schwangerschaft<br />
Prof. Dr. med. Axel <strong>Seltsam</strong><br />
Prof. Dr. med. Tobias J. <strong>Legler</strong><br />
Dr. rer. nat. Eduard K. <strong>Petershofen</strong><br />
Kongressbericht<br />
Neuntes wissenschaftliches Symposium der Forschungsgemeinschaft<br />
der DRK-Blutspendedienste zum Thema Hämovigilanz in Dresden<br />
Dr. Andreas Karl<br />
Therapie mit Erythrozytenkonzentraten<br />
bei chronischer Anämie<br />
Prof. emerit. Dr. med. Hermann Heimpel<br />
Dr. med. Britta Höchsmann<br />
Dr. med. Markus Wiesneth<br />
Anscheinend schuldig –<br />
Überlegungen zu einem BGH-Urteil<br />
Dr. med. André Fritzsch<br />
Die ärztlichen Aufklärungspfl ichten –<br />
Neue weitere Anforderungen bei der Verabreichung<br />
von Blutprodukten?<br />
Christoph Kleinherne, Rechtsanwalt<br />
Die Autoren / Abo- und Redaktionsservice<br />
3<br />
4-14<br />
15-25<br />
26-31<br />
32-43<br />
44-49<br />
49-58<br />
59
Editorial 7/2006<br />
Sehr geehrte Leserin,<br />
sehr geehrter Leser,<br />
das Ihnen heute vorliegenden Heft 7 unserer<br />
Zeitschrift ist anlässlich des 39. Jahreskongresses<br />
der Deutschen Gesellschaft<br />
für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie<br />
e.V. (DGTI) in Frankfurt am Main herausgegeben<br />
worden. Der vom 19. bis 22.<br />
September in der Messe Frankfurt stattfindende<br />
Kongress wird in diesem Jahr in Zusammenarbeit<br />
mit der International Society<br />
for Cellular Therapy-Europe (ISCT-Europe)<br />
veranstaltet.<br />
Neben den traditionellen Themen wie<br />
Qualität und Sicherheit von Blutprodukten,<br />
Immunhämatologie, Transplantationsmedizin,<br />
Hämotherapie und vielen anderen wurden<br />
Schwerpunkte dieses transfusionsmedizinischen<br />
Fachkongresses entsprechend der<br />
rasanten Entwicklung und aufgrund zunehmender<br />
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
in den letzten Jahren gewählt:<br />
Regenerative Medizin an Beispielen wie der<br />
Stammzell-Therapie beim akuten Myokardinfarkt,<br />
die Transplantation hämatopoietischer<br />
Stammzellen aus Nabelschnurblut und die<br />
modernen Ansätze der Gentherapie werden<br />
auf diversen Symposien und Hauptvorträgen<br />
aus wissenschaftlicher, regulatorischer<br />
und klinischer Sicht beleuchtet und diskutiert.<br />
Aber auch andere für die Anwender<br />
relevante neue Aspekte beispielsweise der<br />
Pathogeninaktivierung von Blutpräparaten,<br />
welche die ohnehin hohe Sicherheit der<br />
Blutprodukte noch weiter erhöhen könnte<br />
und für die erste Verfahren vor der klinischen<br />
Einführung stehen, sind ein Thema,<br />
dem ein ganzer Kongressvormittag gewid-<br />
met wird. Hier werden die diversen Verfahren<br />
zur Pathogenreduktion miteinander verglichen<br />
und ebenfalls regulatorische, klinische,<br />
pharmakologisch-toxikologische und<br />
nicht zuletzt auch Kosten-Aspekte neben<br />
Wirksamkeit und Sicherheit eine wichtige<br />
Rolle spielen.<br />
Unabhängig von diesen neuen Entwicklungen<br />
werden wir die wichtigen Aspekte<br />
der täglichen klinischen Anwendung, der<br />
Hämotherapie, und der praktischen Transfusionsmedizin<br />
nicht vernachlässigen. Dafür<br />
ist auch das vorliegende Heft ein gutes<br />
Beispiel:<br />
Dr. Detlef Nagl vom Blutspendedienst des<br />
Bayerischen Roten Kreuzes nimmt sich im<br />
versprochenen zweiten Teil seines Kommentars<br />
zu den aktuellen „Richtlinien zur<br />
Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen<br />
und zur Anwendung von Blutprodukten<br />
(Hämotherapie)” der Bundesärztekammer<br />
und des Paul-Ehrlich-Instituts den auch für<br />
die Anwender wichtigen und hochinteressanten<br />
Teil des Qualitätsmanagements bzw.<br />
der Qualitätssicherung vor. Er kommentiert<br />
speziell auch Aufgaben und Qualifikation des<br />
von vielen Kliniken derzeit noch zu implementierenden<br />
Qualitätsbeauftragten.<br />
Die Autorengruppe um die Professoren<br />
Axel <strong>Seltsam</strong> und Tobias <strong>Legler</strong> sowie Dr.<br />
Eduard <strong>Petershofen</strong> fassen in ihrem Übersichtsartikel<br />
zur <strong>Rhesus</strong> D-Diagnostik in der<br />
Schwangerschaft den aktuellen Stand und<br />
die neuesten Entwicklungen zum Nachweis<br />
dieser noch immer relevanten Form der fetomaternalen<br />
Inkompatibilität zusammen:<br />
Dank Einführung der generellen Anti-D-<br />
Prophylaxe rhesusnegativer schwangerer<br />
Frauen, welche noch kein Anti-D gebildet<br />
hatten, ist der Anteil von Anti-D-Antikörpern<br />
als Ursache eines Morbus haemolyticus<br />
neonatorum zwar zahlenmäßig stark reduziert<br />
worden, aber weiterhin klinisch bedeutsam.<br />
Dr. Andreas Karl fasst in seinem Beitrag<br />
das neunte wissenschaftliche Symposium der<br />
Forschungsgemeinschaft der DRK-Blutspendedienste<br />
zum Thema Hämovigilanz zusam-<br />
men, welches im November 2005 in Dresden<br />
mit internationaler Beteiligung stattgefunden<br />
hat.<br />
Einen weitern Beitrag möchte ich mit besonderer<br />
persönlicher Freude ankündigen,<br />
da er unter der Federführung meines früheren<br />
klinischen Lehrers, Herrn Professor<br />
Hermann Heimpel, entstand, mit dem mich<br />
beinahe 15 Jahre klinische Hämatologie und<br />
Onkologie am Universitätsklinikum Ulm verbinden.<br />
Neben Professor Heimpel haben die<br />
Kollegen Dr. Britta Höchsmann und Dr.<br />
Markus Wiesneth aus dem Institut für klinische<br />
Transfusionsmedizin in Ulm die Therapie<br />
mit Erythrozytenkonzentraten bei<br />
chronischer Anämie in einem sehr praxisnahen,<br />
überaus lesenswerten Artikel zusammengefasst.<br />
Schließlich möchte ich auf die beiden Artikel<br />
von Rechtsanwalt Kleinherne und Dr.<br />
Fritzsch hinweisen, die das Bundesgerichtshof-Urteil<br />
zur ärztlichen Aufklärungspflicht<br />
bei der Verabreichung von Blutprodukten<br />
aus der Sicht des Juristen bzw. Kollegen am<br />
Krankenbett kommentieren: Dieser Richterspruch,<br />
wie in den Beiträgen im Detail erklärt,<br />
betrifft einen in das Jahr 1985 zurückreichenden,<br />
tragischen Fall einer HIV-Infektion.<br />
Der Spruch des Bundesgerichtshof hat<br />
aber durchaus aktuelle Relevanz für alle<br />
diejenigen, die täglich Blutprodukte am Patienten<br />
anwenden.<br />
Mit der Zusammenstellung dieses Heftes<br />
hoffen die Redaktion der hämotherapie, die<br />
Autoren der Beiträge und ich, wieder eine<br />
für Sie als Leserschaft interessante Mischung<br />
gefunden zu haben, welche den einen oder<br />
anderen gewinnbringenden Aspekt zu Ihrer<br />
täglichen Arbeit im Bereich der Hämotherapie<br />
beitragen kann.<br />
In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen<br />
und Lesern eine spannende Lektüre<br />
und hoffe auf Ihre Rückmeldungen und<br />
Fragen, die wir gerne beantworten.<br />
Herzlichst,<br />
Ihr Professor Dr. med. Erhard Seifried<br />
❯❯❯<br />
‹ Prof. Dr. med. Erhard Seifried<br />
Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,<br />
DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen gGmbH<br />
Sandhofstraße 1, D-60528 Frankfurt, e.seifried@blutspende.de<br />
3<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
4<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Die neuen Richtlinien<br />
Dr. med. Detlev Nagl<br />
Institut für Transfusionsmedizin Augsburg<br />
Blutspendedienst des Bayerischen Roten<br />
Kreuzes<br />
Seit Jahren gehört Dr. Detlev Nagl zu<br />
den regelmäßigen Kommentatoren neuer<br />
Hämotherapie-Richtlinien in dieser Zeitschrift.<br />
Seine kritischen Anmerkungen sind<br />
getragen von den langjährigen Erfahrungen<br />
des Praktikers, der sowohl die Herstellungs-<br />
wie auch die Anwendungsseite der<br />
Richtlinien kennt. Im vorliegenden Kommentar<br />
behandelt der Autor den Teil der Richtlinien,<br />
der sich mit dem Qualitätsmanagement<br />
und der Qualitätssicherung<br />
beschäftigt.<br />
Since years Dr. Detlev Nagl is a<br />
commentator of new German guidelines<br />
for transfusion medicine in this journal.<br />
His critical notes are based on longtime<br />
experience in transfusion medicine both<br />
in the part of preparation of blood<br />
components and their application to<br />
patients. This time he commentates the<br />
chapter of the new guidelines which rules<br />
quality management and quality assurance<br />
in transfusion medicine.<br />
Weitere Anmerkungen zur Novelle 2005<br />
der Richtlinien zur Hämotherapie<br />
In der letzten Ausgabe unserer<br />
Zeitschrift habe ich zwei Ab-<br />
schnitte der aktualisierten „Richt-<br />
linien zur Gewinnung von Blut und<br />
Blutbestandteilen und zur Anwen-<br />
dung von Blutprodukten (Hämo-<br />
therapie) – Aufgestellt gemäß<br />
Transfusionsgesetz von der Bun-<br />
desärztekammer im Einverneh-<br />
men mit dem Paul-Ehrlich-Institut“<br />
rezensiert. Und zwar die Ausfüh-<br />
rungen zu den blutgruppensero-<br />
logischen Untersuchungen bei Pa-<br />
tienten und zur Anwendung von<br />
Blutprodukten.<br />
Am Ende meiner Betrachtungen<br />
habe ich angekündigt, dass ich<br />
mich im nächsten (also dem vor-<br />
liegenden) Heft mit dem Abschnitt<br />
„Qualitätsmanagement /Qualitäts-<br />
sicherung“ befassen werde, was<br />
ich hiermit tun will.<br />
Ich gebe zu, dass ich vor allem<br />
auf den überarbeiteten Abschnitt<br />
in den neuen Richtlinien zu diesem<br />
Thema QM und QS sehr gespannt<br />
war und eine Revision bestimmter<br />
Punkte, die ich in den Vorgänger-<br />
Richtlinien kritisiert hatte, erwartet<br />
hatte.<br />
Es wurden ja in der Erstellungs-<br />
phase der Richtlinien-Novelle im-<br />
mer wieder Entwurfsfassungen<br />
vorgelegt. Dass dabei wesentliche<br />
Teile des Abschnitts „Qualitäts-<br />
management /Qualitätssicherung“<br />
erst einmal zurückhaltend publi-<br />
ziert bzw. überhaupt nicht veröf-<br />
fentlicht wurden, deutete auf einen<br />
intensiven Diskussionsprozess in-<br />
nerhalb der Richtlinien-Kommissi-<br />
on und darauf hin, dass vielleicht<br />
ein Punkt in der Neufassung revi-<br />
diert würde.<br />
Es handelt sich um das aus mei-<br />
ner Sicht zumindest diskutierens-<br />
werte Konstrukt eines zusätzlich<br />
zu installierenden Qualitätsbeauf-<br />
tragten für die Hämotherapie.<br />
In der Ausgabe 1/2001 dieser<br />
(damals noch ausschließlich auf<br />
den Kunden- bzw. Interessenten-<br />
kreis des Blutspendedienstes des<br />
BRK beschränkten) Zeitschrift ha-<br />
be ich im Rahmen meiner Rezen-<br />
sion/Rezeption der damals neuen<br />
Richtlinien 2000 die neu einge-<br />
führte Funktion eines Qualitätsbe-<br />
auftragten, der – und das war aus<br />
meiner Sicht das Hauptproblem<br />
– nicht gleichzeitig Transfusi-<br />
onsverantwortlicher der Ein-
ichtung der Krankenversorgung<br />
sein darf, kritisiert. Ich zitiere mich<br />
selbst:<br />
„Ich habe mich nun seit einigen<br />
Jahren immer wieder sehr intensiv<br />
mit den Richtlinien auseinander-<br />
gesetzt. Der Begriff und die Funk-<br />
tion des transfusionsverantwortli-<br />
chen Arztes ist mir daher schon<br />
seit geraumer Zeit geläufi g und<br />
auch sein Aufgabenbereich –<br />
dachte ich zumindest bislang.<br />
Nach meinem Verständnis war die<br />
Qualitätssicherung im Bereich der<br />
Hämotherapie – sprich: die Vorga-<br />
be und schriftliche Fixierung aller<br />
Vorgänge und Abläufe bei der An-<br />
wendung von Blutprodukten sowie<br />
die Überwachung und Überprü-<br />
fung ihrer Einhaltung – die urei-<br />
genste Aufgabe des Transfusi-<br />
onsverantwortlichen.<br />
Und ich war froh, beobachten zu<br />
können, wie sukzessive eine Ein-<br />
richtung der Krankenversorgung<br />
nach der anderen im Versorgungs-<br />
bereich unseres Blutspendediens-<br />
tes die Vorgaben des Transfusi-<br />
onsgesetzes umsetzte, so dass<br />
zum Stichtag 7. 7. 2000 die Forde-<br />
rungen des § 15 TFG zur Qualitäts-<br />
sicherung umgesetzt waren und<br />
alle Einrichtungen einen transfu-<br />
sionsverantwortlichen Arzt prä-<br />
sentieren konnten.<br />
Die Installation der Transfusions-<br />
verantwortlichen lief nicht überall<br />
ohne Geburtswehen ab, nicht sel-<br />
ten musste (sanfter) Druck ausge-<br />
übt werden (wer drängt sich schon<br />
nach dieser Funktion?), aber letz-<br />
ten Endes konnte man nun befrie-<br />
digt in die Runde sehen und fest-<br />
stellen: Im Großen und Ganzen<br />
alles und überall erledigt. Typi-<br />
scher Fall von „denkste!“: Jetzt<br />
braucht man also noch zusätzlich<br />
einen Qualitätsbeauftragten für<br />
die Hämotherapie! Auf ein Neu-<br />
es!“<br />
Ich tröstete mich damals damit,<br />
dass ich mit meiner Fehleinschät-<br />
zung (Qualitätssicherung in der<br />
Hämotherapie ist Sache des Trans-<br />
fusionsverantwortlichen) nicht al-<br />
leine lag, sondern mein Missver-<br />
ständnis auch mit den unbestreit-<br />
bar kompetenten Kommentatoren<br />
des Transfusionsgesetzes, näm-<br />
lich von Auer und Seitz teilte, die<br />
u. a. ausführen (Kommentar zum<br />
TFG, Kohlhammer Verlag), dass<br />
der Transfusionsverantwortliche<br />
das Qualitätsmanagement über-<br />
nehme.<br />
Und immerhin sah ich mich mit<br />
dem doch nicht unwesentlichen<br />
Kretschmer (Marburg) auf einer<br />
Linie, der ebenfalls Skepsis zum<br />
Punkt „Qualitätsbeauftragter“ äu-<br />
ßerte, insbesondere aus folgen-<br />
dem Grund: „Durch die Tatsache,<br />
dass der Qualitätsbeauftragte<br />
nicht fachkompetent sein muss,<br />
besteht die Gefahr, dass er die<br />
transfusionsmedizinische Quali-<br />
tätssicherung nur formal und da-<br />
für umso bürokratischer oder un-<br />
genügend, in beiden Fällen aber<br />
fachlich inkompetent angeht.“<br />
Was die Fachkompetenz des<br />
Qualitätsbeauftragten betrifft, so<br />
versuchen die neuen Richtlinien<br />
jetzt allerdings mit entsprechen-<br />
den Qualifi zierungsvorgaben nach-<br />
zubessern (siehe später).<br />
Kurzum: Die neuen RiLi sind in<br />
Kraft (seit November 2005), der<br />
Qualitätsbeauftragte bleibt er-<br />
halten. Also schauen wir uns nach<br />
dieser Vorrede und Rückschau<br />
einfach das Kapitel „Qualitätsma-<br />
nagement/Qualitätssicherung“ an.<br />
Und zwar wieder vorrangig (wir<br />
sind ja auch und vor allem eine<br />
Kundenzeitschrift) die Abschnitte,<br />
die sich mit der Qualitätssiche-<br />
❯❯❯<br />
5<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
6<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
rung bei der Anwendung von<br />
Blutprodukten befassen.<br />
(Der übliche Hinweis: Neuerun-<br />
gen in der Novelle 2005 gegenü-<br />
ber den Richtlinien 2000 sind, falls<br />
sie nicht ohnehin im Text als sol-<br />
che vorgestellt werden, farblich<br />
hervorgehoben.)<br />
Transfusionsverantwortlicher<br />
Bei der auch durch das Transfusi-<br />
onsgesetz zwingend vorgeschrie-<br />
benen Funktion des Transfusions-<br />
verantwortlichen (TV) gibt es eine<br />
Änderung, die den Einrichtungen<br />
der Krankenversorgung das Le-<br />
ben erleichtert. Die Hürde für ei-<br />
nen Facharzt, der nicht Transfusi-<br />
onsmediziner ist bzw. nicht die<br />
Zusatzbezeichnung „Bluttransfusi-<br />
onswesen“ besitzt (und das trifft<br />
ja für die meisten Kliniken und<br />
Praxen zu), die Qualifi kation zum<br />
Transfusionsverantwortlichen zu<br />
erwerben, wurde jetzt von einer<br />
bislang geforderten 4-wöchigen<br />
Hospitation in einer zur Weiterbil-<br />
dung für Transfusionsmedizin be-<br />
fugten Einrichtung auf 2 Wochen<br />
reduziert.<br />
Wie bisher kann, falls die erforder-<br />
lichen Voraussetzungen für eine „in-<br />
terne“ Besetzung der Transfusions-<br />
verantwortlichkeit nicht vorliegen,<br />
„externer, entsprechend qualifi zier-<br />
ter Sachverstand“ herangezogen<br />
werden. Dann müssen aber die Zu-<br />
ständigkeit und Aufgaben vertrag-<br />
lich festgelegt und Interessenskon-<br />
fl ikte ausgeschlossen sein.<br />
Ansonsten bleibt es bei den bis-<br />
herigen Anforderungen:<br />
approbierter Arzt<br />
Qualifi kation und Kompetenz den<br />
Aufgaben entsprechend (s. o.)<br />
Transfusionsmedizinisch<br />
qualifi ziert (s. o.)<br />
Hämostaseologische<br />
Grundkenntnisse<br />
Auch an den Aufgaben des<br />
Transfusionsverantwortlichen än-<br />
dert sich nichts: Er hat die Einhal-<br />
tung von Gesetzen, Verordnungen,<br />
Richtlinien, Leitlinien und Empfeh-<br />
lungen der entsprechenden Ins-<br />
titutionen, Gesellschaften usw. si-<br />
cher zu stellen, sorgt für eine<br />
einheitliche Organisation der Hä-<br />
motherapie und die qualitätsgesi-<br />
cherte Bereitstellung der Blutpro-<br />
dukte und kümmert sich um die<br />
Fortentwicklung des QS-System.<br />
Alles qualitätssichernde Maßnah-<br />
men!<br />
Was die oben aufgeführten<br />
grundsätzlichen Qualifi kationen für<br />
den Transfusionsverantwortlichen<br />
betrifft, so räumen die Richtlinien<br />
Ausnahmen ein. Aber hier wird’s<br />
dann schon etwas unübersicht-<br />
lich:<br />
Wenn in einer Einrichtung nur<br />
Plasmaderivate angewendet wer-<br />
den, sind für die Qualifi kation<br />
als Transfusionsverantwortlicher<br />
nicht die sonst geforderten 16, son-<br />
dern nur 8 Stunden theoretische<br />
von einer Ärztekammer anerkann-<br />
te Fortbildung (Kursteil A) Voraus-<br />
setzung. Man darf also nach dem<br />
ersten Tag der im Regelfall 2-tägi-<br />
gen Fortbildung wieder nach Hau-<br />
se fahren (die Familie freut sich!).<br />
Und eine Hospitation kann auch<br />
entfallen.<br />
Das ist ja noch einigermaßen<br />
übersichtlich – aber jetzt!<br />
„Werden in einer Einrichtung<br />
nur Immunglobuline zur passiven<br />
Immunisierung (z. B. Tetanuspro-<br />
phylaxe, auch <strong>Rhesus</strong>prophylaxe)<br />
angewendet, genügt eine Qualifi -<br />
kation nach Abschnitt 1.4.3.6.“<br />
Wir befi nden uns an dieser Stelle<br />
in Abschnitt 1.4.3.1. und um zu wis-<br />
sen, woran wir sind, müssen wir<br />
jetzt also zu Abschnitt 1.4.3.6. wei-<br />
terblättern.<br />
Und das ist so ein Punkt, der an<br />
den neuen Richtlinien (noch viel<br />
mehr als bei den alten Richtlinien,<br />
wo dies auch schon, aber noch<br />
nicht so exzessiv, praktiziert wur-
de) ziemlich nervt (und vor allem<br />
im Kapitel Qualitätsmanagement/<br />
Qualitätssicherung): Diese dauern-<br />
den Quer- und Weiterverweise<br />
(und dazu noch immer wieder die<br />
Fußnoten). Ständig ist man am Vor-<br />
wärts- oder Zurückblättern, um<br />
überhaupt verstehen und nachvoll-<br />
ziehen zu können, was einem denn<br />
jetzt eigentlich vermittelt werden<br />
soll.<br />
Das meinte ich auch, als ich am<br />
Ende meines Beitrags in der letz-<br />
ten Ausgabe der hämotherapie<br />
schrieb, dass der Abschnitt „Qua-<br />
litätsmanagement/Qualitätssiche-<br />
rung“ „streckenweise sehr wun-<br />
derlich daherkommt und in-<br />
haltlicher wie formaler Kritik<br />
bedarf.“<br />
Man hat den Eindruck, als wollten<br />
die Richtlinien mit jeder weiteren<br />
Novellierung noch mehr in ihrer<br />
Prosa den juristischen Kommentar<br />
gleich vorwegnehmen oder gar<br />
übertrumpfen. Eigentlich sollten<br />
sie aber eine Handreichung für<br />
den Arzt in seiner täglichen Tätig-<br />
keit sein, der mitunter auch unter<br />
Zeitdruck Rat, Anleitung oder Ori-<br />
entierung in ihnen sucht.<br />
Aber was steht denn nun in Ab-<br />
schnitt 1.4.3.6.?<br />
1.4.3.6. defi niert die Anforderun-<br />
gen an den transfundierenden<br />
Arzt: Dieser sollte die für hämo-<br />
therapeutische Maßnahmen „er-<br />
forderlichen Kenntnisse und aus-<br />
reichende Erfahrung besitzen. Die<br />
Indikationsstellung ist integraler<br />
Bestandteil des jeweiligen Behand-<br />
lungsplans (kein neuer Satz, aber<br />
seit jeher faszinierend kryptisch!)<br />
Die Leitlinien der Bundesärztekam-<br />
mer zur Therapie mit Blutkompo-<br />
nenten und Plasmaderivaten in der<br />
jeweils gültigen Fassung sind zu<br />
beachten.“<br />
Wir halten also fest: die aus-<br />
schließliche Anwendung von Im-<br />
munglobulinen zur passiven Im-<br />
munisierung als einzige hämothe-<br />
rapeutische Maßnahme in einer<br />
Einrichtung der Krankenversor-<br />
gung (= wahrscheinlich sehr kleine<br />
Arztpraxis) setzt voraus<br />
erforderliche Kenntnisse<br />
ausreichende Erfahrung<br />
Indikationsstellung (als<br />
„integraler Bestandteil des<br />
Behandlungsplans“)<br />
Beachtung der Leitlinien der<br />
BÄK<br />
Weitere Ausnahmen bei der Qua-<br />
lifi kation zum Transfusionsverant-<br />
wortlichen: es reicht aus, Facharzt<br />
zu sein und den 16-Stunden-Kurs<br />
(Teil A und B; von einer Ärztekam-<br />
mer anerkannt) absolviert zu ha-<br />
ben, wenn man „unter den in Ab-<br />
schnitt 1.6.2.1. beschriebenen be-<br />
sonderen Bedingungen“ tätig ist.<br />
Aber dieser Abschnitt 1.6.2.1. ist<br />
nun wirklich ein Kapitel für sich,<br />
das ich mir für nachher aufspare.<br />
Transfusionsbeauftragter<br />
Zu Funktion und Qualifi kation<br />
des (ja ebenfalls per TFG vorge-<br />
schriebenen)Transfusionsbeauf- tragten (TB) gibt es nichts bzw.<br />
wenig Neues zu berichten:<br />
Qualifi ziert für diesen Job ist ein<br />
Facharzt für Transfusionsmedizin<br />
bzw. ein Facharzt mit der be-<br />
reits genannten Zusatzbezeich-<br />
❯❯❯<br />
7<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
8<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
nung „Bluttransfusionswesen“ bzw.<br />
ein Facharzt (jedweder Couleur),<br />
der den 16-Stunden-Kurs der Ärz-<br />
tekammer absolviert hat. Wenn<br />
nur Plasmaderivate oder nur Im-<br />
munglobuline (s. o.) in der Einrich-<br />
tung angewendet werden, gelten<br />
die gleichen Qualifi kationen wie<br />
die vorhin für den Transfusions-<br />
verantwortlichen genannten.<br />
Ein Transfusionsbeauftragter ist<br />
für jede Behandlungseinheit (in<br />
der Klinik = <strong>Abteilung</strong>) zu bestel-<br />
len, der<br />
in der Krankenversorgung<br />
tätig sein<br />
transfusionsmedizinisch<br />
qualifi ziert sein<br />
eine entsprechende Erfahrung<br />
haben und<br />
über hämostaseologische<br />
Grundkenntnisse verfügen<br />
muss.<br />
Er<br />
stellt die Durchführung der<br />
vom Transfusionsverantwort-<br />
lichen bzw. der Transfusions-<br />
kommission festgelegten<br />
Maßnahmen in der <strong>Abteilung</strong><br />
sicher<br />
berät bzgl. Indikation, QS,<br />
Organisation, Dokumentation<br />
sorgt für den ordnungsgemä-<br />
ßen Umgang mit Blutprodukten<br />
in seinem Bereich<br />
regelt die Unterrichtung nach<br />
§ 16 TFG (beim Verdacht der<br />
Nebenwirkung eines Blutproduk-<br />
tes ist ja unverzüglich der phar-<br />
mazeutische Unternehmer (z. B.<br />
der liefernde Blutspendedienst)<br />
und im Falle eines Verdachts<br />
einer schwerwiegenden Ne-<br />
benwirkung zusätzlich die zu-<br />
ständige Bundesoberbehörde<br />
[Paul-Ehrlich-Institut/„PEI“] zu<br />
unterrichten)<br />
und beteiligt sich an Rückver-<br />
folgungsverfahren nach § 19<br />
TFG („look back“)<br />
Transfusionskommission<br />
Die Transfusionskommission, die<br />
nach TFG für Krankenhäuser der<br />
Akutversorgung bzw. mit einer<br />
Blutspendeeinrichtung oder einem<br />
transfusionsmedizinischem Insti-<br />
tut (bzw. einer transfusionsmedi-<br />
zinischen <strong>Abteilung</strong>) gefordert<br />
ist, setzt sich zusammen aus dem<br />
TV (der die Kommission üblicher-<br />
weise leitet), den TB, dem Klinik-<br />
apotheker (falls vorhanden), ei-<br />
nem Vertreter der Pfl egeleitung,<br />
der/dem leitenden MTA sowie ei-<br />
nem Vertreter der Krankenhaus-<br />
leitung. Sie hat folgende Aufga-<br />
ben:<br />
Erarbeitung von Vorgaben, um<br />
die Einhaltung und Durchfüh-<br />
rung von Gesetzen, Verordnun-<br />
gen, Richtlinien, Leitlinien und<br />
Empfehlungen für die Quali-<br />
tätssicherung sicher zu stellen<br />
Beratung der Klinikleitung bei<br />
der Etablierung und Fortent-<br />
wicklung der QS<br />
Erarbeitung von Dienstanwei-<br />
sungen bezüglich der QS<br />
Regelung des organisatorischen<br />
Umgangs mit Blut und Blutpro-<br />
dukten<br />
Erstellung von einrichtungs-<br />
und fachspezifi schen Regelun-<br />
gen zur Anwendung von Blut<br />
und Blutprodukten „auf dem<br />
Boden“ der Leitlinien und Richt<br />
linien der BÄK<br />
Erstellung von Verbrauchs-<br />
statistiken (sehr nützlich!)<br />
Fortbildung von Ärzten, MTA,<br />
Krankenschwestern und<br />
-pfl egern in der Hämotherapie
Arbeitskreis für Hämotherapie:<br />
Die Richtlinien konstatieren auch<br />
diesmal wieder recht zurückhal-<br />
tend, dass „regionale Arbeitskreise<br />
für Hämotherapie eingerichtet wer-<br />
den können, die der regionalen<br />
Zusammenarbeit und dem regel-<br />
mäßigen Informationsaustausch auf<br />
dem Gebiet der Transfusionsmedi-<br />
zin dienen“. Wie bereits in meiner<br />
letzten Richtlinienrezension kann<br />
ich hierzu nur betonen, dass<br />
solche Arbeitskreise, bei denen<br />
sich die Tranfusionsverantwortli-<br />
chen aus den Krankenhäusern<br />
einer Region (möglichst regelmä-<br />
ßig [tempus fugit!]) unter Leitung<br />
und Federführung des zuständigen<br />
Blutspendedienstes treffen, eine<br />
überaus sinnvolle und nützliche<br />
Einrichtung darstellen.<br />
Leitung eines immunhämatologischen<br />
Laboratoriums und/<br />
oder Blutdepots:<br />
Hier muss der verantwortliche<br />
Arzt folgende Qualifi kationen oder<br />
Voraussetzungen haben:<br />
Entweder Facharzt für<br />
Transfusionsmedizin bzw. La-<br />
bormedizin<br />
oder Facharzt mit der Zusatz-<br />
bezeichnung„Bluttransfusions- wesen“<br />
oder (sicher der häufi gste Fall)<br />
Facharzt mit sechsmonatiger<br />
Tätigkeit (früher: Fortbildung)<br />
in einer Einrichtung mit Weiter-<br />
bildungsbefugnis für Transfu-<br />
sionsmedizin.<br />
Falls immunhämatologische Un-<br />
tersuchungen (wieder eine der so<br />
beliebten Fußnoten) „insgesamt<br />
oder teilweise in einem Labor<br />
durchgeführt werden, das durch ei-<br />
nen Naturwissenschaftler geleitet<br />
wird, ist nach § 13 Abs. 1 Satz<br />
3 TFG die Einbeziehung ärztlichen<br />
Sachverstands sicherzustellen. Die-<br />
se Funktion...muss durch eine ärztli-<br />
che Person durchgeführt werden,<br />
die entsprechend 1.4.3.3 a), b), c),<br />
oder d) qualifi ziert ist. Abschnitt<br />
4.2.1 ist zu beachten.“<br />
Der Kenner weiß sofort, was ge-<br />
meint ist: man braucht also zusätz-<br />
lich/unterstützend/wie auch im-<br />
mer (intern vorhanden oder extern<br />
angeheuert) einen Arzt mit den<br />
oben genannten Qualifi kationen.<br />
Für die Leitung eines Blutdepots<br />
ohne Anbindung an ein immunhä-<br />
matologisches Labor genügt eine<br />
16-stündige von einer Ärztekam-<br />
mer anerkannte Fortbildung und<br />
eine vierwöchige Hospitation in ei-<br />
ner zur Weiterbildung für Transfu-<br />
sionsmedizin zugelassenen Ein-<br />
richtung. Ein – Achtung Fußnote!–<br />
„Fachwissenschaftler in der Medizin“<br />
(Berufsbezeichnung in der ehemali-<br />
gen DDR) kann die Leitung eines Blut-<br />
depots übernehmen, falls er über ei-<br />
ne äquivalente Qualifi kation nach den<br />
Buchstaben a), b) oder c) (= Trans-<br />
fusionsmediziner, Labormediziner<br />
oder Zusatzbezeichnung „Blut-<br />
transfusionswesen“) verfügt.<br />
In Ausnahmefällen kann exter-<br />
ner Sachverstand, d. h. die Mithilfe<br />
eines Facharztes für Transfusions-<br />
medizin oder eines Facharztes mit<br />
der Zusatzbezeichnung „Bluttrans-<br />
fusionswesen“, herangezogen wer-<br />
den. Dann müssen aber die Zu-<br />
ständigkeiten und Aufgaben des<br />
externen Experten vertraglich<br />
festgelegt sein.<br />
Übergangsvorschriften:<br />
Transfusionsverantwortlicher, Trans-<br />
fusionsbeauftragter sowie Leiter des<br />
immunhämatologischen Labors und/<br />
oder Blutdepots kann weiterhin<br />
bleiben, wer entweder<br />
zum 7. Juli 1998 (da trat das<br />
Transfusionsgesetz in Kraft)<br />
eine entsprechende Tätigkeit<br />
auf der Grundlage der Richt-<br />
linien von 1996 ausübte (die<br />
Anforderungen für den Trans-<br />
fusionsverantwortlichen und<br />
Transfusionsbeauftragten waren<br />
damals noch nicht spezifi ziert,<br />
die 16-stündige Fortbildung in<br />
❯❯❯<br />
9<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
10<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
einem Ärztekammerkurs exis-<br />
tierte noch nicht und war des-<br />
wegen auch nicht gefordert –<br />
wer es genauer wissen will,<br />
kann in der Ausgabe 1/2001 der<br />
hämotherapie nachlesen) oder<br />
wer auf Grundlage der Über-<br />
gangsvorschriften der bisheri-<br />
gen Richtlinien (2000) eine<br />
entsprechende Funktion aus-<br />
übte („Stichdatum“ für die Lei-<br />
tung des blutgruppenserologi-<br />
schen Labors/Blutdepots<br />
damals der 31.12.1993 – eben-<br />
falls in hämotherapie 1/2001<br />
nachzulesen!).<br />
Wie weist man nach, dass man<br />
unter die Übergangsvorschriften<br />
fällt? Die Richtlinien sagen es uns:<br />
„Bei Einrichtungen der Kranken-<br />
versorgung mit mindestens einer<br />
Behandlungseinheit, aber mehreren<br />
tätigen Ärzten, wird diese Tätigkeit<br />
in der Regel durch eine schriftliche<br />
Bestellung durch die Einrichtung<br />
(z. B. Klinikdirektion) nachgewiesen<br />
werden können.<br />
Bei Einrichtungen mit nur einem<br />
Arzt (z. B. Arztpraxis) hat der Arzt<br />
auch ohne notwendige Bestellung<br />
die Funktion des Transfusionsver-<br />
antwortlichen. Der Nachweis zur<br />
Benennung als Voraussetzung zur In-<br />
anspruchnahme der Übergangsre-<br />
gelung entfällt.“ Wer also alleine<br />
eine Arztpraxis führt, muss sich<br />
(derzeit noch) nicht selbst einen<br />
Brief schreiben und darin die Trans-<br />
fusionsverantwortlichkeitübertra- gen.<br />
Qualitätsmanagementhandbuch<br />
Zur Beschreibung und Dokumen-<br />
tation des funktionierenden QM-<br />
Systems ist ein den Aufgaben<br />
entsprechendes QM-Handbuch zu<br />
erstellen, das sowohl für klinische<br />
als auch transfusionsmedizinische<br />
und Einrichtungen der ambulan-<br />
ten Versorgung Qualitätsmerk-<br />
male und Qualitätssicherungs-<br />
maßnahmen zusammenfasst.<br />
Das QM-Handbuch muss für<br />
alle Mitarbeiter in dem für ihre<br />
Arbeit relevanten Umfang zu-<br />
gänglich sein. Die dort festge-<br />
legten Arbeitsanweisungen bzw.<br />
Dienstanweisungen sind als Stan-<br />
dard verbindlich, müssen freilich<br />
neuen Erfordernissen, Entwicklun-<br />
gen und Änderungen angepasst<br />
werden.<br />
Die Funktionsfähigkeit des QM-<br />
Handbuchs ist durch regelmäßi-<br />
gen Soll-/Ist-Abgleich im Rahmen<br />
von Selbstinspektionen (internen<br />
Audits) sicher zu stellen, für die<br />
ein entsprechendes „Programm“<br />
schriftlich festzulegen ist.<br />
Wir kommen nun zum Abschnitt:<br />
Überwachung des QS-Systems<br />
der Anwendung von Blutprodukten,<br />
(und hier erwartet uns<br />
zum Teil wirklich ganz großes<br />
Tennis!)<br />
Der Abschnitt beginnt freilich<br />
sehr positiv: Die Richtlinien halten<br />
fest, dass die Überwachung des<br />
QS-Systems der Anwendung von<br />
Blutprodukten der Ärzteschaft ob-<br />
liegt. (Möge es so bleiben!)
Die dann folgenden Ausführun-<br />
gen der Richtlinien (Seite 9) sind<br />
ein Beispiel für Redundanz. Ich<br />
fasse daher zusammen:<br />
Bei ausschließlicher Anwendung<br />
von Fibrinkleber und/oder Plas-<br />
maderivaten, die nicht zur Be-<br />
handlung von Hämostasestörun-<br />
gen eingesetzt werden, ist eine<br />
Überwachung des QS-Systems<br />
der Einrichtung nicht erforder-<br />
lich.<br />
Bei Einrichtungen, die Blut-<br />
komponenten und/oder Plas-<br />
maderivate für die Behandlung<br />
von Hämostasestörungen an-<br />
wenden, allerdings schon. Deren<br />
Träger haben im Benehmen mit<br />
der zuständigen Ärztekammer ei-<br />
nen Qualitätsbeauftragten (QB)<br />
zu benennen, der qualifi ziert (sie-<br />
he später) und weisungsunabhän-<br />
gig ist.<br />
Der Qualitätsbeauftragte (das wer-<br />
de ich jetzt nicht mehr kommen-<br />
tieren) darf nicht gleichzeitig<br />
Transfusionsverantwortlicher oder<br />
Transfusionsbeauftragter der Ein-<br />
richtung sein. Er hat das QS-Sys-<br />
tem der Einrichtung im Bereich<br />
der Hämotherapie zu überprüfen,<br />
wofür jetzt in den Anhang der neu-<br />
en Richtlinien ein fast zweiseiti-<br />
ger Aufgabenkatalog aufgenom-<br />
men wurde. Übrigens mit der<br />
Vorbemerkung, dass das Ziel die-<br />
se Kataloges „die Implementierung<br />
eines gelebten PDCA-Zyklus auch<br />
hinsichtlich der Umsetzung der<br />
Richtlinien zur Hämotherapie“ sei.<br />
Die ganz wenigen, die nicht wis-<br />
sen, was ein PDCA-Zyklus ist, fi n-<br />
den die Erklärung im Glossar der<br />
Richtlinien auf Seite 80: Gemeint<br />
ist damit ein „grundlegendes Kon-<br />
zept der ständigen Qualitätsver-<br />
besserung, wonach jeder Vorgang<br />
als ein schrittweise immer weiter<br />
zu verbessernder Prozess be-<br />
trachtet werden kann. Das Vorge-<br />
hen ist dabei in die Teilschritte<br />
Planen (engl.: plan), Ausführen<br />
(do), Überprüfen (check) und Ver-<br />
bessern (act) unterteilt.“ Ergibt:<br />
PDCA. Es ist doch immer wieder<br />
schön, wenn man Selbstverständ-<br />
lichkeiten, um nicht zu sagen: Tri-<br />
vialitäten, mit mehr oder weniger<br />
griffi gen Namensgebungen auf-<br />
blasen kann.<br />
Aufgaben des Qualitätsbeauftragten<br />
Er soll/muss überprüfen<br />
ob ein Transfusionsveranwort-<br />
licher, Transfusionsbeauftragte<br />
und erforderlichenfalls ein<br />
Leiter des Blutdepots bzw. im-<br />
munhämatologischen Labors<br />
bestellt wurden und diese die<br />
erforderliche Qualifi kation<br />
besitzen<br />
ob eine Transfusionskommis-<br />
sion gebildet wurde<br />
ob eine schriftliche Arbeits-<br />
bzw. Dienstanweisung („SOP“)<br />
zur Vermeidung von Verwechs-<br />
lungen und Fehltransfusionen<br />
existiert (und hat „einen Bericht<br />
anzufertigen über die Ausgestal-<br />
tung eines Systems zur Aufarbei-<br />
tung entsprechender Ereignisse“<br />
[solchen Formulierungen bzw.<br />
ihren Verfassern kann man<br />
eigentlich nur applaudieren])<br />
ob für den Bereich des blut-<br />
gruppenserologischen Labors<br />
❯❯❯<br />
11<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
12<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
und/oder Blutdepots schriftliche<br />
Arbeitsanweisungen vorliegen<br />
und ob diese umgesetzt werden<br />
(die Inhalte der Arbeitsanwei-<br />
sungen – so der Originaltext –<br />
und deren Umsetzung müssen<br />
nicht im Detail überprüft wer-<br />
den, hierfür ist der Leiter des<br />
blutgruppenserologischen<br />
Labors verantwortlich<br />
(der Qualitätsbeauftragte kennt<br />
sich in der Regel da eh nicht<br />
aus))<br />
ob SOP den entsprechenden<br />
Mitarbeitern in dem für ihre<br />
Arbeit relevanten Umfang vor-<br />
liegen und jeweils auf dem ein-<br />
richtungsinternen aktuellen<br />
Stand sind<br />
ob die „Richtlinien zur Hämo-<br />
therapie“ und die „Leitlinien zur<br />
Therapie mit Blutkomponenten<br />
und Plasmaderivaten“ den Mit-<br />
arbeitern zugänglich sind<br />
ob eine Statistik zum Verbrauch<br />
von Blutprodukten vorliegt<br />
ob Bedarfslisten bezogen auf<br />
„Standardoperationen/Stan-<br />
dardprozeduren“ geführt<br />
werden<br />
ob die jährliche Meldung an<br />
das PEI über den Verbrauch von<br />
Blutprodukten erfolgt ist<br />
ob vom Träger der Einrichtung<br />
für die Hämotherapie ein Sys-<br />
tem zur Einweisung neuer Mit-<br />
arbeiter etabliert wurde<br />
ob eine Liste existiert, „in der<br />
Verbesserungspotentiale zur<br />
Strukturqualität zusammenge-<br />
fasst sind“ [nochmals Applaus!]<br />
ob die Anwendung von Blutpro-<br />
dukten neben der chargenbe-<br />
zogenen Dokumentation auch<br />
patientenbezogen dokumentiert<br />
wird<br />
Außerdem führt er gemeinsam<br />
mit dem TV Begehungen durch<br />
und bespricht anschließend mit<br />
ihm das Ergebnis<br />
Zudem ist er Ansprechpartner<br />
bei externen Audits (falls diese<br />
durchgeführt werden)<br />
Wie wir es schon vom Transfusi-<br />
onsverantwortlichen und dem Lei-<br />
ter des blutgruppenserologischen<br />
Labors bzw. Blutdepot kennen,<br />
kann man auch einen externen<br />
Qualitätsbeauftragten engagieren,<br />
der freilich auch Arzt und entspre-<br />
chend qualifi ziert sein muss. Auch<br />
hier müssen die Zuständigkeit<br />
und Aufgaben vertraglich festge-<br />
legt und Interessenskonfl ikte aus-<br />
geschlossen sein.<br />
Noch eine wesentliche Aufgabe<br />
des Qualitätsbeauftragten: Jährlich<br />
(bis zum 1. März) hat er einen Be-<br />
richt über die Ergebnisse seiner<br />
Überprüfungen (s. o.) für das je-<br />
weils vorausgegangene Jahr zeit-<br />
gleich (!) an die zuständige Ärz-<br />
tekammer und den Träger der<br />
Einrichtung zu senden.<br />
Nun ist es allerdings nicht so,<br />
dass alle Einrichtungen der Kran-<br />
kenversorgung einen Qualitäts-<br />
beauftragten benennen müssen.<br />
Man darf darauf verzichten, wenn<br />
die folgenden Bedingungen erfüllt<br />
sind:<br />
Es werden jährlich weniger als<br />
50 Erythrozytenkonzentrate<br />
transfundiert<br />
Die Anwendung von Erythro-<br />
zytenkonzentraten erfolgt aus-<br />
schließlich durch den ärztlichen<br />
Leiter der Einrichtung<br />
Andere Blutkomponenten (oder<br />
Plasmaderivate zur Behandlung<br />
von Hämostasestörungen)<br />
werden nicht angewendet<br />
Es werden regelmäßig nur<br />
einem Patienten zum selben<br />
Zeitpunkt (!) Erythrozytenkon<br />
zentrate transfundiert<br />
Sämtliche Prozess-Schritte (??)<br />
der Erythrozytentransfusion<br />
fi nden in der Verantwortung des<br />
ärztlichen Leiters der Einrich-<br />
tung statt
Hier steckt der sprichwörtliche<br />
Teufel im ebenso sprichwörtlichen<br />
Detail. Und ich gebe zu, dass auch<br />
ich beim ersten Studium der neuen<br />
Richtlinien den „Knackpunkt“ fast<br />
übersehen hätte: Um auf die Instal-<br />
lation eines QB verzichten zu<br />
können, müssen nämlich alle<br />
diese Voraussetzungen erfüllt<br />
sein. Oder andersrum (falls ich es<br />
nicht falsch verstanden habe):<br />
wenn nur eine Voraussetzung nicht<br />
zutrifft, braucht man einen QB.<br />
Also: 49 EK pro Jahr ➔ kein QB<br />
erforderlich; 50 EK ➔ QB nötig!<br />
Oder: 1 Patient liegt alleine in der<br />
Praxis oder Ambulanz und erhält<br />
eine EK-Transfusion ➔ kein QB er-<br />
forderlich; ein 2. Patient gesellt<br />
sich dazu ➔ QB nötig!<br />
Es ist nun allerdings nicht so,<br />
dass der ärztliche Leiter einer Ein-<br />
richtung, der aufgrund der gerade<br />
angeführten Kriterien keinen QB<br />
benötigt (also z. B. nicht mehr als<br />
49 EK-Transfusionen pro Jahr oder<br />
immer nur 1 Transfusionspatient<br />
in der Praxis) aller Pfl ichten ledig<br />
ist. Auch er hat zur Überwachung<br />
des Qualitätssicherung jährlich<br />
bis zum 1. März folgende Doku-<br />
mente an die zuständige Ärzte-<br />
kammer zu senden:<br />
Einen Nachweis, dass er als<br />
Facharzt an der von der Ärzte-<br />
kammer anerkannten theoreti-<br />
schen Fortbildung (16 Stunden,<br />
Kursteil A und B) teilgenommen<br />
hat<br />
Eine von ihm selbst unter-<br />
zeichnete Arbeitsanweisung zur<br />
Transfusion eines Erythrozyten-<br />
konzentrats, mit der Selbstver-<br />
pfl ichtung, diese als Standard<br />
zu beachten (im Falle einer Ein-<br />
zelpraxis heißt das, dass man<br />
für sich selbst eine Arbeitsan-<br />
weisung schreibt, diese unter-<br />
schreibt und dann noch eine<br />
Erklärung formuliert und unter-<br />
schreibt, dass man sich auch an<br />
seine eigene Arbeitsanweisung<br />
hält.)<br />
Einen Nachweis der Meldung<br />
des Verbrauchs von Blutproduk-<br />
ten (und Plasmaproteinen zur<br />
Behandlung von Hämostasestö-<br />
rungen) an das PEI für das vor-<br />
angegangene Kalenderjahr<br />
Qualifi kation des QB<br />
Erste Voraussetzung für die Tä-<br />
tigkeit als Qualitätsbeauftragter ist<br />
die Approbation als Arzt und eine<br />
mindestens dreijährige ärztliche<br />
Tätigkeit.<br />
Außerdem muss der QB<br />
entweder die Voraussetzung für<br />
die Zusatzbezeichnung „Ärzt-<br />
liches Qualitätsmanagement“<br />
erfüllen (Kurs der Bundesärzte-<br />
kammer – sehr aufwändig!)<br />
oder eine 40 Stunden um-<br />
fassende theoretische, von einer<br />
Ärztekammer anerkannte Fort-<br />
bildung „Qualitätsbeauftragter<br />
Hämotherapie“ absolvieren.<br />
Letzteres ist sicher die sinnvol-<br />
lere – weil eben auf das eigentli-<br />
che Gebiet „Hämotherapie“ aus-<br />
gerichtete – Variante. Allerdings<br />
ist zu konstatieren, dass noch nicht<br />
alle Landesärztekammern diesen<br />
Kurs anbieten (können). Aber man<br />
arbeitet daran – und wir haben ja<br />
auch noch etwas Zeit:<br />
❯❯❯<br />
13<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
14<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Wer nämlich zum Zeitpunkt des<br />
In-Kraft-Tretens der neuen Richtli-<br />
nien bereits als QB tätig ist, darf<br />
dies weiter ausüben unter der Be-<br />
dingung, dass er einen der o. g.<br />
Kurse innerhalb von 2 Jahren<br />
nach In-Kraft-Treten der Richt-<br />
linien erfolgreich belegt. Die neu-<br />
en Richtlinien sind im November<br />
2005 in Kraft getreten, d. h. man<br />
hat also bis November 2007 Zeit,<br />
sich für diesen Posten nachträglich<br />
zu qualifi zieren. Die Kollegen, de-<br />
nen dieser Job jetzt neu angetra-<br />
gen wird, müssen den Kurs natür-<br />
lich von vornherein machen.<br />
Aufgaben der Ärztekammern<br />
Die zuständige Landesärztekam-<br />
mer unterstützt den QB bei seinen<br />
Aufgaben und kann die Durchfüh-<br />
rung externer Audits anbieten –<br />
also eine (kollegiale) Offerte, die<br />
man in Anspruch nehmen kann<br />
oder auch nicht.<br />
Wenn der Ärztekammer Mängel<br />
bei der Hämotherapie in einer Ein-<br />
richtung bekannt werden, wirkt<br />
sie gegenüber dem Träger der<br />
Einrichtung auf die Beseitigung<br />
dieser Mängel hin. In einer Proto-<br />
kollnotiz (Fußnote!) wird uns in<br />
deutscher Gründlichkeit erklärt,<br />
was „hinwirken“ in diesem Falle<br />
heißt:<br />
Die Richtliniengeber verstehen<br />
darunter folgende Informations-<br />
pfl ichten zwischen Trägereinrich-<br />
tungen und Ärztekammern:<br />
1. Werden der Ärztekammer<br />
Mängel bei der Anwendung von<br />
Blutkomponenten und/oder<br />
Plasmaderivaten zur Behand-<br />
lung von Hämostasestörungen<br />
bekannt, unterrichtet sie den<br />
Träger der Einrichtung und<br />
den QB über diese Mängel.<br />
2. Die Ärztekammer lässt sich<br />
durch den Träger darüber<br />
unterrichten, wie diese Mängel<br />
behoben werden und<br />
3. die Ärztekammer lässt sich die<br />
Mängelbeseitigung bestätigen.<br />
Meldewesen<br />
Abschließend wird noch auf die<br />
Mitteilungs- und Meldepfl ichten<br />
nach §§ 16, 21 und 22 TFG (sowie<br />
§ 63b AMG) hingewiesen. Da der<br />
Text des Transfusionsgesetzes als<br />
Kapitel 6 in die Richtlinien aufge-<br />
nommen wurde, lässt sich leicht<br />
und schnell nachschlagen, was<br />
hier im Detail dahinter steckt: § 16<br />
TFG s. u.; § 21 TFG behandelt das<br />
koordinierte Meldewesen; § 22<br />
TFG: Epidemiologische Daten;<br />
§ 63b AMG: Dokumentations- und<br />
Meldepfl ichten.<br />
Einzelheiten für die Umsetzung<br />
dieser Pfl ichten in der Einrichtung<br />
sind in einer Dienstanweisung zu<br />
regeln.<br />
Das Kapitel 1 der neuen Richt-<br />
linien „QM/QS“ endet mit einer<br />
Tabelle, in der die Unterrichtungs-<br />
pfl ichten nach § 16 TFG übersicht-<br />
lich aufgeführt sind:<br />
Unterrichtungspfl ichten nach § 16 TFG<br />
Ereignis Zu melden an:<br />
Unerwünschte Ereignisse einrichtungsintern<br />
(auch Fehltransfusionen)<br />
Nebenwirkungen Pharmazeutischer Unternehmer<br />
Arzneimittelkommission der<br />
Deutschen Ärzteschaft<br />
Schwerwiegende Nebenwirkung Pharmazeutischer Unternehmer<br />
Arzneimittelkommission der<br />
Deutschen Ärzteschaft<br />
PEI
<strong>Rhesus</strong> D-Diagnostik in der Schwangerschaft<br />
Prof. Dr. med. Axel <strong>Seltsam</strong><br />
Institut für Transfusionsmedizin,<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
Prof. Dr. med. Tobias J. <strong>Legler</strong><br />
<strong>Abteilung</strong> Transfusionsmedizin,<br />
Georg-August-Universität – Bereich<br />
Humanmedizin, Göttingen<br />
Dr. rer. nat. Eduard K. <strong>Petershofen</strong><br />
Molekulare Diagnostik,<br />
Institut Bremen-Oldenburg,<br />
DRK-Blutspendedienst NSTOB<br />
Auch nach Einführung der generellen<br />
Anti-D-Prophylaxe stellt der durch Anti-D-<br />
Antikörper bedingte Morbus haemolyticus<br />
neonatorum den Prototyp einer durch<br />
mütterliche blutgruppenspezifi sche Alloantikörper<br />
verursachten fetomaternalen<br />
Inkompatibilität dar. Moderne molekulargenetische<br />
Methoden zur Bestimmung der<br />
<strong>Rhesus</strong> D (RhD)-Blutgruppe bieten neue<br />
Möglichkeiten in der pränatalen Diagnostik<br />
und der Schwangerschaftsvorsorge. So ist<br />
es mit der Bestimmung des fötalen RhD-<br />
Status aus der mütterlichen Blutprobe<br />
möglich geworden, bei RhD-heterozygoten<br />
Vätern die nicht gefährdeten Kinder zu<br />
identifi zieren und eine invasive Diagnostik<br />
zu vermeiden. Der frühzeitige Nachweis<br />
des kindlichen RhD-Merkmals in der<br />
Schwangerschaft eröffnet zudem die Perspektive<br />
eines zielgerichteten Einsatzes<br />
der präpartalen Anti-D-Prophylaxe. Mit<br />
Hilfe der paternalen RHD-Zygotiebestimmungen<br />
lässt sich bei Anti-D-immunisierten<br />
Frauen mit Kinderwunsch das Risiko<br />
des Auftretens einer RhD-Inkompatibilität<br />
abschätzen.<br />
In spite of anti-D immunoprophylaxis,<br />
hemolytic disease of the fetus and<br />
newborn attributed to D alloimmunization<br />
occurs. The use of molecular genetic<br />
technology for blood group typing has<br />
opened new possibilities for RhD typing in<br />
prenatal diagnostics and pregnancy<br />
precaution. Fetal DNA in maternal plasma<br />
can be used for non-invasive determination<br />
of the RhD status of fetuses carried by<br />
RhD-negative pregnant women. Moreover,<br />
the availability of non-invasive diagnostic<br />
assays for prenatal RHD typing makes it<br />
possible to restrict antenatal prophylaxis<br />
to only those women at risk for immunization.<br />
Finally, paternal RHD zygosity testing<br />
offers the opportunity to assess the risk of<br />
RhD incompatibility in D alloimmunized<br />
women.<br />
Morbus haemolyticus<br />
neonatorum durch<br />
<strong>Rhesus</strong>inkompatibilität<br />
Pathophysiologie und<br />
Klinik<br />
Der Morbus haemolyticus<br />
neonatorum (MHN) durch Anti-<br />
D-Antikörper ist eine schwere<br />
hämolytische Anämie des Föten<br />
bzw. des Neugeborenen mit Ery-<br />
throblastose infolge gesteigerter<br />
Erythrozytendegeneration durch<br />
diaplazentaren Übertritt materna-<br />
ler Blutgruppenantikörper gegen<br />
kindliche Blutgruppeneigenschaf-<br />
ten bei einer <strong>Rhesus</strong> D (RhD)-in-<br />
kompatiblen Schwangerschaft (1).<br />
Obgleich seit Einführung der An-<br />
ti-D-Prophylaxe Ende der 60er<br />
Jahre der Anti-D-bedingte MHN<br />
sehr stark an epidemiologischer<br />
Bedeutung verloren hat und heute<br />
ein MHN bei AB0-Inkompatibilität<br />
am häufi gsten vorkommt, besitzt<br />
der durch Anti-D induzierte MHN<br />
klinisch nach wie vor die größte<br />
Bedeutung. <strong>Rhesus</strong>antikörper<br />
anderer Spezifi täten (z. B. Anti-c)<br />
oder Antikörper gegen andere<br />
Blutgruppenmerkmale (z. B. Anti-<br />
K) sind hingegen weniger häufi g<br />
in einen MHN involviert (1).<br />
Voraussetzungen für eine feto-<br />
maternale RhD-Inkompatibilität<br />
sind die Immunisierung einer RhD-<br />
negativen Mutter, die Bildung und<br />
der diaplazentare Übertritt von<br />
Antikörpern der Klasse IgG und<br />
das Vorhandensein des RhD-An-<br />
tigens auf den kindlichen Erythro-<br />
zyten (vom RhD-positiven Vater<br />
geerbt) (Abbildung 1). Als im-<br />
munisierende Ereignisse kommen<br />
ein transplanzentarer Übertritt<br />
fötalen, RhD-positiven Blutes, der<br />
bis zum 3. Trimenon in knapp der<br />
Hälfte aller Schwangerschaften<br />
beobachtet wird, sowie Traumata<br />
während der Schwangerschaft,<br />
Chorionzottenbiopsien, Amnio-<br />
Kindsmutter<br />
(D-negativ)<br />
❯❯❯<br />
15<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Immunisierung beim Morbus<br />
haemolyticus neonatorum<br />
›<br />
Abbildung 1<br />
Während der Schwangerschaft, insbesondere im<br />
3. Trimenon, kann es zum Übergang von fötalen Erythrozyten<br />
in den mütterlichen Kreislauf kommen.<br />
In Abhängigkeit von der Dosis können immunologische<br />
Zellen der Kindsmutter erythrozytäre Antigene<br />
präsentieren und die Bildung von Antikörper-produzierenden<br />
Zellen induzieren. Im Falle einer Vorimmunisierung<br />
der Mutter werden vorgebildete Immunzellen<br />
geboostert. Die maternalen Antikörper des Isotyps IgG<br />
vermögen die Plazenta-Blut-Schranke zu passieren und<br />
können dann an die Oberfläche von fötalen Erythrozyten<br />
im kindlichen Kreislauf binden<br />
(Opsonisierung).<br />
Fötus<br />
(D-positiv)
❯❯<br />
16<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
zentesen oder Bluttransfusionen<br />
in Frage. Der Schweregrad eines<br />
MHN wird aus immunhämatolo-<br />
gischer Sicht im Wesentlichen<br />
durch die Konzentration der müt-<br />
terlichen Antikörper, den Anteil<br />
der die Plazenta passierenden<br />
IgG-Antikörper und ihre Sub-<br />
klassenverteilung sowie die An-<br />
tigendichte und -verteilung auf<br />
dem fötalen Gewebe bestimmt.<br />
Das RhD-Antigen gehört zu den-<br />
jenigen Blutgruppenmerkmalen,<br />
die bereits in der Frühschwan-<br />
gerschaft auf den kindlichen Ery-<br />
throzyten exprimiert sind (Ab-<br />
bildung 2).<br />
Als Folge der Einschwemmung<br />
mütterlicher Antikörper in den<br />
kindlichen Kreislauf kommt es<br />
zu einer Beladung der kindlichen<br />
Erythrozyten mit diesen Antikör-<br />
pern und zu einem beschleunig-<br />
ten Abbau der Antikörper-bela-<br />
denen roten Blutzellen im retiku-<br />
loendothelialen System (RES),<br />
was sich in einem hämolytischen<br />
Syndrom mit verkürzter Lebens-<br />
zeit der kindlichen Erythrozyten<br />
manifestiert. Das klinische Bild<br />
des durch Anti-D-bedingten MHN<br />
ist variabel (Tabelle 1) (3).<br />
›<br />
Tabelle 1<br />
Expression von Blutgruppenmerkmalen und<br />
diaplazentarer Übertritt mütterlicher IgG-Antikörper<br />
im Verlauf der fötalen Entwicklung<br />
BG & 1. AKST 2. AKST & 1. Prophylaxe<br />
Rh<br />
k<br />
Fy a<br />
Fy b<br />
plazentarer Übertritt<br />
von IgG aus dem<br />
maternalen Kreislauf<br />
Jk b K Jk a Kp a<br />
4 6 8 9 10 12 14 16 20 24 28 32 36 38<br />
Schwangerschaftswochen (SSW)<br />
BG = Blutgruppenbestimmung AKST = Antikörpersuchtest (modifiziert nach D. Schönitzer)<br />
In leichten Fällen entwickelt sich<br />
lediglich eine frühzeitige Hyper-<br />
bilirubinämie (Icterus praecox)<br />
und eine leichte Anämie, während<br />
in schweren Fällen die Bilirubin-<br />
konzentration so weit ansteigen<br />
kann (Icterus gravis), dass es zu<br />
einer irreversiblen Schädigung<br />
von Nervenzellen und neurologi-<br />
Abbildung 2<br />
schen Ausfällen mit gelblicher An-<br />
färbung der Basalganglien des Ge-<br />
hirns (Kernikterus) kommen kann.<br />
Als Reaktion auf die hämolytische<br />
Anämie lassen sich im Sinne einer<br />
übersteigerten Erythrozytenrege-<br />
neration und -sequestration erhöh-<br />
te Werte von Retikulozyten und<br />
Erythroblasten im peripheren Blut<br />
Klassifi kation eines <strong>Rhesus</strong> D-bedingten Morbus<br />
haemolyticus neonatorum (Nach 3)<br />
Schweregrad Bezeichnung Klinische Merkmale<br />
Leicht Anaemia neonatorum Mäßige Anämie<br />
Mittel Icterus gravis Hyperbilirubinämie<br />
Schwer Anaemia gravis Schwere Anämie,<br />
Hyperbilirubinämie,<br />
keine Ödeme<br />
Schwer Hydrops fetalis Ödeme, Ascites, Pleura-,<br />
Perikarderguss<br />
›
sowie eine Vergrößerung der<br />
extramedullären Blutbildungsor-<br />
gane Leber und Milz nachweisen.<br />
Die schwerste Form des MHN<br />
wird als Hydrops fetalis bezeich-<br />
net. Dabei handelt es sich um ei-<br />
ne allgemeine Ödemneigung mit<br />
Wassereinlagerung in das Ge-<br />
webe und in die Körperhöhlen<br />
infolge anämischer Hypoxie und<br />
Hypalbuminämie (Abbildung 3).<br />
Ein Hydrops fetalis kann unbe-<br />
handelt innerhalb von Tagen zum<br />
Tode führen und abhängig vom<br />
Sensibilisierungsgrad der Schwan-<br />
geren bereits vor der 18. Schwan-<br />
gerschaftswoche (SSW) auftreten.<br />
Vorkommen und Häufi gkeit<br />
Vor Einführung der Anti-D-<br />
Prophylaxe (<strong>Rhesus</strong>prophylaxe)<br />
lag das Immunisierungsrisiko<br />
RhD-negativer Schwangerer bei<br />
7-14 %. Zu dieser Zeit fand sich<br />
ein MHN durch Anti-D bei 0,6 %<br />
aller Schwangerschaften, von<br />
denen 60 % therapiebedürftig<br />
waren und 12 % tödlich endeten.<br />
Während die durch Anti-D ver-<br />
ursachten MHNs früher 98 % aller<br />
Fälle (AB0-MHN ausgenommen)<br />
ausmachten, hatte nach Einfüh-<br />
rung der postpartalen Anti-D-<br />
Prophylaxe Ende der 60er Jahre<br />
die Häufi gkeit des Auftretens ei-<br />
nes Anti-D-bedingten MHN um<br />
90 % abgenommen. Durch die<br />
präpartale Anti-D-Prophylaxe<br />
konnte die Inzidenz nochmals um<br />
90 % gesenkt werden (4). Die Im-<br />
munisierungsrate RhD-negativer<br />
Schwangerer liegt seitdem nur<br />
noch in einem Bereich von 0,2-<br />
0,5 % (5,6). Obgleich die Häufi g-<br />
keit eines Anti-D-verursachten<br />
MHN inzwischen etwa der aller<br />
übrigen MHNs zusammen ent-<br />
spricht, ist die Zahl der Kinder mit<br />
schweren Verläufen bei einem<br />
Anti-D-bedingtem MHN immer<br />
noch am größten. Seit Anfang der<br />
90er Jahre lässt sich durch die<br />
Zuwanderung aus Ländern mit<br />
weniger konsequenter Prophyla-<br />
xe ein durch Anti-D verursachter<br />
MHN im deutschsprachigen Raum<br />
wieder häufi ger beobachten.<br />
Vorsorge und Anti-D-<br />
Prophylaxe<br />
Die zur rechtzeitigen Erkennung,<br />
Behandlung und Prophylaxe des<br />
Anti-D-bedingten MHN erfor-<br />
derlichen Untersuchungen bei<br />
Schwangeren werden durch die<br />
‹<br />
Abbildung 3<br />
Hydrops fetalis bei<br />
Geburt<br />
Mit freundlicher Genehmigung<br />
von Herrn Dr. P. Baier,<br />
Pränataldiagnostik,<br />
Universität Heidelberg<br />
„Mutterschafts-Richtlinien” und<br />
in den „Hämotherapie-Richtlinien”<br />
geregelt (7,8). Demnach müssen<br />
bei jeder schwangeren Frau zu<br />
defi nierten Zeitpunkten eine Blut-<br />
gruppenbestimmung und Anti-<br />
körpersuchtests durchgeführt<br />
werden. Deuten die Ergebnisse<br />
der Blutgruppenbestimmung auf<br />
ein abgeschwächtes oder vari-<br />
antes RhD-Merkmal hin, wird ei-<br />
ne weitere Abklärung erforder-<br />
lich. Ein direkter Coombstest mit<br />
den Erythrozyten des Neugebore-<br />
nen ist durchzuführen, wenn sich<br />
der Verdacht eines MHN ergibt<br />
oder wenn die nach den „Mutter-<br />
schafts-Richtlinien”vorgeschrie- benen Antikörpersuchtests nicht<br />
durchgeführt wurden. Ein posi-<br />
tiver direkter Coombstest muss<br />
als möglicher Hinweis auf eine<br />
fetomaternale Inkompatibilität<br />
weiter abgeklärt werden.<br />
Mit der Anti-D-Prophylaxe lässt<br />
sich bei werdenden Müttern ver-<br />
meiden, dass sich in ihrem Blut<br />
Anti-D-Antikörper gegen die<br />
❯❯❯<br />
17<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
18<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
RhD-positiven Erythrozyten des<br />
Kindes bilden. Das geht nur, wenn<br />
im Körper der <strong>Rhesus</strong>-negativen<br />
Mutter noch keine Antikörper nach-<br />
weisbar sind. Dann bekommt die<br />
Frau in der 28. - 30. SSW und<br />
direkt nach der Geburt (bis max.<br />
72 Stunden post partum) eine<br />
Standarddosis Anti-D-Immunglo-<br />
bulin appliziert. Sollte aus tech-<br />
nischen Gründen die Zeit einmal<br />
nicht eingehalten werden können,<br />
empfi ehlt es sich trotzdem auch<br />
noch am Tag 4, 5 oder 6 die Pro-<br />
phylaxe durchzuführen, da hier<br />
immerhin noch mit einer Wahr-<br />
scheinlichkeit von 20-50 % eine<br />
Immunisierung verhindert wer-<br />
den kann. Der Anti-D-Prophylaxe<br />
liegt die Vorstellung zugrunde,<br />
dass die RhD-positiven Erythro-<br />
zyten des Kindes, sobald sie in<br />
den Blutkreislauf der Mutter ge-<br />
langen, durch die Anti-D-Antikör-<br />
per beladen und im RES abgebaut<br />
werden, und so der mütterliche<br />
Kindsmutter<br />
Anti-D Prophylaxe<br />
Körper selbst keine Antikörper<br />
produziert (Abbildung 4). Mit<br />
der empfohlenen Dosis von 300 µg<br />
können ca. 10 ml Erythrozytense-<br />
diment neutralisiert werden. Die<br />
Anti-D-Prophylaxe kommt auch zum<br />
Einsatz bei: Schwangerschaftsab-<br />
bruch und Abort, Extrauterin-<br />
Schwangerschaften, Fruchtwasser-<br />
untersuchung oder bei Blutungen<br />
in der Schwangerschaft.<br />
Pränatale Diagnostik bei<br />
<strong>Rhesus</strong>inkompatibilität<br />
Serologie<br />
Bei Beginn der Schwangerschaft<br />
sollen Frauen entsprechend der<br />
Mutterschaftsrichtlinie u. a. auf das<br />
Vorliegen irregulärer erythrozy-<br />
tärer Antikörper überprüft wer-<br />
den (7). Bereits existierende An-<br />
tikörper können durch früheren<br />
Fremdantigenkontakt der Schwan-<br />
Anti-D (IgG)<br />
Neugeborenes<br />
geren induziert oder durch Be-<br />
handlung zugeführt worden sein.<br />
Die wichtigsten Spezifitäten im<br />
Zusammenhang mit einem Mor-<br />
bus haemolyticus neonatorum<br />
sind Anti-D, Anti-c und Anti-K.<br />
Es können aber auch Antikörper<br />
gegen Merkmale auf Thrombo-<br />
zyten, z. B. Anti-HPA-1a oder HLA-<br />
Antikörper, induziert werden.<br />
Die Präsenz dieser Antikörper im<br />
Serum kann je nach Immunsystem<br />
unterschiedlich lang sein: einige<br />
Antikörper können nach wenigen<br />
Wochen bereits nicht mehr nach-<br />
weisbar sein, andere können über<br />
Jahre und Jahrzehnte persistieren<br />
(es gibt Beispiele für Allo-Anti-<br />
körper, die über einen Zeitraum<br />
von > 50 Jahren nachweisbar<br />
waren). Es gilt jedoch zu beach-<br />
ten, dass einmal induzierte Anti-<br />
köper innerhalb weniger Tage<br />
wieder geboostert werden kön-<br />
nen.<br />
Bei den therapeutisch zugeführ-<br />
ten Antikörpern handelt es sich im<br />
Wesentlichen um humanes IgG-<br />
Anti-D aus der Prophylaxe. Nach<br />
Applikation der vorgegebenen Do-<br />
‹<br />
Abbildung 4<br />
Nach Geburt des Kindes (oranger Kreis) wird das Blutgruppenmerkmal<br />
<strong>Rhesus</strong> D, der so genannte <strong>Rhesus</strong>faktor, bestimmt.<br />
Um eine Immunisierung der Mutter durch in den mütterlichen<br />
Kreislauf gelangte kindliche Erythrozyten zu vermeiden, wird<br />
nach Geburt <strong>Rhesus</strong> D-positiver Kinder eine Anti-D-Prophylaxe<br />
appliziert. Auf diese Weise werden residuale fötale Erythrozyten<br />
im Kreislauf der Mutter mit Antikörpern „maskiert”.
sis zwischen der 25.und 27. SSW<br />
werden noch zum Zeitpunkt der<br />
Geburt therapeutisch wirksame<br />
Antikörpertiter in der Mutter und<br />
im Kind gemessen, da die durch-<br />
schnittliche Halbwertszeit von IgG<br />
ca. 20-30 Tage beträgt.<br />
Im Rahmen der Mutterschafts-<br />
fürsorge wird in Deutschland<br />
heute routinemäßig zwischen der<br />
24. und 26. SSW der Antikörper-<br />
suchtest wiederholt. Ist der Anti-<br />
körpersuchtest negativ, wird die<br />
Anti-D-Prophylaxe appliziert; ist<br />
er positiv, ist eine exakte Abklä-<br />
rung der Spezifi tät des Antikör-<br />
pers erforderlich, inklusive einer<br />
quantitativen Bestimmung. Die<br />
quantitative Bestimmung kann<br />
einerseits durch den Vorgang der<br />
Titrierung mit defi nierten Testzel-<br />
len bestimmt werden (häufi gste<br />
Durchführung), andererseits<br />
durch Vergleichstestung mit ei-<br />
nem quantitativen Standard (sel-<br />
tenere Durchführung). Für die<br />
Vergleichstestung bietet sich das<br />
Präparat der Anti-D Prophylaxe<br />
an, da hier exakt defi nierte Men-<br />
gen gegeben sind. Ein Vorteil<br />
dieser Methode ist die gute Ver-<br />
gleichbarkeit der Untersuchungs-<br />
ergebnisse; allerdings wird die-<br />
ses Verfahren nur von wenigen<br />
Laboratorien eingesetzt. Vorteil<br />
der Technik der Titrierung mit<br />
defi nierten Testzellen ist die ein-<br />
fache und schnelle Handhabung<br />
sowie die Übertragbarkeit auf<br />
andere Antikörperspezifitäten.<br />
Die große technische Variabilität<br />
dieses Verfahrens macht jedoch<br />
einen Vergleich zwischen verschie-<br />
denen Laboratorien kaum sicher<br />
möglich. Dies liegt vor allem da-<br />
ran, dass die ermittelten Titerstu-<br />
fen stark in Abhängigkeit verschie-<br />
dener Testparameter variieren:<br />
› von der eingesetzten Methode<br />
(Röhrchen, Gelkarte oder<br />
Mikrotiterplatte),<br />
› von der Lösung, mit der<br />
verdünnt wurde (NaCl, Plasma<br />
oder LISS),<br />
› von den eingesetzten Zellen<br />
(homozygot, heterozygot,<br />
enzymbehandelt) und<br />
› anderen Testbedingungen<br />
Damit vor Ort eine relativ gute<br />
Beurteilung der Antikörpertiter-<br />
werte möglich wird, sollte zwi-<br />
schen den Klinikern und dem<br />
untersuchenden Labor eine de-<br />
finierte Vorgehensweise festge-<br />
legt werden. Aus diesem Grund<br />
wird empfohlen, Wiederholungs-<br />
untersuchungen möglichst durch<br />
das Labor ausführen zu lassen, in<br />
dem bereits die Erstuntersuchung<br />
stattgefunden hat.<br />
Zur Risikoeinschätzung des An-<br />
tikörpertiters sind zwei Punkte<br />
beachtenswert: erstens, die Höhe<br />
des Titerwertes (quantitative Men-<br />
ge des physiologisch vorliegen-<br />
den irregulären Antikörpers) und<br />
zweitens, die Veränderung des<br />
Titerwertes im Verlauf. Titerwerte<br />
als solche sagen relativ wenig<br />
über die klinische Relevanz ver-<br />
schiedener Antikörper aus. So<br />
sind einerseits schwere MHN-Ver-<br />
läufe mit niedrigtitrigem Antikör-<br />
per bekannt und andererseits<br />
Schwangerschaften mit hohen<br />
Antikörpertitern ohne klinisch<br />
relevante Hämolyse des Kindes.<br />
Titerveränderungen werden<br />
während der Schwangerschaft<br />
zur Verlaufsbeobachtung heran-<br />
gezogen, wobei Veränderungen<br />
um zwei oder mehr Verdünnungs-<br />
stufen im Allgemeinen als ein<br />
Indiz für eine gesteigerte immu-<br />
nologische Aktivität gewertet<br />
werden können. Häufi g gehen<br />
Veränderungen im Antikörper-<br />
titer den mit technischen Geräten<br />
erkennbaren morphologisch-<br />
physiologischen Veränderungen<br />
eines MHN voraus.<br />
Fötale Sonographie<br />
Für die Untersuchung des unge-<br />
borenen Kindes werden heutzu-<br />
tage bevorzugt Ultraschallgeräte<br />
eingesetzt (Doppler-Sonographie),<br />
da dieses Untersuchungsverfahren<br />
nicht-invasiv ist. Im Falle einer stär-<br />
kergradigen Anämie oder eines<br />
❯❯❯<br />
19<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
20<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
MHN bei einem Föten, verändert<br />
sich die Flussgeschwindigkeit in<br />
den Kopfarterien, was mit dieser<br />
Technik darstellbar ist. Für den<br />
Nachweis einer schweren fötalen<br />
Anämie lag die Sensitivität der<br />
Doppler-Sonographie in einer<br />
kürzlich durchgeführten Multicen-<br />
ter-Studie bei 88 %, die Spezifität<br />
bei 82 %. Die noch häufi g durch-<br />
geführte spektrophotometrische<br />
Bestimmung der Bilirubinoide<br />
im Fruchtwasser (��D 450) zeigte<br />
dahingegen eine Sensitivität von<br />
nur 76 % und eine Spezifi tät von<br />
77 % (9).<br />
Invasive Diagnostik<br />
Um genauere Kriterien zur Ein-<br />
schätzung der Krankheit und des<br />
MHN-Risikos zu erhalten, ist eine<br />
Punktion mit Gewebe-/Zellent-<br />
nahme erforderlich. Technisch<br />
stehen dafür heute drei Verfahren<br />
zur Verfügung: in frühen Stadien<br />
der Schwangerschaft wird ver-<br />
sucht, Zellen von den Chorionzot-<br />
ten zu isolieren; in späteren Sta-<br />
dien kommen die Amnionzentese<br />
(Punktion der Fruchtblase) und<br />
die Kordazentese (Punktion der<br />
Plazenta bzw. der Nabelschnur) in<br />
Frage. Mit Zellen aus der entnom-<br />
menen Gewebeprobe des Kindes<br />
›<br />
Tabelle 2<br />
kann eine molekulargenetische<br />
Bestimmung der Blutgruppengene<br />
erfolgen. Das durch die Kordazen-<br />
tese gewonnene Blut ermöglicht<br />
zusätzlich die serologische Be-<br />
stimmung der Blutgruppenanti-<br />
gene auf den fötalen Erythrozyten,<br />
den Nachweis irregulärer Anti-<br />
körper der Mutter im kindlichen<br />
Plasma sowie die Bestimmung re-<br />
levanter Laborparameter, wie den<br />
Hämatokrit, die Hämoglobinkon-<br />
zentration, die Blutzellzahlen, En-<br />
zyme, etc..<br />
Da es sich hierbei jedoch um<br />
invasive Techniken mit einem<br />
nicht unerheblichen Verletzungs-<br />
risiko für den Föten handelt, sollte<br />
diese Diagnostik in Einrichtungen<br />
mit speziellem Therapiespektrum<br />
durchgeführt werden. In Tabelle 2<br />
sind Daten aus Studien wiederge-<br />
geben, die Angaben zum relati-<br />
ven Abortrisiko enthalten. Bei der<br />
Amnionzentese kam es dabei in<br />
13-62 % der Fälle zu Blutungen,<br />
die zwischen ein und drei Minuten<br />
dauerten. Das ausgetretene Blut-<br />
volumen betrug zwischen 50 und<br />
680 µl. Selbst diese kleinen<br />
Blutmengen können für die<br />
Induktion von irregulären Anti-<br />
körpern in der Mutter ausreichend<br />
sein. Besonders hoch waren die<br />
Werte bei der Punktion in oder<br />
durch die Plazenta hindurch oder<br />
direkt in die Nabelschnur.<br />
Gefürchtet sind vor allem Häma-<br />
tome, die nach der Punktion an<br />
der Einstichstelle entstehen und<br />
zu einem massiven Blutverlust des<br />
Föten führen können.<br />
Die Kordazentese ist jedoch<br />
nicht nur Mittel zur Diagnostik<br />
sondern stellt auch eine sehr gute<br />
Möglichkeit zur effektiven Thera-<br />
pie dar. Mit einer gezielten Punk-<br />
tion der Plazenta oder der Nabel-<br />
schnur ist es in spezialisierten<br />
Zentren heute möglich, Föten<br />
durch intrauterine Transfusion<br />
(IUT) mit kompatiblen Erythro-<br />
zyten (D-negativen Erythrozyten,<br />
Anti-CMV-negativ, bestrahlt) ab<br />
der 20. SSW zu behandeln (Ab-<br />
bildung 5).<br />
Abortrisiko nach Amnionzentese (23-25)<br />
Amnionzentese Risiko für Abort<br />
Fötus < 16 SSW bis 5 - 8 %<br />
Fötus > 20 SSW ca.1 %<br />
therapeutische Punktion bis 14 %<br />
Punktion bei Hydrops fetalis bis 25 %
Postpartal bleiben die Neuge-<br />
borenen noch für einige Zeit be-<br />
handlungsbedürftig. Die Fremd-<br />
erythrozyten können einen<br />
supprimierenden, aber rever-<br />
siblen Effekt auf das autologe<br />
Knochenmark entfalten. In Ab-<br />
hängigkeit von der Antikörper-<br />
konzentration können die heran-<br />
reifenden RhD-positiven kind-<br />
lichen Blutzellen noch für einen<br />
gewissen Zeitraum beladen und<br />
abgebaut werden. In Einzelfällen<br />
kann sich die Transfusionsbedürf-<br />
tigkeit der betroffenen Neugebo-<br />
renen über bis zu vier Monate<br />
hinziehen.<br />
<strong>Rhesus</strong>-Diagnostik bei<br />
aberrantem mütterlichem<br />
RhD-Merkmal<br />
Beim Auftreten ungewöhnlicher<br />
Befunde im Rahmen der mütter-<br />
Intrauterine Transfusion<br />
lichen RhD-Bestimmung ist heut-<br />
zutage eine weitergehende Spezi-<br />
fi zierung des RhD-Status anzustre-<br />
ben. Für eine korrekte Versorgung<br />
Transfusion von 50 ml Blut/kg KG,<br />
Blutgruppe 0 RhD-negativ, gewaschen,<br />
bestrahlt, CMV-negativ<br />
(Hämatokrit des Erythrozytenpräparates > 70%)<br />
Ultraschall-gestützte Punktion eines<br />
Venenpools der Plazenta oder direkt<br />
in die Nabelschnur<br />
(alle 7-14 Tage in OP-Bereitschaft)<br />
Blutvolumen des Kindes:<br />
80-100 ml/kg KG<br />
der Mütter mit einer Anti-D-Prophy-<br />
laxe ist es erforderlich, Anti-D-<br />
immunisierbareRhD-Untergrup- pen von solchen, die kein Anti-D-<br />
Immunisierungsrisiko aufweisen,<br />
zu differenzieren. Unter den aber-<br />
ranten RhD-Phänotypen werden<br />
grundsätzlich RhD-Blutgruppen<br />
mit verminderter Expression<br />
(weak D-Typen) von solchen mit<br />
qualitativ veränderter Antigen D-<br />
Ausprägung (Partial-D’s oder D-<br />
Kategorien) unterschieden. Die<br />
häufi gen weak D-Typen, die Ty-<br />
pen 1 bis 3, sind nach heutigem<br />
Kenntnisstand nicht Anti-D-immu-<br />
nisierbar und sollten daher im<br />
Rahmen der Schwangerschafts-<br />
vorsorge als RhD-positiv betrach-<br />
tet werden. Im Gegensatz dazu<br />
muss bei Schwangeren mit Partial-<br />
D’s aufgrund des Fehlens einzel-<br />
ner RhD-Epitope mit einer Allo-<br />
Anti-D-Immunisierung gerechnet<br />
werden. Das Anti-D-Immunisie-<br />
rungsrisiko der vielen anderen,<br />
sehr seltenen weak D-Typen ist<br />
zur Zeit nicht abschätzbar. Der<br />
›<br />
Abbildung 5<br />
spezifi sche Nachweis der weak D-<br />
Typen und der Partial-D’s ist nur<br />
mit Hilfe moderner molekularbio-<br />
logischer Methoden möglich.<br />
Nach den derzeit gültigen Hämo-<br />
therapierichtlinien werden zur Be-<br />
stimmung des Antigens D in der<br />
Mutterschaftsvorsorge zwei unter-<br />
schiedliche monoklonale Anti-D-<br />
Antikörper eingesetzt, die mit der<br />
in unseren Breiten häufi gsten D-<br />
Kategorie, der D-Kategorie VI,<br />
nicht reagieren. Dieses Verfahren<br />
führt dazu, dass Schwangere mit<br />
D-Kategorie VI absichtlich als<br />
“falsch-negativ” bestimmt werden.<br />
Ist der Reaktionsausfall mit beiden<br />
Antikörpern positiv, so ist die<br />
Schwangere RhD-positiv und be-<br />
nötigt keine Anti-D-Prophylaxe.<br />
Ist der Reaktionsausfall negativ,<br />
muss die Schwangere eine Prophy-<br />
laxe erhalten. Liegt ein fraglich<br />
positiver serologischer Befund vor,<br />
so wird eine weitere Abklärung<br />
erforderlich. Die allermeisten der<br />
unklaren Blutproben repräsen-<br />
tieren weak D-Typ 1, Typ 2 oder<br />
Typ 3, deren spezifi scher Nachweis<br />
nur mit molekularen Methoden ge-<br />
lingt. Angesichts der Fülle geneti-<br />
scher D-Varianten könnte eine<br />
pragmatisch ausgerichtete moleku-<br />
larbiologische RhD-Typisierung<br />
so aussehen, dass nur die häufi gen<br />
weak D-Typen 1 bis 3 identifi ziert<br />
und alle anderen selteneren weak<br />
❯❯❯<br />
21<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
22<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
D-Typen sowie D-Kategorien nicht<br />
erfasst werden. Auf diese Weise<br />
bekäme man bei den meisten<br />
Schwangeren mit weak D-Typen<br />
eine gesicherte Indikation, um auf<br />
eine Anti-D-Gabe verzichten zu<br />
können. Bei den restlichen Fällen<br />
mit aberranten RhD-Phänotypen<br />
lieferte dieses Vorgehen eine diffe-<br />
renziertere Grundlage für die An-<br />
wendung der Anti-D-Prophylaxe.<br />
Molekulargenetische<br />
Bestimmung des fötalen<br />
RhD-Status aus mütterlichem<br />
Blut<br />
Fötale DNA im<br />
mütterlichen Blut<br />
In den letzten Jahren konnte<br />
im Rahmen von Studien die Be-<br />
stimmung fötaler <strong>Rhesus</strong>-Fakto-<br />
ren im mütterlichen Blut etabliert<br />
werden. Fötale DNA wird in der<br />
Schwangerschaft wahrscheinlich<br />
überwiegend aus apoptotischen<br />
Synzytiothrophoblastzellkernen<br />
freigesetzt. Der Synzytiotropho-<br />
blast steht in direktem Kontakt<br />
mit dem mütterlichen Kreislauf<br />
und apoptotische Zellkerne kön-<br />
nen beim Umbau der Plazenta in<br />
das mütterliche Blut gelangen.<br />
Weiterhin werden während der<br />
Schwangerschaft Mikrovesikel<br />
aus der Plazenta freigesetzt, die<br />
fötale RNA und DNA enthalten<br />
und mit einer Halbwertszeit von<br />
ca. 15 Minuten aus dem mütter-<br />
lichen Kreislauf entfernt werden.<br />
Am häufi gsten wird eine Real-<br />
time-PCR mit sequenzspezi-<br />
fi schen Primern und Sonden<br />
eingesetzt, um fötale <strong>Rhesus</strong>-<br />
Faktoren anhand spezifi scher<br />
Nukleinsäurepolymorphismen im<br />
mütterlichen Blut zu bestimmen.<br />
Freie fötale DNA unterliegt im<br />
mütterlichen Blut einem raschen<br />
Abbauprozess und ist wenige<br />
Stunden nach der Geburt nicht<br />
mehr im mütterlichen Blut nach-<br />
weisbar (10). Im Vergleich zur mo-<br />
lekulargenetischen Bestimmung<br />
aus Chorionzotten, Amnionfüssig-<br />
keit oder Nabelschnurblut ist da-<br />
her nicht in allen Fällen ausrei-<br />
chend freie fötale DNA im mütter-<br />
lichen Kreislauf nachweisbar. Da<br />
die Fragmente freier fötaler DNA<br />
zum großen Teil deutlich kürzer<br />
sind (< 300 bp), müssen Methoden,<br />
die ursprünglich anhand von ge-<br />
nomischer DNA aus Amnionzellen<br />
oder Chorionzotten etabliert wur-<br />
den, mit mütterlichem Plasma neu<br />
validiert werden.<br />
Aufgrund der vorliegenden phy-<br />
siologischen Erkenntnisse und<br />
longitudinaler Untersuchungen ist<br />
es verständlich, dass die Konzen-<br />
tration freier fötaler DNA zu Beginn<br />
der Schwangerschaft geringer ist<br />
als zum Ende der Schwanger-<br />
schaft. Es kommt jedoch nicht zu<br />
einem linearen Anstieg der Kon-<br />
zentration fötaler DNA im Verlauf<br />
der Schwangerschaft, sondern<br />
dieser Anstieg verläuft wellenför-<br />
mig. Die erhebliche biologische<br />
Variabilität wurde durch eine Un-<br />
tersuchung in der 30. SSW deut-<br />
lich, in der zwischen 15 und 708<br />
Genomäquivalente RHD-positive<br />
DNA pro Milliliter Plasma bei 160<br />
RhD-negativen Schwangeren mit<br />
RhD-positiven Föten nachgewie-<br />
sen wurden (11).<br />
Fötale RhD-Bestimmung<br />
bei Anti-D immunisierten<br />
Schwangeren<br />
Im Rahmen der <strong>Rhesus</strong>-Diagnos-<br />
tik in der Schwangerschaft kann die<br />
Bestimmung fötaler <strong>Rhesus</strong>-Fakto-<br />
ren aus mütterlichem Blut wertvoll<br />
sein, da dadurch die mit einer in-<br />
vasiven Diagnostik verbundenen<br />
Risiken vermieden werden. Diese<br />
Diagnostik wird in Deutschland<br />
studienbegleitend zur Zeit vom Ins-<br />
titut Bremen-Oldenburg des DRK<br />
Blutspendedienst NSTOB angebo-<br />
ten; im Ausland haben sich Zentren<br />
in Amsterdam und Bristol etabliert<br />
(12). Die Grenzen der Methode<br />
müssen in die Befundinterpretation<br />
immer mit einfl ießen, um nicht<br />
durch Fehlschlüsse zu neuen Risi-<br />
ken für den Föten und die Schwan-
gere zu führen. So sollte z. B. bei<br />
einer Schwangeren mit Anti-D und<br />
einem, aus mütterlichem Blut be-<br />
stimmten negativen fötalen RhD-<br />
Status sichergestellt werden, dass<br />
in der untersuchten Probe ausrei-<br />
chend fötale DNA vorhanden war.<br />
Zur Befundsicherung kann der mo-<br />
lekulargenetische Nachweis des<br />
Y-Chromosoms verwendet werden,<br />
wobei jedoch die Methode zum<br />
Nachweis des Y-Chromosoms nicht<br />
empfindlicher sein sollte als die<br />
Methode zum Nachweis des RhD-<br />
Faktors. Bei RhD-negativen weib-<br />
lichen Föten müssen zunächst infor-<br />
mative Polymorphismen identifi -<br />
ziert werden, die vom Kindsvater<br />
vererbt werden könnten und in<br />
mütterlichen Blutlymphozyten nicht<br />
vorkommen. Auch bei diesem auf-<br />
wändigen Vorgehen kommt es vor,<br />
dass keine informativen Polymor-<br />
phismen im mütterlichen Blut iden-<br />
tifi ziert werden können. Wie bei<br />
jeder Blutgruppenbestimmung ist<br />
es ratsam, bei Schwangeren mit<br />
Anti-D den Genotypisierungsbe-<br />
fund aus mütterlichem Blut durch<br />
eine Wiederholungsuntersuchung<br />
abzusichern.<br />
Indikationsbezogene Anti-<br />
D-Prophylaxe<br />
Die Bestimmung des fötalen<br />
RhD-Status aus mütterlichen Blut<br />
ist eine nicht-invasive Methode,<br />
die nicht nur dazu beitragen kann,<br />
bei Schwangeren mit Anti-D früh-<br />
zeitig eine fetomaternale RhD-In-<br />
kompatibilität zu diagnostizieren,<br />
sondern bietet auch die Möglich-<br />
keit, den fötalen RhD-Status in der<br />
Schwangerschaft bereits vor Gabe<br />
der präpartalen Anti-D-Prophyla-<br />
xe zu bestimmen. Die derzeitigen<br />
Regelungen lassen streng genom-<br />
men keine indikationsbezogene<br />
(nur bei RhD-positiven Föten) Anti-<br />
D-Prophylaxe nach Untersuchung<br />
von fötalem Material zu. Bei 40 %<br />
der RhD-negativen Schwangeren<br />
besteht eigentlich keine Indikation<br />
für eine Anti-D-Prophylaxe, da der<br />
Fötus RhD-negativ ist. Damit erhal-<br />
ten jährlich mindestens 50.000<br />
Schwangere in Deutschland un-<br />
nötigerweiseAnti-D-Immunglo- bulin. Bei Einführung der Anti-D-<br />
Prophylaxe war ein indikations-<br />
bezogenes Vorgehen während der<br />
Schwangerschaft nicht möglich, da<br />
keine Testverfahren zur Bestim-<br />
mung der fötalen RhD-Eigenschaft<br />
zur Verfügung standen. In den<br />
letzten Jahren sind jedoch zahl-<br />
reiche Studien publiziert worden,<br />
die die Zuverlässigkeit einer mole-<br />
kulargenetischenRHD-Bestim- mung aus Fruchtwasser oder auch<br />
mütterlichem Blut belegen (10,12-<br />
18). Daher wird derzeit diskutiert,<br />
ob eine generelle präpartale Anti-<br />
D-Prophylaxe unter medizinischen<br />
Gesichtspunkten noch zu rechtfer-<br />
tigen ist, zumal das Restrisiko einer<br />
Infektion durch das aus mensch-<br />
lichem Plasma gewonnene Anti-D-<br />
Präparat besteht. In den Nieder-<br />
landen steht eine indikationsbe-<br />
zogene Anti-D-Prophylaxe bereits<br />
kurz vor der landesweiten Ein-<br />
führung.<br />
EU-Exzellenznetzwerk SAFE<br />
Die diagnostische Genauigkeit<br />
der präpartalen RhD-Bestimmung<br />
aus mütterlichem Plasma lag in der<br />
bisher größten Studie mit 1.257 Be-<br />
stimmungen in der 30. SSW bei<br />
99,4 % (19). In dieser Studie wurden<br />
drei falsch negative und fünf falsch<br />
positive Ergebnisse beobachtet.<br />
Falsch positive Ergebnisse wer-<br />
den z. B. beobachtet, wenn RHD-<br />
Gen-Varianten mit RhD-negativem<br />
Phänotyp mit den molekulargene-<br />
tischen Methoden als RhD-positiv<br />
bestimmt werden. Diese Konstella-<br />
tion ist jedoch in der deutschspra-<br />
chigen Bevölkerung sehr selten<br />
und hätte lediglich eine nicht-in-<br />
dizierte Anti-D-Prophylaxe zur<br />
Folge. Derzeit besteht im Rahmen<br />
eines mit insgesamt 12 Mio € für<br />
53 Arbeitsgruppen über fünf Jahre<br />
seit 2004 geförderten EU-Projekts<br />
(Exzellenznetzwerk SAFE) (20)<br />
die Möglichkeit, an einer Studie<br />
der <strong>Abteilung</strong> Transfusionsmedi-<br />
zin an der Universität Göttingen<br />
teilzunehmen, um die diagnos-<br />
❯❯❯<br />
23<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
24<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
<strong>Rhesus</strong> box, upstream <strong>Rhesus</strong> box, downstream<br />
<strong>Rhesus</strong> D positiv<br />
<strong>Rhesus</strong> D negativ<br />
tische Genauigkeit mit den mo-<br />
dernsten Verfahren zu ermitteln.<br />
Zur Optimierung der Testverfah-<br />
ren fi nden innerhalb des EU-Netz-<br />
werks Workshops und Standardi-<br />
sierungskonferenzen statt. Jährliche<br />
internationale Ringversuche wur-<br />
den bereits implementiert. Ein<br />
internationales Konsensusproto-<br />
koll für die fötale RhD-Bestim-<br />
mung aus mütterlichem Blut wird<br />
für 2007 erwartet.<br />
Organisation des <strong>Rhesus</strong>-Genkomplexes<br />
und der <strong>Rhesus</strong> boxen<br />
Paternale RhD-Diagnostik<br />
bei Kinderwunsch<br />
Wird bei einer schwangeren<br />
Frau ein irregulärer Anti-D Anti-<br />
körper identifi ziert, besteht häufi g<br />
die Frage nach dem MHN-Risiko<br />
bei weiteren Schwangerschaften.<br />
Aus epidemiologischen Untersu-<br />
chungen ist bekannt, dass ein MHN<br />
meistens erst bei einer Zweit- oder<br />
Drittschwangerschaft eintritt.<br />
RHD RHCE<br />
SMP1<br />
<strong>Rhesus</strong> box, Hybrid<br />
Ob ein Kindsvater für das Merk-<br />
mal RhD homozygot ist, kann mit<br />
serologischen Techniken nicht<br />
bestimmt werden, da über die<br />
Antigenreaktion keine Aussage<br />
gemacht werden kann, ob hier ein<br />
RHD-Gen oder zwei RHD-Gene<br />
vorliegen. Aus diesem Grund<br />
wird in serologischen Befunden<br />
bei RhD-positiven Personen ein<br />
Punkt gesetzt (D.).<br />
RHCE<br />
(modifiziert nach Wagner & Flegel)<br />
Die Kenntnis über die genomi-<br />
sche Organisation des <strong>Rhesus</strong>-<br />
komplexes ermöglicht seit weni-<br />
gen Jahren die Zygotieabklärung<br />
mit molekulargenetischen Tech-<br />
niken (Abbildung 6) (21). Der<br />
<strong>Rhesus</strong>komplex besteht aus den<br />
beiden Genen für <strong>Rhesus</strong> D (RHD)<br />
und <strong>Rhesus</strong> CcEe (RHCE). Diese<br />
bestehen jeweils aus zehn Exonen<br />
und sind in umgekehrter Orien-<br />
tierung auf dem Chromosom an-<br />
›<br />
Abbildung 6<br />
geordnet. Zwischen beiden Genen<br />
liegt das SMP1-Gen, dessen Funk-<br />
tion bis heute nicht geklärt ist. Vor<br />
und hinter dem RHD-Gen liegen<br />
zwei sehr ähnliche Bereiche, die<br />
so genannten <strong>Rhesus</strong> boxen, die<br />
sich aber auf der Ebene der DNA-<br />
Sequenz unterscheiden lassen.<br />
Aufgrund der Ähnlichkeit der bei-<br />
den Sequenzen kann es in diesem<br />
Bereich zu einer Rekombination<br />
kommen, die eine Eliminierung<br />
des RHD-Gens zur Folge hat (an-<br />
gedeutet mit gestrichelten Linien<br />
in Abbildung 6). Die <strong>Rhesus</strong> box,<br />
die dabei entsteht, ist dann zusam-<br />
mengesetzt aus der upstream- und<br />
der downstream-<strong>Rhesus</strong> box. Bei<br />
Verwendung geeigneter Amplifi -<br />
kationsprimer können diese Be-<br />
reiche durch PCR vermehrt und<br />
differenziert werden. Das Fehlen<br />
einer hybrid <strong>Rhesus</strong> box bedeu-<br />
tet, dass der Proband homozygot<br />
für das RHD-Gen ist und damit<br />
RhD-positiv ist. Der Nachweis<br />
einer hybrid <strong>Rhesus</strong> box hinge-<br />
gen bedeutet, dass der Proband<br />
entweder heterozygot für das RHD-<br />
Gen ist oder kein RHD-Gen besitzt.<br />
In Zusammenschau mit dem sero-<br />
logischen RhD-Status des Proban-<br />
den kann dann auf eine RHD-Hete-<br />
rozygotie oder ein Fehlen des RHD-<br />
Gens zurückgeschlossen werden.<br />
Alternativ kann die Homozygo-<br />
tie des RHD-Gens auch über die<br />
quantitative Messung und den<br />
Vergleich einzelner Exone be-<br />
stimmt werden (Abbildungen 7a
›<br />
Abbildung 7a<br />
Bei der quantitativen Bestimmung werden<br />
die Verhältnisse bestimmter Exone zueinander<br />
gemessen. In der Abbildung ist die Lage der<br />
Sonden im Bereich der Exons 3, 4, 5, 6, 7 und<br />
10 dargestellt.<br />
und 7b) (21). Dafür benutzt man<br />
z. B. als Kontrolle das RHCE-Gen,<br />
das in der Regel immer zweimal<br />
vorkommt. Wenn nun die Genko-<br />
pien der Exone drei der RHD- und<br />
RHCE-Gene quantifi ziert werden<br />
und das Mengenverhältnis 1:1 be-<br />
trägt, liegt eine RHD-homozygoter<br />
Proband vor; ist das Verhältnis der<br />
Genkopienzahl 1:2, ist der Proband<br />
folglich heterozygot für das RHD-<br />
Gen. In Abbildung 7a ist die Lage<br />
verschiedener fluoreszenzmar-<br />
kierter DNA-Sonden wiedergege-<br />
ben, mit denen eine solche Mes-<br />
sung durchgeführt werden kann.<br />
Bedingt durch die hohe Anzahl von<br />
varianten RHD-Allelen gibt es leider<br />
RHD-Varianten, bei denen einzelne<br />
Exons fehlen können. Aus diesem<br />
Grund ist es empfehlenswert, die<br />
Untersuchung an zwei unterschied-<br />
lichen Exons durchzuführen. In Ab-<br />
bildung 7b ist die Auswertung in-<br />
nerhalb einer Probandenstudie in<br />
Form einer Skizze wiedergegeben.<br />
Die blauen Kreuze symbolisieren<br />
dabei DNA-Proben von heterozy-<br />
goten RhD-positiven Kindern von<br />
RhD-negativen Müttern. Aufgrund<br />
der hohen Allelvariabilität im Rhe-<br />
suskomplex – zur Zeit sind über 150<br />
�Ct (TET-FAM)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RHD<br />
DNA-Sonden<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
<strong>Rhesus</strong> D, heterozygot RHCE, homozygot<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
Quantitative Bestimmung der RHD-Zygotie<br />
Auswertetabelle für die RHD-Zygotie<br />
D-homozygot<br />
Varianten bekannt – kann eine ex-<br />
akte Bestimmung der Zygotie des<br />
RHD-Gens, insbesondere bei Pro-<br />
ben mit afrikanischem Ursprung,<br />
sehr komplex werden. Die Ergeb-<br />
nisse laufender internationalen<br />
Studien werden zeigen, welche der<br />
D-heterozygot<br />
0 70 140 210 280 350 420 490<br />
RHCE<br />
Beispiel: �C T -3,0<br />
x = <strong>Rhesus</strong> D<br />
positive DNAs<br />
(homo- und<br />
heterozygot)<br />
x = <strong>Rhesus</strong> D<br />
positive Kinder<br />
von <strong>Rhesus</strong>-D<br />
negativen Müttern<br />
Abbildung 7b<br />
Bei Verwendung der Real-Time-PCR wird gemessen, bei welchem PCR-Zyklus das Amplifi kat sicher<br />
nachgewiesen werden kann. Je mehr Ausgangsmaterial vorhanden ist, desto früher ist ein Signal (CT)<br />
messbar. Aus den Unterschieden zwischen den Signalen (�CT) lässt sich bestimmen, ob die DNA für ein<br />
defi niertes Exon einfach oder doppelt vorkommt.<br />
Homozygote Probanden zeigen (�CT) Messwerte zwischen +2 und -1.<br />
Heterozygote Probanden zeigen (�CT) Messwerte zwischen -2 und -4.<br />
Die <strong>Rhesus</strong> D-positiven Kinder von <strong>Rhesus</strong> D-negativen Müttern sind RHD-heterozygot.<br />
Die blauen Kreuze liegen alle in der unteren Hälfte der Auswertetabelle.<br />
beiden genannten Methoden in<br />
praxi die sichersten Ergebnisse<br />
liefert.<br />
›<br />
Die Literaturhinweise fi nden Sie im<br />
Internet zum Download<br />
www.drk.de/blutspende<br />
❯❯❯<br />
25<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯ Kongressbericht<br />
Neuntes wissenschaftliches Symposium der Forschungsgemeinschaft<br />
der DRK-Blutspendedienste zum Thema Hämovigilanz in Dresden<br />
26<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Dr. Andreas Karl<br />
DRK-Blutspendedienst Ost gGmbH<br />
Institut für Transfusionsmedizin Plauen<br />
Im November 2005 führte die Forschungsgemeinschaft<br />
der DRK-Blutspendedienste<br />
ihr neuntes wissenschaftliches Symposium<br />
in Dresden durch. Im Mittelpunkt des<br />
Symposiums stand in diesem Jahr die Hämovigilanz.<br />
Es konnten namhafte Referenten<br />
zu verschiedenen Aspekten dieses<br />
sehr wichtigen und aktuellen Themas der<br />
klinischen Hämotherapie gewonnen werden.<br />
Ziel des Symposiums war die Vorstellung<br />
verschiedener Hämovigilanzsysteme,<br />
die Fokussierung auf aktuelle Probleme und<br />
Tendenzen bei der Überwachung des Einsatzes<br />
von Blutkomponenten sowie die<br />
Erarbeitung neuer Konzepte für eine weitere<br />
Verbesserung der Qualität in der Transfusionsmedizin.<br />
Der sichere und effektive<br />
Einsatz von Blutprodukten ist heute ohne<br />
ein etabliertes und effi zientes Hämovigilanzsystem<br />
undenkbar.<br />
Schlüsselwörter:<br />
Hämovigilanz; DRK-Forschungsgemeinschaft;<br />
Hämotherapie; Transfusions-<br />
Nebenwirkungen<br />
In November 2005, the ninth scientifi c<br />
symposium of the research foundation of<br />
the blood transfusion services of the German<br />
Red Cross took place at the Dresden<br />
congress center. Well-known national and<br />
international speakers discussed relevant<br />
aspects of haemovigilance, a current and<br />
important topic in clinical hemotherapy.<br />
During the symposium, European<br />
haemovigilance systems and data were<br />
presented as well as basic principles in<br />
infection epidemiology, clinical transfusion<br />
medicine, immunohaematology, virology and<br />
other closely related fi elds. Novel developments<br />
and perspectives for the ongoing<br />
improvement of quality and safety of<br />
haemotherapy were discussed. Safe and<br />
effective modern haemotherapy today<br />
requires an established and effi cient<br />
haemovigilance system.<br />
Keywords:<br />
haemovigilance; research foundation of<br />
the German red cross; haemotherapy;<br />
adverse events of transfusion<br />
Am 04. November 2005 führ-<br />
te die Forschungsgemeinschaft<br />
der DRK-Blutspendedienste ihr<br />
neuntes wissenschaftliches<br />
Symposium in Dresden unter der<br />
Leitung von Prof. Dr. E. Seifried,<br />
Frankfurt am Main, durch. Im Mit-<br />
telpunkt des Symposiums stand<br />
in diesem Jahr die Hämovigilanz.<br />
Es konnten namhafte Referenten<br />
zu verschiedenen Aspekten die-<br />
ses sehr wichtigen und aktuellen<br />
Themas der klinischen Hämothe-<br />
rapie gewonnen werden. Ziele des<br />
Symposiums waren die Vorstellung<br />
verschiedener Hämovigilanzsys-<br />
teme, die Fokussierung auf aktuelle<br />
Probleme und Tendenzen bei der<br />
Überwachung des Einsatzes von<br />
Blutkomponenten sowie die Erar-<br />
beitung neuer Konzepte für eine<br />
weitere Verbesserung der Quali-<br />
tät in der Transfusionsmedizin.<br />
Der sichere und effektive Ein-<br />
satz von Blutprodukten ist heute<br />
ohne ein etabliertes und effi zien-<br />
tes Hämovigilanzsystem undenk-<br />
bar. Die Europäische Kommission<br />
defi niert die Hämovigilanz als<br />
eine Reihe von systematischen<br />
Überwachungsverfahren bei der<br />
Gewinnung, Testung, Verarbei-<br />
tung, Lagerung, Verteilung und<br />
Verabreichung von Blut und Blut-<br />
bestandteilen. Diese Defi nition ist<br />
die Grundlage für den Aufbau na-<br />
tionaler Hämovigilanzsysteme.<br />
Unter Hämovigilanz versteht<br />
man neben der Erfassung und<br />
Bewertung von Nebenwirkungen<br />
bei der Verabreichung von Blut-<br />
und Plasmaprodukten die Über-<br />
wachung des Prozesses einer<br />
sorgfältigen, umfassenden Spen-<br />
derauswahl, der Herstellung,<br />
Prüfung und Freigabe der Blut-<br />
produkte und der Auswahl für<br />
den Empfänger geeigneter und<br />
sicherer Blutkomponenten.<br />
Im Vortrag von Dr. J. C. Faber,<br />
Luxemburg, wurde der aktuelle<br />
Stand des noch im Aufbau befi nd-<br />
lichen europäischen Hämovigi-<br />
lanz-Netzwerkes (EHN) vorge-<br />
stellt. In den letzten Jahren ent-<br />
standen in Europa und Amerika<br />
nationale Hämovigilanzsysteme.<br />
Die große Mehrheit der Europä-<br />
ischen Mitgliedsstaaten hat be-<br />
reits entsprechende Strukturen<br />
zur Überwachung der Hämo-<br />
therapie geschaffen, die sich auf<br />
Grund unterschiedlicher natio-<br />
naler gesetzlicher Rahmenbedin-<br />
gungen inhaltlich unterscheiden.<br />
So sind z. B. in Deutschland und<br />
Schweden Blutprodukte Arznei-<br />
mittel und fallen damit unter das<br />
Arzneimittelgesetz.<br />
Die Erhebung der Hämovigi-<br />
lanzdaten ist zum Teil gesetzlich<br />
geregelt (Deutschland, Frank-<br />
reich) oder erfolgt in anderen Län-
dern (z. B. England, Dänemark,<br />
Benelux-Staaten) auf freiwilliger<br />
Basis. Besonders wichtig ist das<br />
Erfassen und Auswerten der un-<br />
erwünschten Nebenwirkungen.<br />
In zwei Staaten werden alle Ne-<br />
benwirkungen, in den restlichen<br />
Ländern nur schwerwiegende<br />
Reaktionen gemeldet. Nur in drei<br />
Staaten erfolgt eine Meldung von<br />
Verwechslungen („wrong blood<br />
to wrong patient”).<br />
Ebenso werden in einigen<br />
Ländern so genannte „near miss<br />
events” (noch vor erfolgter Trans-<br />
fusion bemerkte Fehler) proto-<br />
kolliert, die zur Verbesserung der<br />
Transfusionssicherheit beitragen.<br />
Eine wichtige Strategie des EHN<br />
zur Umsetzung der EU-Blut-<br />
Richtlinie ist die Information und<br />
Schulung der Mitgliedsstaaten in<br />
jährlichen Fortbildungssemi-<br />
naren.<br />
Inhaltliche Schwerpunkte dieser<br />
Seminare sind die Standardisie-<br />
rung von Prozessen und Melde-<br />
formularen sowie eine Harmoni-<br />
sierung bei der Erfassung und<br />
Auswertung der europäischen<br />
Daten. Ziel ist neben der Verein-<br />
heitlichung der Meldeverfahren<br />
der Aufbau eines europäischen<br />
Frühwarnsystems (rapid alert<br />
system-RAS) zur Erhöhung der<br />
Qualität der Blutprodukte und<br />
Minimierung von Risiken durch<br />
deren Anwendung. Die Ergeb-<br />
nisse und Erfahrungen nationaler<br />
Hämovigilanzsysteme wurden<br />
von Dr. Dorothy Stainsby (Groß-<br />
britannien), Dr. Georges Andreu<br />
(Frankreich) und Dr. Brigitte Kel-<br />
ler-Stanislawski (Deutschland)<br />
vorgestellt.<br />
In Frankreich existiert ein Hämo-<br />
vigilanz-Netzwerk, an dem sich<br />
lokale Kliniken, regionale Koordi-<br />
natoren und nationale Institutionen<br />
wie die Zentrale des französischen<br />
Blutspendedienstes beteiligen. Es<br />
werden die Rückverfolgung von<br />
Blutprodukten, Transfusionsreak-<br />
tionen beim Spender und epide-<br />
miologische Daten der Spender er-<br />
fasst. Vorgestellt wurden die Daten<br />
des Beobachtungszeitraumes 2000<br />
bis 2004. Die Mehrzahl der gemel-<br />
deten Ereignisse sind allergische<br />
Reaktionen beim Empfänger. Über-<br />
tragungen von Infektionserregern<br />
kommen dagegen sehr selten vor.<br />
Zwischen 2000 und 2004 kam es<br />
aufgrund von Fehlern überwie-<br />
gend der transfundierenden Kli-<br />
nik zu AB0-Inkompatibilitäten, die<br />
in sieben Fällen zum Tod des Pa-<br />
tienten führten. Die Gefahr von<br />
transfusionsbedingten Zwischen-<br />
fällen aufgrund bakterieller Kon-<br />
taminationen beträgt 1:296.000.<br />
Im gleichen Zeitraum wurden in<br />
Frankreich sieben Todesfälle<br />
durch Transfusion von bakteriell<br />
kontaminierten Blutprodukten<br />
gemeldet.<br />
Die transfusionsassoziierte akute<br />
Lungeninsuffi zienz wird erst seit<br />
2001 gezielt erfasst. Bis 2004 wur-<br />
den 41 schwere oder tödlich ver-<br />
laufende Nebenwirkungen gemel-<br />
det. Das Risiko einer transfusions-<br />
assoziierten Virusübertragung ist<br />
von 5,82 pro 1 Million Spenden im<br />
Jahr 1994 seit Einführung der NAT<br />
auf 0,85 pro 1 Millionen Spenden<br />
gesunken. Trotz NAT wurden im<br />
Beobachtungszeitraum vier Virus-<br />
übertragungen bestätigt. Epidemi-<br />
ologische Daten zeigen, dass die<br />
HCV-, HBV-, und HIV-Prävalenzen<br />
in der französischen Spenderpo-<br />
pulation seit 1992 kontinuierlich<br />
sinken.<br />
In Großbritannien wurde 1996<br />
durch den britischen Blutspende-<br />
dienst die SHOT-Initiative ins Le-<br />
ben gerufen. In Mittelpunkt dieser<br />
Initiative steht die Verbesserung<br />
❯❯❯<br />
27<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
28<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
der klinischen Anwendung von<br />
Blutprodukten. Mit der SHOT-Stu-<br />
die gelang erstmals eine systema-<br />
tische Analyse wichtiger klinisch<br />
relevanter Hämovigilanzdaten an<br />
einer großen Patientenpopulation.<br />
Mittlerweile nehmen 94 % aller<br />
englischen Krankenhäuser an<br />
dieser Studie teil, von denen 67 %<br />
im Jahr 2004 Berichte abgegeben<br />
haben.<br />
Von insgesamt 2.628 gemeldeten<br />
Vorfällen seit 1996 waren 69,7 % in<br />
der fehlerhaften Anwendung von<br />
Blutprodukten begründet. Daraus<br />
resultierten 20 tödliche Verläufe.<br />
Hauptursache waren Verwechs-<br />
lungen und falsche Zuordnungen<br />
der Blutprodukte zu den jeweili-<br />
gen Patienten. In England wurde<br />
eine Initiative ins Leben gerufen,<br />
die diese Fehler innerhalb der<br />
nächsten 3-5 Jahre um 50 % sen-<br />
ken soll. Hier wird neben einer<br />
sicheren Rückverfolgbarkeit der<br />
Konserven eine Identifi zierung der<br />
Patienten mittels Lichtbild sowie<br />
eine Intensivierung und Verbes-<br />
serung der Ausbildung des Per-<br />
sonals gefordert.<br />
Transfusionsbedingte Übertra-<br />
gungen von Infektionskrankheiten<br />
traten in insgesamt 52 Fällen auf,<br />
wobei mehr als die Hälfte dieser<br />
Reaktionen durch bakterielle Kon-<br />
taminationen bedingt waren, die<br />
in sieben Fällen zum Tode der Pa-<br />
tienten führte. Insgesamt 19 trans-<br />
fusionsbedingte Übertragungen<br />
von Viren wurden seit 1996 doku-<br />
mentiert, davon allein zehn Fälle<br />
einer HBV-Infektion.<br />
Zur Reduktion des Risikos einer<br />
TRALI werden in UK seit 2003/04<br />
nur noch FFP von männlichen<br />
Spendern verwendet. Spender<br />
mit HLA- oder HNA-Antikörpern<br />
werden ausgeschlossen.<br />
Arzneimittelgesetz und Trans-<br />
fusionsgesetz bilden in Deutsch-<br />
land die Grundlage des etablier-<br />
ten Hämovigilanzsystems. Im §15<br />
des Transfusionsgesetzes wird<br />
die Einrichtung eines Qualitätssi-<br />
cherungssystems als Vorausset-<br />
zung defi niert.<br />
Bei der Auswertung der gemel-<br />
deten Nebenwirkungen zeigten<br />
sich gegenüber anderen Hämo-<br />
vigilanzsystemen deutliche Un-<br />
terschiede im Meldeverhalten von<br />
Fehltransfusionen (Incorrect blood<br />
component transfused – ICBT),<br />
von denen 2004 in Deutschland<br />
drei Fälle gemeldet wurden (UK<br />
2004 – 439 gemeldete Fälle).<br />
Im Vortrag von Dr. R. Knels<br />
wurde die Inzidenz von hämoly-<br />
tischen Transfusionsreaktionen<br />
durch Verwechslungen in Deutsch-<br />
land (1:26.500 bis 1:38.000) mit An-<br />
gaben aus England (1:50.000) und<br />
Frankreich (1:94.000) verglichen.<br />
Zur Interpretation der Zahlen<br />
gibt es in Deutschland keine klare<br />
Datenlage, da Fehltransfusionen<br />
nicht meldepfl ichtig sind. In ihren<br />
weiteren Ausführungen für das PEI<br />
ging Frau Dr. Keller-Stanislawski<br />
auf die bakterielle Kontamination<br />
von Blutprodukten ein.<br />
Im Vergleich zum französischen<br />
Hämovigilanzsystem fanden sich<br />
deutliche Unterschiede bei der<br />
Anzahl gemeldeter Reaktionen.<br />
So wurden 1997 in Frankreich 191<br />
Fälle gemeldet, während in Deut-<br />
schland nur insgesamt fünf Neben-<br />
wirkungen beschrieben wurden,<br />
die auf bakterielle Kontamination<br />
zurückzuführen sind.<br />
Von Frau Dr. G. Walther-Wenke<br />
wurden erste Ergebnisse der<br />
GERMS-Studie (German Evalua-<br />
tion of Regular Monitoring Study)<br />
der Forschungsgemeinschaft der<br />
DRK-Blutspendedienste, einer<br />
prospektiven Multicenter-Studie<br />
zur bakteriellen Kontamination<br />
von Thrombozytenkonzentraten,<br />
vorgestellt.Das Kontaminations-<br />
monitoring mit BacT/ALERT (Bio<br />
Merieux) an mehr als 50.000 Throm-<br />
bozytenkonzentraten in neun
Studienzentren (Breitscheid,<br />
Dresden, Frankfurt/Main, Ulm,<br />
München, Münster, Nürnberg,<br />
Oldenburg, Springe) zeigt bei<br />
0,07 % der TK bestätigt positive<br />
Kulturergebnisse. Entgegen<br />
der bisher in der Literatur be-<br />
schriebenen Unterschiede hin-<br />
sichtlich der Kontaminationsrate<br />
von Apherese-Thrombozytenkon-<br />
zentraten und Pool-Thrombozyten-<br />
konzentraten konnten in der pro-<br />
spektiven GERMS-Studie keine<br />
signifi kanten Unterschiede ge-<br />
funden werden.<br />
Aufgrund der Tatsache, dass<br />
die mittlere Inkubationszeit bis<br />
zum positiven Kultursignal 3,8<br />
Tage dauert und bis zu diesem<br />
Zeitpunkt der überwiegende Teil<br />
der TK bereits transfundiert war,<br />
muss die Strategie des Sterili-<br />
tätsmonitorings mittels Kulturme-<br />
thode bezüglich ihrer Effi zienz<br />
kritisch bewertet werden.<br />
Ein möglicher Weg für die zeit-<br />
nahe Testung wäre der direkte<br />
molekularbiologische Bakterien-<br />
nachweis. Die Grenzen der Metho-<br />
de wurden durch einen bedeut-<br />
samen Zwischenfall deutlich.<br />
Zwei als negativ getestete Aphe-<br />
rese-TK aus einer Apherese lösten<br />
bei zwei Patienten schwerwiegen-<br />
de Septitiden aus. Beide TK waren<br />
mit langsam sich vermehrenden<br />
Bakterien der Spezies Klebsiella<br />
pneumoniae kontaminiert, die der<br />
Detektion entgingen. Die klinische<br />
Nachbetrachtung zu allen ande-<br />
ren als bakteriell kontaminiert<br />
einzuordnenden TK zeigte hinge-<br />
gen keinen weiteren Sepsisfall.<br />
Die TRALI scheint auch in Deut-<br />
schland eine wichtige Rolle bei<br />
den schweren Transfusionsreakt-<br />
ionen zu spielen. Um eine bessere<br />
Datenlage zu erhalten, ist vom PEI<br />
eine Studie zur Induktion und Dif-<br />
ferenzierung von TRALI-Reakti-<br />
onen vorgesehen.<br />
In seinem Vortrag gab Prof. J. Bux<br />
zu diesem Aspekt einen zusam-<br />
menfassenden Überblick. So gibt<br />
es zwar immer noch geringfügige<br />
Unterschiede bei der Defi nition<br />
einer TRALI zwischen Nordameri-<br />
ka und Europa, sicher ist jedoch,<br />
dass es für die Diagnose einer<br />
TRALI einer Röntgenthoraxauf-<br />
nahme mit neu aufgetretenen In-<br />
fi ltrationen bedarf. Nach neuen<br />
Erkenntnissen wird eine antikör-<br />
pervermittelte immunogene von<br />
einer nicht-immunogenen Form<br />
unterschieden. Während die oft<br />
lebensbedrohlich verlaufende<br />
immunogene TRALI durch leuko-<br />
zytäre Antikörper (HLA- bzw.<br />
HNA-AK) hervorgerufen wird,<br />
kann die nicht-immunogene TRALI<br />
bei der Transfusion von länger<br />
gelagerten, zellulären Blutpro-<br />
dukten auftreten bzw. bei schwer<br />
kranken Patienten, ohne dass prä-<br />
formierte Antikörper die Granulo-<br />
zyten aktivieren.<br />
Das TRALI-Risiko infolge der<br />
Transfusion von Blutprodukten<br />
kann durch die Selektion der<br />
Spender, aber auch durch die<br />
Auswahl geeigneter Konserven<br />
bei Risikopatienten bereits heute<br />
minimiert werden.<br />
❯❯❯<br />
29<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
30<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Die Auswertung des Paul-Ehrlich-<br />
Institutes (PEI) zur Infektionssicher-<br />
heit von Blutprodukten zeigte, dass<br />
durch die Einführung der PCR so-<br />
wie die Quarantänelagerung von<br />
FFP eine deutliche Verminderung<br />
des Risikos einer Virusübertra-<br />
gung besonders bei HIV und HCV<br />
erreicht wurde. Seit Einführung<br />
der obligatorischen NAT-Testung<br />
wurden bei diesen beiden Virus-<br />
erkrankungen nur ein HVC-Über-<br />
tragungsfall gemeldet.<br />
Etwas anders stellt sich dies bei<br />
der Hepatitis B dar, insbesondere<br />
wurde auf die Gefahr der Über-<br />
tragung einer Hepatitis B durch<br />
„Chronische Low Level Carrier”<br />
hingewiesen. Mit der zwischen-<br />
zeitlich erfolgten Einführung der<br />
Anti-HBc-Testung ist die diagnos-<br />
tische Lücke geschlossen und ein<br />
zusätzlicher Sicherheitsgewinn<br />
erreicht worden.<br />
Frau Dr. Keller-Stanislawski be-<br />
richtete von insgesamt 57 mög-<br />
lichen bzw. gesicherten HBV-In-<br />
fektionen bei Empfängern von<br />
Blutprodukten, von denen neun<br />
durch ein Anti-HBc-Screening<br />
verhindert worden wären. Erste<br />
Erfahrungen beim Einsatz die-<br />
ser Testmethode im Rahmen einer<br />
Multicenterstudie der DRK-Blut-<br />
spendediensteBaden-Württem- berg–Hessen,Berlin-Branden- burg, Nord und Sachsen wurden<br />
von Dr. M. Schmidt präsentiert.<br />
Die Auswahl einer Testmetho-<br />
de, die neben einer hohen Sensi-<br />
tivität auch eine gute Spezifi tät<br />
garantiert, ist für jeden Blutspen-<br />
dedienst von großer Bedeutung,<br />
hilft sie doch, den zu erwartenden<br />
Verlust an Spendern zu minimie-<br />
ren.<br />
Die Studie zeigte, dass die Sen-<br />
sitivität der verschiedenen Tests<br />
vergleichbar war, jedoch bei der<br />
Spezifi tät beträchtliche Unter-<br />
schiede auftraten. Außerdem<br />
wurden regionale Unterschiede<br />
in der Prävalenz von Anti-HBc-<br />
positiven Blutspendern festge-<br />
stellt, die durch die unterschied-<br />
liche Verfahrensweise bei der<br />
HBV-Testung in der Vergangen-<br />
heit erklärbar ist. Seit Beginn der<br />
Routinetestung auf Anti-HBc wird<br />
eine Fall-Kontroll-Studie weiter-<br />
geführt, bei der durch Look-back<br />
untersucht werden soll, ob Anti-<br />
HBc-positive Blutprodukte von<br />
Mehrfachspendern HBV-Infekti-<br />
onen bei den Empfängern verur-<br />
sacht haben. Es wird ein Vergleich<br />
der Prävalenz von Anti-HBc, Anti-<br />
HBs und HBV-DNA zwischen Fall-<br />
und Kontrollgruppe gemacht. An<br />
dieser Studie nehmen die Blut-<br />
spendediensteBaden-Württem- berg–Hessen, NSTOB, Nord und<br />
Sachsen teil.<br />
Die Vorstellung der neuesten<br />
epidemiologischen Daten des<br />
Robert Koch-Institutes von Frau<br />
Dr. Offergeld bestätigten ein sehr<br />
niedriges Infektionsrisiko. Im Jahr<br />
2004 lag der Anteil der bestätigt<br />
positiven Spender pro 100.000<br />
Neuspender für HIV bei 4,8, für<br />
HCV bei 85,3, für HBV bei 156,3<br />
und für Syphilis bei 36,2.<br />
Bei Mehrfachspendern lag er<br />
für HIV bei 0,9, für HCV bei 1,3,<br />
für HBV bei 0,6 und für Syphilis<br />
bei 2,0. Vergleicht man die Daten<br />
für Neuspender über den 6-Jahres-<br />
zeitraum 1999-2004, so erkennt<br />
man einen relativ konstanten Ver-<br />
lauf der HCV-, HBV- und Syphilis-<br />
infektionszahlen. Im Hinblick auf
die HIV-Infektionen war von 1999<br />
bis 2003 ein signifi kanter Anstieg<br />
zu beobachten. Die HIV-Infektions-<br />
zahlen im Jahr 2004 waren wieder<br />
leicht rückläufi g. Dennoch bedarf<br />
dieser Trend der sorgfältigen Be-<br />
obachtung und weiterer Analysen.<br />
Bei den Infektionen unter Mehr-<br />
fachspendern, d. h. Personen, die<br />
im Blutspendedienst mindestens<br />
eine serologische Voruntersuchung<br />
hatten, erkennt man in demselben<br />
Betrachtungszeitraum einen signi-<br />
fi kanten Abfall der HCV-Infektio-<br />
nen zwischen 1999 und 2003.<br />
Die inzidenten HBV-Infektionen<br />
zeigen seit 2001 ebenfalls einen<br />
abfallenden Trend. Hingegen<br />
erkennt man bei den Syphilis-<br />
Infektionen seit 2000 und den<br />
HIV-Infektionen seit 2001 einen<br />
ansteigenden Trend.<br />
Nach wie vor problematisch ist<br />
die Häufung der Neuinfektionen<br />
besonders in den Ballungsgebie-<br />
ten. Als häufi gste nachträglich<br />
angegebene oder vermutete Über-<br />
tragungswege wurden sexuelle<br />
Kontakte unter Männern und he-<br />
terosexuelle Kontakte mit neuen/<br />
unbekannten Partnern identifi -<br />
ziert.<br />
In der Auswertung der Hämo-<br />
vigilanzdaten des DRK-Blutspen-<br />
dedienstes Baden-Württemberg –<br />
Hessen von Dr. W. Sireis wurde<br />
hinsichtlich der epidemiolo-<br />
gischen Situation ein ähnliches<br />
Bild festgestellt. Die Auswer-<br />
tungen zeigten kein höheres Ri-<br />
siko der Infektionsübertragung<br />
bei Apheresespenden im Ver-<br />
gleich zu Vollblutspenden und<br />
keinen Anstieg der HIV-Infekti-<br />
onen in der Spenderpopulation.<br />
Die vorliegenden Look-back-<br />
Daten unterstreichen auch hier,<br />
das die Einführung der Anti-HBc-<br />
Testung besonders durch das Er-<br />
kennen von Spendern mit niedrig<br />
virämischen HBV-Infektionen einen<br />
zusätzlichen Sicherheitsgewinn<br />
erbringt.<br />
Die Implementierung eines Ab-<br />
weichungs- und Risikomanage-<br />
ments in das Qualitätssicherungs-<br />
sytem ist ein wichtiger Schritt zur<br />
Verbesserung von Qualität und<br />
Sicherheit der Blutprodukte.<br />
Professor L. Gürtler wies in<br />
seinem Vortrag auf die zuneh-<br />
menden Herausforderungen hin,<br />
denen sich die Blutspendedienste<br />
durch das Auftreten neuer Krank-<br />
heitserreger stellen müssen. Be-<br />
sonders die immer raschere Ver-<br />
breitung von Infektionen durch<br />
den gestiegenen Reiseverkehr<br />
stellt ein wichtiges Problem für<br />
die Spenderauswahl dar. Von be-<br />
sonderer aktueller Bedeutung<br />
sind Zoonosen, Erkrankungen, die<br />
primär in Tieren verbreitet sind.<br />
Aktuelle Beispiele dafür sind SARS,<br />
vCJD, WNV oder die Infl uenzavi-<br />
ren (H5N1). Wie schwierig sich die<br />
Bekämpfung von Infektionskrank-<br />
heiten darstellt, wird am Beispiel<br />
von Polio deutlich. Trotz effektiver<br />
Impfstoffe treten insbesondere in<br />
Entwicklungsländern immer wieder<br />
Polio-Epidemien auf. Zusammen-<br />
fassend wurde festgestellt, dass<br />
auch in Zukunft neue Infektionser-<br />
reger auftauchen werden, z. B.<br />
durch Mutationen bekannter Viren.<br />
Parallel dazu wird aber auch die<br />
Zahl antiviraler Medikamente und<br />
Vakzine zunehmen, solange diese<br />
kommerziellen Nutzen verspre-<br />
chen.<br />
Das neunte wissenschaftliche<br />
Symposium der Forschungsge-<br />
meinschaft der DRK-Blutspende-<br />
dienste in Dresden zeigte zum<br />
wiederholten Mal eindrucksvoll<br />
die vielfältigen Anstrengungen<br />
und wissenschaftlichen Aktivitäten<br />
der DRK-Blutspendedienste auf<br />
dem Gebiet der klinischen Trans-<br />
fusionsmedizin.<br />
❯❯❯<br />
31<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
32<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Therapie mit Erythrozytenkonzentraten<br />
bei chronischer Anämie<br />
Prof. emerit. Dr. med. Hermann Heimpel<br />
Ehem. Ärztlicher Direktor der <strong>Abteilung</strong><br />
Innere Medizin III, Universitätsklinikum Ulm<br />
Dr. med. Britta Höchsmann<br />
Dr. med. Markus Wiesneth<br />
Institut für Klinische Transfusionsmedizin<br />
und Immungenetik Ulm und<br />
Institut für Transfusionsmedizin,<br />
Universitätsklinikum Ulm<br />
DRK-Blutspendedienst<br />
Baden-Württemberg – Hessen gGmbH<br />
Die Transfusion von Erythrozytenkonzentraten<br />
ist ein wesentlicher Bestandteil<br />
aller Therapiekonzepte der chronischen<br />
Anämie. Die Langzeitsubstitution trägt<br />
als Palliativmaßnahme entscheidend zur<br />
Erhaltung einer adäquaten Lebensqualität<br />
dieser Patienten bei und ist insbesondere<br />
in klinisch orientierten transfusionsmedizinischen<br />
Einrichtungen ambulant gut<br />
durchführbar.<br />
Transfusion of red blood cells is a<br />
substantial part of all therapeutic<br />
strategies for patients with chronic<br />
anaemia. Long term substitution makes<br />
a signifi cant contribution to guarantee<br />
adequate quality of life also in palliative<br />
care situations. Institutes for transfusion<br />
medicine with a clinical focus are specially<br />
qualifi ed for outpatient transfusions.<br />
Einleitung<br />
Die Behandlung der Anämie durch Substitution allogener Erythrozyten hat sich seit<br />
der Beschreibung der wichtigsten Blutgruppen-Antigene durch Karl Landsteiner im<br />
Jahr 1901 als ein Standardverfahren etabliert, ohne das die weitere Entwicklung so-<br />
wohl der chirurgischen als auch der internistischen Therapie nicht möglich gewesen<br />
wäre. Die zunächst im Vordergrund stehenden wissenschaftlichen und logistischen<br />
Probleme der Verträglichkeit und der Lagerfähigkeit der Blutpräparate sind seit vielen<br />
Jahren für die tägliche Praxis zufriedenstellend gelöst. Wesentliche Schritte waren<br />
dabei die Entdeckung weiterer Blutgruppen-Systeme, wie beispielsweise 1940 des<br />
<strong>Rhesus</strong>-Systems und die Einführung der „Hämotherapie nach Maß“, das heißt eine<br />
Blutkomponententherapie mit Transfusion nur der benötigten Bestandteile in ent-<br />
sprechender Menge und Wirksamkeit. Dieses Konzept wurde Mitte der 70er Jahre in<br />
Deutschland, insbesondere von Andreas Ganzoni, dem damaligen Ärztlichen Direktor<br />
der DRK-Blutspendezentrale Ulm, vorangetrieben (11). Das damit verbundene Ende<br />
der Vollblutära und die gleichzeitige technische Weiterentwicklung mit Blutbeutelsys-<br />
temen anstelle von Flaschen sowie die Verwendung von Additivlösungen zur Lagerung<br />
der Erythrozytenkonzentrate haben den hohen Qualitätsstandard der heutigen Trans-<br />
fusionsmedizin begründet. Die weiteren Anstrengungen konzentrierten sich insbeson-<br />
dere auf die Einführung von Testverfahren zur Vermeidung von mit Blut übertragbaren<br />
Infektionskrankheiten, vor allem der Übertragung von HIV und Hepatitisviren.<br />
Aktuelle Fragen der Therapie mit Blutkomponenten und damit der Erythrozyten-<br />
substitution betreffen vorwiegend die Indikation und die individuelle Anpassung der<br />
Transfusionsdosis, insbesondere seit bei vielen Anämieformen als Alternative zur<br />
Transfusion die Stimulation der autologen Erythrozytenbildung durch erythropoe-<br />
tische Wachstumsfaktoren (Erythropoetin) zur Verfügung steht (7).<br />
Diagnose<br />
„Chronische Anämie“<br />
Der Begriff einer „Chronischen<br />
Anämie” ist in Hinsicht der dabei<br />
auftretenden transfusionsmedizi-<br />
nischen Probleme nur teilweise<br />
eindeutig zu defi nieren. Anämien,<br />
bei denen über Monate oder Jahre<br />
regelmäßig Erythrozyten substi-<br />
tuiert werden müssen, beruhen<br />
überwiegend auf einer vermin-<br />
derten Erythrozytenproduktion<br />
im Rahmen eines therapierefrak-<br />
tären Knochenmarkversagens.<br />
Dazu gehören die seltene Aplas-<br />
tische Anämie (AA), die noch<br />
seltenere isolierte Aplastische
Anämie (PRCA, Pure Red Cell<br />
Aplasia) und Formen des Myelo-<br />
dysplastischen Syndroms (MDS)<br />
mit zunächst isolierter Insuffi zi-<br />
enz der Erythropoese (RA, Refra-<br />
ktäre Anämie) sowie Patienten mit<br />
akuter Leukämie, bei denen nach<br />
einem Rezidiv nur noch eine in-<br />
komplette Remission erreicht wur-<br />
de und die teilweise sekundär ei-<br />
nen MDS-ähnlichen Verlauf zei-<br />
gen. Eine weitere Gruppe bilden<br />
die heute das Erwachsenenalter<br />
erreichenden hereditären Anä-<br />
mien, wie die Thalassämiesyn-<br />
drome. Am häufi gsten sind Patien-<br />
ten mit soliden Tumoren oder Neo-<br />
plasien der Lymphohämatopoese<br />
unter und nach intensiver zyto-<br />
statischer Chemotherapie sowie<br />
nach autologer oder allogener<br />
Blutstammzelltransplantation. Bei<br />
diesen Patienten sind in einem be-<br />
grenzten, allerdings prospektiv<br />
oft nicht genau festzulegenden,<br />
Zeitraum Erythrozyten, meist<br />
gleichzeitig auch Thrombozyten,<br />
zu substituieren (Tabelle 1). Eine<br />
weitere große Gruppe beinhaltet<br />
Patienten im höheren Lebensalter<br />
Patientengruppen mit Erythrozytensubstitution<br />
Gruppe 1<br />
Patienten mit langzeitiger Erythrozytensubstitution (Jahre)<br />
› Aplastische Anämie (AA)<br />
› Isolierte Aplastische Anämie (PRCA, Pure Red Cell Aplasia)<br />
› Myelodysplastisches Syndrom (MDS) mit geringer Progressionstendenz<br />
› Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) mit schwerer Anämie<br />
› Thalassämia major und intermedia<br />
› Pyruvatkinasemangel und andere enzymopenische hämolytische Anämien<br />
Gruppe 2<br />
Patienten mit passagerer Erythrozytensubstitution (Monate)<br />
› Solider oder hämatopoetischer Tumor unter zytostatischer Chemotherapie<br />
› Solider oder hämatopoetischer Tumor mit Palliativtherapie<br />
› Chronisch-myeloproliferatives Syndrom / Idiopathische Myelofi brose<br />
› Nach autologer oder allogener Blutstammzelltransplantation<br />
› Autoimmunhämolytische Anämie<br />
Gruppe 3<br />
Patienten mit interkurrenter Erythrozytensubstitution<br />
› Infektion oder Schwangerschaft bei angeborener hämolytischer oder<br />
dyserythropoetischer Anämie<br />
› Erworbene autoimmunhämolytische Anämie in Teilremission<br />
› Schwere nutritive Anämie (Eisen-, Vitamin B12-, Folsäure-Mangel)<br />
› Renale Anämie bis zum Wirkungseintritt von Erythropoetin<br />
› Alle Erkrankungen der Gruppe 1 ohne ständigen Transfusionsbedarf<br />
›<br />
Tabelle 1<br />
mit Anämie unklarer Genese oder<br />
infolge chronischen Blutverlusts.<br />
Die verbesserte Überlebenszeit<br />
und der damit längere Substituti-<br />
onsbedarf der Patienten mit MDS,<br />
therapierefraktären Leukämien<br />
oder soliden Tumoren haben ins-<br />
gesamt zu einer Zunahme der Pa-<br />
tienten mit chronischem Transfusi-<br />
onsbedarf geführt und den Weg-<br />
fall der Patienten mit z. B. renaler<br />
Anämie, die auf eine Erythropoe-<br />
tinbehandlung ansprechen, mehr<br />
als kompensiert. In der Transfusi-<br />
onsmedizinischen Ambulanz des<br />
Ulmer Instituts hat sich somit die<br />
Zahl der jährlich transfundierten<br />
Erythrozytenpräparate im Zeitraum<br />
1995 bis 2005 mehr als verdoppelt.<br />
Eine Gliederung der transfundierten<br />
Patienten nach der jeweils zugrun-<br />
de liegenden Erkrankung fi ndet<br />
sich in Abbildung 1.<br />
Ziel der Erythrozytensubstitution<br />
Der vorliegende Beitrag be-<br />
schränkt sich auf die Indikationen<br />
zur Erythrozytentransfusion bei<br />
Erwachsenen und Jugendlichen<br />
nach Abschluss der Wachstums-<br />
periode, bei denen Erythrozyten<br />
zur Erhaltung einer ausreichenden<br />
Sauerstoffversorgung der Gewe-<br />
❯❯❯<br />
33<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
34<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Diagnosehäufigkeit der Patienten in der Transfusionsmedizinischen<br />
Ambulanz des Ulmer Instituts im Jahr 2005<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
ALL/AML MDS/cMPS CLL/CML LYMPHOM AA/PNH SONSTIGE BLU/UNK SOLITUM<br />
ALL/AML: Akute lymphatische/myeloische Leukämie<br />
MDS/cMPS: Myelodysplastisches/chronisch-myeloproliferatives<br />
Syndrom<br />
CLL/CML: Chronisch-lymphatische/myeloische<br />
Leukämie<br />
LYMPHOM: Morbus Hodgkin/Non-Hodgkin-Lymphom/<br />
Multiples Myelom<br />
be substituiert werden müssen.<br />
Dagegen umfasst bei Kindern die<br />
Indikation die Gewährleistung<br />
eines normalen Wachstums und<br />
einer normalen Organentwicklung<br />
sowie die Vermeidung von Ent-<br />
wicklungsanomalien des Gesicht-<br />
schädels und klinisch relevanter<br />
extramedullärer Blutbildungsher-<br />
de. Die pädiatrischen Aspekte der<br />
Erythrozytentransfusion werden in<br />
einem separaten Beitrag in einer<br />
der nächsten Ausgaben der „hämo-<br />
therapie” dargestellt.<br />
Ziel der Erythrozytensubstitution<br />
bei den hier betrachteten Patien-<br />
tengruppen ist neben der Reduk-<br />
tion einer anämiebedingten Mor-<br />
talität die Erhaltung einer ausrei-<br />
chenden Leistungsfähigkeit und<br />
Lebensqualität. Beide Parameter<br />
sind verständlicherweise von den<br />
AA/PNH: Aplastische Anämie/Paroxysmale nächtliche<br />
Hämoglobinurie<br />
SONSTIGE: Sonstige (z.B. Leberzirrhose, Niereninsuffizienz)<br />
BLU/UNK: Blutung (z.B. Gl-Blutung, M. Osler) und<br />
Anämie unklarer Genese<br />
SOLITUM: Solide Tumore (Gl, Mamma, Prostata)<br />
Erwartungen und subjektiven Per-<br />
spektiven der Patienten abhängig.<br />
Von ärztlicher Seite sind nicht nur<br />
die akuten Risiken, sondern bei<br />
langzeitig zu erwartender Trans-<br />
fusionsbehandlung insbesondere<br />
die zwangsläufi ge Entwicklung<br />
einer sekundären Hämochroma-<br />
tose und deren Folgen gegenüber<br />
dem Nutzen der Transfusionsthe-<br />
rapie abzuwägen (Abbildung 2).<br />
Pathophysiologie<br />
chronischer Anämien<br />
Im Gegensatz zu akuten Anä-<br />
mien durch Blutverlust oder infol-<br />
ge akuter Hämolyse ist das Ge-<br />
samtblutvolumen bei chronischen<br />
Anämien normal, da die Vermin-<br />
derung des zirkulierenden Ery-<br />
throzytenvolumens durch eine<br />
‹<br />
Abbildung 1<br />
Vermehrung des Plasmavolumens<br />
ausgeglichen wird. Aus Hämato-<br />
krit und Hämoglobinkonzentration<br />
kann also bei chronischen Anä-<br />
mien auf den Grad der Verminde-<br />
rung der Erythrozytenmasse ge-<br />
schlossen werden. Eine Ausnah-<br />
me ist die nicht selten langfristig<br />
transfusionsbedürftige Anämie bei<br />
stark vergrößerter Milz z.B. bei<br />
Patienten mit Myelofi brose. Hier<br />
tritt durch reversible Sequestrati-<br />
on von Erythrozyten in der roten<br />
Pulpa eine Verteilungsanämie be-<br />
reits bei normalen oder sogar er-<br />
höhten Werten der zirkulierenden<br />
Erythrozytenmasse auf. Damit ist<br />
die Beobachtung erklärt, dass bei<br />
diesen Patienten der Anstieg des<br />
Hämatokrits und der Hämoglobin-<br />
konzentration nach Erythrozyten-<br />
transfusion geringer ist, als nach<br />
Körpergewicht und Menge der<br />
transfundierten Erythrozyten zu<br />
erwarten wäre.<br />
Die Tatsache, dass bei der über-<br />
wiegenden Zahl der Patienten mit<br />
chronischer Anämie das Gesamt-<br />
blutvolumen normal ist, unterstreicht<br />
den klinischen Vorteil der heute<br />
ausnahmslosen Verwendung von<br />
„gepackten” Erythrozytenkonzen-
traten anstelle der früher üblichen<br />
Vollbluttransfusionen, unabhängig<br />
von den logistischen Vorteilen. Die<br />
gefürchtete akute Herzinsuffi zienz<br />
durch Volumenüberladung nach<br />
Transfusion spielt, abgesehen von<br />
Ausnahmefällen mit vorbestehen-<br />
der schwerer Herzinsuffi zienz, auch<br />
bei der üblichen Gabe von zwei<br />
Erythrozytenkonzentraten keine<br />
Rolle mehr.<br />
Regulation und Kompensation<br />
der chronischen Anämie<br />
›<br />
Abbildung 2<br />
Ziel aller regulativen Kompensa-<br />
tionsvorgänge bei Anämien ist die<br />
Aufrechterhaltung der Sauerstoff-<br />
versorgung der Gewebe. Diese be-<br />
kannten Adaptationsvorgänge be-<br />
treffen vor allem die Erhöhung des<br />
Herzzeitvolumens. Bei chronischen<br />
Anämien steht in Ruhe – im Gegen-<br />
satz zu akuten Anämien – die Er-<br />
höhung des Schlagvolumens mit<br />
Verminderung des arteriellen Wie-<br />
derstands und Erhöhung der Blut-<br />
druckamplitude im Vordergrund.<br />
Eine zusätzliche Tachykardie tritt<br />
meist nur bei Belastung ein. Die Er-<br />
höhung des Herzzeitvolumens ist<br />
bei herzgesunden Patienten der Hä-<br />
moglobinkonzentration etwa um-<br />
Nutzen-Risiko-Analyse der Erythrozytentransfusion in<br />
Abhängigkeit von der Hämoglobinkonzentration<br />
6 7 Hb<br />
g/dl<br />
9 10<br />
Nutzen Risiko<br />
gekehrt proportional. Eine weite-<br />
re Steigerung ist nur noch einge-<br />
schränkt möglich. Zudem ist die<br />
Sauerstoffbindung des Hämoglo-<br />
bins durch einen Anstieg des ery-<br />
throzytären2,3-Diphosphoglyce- rat verschoben, so dass O2 in den<br />
Kapillaren leichter ans Gewebe ab-<br />
gegeben wird. Trotz der dadurch<br />
bedingten besseren Ausschöpfung<br />
der arteriellen Sauerstoffsättigung<br />
ist aufgrund des erhöhten Fluss-<br />
volumens die arteriovenöse Sauer-<br />
stoffkonzentration vermindert. Die<br />
Lungenfunktion ist auch bei aus-<br />
geprägten chronischen Anämien<br />
ohne vorbestehende Lungener-<br />
krankung nicht verändert.<br />
Aus den geschilderten physio-<br />
logischen Regulations- und Kom-<br />
pensationsvorgängen resultieren<br />
drei wesentliche Folgerungen für<br />
die Indikation und Dosisanpas-<br />
sung der Erythrozytentransfusion<br />
bei chronischen Anämien:<br />
› Die Adaptationsbreite, die<br />
bei vorbestehenden kardio-<br />
pulmonalen Erkrankungen<br />
eingeschränkt ist und im Alter<br />
abnimmt, bestimmt die Anä-<br />
miesymptome.<br />
› Die Anämiesymptome auf-<br />
grund der Erhöhung des Herz-<br />
zeitvolumens sind weniger<br />
bedrohlich als diejenigen infol-<br />
ge einer verminderten Sauer-<br />
stoffversorgung der Gewebe,<br />
insbesondere des Gehirns.<br />
› Die anamnestische Bewer-<br />
tung der Anämiesymptome<br />
(s. Tabelle 2) hat nicht nur den<br />
Ruhezustand, sondern ebenso<br />
die Symptomatik unter Belas-<br />
tung zu berücksichtigen.<br />
❯❯❯<br />
35<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
36<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Indikation zur Erythrozytentransfusion<br />
Die Anämie ist bei vielen chro-<br />
nischen Erkrankungen ein unab-<br />
hängiger Risikofaktor für Morta-<br />
lität und Morbidität. Dies gilt nicht<br />
nur für Anämien durch eine iso-<br />
lierte Insuffi zienz der Erythropo-<br />
ese, sondern auch für die ungleich<br />
häufi geren Erkrankungen der Hä-<br />
matopoese insgesamt, sowie für an-<br />
dere Krankheiten, bei denen die An-<br />
ämie eine von mehreren Folgezu-<br />
ständen ist. Hier ist zunächst nicht<br />
zu entscheiden, ob die Anämie le-<br />
diglich ein die Schwere der Krank-<br />
heit widerspiegelnder Risikoindi-<br />
kator ist oder ob sie über die oben<br />
genannten pathophysiologischen<br />
Abläufe das Risiko direkt erhöht.<br />
Daten aus einigen prospektiv ran-<br />
domisierten Interventionsstudien<br />
bei Patienten mit mäßiger Anämie<br />
und Herzinsuffi zienz, HIV, entzünd-<br />
lichen Darmerkrankungen und an-<br />
deren chronischen Krankheiten<br />
sprechen dafür, dass eine effektive<br />
Behandlung der Anämie zu einer<br />
Verminderung der Mortalität und<br />
der Morbidität – gemessen z. B.<br />
an der Frequenz der Klinikaufent-<br />
halte – und zu einer Verbesserung<br />
der Lebensqualität führt (9). Dage-<br />
gen existieren über den Hämoglo-<br />
bingrenzwert, bei dem eine regel-<br />
mäßige Substitution begonnen wer-<br />
den soll, und über den Zielwert,<br />
der durch die Substitution bei<br />
chronischen Anämien erreicht wer-<br />
den soll, keine experimentellen<br />
Daten.<br />
Die Indikation zur Erythrozyten-<br />
transfusion ist deshalb individuell<br />
zu stellen und abhängig von Fak-<br />
toren wie<br />
› Ursache der Anämie<br />
(Bildungsstörung, Verlust,<br />
Hämolyse)<br />
› Kausale Therapiemöglichkeit<br />
(Eisen, Vitamin B12)<br />
› Ansprechen auf Erythropoetin<br />
› Prognose und Verlauf der<br />
Grunderkrankung<br />
› Dauer der Anämie<br />
(akut, passager, chronisch)<br />
› Schweregrad und klinische<br />
Symptomatik<br />
› Begleiterkrankung<br />
(kardial, pulmonal)<br />
› Kompensationsmöglichkeit<br />
(Alter)<br />
› Leistungserwartungen des<br />
Patienten.<br />
Die folgenden Empfehlungen<br />
beruhen auf eigenen Erfahrungen,<br />
Beobachtungsstudien, teilweise<br />
evidenzbasierten Leitlinien (1,5)<br />
und Analogien zu Empfehlungen<br />
aus der Intensivmedizin, die sich<br />
auf prospektive Studien stützen.<br />
Ein Teil dieser Angaben betrifft<br />
die Indikation zu einer wirksamen<br />
Anämiebehandlung als solche,<br />
schließt also neben der Erythrozy-<br />
tentransfusion die Behandlung mit<br />
Erythropoetinpräparaten ein (7).<br />
Welcher Hämoglobinwert soll<br />
nicht unterschritten werden?<br />
Hämoglobinwert oder Hämato-<br />
krit sind Surrogatmarker für das<br />
eigentliche Behandlungsziel, näm-<br />
lich der Gewährleistung einer<br />
ausreichenden Sauerstoffversor-<br />
gung der Gewebe. Primär richtet<br />
sich die Transfusionsindikation<br />
deshalb nicht nach der Hämoglo-<br />
binkonzentration, sondern nach<br />
den auf der Anämie beruhenden<br />
Symptomen. Unterhalb einer Hb-<br />
Konzentration von 8 g/dl treten re-<br />
gelmäßig Symptome der Hyper-<br />
zirkulation auf, häufi g zusätzlich<br />
Symptome der Hypoxie (Tabelle<br />
2). Darüber hinaus ist bereits bei<br />
Belastungen des täglichen Lebens<br />
die Leistungsfähigkeit erheblich<br />
eingeschränkt. Schwere körper-<br />
liche Arbeit oder stärkere sport-<br />
liche Belastung können zur Hypo-<br />
xie mit möglicherweise lebens-<br />
bedrohlichen Folgen führen. Der<br />
Hämoglobinwert von 8 g/dl wird<br />
deswegen allgemein als die<br />
Schwelle betrachtet, unterhalb<br />
der eine rasch wirksame Behand-<br />
lung der Anämie erfolgen soll (9).<br />
Die Transfusion von Erythrozyten<br />
ist allerdings nur indiziert, wenn<br />
andere, insbesondere kausale Be-
Klassifi kation der Anämiesymptome<br />
Hyperzirkulation › Herzzeitvolumen<br />
› Schlagvolumen<br />
› Herzfrequenz ( )<br />
› Arterieller Widerstand<br />
Gewebehypoxie › Schwindel<br />
› Sehstörung<br />
› Schlafstörung<br />
› Muskelschwäche<br />
› Atemfrequenz<br />
Subjektives Empfi nden › Müdigkeit<br />
› Körperliche Belastbarkeit<br />
handlungsmöglichkeiten ausge-<br />
schöpft sind oder die Zeit bis zu<br />
ihrem Wirkungseintritt zu über-<br />
brücken ist.<br />
Hämoglobingrenzwert und Patien-<br />
tengruppen: Bei einzelnen gut ad-<br />
aptierten jüngeren Patienten der<br />
Gruppe 1 in Tabelle 1 sind auch<br />
Hb-Werte um 7 g/dl zu tolerie-<br />
ren. Bei Patienten der Gruppen 2<br />
und 3 sollen dagegen Hb-Werte<br />
von 8 g/dl in der Regel nicht un-<br />
terschritten werden. Dies gilt ins-<br />
besondere für Patienten mit ver-<br />
minderter Lebenserwartung, bei<br />
denen mögliche Organschäden<br />
durch eine sekundäre Hämochro-<br />
matose voraussichtlich keine Rolle<br />
spielen werden und die Erhaltung<br />
› Zerebrale Leistungsfähigkeit<br />
der Lebensqualität ganz im Vor-<br />
dergrund steht.<br />
Bei Hämoglobinwerten von 8-10<br />
g/dl werden Erythrozyten nur bei<br />
Anämiesymptomen und zusätz-<br />
lichen Risikofaktoren substituiert,<br />
wobei Symptome der Hypoxie im<br />
Hinblick auf die Risiken wie sekun-<br />
däre Herzinsuffi zienz oder Synko-<br />
pen stärker zu bewerten sind als<br />
Symptome der Hyperzirkulation<br />
allein (Abbildung 3).<br />
Welche Einfl ussfaktoren sind<br />
zu beachten?<br />
Ältere Patienten: Unabhängig von<br />
ihrer Genese werden Anämien im<br />
hohen Alter oft erst spät erkannt,<br />
›<br />
Tabelle 2<br />
da die wenig spezifi schen Anä-<br />
miesymptome oft auf im Alter häu-<br />
fi gere kardiopulmonale Erkran-<br />
kungen zurückgeführt werden.<br />
Tatsächlich werden aber im Alter<br />
Anämiesymptome bereits bei hö-<br />
heren Hämoglobinwerten als im<br />
mittleren Lebensalter manifest.<br />
Objektivierbare Folgen der Ge-<br />
webehypoxie, vor allem des Her-<br />
zens, des Gehirns und der Mus-<br />
kulatur können bereits unterhalb<br />
eines Hb-Wertes von 11 g/dl auf-<br />
treten, wie z. B. die Zunahme von<br />
Sturzverletzungen und die Mani-<br />
festation einer vorher nicht beste-<br />
henden Herzinsuffi zienz bei über<br />
70-jährigen Menschen zeigen (8).<br />
Komorbidität: Aus der Pathophy-<br />
siologie der Kompensationsvor-<br />
gänge ist es verständlich, dass<br />
Patienten mit chronischen Erkran-<br />
kungen des Herzens und der Lun-<br />
ge niedrige Hämoglobinwerte<br />
schlechter tolerieren. Hier können<br />
sich die Symptome und Befunde<br />
der Grundkrankheit, welche den<br />
Anämiesymptomen bei Herzge-<br />
sunden ähneln, bereits unterhalb<br />
eines Hb-Wertes von 11 g/dl ver-<br />
stärken und Komplikationen wie<br />
lebensbedrohlichen Herzrhyth-<br />
musstörungen oder einem Myo-<br />
kardinfarkt vorausgehen (17).<br />
Häufi g ist erst unter einer wirk-<br />
samen Anämietherapie zu ent-<br />
scheiden, welchen Anteil die<br />
❯❯❯<br />
37<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
38<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Anämie auf die Symptomatik und<br />
damit auf die Gefährdung des Be-<br />
troffenen hat. Die sorgfältige Be-<br />
obachtung und die Dokumentation<br />
der symptomorientierten Anam-<br />
nese sind unter einer Transfusi-<br />
onstherapie deshalb für deren<br />
Fortführung und für die Anpas-<br />
sung der Transfusionsintervalle<br />
zur Therapieüberwachung ent-<br />
scheidend.<br />
Indikation zur Erythrozytentransfusion bei<br />
chronischer Anämie<br />
Klinische<br />
Symptomatik<br />
Berufl iche und sportliche Aktivität:<br />
Viele Patienten mit chronischen<br />
Anämien, vor allem der Gruppe 1<br />
(Tabelle 1), wollen so lange wie<br />
möglich, auch unter regelmäßigen<br />
Transfusionen, in ihrem Beruf ver-<br />
bleiben. Eine angepasste sport-<br />
liche Tätigkeit wird ebenfalls häu-<br />
fi g gewünscht und ist von ärzt-<br />
licher Seite zu unterstützen. Der<br />
untere Schwellenwert der Hb-<br />
Konzentration und die Transfusi-<br />
Hämoglobin<br />
g/dl<br />
onsabstände sollten den Erwar-<br />
tungen des Patienten angepasst<br />
werden, wobei vor allem die hö-<br />
heren Langzeitrisiken einer ge-<br />
steigerten Transfusionsfrequenz<br />
mit dem Betroffenen in geeigneter<br />
Form zu besprechen sind. Eine<br />
Möglichkeit hierzu bietet die zwin-<br />
gend vorgeschriebene Aufklärung<br />
und schriftliche Einwilligung des<br />
Patienten zur Transfusionstherapie,<br />
bei der das geplante Vorgehen<br />
und die Therapieziele festgelegt<br />
werden können.<br />
Transfusionsindikation<br />
keine >10<br />
selten<br />
Symptombegleitend<br />
8-10<br />
Erkrankungsorientiert<br />
6-8<br />
ausgeprägt
erwünschten Wirkungen defi niert,<br />
die in drei Haupt-Kategorien ein-<br />
geteilt werden: infektiologisch,<br />
immunologisch und kardiovasku-<br />
lär-metabolisch.<br />
Im Vordergrund der unerwünsch-<br />
ten Wirkungen standen bisher<br />
febrile nichthämolytische Transfu-<br />
sionsreaktionen, die seit Einfüh-<br />
rung der generellen Leukozyten-<br />
depletion aller Blutpräparate im<br />
Jahre 2001 deutlich abgenommen<br />
haben. Durch Bescheid des Paul-<br />
Ehrlich-Instituts vom 14.09. 2000<br />
wurde festgelegt, dass alle zellu-<br />
lären Blutprodukte einer Leuko-<br />
zytendepletion zu unterziehen<br />
sind und nur noch < 10 6 Leukozy-<br />
ten pro Einheit aufweisen dürfen.<br />
Durch diese Maßnahme wurden<br />
nicht nur die febrilen nichthämo-<br />
lytischen Transfusionsreaktionen,<br />
sondern auch andere Risiken wie<br />
die Sensibilisierung gegen HLA-<br />
Antigene und die Übertragung<br />
von zellständigen Viren wie dem<br />
Cytomegalievirus deutlich redu-<br />
ziert. Die Übertragung von Virus-<br />
infektionen, insbesondere von He-<br />
patitis B, C und HIV, konnte durch<br />
entsprechende Spenderauswahl-<br />
kriterien und die Einführung der<br />
PCR-Testung minimiert werden.<br />
So wurden dem Paul-Ehrlich-Insti-<br />
tut in den Jahren 2000 bis 2004 für<br />
Deutschland nur noch zwölf Fälle<br />
einer HBV-, ein Fall einer HCV-<br />
und kein Fall einer HIV-Übertra-<br />
gung mit Blutprodukten gemeldet.<br />
Dem stehen für den Zeitraum 1995<br />
bis 2004 insgesamt 15 Todesfälle<br />
durch bakterielle Kontaminationen<br />
gegenüber, die allerdings vorwie-<br />
gend bei Thrombozytenkonzentra-<br />
ten auftraten (16). Die französischen<br />
Hämovigilanzdaten geben für Ery-<br />
throzytentransfusionen ein bakte-<br />
rielles Kontaminationsrisiko von<br />
1:0,1 Mio. mit einer Letalität von<br />
1:1,4 Mio. an (2), das allerdings<br />
durch Einführung des sog. „Predo-<br />
nation Sampling” im Juli 2003 wei-<br />
ter reduziert wurde. Hierbei wird<br />
nach der Venenpunktion zur Blut-<br />
spende die erste Blutprobe, die<br />
möglicherweise mit der Hautstan-<br />
ze kontaminiert ist, für diagnosti-<br />
sche Zwecke verwendet und erst<br />
danach das Blut in den Sammel-<br />
beutel geleitet.<br />
Im Vordergrund der heutigen<br />
Transfusionsrisiken stehen bei<br />
der Erythrozytensubstitution die<br />
Verwechslung, wobei 70 % der<br />
Fehler im Klinikbereich und 30 %<br />
im Laborbereich liegen (18). Die<br />
Häufi gkeit hämolytischer Reakti-<br />
onen beträgt etwa 1:10.000, die<br />
in 60 % der Fälle akut und in 40 %<br />
verzögert auftreten. Das Risiko ei-<br />
ner AB0-Verwechslung wird der-<br />
zeit mit 1:90.000 beziffert, was für<br />
Deutschland bei ca. 4,5 Mio. Ery-<br />
throzytentransfusionen jährlich 50<br />
schwere Zwischenfälle bzw. drei<br />
Todesfälle bedeuten würde (12).<br />
Die Britische Meldestelle für Ne-<br />
benwirkungen von Bluttransfusio-<br />
nen SHOT (Serious Hazards of<br />
Transfusion www.shot-uk.org) hat<br />
seit Einführung der Leukozyten-<br />
depletion nur noch einen Fall ei-<br />
ner transfusionsassoziierten GvHD<br />
(Graft versus Host Disease) und<br />
zwei Fälle (1997 und 1999) einer<br />
Übertragung von TSE (Transmis-<br />
sible Spongiforme Encephalopa-<br />
thie) dokumentiert. Das Risiko<br />
einer transfusionsassoziierten aku-<br />
ten Lungeninsuffi zienz (TRALI) be-<br />
steht auch bei plasmaarmen Prä-<br />
paraten wie Erythrozytenkonzen-<br />
traten, ist jedoch bei diesen sehr<br />
gering (6). In der Transfusionsam-<br />
bulanz des Ulmer Instituts wurde<br />
bei über 25.000 Erythrozyten-<br />
transfusionen weder ein Fall von<br />
TRALI noch eine akute hämoly-<br />
tische Transfusionsreaktion bzw.<br />
eine Verwechslung beobachtet.<br />
Akute Volumenbelastung: Auch<br />
bei der Transfusion von Erythro-<br />
zytenkonzentraten steigt das Ge-<br />
samtblutvolumen zunächst analog<br />
der transfundierten Menge an und<br />
kehrt nach etwa 48 Stunden wie-<br />
der auf die Ausgangswerte zurück.<br />
Gleichzeitig erhöht sich vorüber-<br />
gehend der zentrale Venendruck<br />
(14). Diese Veränderungen bleiben<br />
❯❯❯<br />
39<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
40<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
im Allgemeinen ohne Symptome.<br />
Eine durch Volumenüberladung<br />
bedingte Verminderung der<br />
Vitalkapazität kommt bei der üb-<br />
lichen Begrenzung auf zwei Ery-<br />
throzytenpräparate pro Transfusi-<br />
onstermin nicht vor. Trotzdem ist<br />
bei alten Menschen und solchen<br />
mit vorbestehender Herz- und/<br />
oder Niereninsuffi zienz insbeson-<br />
dere in Bezug auf die Transfusi-<br />
onsgeschwindigkeit Vorsicht ge-<br />
boten und die üblicherweise für<br />
ein Erythrozytenpräparat veran-<br />
schlagte Transfusionsdauer von<br />
ca. 45-60 Min. entsprechend zu<br />
verlängern (4).<br />
Eisenüberladung<br />
und sekundäre<br />
Hämochromatose<br />
Die tägliche Eisenaufnahme<br />
und Eisenausscheidung des er-<br />
wachsenen Mannes liegt bei etwa<br />
1 mg, die der Frau im Menstrua-<br />
tionsalter bei 2 mg. Die Ausschei-<br />
dung des Eisens ist nicht reguliert.<br />
Die Homöostase des Körpereisens<br />
beruht ausschließlich auf der in<br />
den vergangenen Jahren gut er-<br />
forschten Aufnahme von Eisen in<br />
den Enterozyten des Dünndarms.<br />
Ein Erythrozytenkonzentrat ent-<br />
hält ca. 200-250 mg Eisen. Bei<br />
einer Transfusion mit zwei Kon-<br />
zentraten wird also etwa der Jah-<br />
resbedarf eines Gesunden ver-<br />
abreicht. Selbst eine regulative<br />
Verminderung der Eisenaufnah-<br />
me, die aber gerade bei vielen Pa-<br />
tienten der Gruppe 1 (Tabelle 1)<br />
aufgrund der Regulationsstörung<br />
nicht eintritt, kann die Zunahme<br />
des Eisenbestands nicht verhin-<br />
dern. Anders ist die Situation bei<br />
einem Teil der Patienten in Grup-<br />
pe 2, bei denen chronische Blut-<br />
verluste aufgrund einer Throm-<br />
bozytopenie zu einem Eisenver-<br />
lust führen, aber gleichzeitig zur<br />
Transfusionsbedürftigkeit beitra-<br />
gen.<br />
Der gesamte Eisenbestand des<br />
Körpers liegt beim Gesunden bei<br />
40-50 mg/kg, entsprechend einem<br />
Gesamtkörpereisen von 3-4 g.<br />
Bei regelmäßiger Erythrozyten-<br />
gabe steigt das Gesamtkörperei-<br />
sen unvermeidbar entsprechend<br />
der transfundierten Erythrozyten-<br />
menge an. Da der an Hämoglobin<br />
gebundene Anteil beim Gesunden<br />
auf etwa 2 3 des Eisenbestandes<br />
begrenzt ist, führt die wiederholte<br />
Transfusion zu einer ständigen Zu-<br />
nahme des Speichereisens in der<br />
Leber, zur Sättigung des Transfer-<br />
rins und zum Auftreten von nicht-<br />
transferringebundenem Eisen im<br />
Serum. Nicht-transferringebun-<br />
denes Eisen wird auch in Organen<br />
abgelagert, die nicht zu den phy-<br />
siologischen Speichergeweben<br />
gehören, und führt dort durch die<br />
Bildung von aktiven Radikalen zu<br />
schwerwiegenden Funktionsstö-<br />
rungen. Die klinisch relevanten<br />
Folgen, vor allem die vor der An-<br />
wendung von Eisenchelatoren<br />
häufi g tödliche Kardiomyopathie,<br />
die Leberzirrhose, der Insulin-<br />
mangeldiabetes und die Hypothy-<br />
reose, drohen ebenso wie bei nicht<br />
durch Transfusionen bedingter<br />
Hämochromatose bei einem Spei-<br />
chereisengehalt von 10-30 g (10).<br />
Dies entspricht der Eisenmenge,<br />
die nach etwa 50 Erythrozytenkon-<br />
zentraten oder durch Transfusion<br />
von zwei Einheiten pro Monat in<br />
zwei Jahren erreicht wird. Da bei<br />
einem Teil der Patienten aller drei<br />
Gruppen der Speichereisengehalt<br />
bereits vor dem Beginn regelmä-<br />
ßiger Transfusionen erhöht ist<br />
und vorbestehende Gewebeschä-<br />
den die Toxizität des Eisens erhö-<br />
hen können, sind Organschäden<br />
auch schon nach einer geringeren<br />
Transfusionsmenge möglich.<br />
Eisendepletionsbehandlung<br />
Durch eine rechtzeitig begon-<br />
nene und konsequent durchge-<br />
führte Behandlung mit Eisenche-<br />
latoren lassen sich Organschäden<br />
vermeiden und die Lebenserwar-<br />
tung der Patienten aus Gruppe 1<br />
normalisieren (15). Trotz der nur<br />
begrenzt verlässlichen Korrelation
zur Menge des Speichereisens hat<br />
sich die Bestimmung des Serum-<br />
ferritins als Routinemethode zur<br />
Überwachung des Eisenstatus bei<br />
chronischer Transfusion bewährt,<br />
insbesondere wenn der Verlauf be-<br />
rücksichtig und aus der Verlaufs-<br />
kurve herausfallende Einzelwerte<br />
kritisch gewertet werden. Bei ste-<br />
tigem Anstieg des Serumferritins<br />
in einer Situation, in der mit einer<br />
Fortführung des Transfusionspro-<br />
gramms zu rechnen ist, sollte bei<br />
Erreichen eines durch Kontrollen<br />
bestätigten Wertes von 1.000 ng/ml<br />
mit einer Eisendepletionsbehand-<br />
lung begonnen werden.<br />
Die meisten Erfahrungen liegen<br />
für Deferoxamin (Desferal ® ) vor.<br />
Wegen der kurzen Halbwertszeit<br />
und der Notwendigkeit des Myo-<br />
kardschutzes ist ein Wirkspiegel<br />
langzeitig aufrechtzuerhalten, so<br />
dass Deferoxamin als Dauerinfusi-<br />
on gegeben werden muss. Üblich<br />
ist eine Anfangsdosis von 40 mg/kg<br />
täglich in Form einer mindestens<br />
8-stündigen subkutanen Infusion<br />
an 5 -7 Tagen in der Woche. Wegen<br />
der damit verbundenen Umstände<br />
und gelegentlich auftretender Lo-<br />
kalreaktionen ist die Compliance<br />
allerdings nicht befriedigend. Auf-<br />
grund der Gefahr irreversibler<br />
Schädigung des Hör- und Sehver-<br />
mögens bei absinkenden Serum-<br />
ferritinkonzentrationen sind diese<br />
unter Therapie regelmäßig zu<br />
kontrollieren. Ebenso ist die vor<br />
Beginn erforderliche Audiometrie<br />
in jährlichen Abständen zu wieder-<br />
holen.<br />
Eine Alternative ist Deferiprone<br />
(Deferiprox ® ) in einer Standard-<br />
dosis von täglich 3 x 25 mg/kg (13)<br />
oder einmal pro Tag die Gabe von<br />
20 mg/kg Deferasirox (Exjade ® ).<br />
Letzteres scheint in Hinsicht auf<br />
Wirksamkeit und Nebenwirkungs-<br />
spektrum Vorteile zu bieten. Die<br />
Zulassung für die Behandlung der<br />
transfusionsbedingten Eisenüber-<br />
ladung soll in der EU in Kürze er-<br />
folgen.<br />
Transfusionsmenge und<br />
Transfusionsintervalle<br />
Transfundierte allogene Erythro-<br />
zyten werden ebenso wie autologe<br />
Erythrozyten mit einer Rate von<br />
etwa 1 % abgebaut, da eine alters-<br />
gemischte Zellpopulation transfun-<br />
diert wird. Allerdings liegt die<br />
Wiederfi ndungsrate nach Transfu-<br />
sionsende („recovery”) bei etwa<br />
90 % des theoretisch anzunehmen-<br />
den Wertes und sinkt nach 4-wö-<br />
chiger Lagerungszeit auf etwa 80 %<br />
ab. In einem theoretischen Modell<br />
steigt das zirkulierende Erythro-<br />
zytenvolumen bei einem normal-<br />
gewichtigen Erwachsenen mit ei-<br />
ner Anämie von 8g/dl von einem<br />
Ausgangswert von 1.000 ml nach<br />
Transfusion einer Einheit mit<br />
200 ml um 8 % an. Der Hämoglobin-<br />
wert steigt nach Normalisierung<br />
des zunächst erhöhten Gesamt-<br />
blutvolumens um etwa 1 g/dl bzw.<br />
der Hämatokrit um 3 % (14). Eine<br />
Halbierung dieses Transfusions-<br />
effektes ist nach etwa 50 Tagen<br />
zu erwarten. Auch wenn man die<br />
Verminderung einer noch vorhan-<br />
denen autologen Restproduktion<br />
berücksichtigt, sollte die übliche<br />
Gabe von zwei Einheiten in 4-wö-<br />
chigen Abständen ausreichen, um<br />
die Hämoglobinkonzentration zwi-<br />
schen dem Grenzwert von 8 g/dl<br />
und einem Posttransfusionswert<br />
von 10-11 g/dl zu halten. Die Pra-<br />
xis zeigt allerdings, dass der tat-<br />
sächliche Transfusionsbedarf bei<br />
manchen Patienten fast doppelt so<br />
hoch ist, wie das Beispiel der in<br />
Abbildung 4 dargestellten 82-jäh-<br />
rigen Patientin mit MDS belegt, die<br />
in ca. 2-wöchigen Abständen Ery-<br />
throzytentransfusionen erhält. Ein<br />
geringerer Anstieg fi ndet sich ins-<br />
besondere bei Patienten mit deut-<br />
lich vergrößerter Milz oder immu-<br />
nologisch bedingter Hämolyse. In<br />
Fällen mit rascherem Abfall in den<br />
Tagen und Wochen nach Transfusi-<br />
on ist an unbemerkte Blutverluste<br />
oder beschleunigten Abbau durch<br />
anti-erythrozytäre Antikörper zu<br />
denken, die durch die Transfusion<br />
❯❯❯<br />
41<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
42<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
primär oder sekundär gebildet<br />
wurden. Hierbei kommt es zu an-<br />
ti-erythrozytären Antikörpern ins-<br />
besondere gegen Rh-Untergrup-<br />
pen, Kell, Duffy oder Kidd, d. h.<br />
Blutgruppensysteme, die bei Vor-<br />
transfusionen nicht berücksichtigt<br />
wurden (14,18). Bei chronischen<br />
Transfusionsempfängern sollten<br />
deshalb Rh-Untergruppen und<br />
Kell grundsätzlich bereits im Vor-<br />
feld beachtet werden.<br />
Sonderpräparate<br />
Zur Risiko-Minimierung sind für<br />
spezielle Patientengruppen Son-<br />
derpräparate erforderlich, die z. B.<br />
die Auswahl Anti-CMV negativer<br />
Spender oder die Bestrahlung der<br />
Blutpräparate zur Prophylaxe einer<br />
Spender gegen Wirt-Reaktion (GvH)<br />
erfordern. Die Indikationen hierfür<br />
‹<br />
Abbildung 4<br />
82-jährige Patientin mit<br />
Diagnose MDS vor 2 Jahren und<br />
seither 101 Erythrozyten- und<br />
114 Thrombozytentransfusionen<br />
(Veröffentlichung mit Einverständnis der Patientin)<br />
werden jeweils aktuell in den Leit-<br />
und Richtlinien (4,5) zur Therapie<br />
mit Blutprodukten festgelegt. Eine<br />
Indikation für gewaschene Ery-<br />
throzytenkonzentrate besteht auf-<br />
grund des minimalen Restgehaltes<br />
an Plasma in den heutigen Erythro-<br />
zytenkonzentraten nicht mehr. Im<br />
Gegensatz zur früheren Forderung<br />
gilt dies auch für Patienten mit PNH<br />
(3). Lediglich bei relevanten An-<br />
tikörpern gegen Plasmaproteine<br />
wie z. B. IgA ist eine Entfernung<br />
des Rest-Plasmagehalts durch Wa-<br />
schung der Erythrozytenkonzent-<br />
rate indiziert. Das Gleiche gilt für<br />
die Anwärmung der bei +4 °C ge-<br />
lagerten Erythrozytenkonzentrate,<br />
die nur bei klinisch relevanten Käl-<br />
teantikörpern erforderlich ist.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Erythrozytentransfusion bei<br />
chronischer Anämie ist eine effek-<br />
tive und sichere Behandlungsform,<br />
die einen wesentlichen Bestand-<br />
teil der immer wichtiger werden-<br />
den Palliativmedizin darstellt.<br />
Während die Thrombozytentrans-<br />
fusion Blutungsrisiken vermindert,<br />
trägt die Langzeitsubstitution mit<br />
Erythrozyten vorwiegend zur Ver-<br />
besserung und Erhaltung einer er-<br />
strebenswerten Lebensqualität bei.<br />
Dabei richtet sich die Indikation<br />
nicht allein nach dem Hämoglobin-<br />
wert, sondern nach den durch Al-<br />
ter und Komorbidität modifi zierten<br />
Folgeerscheinungen der Anämie<br />
und den Leistungserwartungen<br />
des Patienten. Klinisch orientier-<br />
te transfusionsmedizinische Ein-<br />
richtungen sind aufgrund ihrer<br />
labortechnischen Voraussetzun-<br />
gen besonders geeignet, solche<br />
Transfusionsstrategien ambulant<br />
anzubieten. Nicht zuletzt ein ge-<br />
ringes Verwechslungsrisiko durch<br />
Testung und Anwendung der Prä-<br />
parate in einer Hand und konse-<br />
quentes immunhämatologisches<br />
Screening tragen dazu bei, dass<br />
die Erythrozytensubstitution auch<br />
bei chronisch transfundierten Pa-<br />
tienten eine hohe Sicherheit ge-<br />
währleistet. Unverändert gilt je-<br />
doch für jede einzelne Transfu-<br />
sion:<br />
Das richtige Blut –<br />
Die richtige Zeit –<br />
Der richtige Patient.
Kasuistik einer Langzeitsubstitution bei Aplastischer Anämie<br />
Die hohen Standards und die Möglichkeit einer Langzeitsubstitution mit Blutprodukten belegt das Beispiel eines 50-<br />
jährigen Patienten, bei dem im August 1991 eine erworbene Aplastischen Anämie mit schwerer Leukopenie und substi-<br />
tutionsbedürftiger Thrombozytopenie sowie Anämie diagnostiziert wurde, der auf verschiedene Therapieansätze mit<br />
Steroiden, Cyclosporin, ATG und Interleukin-6 nicht ansprach und keine Option für eine Knochenmarktransplantation<br />
hatte.<br />
Der Patient erhielt allein in der ambulanten Betreuung bis zum Mai 1999 insgesamt 444 Erythrozytenkonzentrate,<br />
1003 Pool-Thrombozytenkonzentrate und 197 HLA-kompatible Apherese-Thrombozytenkonzentrate. Dazwischen lagen<br />
mehrere stationäre Aufenthalte wegen chirurgischen Eingriffen wie einer infektbedingten Kniegelenksarthrodese mit wei-<br />
teren Transfusionen.<br />
Durch eine konsequente palliative Substitutionsstrategie einschließlich Desferaltherapie konnte eine unter diesen Um-<br />
ständen für den Patienten befriedigende Lebensqualität erreicht werden, die im Wesentlichen durch die schwere Granu-<br />
lozytopenie und die dadurch bedingten, zum Teil lebensbedrohlichen Infektkomplikationen beeinträchtigt war. Der Pati-<br />
ent verstarb nach 8-jährigem Krankheitsverlauf mit kontinuierlichem Transfusionsbedarf im Mai 1999 an einer fulmi-<br />
nanten Oberlappenpneumonie.<br />
Die anfangs nicht konsequent verfolgte Leukozytendepletion der Erythrozyten- und Thrombozytenpräparate führte<br />
bei dem Patienten zur Bildung von Anti-HLA-Antikörpern und dadurch bedingten einzelnen, leichten allergischen Reakti-<br />
onen, die HLA-kompatible Thrombozytenkonzentrate erforderlich machten. Anti-erythrozytäre Antikörper manifestierten<br />
sich in einem positiven Coombs-Test und passager nachweisbaren Antikörpern, die bei Nachfolgetransfusionen berück-<br />
sichtigt wurden, so dass es zu keiner hämolytischen Transfusionsreaktion kam.<br />
Die regelmäßige Kontrolle der klassischen Infektmarker ergab bis zum Schluss keinen Hinweis auf eine transfusions-<br />
assoziierte Infektion. Die Eisendepletionstherapie mit Desferal ® wurde anfangs mit der Messung der Eisenausscheidung<br />
im Urin, später allein durch den Verlauf des Serumferritin-Wertes überwacht und gesteuert.<br />
Dieses Beispiel eines Patienten mit Langzeitsubstitution von Erythrozyten- und Thrombozytenkonzentraten ohne<br />
schwerwiegende transfusionsassoziierte Nebenwirkungen zeigt, dass insbesondere klinisch orientierte Transfusionsmedi-<br />
zinische Einrichtungen mit den entsprechenden labortechnischen Voraussetzungen für diese Art der Palliativmedizin<br />
qualifiziert sind.<br />
Die Literaturhinweise fi nden Sie im<br />
Internet zum Download<br />
www.drk.de/blutspende<br />
❯❯❯<br />
43<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
44<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Dr. med. André Fritzsch<br />
Oberarzt<br />
Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt<br />
Klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie<br />
Christoph Kleinherne, Rechtsanwalt<br />
Kanzlei Dr. Kirchhoff & Kollegen<br />
Im Juni 2005 hat das höchste deutsche<br />
Zivilgericht mit seiner Entscheidung zur<br />
Aufklärungspfl icht nach einer Notfalltransfusion<br />
in der Ärzteschaft eine starke Verunsicherung<br />
erzeugt. Welche Konsequenzen<br />
ergeben sich aus diesem Urteil für die im<br />
Bereich der Hämotherapie tätigen Ärzte.<br />
Oberarzt Dr. André Fritzsch, Dresden beschreibt<br />
aus der Sicht der täglichen Erfahrungen<br />
seine Probleme mit dem Urteil. Im<br />
zweiten Teil erläutert der Medizinjurist<br />
Christoph Kleinherne, Wuppertal die juristischen<br />
Konsequenzen des BGH-Urteils und<br />
stellt dessen aktuellen Bezug zur derzeitigen<br />
Diskussion über eine mögliche vCJK-<br />
Übertragung heraus.<br />
There may be uncertainty as to ermergency<br />
transfusions within the medical fraternity<br />
by the germans high court decision from<br />
june 2005 concerning the dutys to inform<br />
patients. What are the consequences arising<br />
out of these decision? The senior physician<br />
Dr. André Fritzsch, Dresden characterises<br />
his daily experiences with this decision in his<br />
contact to patients. The medical lawyer<br />
Christoph Kleinherne, Wuppertal explained<br />
the high court decision regarding to the<br />
current discussions of a propably vCJK<br />
transmission.<br />
Anscheinend schuldig – Überlegungen<br />
zu einem BGH-Urteil*<br />
Der Einfl uss von Rechtsprech-<br />
ung und Juristen auf den ärztlichen<br />
Beruf hat sich in den letzten Jahr-<br />
zehnten „unbestrittenermaßen in<br />
erschreckendem Ausmaße gestei-<br />
gert” (10). Eher zufällig wurde mir<br />
eine aus Juristenkreisen stammen-<br />
de Kurzinformation über das BGH-<br />
Urteil vom 14.6.2005 (Az: VI ZR 179/<br />
04) (2) zugängig (siehe auch den<br />
Beitrag von RA Ch. Kleinherne in<br />
diesem Heft). Das meines Erach-<br />
tens brisante Thema war Anlass,<br />
mir das Urteil vom Internetauftritt<br />
des BGH per Download zu besor-<br />
gen. Hier fängt schon das Problem<br />
an: Welcher Arzt liest regelmäßig<br />
die BGH-Urteile? Ich nicht – bisher<br />
ist mir aber noch keine andere In-<br />
formation über die Existenz dieses<br />
Urteils zugängig geworden oder<br />
zumindest merkhaft aufgefallen.<br />
Für die tägliche Praxis in einer<br />
transfusionsintensiven Fachrichtung<br />
unserer aufgeklärten/aufklärenden<br />
Medizin ist dieser Richterspruch<br />
zumindest unter forensischen Ge-<br />
sichtspunkten nicht ganz unerheb-<br />
lich. Eigentlich sollten alle transfun-<br />
dierenden Ärzte die Entscheidung<br />
kennen. Unter menschlichen As-<br />
pekten ist die HIV-Infektion eines<br />
Ehepaares, ganz gleich wie es dazu<br />
kam, allemal ein schlimmer Fakt.<br />
Wie aber ist die juristische Bewer-<br />
tung?<br />
Im Urteil wird ausgeführt, dass<br />
der Patient nach erfolgter Notfall-<br />
transfusion auf dem Wege der<br />
nachträglichen Sicherungsaufklä-<br />
rung über die ihm verabreichten<br />
Blutprodukte und die mit der Ver-<br />
abreichung verbundenen Risiken<br />
zu informieren ist. Das dürfte im<br />
Alltag keine Probleme bereiten, da<br />
spätestens beim erforderlichen Ab-<br />
schlussgespräch diese Sachverhal-<br />
te automatisch zur Sprache kom-<br />
men. Allerdings hat ein nicht uner-<br />
heblicher Anteil der Patienten nur<br />
grobe Vorstellungen von roten<br />
Blutzellen, Blutplättchen, Blutplas-<br />
ma und Gerinnungseiweißen. Das<br />
macht die Vermittlung der diffe-<br />
renten Risiken auf einem für den<br />
Patienten fassbaren Niveau zwar<br />
schwieriger, aber so richtig hin-<br />
derlich ist das selten. Die Anzahl<br />
der Patienten, die hier nachfragen,<br />
ist minimal. Vielen genügt bzw.<br />
genügte bisher die Information,<br />
dass „Fremdblut” bzw. „Eiweiße<br />
aus Fremdblut” verwendet wurden.<br />
Deutlich mehr macht es dem ge-<br />
sprächsführenden Arzt Mühe, in<br />
der Fülle der wichtigen mitzutei-<br />
lenden Fakten auch diesen noch
„praxistauglich” so unterzubringen,<br />
dass die anderen behandlungs-<br />
und heilungsrelevanten Fakten nicht<br />
überlagert oder gar verdrängt wer-<br />
den. Das wird vor allem dadurch<br />
schwierig, weil von nun an der Pa-<br />
tient ebenfalls nachträglich über<br />
die mit der Blutprodukteanwen-<br />
dung verbundene Infektionsgefahr<br />
zu informieren ist. Aufklärung ohne<br />
Verunsicherung und ohne Vernied-<br />
lichung wird da schon anspruchs-<br />
voll. Der Patient hat ja keinen Ent-<br />
scheidungsspielraum mehr, ob er<br />
sich dieser Gefahr aussetzen will.<br />
So schicksalhaft, wie ihn der Notfall<br />
ereilte, ereilt ihn nun die Informati-<br />
on, zumindest minimal einer AIDS-<br />
Gefahr ausgesetzt zu sein.<br />
Im Urteil wird aber auch ange-<br />
führt, dem Patienten sei zu einem<br />
HIV-Test zu raten. Sofern der Patient<br />
bisher nicht von sich aus danach<br />
gefragt hat, wird es in der täglichen<br />
Praxis spätestens jetzt schwierig.<br />
Denn wenn der Patient an dieser<br />
Stelle nicht zum Wann, Wo und<br />
Wie interveniert, sollte man wohl<br />
als Arzt für sich klären, ob das<br />
Gespräch in Inhalt und Zusam-<br />
menhang sein Ziel erreicht. Nie-<br />
mand wird bei einem ihm angera-<br />
tenen “AIDS-Test” völlig ruhig<br />
bleiben und ohne Nachfragen ab-<br />
warten. Oft genug ist es schon<br />
schwierig, mit einem Kollegen der<br />
transfusionsintensiven Disziplinen<br />
diese Thematik fachlich und sach-<br />
lich fundiert zu diskutieren, zumal<br />
die Transfusionsmedizin wie alle<br />
medizinischen Teilbereiche einen<br />
rasanten Zuwachs an Faktenwissen<br />
zu verzeichnen hat. Da kommt auch<br />
ein geübter und intensiv invol-<br />
vierterNicht-Transfusionsmedizi- ner schnell an seine Wissensgren-<br />
zen. Befi ndet sich ein (ja medizi-<br />
nisch ausgebildeter) Kollege in der<br />
Rolle des Patienten, erstaunt einen<br />
schon, wie schnell dieser in die<br />
Position eines Laien gerät. Wo aber<br />
liegt beim Patienten die Grenze<br />
zwischen fehlendem (und nicht er-<br />
forderlichem) Faktenwissen einer-<br />
seits und fehlendem Verständnis<br />
bzw. Risikobewusstsein anderer-<br />
seits? Letzteres ist das Aufklä-<br />
rungsziel, um dem Patienten eine<br />
selbstbestimmte Entscheidung zu<br />
ermöglichen. Kann ich von mir<br />
selbst behaupten, eine fachlich<br />
fundierte Risikobeschreibung ab-<br />
geben zu können? Oder ist mein<br />
Foto: eye of science, Reutlingen<br />
mühsam aktualisiertes Wissen ge-<br />
rade wieder überholt durch neue<br />
Zahlen und Erkenntnisse, deren<br />
Veröffentlichung ich (noch) nicht<br />
kenne? Hilft es überhaupt noch<br />
bei der Entscheidung, wenn man<br />
als Arzt oder als Patient die rela-<br />
tiven Infektionsrisiken zahlenmä-<br />
ßig kennt? Entscheidet sich der<br />
aufgeklärte verständnisvolle Pa-<br />
tient anders, wenn er registriert,<br />
dass das (jährlich neu bewertete)<br />
relative Infektionsrisiko für die<br />
HIV-Infektion bei der Erythrozy-<br />
tentransfusion vom DRK-Blutspen-<br />
dedienst durch PCR-Testung und<br />
weitere Veränderungen im Spen-<br />
dewesen von etwa 1:8,5 hochge-<br />
rechnet wahrscheinlich auf nun-<br />
mehr ca. 1:18 Millionen Transfu-<br />
sionseinheiten reduziert wurde?<br />
Oder soll ich dem Patienten lieber<br />
vermitteln, dass das Risiko der He-<br />
patitis B-Übertragung bei 1:0,5 Mil-<br />
lionen Transfusionseinheiten ge-<br />
blieben ist. Für die Hepatitis B wur-<br />
de durch das Votum 31 die Testung<br />
auf Anti-HBc-AK initiiert (6). Hier-<br />
durch wird eine Verbesserung der<br />
Risikokonstellation für die Hepatitis<br />
B erwartet. Risikobewusstsein hat<br />
qualitative und quantitative Struk-<br />
❯❯❯<br />
45<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
* Zum 65. Geburtstag<br />
von Herrn Prof. Dr. med.<br />
habil. Klaus Ludwig am<br />
09.08.2006
❯❯<br />
46<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
turen. Wenn ich einem<br />
jungen Unfallopfer vermit-<br />
teln soll, dass ihm im Rah-<br />
men seiner Behandlung,<br />
bestehend aus Notfallver-<br />
sorgung und defi nitiver<br />
Versorgung mit wochen-<br />
langem und komplikati-<br />
onsreichem Verlauf, zahl-<br />
reiche Erythrozyten- und<br />
Thrombozytenkonzentrate<br />
(Unser „Spitzenreiter” be-<br />
kam insgesamt 200 Ein-<br />
heiten!) sowie gerinnungs-<br />
aktive Plasmen appliziert<br />
werden mussten, fl ankiert<br />
von PPSB- und Einzelfak-<br />
torpräparaten, wird auch<br />
die ärztliche Vorstellungskraft<br />
schnell strapaziert. Aus mensch-<br />
licher Sicht neigen dann wohl alle<br />
zum Credo „Hauptsache überlebt –<br />
lass’ es kommen, wie es kommt”.<br />
Dem Patienten möchte man dann<br />
raten, das Infektionsrisiko schlicht<br />
und einfach zu ignorieren, denn er<br />
hat andere massive alltägliche Pro-<br />
bleme. Juristisch wäre das aber ein<br />
Fauxpas.<br />
Mit dem Rat zum HIV-Test entste-<br />
hen also angesichts des Urteils-<br />
textes zumindest beim Nichtju-<br />
risten, und hier besonders bei uns<br />
Ärzten, unweigerlich zahlreiche<br />
weitere Fragen. Denn schließlich<br />
wissen wir, dass der BGH festlegt,<br />
was zu gehen hat, und nicht, wie<br />
das umsetzbar ist. Dass dieses<br />
„sprechende Recht” auf analoge<br />
Situationen bzw. Sachverhalte zu<br />
übertragen ist, leuchtet ein. In der<br />
täglichen Praxis braucht man aber<br />
klare Antworten, keine theore-<br />
tischen Erwägungen. Wie ist das<br />
also:<br />
? Müssen wir auch den Patienten<br />
mit geplanten Eingriffen, bei denen<br />
sich das von der vorherigen OP-<br />
Aufklärung erfasste Transfusions-<br />
risiko realisiert hat, nachträglich<br />
oder gar gleich bei der Aufklärung<br />
für den Fall einer Blutproduktean-<br />
wendung zu einem HIV-Test raten?<br />
Anderenfalls wären diese Plan-Pa-<br />
tienten schlechter aufgeklärt als<br />
der Notfallpatient.<br />
? Wie soll die Testdurchführung<br />
erfolgen – als ein-<br />
maliger Suchtest, oder<br />
3 mal in Abständen, um<br />
ganz sicher die Entwick-<br />
lung von Antikörpern aus-<br />
zuschließen? Welche Zeit-<br />
räume sollen wir nennen?<br />
Wie soll der Patient in die-<br />
ser Zeit sein Verhältnis zu<br />
seinem Partner/seiner Part-<br />
nerin gestalten? Denn: „In<br />
den Schutzbereich dieser<br />
Aufklärungspfl icht ist nicht<br />
nur der behandelte Patient,<br />
sondern auch dessen zu-<br />
künftiger, zum Behand-<br />
lungszeitpunkt noch nicht<br />
bekannter, Ehepartner einbezo-<br />
gen.” (2)<br />
? Wenn der Patient diesem Hinweis<br />
nachkommen möchte, wer ist<br />
dann zur Ausführung der Testung<br />
auf Verlangen des Patienten ver-<br />
pfl ichtet: der Nachbehandler, der<br />
Hausarzt, die transfundierende Ein-<br />
richtung oder jeder den Patienten<br />
behandelnde Arzt? Oder bleibt aus<br />
logistischen Erwägungen nur der<br />
generelle Hinweis auf die Gesund-<br />
heitsämter? Gemäß der Novelle<br />
2005 der Richtlinien zur Hämothe-<br />
rapie muss bei <strong>Rhesus</strong>-ungleicher<br />
Transfusion der weiterbehandeln-<br />
de Arzt nach 2 – 4 Monaten einen<br />
Antikörpersuchtest veranlassen (8).
? Wer hat für die Kosten der Testung<br />
aufzukommen? Die transfun-<br />
dierende Einrichtung, weil sie die<br />
Prozedur vergütet bekommt, mit<br />
der das Risiko verbunden ist? Oder<br />
die Krankenversicherung des Pa-<br />
tienten unabhängig davon, wann<br />
und wo die Testung erfolgt? Gibt es<br />
gar Unterschiede zwischen GKV<br />
und PKV? Wird mit der Untersu-<br />
chung das Budget des die Unter-<br />
suchung auslösenden niederge-<br />
lassenen Arztes belastet? Wie ist<br />
das mit den Kosten bei einer Tes-<br />
tung im Gesundheitsamt?<br />
? Wie genau sollen bzw. müssen<br />
wir zu den genannten Fragen über<br />
andere transfusionsrelevante Krank-<br />
heiten aufklären? In den letzten Jah-<br />
ren kam es zu einer eminenten Ri-<br />
sikoreduktion bei der Wahrschein-<br />
lichkeit, mittels homologer Blut-<br />
produkte Viruserkrankungen zu<br />
übertragen, was den Fokus auf<br />
bakterielle Erkrankungen verscho-<br />
ben hat (9). Den damals, also im<br />
Jahre 1985, tätigen Ärzten wurde<br />
eine Kenntnis über die Gefahr ei-<br />
ner HIV-Infektion unterstellt, ob-<br />
wohl dieses Risiko wissenschaft-<br />
lich noch gar nicht abschließend<br />
gesichert war. Dem BGH reichte<br />
es aber aus, dass die Gefahr ei-<br />
ner HIV-Infektion in medizinischen<br />
Fachkreisen ernsthaft diskutiert<br />
wurde. Welcher Arzt klärt gemäß<br />
BGH-Urteil für eine Transfusion<br />
bereits mit über die Creutzfeldt-<br />
Jakob-Krankheit (vCJD) auf, wo<br />
doch „zumindest die Möglichkeit<br />
eines solchen Infektionswegs in<br />
medizinischen Fachkreisen ernst-<br />
haft in Betracht gezogen” wird? So<br />
wurde die Thematik mit dem da-<br />
maligen Wissensstand bereits 1998<br />
im Deutschen Ärzteblatt (1) und<br />
ebenfalls 1998 in einer Stellung-<br />
nahme des Arbeitskreises Blut (11)<br />
allen Ärzten zugängig gemacht. In-<br />
zwischen scheint die Übertrag-<br />
barkeit der nvCJD durch Blutpro-<br />
dukte bewiesen zu sein (7). In die<br />
tägliche Aufklärungspraxis hat die<br />
vCJD aber noch keinen Einzug ge-<br />
halten.<br />
? Gilt die rückwirkende Aufklärungspfl<br />
icht ggf. inklusive der<br />
Pfl icht zum Anraten einer Testung<br />
auch (in Analogie) für die statistisch<br />
viel höhere Wahrscheinlichkeit<br />
des Erwerbs von antierythrozy-<br />
tären und antithrombozytären<br />
sowie HLA-Antikörpern? Denn<br />
fraglos ist ein Patient bei einem<br />
erneuten Notfall mit einem aktu-<br />
ellen Nothilfepass und darin ver-<br />
merktem Antikörperstatus im Vor-<br />
teil bei der Bereitstellung von Blut-<br />
produkten. Spätere Transplanta-<br />
tionen (und wer kann schon<br />
vorhersagen, ob ein Patient zukünf-<br />
tig nicht davon betroffen sein wird)<br />
dürften auch relevant sein. Prinzi-<br />
piell kann die erfolgte Antikörper-<br />
aquirierung nämlich ebenfalls<br />
vitale Konsequenzen haben –<br />
dadurch bedingte längere Suche<br />
nach einem passenden Spen-<br />
der(organ) und schlimmstenfalls<br />
Versterben auf der Warteliste. Denn<br />
es ist inzwischen unstrittig gewor-<br />
den, dass wir über sehr seltene,<br />
aber gravierende und besonders<br />
über vitale Risiken aufzuklären ha-<br />
ben!<br />
? Sollten wir aus forensischen<br />
Gründen dem Patienten bzw. dem<br />
gesetzlichen Vertreter (Eltern, Be-<br />
treuer) eine Art Protokoll des Ab-<br />
schlussgespräches und insbeson-<br />
dere der nachträglichen Siche-<br />
rungsaufklärung über die erfolgte<br />
Blutprodukteanwendung, die da-<br />
mit verbundenen Risiken und den<br />
Rat zur HIV-Testung zur Unter-<br />
schrift vorlegen? Müssen wir gar<br />
dokumentieren, zu welchem Zeit-<br />
punkt der Patient den Test durch-<br />
führen lassen soll?<br />
? Ist dem Nachbehandler und/<br />
oder dem Einweiser und/oder dem<br />
Hausarzt mitzuteilen, ob Blutpro-<br />
dukte zur Anwendung kamen und<br />
wie detailliert? Nicht immer liegt<br />
der Idealfall einer Personalunion<br />
dieser drei Funktionalitäten vor. In<br />
welcher „Vorschrift” ist diese Pfl icht<br />
(wie) formuliert?<br />
❯❯❯<br />
47<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
48<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Schafft eine Aufklärung in dieser<br />
Form heutzutage nicht eine un-<br />
angebrachte Verunsicherung der<br />
Patienten angesichts des inzwi-<br />
schen deutlich minimierten Risi-<br />
kos einer Infektionsübertragung?<br />
Der Patient ist ohnehin überfl utet<br />
mit Informationen und über weite<br />
Strecken emotional nicht zum Er-<br />
fassen in der Lage. Schon seit über<br />
25 Jahren ist bekannt, dass zum<br />
Beispiel weniger als 20 % elektiv<br />
operierter chirurgischer Patienten<br />
den Inhalt des präoperativen Auf-<br />
klärungsgespräches reproduzieren<br />
können und gar 50 % keinerlei Er-<br />
innerung an den Inhalt haben (4).<br />
Die tägliche Erfahrung mit am<br />
postoperativen Morgen nachfra-<br />
genden Patienten macht diese Zah-<br />
len auch heute noch sehr glaubhaft.<br />
In einer aktuellen Untersuchung (5)<br />
werden gleiche Feststellungen ge-<br />
macht und interessanterweise im<br />
Vergleich zur Situation vor 10 Jah-<br />
ren keine gravierenden Verände-<br />
rungen registriert. Mit 12,6 % (ak-<br />
tive) bzw. 43,5 % (passive = Wie-<br />
dererkennung) Erinnerung an die<br />
Inhalte des Aufklärungsgespräches<br />
war die Nachhaltigkeit der präope-<br />
rativen Aufklärung ist bei allen<br />
Patienten sehr lückenhaft. Teilwei-<br />
se wird deshalb die Meinung ver-<br />
treten, dass durch einen Mangel an<br />
bestehenden bzw. vermittelbarem<br />
Wissen auf Seiten des Patienten als<br />
Grundlage für die Entscheidung<br />
eine vernünftige, wissensbasierte<br />
Entscheidung eine Illusion sei, was<br />
ja auch in einer Großzahl von Studi-<br />
en belegt wurde (3).<br />
Wie soll nun ein Patient damit um-<br />
gehen, wenn ihm zum Beispiel im<br />
Abschlussgespräch einerseits die<br />
Unfallfolgen, die ergriffenen opera-<br />
tiven Maßnahmen mitsamt der re-<br />
sultierenden weiteren Eingriffe<br />
(z. B. Metallentfernungen), der funk-<br />
tionellen und optischen Residuen,<br />
Notwendigkeit von Rehabilitation,<br />
Übungsprogrammen und anderer-<br />
seits die Blutprodukteanwendung<br />
in o. g. Form vor Augen gehalten<br />
werden? Ist-Zustand, Prognose und<br />
Risiken da vernünftig zu gewichten,<br />
ist schwer. Die Fülle auch praktisch<br />
notwendigerweise zu übermitteln-<br />
der Fakten macht selbst erfahrenen<br />
Ärzten zu schaffen. Verteilt man<br />
andererseits die mitzuteilenden<br />
Sachverhalte über den gesamten<br />
Krankenhausaufenthalt, dürfte bei<br />
Entlassung schon manche wichtige<br />
Information verloren sein. Die<br />
„Drohung AIDS-Test” würde aber<br />
sicher überhöht in Erinnerung<br />
bleiben, selbst wenn man sie<br />
„kleinredet”. Real existierende<br />
Zeit- und Organisationsregimes in<br />
Kliniken reduzieren ohnehin die<br />
praktische Machbarkeit umfassen-<br />
der Gespräche im Alltag erheblich.<br />
Die Realität des ärztlichen Alltags<br />
der Patientenversorgung in einer<br />
chirurgischen <strong>Abteilung</strong> ist sehr oft<br />
treffend mit dem Motto eines groß-<br />
en Autoherstellers zu beschreiben:<br />
„Rein – Rauf – Runter – Raus”! Und<br />
mit Umsetzung des Arbeitszeitge-<br />
setzes wird die ärztliche Präsenz<br />
auf Station noch weiter sinken.
Auch für eine Klinikleitung wird<br />
die Aufgabe, den Arbeitsablauf so<br />
zu organisieren, dass einerseits<br />
keine ökonomischen Nöte entste-<br />
hen, andererseits aber Versor-<br />
gungsrealität für die Patienten und<br />
Arbeitsrecht für die Angestellten<br />
noch in Kongruenz zu bringen sind,<br />
durch solche Urteile zunehmend<br />
zur Quadratur des Kreises. Den<br />
Kostenträgern dürfte das Urteil<br />
ebenfalls zu schaffen machen –<br />
wenn als Folge der Aufklärung zu-<br />
nehmend Patienten einen Test auf<br />
Antikörper gegen HIV, Hepatitis-<br />
Viren und ggf. auf irreguläre Anti-<br />
körper einfordern.<br />
Nachwort<br />
Die obigen Gedanken mögen über-<br />
trieben erscheinen. Ohnehin nicht zu<br />
diskutieren ist die Sinnhaftigkeit einer<br />
solchen Rechtsprechung – oder doch?<br />
Jeder Patient soll über seine Erkran-<br />
kung, Verletzung und Behandlung infor-<br />
miert werden. Kein Arzt würde das<br />
anders wollen. Und wahrscheinlich ist<br />
das in einem guten präoperativen Ge-<br />
spräch aufgebaute Vertrauensverhält-<br />
nis der beste Schutz vor einem Schuld-<br />
vorwurf. Was aber in welcher Tiefe<br />
aufzuklären ist, wird selbst für den juris-<br />
tisch interessierten Mediziner immer<br />
schwerer erkennbar und schaffbar. Ei-<br />
nerseits ist das juristische Risiko Trieb-<br />
kraft zur Überfrachtung des Patienten<br />
mit Fakten, andererseits ist ein Zuviel<br />
an Information für die Patienten eher<br />
lähmend oder desorientierend. Eine<br />
(ohnehin nicht mögliche) juristisch<br />
„wasserdichte” Aufklärung inklusive<br />
Dokumentation ist für keinen Patienten<br />
hilfreich – und enthebt sich damit auch<br />
selbst ihrer Gültigkeit, da die Aufklä-<br />
rung (zu Recht) „angemessen” sein soll.<br />
Was nach dem Urteil bleibt, ist ein<br />
noch höheres forensisches Risiko für<br />
Ärzte. Was auch bleibt, ist ein weiterer<br />
Baustein zur Mehrung des Unverständ-<br />
nisses von Ärzten (und Patienten) für<br />
die gültigen „Spielregeln“. Rechtsnor-<br />
men, Rechtsverständnis und Rechts-<br />
empfi nden gehen – je nach Position –<br />
hier deutlich auseinander. Zumindest<br />
ist das Urteil für den in der täglichen<br />
Praxis stehenden Arzt ein Grund mehr,<br />
der Chargen-Dokumentation verstärk-<br />
te Aufmerksamkeit zu widmen.<br />
Die ärztlichen Aufklärungspfl ichten – Neue<br />
weitere Anforderungen bei der Verabreichung<br />
von Blutprodukten?<br />
Mit seinem Urteil vom 14. Juni<br />
2005, Az. VI ZR 179/04, hat der Bun-<br />
desgerichtshof für Verunsicherung<br />
in der Ärzteschaft gesorgt. Das Ge-<br />
richt setzte sich unter anderem mit<br />
der Frage auseinander, wann und<br />
in welcher Form bei der Verabrei-<br />
chung von Blutprodukten eine Auf-<br />
klärung zu erfolgen hat.<br />
Dieser Beitrag soll einige Grund-<br />
lagen der ärztlichen Aufklärungs-<br />
pfl ichten in Erinnerung rufen und<br />
anhand dieser die Bedeutung des<br />
vorgenannten Urteils aufzeigen.<br />
Der Entscheidung lag folgender,<br />
hier nur gekürzt dargestellter Sach-<br />
verhalt zugrunde:<br />
Eine junge Frau, deren heutiger<br />
Ehemann im Juni 1985 nach einem<br />
Motorradunfall notfallmäßig ver-<br />
sorgt werden musste, führte eine<br />
Klage gegen den verantwortlichen<br />
Krankenhausträger. Ihr Ehemann,<br />
den die Klägerin erst drei Jahre<br />
nach dem Eingriff kennen gelernt<br />
hatte, erhielt seinerzeit Frischblut<br />
von drei Spendern sowie mehrere<br />
aus Blutspenden hergestellte Pro-<br />
dukte (Erythrozyten-Konzentrat, GFP,<br />
PPSB und Biseko). Eine präopera-<br />
❯❯❯<br />
49<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
50<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
tive Aufklärung des schwer verun-<br />
fallten Ehemannes über die Ge-<br />
fahren der Verabreichung von Blut-<br />
produkten war nicht möglich. Eine<br />
postoperative Aufklärung mit dem<br />
Hinweis auf die Möglichkeit einer<br />
HIV-Infektion und dem ärztlichen<br />
Rat, einen HIV-Test durchführen zu<br />
lassen, unterblieb. Ende 1997 wur-<br />
den in einer Blutprobe des Ehe-<br />
mannes HIV-Antikörper nachge-<br />
wiesen. Wenig später stellte sich<br />
heraus, dass auch die Klägerin sich<br />
mit HIV infi ziert hatte.<br />
Der Bundesgerichtshof bestätigt<br />
mit seinem Urteil die Haftung des<br />
Krankenhausträgers für Aufklä-<br />
rungsfehler seines ärztlichen Per-<br />
sonals. Bei seiner Entscheidung<br />
ging er davon aus, dass der Ehe-<br />
mann der Klägerin bei der Verab-<br />
reichung der Blutprodukte mit HIV<br />
infi ziert worden sei und den Virus<br />
auf die Klägerin übertragen habe.<br />
Die behandelnden Ärzte hätten die<br />
ihnen auch gegenüber der Kläge-<br />
rin obliegenden Sorgfaltspfl ichten<br />
verletzt, weil sie trotz der vielen<br />
1985 verabreichten Blutprodukte<br />
bei keinem der zahlreichen spä-<br />
teren Krankenhausaufenthalte des<br />
Ehemannes auf die Möglichkeit<br />
einer HIV-Infektion hingewiesen<br />
und zu einem HIV-Test angeraten<br />
hätten. Die Gefahr einer transfusi-<br />
onsassoziierten HIV-Infektion sei<br />
den behandelnden Ärzten Mitte<br />
1985 hinreichend<br />
bekannt gewesen,<br />
zumindest sei sie<br />
in medizinischen<br />
Fachkreisen ernst-<br />
haft diskutiert wor-<br />
den. Die Patienten<br />
hingegen hätten<br />
damals bei der<br />
Verabreichung von<br />
Blutprodukten nicht<br />
an die Gefahr einer<br />
HIV-Infektion den-<br />
ken können. Soweit<br />
also eine präope-<br />
rative Aufklärung<br />
wegen der Notfall-<br />
behandlung nicht<br />
möglich sei, wan-<br />
dele sich die Auf-<br />
klärungsverpflich- tung des Arztes gegenüber dem<br />
Patienten, jedenfalls bei für den<br />
Patienten und dessen Kontaktper-<br />
sonen lebensgefährlichen Risiken,<br />
zu einer Pfl icht zur alsbaldigen<br />
nachträglichen Selbstbestimmungs-<br />
und Sicherungsaufklärung.<br />
Die behandelnden Ärzte hätten<br />
also nach Ansicht des Bundesge-<br />
richtshofes wegen des bei ihnen<br />
bereits im Jahre 1985 vorhan-<br />
denen Kenntnisstandes über die<br />
Gefahr einer transfusionsassozi-<br />
ierten HIV-Infektion aufklären<br />
und zu einem HIV-Test raten<br />
müssen, um so insbesondere<br />
die potentiellen Kontaktperso-<br />
nen des Patienten zu schützen.<br />
Für die heutige Praxis stellt sich<br />
die Frage, ob Patienten im Rahmen<br />
der Aufklärungspfl icht, sei es vor<br />
oder auch nach einer Verabrei-<br />
chung von Blutprodukten, anzura-<br />
ten ist, einen HIV-Test durchführen<br />
zu lassen. Wegen des heute sehr<br />
viel höheren Risikos beispielswei-<br />
se eines Erwerbs von Antikörpern<br />
oder aber auch einer – zum Teil<br />
diskutierten – Übertragung der<br />
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit durch<br />
die Verabreichung von Spender-<br />
blut, kann das Urteil darüber hi-
naus auch für Aufklärungspfl ichten<br />
in diesen Bereichen äußerst be-<br />
deutsam sein.<br />
Über welche Risiken muss also<br />
aufgeklärt werden und aus wel-<br />
chem Grund? Muss der Arzt tat-<br />
sächlich auch über minimale oder<br />
auch dem Patienten eigentlich be-<br />
kannte Risiken aufklären? Geht die<br />
Pfl icht des Arztes wirklich so weit,<br />
dass er dem Patienten nach der<br />
Verabreichung von Blutprodukten<br />
tatsächlich zu einem HIV-Test raten<br />
muss? Ist die Aufklärung auch über<br />
noch nicht sichere, aber zum Teil<br />
diskutierte Risiken bei der Verab-<br />
reichung von Blutprodukten zwin-<br />
gend notwendig?<br />
Auf diese, in der Ärzteschaft<br />
tagtäglich aufkommenden Fragen,<br />
kann keine allgemeingültige Ant-<br />
wort gegeben werden. Es sollen<br />
daher nachfolgend zunächst einige<br />
relevante Grundzüge der ärzt-<br />
lichen Aufklärungspfl ichten aufge-<br />
zeigt werden, um so das Bewusst-<br />
sein für diese den Ärzten oblie-<br />
gende Aufgabe zu schärfen und<br />
die Bedeutung des hier bespro-<br />
chenen Urteils, bezogen auf das<br />
Jahr 2006, möglicherweise etwas<br />
zu relativieren. Denn eines sollte<br />
nicht in Vergessenheit geraten:<br />
Der Bundesgerichtshof hat einen<br />
Sachverhalt beurteilt, der sich vor<br />
mehr als zwanzig Jahren abspielte.<br />
Ob die insoweit jüngst aufgestell-<br />
ten Anforderungen an die ärztliche<br />
Aufklärungspfl icht, also insbeson-<br />
dere die nachträgliche Sicherungs-<br />
aufklärung in Form des Anratens<br />
zu einem HIV-Test, auch heute noch<br />
in dieser Form gelten würden, muss<br />
zumindest kritisch hinterfragt wer-<br />
den. Schließlich haben sich nicht<br />
nur die Verfahren zur Gewinnung<br />
der Blutprodukte entscheidend ge-<br />
ändert. Auch dem Patienten dürfte –<br />
vorsichtig formuliert – heutzutage<br />
bewusst sein, dass bei der Verab-<br />
reichung von Blutprodukten ge-<br />
wisse Risiken bestehen.<br />
Das Selbstbestimmungsrecht<br />
des Patienten – Die Einwilligung<br />
als Rechtfertigung<br />
Wieso wird von Juristen eigentlich<br />
soviel Wert auf eine ordnungsge-<br />
mäße Aufklärung gelegt? Schließ-<br />
lich sind es doch die Ärzte, die<br />
über das notwendige Fachwissen<br />
verfügen. Aus diesem Grunde steht<br />
ihnen ja auch grundsätzlich die<br />
Freiheit der Therapiewahl zu. Die<br />
Aufklärung wird daher von den<br />
Ärzten oft als lästige und zeitrau-<br />
bende Pfl ichterfüllung beschrie-<br />
ben, nicht zuletzt deshalb, weil die<br />
Patienten bei dem Aufklärungsge-<br />
spräch oftmals überfordert, irritiert<br />
oder gar desinteressiert wirken.<br />
Dennoch: Nach gefestigter Rechts-<br />
sprechung erfüllt auch der gebote-<br />
ne und fachgerecht ausgeführte<br />
Heileingriff diagnostischer wie the-<br />
rapeutischer Art den strafrechtlich<br />
relevanten Tatbestand der Körper-<br />
verletzung. Dieser wird nur durch<br />
eine wirksame Einwilligung des<br />
Patienten zu einem gerechtfertig-<br />
ten Eingriff. Eine solche Einwilli-<br />
gung setzt aber zwingend voraus,<br />
dass eine Aufklärung über die mit<br />
einem medizinischen Eingriff ver-<br />
bundenen Risiken erfolgt, um dem<br />
Patienten so eine Entscheidungs-<br />
freiheit einzuräumen und letztlich<br />
sein Selbstbestimmungsrecht zu<br />
wahren. Wird der Patient bei der<br />
Entscheidungsfi ndung also quasi<br />
übergangen oder nicht vollständig<br />
informiert, droht dem Behandeln-<br />
den unter Umständen ein Strafver-<br />
fahren und ein auf Schadensersatz<br />
gerichtetes, zivilrechtliches Ver-<br />
fahren.<br />
Selbstbestimmungs- und<br />
Sicherungsaufklärung<br />
Von dieser Selbstbestimmungs-<br />
aufklärung ist die im Urteil<br />
des Bundesgerichtshofes erwähnte<br />
Sicherungsaufklärung abzugren-<br />
zen. Diese dient vor allem der<br />
Sicherung des Heilungserfolges<br />
durch die Aufklärung über ein the-<br />
rapiegerechtes Verhalten. Darüber<br />
hinaus wird den behandelnden<br />
Ärzten abverlangt, durch eine ent-<br />
sprechende Aufklärung dafür Sor-<br />
ge zu tragen, dass der Patient und<br />
❯❯❯<br />
51<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
52<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
die mit ihm in Kontakt kommenden<br />
Personen nicht geschädigt werden.<br />
Wenn also der Patient eine „Infekti-<br />
onsquelle“ zum Nachteil seiner An-<br />
gehörigen oder weiterer Dritter<br />
darstellt, kann es im Rahmen der<br />
Sicherungsaufklärung geboten sein,<br />
ihm zum Schutze Dritter eine ent-<br />
sprechende „Warnung“ zukommen<br />
zu lassen.<br />
Der Aufklärungszeitpunkt<br />
Der Wahl des richtigen Aufklä-<br />
rungszeitpunktes wird häufi g eine<br />
nur untergeordnete Bedeutung bei-<br />
gemessen. Aus haftungsrechtlicher<br />
Sicht spielt dieser Punkt aber nicht<br />
zuletzt wegen des vielfach verspä-<br />
tet durchgeführten Aufklärungs-<br />
gesprächs eine relativ große Rolle.<br />
Entscheidend ist erneut das Selbst-<br />
bestimmungsrecht des Patienten.<br />
Dieser muss so rechtzeitig aufge-<br />
klärt werden, dass er durch eine<br />
hinreichende Abwägung der für<br />
und wider den Eingriff sprechenden<br />
Gründe seine Entscheidungsfrei-<br />
heit und damit sein Selbstbestim-<br />
mungsrecht in angemessener Wei-<br />
se wahren kann. Das bedeutet im<br />
Ergebnis, dass dem Patienten aus-<br />
reichend Zeit gelassen werden<br />
muss, sich nach der erfolgten Auf-<br />
klärung für oder gegen die vom<br />
Arzt gewählte Therapie zu ent-<br />
scheiden. Wie viel Zeit ausreichend<br />
ist, richtet sich dabei grundsätzlich<br />
nach der Schwere des geplanten<br />
Eingriffes. Als Faustformel kann<br />
hier gelten: Liegen die für die<br />
Operationsindikation entscheiden-<br />
den Voruntersuchungen vor und<br />
hängt der Eingriff nicht mehr von<br />
der Einholung weiterer Befunde ab,<br />
sollte bereits zu diesem – gege-<br />
benenfalls sehr frühen – Zeitpunkt<br />
aufgeklärt werden. Eine Aufklä-<br />
rung erst am Vortag der Operation<br />
kann bei extrem risikobehafteten<br />
Eingriffen verspätet sein. Der Pa-<br />
tient wird durch die ihm erst dann<br />
mitgeteilten Tatsachen regelmäßig<br />
„überfordert“ sein und somit sein<br />
Selbstbestimmungsrecht nicht mehr<br />
wirksam ausüben können. Die prä-<br />
operative Aufklärung sollte also<br />
besser schon dann erfolgen, wenn<br />
sich der Behandelnde der Thera-<br />
piewahl – oder bei echten Alter-<br />
nativen der einzelnen Möglich-<br />
keiten – sicher ist, beispielsweise<br />
im Rahmen der Vereinbarung des<br />
Operationstermins. Ein Fall, bei<br />
dem ein Arzt wegen einer ord-<br />
nungsgemäßen, aber „verfrühten“,<br />
das heißt einer unter Umständen<br />
schon mehrere Wochen vor dem<br />
geplanten Eingriff, aber inner-<br />
halb des Behandlungszeitraumes<br />
durchgeführten Aufklärung ver-<br />
urteilt wurde, ist mir nicht bekannt.<br />
Auch zu intraoperativen Erweite-<br />
rungen kann eine präoperative<br />
Aufklärung erforderlich sein. War<br />
die Erweiterung bereits vor dem<br />
Eingriff vorhersehbar, muss der<br />
Patient auch zuvor über die Risiken<br />
und die Möglichkeit einer gegebe-<br />
nenfalls erforderlichen Erweite-<br />
rung aufgeklärt worden sein. Fehlt<br />
die vorherige Aufklärung, so muss<br />
die Operation – grundsätzlich – ab-<br />
gebrochen und der Patient vor dem<br />
erneuten Eingriff entsprechend<br />
aufgeklärt werden. Dies gilt<br />
selbstverständlich nicht, wenn<br />
die Nichtbehandlung oder der Ab-<br />
bruch des Eingriffes medizinisch<br />
unvertretbar ist oder eine absolute<br />
Indikation vorliegt. In derartigen<br />
Fällen kann der Behandelnde von<br />
einer mutmaßlichen Einwilligung<br />
des Patienten zur Fortsetzung des<br />
Eingriffes ausgehen.<br />
Bei Notfalloperationen fi nden die<br />
vorstehenden Erwägungen selbst-<br />
verständlich nur eingeschränkt Gel-<br />
tung. Eine Aufklärung kann hier<br />
zeitlich erst kurz vor dem Eingriff –<br />
aber dennoch so früh wie mög-<br />
lich – erfolgen. Ist derartiges gar<br />
nicht möglich, kann der Behandeln-<br />
de – bei vital indizierten Operati-<br />
onen – regelmäßig von einer mut-<br />
maßlichen Einwilligung des Pa-<br />
tienten ausgehen.<br />
Aufklärungspfl ichten des<br />
Arztes - Grundsätze<br />
Der Patient muss also durch ein<br />
rechtzeitiges Aufklärungsgespräch<br />
in die Therapiewahl miteinbezogen
werden. Wie der Inhalt dieses,<br />
zu Beweiszwecken schriftlich zu<br />
dokumentierenden Aufklärungsge-<br />
spräches zu gestalten ist, hängt<br />
selbstverständlich von dem jeweils<br />
geplanten Eingriff ab. Der Bundes-<br />
gerichtshof hat mehrfach die<br />
Formulierung ver-<br />
wendet, dass der<br />
Patient „nur im Gro-<br />
ßen und Ganzen“<br />
über die Risiken<br />
eines Eingriffes<br />
aufgeklärt werden<br />
muss. Allein hier-<br />
mit könnte ein Arzt<br />
in einem Rechts-<br />
streit zumeist aber<br />
nicht bestehen. Es<br />
bedarf also wei-<br />
tererKonkretisie- rungen. Auch die-<br />
se orientieren sich wieder an dem<br />
Selbstbestimmungsrecht des Pati-<br />
enten: Um eben dieses Recht zu<br />
wahren, müssen dem Patienten<br />
nicht alle theoretisch denkbaren<br />
medizinischen Risiken in allen<br />
theoretisch denkbaren Erschei-<br />
nungsformen dargestellt werden.<br />
Wichtig ist aber, dem Patienten zu<br />
verdeutlichen, wie ihm nach me-<br />
dizinischer Erfahrung durch den<br />
geplanten Eingriff geholfen werden<br />
kann, welche Erfolgsaussichten und<br />
Heilungschancen bestehen und<br />
welche ernsthaft möglichen Ge-<br />
fahren damit verbunden sein kön-<br />
nen. Dabei sind – unter anderen -<br />
folgende Grundsätze zu beachten:<br />
Über bestimmte Behandlungsal-<br />
ternativen muss der Arzt immer<br />
aufklären. Im Rahmen des Aufklä-<br />
rungsgespräches muss er dabei<br />
selbstverständlich nicht von sich<br />
aus auf den Patienten zugehen und<br />
diesem alle theoretisch denkbaren<br />
Therapiemöglichkeiten aufzeigen.<br />
Die Frage der Therapie ist grund-<br />
sätzlich Sache des Arztes. Ent-<br />
spricht die von ihm gewählte The-<br />
rapie aber nicht der Methode der<br />
Wahl oder aber bestehen in dem<br />
konkreten Fall echte Behandlungs-<br />
alternativen, also mit jeweils unter-<br />
schiedlichen Belastungen und/oder<br />
Risiken und Erfolgschancen ver-<br />
bundeneBehandlungsmöglichkei- ten, so muss der Patient hierüber<br />
aufgeklärt werden. Die Therapie-<br />
wahlfreiheit des Arztes wird inso-<br />
weit durch das Selbstbestimmungs-<br />
recht des Patienten eingeschränkt.<br />
Bei allgemeinen Operationsri-<br />
siken kann gegebenenfalls eine<br />
Aufklärung entbehrlich sein. Hier-<br />
bei handelt es sich<br />
um mit jeder grö-<br />
ßeren Operation<br />
verbundene, allge-<br />
meine und weitge-<br />
hendbeherrsch- bare Risiken bei<br />
Standardeingriffen.<br />
Ob über solche Ri-<br />
siken, wie beispiels-<br />
weise eine Wund-<br />
infektion, eine Em-<br />
bolie oder das<br />
Narkoserisiko, im<br />
Einzelfall aufge-<br />
klärt werden muss, hängt maß-<br />
geblich davon ab, ob der behan-<br />
delnde Arzt davon ausgehen darf,<br />
dass sein Patient – ebenso wie die<br />
Allgemeinheit – Kenntnis von die-<br />
sen allgemeinen Risiken hat und<br />
damit über ein gewisses „medizi-<br />
nisches Basiswissen“ verfügt. Hier-<br />
von kann insbesondere ausgegan-<br />
gen werden, wenn der Patient bei-<br />
spielsweise von dem einweisenden<br />
oder vorbehandelnden Arzt bereits<br />
über die entsprechenden Gefahren<br />
aufgeklärt wurde oder aber es sich<br />
um eine wiederholte Operation<br />
desselben Leidens ohne geänderte<br />
❯❯❯<br />
53<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
54<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Risiken handelt und der Patient<br />
bei der zeitlich nicht weit zurück-<br />
liegenden ersten Operation bereits<br />
entsprechend aufgeklärt wurde.<br />
Gleiches gilt grundsätzlich in den<br />
Bereichen, in denen der Patient<br />
wissen muss, welche Gefahren mit<br />
dem jeweiligen Eingriff verbunden<br />
sind. Der Umfang der ärztlichen<br />
Aufklärungspfl icht wird insoweit<br />
eingeschränkt. Einzelhinweise sind<br />
gegenüber einem verständigen Pa-<br />
tienten, dem diese allgemeinen<br />
Risiken nicht verborgen sind,<br />
grundsätzlich nur dann erfor-<br />
derlich, wenn sich für<br />
ihn als medizinischen<br />
Laien, nicht erkennbare<br />
Risiken und Komplikati-<br />
onen entwickeln könnten,<br />
die ihn in seinen beson-<br />
derenLebensverhältnis- sen erkennbar schwer-<br />
wiegend träfen.<br />
Von dieser „Begren-<br />
zung“ der ärztlichen Auf-<br />
klärungspfl icht sollte aber –<br />
so wie auch derzeit<br />
in den Aufklärungsge-<br />
sprächen üblich – nur zu-<br />
rückhaltend Gebrauch ge-<br />
macht werden, denn das<br />
Haftungsrisiko in einem<br />
entsprechenden Prozess<br />
verbleibt bei dem be-<br />
handelnden Arzt.<br />
Auch über Risiken, die statistisch<br />
sehr unwahrscheinlich sind, sollte<br />
aufgeklärt werden. Die Frage, ob<br />
eine Aufklärung im Einzelfall ent-<br />
behrlich sein kann, hängt nicht von<br />
der geringen Wahrscheinlichkeit<br />
eines Schadenseintrittes ab. Ent-<br />
scheidend ist vielmehr, ob das sel-<br />
tene Risiko, so es sich verwirklicht,<br />
für den Eingriff spezifi sch ist, die<br />
Lebensführung des Patienten schwer<br />
belastet und ihn als medizinischen<br />
Laien überraschen würde. Ist dies<br />
der Fall, muss zwingend aufgeklärt<br />
werden.<br />
Aufklärungspfl ichten bei<br />
der Verabreichung von Blutprodukten<br />
Auch bei den zahlreichen Ent-<br />
scheidungen der Gerichte, die sich<br />
im Speziellen mit den Aufklärungs-<br />
pfl ichten bei der Verabreichung<br />
von Blutprodukten auseinanderset-<br />
zen mussten, fanden die vorstehen-<br />
den, allgemeinen Grundsätze im-<br />
mer wieder Berücksichtigung:<br />
So wurde beispielsweise im<br />
Bereich der echten Behandlungs-<br />
alternativen entschieden, dass der<br />
Patient, sofern gegenüber<br />
der Verabreichung von<br />
Spenderblut die echte Al-<br />
ternative besteht, Eigen-<br />
blut zu bilden und im<br />
Anschluss zu verwenden,<br />
hierüber selbstverständ-<br />
lich aufzuklären ist. Diese<br />
Aufklärungspfl icht kann<br />
nur dann entfallen, wenn<br />
es tatsächlich keine echte<br />
Alternative zu den Pro-<br />
dukten aus Spenderblut<br />
gibt, beispielsweise bei<br />
unzureichender Hämo-<br />
globinkonzentration des<br />
Eigenblutes.<br />
Zu den allgemeinen Ope-<br />
rationsrisiken hat sich der<br />
Bundesgerichtshof mit ei-<br />
ner Entscheidung vom<br />
17.12.1991, VI ZR 40/91,
schon einmal mit der Frage ausei-<br />
nander gesetzt, ob den Patienten<br />
eine Kenntnis über die transfusi-<br />
onsbedingten Risiken unterstellt<br />
werden kann. Diese Entscheidung<br />
ist besonders bedeutsam, weil der<br />
Bundesgerichtshof in dem hier be-<br />
sprochenen Urteil vom 14. Juni 2005<br />
ausdrücklich Bezug auf seine da-<br />
malige Begründung nimmt. Sei-<br />
nerzeit wurde folgendes Urteil<br />
des Oberlandesgerichts Düssel-<br />
dorf aufgehoben:<br />
Das Oberlandesgericht Düssel-<br />
dorf hatte die Klage einer Frau,<br />
welche im Jahre 1987 vor der Ver-<br />
abreichung von Blutprodukten nicht<br />
über das Risiko einer HIV und He-<br />
patitis-Infektion aufgeklärt wurde,<br />
sich aber infi ziert hatte, abgewie-<br />
sen. Es war der Auffassung, dass der<br />
behandelnde Arzt angesichts der im<br />
Jahre 1987 öffentlich geführten Dis-<br />
kussion über das Vordringen der<br />
AIDS-Erkrankung davon habe aus-<br />
gehen dürfen, der Klägerin seien<br />
auch die möglichen Folgen einer<br />
Bluttransfusion mit Fremdblut, ins-<br />
besondere die Gefahr einer HIV-In-<br />
fektion, bekannt. Über derartig be-<br />
kannte, in das Wissen des Patienten<br />
zu stellende Risiken, müsse aber<br />
nicht aufgeklärt werden.<br />
Der Bundesgerichtshof hielt dem<br />
entgegen, dass eine solche „Kennt-<br />
nis” weder im Jahre 1987 noch bei<br />
seiner Entscheidung im Jahre 1991<br />
unterstellt werden könne. Im Vor-<br />
dergrund der öffentlichen Diskus-<br />
sion habe die Gefahr einer Infek-<br />
tion innerhalb bestimmter Risiko-<br />
gruppen oder durch sexuellen<br />
Kontakt mit Angehörigen dieser<br />
Gruppen gestanden. Die Frage der<br />
Infektion durch Blutübertragungen<br />
sei in der Öffentlichkeit nicht ernst-<br />
haft diskutiert worden. Der Patien-<br />
tin hätte das nötige Wissen über<br />
die transfusionsbedingten Gefahren<br />
also nicht einfach unterstellt wer-<br />
den dürfen. Vielmehr hätten die<br />
behandelnden Ärzte hierüber auf-<br />
klären müssen.<br />
Die Entscheidungsgründe<br />
des Bundesgerichtshofes vom<br />
14. Juni 2005<br />
In dem hier besprochenen Urteil<br />
vom 14. Juni 2005, beschränkte sich<br />
der Bundesgerichtshof bei der Fra-<br />
ge, ob über die Risiken einer trans-<br />
fusionsbedingten Infektion über-<br />
haupt eine Aufklärung zu erfolgen<br />
habe, lediglich auf den angespro-<br />
chenen Verweis auf seine Entschei-<br />
dung vom 17.12.1991: „Eine Aufklä-<br />
rungspfl icht über die Gefahren der<br />
Verabreichung von Blutprodukten<br />
entspricht den vom erkennenden<br />
Senat bereits früher aufgestellten<br />
Anforderungen an die Risikoauf-<br />
klärung bei Bluttransfusionen.”<br />
Dieser Verweis ist auch durchaus<br />
nachvollziehbar. Der Bundesge-<br />
richtshof hatte ja schließlich für<br />
das Jahr 1987 entschieden, dass<br />
dem Patienten die Kenntnis über<br />
die Risiken bei der Verabreichung<br />
von Blutprodukten nicht unterstellt<br />
werden konnte und durfte, da sich<br />
die öffentliche Diskussion über das<br />
HI-Virus seinerzeit auf den Bereich<br />
innerhalb der Risikogruppen be-<br />
schränkte. Für das hier relevante<br />
Jahr 1985 konnte dann nichts an-<br />
deres gelten, zumal die öffentliche<br />
Diskussion zu diesem Zeitpunkt<br />
noch nicht oder nicht in dem Maße<br />
geführt wurde. Wegen des insoweit<br />
fehlenden medizinischen Basiswis-<br />
sens durften die behandelnden<br />
Ärzte nicht von einem dem Pa-<br />
tienten bekannten allgemeinen<br />
Operationsrisiko bei der Verabrei-<br />
chung der Blutprodukte ausgehen.<br />
Aufgrund der im konkreten Fall tat-<br />
sächlich nicht möglichen präopera-<br />
tiven Aufklärung wandelte sich die<br />
Verpfl ichtung der Ärzte dement-<br />
sprechend zu einer nachträglichen<br />
Sicherungsaufklärung in Form des<br />
ärztlichen Rates zu einem HIV-Test.<br />
Auf diese Form der Aufklärung<br />
wurde großer Wert gelegt, da die<br />
Übertragung gerade einer gefähr-<br />
lichen Infektion auf die Klägerin<br />
und Dritte hierdurch möglicherwei-<br />
se hätte verhindert werden kön-<br />
nen.<br />
Der Bundesgerichtshof hatte wei-<br />
ter zu entscheiden, ob den behan-<br />
❯❯❯<br />
55<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
56<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
delnden Ärzten ein die Aufklä-<br />
rungspfl icht begründendes Wis-<br />
sen unterstellt werden durfte.<br />
Schließlich haben diese ja nicht<br />
über alle theoretisch denkbaren<br />
Risiken in allen theoretisch denk-<br />
baren Erscheinungsformen aufzu-<br />
klären. Wenn nun aber im Jahre<br />
1985 wissenschaftlich noch gar<br />
nicht gesichert war, dass durch die<br />
Verabreichung von Blutprodukten<br />
der HI-Virus übertragen werden<br />
kann, wieso hätte dann hierüber<br />
überhaupt aufgeklärt werden müs-<br />
sen? Es lagen nicht einmal ärzt-<br />
liche Richtlinien zur Frage der ent-<br />
sprechenden Sicherungsaufklärung<br />
vor. Diese, von den Rechtsanwälten<br />
der Revision, also dem Kranken-<br />
hausträger, auch vorgetragenen<br />
Einwände, ließ der Bundesgerichts-<br />
hof nicht gelten:<br />
„Die Aufklärungspfl icht setzt<br />
keine sichere Kenntnis in Fach-<br />
kreisen davon voraus, dass HIV-<br />
Infektionen transfusionsassozi-<br />
iert auftraten; angesichts der<br />
erheblichen Beeinträchtigungen,<br />
die mit einer HIV-Infektion/AIDS-<br />
Erkrankung einhergehen, ge-<br />
nügte für das Entstehen einer<br />
Aufklärungspfl icht schon die<br />
ernsthafte Möglichkeit der Ge-<br />
fahr. Dass 1985 die Möglichkeit<br />
transfusionsassoziierter HIV-In-<br />
fektionen in Fachkreisen (wenn<br />
auch „zurückhaltend“) disku-<br />
tiert wurde, zieht auch die Revi-<br />
sion nicht in Zweifel.“<br />
Für den Bundesgerichtshof reichte<br />
es also aus, dass in medizinischen<br />
Fachkreisen eine ernsthafte Dis-<br />
kussion über die möglichen Ge-<br />
fahren geführt wurde!<br />
Die Bedeutung des Urteils<br />
für die ärztliche Aufklärungspfl<br />
icht<br />
Welche Konsequenzen ergeben<br />
sich nunmehr für die im Bereich<br />
der Hämotherapie tätigen Ärzte?<br />
Durch eine „schonende” Aufklä-<br />
rung über alle theoretisch in Be-<br />
tracht kommenden Risiken im<br />
Rahmen der Selbstbestimmungs-<br />
aufklärung und durch eine Siche-<br />
rungsaufklärung in Form des ärzt-<br />
lichen Anratens zu einem HIV-Test,<br />
wird das Haftungsrisiko tatsäch-<br />
lich verringert. Ob eine solche Vor-<br />
gehensweise von den Ärzten aber<br />
überhaupt zu bewältigen wäre,<br />
scheint ungewiss.<br />
Würden Versäumnisse in diesem<br />
Bereich, bezogen auf einen Fall im<br />
Jahre 2006, aber nach wie vor eine<br />
Haftung der Ärzte nach sich zie-<br />
hen? Unbestritten ist das Risiko,<br />
sich mit dem HI-Virus zu infi zieren,<br />
wegen der verbesserten Herstel-<br />
lungsverfahren sehr gering gewor-<br />
den. Die Wahrscheinlichkeit für<br />
den Schadenseintritt spielt aber,<br />
wie oben gesagt, nur eine sehr un-<br />
tergeordnete Rolle. Von Bedeutung<br />
ist hier vielmehr die Frage, ob das<br />
Infektionsrisiko für den Eingriff<br />
spezifi sch ist und den Patienten als<br />
medizinischen Laien überraschen<br />
würde. Dies ist gerade auch im<br />
Hinblick auf die mehrfach ange-<br />
sprochenen „allgemeinen Operati-<br />
onsrisiken” von Bedeutung, bei de-<br />
nen eine Aufklärung ja entbehrlich<br />
sein kann. Der Bundesgerichtshof<br />
war in den letzten Entscheidungen<br />
der Ansicht, dass die Möglichkeit<br />
einer transfusionsassoziierten HIV-<br />
Infektion in den achtziger Jahren –<br />
noch – kein allgemein bekanntes<br />
Risiko darstellte. Es wurde ent-<br />
scheidend auf das Bewusstsein der<br />
Bevölkerung abgestellt. Wie hat<br />
sich dieses entwickelt?<br />
Ein verständiger und durch-<br />
schnittlich intelligenter Patient<br />
sollte wissen, dass sich die Aus-<br />
breitung des HI-Virus nicht mehr<br />
nur auf die so genannten Risiko-<br />
gruppen beschränkt und dass es<br />
durch die Verabreichung von Blut-<br />
produkten bereits zu zahlreichen<br />
Fällen einer HIV-Infektion gekom-<br />
men ist. Gleiches dürfte auch für<br />
die Gefahr einer Infektion mit He-<br />
patitis B/C gelten. Auf der anderen<br />
Seite ist aber auch nicht von der<br />
Hand zu weisen, dass mittlerweile<br />
ein gewisses Maß an Vertrauen in<br />
die Sicherheit der Blutprodukte be-
steht. Schließlich wird eine öffent-<br />
liche Diskussion über die zurück-<br />
liegenden Fälle solcher Infektionen<br />
derzeit wohl nicht mehr geführt.<br />
Möglicherweise wiegen sich die<br />
Patienten daher in Sicherheit und<br />
denken bei dem Empfang von<br />
Spenderblut gerade nicht mehr an<br />
die nach wie vor bestehenden, gra-<br />
vierenden Risiken.<br />
Müsste der Bundesgerichtshof<br />
einen aktuellen Fall beurteilen,<br />
würde er seine Entscheidung wohl<br />
von den vorstehenden Erwägungen<br />
und dem derzeitigen Kenntnisstand<br />
der Patienten abhängig machen.<br />
Ob er sodann erneut derart strenge<br />
Anforderungen an die Selbstbe-<br />
stimmungs- und Sicherungsaufklä-<br />
rung stellen würde, ist zweifelhaft<br />
und nicht klar zu beantworten. Zwar<br />
dient insbesondere die Sicherungs-<br />
aufklärung auch der Verhinderung<br />
einer weiteren Verbreitung der In-<br />
fektion. Der Zweck, nämlich dem<br />
Patienten eine „Warnung” zukom-<br />
men zu lassen, könnte aber obsolet<br />
sein, wenn dem Pa-<br />
tienten eine Kennt-<br />
nis über die Ge-<br />
fahren unterstellt<br />
werden könnte. Der<br />
entsprechenden Ri-<br />
siken wäre er sich<br />
dann auch ohne<br />
eine Warnung be-<br />
wusst.<br />
Höchst bedeutsam ist schließlich<br />
die Frage, ob in die Aufklärungs-<br />
gespräche bislang noch nicht an-<br />
gesprochene Risiken aufgenom-<br />
men werden müssen:<br />
Die Ärzte hatten sich in der hier<br />
besprochenen Entscheidung damit<br />
„verteidigt”, dass im Jahre 1985<br />
wissenschaftlich noch gar nicht<br />
gesichert gewesen sei, ob das HI-<br />
Virus durch die Verabreichung von<br />
Blutprodukten übertragen werden<br />
konnte. Aus diesem Grunde sahen<br />
sie sich nicht dazu verpfl ichtet,<br />
über die theoretisch bestehende<br />
Gefahr aufzuklären. Der Bundes-<br />
gerichtshof hingegen hielt es für<br />
ausreichend, dass diese Thematik<br />
zumindest „ernsthaft” in Fachkrei-<br />
sen diskutiert wurde.<br />
Diese Kernaussage sollte sich<br />
die Ärzteschaft im Rahmen der<br />
Aufklärungsgespräche zu Herzen<br />
nehmen. Erfolgt tatsächlich eine<br />
Aufklärung über alle ernsthaft dis-<br />
kutierten Risiken? Beispielhaft er-<br />
wähnt sei hier die Creutzfeldt-Ja-<br />
kob-Krankheit (siehe auch den Bei-<br />
trag von Herrn Dr. Fritzsch in<br />
diesem Heft). In vielen Häusern<br />
wird derzeit weder vor noch nach<br />
der Verabreichung von Blutpro-<br />
dukten über das Risiko einer ent-<br />
sprechenden Infektion aufgeklärt.<br />
Eine Diskussion über die mögliche<br />
Übertragung durch Spenderblut<br />
wird dennoch geführt. So wird bei-<br />
spielsweise in der – auch Patien-<br />
tenanwälten zugänglichen – Leitli-<br />
nie der Deutschen Gesellschaft für<br />
Neurologie zur Creutzfeldt-Jakob-<br />
Krankheit aufgeführt, dass die<br />
Übertragung einer dort näher be-<br />
schriebenen, neuen Variante der<br />
CJK über Blut und Blutprodukte<br />
wahrscheinlich ist! Die Infektions-<br />
möglichkeit ist also in medizi-<br />
nischen Fachkreisen bekannt; im<br />
Patientenkreis darf man dieses<br />
Wissen zum jetzigen Zeitpunkt<br />
sicherlich nicht als bekannt voraus-<br />
setzen. Es zeigt sich an diesem Bei-<br />
spiel also eine deutliche Parallele<br />
zu dem besprochenen Urteil, die<br />
❯❯❯<br />
57<br />
Ausgabe 7<br />
2006
❯❯<br />
58<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
eine Aufklärung solcher, ernsthaft<br />
in Betracht kommender Risiken<br />
dringend erforderlich erscheinen<br />
lässt.<br />
Die Entscheidung des Bundesge-<br />
richtshofes sollte der Ärzteschaft<br />
nach alldem aufzeigen, dass an die<br />
Aufklärungspfl icht gerade in dem<br />
Bereich gefährlicher und sich ver-<br />
breitender Infektionen strenge An-<br />
forderungen gestellt werden. Mit<br />
der Verabreichung von Blutpro-<br />
dukten in Zusammenhang stehen-<br />
de und ernsthaft diskutierte Risiken<br />
sollten unbedingt in das Aufklä-<br />
rungsgespräch einfl ießen. Gleich-<br />
zeitig darf nicht in Vergessenheit<br />
geraten, dass sich der Fall in den<br />
achtziger Jahren abspielte und für<br />
die Entscheidung des Bundesge-<br />
richtshofes unter anderem der da-<br />
mals vorhandene Wissensstand<br />
der Bevölkerung ausschlaggebend<br />
war. Sowohl dieser als auch die<br />
Herstellungsverfahren haben sich<br />
seitdem aber erheblich geändert.<br />
Die Gerichte werden sich hiermit<br />
in künftigen Haftungsfällen ausein-<br />
andersetzen müssen. Eine klare<br />
und eindeutige Prognose über den<br />
Ausgang der zu erwartenden Ent-<br />
scheidungen ist wegen der Vielfalt<br />
der denkbaren Sachverhalte und<br />
dem sich ständig verändernden<br />
Bewusstsein in der Bevölkerung<br />
über die Gefahren eines medizi-<br />
nischen Eingriffs nicht möglich.<br />
Ebenso wenig können der Ärzte-<br />
schaft wegen der Fülle der vorstell-<br />
baren Situationen konkrete Rat-<br />
schläge zu dem Verhalten in den<br />
Aufklärungsgesprächen gegeben<br />
werden. Im Zweifel sollten sich die-<br />
se immer wieder die grundsätz-<br />
liche Frage stellen, ob der Patient<br />
genügend Informationen erhalt hat,<br />
um das Recht, über seinen Körper<br />
selbst zu bestimmen, entscheiden<br />
zu können.<br />
Die Literaturhinweise fi nden Sie im<br />
Internet zum Download<br />
www.drk.de/blutspende
Die Autoren<br />
Die neuen Richtlinien<br />
❯ Dr. med. Detlev Nagl, Institut für Transfusionsmedizin Augsburg, Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes<br />
Westheimerstraße 80, D-86156 Augsburg, d.nagl@blutspendedienst.com<br />
<strong>Rhesus</strong> D-Diagnostik in der Schwangerschaft<br />
❯ Prof. Dr. med. Axel <strong>Seltsam</strong>, Institut für Transfusionsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover<br />
Carl-Neuberg-Straße 1, D-30625 Hannover, seltsam.axel@mh-hannover.de<br />
❯ Prof. Dr. med. Tobias J. <strong>Legler</strong>, <strong>Abteilung</strong> Transfusionsmedizin, Georg-August-Universität – Bereich Humanmedizin<br />
Robert-Koch-Straße 40, D-37099 Göttingen,<br />
❯ Dr. rer. nat. Eduard K. <strong>Petershofen</strong>, Molekulare Diagnostik, Institut Bremen-Oldenburg, DRK-Blutspendedienst NSTOB<br />
Brandenburger Straße 21, D-26133 Oldenburg,<br />
Kongressbericht<br />
❯ Dr. Andreas Karl, DRK-Blutspendedienst Ost gGmbH, Institut für Transfusionsmedizin Plauen<br />
Röntgenstraße 2a, D-08529 Plauen, akarl@drk-bsd-sachsen.de<br />
Therapie mit Erythrozytenkonzentraten bei chronischer Anämie<br />
❯ Prof. emerit. Dr. med. Hermann Heimpel, Ehem. Ärztlicher Direktor der <strong>Abteilung</strong> Innere Medizin III, Universitätsklinikum Ulm<br />
Robert-Koch-Straße 8, D-89081 Ulm, hermann.heimpel@uniklinik-ulm.de<br />
❯ Dr. med. Britta Höchsmann, Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm und <strong>Abteilung</strong> für Transfusionsmedizin<br />
Universitätsklinikum Ulm, DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen gGmbH,<br />
Helmholtzstraße 10, 89081 Ulm, b.hoechsmann@blutspende.de<br />
❯ Dr. med. Markus Wiesneth, Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm und <strong>Abteilung</strong> für Transfusionsmedizin<br />
Universitätsklinikum Ulm, DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen gGmbH,<br />
Helmholtzstraße 10, 89081 Ulm, m.wiesneth@blutspende.de<br />
Anscheinend schuldig – Überlegungen zu einem BGH-Urteil<br />
❯ Dr. med. André Fritzsch, Oberarzt, Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie<br />
Friedrichstraße 41, D-01067 Dresden, fritzsch-an@khdf.de<br />
Die ärztlichen Aufklärungspfl ichten – Neue weitere Anforderungen bei der Verabreichung von Blutprodukten?<br />
❯ Christoph Kleinherne, Rechtsanwalt, Kanzlei Dr. Kirchhoff & Kollegen<br />
Wall 28, D-42103 Wuppertal, kleinherne@rechtsdoktor.de<br />
Abo- und Redaktionsservice<br />
Abonnieren Sie die„hämotherapie - Beiträge zur Transfusionsmedizin”<br />
Sie erhalten diese kostenlos durch Ihren DRK-Blutspendedienst. Mit beiliegender Postkarte können Sie<br />
Ihre Adresse für den regelmäßigen Postversand vormerken lassen.<br />
›››<br />
59<br />
Ausgabe 7<br />
2006
Beiträge zur Transfusionsmedizin<br />
Leser fragen<br />
Beiträge zur Transfusionsmedizin<br />
● Dieses Thema/diese Themen würde(n) mich interessieren. Bitte berichten Sie darüber!*<br />
● Der Artikel in Ausgabe<br />
hat mir sehr gut gefallen, bitte mehr zu diesem Thema!<br />
● Platz für Verbesserungsvorschläge!<br />
*Bitte haben Sie Verständnis, dass bei der Fülle an Rückmeldungen die geäußerten Wünsche kanalisiert werden müssen!<br />
Beiträge zur Transfusionsmedizin<br />
✗<br />
Ja,<br />
ich möchte Ihre Zeitschrift „hämotherapie“ abonnieren !<br />
Bitte senden Sie zukünftig ein Exemplar „hämotherapie“<br />
kostenlos an die folgende Adresse:<br />
Name:<br />
Vorname:<br />
Straße, Hausnummer:<br />
PLZ/ORT:<br />
Telefon: Fax:<br />
Experten antworten<br />
Ihre Fragen leitet das Redaktionsteam an die Experten weiter.<br />
Veröffentlichte Anfragen werden anonymisiert.<br />
● Ihre Frage:<br />
?<br />
Ausgabe 7<br />
2006<br />
Die neuen Richtlinien<br />
Dr. med. Detlev Nagl<br />
<strong>Rhesus</strong> D-Diagnostik<br />
in der Schwangerschaft<br />
Prof. Dr. med. Axel <strong>Seltsam</strong><br />
Prof. Dr. med. Tobias J. <strong>Legler</strong><br />
Dr. rer. nat. Eduard K. <strong>Petershofen</strong><br />
Kongressbericht<br />
Dr. Andreas Karl<br />
Therapie mit Erythrozytenkonzentraten<br />
bei chronischer Anämie<br />
Prof. emerit. Dr. med. Hermann Heimpel<br />
Dr. med. Britta Höchsmann<br />
Dr. med. Markus Wiesneth<br />
Anscheinend schuldig – Überlegungen<br />
zu einem BGH-Urteil<br />
Dr. med. Andre Fritzsch<br />
Die ärztlichen Aufklärungspfl<br />
ichten – Neue weitere Anforderungen<br />
bei der Verabreichung von<br />
Blutprodukten?<br />
Christoph Kleinherne, Rechtsanwalt<br />
!<br />
Beiträge zur Transfusionsmedizin<br />
S ONDERAUSGABE<br />
zur DGTI-Tagung September 2006<br />
››<br />
››<br />
››<br />
››<br />
ABO-SERVICE
ADRESSÄNDERUNG?<br />
Bitte abtrennen, ausfüllen und abschicken<br />
Meine Adresse:<br />
Vorname:<br />
Name:<br />
Straße, Hausnummer:<br />
PLZ/ORT:<br />
Telefon:<br />
Meine Adresse:<br />
Vorname:<br />
Name:<br />
Straße, Hausnummer:<br />
PLZ/ORT:<br />
Telefon:<br />
Bitte streichen Sie folgende Adresse aus Ihrem Verteiler<br />
Vorname:<br />
Name:<br />
Straße, Hausnummer:<br />
PLZ/ORT:<br />
Telefon:<br />
und ersetzen Sie diese durch<br />
Vorname:<br />
Name:<br />
Straße, Hausnummer:<br />
PLZ/ORT:<br />
Telefon:<br />
Antwort<br />
DRK-Redaktionsteam<br />
Feithstr. 182<br />
58097 Hagen<br />
Antwort<br />
DRK-Redaktionsteam<br />
Feithstr. 182<br />
58097 Hagen<br />
Antwort<br />
Bestellservice<br />
Feithstr. 182<br />
58097 Hagen<br />
Bitte<br />
ausreichend<br />
frankieren.<br />
Danke!<br />
Bitte<br />
ausreichend<br />
frankieren.<br />
Danke!<br />
Bitte<br />
ausreichend<br />
frankieren.<br />
Danke!
ISSN 1612-5592 (Ausg. Baden-Württemberg, Hessen)<br />
ISSN 1612-5584 (Ausg. Bayern)<br />
SSN 1612-5614 (Ausg. Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)<br />
ISSN 1612-5622 (Ausg. Hamburg, Schleswig-Holstein)<br />
ISSN 1612-5630 (Ausg. Mecklenburg-Vorpommern)<br />
ISSN 1612-5606 (Ausg. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland)<br />
ISSN 1612-5657 (Ausg. Berlin, Brandenburg, Sachsen)<br />
Prominente bei der Blutspende<br />
Dr. rer. nat. Angela Merkel,<br />
CDU<br />
Franz Müntefering,<br />
SPD<br />
Claudia Roth,<br />
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN<br />
Dr. rer. soc. Norbert Lammert,<br />
CDU