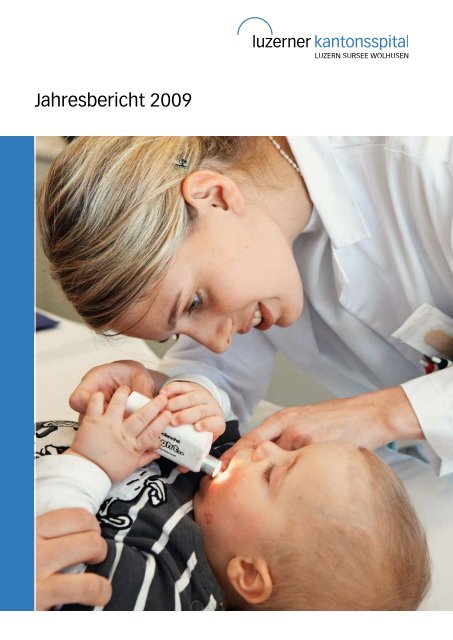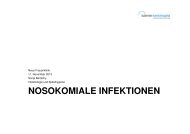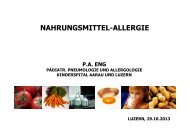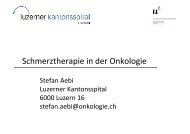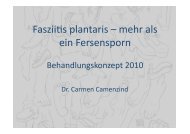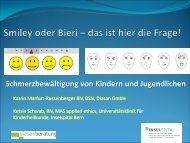Jahresbericht 2009 - Luzerner Kantonsspital
Jahresbericht 2009 - Luzerner Kantonsspital
Jahresbericht 2009 - Luzerner Kantonsspital
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong>
Die LUKS-Organisation<br />
Departement<br />
Wolhusen<br />
Anästhesie<br />
Innere<br />
Medizin<br />
Chirurgie &<br />
Orthopädie<br />
Gynäkologie/<br />
Geburtshilfe<br />
Departement<br />
Sursee<br />
Anästhesie<br />
Innere<br />
Medizin<br />
Chirurgie &<br />
Orthopädie<br />
Gynäkologie/<br />
Geburtshilfe<br />
Departement<br />
Chirurgie<br />
Chirurgische<br />
Klinik<br />
Herz-/<br />
Thorax-/<br />
Gefässchirurgie<br />
Orthopädie<br />
Urologie<br />
Kieferchirurgie<br />
Operationssäle<br />
Stab Medizin<br />
Arbeitsmedizin, Hygiene, Medizin-/<br />
Pflegeinformatik, Medizinalcontrolling,<br />
Qualitäts-/Riskmanagement<br />
Departement<br />
Medizin<br />
Privatabteilung<br />
Innere<br />
Medizin<br />
Innere<br />
Medizin,<br />
med. IPS<br />
Spezialmedizin 1<br />
Spezialmedizin 2<br />
Spezialmedizin 3<br />
Rehabilitation<br />
Departement<br />
Spezialkliniken<br />
Hals-Nasen-<br />
Ohren-Klinik<br />
Augenklinik<br />
Frauenklinik<br />
Höhenklinik<br />
Montana<br />
Spitalrat<br />
Direktor<br />
Geschäftsleitung<br />
Geschäftsleitungsausschuss<br />
Departement<br />
Kinderspital<br />
D-BW<br />
D-BW D-BW D-BW D-BW D-BW<br />
Pädiatrie<br />
Kinderchirurgie<br />
Stab Direktion<br />
Kommunikation & Marketing<br />
Multiprojektmanagement,<br />
Recht<br />
Departement<br />
Institute<br />
Radiologie<br />
Radio-Onkologie<br />
Pathologie<br />
Apotheke<br />
D-BW<br />
Labormedizin<br />
Anästhesie/<br />
chir.Intensivmed<br />
/Rettungsmed./<br />
Schmerztherapie<br />
Departement<br />
Pflege,<br />
Soziales<br />
Pflegeentwicklung/<br />
-qualität<br />
Fachberatung<br />
Ausbildung<br />
Weiterbildung<br />
Sozialdienst<br />
Seelsorge<br />
Departement<br />
Betrieb und<br />
Infrastruktur<br />
Informatik<br />
Ökonomie<br />
Technik, Bau &<br />
Sicherheit<br />
Departement<br />
Finanzen,<br />
Personal<br />
Finanzen<br />
Personal
Inhalt<br />
Editorial Spitalratspräsident 2<br />
Bericht Direktion/Geschäftsleitung 4<br />
Revue <strong>2009</strong> 8<br />
Departementsberichte<br />
Departement Medizin 13<br />
Departement Chirurgie 23<br />
Departement Spezialkliniken 35<br />
Departement Kinderspital 45<br />
Departement Institute 53<br />
Departement Pflege, Soziales 63<br />
Departement Betrieb und Infrastruktur 71<br />
Departement Sursee 81<br />
Departement Wolhusen 91<br />
Kennzahlen <strong>2009</strong><br />
Jahresrechnung 102<br />
Kennzahlen 108<br />
Medizinische Statistiken<br />
Chirurgie 109<br />
Medizin 110<br />
Spezialkliniken 112<br />
Kinderspital 113<br />
Institute 114<br />
Publikationen 115<br />
Impressum<br />
Herausgeber: <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong><br />
Koordination: Kommunikation und Marketing<br />
Redaktion: Hans Beat Stadler, Ebikon<br />
Fotos: Emanuel Ammon, Natalie Boo, Luzern<br />
Konzept/Gestaltung: hellermeier, Emmenbrücke<br />
Druck: beagdruck, Emmenbrücke<br />
Für die bessere Lesbarkeit wird in der Regel<br />
nur die männliche Form eines Begriffs verwendet.<br />
Gemeint sind immer beide Geschlechter.<br />
1
2 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Editorial<br />
Hans Amrein<br />
Präsident des Spitalrates<br />
Auf dem Weg<br />
zu optimalen Strukturen<br />
Erfolgreiche und erfahrene Ärzte sowie gut ausgebildetes, leistungsbereites und freund-<br />
liches Pflegepersonal sind weiterhin Voraussetzung für den guten Ruf eines Spitals. Das<br />
allein reicht aber für die Zukunft nicht mehr aus. Die freie Spitalwahl und der unüber-<br />
hörbare Ruf nach dem qualitativ messbaren, transparenten Patientennutzen heizen den<br />
Wettbewerb unter den Spitälern noch weiter an. Wirkungsvoll, zweckmässig und wirtschaftlich<br />
soll es sein. So verlangen es unsere neuen Gesetze und unsere Vorgaben.<br />
Die Wirtschaftlichkeit wird, ob uns das gefällt oder nicht, zu einer immer höher bewerteten<br />
Dimension. Wer im künftigen Benchmark nicht genügt, kommt unter Druck. Der<br />
wissenschaftlich-technische Fortschritt der Medizin und der Wille des Patienten, diesen<br />
auch zu nutzen, lassen sich durch nichts und niemanden aufhalten. Die Kosten werden<br />
weiter steigen und die oft hilflos scheinenden Anstrengungen, dies zu ändern, bleiben<br />
das weltweite Dauerthema im Gesundheitswesen.<br />
Verwaltungsräte bzw. Spitalräte sind nicht zuständig für die Gesundheitspolitik eines<br />
Kantons. Aber sie sind von Gesetzes wegen verantwortlich für die strategische Führung<br />
der ihnen anvertrauten Spitalunternehmungen. So ist die Hinterfragung unserer heutigen<br />
Spitalstrukturen nicht eine Anmassung, sondern vielmehr unsere oberste Pflicht.<br />
Für die Leistungsaufträge und für die Spitalstandorte ist und bleibt die politische<br />
Behörde zuständig. Das ist gut so. Es ist aber zweifellos Aufgabe der Führungsorgane<br />
eines Spitals, der Politik Lösungsvorschläge und Varianten zu unterbreiten, welche sie<br />
zur Evaluation für ihre oft schwierigen Entscheide dringend benötigen. In dieser Absicht<br />
habe ich mich im Sommer <strong>2009</strong> mit meiner Vision «Spitalgruppe Waldstätten» aufs<br />
Glatteis gewagt. Wenn auch Ort, Zeitpunkt und Publikum der Botschaft hinterfragt werden<br />
dürfen, so war deren Wirkung doch einmalig und aufschlussreich: eine (ungewollte)<br />
Aufklärung über die spitalpolitische Befindlichkeit in der Zentralschweiz. Vielen<br />
positiven Reaktionen entnehme ich die Aufforderung, mich mit dem Thema «Kantonsübergreifende<br />
Spitalstrukturen» weiterhin zu beschäftigen. Das werde ich tun, aber<br />
behutsamer, denn ohne den Willen zu Veränderungen und ohne das dafür notwendige<br />
Vertrauen innerhalb aller angesprochenen Partner lassen sich keine Visionen verwirklichen.<br />
Es ist nicht so, dass wir <strong>Luzerner</strong> in der Zentralschweiz alle «einpacken» wollen. Der<br />
Kanton Luzern ist kein grosser, sondern lediglich ein mittelgrosser Kanton. Er ist aber<br />
grösser als seine Zentralschweizer Nachbarn und steht mit seinem Zentrumsspital im<br />
Dienst der ganzen Zentralschweiz. Mit unserem Zentrumsspital spielen wir in einer hohen<br />
Liga. Es ist kein Geheimnis, dass wir uns diesen Ligaerhalt auf die Dauer nur leisten<br />
können, wenn er in der Zukunft noch vermehrt von der ganzen Region Zentralschweiz<br />
mitgetragen wird. Darauf basiert meine Idee «Spitalgruppe Waldstätten». Das Zentrumsspital<br />
Luzern soll eines Tages allen Zentralschweizern gehören und von diesen auch<br />
getragen und genutzt werden, beispielsweise im Proporz nach Einwohnerzahl, mit<br />
gleichzeitiger Absicherung der Kantonsinteressen. Mit den immer wieder zu hörenden<br />
Forderungen nach Spitalschliessungen sollte man vorsichtiger umgehen. Sie verunsichern,<br />
führen zu Existenzängsten und organisiertem Widerstand. Was aber im Interesse<br />
einer allseits nachvollziehbaren Kosten-/Nutzen-Analyse nottut, ist die Konzentra tion<br />
der Kräfte. Das führt zur Erkenntnis, nicht mehr überall alles anbieten zu müssen oder<br />
anbieten zu wollen. Das heisst, sich der Tatsache zu stellen, dass bei Erhöhung der Fall-<br />
zahlen die Sicherheit erhöht und die Kosten gesenkt werden können.
Es bleibt noch die Frage der Spitzenmedizin. Ich stimme der Forderung zu, dass Transplantationen<br />
auf einige wenige Universitätsspitäler konzentriert werden sollen. Luzern<br />
gehört da nicht dazu. Als universitäres Lehrspital gehört aber Luzern zu den wenigen<br />
Zentrumsspitälern, welche die Voraussetzungen für einige wichtige Angebote der<br />
Spitzenmedizin erfüllen. Voraussetzung ist die notwendige Anzahl Fälle und die damit<br />
einhergehende Qualität und Wirtschaftlichkeit. Im Namen und im Auftrag der ganzen<br />
Region Zentralschweiz ist das möglich und im Interesse aller auch sinnvoll.<br />
Mit der Absichtserklärung zum Projekt «LUNIS» (Luzern-Nidwalden-Spitäler) haben nun<br />
die Kantonsregierungen von Nidwalden und Luzern einen ersten Schritt gewagt. Es<br />
bleibt zu hoffen, dass sich daraus so etwas wie eine gemeinsame «Spitalregion Zent-<br />
ralschweiz» weiterentwickelt. Wir sollten uns tatsächlich zusammenraufen, füreinander<br />
und nicht gegeneinander.<br />
Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege, der Technik und der Administration<br />
sowie der ganzen Ärzteschaft, dem Kader, der Geschäftsleitung und dem<br />
CEO für die auch im Berichtsjahr <strong>2009</strong> geleistete gute Arbeit. Der Dank gilt auch meinen<br />
Kolleginnen und Kollegen im Spitalrat für die gute und engagierte Zusammenarbeit.<br />
Hans Amrein<br />
Präsident Spitalrat LUKS<br />
Die Mitglieder des Spitalrats sind<br />
Hans Amrein, Präsident, Sursee<br />
Prof. Dr. med. Oskar Schmucki, Vize-Präsident, Luzern<br />
Dr. rer. pol. Kurt Aeberhard, Schüpfen<br />
Frida Alder, Gerzensee<br />
Dr. med. Premy Hub, Sursee<br />
Dr. med. Christiane Roth, Gockhausen<br />
Peter Schilliger, Udligenswil<br />
Prof. Dr. med. Thomas Schnider, Speicher<br />
Pius Zängerle, Adligenswil<br />
Peter Schwegler, Vertreter des GSD (mit beratender Stimme)<br />
Robert Bisig, Sekretär Spitalrat<br />
LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Editorial<br />
3
4 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong><br />
Benno Fuchs<br />
Direktor (CEO)<br />
Bericht Direktion/<br />
Geschäftsleitung<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
Das Gesundheitswesen gibt nach wie vor viel zu reden, nicht nur im Kanton Luzern, und<br />
nicht nur wegen der Kosten. Angesprochen sind – vor dem Hintergrund zahlreicher<br />
Widersprüche – auch die Spitäler. Angesichts der unterschiedlichen Bedürfnisse seitens<br />
der Bevölkerung, der Leistungsfinanzierer und der Politik geraten sie immer mehr unter<br />
finanziellen Druck. Die Spitäler befinden sich zwischen dem Hammer der zunehmenden<br />
Leistungsbeanspruchung, der medizinischen Entwicklung und ständig steigenden ge-<br />
setzlichen Auflagen sowie dem Amboss von stagnierenden Tarifen der Versicherer und<br />
limitierten Staatsbeiträgen; Staatsbeiträgen, mit denen den Spitälern nicht etwa Defizite,<br />
sondern die durch die Versicherer gesetzlich nicht zu tragenden Leistungen abgegolten<br />
werden. Diese umfassen im Besonderen die lückenlose Notfallversorgung rund um die<br />
Uhr an 365 Tagen, die uneingeschränkte Aufnahmepflicht aller Patienten, die Aus- und<br />
Weiterbildung sowie die durch die Grundversicherung nicht gedeckten Spitalkosten.<br />
Die Bevölkerung bewegt sich zunehmend selbstbewusster durch das Angebot von Gesundheitsdienstleistungen.<br />
War früher das nächstgelegene Spital als praktisch universaler<br />
Leistungsanbieter unbestritten, suchen sich heute viele Patientinnen und Patienten<br />
die nach ihrem persönlichen Empfinden geeignetste Institution mit entsprechendem<br />
Leistungsangebot, qualifizierten Fachpersonen und modernster Infrastruktur. Am Ausgang<br />
des «Gesundheits-Supermarkts» steht aber nicht die klassische Kasse wie beim<br />
Grossverteiler. Auf dessen Leistungen erheben die Patientinnen und Patienten Anspruch,<br />
schliesslich zahlen sie immer höhere Versicherungsprämien. Die Verantwortung für das<br />
«kränkelnde» Gesundheitswesen tragen alle Beteiligten – die Politik, die Versicherer, die<br />
Leistungserbringer und die Bevölkerung als Leistungsbezüger. Und nur gemeinsam lässt<br />
sich eine Besserung erzielen.<br />
Das LUKS entwickelt sich laufend weiter<br />
Die Herausforderungen, die sich dem <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> stellen, können nur dank<br />
hohem mitmenschlichem Engagement und ständigen Verbesserungen hinsichtlich Qualität,<br />
Effizienz, Vernetzung, Kostenmanagement und Innovationen bewältigt werden. Das<br />
LUKS erfüllte seinen medizinischen Versorgungsauftrag auch im Berichtsjahr auf hohem<br />
Niveau und entwickelt sich als Unternehmen laufend weiter. Beispiele, die in den folgenden<br />
Berichten der Departemente näher ausgeführt werden, belegen dies:<br />
– Der Weg zum Tumor führt auch über gezielte kleine Schädeleröffnungen («navigati-<br />
onsgestützte Mini-Craniotomien»). Diese Eingriffe erfordern weniger Zeit als früher,<br />
die Wunden sind kleiner und weniger schmerzhaft, sie heilen schneller und ermöglichen<br />
einen früheren Spitalaustritt sowie eine kürzere Rekonvaleszenz.<br />
– Seit Jahresbeginn <strong>2009</strong> leisten zahlreiche Hausärzte der Stadt und Landschaft den<br />
Notfalldienst am LUKS Luzern und Wolhusen. Mit der Einrichtung der Notfallpraxen<br />
liess sich der immer grösser gewordene Patientenstrom dem Schweregrad entsprechend<br />
aufteilen und die für stationäre Patienten konzipierten Notfallstationen von ambulanten<br />
Patienten entlasten.<br />
– Im Jahr <strong>2009</strong> konnte die interventionelle Therapie von kranken Herzklappen nach der<br />
Einführung des kathetertechnischen Ersatzes der Aortenklappe nun auch auf die Mitralklappe<br />
ausgedehnt werden. Die Eröffnung des Brustkorbs und der Anschluss an<br />
die Herz-Lungen-Maschine sind so nicht mehr in jedem Fall nötig.
– Im Frühjahr <strong>2009</strong> konnte die Augenklinik des LUKS als erste Klinik in Europa ein neuartiges<br />
Medikament zur Behandlung von Augenentzündungen einsetzen. Dabei werden<br />
therapeutische Antikörper, die bisher gespritzt werden mussten, so weit verkleinert,<br />
dass sie nun schmerz- und nebenwirkungsfrei als Tropfen dem Auge direkt<br />
verabreicht werden können.<br />
– Im Jahr <strong>2009</strong> nahmen die Konsultationen auf der Notfallstation des Kinderspitals um<br />
50 Prozent auf über 12‘000 zu. Gleichzeitig stieg die Zahl der telefonischen Anfragen,<br />
die jedoch vielfach keine Notfälle betrafen, sondern eine allgemein-pädiatrische Beratung<br />
umfassten. Die Organisation der Notfallstation musste deshalb auf allen Ebenen<br />
rasch angepasst werden.<br />
– Ende <strong>2009</strong> wurden die alten Gammakameras der Nuklearmedizin durch moderne Geräte<br />
mit SPECT/CT ersetzt. Die Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie ist ein<br />
diagnostisches Verfahren zur Herstellung von Schnittbildern lebender Organismen.<br />
Auf diese Weise kann die Funktion verschiedener Organe beurteilt werden.<br />
– Das Zentrum für Endoskopie und Laparoskopie Sursee steht unter der Leitung von drei<br />
Chefärzten. Damit wird das Know-how von Spezialisten verschiedener Fachgebiete<br />
vereinigt. Die Vernetzung basiert auf dem ausgezeichneten kollegialen Klima innerhalb<br />
der Gastroenterologie, Gynäkologie und Viszeralchirurgie.<br />
– Beim kontinuierlichen Analgesieverfahren kommen im Rahmen orthopädischer Eingriffe<br />
in Wolhusen neben den rückenmarknahen Katheterverfahren vorwiegend kontinuierliche<br />
periphere Nervenblockaden sowie zur kontinuierlichen Applikation der<br />
Schmerzmedikation eine Präzisionspumpe zum Einsatz. Über einen Druckknopf an<br />
der Pumpe kann der Patient aufgrund seiner Bedürfnisse die Schmerztherapie autonom<br />
mitgestalten. Wolhusen ist zudem weltweit die erste Klinik, in welcher bestimmte<br />
Operationen im Bereich der arthroskopischen Chirurgie navigiert durchgeführt werden.<br />
– Aktuell besuchen im Bereich Pflege 344 Studierende aus 39 Ausbildungsbetrieben den<br />
Unterricht im Lernbereich Training & Transfer (LTT). Zum Vergleich: 2005 waren es lediglich<br />
26 Studierende.<br />
– Um Zeit und Geld zu sparen, finden neu standortübergreifende Videokonferenzen<br />
statt. Die LUKS-Standorte Luzern, Sursee, Wolhusen und Montana sind über ein neues<br />
Videokonferenzsystem verbunden. Damit ist die effiziente und sichere Gestaltung von<br />
Tumorboards, Fallbesprechungen und Fortbildungen auf hohem Niveau möglich. Das<br />
Videokonferenzsystem lässt sich auch mit Drittinstitutionen, wie Universitätskliniken,<br />
einsetzen.<br />
– Am LUKS erfolgten im Berichtsjahr wiederum umfassende bauliche Massnahmen. Besonders<br />
erwähnenswert ist die aufwändige Modernisierung und Erweiterung der zentralen<br />
Operationssäle am Spitalzentrum Luzern unter laufendem Betrieb.<br />
Erstmals unbefriedigendes Rechnungsergebnis<br />
Zwischen 2004 und 2007 führten das LUKS bzw. die Spitäler Luzern, Sursee und Wolhusen<br />
insgesamt rund 80 Mio. Franken der gesprochenen Staatsbeiträge ohne unternehmerisch<br />
notwendige Reservebildung an den Kanton zurück. Nach einem Gewinn über<br />
5.1 Mio. Franken im Jahr 2008 und den finanziell ebenfalls erfolgreichen Vorjahren zeigt<br />
die Jahresrechnung <strong>2009</strong> mit einem Minus von rund 26 Mio. Franken erstmals ein deutlich<br />
unbefriedigendes Ergebnis. 19.4 Mio. Franken davon lassen sich auf einmalige<br />
LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong><br />
5
6 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong><br />
Effekte zurückführen. Denn die im Leistungsauftrag des Kantons Luzern vorgeschrie bene<br />
Umstellung auf den Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER verlangte eine Neudarstellung<br />
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des LUKS. Erstens mussten im Zusammenhang<br />
mit der Sanierung der <strong>Luzerner</strong> Pensionskasse vorsorglich 11.8 Mio. Franken<br />
in der Bilanz zurückgestellt werden. Zweitens wurde die Aktivierungsgrenze im Jahr<br />
<strong>2009</strong> erhöht, was Nachholabschreibungen bei den vom Kanton Luzern auf 2008 übernommenen<br />
Anlagegütern über 7.6 Mio. Franken verursachte. Der Verlust aus der operativen<br />
Tätigkeit beträgt somit bei einem Jahresumsatz von über 640 Mio. Franken 6.6 Mio. Franken<br />
oder rund 1% des Gesamtumsatzes.<br />
Obwohl sich die relative Budgetabweichung im operativen Betrieb im Rahmen der Vor-<br />
jahre bewegt, stellt sich die Frage, ob sich für das LUKS neu die Kosten-Ertrags-Schere<br />
negativ öffnet. Leider zeichnet sich diese Entwicklung ab. Währenddem in den Vorjahren<br />
die Verbesserungen der medizinischen Versorgung, die medizinische, pharmazeutische<br />
und technische Entwicklung, die Anforderungen seitens des Arbeitsmarktes, der Ausund<br />
Weiterbildung usw. durch betriebliche Massnahmen auf der Kosten- und Ertrags-/<br />
Leistungsseite kompensiert werden konnten, scheint dies künftig nicht mehr möglich zu<br />
sein. Intern leitete das LUKS zwar Massnahmen ein, um weitere Optimierungsmöglichkeiten<br />
zu erkennen und umzusetzen. Jedoch dürften die gesetzlichen Vorgaben sowie<br />
das beauftragte Leistungsspektrum den notwendigen Handlungsspielraum nicht zulassen.<br />
Gleichzeitig versuchen die Versicherer – z.B. durch Änderungen in der Tarifstruktur<br />
oder Preissenkungen – Leistungsbereiche mit guten Erträgen zu kappen, währenddem<br />
die unterdeckten und intern quersubventionierten – für die Gesundheitsversorgung der<br />
Bevölkerung jedoch unverzichtbaren – Bereiche niemand berappen will. Die Frage des<br />
Leistungsumfangs wird deshalb in naher Zukunft noch stärker mit derjenigen des Leistungsspektrums<br />
für die Bevölkerung verknüpft sein.<br />
Herausforderungen<br />
Öffentliche Spitäler stehen vor der Herausforderung, sich im Wettbewerb zu behaupten,<br />
ohne sich der Gesamtversorgung der Bevölkerung zu entledigen. Der ökonomische und<br />
organisatorische Anpassungsdruck wird die Politik und auch die verantwortlichen Organe<br />
des LUKS in den kommenden Jahren fordern.<br />
Die Umfeldentwicklungen bedeuten nicht nur organisatorische und restrukturierende<br />
Anstrengungen für die klassische medizinische Versorgung, sie bieten auch eine grosse<br />
Chance zur Weiterentwicklung und Neuausrichtung des LUKS als grösstes medizinisches<br />
Kompetenzzentrum der Zentralschweiz. Dabei gilt es, die Effizienzprobleme an den Sektorrändern<br />
der einzelnen Gesundheitsversorger zu identifizieren und ohne Energie- und<br />
Qualitätsverluste partnerschaftlich anzugehen. Die Spitäler und die anderen Gesundheitsinstitutionen<br />
dürfen sich nicht als abgeschottete Versorgungseinheiten sehen. Als<br />
Folge entstünde eine unzureichende Behandlungskontinuität mit dem Effekt, dass sich<br />
letztlich die Versorgungssituation verschlechtert. Der sich abzeichnende Wandel, bedingt<br />
durch die zunehmend häufigeren chronischen Krankheiten und bösartigen Neubildungen,<br />
benötigt somit schnittstellenarme und sektorenübergreifende Versorgungsprozesse.<br />
Kerninstrument dazu sind klinische Behandlungspfade, die indikationsspezifisch über<br />
die Sektoren hinweg eine effiziente und effektive Versorgung von chronisch Kranken ermöglichen.<br />
Das Versorgungsmanagement spielt zunehmend eine wichtige Rolle. Unter<br />
dem neuen Fallpauschalensystem, den DRGs, gilt es, intelligente vor- und nachstatio näre
Unterstützungs- und Überleitungsprozesse zu entwickeln. Dabei dürfen aber Quali-<br />
tätsaspekte nicht zu kurz kommen. «Drehtür- und Weiterreichungseffekte» zum Nachteil<br />
der Patienten dürfen gar nicht erst entstehen. Diese Veränderungen in der Behandlungs-<br />
kette werden sehr hohe Anforderungen an Pflege und Medizin stellen, insbesondere in<br />
der Zusammenarbeit.<br />
Die Überlebensfähigkeit eines Spitals hängt unabhängig von der öffentlichen oder privaten<br />
Trägerschaft von der Erzielung des notwendigen Gewinns zur Überlebenssicherung<br />
ab. Ein Spital, das nicht auf eine ausreichend hohe erwirtschaftete Rendite abstellt<br />
und die notwendigen Investitionen nicht tätigen kann, wird nicht bestehen können. Ob<br />
es politisch klug ist, die Spitallandschaft weitgehend dem Markt zu überlassen, muss<br />
heute offengelassen werden. Es ist möglich, dass dies zu Lasten der Behandlungsqualität<br />
geschehen wird. Allerdings ist eine hohe Behandlungsqualität wiederum ein wichtiger<br />
Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Spitäler mit einer hohen Versorgungsqualität werden<br />
daher bei einer Marktbereinigung eher bestehen als solche mit Qualitätsdefiziten.<br />
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels mit der älter werdenden Gesellschaft<br />
tritt zudem der Aspekt einer wohnortnahen Versorgung zunehmend in den Mittelpunkt<br />
der Diskussionen. Für die ländlichen Regionen stellt sich vermehrt die Frage,<br />
wie eine flächendeckende Spitalversorgung für den Notfallbereich sichergestellt werden<br />
kann. Das DRG-Finanzierungssystem basiert auf einer Mischkalkulation. Dies bedeutet,<br />
dass kostenintensive Notfallpatienten über Wahlleistungen quersubventioniert werden.<br />
Dementsprechend benötigt ein Spital eine gewisse Leistungsbreite, um wirtschaftlich<br />
zu sein. Der alleinigen Logik des Markts zufolge wären Spitäler in ländlichen Regionen<br />
daher wirtschaftlich nicht attraktiv. Ein kluges Verhalten des öffentlichen Spitalträgers<br />
ist geboten, wenn er als Eigner und Planer dem Gesamtwohl der Bevölkerung verpflichtet<br />
sein will.<br />
Die verantwortlichen Stellen aus Politik, Behörde und Spitälern sind gemeinsam gefor-<br />
dert, speziell die Rolle des öffentlichen Spitals einer Analyse zu unterziehen und die rich-<br />
tigen, der gesamten Bevölkerung dienenden Akzente zu setzen. Diese müssen nicht nur<br />
bei einem hohen betriebswirtschaftlichen, sondern auch vor einem der Fairness ver-<br />
pflichteten sozialpolitischen Anspruch bestehen. Es ist wichtig, dass sich die Eigner der<br />
öffentlichen Spitäler jenseits von vermeintlicher Wettbewerbslogik auch sozial- und<br />
regionalpolitisch verbindlich positionieren, auch im Kanton Luzern.<br />
Dank<br />
Ich danke allen Mitarbeitenden des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s herzlich für das grosse Engagement<br />
und die ausgezeichnete Betreuung unserer Patientinnen und Patienten. Die<br />
vielen positiven Rückmeldungen bezeugen dies eindrücklich.<br />
Besten Dank auch den Mitgliedern des Spitalrats für die gute Zusammenarbeit. Mein<br />
Dank gilt sodann dem Gesundheits- und Sozialdepartement und speziell der <strong>Luzerner</strong><br />
Bevölkerung, die dem <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> für die Arbeit im Dienst der kranken Menschen<br />
das notwendige Umfeld bieten.<br />
Benno Fuchs<br />
Direktor (CEO)<br />
LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong><br />
7
8 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Revue<br />
Revue <strong>2009</strong><br />
Januar<br />
Am 3. Januar <strong>2009</strong> eröffnet das LUKS<br />
Wolhusen in Zusammenarbeit mit der<br />
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern<br />
und Hausärzten aus dem Einzugsgebiet<br />
die Hausärztliche Notfallpraxis. Die<br />
Patientinnen und Patienten werden je<br />
nach Situation ihrem Hausarzt, anderen<br />
Versorgern oder den einzelnen Fachdisziplinen<br />
des LUKS zugewiesen.<br />
April<br />
Die Orthopädie des LUKS Wolhusen<br />
ist eine der ersten Kliniken der Welt,<br />
welche die arthroskopische Chirurgie<br />
des femoroacetabularen Impingements<br />
angewendet hatten, und die erste<br />
Klinik der Welt, die diese Operation navigiert<br />
durchführt. Mit knapp 100 Eingriffen<br />
jährlich gehört sie in diesem Bereich<br />
zu den führenden Zentren der Schweiz.<br />
Februar<br />
Die zweite Etappe der OP-Sanierung<br />
ist erfolgreich abgeschlossen. Der<br />
vollständig erneuerte HNO-Operationsbereich<br />
wird seiner Bestimmung übergeben.<br />
Mit dem Umzug des Chirurgie-<br />
Operationssaals und der Inbetrieb-<br />
nahme des neuen OP-Provisoriums<br />
startet die dritte Umbauetappe.<br />
Die gesamte OP-Sanierung wird im<br />
Februar 2010 vollendet sein.<br />
Mai<br />
Der <strong>Luzerner</strong> Regierungsrat besucht<br />
am 5. Mai <strong>2009</strong> das LUKS Luzern. Auf<br />
dem Programm stehen die Besichtigung<br />
des Da-Vinci-Operationsroboters<br />
in der Urologie sowie ein Einblick in die<br />
neuen Operationssäle. Ein gemeinsames<br />
Arbeitsmittagessen im Personalrestaurant<br />
mit Spitalratspräsident Hans<br />
Amrein, Direktor Benno Fuchs sowie<br />
Mitgliedern der Geschäftsleitung runden<br />
den Besuch ab.<br />
Februar<br />
Die <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana<br />
(LHM) wurde mit der Fusion und der<br />
Verselbstständigung der <strong>Luzerner</strong><br />
Spitäler ins LUKS aufgenommen. Hatte<br />
die Integration zuerst noch provisorischen<br />
Charakter, ist die LHM seit Anfang<br />
<strong>2009</strong> als vierter Standort definitiv ein<br />
Bestandteil des LUKS. Organisatorisch<br />
gehört die LHM zum Departement<br />
Spezialkliniken.<br />
Mai<br />
Um für den Ernstfall gerüstet zu sein,<br />
organisiert das LUKS mehrmals pro Jahr<br />
DBL-Anlässe («Dispositiv besondere<br />
Lagen»). Das Spektrum der Übungen<br />
reicht vom Prüfen des Probealarms<br />
bis zu Grossübungen in Bereichen wie<br />
grosser Patientenanfall, Brand, technische<br />
Panne, Pandemie und Dekontamination<br />
mit den betroffenen Mitarbeitenden<br />
und deren Stellvertretungen.
März<br />
Seit dem 12. März <strong>2009</strong> erfolgt der<br />
Notarztdienst nach dem sogenannten<br />
Rendez-vous-System. Bei einem dringenden<br />
Notfalleinsatz werden über den<br />
Sanitätsnotruf 144 ein Rettungswagen<br />
(Ambulanz) und gleichzeitig das Notarzteinsatzfahrzeug<br />
(NEF) alarmiert und<br />
getrennt zum Notfallort losgeschickt.<br />
Der Notarzt ist auf diese Weise flexibler<br />
einsetzbar und bei dringenden Notfällen<br />
wird die Hilfsfrist weiter verkürzt.<br />
Mai<br />
Am 18. Mai <strong>2009</strong> wird am LUKS Luzern<br />
der erste Patient mit der RapidArc-<br />
Technik bestrahlt. Bei vergleichbarer<br />
Dosisverteilung im Zielvolumen kann mit<br />
dieser neuen Bestrahlungstechnik oft<br />
gesundes, sensibles Gewebe besser<br />
geschont werden. Die tägliche Bestrahlungszeit<br />
ist bis zu achtmal kürzer.<br />
Das LUKS Luzern ist erst das vierte<br />
Spital in der Schweiz, das diese Technik<br />
einsetzt.<br />
März<br />
Der Übergang zur Bypassoperation<br />
am schlagenden Herzen (off-pump) hat<br />
viele Vorteile für die Patienten. In<br />
bestimmten Fällen kann ohne Einsatz<br />
einer Herz-Lungen-Maschine operiert<br />
werden. Diese ist eine potenzielle<br />
Verursacherin von Komplikationen, insbesondere<br />
bei Patienten mit schwerwiegenden<br />
Begleiterkrankungen. Aus<br />
diesem Grund ist die Operation am<br />
schlagenden Herzen eine grosse Chance<br />
für mehrfach Erkrankte.<br />
Juni<br />
Der LUKS-Personalanlass «Hospitalia<br />
<strong>2009</strong>» hat bereits Tradition. Die Mit-<br />
arbeitenden aller Standorte sind an<br />
zwei Abenden zur Rundfahrt auf dem<br />
Vierwaldstättersee mit gepflegtem<br />
Diner und anregender Unterhaltung eingeladen.<br />
Am Freitag, 5. und 19. Juni<br />
<strong>2009</strong> stechen je drei Passagierschiffe<br />
mit den LUKS-Mitarbeitenden in See.<br />
Der sehr gut besuchte Anlass ist<br />
wiederum ein voller Erfolg.<br />
März<br />
LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Revue<br />
Am 23. März <strong>2009</strong> findet die konsti-<br />
tuierende Sitzung der neuen Personalkommission<br />
(PEKO) statt sowie die<br />
Wahl der Mitglieder. Jedes Departement<br />
des LUKS ist mit einem Mitglied – die<br />
Departemente Sursee und Wolhusen<br />
mit je zwei Mitgliedern – in der PEKO<br />
vertreten.<br />
Juli<br />
Weil die kontinuierliche Zunahme der<br />
Operationszahlen zu Engpässen in<br />
der Verfügbarkeit der Operationssäle<br />
geführt hat, sind für die anstehende<br />
Renovation und Erweiterung der Augenklinik<br />
fünf anstelle der bisherigen drei<br />
Operationssäle geplant. Der vierte<br />
Operationssaal wird auf den Jahreswechsel<br />
hin in Betrieb genommen.<br />
9
10 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Revue<br />
Revue <strong>2009</strong><br />
Juli<br />
Am <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> schliessen<br />
81 Lernende ihre berufliche Grund-<br />
bildung erfolgreich ab und feiern diesen<br />
Meilenstein am 1. Juli <strong>2009</strong> an der<br />
Lehrabschlussfeier im Verkehrshaus<br />
Luzern. Herzliche Gratulation, alles Gute<br />
und viel Erfolg den jungen Berufsleuten<br />
auf ihrem weiteren privaten und beruflichen<br />
Lebensweg!<br />
Oktober<br />
Das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> ist mit<br />
5396 Beschäftigten der grösste Arbeitgeber<br />
der Zentralschweiz. Das geht<br />
aus der jährlichen Erhebung der «Neuen<br />
<strong>Luzerner</strong> Zeitung» hervor.<br />
August<br />
Das LUKS Wolhusen ist das erste Spital<br />
im Kanton Luzern mit SRC-Anerkennung<br />
für Basic-Life-Support-Kurse (SRC,<br />
Swiss Resuscitation Council). Die Rate<br />
der Menschen, die einen Kreislaufstillstand<br />
ohne schwere Folgeschäden<br />
überleben, ist nur mit einer lückenlos<br />
funktionierenden Überlebenskette<br />
zu steigern. Im LUKS Wolhusen wird die<br />
entsprechende Schulung des Personals<br />
jährlich durchgeführt.<br />
November<br />
Viele Menschen leiden unter Klappenkrankheiten.<br />
Ein grosser Teil von ihnen<br />
konnte bis vor kurzem keine ursachenorientierte<br />
Behandlung bekommen,<br />
da das Risiko einer Operation sehr gross<br />
war. Nach der erfolgreichen Einführung<br />
des katheterbasierten Ersatzes der Aortenklappe<br />
am LUKS wurden bei den ersten<br />
Patienten undichte Klappen zwischen<br />
dem linken Vorhof und der linken<br />
Herzkammer (der Mitralklappe) ersetzt.<br />
Diese Art von Eingriffen wird zurzeit<br />
in der Schweiz nur in Lugano und am<br />
Universitätsspital Zürich vorgenommen.<br />
September<br />
Der Spitalrat hat grünes Licht erteilt für<br />
die Realisierung bedeutender, zukunftsorientierter<br />
Investitionsprojekte in<br />
der Radiologie und Nuklearmedizin des<br />
LUKS Luzern. Die Angiographieanlage<br />
und die Gamma-Kameras werden noch<br />
dieses Jahr ersetzt. Im Frühjahr 2010<br />
wird dann in der modernisierten Nuklearmedizin<br />
das PET/CT-Gerät in Betrieb<br />
genommen (Positronen-Emissions-<br />
Tomographie/Computer-Tomographie).<br />
November<br />
Das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> und das<br />
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil<br />
rücken im Rahmen ihrer Public Private<br />
Partnership (PPP) weiter zusammen:<br />
Die Sportmedizinabteilungen aus<br />
Nottwil und Luzern schaffen mit dem<br />
gemeinsamen Sportmedizinischen<br />
Zentrum Nottwil-Luzern ein für die<br />
Schweiz einzigartiges Angebot in der<br />
Sportmedizin.
September<br />
Am 25. September <strong>2009</strong> besuchen<br />
über 300 Kinder die Kinderuni am LUKS<br />
und lauschen den Vorträgen von Prof.<br />
Dr. Gregor Schubiger («Herzklopfen: Was<br />
klopft denn da?») und Prof. Dr. Christoph<br />
Konrad («Warum atmen wir?»).<br />
Die Kinder staunen über die Sezierung<br />
eines Schweineherzens und beantworten<br />
fleissig Quizfragen über die Lungenfunktionen.<br />
Die Kinderuni wird jedes<br />
Jahr von der Uni Luzern und dem LUKS<br />
gemeinsam durchgeführt.<br />
November<br />
Das ZELS, Zentrum für Endoskopie<br />
und Laparoskopie Sursee, ist ein interdisziplinäres<br />
Angebot der Chirurgie,<br />
Gynäkologie und Medizin am LUKS Sursee.<br />
Es ist die Anlaufstelle für rasche,<br />
kompetente Abklärungen und Behandlungen<br />
häufiger und besonders komplexer<br />
Erkrankungen des Bauchraums.<br />
September<br />
In der Schweiz herrscht ein Mangel<br />
an Organspenderinnen und -spender.<br />
Die Warteliste ist so lang wie noch nie.<br />
Bei Organentnahmen spielen die Zeit<br />
und die medizinische Kompetenz eine<br />
grosse Rolle. Ab dem 1. Dezember <strong>2009</strong><br />
kann neu das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong><br />
(LUKS) für das Spendernetzwerk Zentralschweiz<br />
Abklärungen treffen und<br />
Organentnahmen durchführen. Pro Jahr<br />
wird mit 5–10 Organspendern aus der<br />
Zentralschweiz gerechnet.<br />
Dezember<br />
Die Pandemie erfasst die Schweiz.<br />
Seit dem 10. November <strong>2009</strong> wird am<br />
LUKS geimpft. Glücklicherweise ist<br />
der Krankheitsverlauf für die meisten<br />
Betroffenen nicht schwerer als bei einer<br />
saisonalen Grippe. Es erkranken aber<br />
mehr Kinder und junge Erwachsene<br />
als gewohnt. Der Personalärztliche<br />
Dienst und die Spitalhygiene haben sich<br />
minutiös vorbereitet und alle Prozesse<br />
im «Dispositiv besondere Lagen»<br />
dokumentiert.<br />
Oktober<br />
Dezember<br />
LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Revue<br />
Die Kantone Luzern und Nidwalden<br />
unterzeichnen eine Absichtserklärung,<br />
mit der sie eine gemeinsame Spitalversorgung<br />
bzw. die Spitalregion Luzern-<br />
Nidwalden anstreben. Mit einem Projekt<br />
wird diese Absicht konkretisiert. Geplant<br />
ist die Führung des <strong>Kantonsspital</strong>s<br />
Nidwalden durch das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong><br />
ab 2012 und später allenfalls<br />
eine Fusion der beiden Institutionen.<br />
Das Krebsregister des Kantons Luzern<br />
nimmt am LUKS den operativen Betrieb<br />
auf. Krebsregister helfen mit, die<br />
Krebsvorbeugung, Früherkennung,<br />
Ursachenforschung sowie die Identifikation<br />
von Risikogruppen zu verbessern.<br />
Der Datenschutz und die Patientenrechte<br />
sind dabei stets gewährleistet. Krebs<br />
ist die zweithäufigste Todesursache,<br />
40 Prozent der Schweizer Bevölkerung<br />
erkranken im Lauf ihres Lebens daran.<br />
11
Departement Medizin<br />
13
14 Departement Medizin<br />
Departementsleiterin<br />
Prof. Dr. Verena Briner<br />
«Wenn der Wind der Veränderung<br />
weht, bauen die<br />
einen Windmühlen, die<br />
anderen Mauern, sagt ein<br />
chinesisches Sprichwort.<br />
Das LUKS nutzt die Kraft<br />
des Windes und schützt<br />
sich gleichzeitig vor allzu<br />
stürmischen Böen. Denn<br />
es braucht beides: den<br />
Wind, der Veränderung<br />
bringt, und die Mauer,<br />
die Bewährtes schützt.»<br />
Prof. Dr. Verena Briner,<br />
Departementsleiterin<br />
Bereichsleitungen<br />
Privatabteilung Innere Medizin<br />
Prof. Dr. Verena Briner,<br />
Chefärztin Innere Medizin (PiP)<br />
Lilian Jäger, Leiterin Pflegedienst<br />
Irene Blumer Balzer,<br />
Leiterin Pflegedienst<br />
Allgemeine Innere Medizin<br />
PD Dr. Christoph Henzen,<br />
Chefarzt Allg. Innere Medizin (PiP)<br />
Lilian Jäger, Leiterin Pflegedienst<br />
Irene Blumer Balzer,<br />
Leiterin Pflegedienst<br />
Spezialmedizin 1<br />
Dr. Dominique Criblez,<br />
Chefarzt Gastroenterologie (PiP)<br />
Irene Blumer Balzer,<br />
Leiterin Pflegedienst<br />
Spezialmedizin 2<br />
Prof. Dr. Paul Erne,<br />
Chefarzt Kardiologie (PiP)<br />
Lilian Jäger, Leiterin Pflegedienst<br />
Spezialmedizin 3<br />
Prof. Dr. Rudolf Joss,<br />
Chefarzt Onkologie (PiP)<br />
Lilian Jäger, Leiterin Pflegedienst<br />
Rehabilitation<br />
Dr. Hanspeter Rentsch,<br />
Chefarzt Rehabilitation (PiP)<br />
Ueli Wenger, Leiter Pflegedienst<br />
Leitendes Personal<br />
Allergologie<br />
Dr. Gerhard Müllner, Konsiliararzt<br />
Angiologie<br />
Dr. Martin Banyai, Leitender Arzt<br />
Dermatologie<br />
Prof. Christoph Brand, Chefarzt<br />
Endokrinologie/Diabetologie<br />
PD Dr. Christoph Henzen, Chefarzt<br />
Gastroenterologie<br />
Dr. Dominique Criblez, Chefarzt<br />
Dr. Claudia Hirschi, Leitende Ärztin<br />
Hämatologie<br />
Prof. Dr. Dr. Walter Wuillemin,<br />
Leitender Arzt<br />
Kardiologie<br />
Prof. Dr. Paul Erne, Chefarzt<br />
PD Dr. Peiman Jamshidi<br />
Medizinische Intensivstation<br />
Dr. Serge Elsasser, Leitender Arzt<br />
Rainer Pöpken, Leiter Pflegedienst<br />
Nephrologie und Dialysestation<br />
Dr. Andreas Fischer, Leitender Arzt<br />
Neurologie<br />
Prof. Dr. Martin Müller, Leitender Arzt<br />
Onkologie<br />
Prof. Dr. Rudolf Joss, Chefarzt<br />
Dr. Ralph Winterhalder, Leitender Arzt<br />
Pneumologie<br />
Dr. Bernhard Schwizer, Leitender Arzt<br />
Rehabilitation<br />
Dr. Hanspeter Rentsch, Chefarzt<br />
Rheumatologie<br />
Dr. Lukas Schmid, Leitender Arzt<br />
«24 Notfall»<br />
Dr. Piet van Spijk, Leiter Notfallpraxis
Departement Medizin<br />
Den Patienten<br />
verpflichtet<br />
Moderne Medizin heisst vernetzte Medizin<br />
Die zunehmende Spezialisierung in der Medizin ist in den ra-<br />
schen Fortschritten auf vielen Fachgebieten begründet. Bei einer<br />
steigenden Zahl von Patienten sind gleichzeitig mehrere Organe<br />
in ihren Funktionen eingeschränkt. Diese Faktoren machen Kooperationen<br />
zwischen verschiedenen Fachexperten unabdingbar.<br />
Ohne ein funktionierendes Netzwerk und ein individualisiertes<br />
Behandlungskonzept sind eine rasche, korrekte Diagnostik<br />
sowie eine moderne und somit auch (kosten-)effektive Therapie<br />
nicht mehr denkbar. Dabei unterscheiden sich die Partner je<br />
nach klinischem Bild.<br />
«Put the patient first»<br />
Für die komplexen, nicht ganz alltäglichen Krankheiten gibt es<br />
am LUKS etablierte Spezialrapporte und Spezialsprechstunden.<br />
So sind beispielsweise beim Zuckerkranken mit Durchblutungsstörungen<br />
der Beine der Internist, Angiologe, Radiologe, Endokrinologe<br />
und eventuell der Gefässchirurg und der Orthopäde involviert.<br />
Bei chronisch entzündlichen Gallenwegerkrankungen<br />
werden die Patienten am Leberrapport mit den Gastroenterologen,<br />
Viszeralchirurgen und invasiv tätigen Radiologen besprochen.<br />
Für die Festlegung der Therapie der Krebspatienten treffen<br />
sich die Experten an den verschiedenen Tumorboards, beispielsweise<br />
medizinische Onkologen und Radioonkologen, Lungenspezialisten,<br />
Thoraxchirurgen und Pathologen, um das optimale Behandlungskonzept<br />
unter Berücksichtigung der individuellen<br />
Besonderheiten des Patienten mit Lungenkrebs auszuarbeiten.<br />
Boards gibt es auch für Brust-, Magen-Darm- oder HNO-Krebs.<br />
So lassen sich die beste Diagnostik und Behandlung für den einzelnen<br />
Patienten herauskristallisieren.<br />
Tagespauschale versus Fallpauschale<br />
Wer neue Wege geht, muss alte Pfade verlassen. Dies gilt auch<br />
bei der Umsetzung der neuen Fallpauschalen. Das Departement<br />
Medizin bereitet sich auf den Systemwechsel vor.<br />
Die vor der Einführung in Deutschland viel gepriesene Abgeltung<br />
aufgrund der Diagnose (Fallpauschale) – und nicht mehr<br />
aufgrund der Anzahl Hospitalisationstage – zeigte gravierende<br />
Folgen. Die Aufenthaltsdauer ging stetig zurück, ebenso die direkte<br />
ärztliche und pflegerische Patientenbetreuung. Letztlich litt<br />
die Zufriedenheit aller Beteiligten, insbesondere der Patienten,<br />
unter dem neuen System. Der Bundesrat hat trotzdem entschie-<br />
Departement Medizin<br />
15
16 Departement Medizin<br />
Blickpunkte<br />
«24 Notfall»<br />
Notfallpraxis am LUKS<br />
Seit Jahresbeginn <strong>2009</strong> leisten die Haus-<br />
ärzte der Stadt und Agglomeration Luzern<br />
ihren Notfalldienst am <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>.<br />
Mit der Einrichtung einer Notfallpraxis<br />
liess sich der immer grösser gewordene<br />
Patientenstrom am LUKS dem<br />
Schweregrad entsprechend aufteilen und<br />
die für stationäre Patienten konzipierten<br />
Notfallstationen von ambulanten Patienten<br />
entlasten. Dadurch wurde eine sogenannte<br />
Win-win-Situation erzielt. Hausärzte<br />
sind während eines zeitlich kürzeren<br />
Notfalldiensts im Einsatz. Patienten mit<br />
«kleinen Notfällen» werden in der Notfallpraxis<br />
viel rascher und meistens auch<br />
kostengünstiger beurteilt und behandelt.<br />
Die Teams der regulären Notfallstationen<br />
können sich effi zienter um die schwer<br />
kranken Patienten kümmern.<br />
Gastroenterologie<br />
Endosonographische Feinnadelpunktion<br />
An der Abteilung Gastroenterologie/Hepatologie<br />
wurde die endosonographische<br />
Feinnadelpunktion eingeführt. In den vergangenen<br />
Jahren hat sich die Endosonographie,<br />
eine Kombination aus gastrointestinaler<br />
Endoskopie und innerlichem<br />
Ultraschall, als zunehmend wichtige diagnostische<br />
Methode gut etabliert. Im Juli<br />
<strong>2009</strong> konnte das Armamentarium mit der<br />
endosonographisch gesteuerten Feinnadelaspirationszytologie(Feinnadelpunktion,<br />
FNP) erweitert werden. Die FNP erlaubt<br />
es, endosonographisch entdeckte,<br />
meist tumorverdächtige Gewebestrukturen<br />
beziehungsweise vergrösserte Lymphknoten<br />
im und um den Magen-Darm-Trakt<br />
herum gezielt zu punktieren. Dies ermöglicht<br />
eine Gewebediagnose. Sie ist für die<br />
Wahl zwischen verschiedenen Therapien<br />
ausschlaggebend.<br />
Präzise Staging-Diagnostik<br />
Da heute für viele Tumorerkrankungen<br />
stadienadaptierte Behandlungswege offenstehen,<br />
hat die präzise Staging-Diagnostik<br />
einen hohen Stellenwert erhalten.<br />
Die Endosonographie mit FNP spielt in<br />
diesen Szenarien eine zunehmend wichtige<br />
Rolle. Sie stellt eine typische Zentrumsleistung<br />
dar, denn sie bedingt eine kostspielige<br />
apparative Infrastruktur und ein<br />
hohes ärztliches Know-how. Die Untersuchung<br />
ist ambulant durchführbar.<br />
Nephrologie<br />
Nieren von lebenden Spendern ...<br />
Aufgrund des herrschenden Mangels an<br />
Leichennieren wird immer häufi ger eine<br />
Niere von lebenden Spendern transplantiert.<br />
Bis vor Kurzem konnte einem nierenkranken<br />
Patienten nur eine Niere eines<br />
blutgruppenidentischen Spenders verpfl<br />
anzt werden. Dies führte dazu, dass<br />
spendewillige Kandidaten abgelehnt werden<br />
mussten und Dialysepatienten oft<br />
mehrere Jahre auf eine passende Niere zu<br />
warten hatten.<br />
... mit unterschiedlichen Blutgruppen<br />
Dank eines neuen Behandlungsverfahrens<br />
wird nun auch eine Nierentransplantation<br />
bei verschiedenen Blutgruppen von Spender<br />
und Empfänger ermöglicht. Der Nierenkranke<br />
wird bereits vor der Transplantation<br />
mit immunosuppressiven Medi -<br />
kamenten behandelt. Seine Antikörper<br />
gegen fremde Blutgruppen werden kurz<br />
vor der Operation mit einer speziellen<br />
Methode (selektive Immunadsorption)<br />
weitgehend entfernt. Obwohl der Empfänger<br />
einige Wochen nach der Transplantation<br />
wieder Antikörper gegen fremde<br />
Blutgruppen produziert, wird die transplantierte<br />
Niere nicht abgestossen.<br />
Mehr Transplantationen möglich<br />
In Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital<br />
Basel wurden bisher bei drei<br />
<strong>Luzerner</strong> Patienten blutgruppeninkompatible<br />
Nierentransplantationen erfolgreich<br />
durchgeführt. Mit diesem neuen Verfahren<br />
ist die Hoffnung verbunden, in Zukunft<br />
etwa 20 bis 30 Prozent mehr Lebendspendertransplantationen<br />
vornehmen zu können.
den, dieses Finanzierungsmodell mit gewissen Anpassungen<br />
(«Helvetisierung») in den öffentlichen und den privaten Schweizer<br />
Spitälern einzuführen. Wer neue Wege gehen will, muss alte<br />
Pfade verlassen. In diesem Sinn wurden im Departement Medizin<br />
die Abläufe und Schnittstellen beleuchtet, damit auch unter den<br />
neuen Bedingungen die Patienten optimal betreut werden können.<br />
Die moderne Medizin ist in vielen Bereichen mit neuen Methoden<br />
und Instrumenten weniger invasiv geworden und kommt<br />
entsprechend den Bestrebungen entgegen, die Hospitalisationsdauer<br />
zu verkürzen.<br />
Spezialmedizin<br />
Individuell und effektiv<br />
Die Fortschritte in vielen Bereichen der Spezialmedizin erlauben<br />
zunehmend massgeschneiderte individuelle Therapien mit im-<br />
mer besseren Resultaten.<br />
Stroke Unit für optimale Schlaganfallversorgung<br />
Anfang <strong>2009</strong> wurden die Stationen in der Behandlungskette von<br />
Patienten mit Hirnschlag ab dem Zeitpunkt der Verständigung<br />
des Rettungsdiensts bis hin zur Neurorehabilitation optimal auf-<br />
einander abgestimmt. Der Patient mit Schlaganfall erhält die glei-<br />
che Priorität wie beispielsweise jener mit Herzinfarkt. Die Ret-<br />
tungssanitäter kündigen den Patienten bereits auf der Fahrt ins<br />
Spital bei dem für die Schlaganfallversorgung zuständigen Neurologen<br />
im LUKS an. Auf der medizinischen Notfallstation erfolgt<br />
die rasche Beurteilung, sodass ohne Zeitverlust die notwendigen<br />
nächsten Schritte folgen wie beispielsweise die Computertomographie<br />
des Schädels.<br />
Departement Medizin<br />
Erfolg mit der Lysetherapie<br />
Je nach Befund wird umgehend ein Medikament zur Auflösung<br />
des verschlossenen Blutgefässes (Lysetherapie) intravenös gespritzt.<br />
Glücklicherweise gelingt es damit öfters, das Gerinnsel<br />
aufzulösen und so die Lähmungen zum Verschwinden zu bringen.<br />
Das Zeitfenster dafür ist allerdings klein – es beträgt nach<br />
dem Auftreten des Schlaganfalls nur wenige Stunden. Die monatliche<br />
Rate an lysierten Patienten konnte in den letzten Jahren<br />
stetig gesteigert werden. Für den einzelnen Patienten kann eine<br />
erfolgreiche Lysetherapie eine dramatische Verbesserung, eventuell<br />
gar eine vollständige Erholung seiner Lähmung bedeuten.<br />
Auf dem «Neuro-Reha-Pfad» nach Hause<br />
Alle Patienten mit Schlaganfall werden im Rahmen des Behandlungskonzepts<br />
«Neuro-Reha-Pfad» beurteilt und behandelt. Im<br />
Verlauf wird, je nach Fortschritt der Rückbildung der neurologischen<br />
Ausfälle, interdisziplinär im Team entschieden, ob der Patient<br />
ohne weitere Massnahmen direkt nach Hause entlassen<br />
wird, ob eine weitere ambulante Rehabilitationsbehandlung nötig<br />
ist oder ob bei einem Patienten mit bleibenden neurologischen<br />
Defiziten eine Rückkehr nach Hause mit unterstützenden<br />
Diensten wie Spitex, Mahlzeitendienst und so weiter trotzdem<br />
möglich ist.<br />
Zwölf Tagesrehabilitationsplätze<br />
Im Dezember <strong>2009</strong> konnte das neue ambulante Neurorehabilitationszentrum<br />
(ZAN) in den Räumen der AMTS in der alten Frauenklinik<br />
bezogen werden. In grosszügigen, hellen Räumen<br />
stehen den Menschen, die von Hirnverletzungen und Hirnerkrankungen,<br />
zum Beispiel einem Hirnschlag, betroffen sind, neue und<br />
moderne Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die zwölf Tagesrehabilitationsplätze<br />
machen eine interdisziplinäre, koordinierte<br />
Begleitung in einem stimulierenden, therapeutischen und<br />
sozialen Umfeld möglich. Das Ambulatorium bietet spezialisierte<br />
Rehabilitationsangebote der verschiedenen Fachbereiche an. Sie<br />
ermöglichen ein individuell zugeschnittenes interdisziplinäres<br />
Rehabilitationsprogramm mit tageweiser Betreuung. Aufgenommen<br />
werden Patienten zur weiterführenden Rehabilitation nach<br />
stationärer Behandlung oder durch Zuweisung von zu Hause. In<br />
Zusammenarbeit mit der Dynortis AG, die im gleichen Haus tätig<br />
ist, werden Patienten mit komplexen Prothesenversorgungen<br />
nach Amputationen von oberen und unteren Extremitäten rehabilitativ<br />
versorgt.<br />
Breit gefächerte Zusammenarbeit<br />
Das Ziel des ZAN ist es, gemeinsam mit allen beteiligten Personen<br />
die grösstmögliche Selbstständigkeit, Selbstbestimmung<br />
und Lebensqualität der Menschen zu erreichen, die mit einer Be-<br />
17
18 Departement Medizin<br />
hinderung zugewiesen werden. Dabei beinhalten die neuroreha-<br />
bilitativen Angebote fachspezifische und vernetzte Abklärungen,<br />
Behandlungen und Rehabilitationen, um Behinderungen in ihren<br />
Auswirkungen zu vermindern, die soziale Eingliederung zu unterstützen<br />
oder den Weg zurück ins Berufsleben zu finden. Das<br />
Fachteam besteht aus qualifizierten Rehabilitationsfachleuten<br />
des ärztlichen Diensts, der Neuropsychologie, der Pflege, der<br />
Physio-, Ergo- und Sprachtherapie sowie des Sozialdiensts. Es<br />
arbeitet eng mit weiteren Spezialisten des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s,<br />
mit ambulanten Therapiestellen und Institutionen der Zentralschweiz,<br />
mit Sozialversicherern, mit beruflichen Eingliederungsstellen<br />
und Arbeitgebern zusammen. Die Zuweisung erfolgt<br />
durch Ärzte, die in der Zentralschweiz tätig sind, oder über vorbehandelnde<br />
Spitäler.<br />
25 Jahre Neurorehabilitation<br />
Mit der Eröffnung des ZAN feierte die Abteilung für Neurorehabilitation<br />
auch ihr 25-Jahr-Jubiläum. Dr. Hanspeter Rentsch und<br />
sein engagiertes Team haben ein national und international anerkanntes<br />
Zentrum für die Rehabilitation von Hirnverletzten und<br />
Patienten mit Hirnerkrankungen geschaffen. Das interdisziplinäre<br />
Zusammenspiel vieler Disziplinen und die grosse Kreativität<br />
aller Beteiligten haben dazu geführt, dass die Behandlungskette<br />
zwar individualisiert, aber aus einem Guss ist und dadurch das<br />
Potenzial des Patienten maximal genutzt werden kann. Mit der<br />
Eröffnung des ZAN ist der ambulante Behandlungsteil räumlich<br />
und infrastrukturell optimiert worden.<br />
Minimalinvasive Mitralklappenbehandlung<br />
Im letzten Jahr konnte die interventionelle Therapie von kranken<br />
Herzklappen nach der Einführung des kathetertechnischen<br />
Ersatzes der Aortenklappe und nach entsprechender Schulung<br />
des Teams nun auch auf die Mitralklappe ausgedehnt werden.<br />
Die Eröffnung des Brustkorbs und der Anschluss an die Herz-<br />
Lungen-Maschine sind nicht nötig und entsprechend ist die Behandlung<br />
viel weniger belastend für die Patienten. Bei spezieller<br />
Indikation einer schweren Mitralinsuffizienz, das heisst ungenügender<br />
Klappenschliessung, kann mit einem durch einen Katheter<br />
platzierten speziellen Clip zwischen dem vorderen und hinteren<br />
Mitralsegel ohne Operation der Klappendefekt korrigiert<br />
werden.<br />
Eingespielte Interaktion, präzises Platzieren<br />
Diese Methode setzt nicht nur eine eingespielte Interaktion zwischen<br />
dem invasiven und dem nicht invasiven Kardiologen voraus,<br />
sondern auch eine modernste apparative Medizin, weil das<br />
Platzieren des Clips höchst präzise erfolgen muss. Deshalb wird<br />
dieser Vorgang unter dreidimensionaler Echokardiographie und
nicht mit den regulären, weniger genauen Röntgengeräten<br />
durchgeführt. Der Clip – zu seiner Herstellung werden 270 Stunden<br />
benötigt! – wird mittels Katheter an die Mitralklappe unter<br />
Echokontrolle herangeführt, wo die beiden Segel an geeigneter<br />
Stelle gefasst und durch Schliessung des Clips verbunden werden.<br />
Der Clip verbindet das anteriore mit dem posterioren Segel<br />
und führt bei diastolisch geöffneter Klappe zu einer Brückenbildung,<br />
womit die Mitralinsuffizienz korrigiert wird.<br />
Krebs – zwischen Volksmund und Realität<br />
Im Volksmund gilt Krebs immer noch als eine Erkrankung, die<br />
praktisch immer zum Tod führt. In Tat und Wahrheit sind es verschiedenste<br />
Erkrankungen, die heute unterschiedlich angegangen<br />
werden können. Ein Teil der Patienten wird geheilt, sodass<br />
heute etwa 5 Prozent der Bevölkerung aktuelle oder ehemalige<br />
Krebspatienten sind. Krebsbehandlungen sind nicht selten eingreifende<br />
Therapien und führen zu oft unerwünschten Wirkungen.<br />
Das Ziel jeder Tumortherapie ist es, möglichst wenige<br />
Nebenwirkungen zu verursachen und trotzdem den Tumor beziehungsweise<br />
die Tumorzellen gezielt zu treffen.<br />
Massgeschneiderte Therapie<br />
Die individuelle Krebstherapie ist in den letzten Jahren ein gutes<br />
Stück nähergerückt. Aufgrund spezifischer Eigenschaften eines<br />
individuellen Tumors werden für den Einzelfall Behandlungen<br />
massgeschneidert. So gelingt es immer besser und bei immer<br />
mehr Tumoren, in den Zellstoffwechsel von Tumorzellen einzugreifen<br />
und deren Wachstum zu stören: Temsirolimus beim Nierenzellkarzinom,<br />
Tyrosinkinaseinhibitoren bei verschiedenen<br />
Neoplasien, monoklonale Antikörper gegen Rezeptoren an der<br />
Zelloberfläche – beim Brust- und Dickdarmkrebs sehr erfolgreich<br />
(Herceptin und Erbitux) – und schliesslich der monoklonale Antikörper<br />
Avastin, der einen durch Tumorzellen produzierten und<br />
die Gefässneubildung anregenden Botenstoff neutralisiert, werden<br />
heute erfolgreich eingesetzt.<br />
Spezialisierte Gewebediagnostik entscheidend<br />
Diese individualisierten Therapien sind auf eine verlässliche,<br />
hoch spezialisierte Gewebediagnostik (Pathologisches Institut)<br />
am Tumor mit dem Nachweis bestimmter Tumoreigenschaften<br />
angewiesen. Dies ist eine Voraussetzung für die Wirksamkeit und<br />
damit den Einsatz der oft sehr teuren Medikamente. Als Beispiel<br />
sei der Nachweis der vermehrten Expression des HER2-Gens erwähnt:<br />
Nur bei Brustkrebs mit einer nachgewiesenen Amplifikation<br />
des HER2-Gens hat der Einsatz des Medikaments Herceptin<br />
eine Wirkung und ist entsprechend sinnvoll. Gleiches gilt für den<br />
Lymphdrüsenkrebs: Nur bei Lymphomen, die das CD20-Antigen<br />
an ihrer Oberfläche exprimieren, lohnt sich der Einsatz eines<br />
Departement Medizin<br />
19
20 Departement Medizin<br />
monoklonalen Antikörpers, der gegen das CD20-Antigen gerichtet<br />
ist (Mabthera ® ). Und nur bei Dickdarmkrebs, der keine Mutation<br />
des kras-Gens aufweist, ist eine Behandlung mit Cetuximab<br />
(Erbitux ® ) erfolgversprechend.<br />
Individuell abgestimmte Behandlung<br />
Dank zahlreicher Informationsquellen (Arzt, Pflegende, Literatur,<br />
Internet, Fernsehen usw.) sind die Patienten – und die Angehörigen<br />
– heute in der Regel sehr gut über ihre Krankheit orientiert.<br />
Oftmals haben sie bereits Vorstellungen zur Behandlung ihres<br />
Tumorleidens. Viele Patienten bringen spezielle berufliche oder<br />
familiäre Anforderungen mit sich, die bei der Behandlungsplanung<br />
berücksichtigt werden müssen. Ein Beispiel: Eine 25-jährige<br />
Patientin konsultiert ihren Arzt wegen einer Verhärtung in der<br />
linken Hohlhand. Die Entfernung des Knötchens ergibt die Diagnose<br />
eines bösartigen Weichteiltumors (Rhabdomyosarkom) der<br />
Hohlhand. Die Patientin ist als Linkshänderin und in ihrem Beruf<br />
als Kauffrau auf ihre linke Hand besonders angewiesen und<br />
möchte sie auch aus diesem Grund nicht verlieren.<br />
Ohne Amputation vom Tumor befreit<br />
Bisher war grundsätzlich in dieser Situation aus onkologischer<br />
Expertensicht eine Amputation im Bereich des linken Unterarms<br />
angezeigt, um eine sichere Heilung zu erzielen. In diesem Fall<br />
wurde jedoch unter Berücksichtigung des Alters der Patientin<br />
und der individuellen Tumorcharakteristika eine sehr intensive<br />
Chemotherapie durchgeführt, die bereits zu einer nahezu vollständigen<br />
Tumorrückbildung führte. Die anschliessende konsolidierende<br />
Bestrahlung der Hand tolerierte die Patientin gut. Bei<br />
den Nachkontrollen ist die Patientin seit Abschluss der Behandlung<br />
tumorfrei. Sie ist in ihrem Beruf wieder voll arbeitsfähig.<br />
Dank neuster diagnostischer und therapeutischer Verfahren<br />
konnte ihre Hand erhalten werden.<br />
Mehr Treffsicherheit durch Tests<br />
Eine weitere Entwicklung in der Individualisierung der Behandlungen<br />
sind verschiedene Tests, die Auskunft über die Verstoffwechselung<br />
eines Medikaments bei einem Patienten geben. Der<br />
sogenannte Tamoxitest identifiziert Patientinnen, die das Enzym<br />
CYP2D6 nicht herstellen und damit das beim Brustkrebs sehr<br />
wirksame Medikament Tamoxifen nicht beziehungsweise kaum<br />
aktivieren können. Damit ist bei diesen Patientinnen der Einsatz<br />
von Tamoxifen nicht sinnvoll und entsprechend müssen andere<br />
Hormontherapien eingesetzt werden.
Enge Kooperation zum Wohl der Betroffenen<br />
Fazit: Massgeschneiderte Krebsbehandlungen unter Berücksich-<br />
tigung der Tumoreigenschaften, der Besonderheiten des einzelnen<br />
Patienten sowie der Wünsche und Vorstellungen der Betroffenen<br />
sind heute Alltag. Sie setzen eine enge Zusammenarbeit<br />
der verschiedenen Spezialisten des Zentrums voraus, wobei sich<br />
oftmals erst am Tumorboard die bestmögliche Therapie herauskristallisiert.<br />
Diese Kontakte ergeben sich am <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong><br />
rasch und unkompliziert – zum Wohl der Betroffenen.<br />
Departement Medizin<br />
21
Departement Chirurgie<br />
23
24 Departement Chirurgie<br />
Departementsleiter<br />
Prof. Dr. Reto Babst<br />
«Der politische Rahmen<br />
verlangt einen Spagat –<br />
zwischen Ressourcenverknappung<br />
und Investitionsstau<br />
einerseits und den<br />
Bedürfnissen unserer Patienten<br />
nach zeitgerechter<br />
und bester Behandlungsqualität<br />
andererseits. Mit<br />
Prozessverbesserungen<br />
und Innovationen können<br />
wir dieser Herausforderung<br />
begegnen. Das erfordert<br />
aber Investitionen, die<br />
gerade in den operativen<br />
Fächern kostenintensiv<br />
sind. Die Navigation und<br />
die SILS-Technik zur Minimierung<br />
des operativen<br />
Zugangs sind Beispiele<br />
dafür.»<br />
Prof. Dr. Reto Babst,<br />
Departementsleiter<br />
Klinikleitungen<br />
Chirurgische Klinik<br />
Prof. Dr. Reto Babst, Chefarzt (PiP)<br />
Susi Valdepeñas,<br />
Leiterin Pflegedienst<br />
Herz-, Thorax- und Gefässchirurgie<br />
Prof. Dr. Xavier Mueller, Chefarzt<br />
Susi Valdepeñas,<br />
Leiterin Pflegedienst<br />
Orthopädie<br />
PD Dr. Martin Beck, Chefarzt<br />
Beat Sommerhalder,<br />
Leiter Pflegedienst<br />
Urologie<br />
Prof. Dr. Hansjörg Danuser,<br />
Chefarzt (PiP)<br />
Beat Sommerhalder,<br />
Leiter Pflegedienst<br />
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie<br />
Dr. Dr. Johannes Kuttenberger,<br />
Chefarzt<br />
Leitendes Personal<br />
Unfallchirurgie/Tageschirurgie/<br />
Chirurgische Sprechstunden<br />
Dr. Jörg Winkler<br />
Unfallchirurgie/Chirurgische<br />
Notfallstation<br />
Dr. Jan Rosenkranz<br />
Chirurgische Klinik<br />
Viszeralchirurgie<br />
Dr. Jürg Metzger, Chefarzt<br />
Dr. Andreas Scheiwiller<br />
Dr. Martin Sykora<br />
Neurochirurgie<br />
Dr. Karl Kothbauer<br />
Wirbelsäulenchirurgie<br />
Dr. Martin Baur<br />
Plastische und<br />
Wiederherstellungschirurgie<br />
Dr. Elmar Fritsche<br />
Handchirurgie<br />
Dr. Urs von Wartburg<br />
Herz- und Thoraxchirurgie<br />
Dr. Reinhard Schläpfer<br />
PD Dr. Reza Tavakoli<br />
Gefässchirurgie<br />
Dr. Dölf Brunner<br />
Dr. Robert Seelos<br />
Orthopädie<br />
Dr. Urs Müller, Co-Chefarzt<br />
Urologie<br />
Dr. Agostino Mattei, Co-Chefarzt<br />
Dr. Patrick Stucki<br />
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie<br />
Dr. Michael Merwald<br />
Leiterin Pflegedienst<br />
Operationssäle<br />
Esther Rölli
Neurochirurgie<br />
Exakt gelenkt zum Tumor<br />
Navigationsgestützte Mini-Craniotomien sind präzis gelenkte<br />
kleine Schädeleröffnungen. Dieses Verfahren erlaubt bessere Re-<br />
sultate und bringt gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile.<br />
Leistungsfähige Neuronavigationsgeräte<br />
Navigation kommt aus der Schifffahrt und bezeichnet die Technik,<br />
mit der sich Seefahrer auf hoher See ohne landschaftliche<br />
Anhaltspunkte zurechtfinden können. Man hat dieses Prinzip in<br />
die Medizin übernommen und besonders in der Neurochirurgie<br />
praxisgerecht umgesetzt. Eingriffe am Gehirn erfordern grosse<br />
Genauigkeit und ähnlich wie auf hoher See gibt es auch im Gehirn<br />
nur ungenaue «landschaftliche» Orientierungspunkte. Vor<br />
ungefähr fünfzehn Jahren kamen die ersten Prototypen von Neuronavigationsgeräten<br />
auf den Markt. Das war damals sehr teuer,<br />
sehr umständlich, sehr langsam und gar noch nicht so genau.<br />
Innerhalb weniger Jahre hat sich diese Technologie aber enorm<br />
entwickelt, sodass heute vergleichsweise billige Geräte mit enormer<br />
Leistungsfähigkeit nicht nur zur Verfügung stehen, sondern<br />
zur Grundausrüstung einer neurochirurgischen Klinik gehören.<br />
Wie in einem Film<br />
Das Vorgehen ist wie folgt: Vor der Operation wird ein MRI(Magnetic<br />
Resonance Imaging)-Bilddatensatz aufgenommen, der sowohl<br />
einen anzugehenden Tumor im Gehirn als auch die gesamte<br />
Aussenkontur von Kopf und Gesicht darstellt. Bei der<br />
Operationsvorbereitung können zusätzlich die Umrisse eines<br />
Hirntumors markiert und dann auf dem Bildschirm im Operationssaal<br />
dargestellt werden. Für die Operation wird der Kopf des<br />
Patienten nach der Narkoseeinleitung in einer starren Kopfhalterung<br />
fixiert. Der Kopf ist im «Blick» einer Infrarotkamera. Damit<br />
kann man die Kopf- und Gesichtskonturen durch die Kamera sehen<br />
und in den Computer einlesen. Der Computer vergleicht diese<br />
Umrisse mit denen aus dem MR-Bild und legt dann diese beiden<br />
Bilder zusammen. Mit einem ebenfalls in der Infrarotkamera<br />
sichtbaren Zeigeinstrument kann man dann jeden Punkt am Kopf<br />
und im Kopf, daher auch im Gehirn, anpeilen, «navigieren», und<br />
der Computer stellt das auf dem Bildschirm wie in einem Film<br />
ohne Zeitverzögerung dar.<br />
Einfacher, schneller, sicherer, genauer<br />
Die Vorteile dieser Technologie sind vielfältig. Praktisch am wichtigsten<br />
ist die Möglichkeit, auch kleine Herde im Gehirn gezielt<br />
anzupeilen und chirurgisch zu entfernen, ohne dass eine allzu<br />
grosse Schädeleröffnung dafür benötigt wird. Früher waren rela-<br />
Departement Chirurgie<br />
tiv grosse «Standard»-Schädeleröffnungen notwendig, um einen<br />
Tumor sicher nicht zu verfehlen. Trotzdem konnte es vorkommen,<br />
dass es bei tief im Gehirn liegenden Tumoren schwierig war,<br />
die richtige Stelle zu finden. Mit der Neuronavigation ist das viel<br />
einfacher, viel schneller, viel sicherer, viel genauer geworden und<br />
erfordert noch dazu nur eine kleinere Schädeleröffnung.<br />
Besser, sanfter und ökonomischer<br />
Diese gezielten kleinen Schädeleröffnungen werden fachgerecht<br />
«navigationsgestützte Mini-Craniotomien» genannt. Dieses Verfahren<br />
ist nicht nur besser, schonender und sicherer für die Betroffenen,<br />
es bringt auch – in einer Zeit, in der im Gesundheitswesen<br />
fast nur noch über Geld gesprochen wird – ökonomische<br />
Vorteile: Die Eingriffe erfordern weniger Zeit als früher, die Wunden<br />
sind kleiner und weniger schmerzhaft, sie heilen schneller<br />
und ermöglichen einen früheren Spitalaustritt sowie eine kürzere<br />
Rekonvaleszenz. Trotz ihrer Anschaffungskosten führen die<br />
Neuronavigationsgeräte also zu einem Spareffekt.<br />
Unfallchirurgie<br />
Navigation in der<br />
Traumatologie<br />
Navigationssysteme unterstützen den Chirurgen ähnlich wie einen<br />
Bogenschützen, dessen Bogenhaltung durch den Computer<br />
so navigiert wird, dass der Pfeil ins Schwarze trifft.<br />
Minimalinvasive Operationstechniken<br />
Die operative Behandlung von Frakturen wurde in den letzten<br />
Jahrzehnten mit dem Ziel einer optimalen Ausheilung in anatomischer<br />
Stellung und möglichst guter Funktion stetig verbessert.<br />
Neben der Entwicklung von neuen Implantaten, welche die Kno-<br />
25
26 Departement Chirurgie<br />
Blickpunkte<br />
Neurochirurgie/Wirbelsäulenchirurgie<br />
Über 500 Eingriffe<br />
Die Abteilung für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie<br />
hat nach dem grossen<br />
Zuwachs 2008 im Jahr <strong>2009</strong> erneut eine<br />
deutliche Zunahme der Leistungsnachfrage<br />
bewältigt. Nachdem die Eingriffszahl<br />
2008 erstmals über 400 gestiegen ist, hat<br />
diese Zahl <strong>2009</strong> auf mehr als 500 zugenommen!<br />
Die Zunahme gründet auf einem<br />
für das Fach vielfältigen Casemix mit vielen<br />
anspruchsvollen Eingriffen am Gehirn<br />
und am Rückenmark sowie komplexen<br />
Eingriffen an der Wirbelsäule. Der Zuwachs<br />
verdankt sich aber auch dem Vertrauen,<br />
das die zuweisenden Ärztinnen<br />
und Ärzte der Abteilung für Neurochirurgie<br />
und Wirbelsäulenchirurgie nach mehrjähriger<br />
Aufbauarbeit entgegenbringen.<br />
Perfekte Zusammenarbeit<br />
<strong>2009</strong> war zudem das erste Jahr als von der<br />
FMH anerkannte Weiterbildungsinstitution<br />
für das Fach Neurochirurgie. Die Integration<br />
der ersten Assistentenstelle ist hervorragend<br />
gelungen. Die fachspezifi sche Weiterbildung<br />
erweist sich sowohl auf<br />
Assistenten- und Lernebene als auch auf<br />
organisatorischer Lehr- und Führungsebene<br />
als grosser Erfolg. Die enorme Zunahme<br />
der Operationszahlen und der Anzahl<br />
der hospitalisierten Patienten konnte nur<br />
durch grosse Anstrengungen des Ärzte-,<br />
Pfl ege- und Logistikteams und durch die<br />
hervorragende Zusammenarbeit im Bereich<br />
Operationsmanagement und Tagesklinik<br />
so reibungslos geschafft werden.<br />
Die nach einem Pilotprojekt von 2008/<strong>2009</strong><br />
erfolgreich eingeführte Case-Management-Betreuung<br />
hat diese Leistungen<br />
überhaupt erst möglich gemacht. Die interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit auf dem<br />
Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie mit dem<br />
SPZ Nottwil im Schweizer Wirbelsäulenund<br />
Rückenmarkzentrum (SWRZ) entwickelt<br />
sich positiv weiter. Das Jahr <strong>2009</strong> war<br />
auch das erste Jahr mit durchgehender<br />
Qualitätserfassung nach dem System der<br />
Arbeitsgemeinschaft für Qualitätsmanagement<br />
in der Neurochirurgie (AQN).<br />
Hand- und Plastische Chirurgie<br />
Ziel erreicht<br />
Wie schon in den vergangenen Jahren<br />
sind alle Zahlen, mit geringen Abweichun-<br />
gen, auf sehr hohem Niveau konstant ge-<br />
blieben. Besonders erwähnenswert ist der<br />
geleistete Anteil im Mammazentrum. Die<br />
Ziele wurden dank hervorragender Arbeit<br />
auf allen Ebenen erreicht. Zudem gelang<br />
es, zwei wissenschaftliche Arbeiten zu publizieren<br />
und sich schweizweit in mehreren<br />
Gremien zu engagieren.<br />
Wundsprechstunde<br />
Notwendiger Ausbau<br />
Auch <strong>2009</strong> wurden in der chirurgischen<br />
Wundsprechstunde wieder mehr Patien-<br />
ten behandelt. Bedingt durch die gestei-<br />
gerte Nachfrage entstanden Wartezeiten<br />
von bis zu drei Wochen. Aus diesem Grund<br />
wird seit Januar 2010 das Sprechstunden-<br />
Angebot um einen weiteren Tag auf insge-<br />
samt drei Tage erweitert. Mit einer zusätz-<br />
lichen 40-Prozent-Spitalarztstelle und der<br />
Anstellung von weiteren Pfl egefachkräf-<br />
ten ist jetzt ein noch effi zienterer Betriebs-<br />
ablauf mit kürzeren Wartezeiten möglich.<br />
Chirurgische Klinik<br />
Neues Weiterbildungsangebot<br />
Seit der Eröffnung der Akademie für me-<br />
dizinisches Training und Simulation (AMTS)<br />
ist es uns möglich, das Weiterbildungsan-<br />
gebot für unsere Assistenzärzte weiter<br />
zu verbessern. Neben den theoretischen<br />
Weiterbildungen können unsere Mitarbeiter<br />
neu regelmässig an Patientensimulatoren<br />
und an Plastikknochen operieren,<br />
sowie an anatomischen Präparaten ihre<br />
anatomischen Kenntnisse vertiefen.
chendurchblutung wenig schädigen und auch im osteoporoti-<br />
schen Knochen einen guten Halt finden, ist die Suche nach Me-<br />
thoden, die für den Körper weniger invasiv sind, im Fokus der<br />
Bemühungen des traumatologisch tätigen Chirurgen. Um ausge-<br />
dehnte Freilegungen des Knochens mit entsprechender Kompro-<br />
mittierung der Durchblutung zu vermeiden, gewinnen die mini-<br />
malinvasiven Operationstechniken in der Frakturversorgung<br />
immer mehr an Bedeutung.<br />
Höhere Präzision, tiefere Strahlenbelastung<br />
Die Navigation ist eine Methode, die dieser Zielsetzung Rechnung<br />
trägt und zusätzlich eine höhere Präzision in der Positionierung<br />
von Schrauben und Nägeln erlaubt. Sie hilft nicht nur bei der Erreichung<br />
einer möglichst anatomiegerechten Wiederherstellung<br />
von Achse, Länge und Rotation, sondern erlaubt zugleich eine<br />
sicherere Positionierung von Implantaten in der Nachbarschaft<br />
von kritischen Versorgungsstrukturen wie Nerven und Gefässen.<br />
Ein wichtiger Effekt ist auch die Reduktion der Strahlenbelastung<br />
sowohl des Patienten wie auch des chirurgischen Teams.<br />
Navigation hilft den Chirurgen<br />
Exemplarisch für die Navigation in der Frakturversorgung ist die<br />
Verschraubung von Kreuzbeinfrakturen. Das Kreuzbein ist umgeben<br />
von voluminösen Gesässmuskeln. Durch das Kreuzbein verlaufen<br />
wichtige Nerven für die Funktionsversorgung der unteren<br />
Extremität und der Schliessmuskeln des Harn- und Verdauungsapparats.<br />
Fehlplatzierungen von Schrauben erhöhen das Risiko<br />
von Funktionsstörungen wie Inkontinenz oder Muskellähmungen.<br />
Auch die gleichzeitige Positionierung von zwei Schrauben<br />
ist selbst in der Hand des erfahrenen Chirurgen nicht immer einfach.<br />
Hier unterstützt die Navigation die Platzierung der Schrauben<br />
erheblich.<br />
Computergestützte Planung<br />
Nach der Lagerung des Patienten auf dem Operationstisch wird<br />
ein Referenzpunkt am Beckenkamm angebracht, damit die Infrarotkamera<br />
die Lage des Patienten im Raum erkennt und diese im<br />
Computer registriert werden kann. Anschliessend werden drei<br />
standardisierte Aufnahmen des Beckens mit dem Bildverstärker<br />
angefertigt und in den Computer eingelesen. Am Bildschirm erfolgt<br />
dann die Planung der späteren Schraubenlage im Kreuzbein.<br />
Seit drei Jahren bewährt<br />
Ähnlich einem Bogenschützen, dessen Bogenhaltung durch den<br />
Computer so navigiert wird, dass der Pfeil ins Schwarze trifft, bestimmt<br />
der Computer über eine Infrarotkamera die Haltung der<br />
referenzierten Bohrmaschine, die einen Führungsdraht setzt.<br />
Departement Chirurgie<br />
Nach der korrekten Platzierung des Zieldrahts wird eine Hohlschraube<br />
über diesen Draht eingedreht. Dabei kann man die<br />
Führung des Instruments auf dem Bildschirm in Realtime verfolgen<br />
und erkennen, wann die korrekte Eindringtiefe des Zieldrahts<br />
erreicht wurde. Die Länge und der Durchmesser der Schrauben<br />
können ebenfalls in die Planung einbezogen werden. Während<br />
dieses Vorgehens sind keine weiteren Röntgenbilder erforderlich.<br />
Erst nach Abschluss der Intervention erfolgt die Erfolgskontrolle<br />
mit dem Bildverstärker. Dieses Vorgehen wird von der<br />
Unfallchirurgie am LUKS schon seit drei Jahren mit Erfolg angewendet.<br />
Wirbelsäulenchirurgie<br />
Kleinerer Eingriff,<br />
grössere Schonung<br />
Durch den Fortschritt in der Wirbelsäulenchirurgie sind heute<br />
schonendere OP-Methoden bei Wirbelfrakturen und Instabilitäten<br />
möglich.<br />
Minimalinvasive Stabilisationssysteme<br />
Im Rahmen der raschen Entwicklungen in der Wirbelsäulenchirurgie<br />
ist es heute zunehmend möglich, geeignete Frakturen und<br />
Instabilitäten der Wirbelsäule auch über minimalinvasive Stabilisationssysteme<br />
über mehrere kleine Hautschnitte zu versorgen.<br />
Hierbei wird über einen auf beiden Seiten des Wirbels vom Rücken<br />
aus unter strenger Röntgenkontrolle eingebrachten Draht<br />
die Schraubenpositionierung vorgenommen. Die Schrauben einer<br />
Seite werden mit einem ebenfalls über einen kleinen Hautschnitt<br />
eingebrachten Längsstab fixiert. Über die vom Chirurgen<br />
zuvor vorgenommene Stabbiegung wird das erwünschte Profil<br />
der Wirbelsäule an das modellierte Stabprofil angepasst und<br />
27
28 Departement Chirurgie<br />
auch versetzte, abgeglittene Wirbelkörper werden zurückgezogen.<br />
Vorteil für ältere Risikopatienten<br />
Im Gegensatz zum konventionell offenen Zugang wird die Muskulatur<br />
nicht langstreckig abgelöst oder gespalten. Der Blutverlust<br />
ist minim, die Schmerzen sind nach der Operation deutlich<br />
geringer und die Patienten rascher mobilisierbar. Von dieser<br />
deutlich weniger invasiven Methode profitieren hauptsächlich<br />
auch ältere Risikopatienten mit Erkrankungen von Herz, Lunge<br />
und Stoffwechsel, die im Fall einer Osteoporose mit spontanen<br />
Frakturen und schleichender Entwicklung einer Instabilität deutlich<br />
risikoärmer versorgt und rascher mobilisiert werden können.<br />
In der Wirbelsäulenchirurgie des LUKS wurden diese Verfahren<br />
erfolgreich eingesetzt.<br />
Bald nicht mehr nur im Lendenwirbelbereich<br />
Aktuell limitiert ist diese neue perkutane Stabilisierung noch im<br />
Lendenwirbelbereich, da jetzige Systeme noch nicht gleichzeitig<br />
eine physiologische LWS-Lordose (Krümmung der Lendenwirbelsäule)<br />
und eine kräftige Aufrichtung unter Längszug vornehmen<br />
können. Im Rahmen der rasanten Entwicklung neuer Techniken<br />
und Implantatsysteme der Wirbelsäule ist jedoch bald mit einem<br />
modifizierten Schraubenkopf zu rechnen, der diese Funktionen<br />
vergleichbar mit den offen eingebrachten bewährten Fraktursystemen<br />
durchführen lässt. Damit kann das Indikationsspektrum noch<br />
weiter ausgebaut werden, sodass die Mehrheit der betroffenen Patienten<br />
von den Vorteilen dieser Methode profitieren kann.<br />
Viszeralchirurgie<br />
OP durch den Nabel<br />
SILS («Single Incision Laparoscopic Surgery») steht für eine Wei-<br />
terentwicklung im Bereich der Schlüsselloch-Chirurgie. Bei dieser<br />
Operationsmethode dient der Nabel als Zugang.<br />
Minimalinvasive Methoden auf dem Vormarsch<br />
Dank bestechender Vorteile haben sich die minimalinvasiven<br />
Operationsmethoden in den letzten 20 Jahren eindrücklich etabliert.<br />
Die laparoskopische Vorgehensweise hat sich in diversen<br />
Bereichen zum Standard entwickelt. Die heutigen Bestrebungen<br />
gehen einerseits in die Richtung einer erhöhten Präzision und<br />
andererseits in die Richtung eines weiter reduzierten Zugangstraumas<br />
und einer verbesserten Kosmetik.<br />
Wiederentdeckung des Nabels<br />
Die Bestrebungen, das Zugangstrauma im Vergleich zur klassischen<br />
Laparoskopie zu verringern, sind nicht ganz neu. So finden<br />
sich in der Literatur der letzten 10 bis 15 Jahre diverse Berichte<br />
beispielsweise über Appendektomien über einen einzelnen Zugang<br />
mittels um 90 Grad abgewinkelten Optiken mit Instrumentenkanal.<br />
Diese Methode hat jedoch zwei Nachteile: ein instabiles<br />
Bild, bedingt durch Instrumentenbewegungen, sowie die<br />
fehlende Möglichkeit der Triangulation. Mit dem Aufkommen verbesserter<br />
5-Millimeter-Kameras in Kombination mit der Wiederentdeckung<br />
des Nabels als bereits existierende Narbe hat unter<br />
dem Kürzel SILS eine «neue» Operationsmethode Einzug gehalten.<br />
SILS steht für «Single Incision Laparoscopic Surgery», auch<br />
LESS – «Laparo-Endoscopic Single-Site Surgery» – genannt.<br />
Narbe «verschwindet» im Nabelgrund<br />
Am Beispiel einer SILS-Cholezystektomie soll das Prinzip dieser<br />
Technik kurz erläutert werden. Der Eingriff beginnt mit dem Evertieren<br />
des Nabels und der Hautinzision direkt im Nabelgrund.<br />
Nach Durchtrennung der Faszie wird ein spezielles Trokarsystem<br />
mit drei 5-Millimeter-Zugängen eingeführt und das Pneumoperitoneum<br />
installiert. Die Gallenblase wird mit dem Fundus an die<br />
Bauchwand pexiert oder mittels einer 2-Millimeter-Fasszange,<br />
die über eine Nadel ins Abdomen eingeführt wird, hochgehalten.<br />
Mithilfe eines abwinkelbaren Instruments wird die Möglichkeit<br />
der Triangulation wiederhergestellt und die Gallenblase analog<br />
dem klassischen laparoskopischen Vorgehen nach Verschluss<br />
von Ductus cysticus und Arteria cystica aus dem Leberbett präpariert.<br />
Im Nabelbereich können nun zwei der 5-Millimeter-Zugänge<br />
durch einen 12-Millimeter-Zugang ersetzt und die Gallenblase<br />
in einem Plastikbeutel darüber entfernt werden. Die circa
20 Millimeter grosse Nabelinzision wird zum Schluss schichtwei-<br />
se verschlossen, die Narbe «verschwindet» im Nabelgrund.<br />
Sicher und kosmetisch überzeugend<br />
Die SILS-Technik gehört heute zum Armentarium der minimalin-<br />
vasiven Chirurgie und kann sicher durchgeführt werden. Der<br />
Hauptvorteil liegt im kosmetischen Bereich. Ob dies genügt, um<br />
sich gegen die klassische Laparoskopie durchzusetzen, wird die<br />
Zukunft zeigen.<br />
Klinik für Orthopädie<br />
Computer als Wegweiser<br />
Die computergestützte Navigation in der orthopädischen Chirur-<br />
gie hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Entscheidend<br />
bleibt aber das Können des Chirurgen.<br />
Dynamische Navigation<br />
Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends hat der computergestützten<br />
Navigation in der orthopädischen Chirurgie viele neue<br />
Erkenntnisse gebracht. Im Unterschied zu anderen Fachgebieten,<br />
in denen die computergestützte Navigation seit bald zwanzig<br />
Jahren in Entwicklung ist, handelt es sich in der orthopädischen<br />
Chirurgie um eine dynamische Navigation, die auf<br />
Echtzeit-Informationen angewiesen ist. In den letzten zehn Jahren<br />
hat sich die Navigation im orthopädischen Bereich von CTgesteuerten<br />
Navigationen wegentwickelt, da diese ineffizient waren.<br />
Heute beruht die Navigation in der orthopädischen Chirurgie<br />
auf dem direkten Einlesen von sogenannten Landmarken intraoperativ.<br />
Ohne Computertomographie und ohne Kabel<br />
Der Beginn der navigierten Chirurgie in der Orthopädie kann auf<br />
den Einsatz der Robotertechnologie zurückgeführt werden. Anfang<br />
der Neunzigerjahre wurde der «Robodoc» entwickelt, vor<br />
allem für die hochexakte Implantation von Hüfttotalprothesen.<br />
Diese Technik wird heute nur noch vereinzelt eingesetzt – und<br />
dies erst nach einer klaren voroperativen Abklärung, für welches<br />
ausgewählte Krankengut dieser roboterassistierte Einsatz noch<br />
riskiert werden darf. Ende der Neunzigerjahre und Anfang des<br />
neuen Jahrtausends hat sich dann zunehmend die kabellose und<br />
die CT-freie Navigation durchgesetzt, da es die einzige Methode<br />
darstellt, um intraoperativ effizient und effektiv mit dieser Technologie<br />
umzugehen, ohne dass die Operationszeiten sich zu sehr<br />
in die Länge ziehen.<br />
Departement Chirurgie<br />
Moderner Einsatz der navigierten Chirurgie ...<br />
Die präoperative Vorbereitung sowie das intraoperative Abde-<br />
cken erfolgen genau gleich wie ohne Navigation. Zu Beginn der<br />
Operation werden jedoch Landmarken an den beteiligten anatomischen<br />
Strukturen befestigt. Rund um das Kniegelenk sind dies<br />
das Femur sowie die Tibia. Für die Navigation um das Kniegelenk<br />
ist es wichtig, dass die Belastungsachse, auch mechanische Achse<br />
genannt, bekannt ist. Durch kreisende Bewegung kann das<br />
Hüftgelenkszentrum dreidimensional im Raum bestimmt werden.<br />
Durch Abtasten der Malleolengabel medial und lateral kann das<br />
virtuelle Zentrum der Sprunggelenksgabel ermittelt werden.<br />
Durch das Zentrum des Hüftgelenks sowie durch Ermittlung des<br />
Zentrums des Sprunggelenks kann die mechanische Beinachse<br />
definiert werden. In einem weiteren Schritt werden die kniegelenksspezifischen<br />
anatomischen Strukturen ebenfalls im Computer<br />
eingegeben, dies sind das Tibiaplateau sowie das distale Femur.<br />
Somit sind dem Computer alle wichtigen Daten bekannt, die<br />
es ermöglichen, eine Knietotalprothese vollkommen achsengerecht<br />
zu implantieren.<br />
... bei der vorderen Kreuzbandrekonstruktion<br />
Da das Kniegelenk in seinen anatomischen Strukturen, in seiner<br />
Biomechanik und in seiner ligamentären Führung das grösste<br />
und gleichzeitig auch das komplexeste Gelenk am Körper ist und<br />
die vordere Kreuzbandverletzung eine sehr häufige und schwere<br />
Verletzung des Kniegelenks ist, kommt der anatomischen Rekonstruktion<br />
des vorderen Kreuzbandes grosse Bedeutung zu. Von<br />
der Verletzung des Kreuzbandes, die immer noch als Präarthrose<br />
gilt, sind sehr häufig junge, sportlich aktive Patienten betroffen.<br />
Bis zum heutigen Tag wurden zahllose Bücher und Tausende von<br />
wissenschaftlichen Beiträgen geschrieben, wie das vordere<br />
Kreuzband zu rekonstruieren sei – mit allen technischen Details<br />
wie Transplantatentnahme, Fixation, Einzel- und Doppelbündeltechnik.<br />
Analysen zeigen jedoch, dass es nur einen wichtigen<br />
Faktor gibt, der für die erfolgreiche Rekonstruktion des Kreuz-<br />
29
30 Departement Chirurgie<br />
bandes wichtig ist, nämlich die anatomisch korrekte Lage sowie<br />
das Verhindern von Konflikten zwischen anatomischen Gegeben-<br />
heiten und dem Transplantat.<br />
Mehrfache Vorteile der Navigation<br />
Bei der vorderen Kreuzbandrekonstruktion ist also die anatomisch<br />
korrekte Implantation entscheidend für den Erfolg. Welche<br />
Technik, welche Transplantate und welche Fixationstechnik gebraucht<br />
werden, hat sekundäre Bedeutung und ist für die Langzeitprognose<br />
des Kniegelenks irrelevant. Bei der Knietotalprothetik<br />
weiss man heute, dass die achsengerechte Implantation der<br />
absolute Garant für ein Langzeitüberleben von Knietotalprothesen<br />
darstellt. Eine Varus- oder Valgusfehlstellung von 1 bis 2 Grad<br />
ist akzeptabel, geht die Fehlimplantierung darüber hinaus, muss<br />
innerhalb von 7 bis 8 Jahren mit einer Frühlockerung gerechnet<br />
werden. Genau in diesem Punkt scheint die Navigation der herkömmlichen<br />
Technik deutlich überlegen zu sein. Achsenfehlimplantationen<br />
kommen navigiert deutlich weniger häufig vor als<br />
mit der herkömmlichen Technik. In den Verlaufsstudien ist auch<br />
zu sehen, dass selbst erfahrene Chirurgen ihre Fehlimplantationen<br />
dank Navigationen noch deutlich reduzieren können. Haben<br />
sie erst einmal genügend oft navigiert, wird ihre Freihandtechnik<br />
ebenfalls deutlich besser, womit die Navigation auch eine grosse<br />
Bedeutung als Lerninstrument erhält.<br />
«A fool with a tool is still a fool»<br />
Bei allen Vorteilen der Navigation ersetzt diese das Denken des<br />
Operateurs in keiner Weise. Am Beginn internationaler Kongresse<br />
und Instruktionskurse fallen immer wieder zwei Zitate: «A fool<br />
with a tool is still a fool» und «the navigation makes your error<br />
more precise». Damit ist fast alles gesagt, was die Gefahren und<br />
Tücken der Navigation betrifft. Kennt jemand die herkömmlichen<br />
Techniken nicht, nützt ihm die Navigation nichts. Macht jemand<br />
beim Verständnis oder zu Beginn der Navigation bereits einen<br />
Fehler, wird sich dieser Fehler fortpflanzen – dies allerdings mit<br />
einer besonders hohen Präzision.
Klinik für Orthopädie<br />
Für die Zukunft gerüstet<br />
Immer anspruchsvollere Operationstechniken verlangen eine<br />
Spezialisierung auf einzelne Fachgebiete. Die Klinik für Orthopädie<br />
hat klar definierte Zuständigkeitsbereiche geschaffen.<br />
Neue Verfahren, feinere Techniken<br />
Das Fachgebiet der orthopädischen Chirurgie hat in den letzten<br />
Jahren grosse Fortschritte in der Diagnostik, Therapie und operativen<br />
Versorgung abnützungs- und unfallbedingter Erkrankungen<br />
des Bewegungsapparats gemacht. Neue Verfahren wurden<br />
entwickelt, die Techniken verfeinern sich ständig. Mehr und mehr<br />
werden minimalinvasive und arthroskopische Techniken eingesetzt.<br />
Zeit der Universalgenies ist vorbei<br />
Durch die erweiterten diagnostischen Möglichkeiten können<br />
heute Pathologien früher diagnostiziert und deshalb früher und<br />
differenzierter behandelt werden. Dadurch steigen auch die Ansprüche<br />
an die Kenntnisse und die operativen Fähigkeiten des<br />
orthopädischen Chirurgen. Noch vor wenigen Jahren war es<br />
möglich, dass ein gut ausgebildeter Orthopäde das ganze Spektrum<br />
der Chirurgie des Bewegungsapparats erlernen und abdecken<br />
konnte. Heute ist die Spezialisierung so weit fortgeschritten,<br />
dass das Fachgebiet der Orthopädie und Chirurgie des<br />
Bewegungsapparats nicht mehr von einer Person überblickt werden<br />
kann.<br />
Subspezialisierung – ein Muss<br />
Die immer anspruchsvolleren Techniken bedingen eine zunehmende<br />
Spezialisierung des Operateurs. Diesem Umstand muss<br />
sich eine moderne orthopädische Klinik anpassen. Um der steigenden<br />
Komplexität der Behandlung Rechnung zu tragen, ist die<br />
Subspezialisierung eine Notwendigkeit, der sich auch die Orthopädische<br />
Klinik des LUKS stellt. In Analogie zu den führenden Universitätskliniken<br />
unterteilt sie das Fachgebiet in Gelenkregionen<br />
– zum Beispiel in Hüfte, Schulter, Knie, Fuss und so weiter. Dies<br />
hat den Vorteil, dass sämtliche Erkrankungen und Verletzungen<br />
eines Gelenks kompetent von einer Person behandelt werden<br />
können und dass die Behandlung der Situation genau angepasst<br />
werden kann.<br />
Aufteilung in Spezialbereiche<br />
Seit dem Antritt des neuen Chefarztes im August 2008 ist die<br />
Spezialisierung schrittweise eingeführt und das Gebiet der Orthopädie<br />
wie folgt aufgeteilt worden: Chefarzt PD Dr. Martin Beck<br />
Departement Chirurgie<br />
ist spezialisiert auf Becken- und Hüftchirurgie, Ellbogenchirurgie<br />
sowie auf Tumoren des Bewegungsapparats. Der Fokus von Dr.<br />
Urs W. Müller, Co-Chefarzt und Leiter Sportmedizin, richtet sich<br />
auf die Kniechirurgie, auf Deformitäten der unteren Extremitäten<br />
sowie auf die Sportmedizin und Sporttraumatologie. Die Spezialisierung<br />
von Dr. Regula Wiesmann umfasst die Sprunggelenkund<br />
Fusschirurgie, jene von Dr. Mathias Hoffmann die Schulterchirurgie.<br />
Lückenlose und hochstehende Versorgung<br />
Im Jahr 2010 wird die Orthopädie durch einen orthopädischen<br />
Wirbelsäulenchirurgen ergänzt, der im Rahmen des Schweizerischen<br />
Wirbelsäulenzentrums mit der neurochirurgischen Wirbelsäulenchirurgie<br />
und dem SPZ Nottwil diese Lücke in der Versorgung<br />
des Bewegungsapparats schliesst. Das Ziel der<br />
Spezialisierung ist, dem Patienten eine lückenlose und hochstehende<br />
Versorgung zu gewährleisten, die alle Aspekte der Diagnostik<br />
und der modernen Behandlung der Erkrankungen und Verletzungen<br />
des Bewegungsapparats beinhaltet.<br />
Klinik für Urologie<br />
Da Vinci bringt’s!<br />
Mit dem Da-Vinci-Robotersystem werden bei der operativen Entfernung<br />
der Prostata sehr gute Resultate erzielt, wie ein Vergleich<br />
mit der offenen Operationsmethode zeigt.<br />
Roboterassistierte Prostataentfernung<br />
Mitte 2008 wurde an der Klinik für Urologie der Da-Vinci-Operationsroboter<br />
eingeführt. Seither wurden als Hauptindikation die<br />
radikale Prostatektomie (operative Entfernung der Prostata) sowie<br />
etwas weniger häufig die Nierenbeckenplastik und die Nierenteilresektion<br />
durchgeführt. Das Ziel der roboterassistierten<br />
radikalen Prostatektomie war, gleichwertige tumorchirurgische<br />
und funktionelle Resultate (Urinkontinenz und Potenzerhalt) wie<br />
bei der offenen Operation zu erreichen und zusätzlich den Vorteil<br />
der geringeren Invasivität zu nutzen. Deshalb wurden die<br />
ersten 70 Patienten, die mit dem Da-Vinci-Roboter operiert wurden,<br />
mit den letzten 70 Patienten, die offen operiert wurden, verglichen.<br />
31
32 Departement Chirurgie<br />
Pluspunkte für Da Vinci<br />
Der Vergleich der beiden Operationsmethoden hat Folgendes er-<br />
geben:<br />
• Mit dem Da-Vinci-System konnten weniger Lymphknoten entfernt<br />
werden.<br />
• Die Rate von Patienten mit positiven Absetzungsrändern war<br />
signifikant geringer als bei der offenen Operation.<br />
• Die Komplikationsrate nach der Da-Vinci-Prostatektomie war<br />
deutlich kleiner als nach offener Operation.<br />
• Mit dem Roboter konnte die erektile Potenz bedeutend besser<br />
erhalten werden als mit der offenen Operation.<br />
• Die Urinkontinenz war nach der Da-Vinci-Prostatektomie leicht<br />
höher als nach offener Operation, der Unterschied war aber<br />
nicht statistisch signifikant.<br />
Gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis<br />
Insgesamt ist klar, dass die Resultate nach Da-Vinci-Prostatektomien<br />
besser sind als nach offenen Operationen. Zusätzlich kann<br />
durch die geringere Invasivität eine schnellere Rehabilitation des<br />
Patienten erreicht werden. Insofern wurden die Minimalanforderungen<br />
an das System deutlich übertroffen. Auch die Resultate<br />
nach einer Nierenteilresektion und insbesondere nach einer roboterassistierten<br />
Nierenbeckenplastik sind sehr gut. Natürlich<br />
sind die Beschaffung und der Betrieb eines solchen Robotersystems<br />
mit Kosten verbunden, die auf den ersten Blick höher scheinen<br />
als bei der offenen Technik. Allerdings wird mit der Robotertechnik<br />
der zweite Assistent eingespart und die Rehabilitation<br />
der Patienten verkürzt. Unter dem Strich bringt die Anwendung<br />
eines solchen Systems einen Mehrwert.<br />
Klinik für Herzchirurgie<br />
Reparieren statt ersetzen<br />
Seit <strong>2009</strong> ist die Aortenklappenrekonstruktion auch in Luzern<br />
möglich. Bereits wurden 14 Patienten erfolgreich behandelt.<br />
Die Rekonstruktion von Aortenklappen<br />
Eine Aortenklappenstenose (Verengung) wird in allen herzchirurgischen<br />
Zentren routinemässig durch einen Aortenklappenersatz<br />
behandelt. Ganz anders ist es, wenn die Aortenklappe insuffizient,<br />
das heisst undicht ist. In den meisten herzchirurgischen Zentren<br />
wird die Aortenklappeninsuffizienz ebenfalls durch einen<br />
Aortenklappenersatz behoben. In wenigen Zentren, wo das<br />
Know-how vorhanden ist, wird aber die Aortenklappeninsuffizienz<br />
durch eine Aortenklappenrekonstruktion therapiert.<br />
Technisch anspruchsvoll<br />
Die Rekonstruktion der Aortenklappe ist technisch anspruchsvoller<br />
als der Ersatz. Für die Operation muss die Basis der Aorta<br />
entfernt werden und die Klappe in eine entsprechend angemessene<br />
Gefässprothese so eingenäht werden, dass die Geometrie<br />
wiederhergestellt wird und sich die Ränder der Taschenklappen<br />
wieder treffen können. Wie bei der biologischen Klappe besteht<br />
der grosse Vorteil der Aortenklappenrekonstruktion darin, dass<br />
auf eine lebenslängliche Antikoagulation mit Marcoumar verzichtet<br />
werden kann. Zusätzlich ist das Flussmuster über die patienteneigene<br />
Klappe im Vergleich zu künstlichen Klappen, mechanisch<br />
oder biologisch, überlegen.<br />
Bereits 14 erfolgreiche Therapien<br />
Bemerkenswert ist auch, dass die Kosten einer Kunstklappe gespart<br />
werden können. Seit Januar <strong>2009</strong> ist das Know-how der<br />
Aortenklappenrekonstruktion im <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> vorhanden.<br />
14 Patienten wurden im LUKS bereits erfolgreich durch eine<br />
Aortenklappenrekonstruktion behandelt.
Chirurgische Klinik<br />
Magen-Darm-Zentrum Luzern<br />
Mehr Patientinnen<br />
1587 Konsultationen, 488 Patientinnen und Patienten,<br />
119 neue Stomata – dies ist die Bilanz der Stomaberatung<br />
des Magen-Darm-Zentrums.<br />
Aufwendigere Betreuungsarbeit<br />
Dank einer eingespielten Teamarbeit konnte auch im Jahr<br />
<strong>2009</strong> eine hohe Beratungsqualität geleistet werden. Die<br />
Betreuung der anvertrauten Menschen ist im Vergleich<br />
zu den vergangenen Jahren aufwendiger geworden. Dies<br />
ist auf die komplexen Lebenssituationen und Krankheitsbilder<br />
der Patienten sowie auf die vermehrte Administration<br />
zurückzuführen. <strong>2009</strong> wurden 1587 Konsultationen<br />
durchgeführt. Die 488 Patientinnen und Patienten stammten<br />
hauptsächlich aus der Zentralschweiz sowie zu einem<br />
kleinen Teil aus den Kantonen Aargau und Zürich.<br />
Insgesamt wurden 119 Stomata neu angelegt.<br />
Entlastung durch Telefonberatung<br />
Im Vergleich zum Vorjahr haben die Konsultationen trotz<br />
steigender Patientenzahlen um 5 Prozent abgenommen.<br />
Der Anteil der Frauen ist gestiegen, während der Männeranteil<br />
gleich geblieben ist. Die auswärtigen, zeitaufwendigen<br />
und intensiven Konsultationen konnten dank einer<br />
individuellen, umfassenden und kompetenten Telefonberatung<br />
um 20 Prozent reduziert werden.<br />
Nachwuchs durch Aus- und Weiterbildung<br />
Während sieben Wochen begleiteten und unterstützten<br />
vier Praktikantinnen das Stomaberatungsteam, das den<br />
Austausch mit den angehenden Stomaberaterinnen und<br />
die durchwegs positiven Feedbacks zu schätzen wusste.<br />
Im Bereich Aus- und Weiterbildung engagierte sich das<br />
ganze Team. Die Stomaberaterinnen führten interne Fortbildungen<br />
durch, unterrichteten an Schulen und leiteten<br />
Pflegefachpersonen vor Ort an. Erwähnenswert ist die<br />
sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen<br />
Beteiligten im <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>.<br />
Departement Chirurgie<br />
33
Departement Spezialkliniken<br />
35
36 Departement Spezialkliniken<br />
Departementsleiter<br />
Prof. Dr. Bernhard Schüssler<br />
«Wer stillsteht,<br />
verliert den Anschluss.»<br />
Klinikleitungen<br />
Augenklinik<br />
PD Dr. Dr. Michael Thiel, Chefarzt<br />
Brigitte Bendiner,<br />
Leiterin Pflegedienst (PiP)<br />
HNO<br />
Prof. Dr. Thomas Linder,<br />
Chefarzt (PiP)<br />
Kathleen Schwarz,<br />
Leiterin Pflegedienst<br />
Neue Frauenklinik<br />
Prof. Dr. Bernhard Schüssler,<br />
Chefarzt (PiP)<br />
Corinne Spillmann,<br />
Leiterin Pflegedienst<br />
<strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana<br />
Dr. Werner Karrer, Chefarzt und<br />
Vorsitzender der Klinikleitung<br />
Raymonde Bonvin, Leiterin Pflegedienst<br />
lic. rer. pol. Fabian Wenger,<br />
Leiter Betriebswirtschaft<br />
Leitendes Personal<br />
Augenklinik<br />
Dr. Peter Senn, Co-Chefarzt<br />
Dr. Oliver Job<br />
Dr. Martin Schmid<br />
HNO<br />
Dr. Werner Müller, Co-Chefarzt<br />
Dr. Christoph Schlegel-Wagner,<br />
Co-Chefarzt<br />
Dr. Dipl. phys. Peter Oppermann<br />
Dr. Gunther Pabst<br />
Dr. Marcel Gärtner<br />
Neue Frauenklinik<br />
Dr. Markus Bleichenbacher, Co-Chefarzt<br />
Dr. Markus Hodel<br />
Dr. Susanne Bucher<br />
<strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana<br />
Dr. Helena Shang Meier,<br />
Leitende Ärztin<br />
Dr. Patrick Brun, Oberarzt<br />
Willi Amherd,<br />
Leiter psychologischer Dienst<br />
Dominique Janssens,<br />
Chefphysiotherapeut<br />
Marianne Benner, Leiterin Ergotherapie<br />
Marie-José Vaucher,<br />
Leiterin Medizintechnik<br />
Ingeborg Klinkhamer, Leiterin Schlaflabor<br />
Ursula Forte, Leiterin Sekretariate<br />
Lies Antille, Leiterin Labor<br />
Veronica Schädler, Leiterin Sozialdienst<br />
Asja Schmid, Stv. Leiterin Pflegedienst<br />
Susanne Musy, Leiterin Personalwesen<br />
Pia Neyerlin, Leiterin Hotellerie<br />
René Arnold, Leiter Technischer Dienst<br />
Bruno Arnold, Leiter Informatik<br />
Margrit Berclaz, Leiterin Empfang<br />
Elfriede Roller, Stationsleitung<br />
Nadia Margelisch, Stationsleitung<br />
Paul Brauns, Stationsleitung
Departement Spezialkliniken<br />
Auf der Erfolgsspur<br />
Die Augenklinik, HNO-Klinik, Neue Frauenklinik und <strong>Luzerner</strong><br />
Höhenklinik Montana (LHM) nutzen ihre Möglichkeiten, um sich<br />
auch in Zukunft erfolgreich zu positionieren.<br />
Erweitern, erneuern, restrukturieren<br />
Die OP-Erweiterung durch einen zusätzlichen Operationsraum<br />
hilft der Augenklinik, die Kapazitätsengpässe zu beseitigen. In<br />
der HNO-Klinik trägt die letzte Umbauetappe nicht nur zur Modernisierung<br />
der gesamten Abteilung, sondern auch zur Optimierung<br />
der Abläufe bei. Die Neue Frauenklinik wiederum hat auf<br />
Restrukturierung gesetzt: Die Risikoschwangerenstation wurde<br />
in die unmittelbare Nähe der Gebärabteilung verlegt, die Überwachung<br />
für Risikoschwangere auf der Pränatalstation verbessert<br />
und ausserdem das Frühstücksbuffet auf der Mutter-und-<br />
Kind-Abteilung eingeführt. Die <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana<br />
(LHM) hat die aus Sicherheitsgründen notwendige Bachsanierung<br />
dazu genutzt, die für eine Rehabilitationsklinik wichtige<br />
Parkanlage zu sanieren und eine neue Kneippanlage zu erstellen.<br />
Der stetige Wandel sorgt für Bewegung und dafür, dass die Spezialkliniken<br />
weiterhin auf der Erfolgsspur bleiben.<br />
Departement Spezialkliniken<br />
Augenklinik<br />
Tropfen statt Spritzen<br />
Der Erfolg der Augenklinik führt zu einem erhöhten Raumbedarf<br />
und zu entsprechenden Massnahmen. Eine Forschungsarbeit<br />
des Chefarztes wurde mit einer europäischen Premiere erfolgreich<br />
abgeschlossen.<br />
Entlastung durch Fertigbau<br />
Die in den letzten Jahren rasant gewachsene Zahl von Patienten<br />
und Operationen stellt die Augenklinik vor kaum mehr lösbare<br />
Raumprobleme. Obwohl die Projektplanung für eine Totalrenovation<br />
mit Erweiterung des 1973 in Betrieb genommenen Gebäudes<br />
der Augenklinik bereits in vollem Gang ist, hat der Spitalrat<br />
2008 als Überbrückung dem Bau eines vierten Operationssaals<br />
zugestimmt. Geplant wurde ein an das Gebäude angedockter<br />
Fertigbau. Im November <strong>2009</strong> konnte der Operationssaal bestellt<br />
werden. Daraufhin wurden die Metallstützen im Erdreich verankert.<br />
Bereits nach wenigen Wochen wurde der vorgefertigte Bau<br />
mit Tiefladern angeliefert und mit einem 500-Tonnen-Kran direkt<br />
an der Südfassade der Klinik platziert. Sobald die Feinarbeiten<br />
und Abnahmeprüfungen erfolgt sind, kann Anfang 2010 der Betrieb<br />
aufgenommen werden. Mit dem zusätzlichen Operationssaal<br />
können für die Patienten die Wartezeiten für geplante, nicht<br />
dringende Operationen wieder auf wenige Wochen reduziert<br />
werden.<br />
Räumliche Optimierungen<br />
Bereits im Sommer <strong>2009</strong> wurde der Vortragsraum der Klinik im<br />
4. Stock durch provisorische Wände in mehrere Büros unterteilt.<br />
Durch eine Raumrochade konnten damit im Bereich des 3. Stocks<br />
zusätzliche Untersuchungsräume für Patienten geschaffen werden.<br />
Für die Patienten und ihre Angehörigen ist dies eine erfreu-<br />
37
38 Departement Spezialkliniken<br />
Blickpunkte<br />
Augenklinik<br />
Erfolgreiche Kongresse<br />
Im Juni <strong>2009</strong> organisierte die Augenklinik<br />
unter der Leitung von PD Dr. Dr. Michael<br />
Thiel den Europäischen Hornhautkongress.<br />
Hornhautspezialisten aus 26 Ländern,<br />
von Skandinavien bis Australien,<br />
reisten für diese Veranstaltung nach Luzern<br />
und stellten ihre neuesten Resultate<br />
und Studien vor. Im Dezember folgte ein<br />
Jahreskongress unter der Leitung von Co-<br />
Chefarzt Dr. Peter Senn: Das «Swiss Vitreoretinal<br />
Group Meeting» im KKL war ein<br />
voller Erfolg – keine der bisherigen Veranstaltungen<br />
hatte ein so grosses schweizweites<br />
Interesse geweckt!<br />
Bestnoten der FMH<br />
Die Augenklinik organisierte auch eine<br />
grosse Fortbildungstagung für Schweizer<br />
Augenärzte, zwei Fortbildungen für Optiker<br />
der Zentralschweiz und zwei Fortbildungen<br />
für in Augenheilkunde spezialisierte<br />
Pfl egemitarbeiter der Deutschschweiz.<br />
Die Ärzte der Augenklinik hielten mehr<br />
als 60 Vorträge an nationalen und internationalen<br />
Fortbildungsveranstaltungen.<br />
Die Augenklinik wurde dieses Jahr zudem<br />
von der Weiterbildungskommission der<br />
FMH visitiert und erhielt die bestmögliche<br />
Gesamtbeurteilung. Das gleiche Resultat<br />
zeigte sich auch in der Auswertung der<br />
anonymen Assistentenumfrage durch die<br />
FMH zur Qualität der Augenklinik als Weiterbildungsstätte.<br />
Neue Frauenklinik<br />
Umzug der Pränatalstation<br />
Die Pränatalstation befi ndet sich jetzt in<br />
der Nähe der Gebärabteilung. Der Umzug in<br />
das 2. OG erfolgte, um die Sicherheit der<br />
Schwangeren zu gewährleisten und die interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit zu fördern.<br />
Fast wie zu Hause<br />
Das Familienzimmer ist nun Bestandteil<br />
der Mutter-und-Kind-Abteilung. An diesem<br />
Ort der Ruhe soll sich die Familie fast wie<br />
zu Hause fühlen. Auch der Vater wird in<br />
alle Bereiche der Pfl ege des Neugeborenen<br />
integriert.<br />
Wissenschaft gegen Brustkrebs<br />
Im Oktober fand als Zeichen der Solidarität<br />
für an Brustkrebs erkrankte Frauen die<br />
öffentliche Veranstaltung «Wissenschaft<br />
gegen Brustkrebs» statt. Experten aus<br />
dem Ausland und dem LUKS informierten<br />
über Qualitätssicherung und Qualitätsbewertung<br />
in der Behandlung von Brustkrebs.<br />
Zudem wurde das neu geschaffene<br />
Zentralschweizer Krebsregister vorgestellt.<br />
Das Angebot für Führungen im<br />
Brustzentrum fand grossen Anklang.<br />
Bessere Krankheitsbewältigung<br />
Im Brustzentrum steht nicht allein die<br />
medizinische Versorgung im Mittelpunkt,<br />
sondern auch die bessere Krankheitsbewältigung<br />
durch Patientinnen und Angehörige.<br />
Aus diesem Grund wurde eigens<br />
für das Brustzentrum eine Psychoonkologin<br />
engagiert.<br />
<strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana<br />
Klinikpark neu gestaltet<br />
Der Bach La Vanire querte das Gelände<br />
der <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana unterirdisch.<br />
Bereits 2008 ist ein Teil dieser Kanalisation<br />
eingebrochen und es bildete<br />
sich ein Einsturzkrater auf einem Weg der<br />
Klinik. Bei einem grösseren Hochwasser<br />
wäre die Sicherheit der Klinik durch einen<br />
allfälligen Wassereinbruch stark gefährdet<br />
gewesen. Für die Sanierung der Kanalisation<br />
kam für den Kanton Wallis nur eine<br />
Öffnung und somit der Bau eines neuen<br />
Bachbetts in Frage.<br />
Kneippanlage im Bach<br />
Im Sommer <strong>2009</strong> wurde an der Grundstücksgrenze<br />
der <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik<br />
Montana ein Bachbett ausgegraben. Nun<br />
fl iesst der Bach offen an der Klinik vorbei.<br />
Dieser Umstand wurde auch dazu genutzt,<br />
die Umgebung der Klinik mit ihrem Park<br />
und dem Heli-Landeplatz neu zu gestalten.<br />
Gleichzeitig wird im Frühjahr 2010 im<br />
neuen Bachlauf eine kleine Kneippanlage<br />
zur Nutzung für die Patientinnen und Patienten<br />
eingerichtet.<br />
Klinik für Hals-Nasen-Ohren,<br />
Hals- & Gesichtschirurgie<br />
Umbauten abgeschlossen<br />
Nach mehrjährigen Umbauphasen im stationären<br />
und ambulanten Bereich sowie<br />
im Operationstrakt sind die Räumlichkeiten<br />
der HNO-Klinik wieder auf dem technisch<br />
neusten Stand und verschönern für<br />
die Patienten den kürzeren oder längeren<br />
Aufenthalt an der Klinik. Die neue Bibliothek<br />
und Videothek mit direkter Vernetzung<br />
zum Operationssaal ermöglicht es,<br />
die Fort- und Weiterbildungen in hochstehender<br />
Qualität für Ärzte (inkl. der regelmässig<br />
anwesenden Gastärzte) und Pfl egende<br />
anzubieten. Mit der Eröffnung des<br />
AMTS auf dem Gelände des <strong>Kantonsspital</strong>s<br />
können künftig auch weitere Kurse<br />
und Fortbildungen hier in Luzern angeboten<br />
werden.
liche Verbesserung, denn nun können alle Untersuchungen der<br />
Maculasprechstunde auf dem gleichen Stockwerk erfolgen.<br />
Informationssystem in den Wartezonen<br />
Die Hauptwartezone im 1. Untergeschoss konnte mit einer zeitgemässen<br />
und energiesparenden Beleuchtung heller und freundlicher<br />
gestaltet werden. Gleichzeitig wurden in allen Wartebereichen<br />
Flachbildschirme montiert, die allfällige Wartezeiten mit<br />
aktuellen Informationen und Bildern verkürzen. Diese neue Art<br />
der Informationsvermittlung hat sich bereits nach kurzer Zeit<br />
sehr bewährt. So konnten unter anderem laufend die aktuellen<br />
Informationen über Hygieneaspekte und zum Verhalten bei Grippe<br />
kommuniziert werden.<br />
Stiftung zur Förderung der Augenklinik<br />
Im Januar <strong>2009</strong> konnte mit einer grosszügigen Spende eines<br />
Patienten eine gemeinnützige Stiftung zur Förderung der Augenklinik<br />
am <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> ins Leben gerufen werden. Das<br />
Ziel der Stiftung ist es sicherzustellen, dass es die Augenklinik<br />
durch die Anschaffung von innovativen Untersuchungs- und Behandlungsgeräten<br />
ihren Patienten ermöglicht, schon frühzeitig<br />
vom Puls der medizinischen Entwicklung zu profitieren. Entsprechend<br />
besteht der Stiftungsrat aus Vertretern der Patienten, der<br />
Ärzte und der Pflege. Durch den gebündelten Einsatz vieler kleiner<br />
Spenden wird es der Stiftung gelingen, grosse Fortschritte<br />
für alle zu erreichen.<br />
Europäische Premiere<br />
Im Frühjahr <strong>2009</strong> konnte die Augenklinik des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s<br />
als erste Klinik in Europa ein neuartiges Medikament zur<br />
Behandlung von Augenentzündungen einsetzen. Dabei werden<br />
therapeutische Antikörper, die bisher gespritzt werden mussten,<br />
so weit verkleinert, dass sie nun schmerz- und nebenwirkungsfrei<br />
als Tropfen dem Auge direkt verabreicht werden können. Diese<br />
neuen Tropfen basieren auf den Resultaten der Grundlagenforschung<br />
von PD Dr. Dr. Michael Thiel, womit es gelang, in mehr<br />
als zehnjähriger Forschungsarbeit den Weg von der Konzeptidee<br />
bis zur therapeutischen Anwendung zu verfolgen.<br />
Departement Spezialkliniken<br />
<strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana (LHM)<br />
Teil der LUKS-Familie<br />
Die <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana (LHM) ist seit dem 1. Januar <strong>2009</strong><br />
– die aktiven Verkaufsabsichten des Kantons Luzern wurden eingestellt<br />
– definitiv ein Standort des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s LUKS.<br />
Nahtlose Betreuung der Patienten<br />
Die Zusammenarbeit zwischen dem LUKS und der <strong>Luzerner</strong><br />
Höhenklinik Montana (LHM) wurde weiter intensiviert. Die Höhenklinik<br />
stellt als Entlastungsklinik die nötigen Betten für die Betreuung<br />
der Patientinnen und Patienten zur Verfügung. Ein nahtloser<br />
Übertritt in die Rehabilitation nützt primär den Patienten,<br />
ist aber auch für die Akut-Spitäler wichtig. Diese wissen ihre Patienten<br />
in optimaler medizinischer Betreuung und können gleichzeitig<br />
ihre eigenen Kapazitäten für neue Fälle bereitstellen.<br />
Vorteile im Verbund<br />
Die <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana (LHM) profitiert mit dem Zugriff<br />
auf PACS und i-engine von den digitalen Röntgenbildern und<br />
39
40 Departement Spezialkliniken<br />
der elektronischen Krankengeschichte der Akut-Spitäler. Im Bereich<br />
Finanzen und Administration ist die Zusammenarbeit bereits<br />
seit 2008 verstärkt worden. Die finanziellen Abschlusszahlen<br />
sind in der Gesamtrechnung LUKS konsolidiert.<br />
Zertifizierte Qualität der Rehabilitation<br />
Die <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana (LHM) ist seit sechs Jahren für<br />
ihre Prozesse und Organisation zertifiziert mit dem Standard ISO<br />
9001 : 2000. Daneben sind aber auch bereits mehrere medizinische<br />
Programme der Klinik gemäss den Vorgaben aus den jeweiligen<br />
Fachgesellschaften zertifiziert. Im vergangenen Jahr hat die<br />
Höhenklinik aktiv an der Evaluation eines neuen Qualitätsstandards<br />
für die kardiale Rehabilitation mitgearbeitet. Diese Bestrebungen<br />
wurden vom Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung<br />
in Spitälern und Kliniken ANQ, der von H+ und den Versicherern<br />
getragen wird, sowie von führenden Rehabilitationskliniken im<br />
kardialen Bereich vorangetrieben.<br />
Aus-, Weiter- und Fortbildung<br />
Die <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana (LHM) ist Weiterbildungsklinik<br />
für Ärztinnen und Ärzte in Innerer Medizin, Pneumologie und<br />
physikalischer Medizin und Rehabilitation. Die Beurteilung der<br />
Weiterbildungsqualität durch die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte<br />
fiel im schweizweiten Vergleich 2008 wie <strong>2009</strong> überdurchschnittlich<br />
gut aus. In der Physiotherapie werden Praktikantinnen<br />
betreut und in der Pflege Lernende als Fachangestellte<br />
Gesundheit ausgebildet. Die LHM ist auch ein Lehrbetrieb für Lernende<br />
in der Küche.<br />
Für die Hausärzte wird durch die vier Kliniken von Montana der<br />
jährliche Kongress QUADRIMED durchgeführt, an dem über 1000<br />
Ärztinnen und Ärzte eingeschrieben sind, darunter immer zahlreiche<br />
<strong>Luzerner</strong>innen und <strong>Luzerner</strong>, sei es als Referentinnen und<br />
Referenten oder als Teilnehmerinnen und Teilnehmer.<br />
Neue Frauenklinik<br />
Ob Kinderwunschzentrum,<br />
Geburtshilfe oder<br />
Brustzentrum – zertifizierte<br />
Qualität hat den<br />
Vorteil, dass die Patientin<br />
weiss, was sie bekommt.<br />
Ob Kinderwunschzentrum, Geburtshilfe oder Brustzentrum –<br />
überall ist die Nachfrage wiederum gestiegen. Rezertifizierung<br />
und Benchmark bestätigen die überdurchschnittliche Qualität<br />
des Angebots.<br />
Kinderwunschzentrum bei «FertiPROTEKT»<br />
Das Kinderwunschzentrum ist weiterhin erfolgreich tätig. Es hat<br />
insbesondere in der assistierten Reproduktion sein Leistungsangebot<br />
im Bereich «fertility protection» ausgebaut und wurde als<br />
Mitglied in das Netzwerk «FertiPROTEKT» aufgenommen. Dieses<br />
ist ein Zusammenschluss führender deutschsprachiger Zentren,<br />
die einheitliche Standards im Bereich der fertilitätserhaltenden<br />
Massnahmen einhalten. Im Kinderwunschzentrum werden ratsuchende<br />
Patientinnen und Patienten jeden Alters, deren Fertilität<br />
in der Regel durch eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung<br />
gefährdet ist, beraten – meist am selben Tag, spätestens aber am<br />
folgenden Arbeitstag. Anschliessend werden die geeigneten<br />
Massnahmen eingeleitet. Meist geht es darum, vor einer onkologischen<br />
Behandlung Keimzellen zu konservieren oder aber<br />
kurzfristig noch eine Kinderwunschbehandlung einzuleiten.<br />
Jedes Jahr mehr Geburten<br />
Jedes Jahr erblicken in der Neuen Frauenklinik mehr Kinder das<br />
Licht der Welt als im Vorjahr. Dieser seit neun Jahren bestehende<br />
Trend hat sich auch <strong>2009</strong> fortgesetzt und betrifft auch das Pränatalzentrum.<br />
Auch die weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit<br />
mit der Neonatologie trägt zu diesem Gesamtergebnis bei.<br />
Zunahme der Risiko-Schwangerschaften<br />
Im ambulanten Sektor fallen erneut die steigende Zahl der Ultraschalluntersuchungen<br />
und die Zunahme der Betreuung von Risiko-Schwangerschaften<br />
auf. Mit der Verschiebung des Kinderwunschs<br />
in die vierte, teils fünfte Lebensdekade nehmen auch<br />
die internistischen Grunderkrankungen bei Schwangeren zu.<br />
Diese Frauen und deren Kinder sind auf eine engmaschige inter-
disziplinäre Zusammenarbeit angewiesen, damit Risiken frühzei-<br />
tig erkannt und Komplikationen konsequent therapiert werden<br />
können.<br />
Wöchnerinnen-Treffen am Frühstücksbuffet<br />
Auf der Mutter-und-Kind-Abteilung ist das Frühstücksbuffet ein<br />
voller Erfolg. Die Wöchnerinnen treffen sich in angenehmer<br />
Atmosphäre zum «Zmorge» und können untereinander Informationen<br />
austauschen. Auch werden sie von den Pflegefachfrauen<br />
interaktiv über wichtige Themen des Wochenbetts orientiert.<br />
Brustzentrum erfolgreich rezertifiziert<br />
Das Brustzentrum Luzern hat einen weiteren Meilenstein erreicht<br />
und wurde im August <strong>2009</strong> erfolgreich rezertifiziert. Es hat<br />
für die Rezertifizierung den hohen Qualitätsvorgaben nach DKG/<br />
DGS (Deutsche Krebsgesellschaft und Deutsche Gesellschaft für<br />
Senologie) entsprochen und das Zertifikat für weitere drei Jahre<br />
erhalten. Diese Leistung entspricht einer Schweizer Pionierleistung;<br />
kein anderes Brustzentrum in der Schweiz kann den Qualitätsausweis<br />
einer Rezertifizierung nachweisen. Medizinische<br />
Kompetenzzentren gewinnen stetig an Bedeutung. Dies setzt<br />
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit auf höchstem Niveau voraus.<br />
Regelmässige Tumorboards und interdisziplinäre Kolloquien<br />
mehrmals pro Woche sind im Brustzentrum Luzern Routine,<br />
ebenso die gemeinsame Sprechstunde mit den plastischen Chirurgen.<br />
Höhere Überlebenschance, tiefere Rückfallquote<br />
Der Nutzen der Patientin besteht nicht nur darin, dass sie von<br />
Spezialisten auf dem höchsten Stand der Technik und auch des<br />
medizinischen Wissens unter einem Dach behandelt wird. Gross<br />
angelegte Vergleiche zwischen zertifizierten und nicht zertifizierten<br />
Brustzentren in Deutschland (Prof. R. Kreienberg, Universität<br />
Ulm) haben gezeigt, dass die leitliniengerechte Therapie, die in<br />
zertifizierten Brustzentren zwingend befolgt werden muss, das<br />
Überleben von brustkrebserkrankten Frauen tatsächlich verbessert<br />
und die Rückfallquote statistisch signifikant vermindert.<br />
Besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis<br />
Nicht nur die Patientinnen profitieren von der medizinischen<br />
Versorgungsqualität auf höchstem Niveau durch die Behandlung<br />
von Spezialisten, sondern auch der Kostenträger: Die höhere<br />
Produktivität bei der Leistungserbringung, die Konzentration der<br />
Ressourcen und der geringere Nachbehandlungsaufwand verbessern<br />
das Kosten-Nutzen-Verhältnis.<br />
Internationaler Vergleich: Benchmark<br />
Der internationale Vergleich mit über 220 Brustzentren in Deutsch-<br />
Departement Spezialkliniken<br />
land, Österreich, Italien und der Schweiz zeigte auch in diesem<br />
Jahr, dass das Brustzentrum Luzern nicht nur bezogen auf die medizinische<br />
Qualität bestens dasteht, auch die kontinuierliche Erfassung<br />
der Patientinnenzufriedenheit ergab höchste Werte.<br />
Tumordokumentationssystem ODSeasy<br />
Seit 2006 verfügt das Brustzentrum über ein onkologisches<br />
Tumordokumentationssystem (ODSeasy). Mittlerweile ist eine<br />
stattliche Anzahl primärerkrankter Brustkrebsfälle sowie deren<br />
Diagnostik, Therapie und Nachsorge erfasst. Dies ermöglicht es,<br />
die eigenen Daten auf diverse Fragestellungen zu prüfen und<br />
statistisch relevante Aussagen zu machen.<br />
Beckenbodenzentrum: Erfolg mit TVT<br />
Bereits 1998 wurde an der Neuen Frauenklinik die TVT-Methode<br />
eingeführt. Beim TVT (Tension-free Vaginal Tape) handelt es sich<br />
um ein spannungsfreies Vaginalband zur Behandlung von Belastungsharninkontinenz,<br />
das in einem minimalinvasiven Verfahren<br />
eingesetzt wird. Das Beckenbodenzentrum verfügt inzwischen<br />
über eine exzellente Langzeiterfahrung bei weit über 1000 Patientinnen.<br />
41
42 Departement Spezialkliniken<br />
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren- und<br />
Gesichts-Chirurgie (HNO)<br />
Wandlung und<br />
Erneuerung<br />
Nach zahlreichen Umbauten, die zu wertvollen Optimierungen<br />
führten, kann sich das HNO-Team mit neuem Elan seinen Kernaufgaben<br />
widmen.<br />
Vierjährige Renovationsphase<br />
«Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling.»<br />
(Vincent van Gogh). In den letzten vier Jahren fand innerhalb<br />
der HNO-Klinik eine bemerkenswerte Renovation statt –<br />
zunächst der Abteilungen im 10. Stock, danach des Operations-<br />
trakts, des Ambulatoriums und nun der Audiologie- und<br />
Phonia trieabteilung, der Bibliothek und der Videothek. Nach<br />
Wikipedia wird «Umbau» definiert als die Veränderung eines<br />
Objekts in Form, Gestalt oder Ausführung mit erheblichem<br />
Eingriff und Arbeitsumfang. Ziel ist es, das Objekt zu verbessern,<br />
zu erweitern oder umzunutzen. Alle diese Aspekte durfte das<br />
HNO-Team während und nach den Umbauphasen unmittelbar<br />
erleben.<br />
Bauarbeiten bei laufendem Betrieb<br />
Der Aufwand für die Planer, Bauarbeiter und die Mitarbeiter war<br />
erheblich. So musste bei laufendem Betrieb die Patientenbetreuung<br />
auf gleich hohem Niveau gewährleistet bleiben. Dies bedeutete<br />
zum Beispiel für die Audiologie-Abteilung, dass bestimmte<br />
Sperrzeiten für lärmige Bauarbeiten eingehalten werden mussten,<br />
während deren die Hörprüfungen der Patienten in einer extra zugemieteten<br />
schalldichten Kabine durchgeführt werden konnten.<br />
Durch eine optimale Raumausnützung konnte ein zweiter Untersuchungsraum<br />
für die Ultraschalldiagnostik erstellt werden.<br />
Ausbildungsinfrastruktur verbessert<br />
Die Bibliothek und die Videothek wurden in grösseren Räumen<br />
zusammengeführt. Durch das Zusammenlegen wird die Bearbeitung<br />
von Videos zu Ausbildungszwecken weiter verbessert und<br />
für die eigenen Fachanwärter und die vielen internationalen<br />
Gastärzte eine ideale Lernplattform geschaffen. In Zusammenarbeit<br />
mit der Fisch International Microsurgery Foundation (FIMF)<br />
soll auch eine 3-D-Video-Einheit mit 3-D-Operationsvideos darin<br />
aufgestellt werden und frei zugänglich sein.<br />
Erster Preis am HNO-Kongress <strong>2009</strong><br />
Aus-, Weiter- und Fortbildung der eigenen Mitarbeiter und der
Gastärzte ist neben der primären Patientenbetreuung eine wich-<br />
tige Aufgabe einer A-Klinik und damit Ausbildungsklinik für Fach-<br />
anwärter HNO. Zur Qualitätskontrolle werden die von der HNO-<br />
Klinik in Zusammenarbeit mit der Firma innoforce entwickelten<br />
wissenschaftlichen Datenbanken für Ohr- und Schilddrüsenchirurgie<br />
rege verwendet. Die Aufarbeitung bestimmter Themengebiete<br />
erfolgt durch die Assistenten und Gastärzte unter der Supervision<br />
der Kaderärzte. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden<br />
an verschiedenen Kongressen vorgetragen. Am Schweizer HNO-<br />
Kongress <strong>2009</strong> erhielt Dr. Marion Einsle den ersten Preis für den<br />
besten Vortrag (in Zusammenarbeit mit Dr. Werner Müller und<br />
Dr. Thomas Schmitt-Mechelke).<br />
Säen und Ernten<br />
Die eigenen Operationskurse in Ohr- und Schädelbasischirurgie<br />
in Zusammenarbeit mit der FIMF und dem Anatomischen Institut<br />
der Universität Zürich waren wiederum frühzeitig ausgebucht.<br />
Die grosse Nachfrage nach den Ohrkursen führte zu zusätzlichen<br />
Kursen in Südafrika und Brasilien. Kaderärzte der Klinik wurden<br />
als Hauptreferenten an weitere internationale Kongresse in der<br />
Schweiz, Australien, Südafrika, Irland und Frankreich eingeladen.<br />
Nur durch nicht erlahmende Basisarbeit und die gezielte Förderung<br />
von Projekten kann schlussendlich die «Ernte» eingefahren<br />
werden.<br />
Klare Sicht dank neuem Spülsystem<br />
In den neu renovierten Operationssälen werden die Eingriffe<br />
über das Mikroskop und die Endoskope nun simultan auf zwei<br />
verstellbare hochauflösende Bildschirme übertragen. Dies ermöglicht<br />
es, den zuschauenden Assistenten und Gastärzten die<br />
Operationen «live» zu erklären. In der Rhinologie wurde ein Spülsystem<br />
(Clearvision) angeschafft, das die Endoskopielinse kontinuierlich<br />
reinigt und damit eine optimale Sicht bei Operationen<br />
an den Nasennebenhöhlen oder der vorderen Schädelbasis ermöglicht.<br />
Früher musste dazu das Endoskop regelmässig von<br />
Blutspritzern ausserhalb des Operationsfeldes gereinigt werden,<br />
was auch zur Verlängerung der Operationszeit beigetragen hat.<br />
Technische Verbesserungen<br />
Im Ambulatorium wurde durch den Umbau ein zweiter Ultraschallraum<br />
ermöglicht. Durch die Anschaffung eines weiteren<br />
modernen Geräts können nun parallel Untersuchungen vorgenommen<br />
werden. Dadurch sollten auch die Wartezeiten insbesondere<br />
für Schilddrüsen-Patienten weiter reduziert werden. In<br />
der Phoniatrie wurde eine neue 3.5 mm flexible Videooptik nach<br />
dem Prinzip «chip on the tip» beschafft. Diese liefert im Vergleich<br />
zu den konventionellen Fiberoptiken eine 30-fach erhöhte Detaildarstellung.<br />
Dadurch kann insbesondere bei der Tumordiag-<br />
Departement Spezialkliniken<br />
nostik und -nachsorge sowie bei Stimmfunktionsuntersuchungen<br />
die genaue Beurteilung und Dokumentation morphologischer<br />
Veränderungen verbessert werden.<br />
Neues Hörscreening-Verfahren<br />
In der Kinderaudiologie wurde ein neues Hörscreening-Verfahren<br />
eingeführt: Mithilfe der AAEP-Messung (automatisierte akustisch<br />
evozierte Potenziale) können mögliche Hörstörungen bei Neugeborenen<br />
(zirka 1 bis 3 pro 1000 Geburten) nochmals überprüft<br />
und damit die Häufigkeit von aufwendigen und für die Eltern beängstigenden<br />
Narkose-Untersuchungen deutlich reduziert werden.<br />
Ab 2010 sollen auch die Audiometristinnen der Klinik diese<br />
Untersuchung anbieten und damit den ärztlichen Dienst entlasten<br />
können.<br />
«Mit voller Kraft voraus»<br />
Bedingt durch die zahlreichen Umbauarbeiten war <strong>2009</strong> erneut<br />
ein Jahr mit vielen Planungssitzungen und temporären Reorganisationen.<br />
Der Abschluss der Arbeiten zum Jahresende bedeutet<br />
nun aber, dass sich das HNO-Team im Jahr 2010 in optimierten<br />
Räumlichkeiten «mit voller Kraft voraus» seinen Kernaufgaben<br />
widmen kann. All diese Veränderungen hat Kathleen Schwarz,<br />
Leiterin Pflegedienst, mit stoischer Ruhe miterlebt und aktiv mitgestaltet<br />
– und dies während ihres 30-Jahr-Jubiläums an der<br />
HNO-Klinik!<br />
43
Departement Kinderspital<br />
45
46 Departement Kinderspital<br />
Departementsleiter<br />
Prof. Dr. Gregor Schubiger<br />
«Ein Traum ist unerlässlich,<br />
wenn man die Zukunft<br />
gestalten will.» Victor Hugo<br />
Prof. Dr. Gregor Schubiger<br />
Departementsleiter<br />
Leitung Kinderspital<br />
Pädiatrie<br />
Prof. Dr. Thomas J. Neuhaus, Chefarzt<br />
Kinderchirurgie<br />
PD Dr. Marcus-Georg Schwöbel, Chefarzt<br />
Neo/IPS<br />
Prof. Dr. Thomas M. Berger,<br />
Chefarzt ad personam<br />
Kinderchirurgie<br />
Dr. Hermann Winiker, Leitender Arzt<br />
ambulante Bereiche<br />
Beat Epp, Leiter Pflegedienst<br />
stationäre Bereiche<br />
Lilo Enderli, Leiterin Pflegedienst<br />
Leitende Ärzte<br />
Pädiatrie<br />
Dr. Ueli Caflisch<br />
Dr. Patrick Imahorn<br />
Dr. Hans Peter Kuen<br />
Dr. Johannes Spalinger<br />
Dr. Thomas Schmitt-Mechelke<br />
Gemeinsame Dienste<br />
Dr. Simone Krähenbühl-Blanchard,<br />
Leitende Ärztin KJPD
Kinderspital<br />
Auf zu neuen Ufern<br />
Der Um- und Erweiterungsbau des Kinderspitals befindet sich in<br />
der Startphase. Die hohe Versorgungsqualität wird durch eine in-<br />
tensive interdisziplinäre Zusammenarbeit weiterentwickelt. Die<br />
Notfallstation des Kinderspitals hat neue Dimensionen angenom-<br />
men.<br />
Generalisten und Spezialisten kooperieren<br />
Kinderchirurgen und Pädiater verstehen sich als Generalisten für<br />
die Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Der Fortschritt in<br />
der Medizin fordert aber in allen Bereichen eine Diversifizierung<br />
in Spezialbereiche. Diese Entwicklung macht auch vor dem Kinderspital<br />
nicht halt. Mehrere Kaderärzte mit einer Weiterbildung<br />
in den spezialisierten Schwerpunkten ermöglichen eine interdisziplinäre<br />
Betreuung von Kindern mit komplexen und anspruchsvollen<br />
Krankheitsbildern. Ein Markenzeichen des Kinderspitals<br />
Luzern ist die Zusammenarbeit von Generalisten und Spezialisten,<br />
Pädiatern und Kinderchirurgen, engagierten Pflegeteams<br />
und Therapiestellen. Eine hochstehende und umfassende Versorgungsqualität<br />
ist das «Credo» des Kinderspitals.<br />
Wettbewerb für Um- und Erweiterungsbau<br />
Auf dem Weg zur Realisierung des Um- und Erweiterungsbaus<br />
ist ein weiterer Schritt erfolgt: Im Rahmen des Architekturwettbewerbs<br />
wurden zahlreiche Projekte eingereicht. Aktuell ist die<br />
Jury daran, die Projekte zu bewerten. Der definitive Entscheid ist<br />
für den Frühling 2010 vorgesehen.<br />
Neue Organisation der Notfallstation im Kinderspital<br />
Anfang <strong>2009</strong> organisierte die kantonale Ärztegesellschaft den<br />
Notfalldienst der Stadt und Agglomeration Luzern neu. Die unmittelbare<br />
Folge war eine massiv gesteigerte Belastung in der<br />
Notfallstation: Sowohl die «Walk-in»-Patienten als auch die telefonischen<br />
Beratungsanfragen nahmen explosionsartig zu. Diese<br />
Mehrbelastung konnte an den Wochenenden durch Integration<br />
von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen teilweise kompensiert<br />
werden. Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie einige<br />
Hausärzte der Region leisten ihren Dienst in der Notfallstation<br />
des Kinderspitals. Die Einrichtung einer kaderärztlichen telefonischen<br />
Beratungsstelle drängt sich auf.<br />
Personelle Veränderungen<br />
Lilo Enderli ist die neue Leiterin des Pflegediensts für stationäre<br />
Bereiche und Spezialgebiete. Ihr Vorgänger, Michael Döring, hat<br />
im Departement Pflege, Soziales neue Aufgaben übernommen.<br />
Departement Kinderspital<br />
Nach 21 Dienstjahren ist Marianne Maurer, Leiterin der Physiotherapie<br />
des Kinderspitals, in den Ruhestand getreten. Marianne<br />
Maurer hat das Team der ambulanten und stationären Physiotherapie<br />
mit ihrer Persönlichkeit geprägt und war verantwortlich<br />
für die hohe Qualität und grosse Zufriedenheit der Patienten und<br />
Eltern. Die Leitung des Kinderspitals dankt sowohl Marianne<br />
Maurer als auch Michael Döring herzlich für ihr grosses Engagement.<br />
47
48 Departement Kinderspital<br />
Blickpunkte<br />
Kinderspital<br />
Notfallstation im Wandel<br />
Im Jahr <strong>2009</strong> nahmen die Konsultationen<br />
auf der Notfallstation um 50 Prozent von<br />
8000 auf über 12 000 zu. Gleichzeitig stieg<br />
die Zahl der telefonischen Anfragen auf<br />
durchschnittlich 50 pro Tag, wobei viele<br />
dieser Anfragen keine Notfälle waren, sondern<br />
eine allgemein-pädiatrische Beratung<br />
umfassten. Entsprechend musste die<br />
Organisation der Notfallstation auf allen<br />
Ebenen – Ärzte und Pfl ege, Patientenablauf,<br />
Infrastruktur – rasch angepasst<br />
werden. Sabine Meier, Stationsleiterin der<br />
Notfallstation, hat in ihrer zukunftsweisenden<br />
Masterarbeit die «Grundlagen zur<br />
Umsetzung einer interdisziplinären Notfallstation»<br />
aufgezeigt. Durch die Einführung<br />
eines anerkannten Triagesystems<br />
werden Prioritäten in der Versorgung der<br />
Patientinnen und Patienten einfacher und<br />
für alle, nicht zuletzt auch für Eltern und<br />
Kinder, transparenter defi niert. Der Aufbau<br />
einer interdisziplinär geführten Notfallstation<br />
bedarf einer längeren Aufbauarbeit.<br />
Pädiatrische und kinderchirurgische Patientinnen<br />
und Patienten werden in diesem<br />
Modell von einem interprofessionellen<br />
Team betreut, das aus Mitarbeitenden der<br />
Pfl ege und einem ärztlichen Team besteht.<br />
Die Kinderspitalleitung hat die Verwirklichung<br />
in die strategischen Ziele aufgenommen.<br />
Kispi mit gutem Image<br />
Die beiden Leiter des Pfl egediensts, Beat<br />
Epp und Michael Döring, haben in einer<br />
gemeinsamen Masterarbeit das Image<br />
des Kinderspitals bei Patienteneltern, Politikern<br />
und Medien analysiert. Bei allen drei<br />
Gruppen zeigte sich, dass das Kinderspital<br />
über einen guten Ruf verfügt und die<br />
Akzeptanz seiner Leistungen hoch ist. Dies<br />
hat Auswirkungen auf die Attraktivität als<br />
Arbeitgeber, die Motivation der Angestellten<br />
und die Marktstellung des Betriebs.<br />
Die Notwendigkeit der Gesamtsanierung<br />
und Erweiterung des Kinderspitals wird<br />
generell anerkannt. Durch optimale Leistung<br />
und Ausstrahlung in die Bevölkerung<br />
und die Medien soll das Kinderspital seinen<br />
Ruf als patienten- und familienzentriertes<br />
Spital bestätigen und weiter ausbauen.<br />
Neue Behandlungen von<br />
Hautläsionen<br />
Die Behandlung von Hautläsionen ist nach<br />
wie vor im Fluss. Ständig werden noch<br />
neuere und noch bessere Therapiemöglichkeiten<br />
angeboten. Bis vor einem Jahr<br />
wurden alle Blutgeschwülste (Hämangiome)<br />
mit dem Laser behandelt. Inzwischen<br />
ist am Kinderspital Luzern mit sehr gutem<br />
Erfolg damit begonnen worden, die Hämangiome<br />
medikamentös mit einem Mittel,<br />
das an sich zur Blutdrucksenkung dient,<br />
zu therapieren. Bei einem beträchtlichen<br />
Teil der Patienten wird dadurch die chirurgische<br />
Therapie vermieden oder auf eine<br />
geringere Fläche reduziert. Bei Patienten<br />
mit Feuermalen (Naevi fl ammei) wirken<br />
diese Medikamente jedoch nicht. Bisher<br />
mussten sich diese Kinder zur Behandlung<br />
nach Zürich oder Lausanne begeben,<br />
da in Luzern die entsprechenden Geräte<br />
nicht zur Verfügung standen. Seit <strong>2009</strong><br />
verfügt das Kinderspital über eine impulsgesteuerte<br />
Lichtquelle, mit der Patienten<br />
mit Feuermalen, oberfl ächlichen Blutgeschwülsten<br />
oder anderen oberfl ächlichen<br />
Hautläsionen schmerzarm und oft ohne<br />
Allgemeinnarkose behandelt werden können.
Pädiatrische Klinik<br />
Forscherpreis für<br />
Kispi-Arzt<br />
Das vergangene Jahr brachte in allen Fachbereichen zahlreiche<br />
Neuerungen. Dr. Martin Stocker erhielt den Forscherpreis <strong>2009</strong><br />
der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie für die beste klinische<br />
Studie. Zudem beteiligt sich die Pädiatrische Klinik am<br />
zentralschweizerischen Adipositas-Gruppenprogramm «Hulahopp»<br />
für Kinder und Jugendliche.<br />
Pädiatrische Infektiologie<br />
In Zusammenarbeit mit dem Hygienebeauftragten des LUKS,<br />
Dr. Marco Rossi, und der pädiatrischen Infektiologie der Universitätskinderklinik<br />
Bern, Prof. Dr. Christoph Aebi, wurde unter der<br />
Leitung von Dr. Andreas Spaenhauer die interdisziplinäre Arbeitsgruppe<br />
«Pädiatrische Infektiologie» aufgebaut. Im Vordergrund<br />
stehen:<br />
1. die Erarbeitung von evidenzbasierten Richtlinien zu häufigen<br />
pädiatrischen Infektionen (z. B. Pleuropneumonie oder Osteomyelitis);<br />
2. die Umsetzung der aktiven und passiven Hygienemassnahmen<br />
im Zusammenhang mit saisonalen Epidemien (z. B. RSV, epidemische<br />
und pandemische Grippe);<br />
3. Massnahmen zur Verhinderung von nosokomialen Infektionen.<br />
Die Schweinegrippe (H1N1) erreichte auch das Kinderspital Luzern.<br />
Zum Glück war der Verlauf bei den meisten stationären<br />
Patienten relativ mild; nur zwei Patienten erlitten eine schwere<br />
bakterielle Komplikation respektive Superinfektion (Pleuropneumonie<br />
und Meningitis).<br />
Departement Kinderspital<br />
Onkologie und Hämatologie<br />
Das Ärzteteam konnte mit PD Dr. Johannes Rischewski verstärkt<br />
werden. Zusätzlich zur pädiatrischen Onkologie bei Kindern und<br />
Jugendlichen ist nun auch die pädiatrische Hämatologie abgedeckt.<br />
Zahlreiche pädiatrisch-onkologische Studienprotokolle<br />
fordern für den Einschluss von Patienten eine verstärkte Kaderpräsenz,<br />
was dank des zweiten Kaderarztes nun auch in Luzern<br />
möglich wurde.<br />
Adipositas-Gruppenprogramm «Hulahopp»<br />
In der Zentralschweiz konnte unter der Leitung von PD Dr. Dagmar<br />
L‘Allemand das schweizweit grösste Adipositas-Gruppenprogramm<br />
«Hulahopp» (Basic Training XL) gestartet werden. Die<br />
pädiatrische Tagesklinik ist federführend im Einbezug und den<br />
Vorabklärungen der übergewichtigen Jugendlichen.<br />
Aus-, Weiter- und Fortbildung<br />
Die jährliche Beurteilung der Weiterbildungsstätte Pädiatrie Luzern<br />
durch die Assistenzärztinnen und -ärzte ergab erneut ein<br />
sehr gutes, überdurchschnittliches Resultat. Es ist das Bestreben<br />
aller Kaderärzte, die hohe Qualität der Weiterbildung zu erhalten<br />
und weiterzuentwickeln. Folgende Neuerungen wurden eingeführt:<br />
Zwei Assistenzärzte pro Jahr können im Rahmen der Rotation<br />
eine sechsmonatige Praxisassistenz bei einem pädiatrischen<br />
Lehrpraktiker absolvieren. Zudem wird ein Gesprächsführungskurs<br />
angeboten: An zwei Halbtagen pro Jahr werden die Assistenzärzte<br />
in der verbalen und nonverbalen Kommunikation mit<br />
Patienten und Eltern geschult. Die Pädiatrische Klinik ist weiterhin<br />
akademisches Lehrspital für die Universitäten Zürich und<br />
Bern. Die Fortbildung für die niedergelassenen Kinder- und Hausärzte<br />
erfolgt wie immer in enger Absprache mit der Vereinigung<br />
der Zentralschweizer Kinderärzte.<br />
49
50 Departement Kinderspital<br />
Präsenz in Gremien und Auszeichnung<br />
Dr. Thomas Berger ist weiterhin Präsident der Schweizerischen<br />
Gesellschaft für Neonatologie und Mitglied des Senats der<br />
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften<br />
(SAMW). Dr. Martin Stocker, Oberarzt mbF der Neonatologie/<br />
Intensivstation, gewann anlässlich der Jahresversammlung der<br />
Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) den Forscher-<br />
preis <strong>2009</strong> für die beste klinische Studie.<br />
Kinderchirurgische Klinik<br />
Auf hohem Niveau<br />
Mehr ambulante Patienten<br />
Die Verlagerung vom stationären in den ambulanten Sektor und<br />
die Verkürzung der Hospitalisationsdauer haben auch dieses Jahr<br />
angehalten. Deswegen sind die Patientenzahlen im ambulanten<br />
Bereich absolut gestiegen und im stationären Bereich bei sinken-<br />
der Bettenbelegung etwa unverändert geblieben. Die Zahl der im<br />
Operationssaal in Narkose durchgeführten Eingriffe ist um rund<br />
10 Prozent auf 3337 Eingriffe gestiegen.<br />
Operationen bei Frühgeborenen am Herzen ...<br />
Während die «klassischen» angeborenen Fehlbildungen, die kurz<br />
nach der Geburt operativ korrigiert werden müssen, eher zurückgehen,<br />
nehmen die Eingriffe am Herzen und am Schädel zu. Seit<br />
<strong>2009</strong> führen Prof. Dr. René Prêtre, Chefarzt der Kinderherzchirurgie<br />
am Universitäts-Kinderspital Zürich, und sein Team bei sehr<br />
kleinen Frühgeborenen, die nicht transportfähig wären, dringende,<br />
aber unkomplizierte Eingriffe durch (Ductus Botalli-Verschluss).<br />
Da ist es eine grosse Hilfe, wenn der Herzchirurg nach<br />
Luzern kommt, den Eingriff auf der Intensivpflegestation durchführt<br />
und so dem Kind einen besseren Start ermöglicht.<br />
... und am Kopf<br />
Bei sehr kleinen Frühgeborenen kann es vorkommen, dass eine<br />
Blutung in das Hirnwassersystem auftritt. Früher hat man in diesen<br />
Fällen entweder im Bereich des Rückens oder direkt am<br />
Schädel den Hirnventrikel punktiert und die zu viel produzierte<br />
Flüssigkeit abgelassen. Diese Punktionen waren oft über mehrere<br />
Wochen fast täglich notwendig und belasteten die Patienten<br />
stark. Heute besteht die Möglichkeit, endoskopisch ins Ventrikelsystem<br />
zu gelangen, die blutige Flüssigkeit zu entfernen, die Ventrikel<br />
zu spülen und den Abfluss Richtung Rückenmarkkanal wieder<br />
zu öffnen. Am Ende des Eingriffs wird ein Katheter im<br />
Ventrikelsystem belassen, der mit einem Reservoir, das von aussen<br />
punktiert werden kann, verbunden ist. Bei einem Teil der Patienten<br />
löst diese Behandlung das Problem definitiv und weitere<br />
Massnahmen sind nicht notwendig. Bei anderen Kindern kommt<br />
es im Verlauf von Wochen erneut zu einer Vermehrung des Hirnwassers.<br />
Dann kann der bereits liegende Katheter mit einem Ventilsystem<br />
verbunden werden, mit dem die Flüssigkeit in die<br />
Bauchhöhle abgeleitet werden kann.<br />
Neuigkeiten aus der Kinderurologie<br />
Inzwischen hat die minimalinvasive Chirurgie auch in der Kinderurologie<br />
Einzug gehalten. An der Kinderchirurgischen Klinik hat
man sich bisher auf wenige Eingriffe mit klarer Indikation be-<br />
schränkt, da die deutlich verlängerte Eingriffszeit nach wie vor<br />
gegen einen allgemeinen Wechsel von der offenen Chirurgie zur<br />
minimalinvasiven Chirurgie spricht. Zudem sind die urologischen<br />
Patienten, die nicht operiert werden, häufiger als jene, die einer<br />
Operation zugeführt werden. Um bei der operativen und der<br />
nicht operativen Therapie eine Unité de Doctrine zu erreichen<br />
und Standards zu setzen, wurde zusammen mit der Pädiatrischen<br />
Klinik ein Uroboard eingerichtet, in dem sich regelmässig<br />
Kinderchirurgen und Pädiater treffen, um untereinander die<br />
Behandlung ihrer gemeinsamen Patienten abzustimmen und<br />
dadurch die Behandlungsqualität zu verbessern. Auch auf nationaler<br />
Ebene arbeiten die <strong>Luzerner</strong> Kinderurologen an der Verbesserung<br />
der Behandlungsqualität mit. <strong>2009</strong> wurde die Schweizerische<br />
Gesellschaft für Kinderurologie (SWISS-PU) gegründet, in<br />
der einige <strong>Luzerner</strong> Kinderchirurgen aktiv mitarbeiten. So hat<br />
Dr. Hans Walter Hacker, Oberarzt mbF, im Berichtsjahr für alle<br />
Schweizer Kliniken Behandlungsrichtlinien bei Ureterfehlbildungen<br />
erarbeitet.<br />
Erfolgreiche Inkontinenztherapie<br />
Für die Behandlung von Patientinnen und Patienten, die an Inkontinenz<br />
wegen einer Überaktivität des Blasenmuskels leiden,<br />
nicht selten verbunden mit dem sehr belastenden Einkoten, wurde<br />
aus der Schmerztherapie die transkutane Elektroneurostimulation<br />
(TENS) übernommen. Mit dem Gerät wird während einer<br />
Stunde pro Tag transkutan die den Blasennerven entsprechende<br />
Region am Rücken stimuliert. Mit dieser Therapie, unterstützt von<br />
aktiver und spezialisierter Physiotherapie, konnte innerhalb von<br />
vier Monaten bei allen Patienten ein ausgezeichneter Erfolg erzielt<br />
werden.<br />
Der Spezialist geht zum Kind<br />
Die Leitung der Kinderchirurgischen Klinik dankt allen Kolleginnen<br />
und Kollegen der Erwachsenendisziplinen, die im Kinderspital<br />
die Patienten mitbetreuen. Ohne ihre stete Bereitschaft, ihr<br />
Wissen und Können in den Dienst der Kinder zu stellen, wäre<br />
eine Kinderchirurgie auf hohem Niveau nicht denkbar. In diesem<br />
Zusammenhang ist es wichtig, dass das Prinzip «Der Spezialist<br />
geht zum Kind» weiterhin Gültigkeit hat.<br />
Departement Kinderspital<br />
51
Departement Institute<br />
53
54 Departement Institute<br />
Departementsleiterin<br />
Prof. Dr. Gabriela Pfyffer<br />
von Altishofen<br />
«Unsere Institute zeichnen<br />
sich durch erstklassige<br />
Fachkompetenz und technologische<br />
Führerschaft<br />
aus. Gepaart mit hoher<br />
Leistungs- und Innovationsbereitschaft<br />
unserer<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
sind dies ideale<br />
Voraussetzungen, tagtäglich<br />
hervorragende Serviceleistungen<br />
für unsere<br />
Patienten zu erbringen.»<br />
Prof. Dr. Gabriela Pfyffer von Altishofen<br />
Departementsleiterin<br />
Institutsleitungen<br />
Anästhesie, chirurg. Intensivstation,<br />
Rettungsmedizin,<br />
Schmerztherapie<br />
Prof. Dr. Christoph Konrad, Chefarzt (PiP)<br />
Paul Meier, Leiter Pflegedienst<br />
Radiologie<br />
Prof. Dr. Bernhard Allgayer, Chefarzt<br />
lic. oec. HSG Arnold Lorez,<br />
admin. Geschäftsführer<br />
Josef Rüwe, Leit. MTRA<br />
Radio-Onkologie<br />
Dr. Peter Thum, Chefarzt (PiP)<br />
Ulrike Dechantsreiter, Leit. MTRA<br />
Pathologie<br />
Prof. Dr. Joachim Diebold, Chefarzt (PiP)<br />
Dr. Walter Arnold<br />
Apotheke<br />
Dr. Xaver Schorno, Chefapotheker (PiP)<br />
Gundy Kähny, Stv. Chefapothekerin<br />
Zentrum für LaborMedizin (ZLM)<br />
Dr. Hans Peter Köchli, Chefarzt (PiP)<br />
Prof. Dr. Gabriela Pfyffer von Altishofen,<br />
Chefmikrobiologin<br />
Chemisches Zentrallabor (CZL)<br />
Dr. Hans Peter Köchli, Chefarzt<br />
Stefania Porcaro, Leit. BMA<br />
Institut für Medizinische<br />
Mikrobiologie (IMM)<br />
Prof. Dr. Gabriela Pfyffer von Altishofen,<br />
Chefmikrobiologin<br />
Sacha Thiermann, Leit. BMA<br />
Hämatologisches Zentrallabor (HZL)<br />
Prof. Dr. Dr. Walter Wuillemin,<br />
Silvio Kathriner, Leit. BMA<br />
Labor Kinderspital (LKI)<br />
Dr. Hans Peter Köchli, Chefarzt<br />
Prof. Dr. Gregor Schubiger,<br />
Departementsleiter Kinderspital<br />
Susanne Rieser, Leit. BMA<br />
Labor Departement Sursee (LDS)<br />
Dr. Hans Peter Köchli, Chefarzt<br />
Prof. Dr. Adrian Schmassmann, Chefarzt<br />
Jolanda Pelloli, Leit. BMA<br />
Labor Departement Wolhusen<br />
(LDW)<br />
Dr. Hans Peter Köchli, Chefarzt<br />
Dr. Martin Peter, Chefarzt<br />
Sabina Näf, Leit. BMA<br />
Leitendes Personal<br />
Anästhesie, chirurg. Intensivstation,<br />
Rettungsmedizin,<br />
Schmerztherapie<br />
Dr. Peter Christen, Co-Chefarzt<br />
PD Dr. Christoph Haberthür<br />
Dr. Martin Jöhr, Co-Chefarzt<br />
Dr. Sibylle Ruesch<br />
PhD Dr. Guido Schüpfer, Co-Chefarzt<br />
Radiologie<br />
Dr. Christian Blumer, Co-Chefarzt<br />
Dr. Jürg Caduff<br />
Dr. Daniel Dreier<br />
Dr. Bernhard Hofer<br />
Dr. Thomas Joder<br />
Dr. Manfred Kessler<br />
Dr. Claudia Kurtz<br />
Dr. Stefan Lehnhardt<br />
Dr. Klaus Strobel<br />
Dr. Stefan Stronsky<br />
Dr. Thomas Treumann, Co-Chefarzt<br />
Radio-Onkologie<br />
Dr. Timothy Collen<br />
Dipl. phys. ETH Regina Seiler,<br />
Leit. Physikerin<br />
Pathologie<br />
Dr. Walter Arnold<br />
Dr. Béatrice Wagner<br />
Dr. Hans-Ruedi Zenklusen<br />
Dr. Christian Bussmann<br />
Zentrum für LaborMedizin (ZLM)<br />
Dr. Brigitte Walz (CZL)<br />
Dr. Frantiska Palicova (IMM)
Radiologie<br />
SPECT/CT:<br />
Bessere Resultate<br />
In der Nuklearmedizin wurden modernste Geräte mit SPECT/CT<br />
in Betrieb genommen. Sie bringen klare Vorteile.<br />
Noch präzisere Erfassung<br />
Im Dezember wurden die alten Gammakameras der Nuklearmedizin<br />
durch moderne Geräte mit SPECT/CT (single photon emission<br />
tomography/computed tomography) ersetzt. Die Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie<br />
ist ein diagnostisches<br />
Verfahren zur Herstellung von Schnittbildern lebender Organismen.<br />
Auf diese Weise kann die Funktion verschiedener Organe<br />
beurteilt werden. SPECT/CT kombiniert die funktionelle und die<br />
morphologische Bildgebung in einem Gerät. Man erreicht dadurch<br />
eine noch empfindlichere und präzisere Erfassung von Pathologien<br />
im Rahmen von Skelettszintigraphien, Sentinel-Node-<br />
Darstellungen und vielen anderen nuklearmedizinischen<br />
Untersuchungen bei orthopädischen, traumatologischen, endokrinologischen<br />
und onkologischen Erkrankungen.<br />
Genauere Aussagen<br />
Durch die Kombination der szintigraphischen Information mit der<br />
Computertomographie (CT) kann man Anreicherungen besser lokalisieren<br />
und genauere Aussagen machen. Die Bilder können<br />
als Schnittbilder in allen Raumebenen rekonstruiert werden. Die<br />
Untersuchung mit SPECT/CT dauert etwa 15 Minuten länger als<br />
die herkömmliche Szintigraphie. Die CT wird in der Low-Dose-<br />
Technik durchgeführt, sodass sich die zusätzliche Strahlenbelastung<br />
für den Patienten in einem vertretbaren Rahmen hält. Seit<br />
der Installation des neuen SPECT/CTs wurden bis heute bereits<br />
mehr als 70 Untersuchungen durchgeführt.<br />
Departement Institute<br />
Radio-Onkologie<br />
RapidArc-Bestrahlungstechnik<br />
Am 18. Mai <strong>2009</strong> wurde in der Radio-Onkologie der erste Patient<br />
mit der neuen RapidArc-Technik bestrahlt. Luzern ist damit die<br />
vierte Klinik in der Schweiz, in der diese Technik zum Einsatz<br />
kommt.<br />
Dynamische Therapie<br />
Bei der Einführung dieses neuen Bestrahlungsverfahrens war vor<br />
allem die Gruppe der Medizinphysiker gefordert, muss doch<br />
gewährleistet werden, dass diese neue, dynamische Therapie<br />
sicher appliziert werden kann. Im Gegensatz zur routinemässig<br />
durchgeführten IMRT-Technik (intensitätsmodulierte Radiotherapie),<br />
respektive der technisch analogen Bestrahlung mit dem<br />
elektronischen Kompensator bei Brusttumoren, bei der einzelne<br />
Stehfelder mit wechselnden Blendenöffnungen hintereinander<br />
abgestrahlt werden (Summation von einzelnen modulierten Stehfeldern),<br />
erfolgt bei der RapidArc-Technik die Bestrahlung fliessend,<br />
indem der Strahlerkopf in einem bis mehreren Bogen um<br />
den Patienten rotiert, gleichzeitig sich die Blende öffnet und<br />
schliesst und auch die Dosisleistung sowie die Rotationsgeschwindigkeit<br />
angepasst werden.<br />
Kürzere Bestrahlungszeit<br />
Bei vergleichbarer Dosisverteilung im Zielvolumen kann mit dieser<br />
neuen Bestrahlungstechnik oft gesundes, sensibles Gewebe<br />
besser geschont werden. Als zusätzlicher Vorteil ist die tägliche<br />
Bestrahlungszeit bis um den Faktor 8 kürzer, der Patient muss<br />
also deutlich weniger lang ruhig auf dem Bestrahlungstisch liegen.<br />
Bedingung für diese umschriebene Dosisapplikation ist,<br />
dass die Positionierung des Patienten vor jeder einzelnen Therapiesitzung<br />
mittels kV- und MV-Aufnahme mit dem On-Board-<br />
Imager (OBI) kontrolliert wird. Diese neue Kontroll- und Applikationstechnik<br />
heisst IGRT (Image-Guided Radiotherapy).<br />
Win-win-Situation<br />
Bis Ende <strong>2009</strong> wurden insgesamt 87 Patientinnen und Patienten<br />
mit der RapidArc-Technik bestrahlt. Patienten mit Prostatatumoren,<br />
aber auch mit Tumoren des Enddarms sowie Patientinnen<br />
mit Karzinomen des weiblichen Genitaltrakts profitieren von dieser<br />
neuen Behandlungsmodalität. Es ist geplant, im Jahr 2010<br />
Patienten mit Tumoren im Zentralnervensystem oder im Nasen-/<br />
Rachenraum anstatt der planerisch aufwendigeren IMRT-Bestrahlung<br />
einer RapidArc-Therapie zuzuführen. Der Gewinn für<br />
die Patienten ist eindeutig: kürzere Bestrahlungszeit mit meist<br />
55<br />
kV- und MV-Aufnahme (k kleingeschrieben)?
56 Departement Institute<br />
Blickpunkte<br />
Zentrum für LaborMedizin (ZLM)<br />
Erfolgreiche Akkreditierung<br />
Die Akkreditierung des ZLM nach EN<br />
17025 wurde nach der erfolgreichen Über-<br />
wachung am 14. September <strong>2009</strong> durch<br />
die Schweizerische Akkreditierungsstelle<br />
bestätigt.<br />
Dr. med. et dipl. biochem. Gert Print-<br />
zen wurde per 1.4.2010 als Leitender Arzt<br />
für das Chemische Zentrallabor gewählt.<br />
Er wird den bisherigen Chefarzt Dr. med.<br />
Hans Peter Köchli ersetzen, der zu diesem<br />
Zeitpunkt in Pension geht.<br />
Chemisches Zentrallabor (CZL)<br />
Räumliche Anpassungen<br />
Ein wichtiges diagnostisches Verfahren in<br />
der molekularen Diagnostik ist der Nachweis<br />
von Mutationen im genetischen Material<br />
mittels der Polymerase-Ketten-Reaktion<br />
(Polymerase Chain Reaction, PCR).<br />
Da diese Methode auf geringste Kontaminationen<br />
empfi ndlich ist, sind entsprechende<br />
bauliche Massnahmen durchgeführt<br />
worden, sodass die einzelnen<br />
Schritte in der Analytik auf verschiedene<br />
Räume aufgeteilt sind.<br />
Neuer Immunologie-Analyzer<br />
Mit dem Immunologie-Analyzer Phadia<br />
250 steht neu ein Gerät zur Verfügung, das<br />
vor allem in der Diagnostik von rheumatologischen<br />
und Autoimmunerkrankungen<br />
wertvolle Grundlagen liefert.<br />
Präanalytik-Modul erhöht<br />
E f fi z i e n z<br />
Die Konsolidierung der Routinediagnostik<br />
ist weiter fortgeschritten, sodass anfangs<br />
2010 ein Präanalytik-Modul in Betrieb genommen<br />
werden kann. Dies gewährleistet<br />
eine ökonomische und rationelle Ausnutzung<br />
der grossen Analysengeräte.<br />
Hämatologisches Zentrallabor (HZL)<br />
Umbau abgeschlossen<br />
Sämtliche Räume des HZL wurden umgebaut<br />
und die Technik angepasst. Das ganze<br />
Team war gefordert und hat einen grossen<br />
Einsatz gezeigt. Kein Gerät steht mehr<br />
da, wo es vor dem Umbau war. Ohne Einschränkung<br />
konnte das ganze Analysenspektrum<br />
während des Umbaus angeboten<br />
werden.<br />
Moderne Analysenstrasse<br />
Die Automatisation im HZL ist weiter auf<br />
dem Vormarsch. Durch den Umbau konnten<br />
nicht nur Abläufe optimiert werden,<br />
sondern auch eine moderne Analysenstrasse<br />
zur Bestimmung der Blutzellen in<br />
Betrieb genommen werden. Blutausstriche<br />
werden neu automatisch hergestellt<br />
und gefärbt. Mit diesem System der<br />
neues ten Generation können auch diverse<br />
Körperfl üssigkeiten, wie zum Beispiel<br />
Hirnfl üssigkeit und Gelenksfl üssigkeit,<br />
analysiert werden. Damit werden im Vergleich<br />
zur früheren Methodik eine höhere<br />
Sensitivität sowie eine bessere Vergleichbarkeit<br />
der Resultate erzielt.<br />
Personelles<br />
Nach fast 30 Jahren als Leitender Biomedizinischer<br />
Analytiker hat Markus Tschopp<br />
im letzten Sommer eine neue Herausforderung<br />
angenommen und sich selbstständig<br />
gemacht.<br />
Labor Kinderspital (LKI)<br />
Deutliche Auftragssteigerung<br />
Die Inbetriebnahme des «24 Notfall» im<br />
Spitalzentrum Luzern hat den Notfall für<br />
Kinder stärker in den Fokus der Patienten<br />
gerückt. So wird der Notfall im Kinderspital<br />
deutlich mehr frequentiert. Aber auch<br />
die Zunahme an Fällen in der Tagesklinik<br />
und die Eröffnung der IMC (Intermediate<br />
Care) in der Neuen Frauenklinik führten zu<br />
einer Auftragssteigerung.<br />
Laboranalytik und Funktionsdiagnostik<br />
Die Biomedizinischen Analytikerinnen des<br />
LKI führen neben der Laboranalytik und<br />
den kapillär verordneten Blutentnahmen<br />
auch die Funktionsdiagnostik wie EKG, Belastungs-EKG,<br />
Lungenfunktionen, NO-Messungen<br />
und Schweissteste durch. In der<br />
Schweissanalytik (Verdacht auf Zystische<br />
Fibrose, CF) wird nach den Empfehlungen<br />
der «New Guidelines for the Diagnosis of<br />
CF in Newborns Through Older Adults –<br />
CFF Consensus Report» gearbeitet. Bei<br />
grenzwertigem Ergebnis der Spannungsmessung<br />
erfolgt eine zweite Schweisssammlung<br />
mit anschliessender Bestimmung<br />
des Chlorids. Da hierfür nur kleine<br />
Schweissmengen zur Verfügung stehen,<br />
wurde <strong>2009</strong> ein Chloridmeter zur coulometrischen<br />
Impulstitration des Chlorids<br />
eingeführt.
Labor Departement Sursee (LDS)<br />
Optimierte Diagnostik<br />
Im LDS konnte ein Hämatologieanalyzer<br />
der neuesten Generation in Betrieb genommen<br />
werden. Dieser Fluoreszenz-<br />
Durchfl usszytometer verfügt, nebst den<br />
bisherigen Parametern, über einen zusätzlichen<br />
Kanal für die Analyse von Körperfl<br />
üssigkeiten. Durch die automatisierte<br />
Messung der Zellen in Liquor, Synovia,<br />
Pleura-, Aszitesfl üssigkeit und Dialysaten<br />
ist es gelungen, die Diagnostik zur effi zienten<br />
Behandlung der Patienten zu optimieren.<br />
Labor Departement Wolhusen (LDW)<br />
Neue Tests<br />
Das Labor am Standort Wolhusen ist wieder<br />
eigenständig. Im Frühling wurden auf<br />
dem Immunologieanalyzer cobas e 411<br />
die Schilddrüsenhormone und Vitamin<br />
B12 / Folsäure eingeführt. Ebenso wurde<br />
der bisher verwendete semiquantitative<br />
Procalcitonin-Test durch den quantitativen<br />
Test abgelöst (cobas e 411). Die quantitative<br />
Bestimmung von Procalcitonin<br />
dient zur Unterscheidung von bakteriellen<br />
und viralen Infekten. Mithilfe dieser Untersuchung<br />
können Antibiotika gezielter eingesetzt<br />
und deren Verbrauch gesenkt werden.<br />
Blutgasanalyzer für<br />
Intensivstation<br />
Die Intensivstation erhält im 1. Quartal<br />
2010 einen eigenen Blutgasanalyzer. Dadurch<br />
soll auch die Anzahl der Einsätze<br />
während des Pikettdiensts in der Nacht<br />
gesenkt werden.<br />
Departement Institute<br />
besser umschriebener Dosisapplikation, Reduktion der täglichen<br />
Umtriebe durch Verkürzung der Therapiezeit sowie insbesondere<br />
auch Abnahme der akuten und späten Toxizität. Parallel dazu<br />
kommt der Gewinn für die Klinik: kürzere Planungszeit und kürzere<br />
Belegzeit der Beschleuniger. Die Vorteile für Patienten und<br />
Klinik ergeben eine Win-win-Situation.<br />
Apotheke<br />
Spezialmedikamente<br />
aus Luzern<br />
Der Bedarf an spezifi schen Arzneimitteln nimmt zu. Die Apotheke<br />
des LUKS stellt als einzige Institution in der Zentralschweiz<br />
Sondermedikamente für Spitäler her.<br />
Zusammenarbeit mit SPZ Nottwil<br />
Seit März <strong>2009</strong> besteht auch im Bereich der Apotheken eine vertraglich<br />
geregelte Zusammenarbeit zwischen dem LUKS und dem<br />
Schweizerischen Paraplegiker-Zentrum (SPZ) Nottwil. Die Leitung<br />
der Spitalapotheke LUKS übernimmt die fachliche Betreuung der<br />
Spitalapotheke des SPZ. Zu diesem Zweck arbeitet ein neu eingestellter<br />
Apotheker aus dem Team der <strong>Luzerner</strong> Spitalapotheke<br />
während drei Tagen in Nottwil und erbringt an Ort und Stelle die<br />
gewünschten pharmazeutischen Dienstleistungen. Da die <strong>Luzerner</strong><br />
Spitalapotheke als einzige Institution der ganzen Zentralschweiz<br />
über die notwendige behördliche Bewilligung zur Herstellung<br />
von Arzneimitteln für den Spitalbedarf verfügt, konnte<br />
das LUKS die qualitätsgesicherte Produktion der zahlreichen<br />
Spezialmedikamente (Eigenprodukte) des SPZ übernehmen.<br />
Durch die enge Zusammenarbeit der beiden Institutionen im<br />
Apothekengeschäft konnten zudem in der Ökonomie des Arzneimitteleinkaufs<br />
Verbesserungen realisiert werden.<br />
57
58<br />
Departement Institute<br />
Immer mehr Sonderanfertigungen<br />
Die zunehmende Spezialisierung in den Zentrumsspitälern wi-<br />
derspiegelt sich auch in der deutlichen Bedarfszunahme an spe-<br />
zifischen Arzneimitteln für einzelne Patientengruppen und für<br />
individuelle Patienten. Die Spitalapotheke des LUKS stellte im Be-<br />
richtsjahr für 4 Millionen Franken Sonderarzneimittel her, so zum<br />
Beispiel rund 100 000 Kapseln (132 verschiedene Produkte), ins-<br />
besondere für das Kinderspital, da die Pharma-Industrie für viele<br />
handelsübliche Medikamente keine Kinderdosierungen anbietet.<br />
Auch für den Pain-Dienst der Anästhesie werden immer häufiger<br />
individuell dosierbare Schmerzmittel-Cocktails hergestellt. Wei-<br />
tere Abnehmer für Spezialanfertigungen sind neben der Onkolo-<br />
gie mit ihren Zytostatika die Augenklinik mit Spezialaugentropfen,<br />
die Dermatologie mit diversen Salben und Lotionen und die<br />
Hals-Nasen-Ohren-Klinik mit verschiedensten Rezepturen.<br />
Institut für Anästhesie, chirurgische<br />
Intensivmedizin, Rettungsmedizin<br />
und Schmerztherapie (IFAIRS)<br />
Rettungsdienst/<br />
Sanitätsnotruf 144<br />
Kompetente Hilfe rasch vor Ort<br />
Der Notfallpatient steht im Mittelpunkt des Rettungsdiensts. Die<br />
kontinuierliche personelle und betriebliche Weiterentwicklung<br />
stärkt die Kernkompetenzen Professionalität, Qualität und Sicherheit.<br />
Grösster Zentralschweizer Rettungsdienst<br />
Der Rettungsdienst des LUKS ist der grösste Zentralschweizer<br />
Rettungsdienst. Er versorgt mit seinen drei Rettungsdienststandorten<br />
Luzern, Sursee und Wolhusen – mit Ausnahme des Seetals<br />
und der Region Küssnacht am Rigi – den ganzen Kanton Luzern<br />
mit rund 340 000 Einwohnern. Zudem koordiniert die dem Rettungsdienst<br />
LUKS zugehörige Sanitätsnotrufzentrale 144 Zentralschweiz<br />
die Rettungsdienste der Kantone Uri, Zug, Nidwalden,<br />
Obwalden, Luzern und des Bezirks Küssnacht am Rigi mit insgesamt<br />
rund 570 000 Einwohnern und betreut die interkantonale<br />
Notfallarztvermittlung (041 205 14 14), wo im vergangenen Jahr<br />
über 32 000 Anrufe eingegangen sind.<br />
Geographisches Informationssystem (GIS)<br />
Seit Oktober <strong>2009</strong> ist auf der Sanitätsnotrufzentrale 144 Zentralschweiz<br />
ein neues Geographisches Informationssystem (GIS)<br />
aufgeschaltet. Geht ein Anruf über das Festnetz ein, werden der<br />
Telefonnummer im System eine Adresse und eine Landeskoordinate<br />
zugewiesen. Sogleich zoomt der Bildschirm auf den entsprechenden<br />
Ausschnitt im interaktiven Kartenfenster, wo sich<br />
das Ereignis zugetragen hat. Nun können blitzschnell weitere<br />
Rauminformationen abgefragt werden: Wo befinden sich Rettungsfahrzeuge,<br />
welches ist ihr Zielort? Die mit GPRS (General<br />
Packet Radio Service) ausgerüsteten Fahrzeuge senden an die<br />
Einsatzleitzentralen ihren aktuellen Standort und sind im Kartenfenster<br />
mit Einsatzstatus eingeblendet. Viele weitere Geoinformationen<br />
wie spezielle Objekte, Rettungsdienstregionen und Autobahnabschnitte<br />
sind am Bildschirm sichtbar und können<br />
abgefragt werden. Das Zusammenspiel von Geodaten, GIS-Komponente<br />
und Einsatzleitdatenbanksystem ist von der Technologie,<br />
den Schnittstellen und der Organisation her sehr komplex.<br />
Einheitlicher Rettungstransportwagen (RTW)<br />
Im Rahmen der Zusammenführung und Harmonisierung der drei<br />
Rettungsdienststandorte wurde in einer Projektgruppe der erste<br />
gemeinsame RTW entworfen und hergestellt. Am 8. Juni <strong>2009</strong> erfolgte<br />
die offizielle Einweihung der neuen Ambulanz in Sursee.<br />
Ein gemeinsamer, einheitlicher Fahrzeugpark ist eine wichtige<br />
Voraussetzung für den standortübergreifenden Einsatz sowohl<br />
des Personals als auch der Fahrzeuge.<br />
Einführung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)<br />
Am 12. März <strong>2009</strong> wurde das erste NEF am Standort Luzern offiziell<br />
in Betrieb genommen. Der Notarzt wird bei rettungsdienstlichen<br />
Einsätzen mit vitaler Bedrohung im Rendez-vous-System<br />
an den Einsatzort gebracht. Dies ermöglicht den flexiblen Einsatz<br />
der rettungsdienstlichen Einsatzkräfte. Der Notarzt wird unabhängig<br />
vom Rettungswagen zum Patienten gebracht und kann<br />
damit auch jederzeit umdisponiert werden. Die Besatzung des<br />
NEF, bestehend aus einem diplomierten Rettungssanitäter HF<br />
und einem Notarzt, kann bei Engpässen als First-Responder-<br />
Team oder als Kompaktteam genutzt werden. Zudem vergrössert<br />
das NEF den Einsatzradius des Notarztes.<br />
Kooperation mit der REGA<br />
Das IFAIRS arbeitet eng mit der REGA zusammen. Im Rettungsdienst<br />
LUKS Luzern konnte im Jahr <strong>2009</strong> erneut ein REGA-<br />
Mitarbeiter seine dreijährige Ausbildung zum diplomierten Rettungssanitäter<br />
HF beginnen. Dies als Ergänzung zu den vier<br />
Mitarbeitern, die im Rettungsdienst LUKS im Sommer <strong>2009</strong> ebenfalls<br />
ihre Grundausbildung angefangen haben.<br />
Reanimationsregister: Utstein-Style<br />
Seit dem 1. Januar <strong>2009</strong> werden alle durch den Rettungsdienst<br />
LUKS durchgeführten Reanimationen auf Basis des Utstein-Re-
animationsregisters in Zusammenarbeit mit dem SRC (Swiss Re-<br />
suscitation Council) erfasst und ausgewertet. Die Auswertung<br />
liefert neben der betriebsinternen Analyse der Reanimationsdaten<br />
(Herzrhythmus bei Eintreffen RD, Therapie durch RD, Anzahl<br />
primär erfolgreicher Reanimationen etc.) einen gesamtschweizerischen<br />
Vergleich mit den daran angeschlossenen Rettungsdiensten.<br />
Im untersuchten Zeitraum (1.1. 2005 bis 31.12. <strong>2009</strong>)<br />
wurden insgesamt 228 Reanimationen präklinisch durchgeführt.<br />
In 87 Fällen (38 Prozent) konnte vor Ort erfolgreich ein Kreislauf<br />
wiederhergestellt werden, sodass der Patient zur weiteren<br />
Therapie ins Spital eingewiesen wurde. 80 Patienten überlebten<br />
den ersten Spitaltag, und 31 Patienten (14 Prozent) verliessen das<br />
Spital.<br />
Erste First-Responder-Gruppe<br />
Seit dem 1. September <strong>2009</strong> ist die AED-First-Responder-Gruppe<br />
Lungern (AED = automatischer externer Defibrillator) als erste<br />
Zentralschweizer First-Responder-Gruppe an die Sanitätsnotrufzentrale<br />
144 angeschlossen. In Lungern werden die First-<br />
Responder parallel zum Rettungsdienst alarmiert. Sie leisten primäre<br />
lebensrettende Sofortmassnahmen und setzen wenn<br />
erforderlich ein AED-Gerät ein. Besonders beim Herz-Kreislauf-<br />
Stillstand kommt es auf jede Minute an. Je früher die Betroffenen<br />
die richtige Hilfe erhalten, desto höher und besser sind ihre Überlebenschancen.<br />
Institut für Medizinische Mikrobiologie (IMM)<br />
Gefährliche Keime<br />
im Spital?<br />
Die Patientinnen und Patienten sind am LUKS in guten Händen –<br />
dank Forschung und vorbildlicher Zusammenarbeit zwischen<br />
Mikrobiologie und Infektiologie/Spitalhygiene.<br />
Erfolgreiches MRSA-Forschungsprojekt<br />
Im Berichtsjahr kam ein von der Bonizzi-Theler Stiftung (Zürich)<br />
finanziertes Forschungsprojekt zum erfolgreichen Abschluss, das<br />
sich auf das Auftreten von Methicillin-resistenten Staphylococ-<br />
cus aureus (MRSA) konzentrierte und vom Institut für Medizini-<br />
sche Mikrobiologie (Zentrum für LaborMedizin, ZLM) und mit<br />
Unterstützung der Infektiologie/Spitalhygiene des LUKS bearbeitet<br />
wurde.<br />
Problem in vielen Spitälern<br />
1941 wurde in London ein erster Patient mit Penicillin behandelt,<br />
Departement Institute<br />
in der Folge erhielten viele Opfer des 2. Weltkriegs dieses neue<br />
Wundermittel gegen Wundinfektionen. Bereits in den Fünfzigerjahren<br />
tauchte eine Penicillin-Resistenz bei Staphylokokken auf.<br />
1961 wurde der erste MRSA-Stamm, das heisst ein S. aureus, der<br />
gegen Penicillin und penicillinasefeste Penicilline (Methicillin) resistent<br />
war, nachgewiesen. Diese Bakterien wurden mittlerweile<br />
zu einem Problem in den Spitälern der ganzen Welt, obwohl versucht<br />
wird, mit Isolierungsmassnahmen und sinnvollem Antibiotika-Einsatz<br />
die MRSA-Epidemie zu bremsen. Während es in einzelnen<br />
Ländern, zum Beispiel in Holland und Skandinavien,<br />
gelungen ist, die Ausbreitung der MRSA in Schach zu halten, hat<br />
sich der Keim in anderen Ländern, vor allem in den USA und in<br />
Japan, geradezu unkontrolliert ausgebreitet (über 50 Prozent der<br />
Spitalinfektionen mit S. aureus sind MRSA!). Zu diesem Szenario<br />
hat nicht zuletzt der Fortschritt in der Medizin beigetragen: Immer<br />
mehr schwer kranke und immunkompromittierte Patienten<br />
werden behandelt, und immer häufiger kommen Fremdkörper<br />
wie Katheter und Implantate zum Einsatz. Glücklicherweise weist<br />
die Schweiz noch immer eine niedrige MRSA-Rate auf. Mit Ausnahme<br />
von Genf (über 20 Prozent) beträgt sie, je nach Region,<br />
zwischen Null und 6 Prozent aller nachgewiesenen Staphylococcus<br />
aureus Isolate.<br />
59
60<br />
Departement Institute<br />
Risiko für Spitalpatienten<br />
Normalerweise sind 20 bis 40 Prozent der Bevölkerung mit Staphylokokken<br />
besiedelt, zum Glück nur ein kleiner Teil davon mit<br />
MRSA. Von dieser an sich harmlosen Besiedelung ausgehend<br />
kann es zu klinisch manifesten Infektionen kommen. Ein grösseres<br />
Risiko tragen Spitalpatienten: Nach einer Besiedelung kommt<br />
es bei 10 bis 20 Prozent der Patienten zu einer klinisch manifesten<br />
Infektion. Neben Haut- und Weichteilinfektionen (Furunkel,<br />
Wundinfektionen) treten auch Pneumonien, Osteomyelitiden und<br />
Arthritiden (also Lungen-, Knochen- und Gelenksentzündungen)<br />
auf. Lebensgefährlich sind die Staphylokokken-Sepsis (Blutvergiftung)<br />
und das «Toxic Shock Syndrom».<br />
Wirtschaftliche Konsequenzen<br />
Im Spital werden die Keime durch direkten oder indirekten Kontakt<br />
übertragen. MRSA-besiedelte und -infizierte Patienten müssen<br />
im Spital in Einzelzimmern isoliert werden, zur Behandlung<br />
einer MRSA-Infektion braucht es teurere Reservemedikamente.<br />
Dies führt zu deutlich erhöhten Kosten für das Spital respektive<br />
für die Krankenkassen. Gerade im Hinblick auf die Spitalfinanzierung<br />
mittels DRG (Diagnosis related groups) können sich diese<br />
Spitalinfektionen auch wirtschaftlich erheblich zulasten des Spitals<br />
auswirken.<br />
Ausbreitung auch ausserhalb der Spitäler<br />
Bis vor wenigen Jahren kannte man die MRSA nur als Spitalproblem.<br />
1997 wurden jedoch Berichte publiziert über tödlich verlaufene<br />
MRSA-Infektionen bei Kindern ohne vorherigen Spitalkontakt.<br />
Mittlerweile hat sich gezeigt, dass es neben der Epidemie<br />
mit Spital-MRSA (health care-associated MRSA) auch eine parallele<br />
Ausbreitung von ambulant erworbenen MRSA (communityacquired<br />
MRSA) gibt. Diese Keime sind im Gegensatz zu den Spital-MRSA<br />
meist nicht multiresistent, sondern «nur» resistent<br />
gegen sämtliche Penicilline und Cephalosporine. Etliche dieser<br />
MRSA-Stämme tragen zudem ein spezielles Gen, das sogenann-<br />
te PVL(Panton-Valentine-Leucocidin)-Gen. Solche Stämme ver-<br />
mögen die Leukozyten (weisse Blutkörperchen) des Patienten<br />
auszuschalten und verursachen ausgedehnte und/oder wieder-<br />
holte Hautinfektionen (Furunkulosen). Besiedelte Patienten kön-<br />
nen von diesem Trägertum befreit werden, so zum Beispiel durch<br />
koordinierte Dekolonisierungsmassnahmen mit Nasensalbe, Kör-<br />
per- und Haarshampoo. Voraussetzung für diese epidemiologisch<br />
wichtige Massnahme ist selbstverständlich die Kenntnis um das<br />
Trägertum.<br />
Schnellere Diagnosen<br />
Die Labordiagnostik der MRSA-Keime wurde in den letzten Jahren<br />
entscheidend verbessert. Im Diagnostiklabor weist man die<br />
MRSA mit konventionellen Kulturverfahren nach. Seit bereits einigen<br />
Jahren bietet das Institut für Medizinische Mikrobiologie<br />
(IMM) für alle auf MRSA zu untersuchenden Abstriche ein PCR<br />
(Polymerase-Kettenreaktion)-Verfahren an, mit dem die Diagnose<br />
eines MRSA nur noch wenige Stunden in Anspruch nimmt.<br />
Lücken in der Spitalhygiene erkennen<br />
Die im IMM durchgeführte Forschungsarbeit, die demnächst in<br />
einer renommierten amerikanischen Fachzeitschrift erscheint,<br />
hatte sämtliche in den letzten zwei Jahren am LUKS isolierten<br />
MRSA-Stämme mittels der Technik der Pulsfeld-Gelelektrophorese<br />
molekulargenetisch typisiert. Dies erlaubte festzustellen, ob<br />
es sich um genetisch identische MRSA-Stämme (Klon) oder um<br />
unterschiedliche MRSA-Stämme (kein Klon) handelt. Das Wissen<br />
um die Klonalität respektive die Nicht-Klonalität ist insbesondere<br />
für den Infektiologen und die Spitalhygiene bedeutsam, weisen<br />
doch klonale Stämme auf eine Keimverschleppung innerhalb des<br />
Spitals und damit auf Lücken in der Spitalhygiene hin. Eine Multiplex-PCR<br />
gab ferner Aufschluss, ob es sich bei diesen untersuchten<br />
MRSA um im Spital zirkulierende Spitalkeime handelt<br />
oder ob sie von aussen eingeschleppt worden sind.<br />
Nur 13 Prozent klassische Spitalkeime<br />
Die Untersuchung der Gen-Kassette für die Resistenzgene erlaubt<br />
die Unterteilung der MRSA in fünf Gruppen. Im Gegensatz<br />
zu vielen anderen Studien waren nur 13 Prozent der am LUKS<br />
isolierten MRSA-Stämme klassische Spitalkeime mit SCCmec Typ<br />
I und II Genkassetten. 87 Prozent trugen die Kassetten IV und V<br />
und entsprechen ursprünglich «ambulant» erworbenen Keimen<br />
(community-acquired MRSA). Interessant ist ferner, dass 28 Prozent<br />
der analysierten MRSA-Stämme das PVL-Gen tragen.<br />
Vorbildliche Hygienemassnahmen am LUKS<br />
In einem zweiten Teil des Projekts konzentrierte man sich auf die<br />
Frage, ob mit einem noch grösseren spitalhygienischen Aufwand
mehr MRSA-Patienten erfasst und die Rate der im Spital auftretenden<br />
MRSA-Infektionen weiter vermindert werden kann. Das<br />
Ergebnis war für das LUKS sehr erfreulich: Von fast 300 möglichen<br />
Kontakten für MRSA-Trägertum konnte trotz aufwendigsten<br />
spitalhygienischen Massnahmen (erweitertes Kontakt-Screening)<br />
lediglich ein einziger zusätzlicher MRSA-Träger eruiert werden.<br />
Dies bedeutet, dass die gegenwärtig am ganzen LUKS praktizierten<br />
Hygienemassnahmen vorbildlich sind und keine zusätzlichen<br />
Vorkehrungen zur Eindämmung dieser Keime getroffen werden<br />
müssen.<br />
Pathologie<br />
Zentralschweizer<br />
Krebsregister<br />
Ein Krebsregister bringt viele Vorteile – sowohl dem Patienten als<br />
auch dem Gesundheitswesen generell. Etwa die Hälfte der Kantone<br />
– dazu gehört bald auch der Kanton Luzern – führt ein solches<br />
Register.<br />
Vielfacher Nutzen<br />
Krebs ist die zweithäufigste Todesursache. Rund 40 Prozent der<br />
Schweizerinnen und Schweizer erkranken im Lauf ihres Lebens<br />
daran. Deshalb kommt der Prävention, der Früherkennung und<br />
der Identifizierung von Risikogruppen sowie der Ursachenforschung<br />
eine grosse Bedeutung zu. Mithilfe des Krebsregisters<br />
sollen regionale und kantonale Unterschiede in der Häufigkeit<br />
verschiedener Krebsarten dokumentiert, die Behandlungsqualität<br />
kontrolliert sowie eine Unter- oder gar Überversorgung aufgedeckt<br />
werden. Ein Nutzen ist auch bei der Prävention, Früherfassung,<br />
Therapie und Rehabilitation zu erwarten.<br />
Neue Erkenntnisse<br />
Von den neuen Erkenntnissen, die durch ein Krebsregister gewonnen<br />
werden können, profitieren die Patienten, die Öffentlichkeit,<br />
die Kantone, die Krankenversicherungen sowie die Krebsforschung.<br />
So ist es beispielsweise im Interesse aller Beteiligten,<br />
genau zu wissen, welche Krebstherapien zum Erfolg führen. Um<br />
die erwähnten Ziele zu erreichen, müssen Angaben zu Krebserkrankungen<br />
möglichst lückenlos erhoben werden. Aus diesem<br />
Grund hat der Kanton Luzern das Zentralschweizer Krebsregister<br />
lanciert und die anderen Innerschweizer Kantone zur Mitarbeit<br />
im ersten interkantonalen Krebsregister der Schweiz eingeladen.<br />
Departement Institute<br />
Testphase und Vorarbeiten<br />
Auf der Grundlage eines Regierungsratsbeschlusses im Herbst<br />
<strong>2009</strong> nahm das Krebsregister in Luzern seinen Betrieb im Sinn<br />
einer Testphase auf. Im Frühjahr 2010 wird das Geschäft im Kantonsrat<br />
behandelt. Bereits wurden erste Vorarbeiten in Angriff<br />
genommen. Das Zentralschweizer Krebsregister wird am LUKS<br />
angesiedelt und organisatorisch sowie administrativ dem Pathologischen<br />
Institut angegliedert. Leiter des Krebsregisters wird<br />
Prof. Dr. Joachim Diebold, Chefarzt des Pathologischen Instituts.<br />
Dr. David F. Pfeiffer übernimmt die Aufgabe des Koordinators. Bei<br />
den Vorarbeiten erwies sich die Zusammenarbeit mit der Dachorganisation<br />
NICER (National Institute for Cancer Epidemiology<br />
and Registration) und dem Krebsregister Fribourg als hilfreich. So<br />
konnte bereits eine zeitgemässe Registersoftware bereitgestellt<br />
werden. In diesem Zusammenhang ist die wertvolle Kooperation<br />
mit der Informatikabteilung des LUKS hervorzuheben.<br />
Datenschutz und Information<br />
Selbstverständlich untersteht das Krebsregister den strengen<br />
Anforderungen des Datenschutzes. Seit dem 15. September <strong>2009</strong><br />
liegt die Bewilligung der eidgenössischen Expertenkommission<br />
für das Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung vor, die<br />
allen Ärztinnen und Ärzten im Kanton Luzern erlaubt, ohne Verstoss<br />
gegen die Schweigepflicht Patientendaten an das Krebsregister<br />
zu leiten. Zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten<br />
des Kantons Luzern wurde eine ausführliche Information an die<br />
Ärzteschaft sowie ein Informationsschreiben für die Patienten<br />
erarbeitet und an alle im Kanton tätigen Ärzte verteilt. Weitere<br />
Informationen sind der LUKS-Homepage (www.ksl.ch) sowie einem<br />
in Kürze erscheinenden Flyer zu entnehmen. Anfragen und<br />
Anregungen können unter krebsregister@ksl.ch platziert werden,<br />
wo bereits verschiedene Mitteilungen eingegangen sind, so unter<br />
anderem der ausdrückliche Wunsch einer Patientin, in das<br />
Krebsregister aufgenommen zu werden.<br />
61
Departement Pflege, Soziales<br />
63
64 Departement Pflege, Soziales<br />
Departementsleiterin<br />
Margrit Fries<br />
«Die alten Griechen haben<br />
es schon gewusst: Alles<br />
fliesst und nichts bleibt; es<br />
gibt nur ein ewiges Werden<br />
und Wandeln.»<br />
Margrit Fries, Departementsleiterin<br />
Leitendes Personal<br />
Ausbildung Pflegeberufe<br />
Ingrid Oehen,<br />
Bereichsleiterin<br />
Berufsvorpraktika und IDEM<br />
Manuela Sury,<br />
Leiterin<br />
Bildung – Beratung – Entwicklung<br />
Fabienne Bachmann Zbinden,<br />
Bereichsleiterin<br />
Fachberatung und<br />
Stellvertretung Departement<br />
Pflege, Soziales<br />
Michael Döring-Wermelinger,<br />
Leiter<br />
Pflegeentwicklung und -qualität<br />
vakant<br />
Seelsorge<br />
Brigitte Amrein,<br />
Leiterin<br />
Sozialdienst<br />
Esther Graf,<br />
Leiterin
Departement Pflege, Soziales<br />
Projekt Profil 2010<br />
Das Projekt Profil 2010 bildete im vergangenen Jahr einen<br />
Schwerpunkt für die Führungsgremien des Pflegediensts.<br />
Integration neuer Pflegeberufe<br />
Das Projekt behandelte verschiedene Themen im Bereich der<br />
Teamzusammensetzung und -organisation auf der Ebene Statio-<br />
nen. Während einerseits die Teamzusammenstellung in Bezug<br />
auf die verschiedenen neuen Pflegeberufe analysiert wurde,<br />
musste auch die Organisation der Stationen unter dem Aspekt<br />
der Integration neuer Pflegeberufe beleuchtet werden. Für alle<br />
Stationen wurden im ersten Halbjahr <strong>2009</strong> individuelle Tätigkeitsprofile<br />
erstellt, welche die Arbeitsintensität und -inhalte im<br />
24-Stunden-Verlauf aufzeigen. Aufgrund dieser Profile wurde anschliessend<br />
pro Station der zu integrierende Anteil von Fachangestellten<br />
Gesundheit EFZ berechnet. Diese individuelle Berechnungsart<br />
ist in der Schweiz ein Novum und führt dazu, dass die<br />
Ergebnisse die Bedürfnisse der einzelnen Stationen gezielter abdecken<br />
und die gute Pflegequalität weiterhin geboten werden<br />
kann.<br />
Tandem-Modell<br />
Infolge dieser neuen Teamzusammensetzungen mussten, parallel<br />
zur Integration der neuen Berufsgruppen, die Organisationsstruktur<br />
und die Prozessabläufe der Abteilungen analysiert werden.<br />
Es musste definiert werden, welche Berufsgruppen welche<br />
Tätigkeiten übernehmen, wie diese Berufsgruppen miteinander<br />
arbeiten und so weiter. Zu diesem Zweck wurde ein sogenanntes<br />
Tandem-Modell entwickelt, das die Zusammenarbeit der Dipl.<br />
Pflegefachfrau HF mit der Fachangestellten Gesundheit EFZ in<br />
den Grundzügen regelt. Dazu wurden Verantwortungsfelder festgelegt<br />
und die Abteilungen in der Anwendung geschult. Die Integration<br />
der neuen Berufsgruppen ist in vollem Gang. An vielen<br />
Orten konnten inzwischen Fachangestellte Gesundheit EFZ zu<br />
einem wertvollen, integrierten Bestandteil der Teams gemacht<br />
werden.<br />
Leitsätze für den Veränderungsprozess<br />
Ein weiterer Bestandteil des Projekts Profil 2010 war die Auseinandersetzung<br />
des Pflegekaders mit der Thematik Veränderung. Zu<br />
diesem Zweck wurde in Wolhusen im September <strong>2009</strong> ein Kadertag<br />
mit allen Stationsleitungen und Leitungen Pflegedienst durchgeführt.<br />
Gemeinsam verabschiedete das Führungskader vier verpflichtende<br />
Leitsätze für den Veränderungsprozess, der durch das<br />
Projekt Profil 2010 für den Pflegedienst eingeleitet wurde.<br />
Departement Pflege, Soziales<br />
1. Gemeinsam verändern wir unsere Zukunft.<br />
Das Pflegekader LUKS möchte sich gemeinsam auf die zukünftigen<br />
Veränderungen einlassen und diese aktiv mitgestalten. Diese<br />
Zusammenarbeit soll von Wertschätzung und positivem und aktivem<br />
Vorwärtsgehen geprägt sein.<br />
2. Nur Führungspersonen, die offen für Veränderungen sind,<br />
können den Weg ebnen.<br />
Veränderungen sind heutzutage alltäglich. Die Führungspersonen<br />
des Pflegediensts wollen für diese Realität offen sein und<br />
dadurch den Weg in die Zukunft aktiv beeinflussen. Durch ein offenes<br />
und konstruktives Beschreiten dieses Wegs kann der Prozess<br />
für alle Beteiligten bewältigbar gemacht werden.<br />
3. Konsequentes und einheitliches Auftreten der Führung<br />
in Veränderungsprozessen.<br />
Ein einheitliches und konsequentes Auftreten des Pflegekaders<br />
vermittelt Sicherheit und Stärke durch Gemeinsamkeit. Dies fördert<br />
Vertrauen und Verlässlichkeit innerhalb der Veränderungsprozes-<br />
se. Das Pflegekader möchte ein zuverlässiger Partner sein und sei-<br />
ne Mitarbeitenden aktiv in den Veränderungsprozessen führen.<br />
65
66 Departement Pflege, Soziales<br />
4. Konkrete und verbindliche Aufgaben/Ziele<br />
im LUKS umsetzen.<br />
Konkrete und verbindliche Ziele und Aufgaben geben für alle Be-<br />
teiligten ein klares Bild, wohin der Weg in der Veränderung füh-<br />
ren soll. Durch Verbindlichkeit wird die Führung fassbarer und<br />
durch konkretes Handeln spürbar. Vertrauen und Transparenz<br />
werden gefördert. Dies sind wichtige Ziele für das Pflegekader im<br />
Veränderungsprozess der kommenden Jahre.<br />
Aktiv in die Zukunft<br />
Mit diesen vier Leitsätzen stiegen die Kaderpersonen des Pflege-<br />
dienstes in die weiteren Schritte des Veränderungsprozesses im<br />
Rahmen des Projekts Profil 2010 ein. Mit konkreten Zielvorgaben<br />
entwickeln nun die einzelnen Abteilungen und Stationen die<br />
praktische Umsetzung des Projekts. Das oberste Pflegekader<br />
wird sich in den kommenden Monaten mit einer gemeinsamen<br />
Visionsentwicklung für den Pflegedienst beschäftigen. Die Pflegenden<br />
befinden sich in Bewegung, um aktiv die Zukunft mitgestalten<br />
zu können.<br />
Ausbildung<br />
Pflegeberufe im Kommen<br />
Das Interesse an den Pflegeberufen steigt. Gleichzeitig beginnt<br />
die Vereinheitlichung der Ausbildungen gemäss BBT (Bundesamt<br />
für Berufsbildung und Technologie).<br />
Marketingkampagne für Pflegeberufe<br />
Für die Berufsgruppe Ausbildung Pflegeberufe war das Jahr be-<br />
sonders spannend, weil die Synergien der drei Standorte ver-<br />
mehrt genutzt werden konnten. Ein Beispiel ist die zentrale An-<br />
nahmestelle der Bewerbungen für die Berufe Fachfrau/Fachmann<br />
Gesundheit und Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF. Das andere Beispiel<br />
ist die Durchführung des Eignungstests für die Tertiärstufe.<br />
Ein grosses Ziel war, genügend interessierte Menschen anzusprechen<br />
und deutlich mehr Personen für eine Ausbildung im<br />
Pflegebereich zu rekrutieren. Dieses Ziel wurde mit einer intensiven<br />
Marketingkampagne erreicht.<br />
Vereinfachung durch einheitliche Richtlinien<br />
Zum ersten Mal konnten Hebammen-Studentinnen der Berner<br />
Fachhochschule an den Standorten Luzern und Wolhusen betreut<br />
werden. Im Vorfeld waren diverse Veranstaltungen organisiert<br />
worden, damit die Stationen gut vorbereitet die Herausforderung<br />
angehen konnten. Der noch junge Beruf FAGE, der seit<br />
dem Lehrbeginn <strong>2009</strong> neu Fachfrau/Fachmann Gesundheit genannt<br />
wird, zeigt im Weiteren auf, dass die Praxis gefordert ist<br />
mit den verschiedenen Ausbildungsgängen nach Schweizerisches<br />
Rotes Kreuz SRK oder BBT. Bis im Herbst 2011 werden die<br />
SRK-gestützten Berufe langsam durch die BBT-Berufe abgelöst,<br />
was dann sicherlich zu einer Vereinfachung in der praktischen<br />
Begleitung führen wird. Bis dies so weit ist, sind die Berufsbildnerinnen<br />
wie Lehrpersonen für Pflege in der Praxis gefordert, die<br />
unterschiedlichen Richtlinien ganz genau auseinanderzuhalten.<br />
Praxis im Lernbereich Training & Transfer (LTT)<br />
Aktuell besuchen 344 Studierende aus 39 Ausbildungsbetrieben<br />
den LTT-Praxis-Unterricht. Zum Vergleich: 2005 waren es lediglich<br />
26 Studierende, 2006 bereits 108, 2007 schon 194 und 2008 dann<br />
278. Der renovierte, praxisorientierte Unterrichtsraum im Gebäude<br />
der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJPD) der <strong>Luzerner</strong> Psychiatrie<br />
(LUPS) Luzern ist seit Januar <strong>2009</strong> erfolgreich in Betrieb und<br />
ist eine ideale Ergänzung zum Pavillon 48 auf dem Areal des<br />
LUKS. Eine sehr positive Auswirkung auf die Organisation des LTT-<br />
Praxis-Unterrichts hat die Festanstellung von LTT-Praxis-Lehrpersonen.<br />
Weiterhin notwendig sind externe Lehrpersonen, die fortlaufend<br />
aus den diversen Betrieben rekrutiert werden.
Sozialdienst für Patienten<br />
Täglich eine Heraus-<br />
forderung<br />
Die Spitalaufenthaltszeiten sinken, die Austritte beschleunigen<br />
sich. In Alters- und Pflegeheimen müssen Plätze gefunden wer-<br />
den. Dabei gilt es, stets die Würde der Patientinnen und Patienten<br />
im Auge zu behalten.<br />
Übergangslösungen in Alters- und Pflegeheimen<br />
Das Jahr <strong>2009</strong> war gekennzeichnet von Phasen, in denen sich die<br />
Austritte häuften. Für den Sozialdienst zeigte sich dies darin,<br />
dass für gegen 300 Patientinnen und Patienten Übergangslösungen<br />
in Alters- und Pflegeheimen gesucht werden mussten. Ob<br />
dies als Vorzeichen des DRG-Systems (Fallpauschalen) gedeutet<br />
werden kann oder mit Einflussfaktoren wie einem plötzlich hohen<br />
Patientenaufkommen und der Bevölkerungsentwicklung zu<br />
tun hat, bleibe dahingestellt. Insbesondere in der Stadt Luzern<br />
war das Platzangebot nicht üppig und die klar beschränkten Aufenthaltszeiten<br />
erwiesen sich für Patientinnen und Patienten, deren<br />
gesundheitliche Perspektive ungewiss ist, als Zugangsbarriere.<br />
Dafür war erfreulich festzustellen, dass die Heime sich<br />
mehrheitlich darauf eingestellt haben, temporäre Patientinnen<br />
und Patienten aufzunehmen.<br />
Temporäre Aufenthalte<br />
Als sehr hilfreich erwies sich das Angebot der Übergangspflege<br />
im Alters- und Pflegeheim Rosenberg, das den Einwohnern von<br />
Stadt und Kanton Luzern zur Verfügung steht. Ziel dieses Angebots<br />
ist es, Patientinnen und Patienten ab 60 Jahren in einem<br />
stationären und befristeten Aufenthalt von maximal drei Wochen<br />
vor allem in ihrer Mobilität und Alltagsbewältigung zu fördern,<br />
sodass sie gestärkt nach Hause zurückkehren können. Das unkomplizierte<br />
und schnelle Aufnahmeprozedere war eine Erleichterung<br />
für alle Betroffenen, während die Frage der Finanzierbarkeit<br />
oft schwieriger zu beantworten ist.<br />
Würde der Patientinnen und Patienten<br />
Welche Auswirkungen sind zu erwarten, wenn sich das Rad im<br />
Jahr 2010 noch schneller dreht? Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung<br />
für den Sozialdienst für Patienten und für alle im Spital<br />
Tätigen, der im Sinn der Kostenregulierung notwendigen Begrenzung<br />
der Spitalaufenthaltszeiten Rechnung zu tragen und gleichzeitig<br />
die Würde der Patientinnen und Patienten zu wahren.<br />
Departement Pflege, Soziales<br />
67
68 Departement Pflege, Soziales<br />
Spitalseelsorge<br />
(Seel-)Sorge für den<br />
ganzen Menschen<br />
Die Spitalseelsorge versteht die spirituelle Begleitung und die<br />
tätige Unterstützung von Menschen in Grenzsituationen als<br />
ganzheitliche Aufgabe.<br />
Grosses Aufgabenfeld<br />
Die Spitalseelsorge engagiert sich in verschiedenen Bereichen.<br />
Das Spektrum reicht von der Krankenbegleitung bis zum Unterricht<br />
am Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe. Die Kernaufgaben<br />
sind Krankenbesuche, Langzeitbegleitungen, die Gestaltung<br />
von Gottesdiensten und von Kommunion- und<br />
Abendmahlsfeiern im Zimmer, das Abschiednehmen von verstorbenen<br />
Menschen zusammen mit den Angehörigen sowie Tagesund<br />
Nachtpikettdienste.<br />
Umfassend verstandene Seelsorge<br />
Zugenommen hat die Betreuung von Patientinnen, Patienten und<br />
Angehörigen in Situationen der Krise und des Schocks. Heute<br />
wird dafür der Ausdruck «Care-Aufgaben» – in Abgrenzung zu<br />
den seelsorglichen Aufgaben – verwendet. Nach dem Verständnis<br />
der Spitalseelsorge des LUKS gehören jedoch beide Bereiche<br />
untrennbar zusammen: die Sorge um die spirituellen Bedürfnisse<br />
und das Unterstützungsangebot in einer schwierigen Zeit. Alle<br />
Teammitglieder verfügen über die klinische Seelsorgeausbildung<br />
(KSA/CPT) und über eine Ausbildung in Notfallseelsorge. Damit<br />
bildet die Spitalseelsorge das spitalinterne Care-Team, allerdings<br />
ohne diesen Ausdruck zu verwenden.<br />
Viele Piketteinsätze<br />
Die Spitalseelsorge ist nicht nur während des Tages, sondern<br />
häufig auch in der Nacht im Einsatz. <strong>2009</strong> waren am Standort Luzern<br />
139 Nachteinsätze zu verzeichnen. Vor allem auf den Intensivstationen<br />
gilt es Patientinnen und Patienten, überwiegend<br />
aber Angehörige zu begleiten. Eine solche Betreuung kann mehrere<br />
Stunden in Anspruch nehmen. Dadurch werden die Pflegenden<br />
entlastet. Auch die Seelsorgenden an den Standorten Sursee<br />
und Wolhusen leisteten eine grosse Zahl von Piketteinsätzen in<br />
der Nacht (109 Einsätze) und an den Wochenenden (43 Einsätze).<br />
Wenn eine verstorbene Person ins Ausland überführt werden<br />
soll, können die Abklärungen sehr zeitintensiv sein. In vielen Fällen<br />
übernimmt die Spitalseelsorge die Koordination zwischen<br />
den Angehörigen, der Pathologie und den Bestattungsinstituten.
Fingerspitzengefühl für andere Kulturen<br />
Bei manchen Einsätzen ist die Betreuung von Angehörigen aus<br />
anderen Kulturen besonders anspruchsvoll und verlangt Fingerspitzengefühl.<br />
Oft ist Vermittlungsarbeit notwendig, zum Beispiel<br />
mit Leitern von Asylheimen, mit Vertreterinnen der Caritas und<br />
mit religiösen Gemeinschaften. Die Spitalseelsorge pflegt den<br />
Kontakt mit fremdsprachigen Missionen, zum Beispiel so mit der<br />
Islamischen Gemeinde Luzern (IGL), der Jüdischen Gemeinde und<br />
den Zeugen Jehovas.<br />
Palliative Care: Ein wichtiges Anliegen<br />
Die Förderung der Palliative Care am LUKS ist ein wichtiges Anliegen.<br />
Die Spitalseelsorge beteiligt sich am Palliative Board, einem<br />
regelmässigen, interdisziplinären Treffen zu einem bestimmten<br />
Thema, und bildet sich in fachspezifischen Kursen in<br />
Palliative Care weiter. Einen wesentlichen Teil an der ganzheitlichen<br />
Betreuung von sterbenden Menschen leisten nach wie vor<br />
die freiwilligen Sitzwachen. Die Spitalseelsorge engagiert sich in<br />
der Rekrutierung von geeigneten Leuten, in der Durchführung<br />
des einwöchigen Ausbildungskurses und in der supervisorischen<br />
Begleitung der einzelnen Gruppen.<br />
Freiwillige Helferinnen und Helfer<br />
Neben den Sitzwachen bilden die IDEM (Im Dienste Eines Menschen)<br />
und die Gottesdiensthelferinnen und -helfer weitere<br />
Gruppen von Freiwilligen, die am <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> tätig<br />
sind. Jeden Sonntag findet im Hörsaal der Spitalgottesdienst<br />
statt, der über das Spitalradio auch in die Krankenzimmer übertragen<br />
wird.<br />
Departement Pflege, Soziales<br />
69
Departement Betrieb und Infrastruktur<br />
71
72 Departement Betrieb und Infrastruktur<br />
Departementsleiter<br />
Roger Müller<br />
«Prozesse analysieren<br />
und optimieren, aus den<br />
Erfahrungen anderer<br />
lernen, Partnerschaften<br />
eingehen, Antworten<br />
auf den wachsenden<br />
Kostendruck finden, das<br />
Ziel im Auge behalten und<br />
die Wettbewerbsfähigkeit<br />
des LUKS stärken.»<br />
Roger Müller, Departementsleiter<br />
Leitendes Personal<br />
Informatik<br />
Dr. Peter Steinmann<br />
Leiter<br />
Ökonomie<br />
Beat Furrer<br />
Leiter<br />
Technik, Bau und Sicherheit<br />
Bruno Sager<br />
Leiter
Departement Betrieb<br />
und Infrastruktur<br />
Gemeinsam Kosten<br />
senken<br />
Die Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die Einführung des<br />
neuen DRG-Finanzierungssystems laufen auf Hochtouren. Eine<br />
Antwort auf den zunehmenden Kostendruck ist der Einkaufsverbund<br />
Medsupply AG.<br />
Grosse Mengen, tiefere Preise<br />
Swiss DRG (Diagnosis Related Groups), das neue Verrechnungssystem<br />
mit Fallpauschalen, soll per 1. Januar 2012 eingeführt<br />
werden. Die Veränderung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen<br />
und der zunehmende Wettbewerb zwingen die Spitäler<br />
zu noch mehr Effizienz. Sie müssen ihre Leistungen in Zukunft<br />
noch kostengünstiger erbringen, das heisst Kosten<br />
einsparen. Die Frage ist nur, wo. Ein grosser Posten im Spitalaufwand<br />
ist das medizinische Verbrauchsmaterial. Es liegt deshalb<br />
nahe, dort den Hebel anzusetzen und eine Kostenreduktion zu<br />
erreichen. Tiefere Preise lassen sich jedoch nur bei grossen Mengen<br />
aushandeln. Die einzelnen Spitäler haben ihren diesbezüglichen<br />
Verhandlungsspielraum bereits ausgereizt. Somit sind weitere<br />
Preisoptimierungen nur noch im Verbund mit anderen<br />
möglich.<br />
Sieben Spitäler im Einkaufsverbund<br />
Vor diesem Hintergrund wurde im April <strong>2009</strong> die Medsupply AG<br />
gegründet mit dem Ziel, langfristige und stabile Vernetzungen<br />
zwischen Anbietern und Nachfragern aufzubauen und die Beschaffungskosten<br />
der beteiligten Spitäler zu senken. Der gemeinsame<br />
Einkauf, das Angleichen der Abläufe, die Straffung des Produktsortiments<br />
und die Konzentration auf eine beschränkte<br />
Anzahl qualitativ guter Hauptlieferanten sollen die anvisierten<br />
Synergieeffekte bringen. Neben dem <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> gehören<br />
per 1. Januar 2010 die folgenden sechs Spitäler zu diesem<br />
Einkaufsverbund: <strong>Kantonsspital</strong> Aarau, <strong>Kantonsspital</strong> Baden, <strong>Kantonsspital</strong><br />
Liestal, <strong>Kantonsspital</strong> St. Gallen, Universitätsspital Basel<br />
und Universitätsspital Zürich. Die ersten gemeinsamen Beschaffungsprojekte<br />
starten 2010.<br />
Gewährleistung hoher Qualität<br />
Die Medsupply AG ist eine erfolgversprechende Antwort auf den<br />
wachsenden Kostendruck. Durch den Einkaufsverbund lassen<br />
sich nicht nur die Einkaufskanäle optimieren und die Abhängigkeit<br />
von Lieferanten verringern, sondern auch sämtliche Ein-<br />
Departement Betrieb und Infrastruktur<br />
kaufs-, Beschaffungs- und Logistikprozesse verbessern. Dies<br />
führt einerseits zu tieferen Kosten und gewährleistet anderseits,<br />
dass die hohen Qualitätsanforderungen weiterhin erfüllt werden.<br />
Aus der Zusammenarbeit ergeben sich zudem neue Netzwerke<br />
und Partnerschaften, die allen Beteiligten Vorteile bringen können.<br />
73
74 Departement Betrieb und Infrastruktur<br />
Blickpunkte<br />
Technik, Bau und Sicherheit (TBS)<br />
Facility Management<br />
Die Abteilung TBS bietet im Rahmen des<br />
Facility Managements des <strong>Luzerner</strong> Kan-<br />
tonsspitals umfassende Dienstleistungen<br />
an. Sie ist die technische Betreiberin der<br />
Spitalliegenschaften, die Drehscheibe für<br />
die Bereitstellung und Nutzung der räumlichen<br />
Infrastruktur, das Kompetenzzentrum<br />
für die Evaluation, Planung und Ausführung<br />
von technischen und baulichen<br />
Projekten sowie Anbieterin von handwerklichen<br />
Dienstleistungen. Darüber hinaus<br />
ist sie für die allgemeine Sicherheit der<br />
Patienten, Besucher und Mitarbeitenden<br />
sowie für einen ausfall- und störungsfreien<br />
Spitalbetrieb verantwortlich. Das externe<br />
Betriebs- und Unterhaltsbudget beträgt<br />
rund 20 Millionen Franken. Zusätzlich hat<br />
die Abteilung im Jahr <strong>2009</strong> Projekte mit einem<br />
Investitionsvolumen, von rund 13<br />
Millionen Franken durchgeführt und im<br />
Umfang von rund 27 Millionen Projekte<br />
der Dienststelle Immobilien des Kantons<br />
Luzern fachlich/betrieblich unterstützt.<br />
Eindrückliche Leistung<br />
82 TBS-Mitarbeitende betreuen die drei<br />
LUKS-Standorte Luzern, Sursee und Wolhusen,<br />
eine Arealfl äche von 265700 m2 ,<br />
49 Gebäude mit einer Gesamtgeschossfl äche<br />
von 225000 m2 und einem Inventar<br />
von 17300 Anlagen. Sie führen pro Jahr<br />
über 22000 Reparaturen und andere<br />
Dienstleistungen aus. Dabei werden Zuverlässigkeit,<br />
Präsenz und Reaktionsschnelligkeit<br />
grossgeschrieben.<br />
Aufregender Alltag<br />
Wer Pikettdienst hat, dem wird es nie<br />
langweilig. Das ganze Jahr ist etwas los,<br />
auf das rasch reagiert werden muss: Wassereinbrüche<br />
durch Gewitter, Baustellen<br />
und Rohrbrüche, kurze Netzunterbrüche<br />
oder Notkühlungen zum Schutz wichtiger<br />
Anlagen halten die Pikettmitarbeiter auf<br />
Trab. Pro Jahr sind rund 2000 Interventionen<br />
notwendig. Von 900 dringenden, nicht<br />
verschiebbaren Einsätzen fallen 80 Prozent<br />
ausserhalb der Arbeitszeit an. 87 Prozent<br />
dieser Fälle löst der Pikettdienst ohne<br />
Fremdhilfe selbstständig. Diese hohe Erfolgsquote<br />
basiert nicht zuletzt auf der<br />
permanenten Weiterbildung der Mitarbeiter,<br />
die auch die neuesten Anlagen kennen.<br />
Das Glück der Tüchtigen<br />
Manchmal braucht es das sprichwörtliche<br />
Glück, das dem Tüchtigen zusteht. Dieser<br />
Fall trat am 4. Juni <strong>2009</strong> ein, als es bei Arbeiten<br />
in einem Serverraum zu einem<br />
Kurzschluss kam. Verschiedene ICT-Anwendungen<br />
fi elen im ganzen LUKS aus. Zu<br />
diesem Zeitpunkt waren glücklicherweise<br />
alle wichtigen Informatik- und TBS-Spezialisten<br />
vor Ort. Nach 30 Minuten stand das<br />
Netz wieder zur Verfügung, nach 90 Minuten<br />
waren die meisten Applikationen wieder<br />
online. Fazit: Die Verfügbarkeit eigener<br />
kompetenter Informatik- und TBS-Spezialisten<br />
ist für ein Unternehmen wie das<br />
LUKS von zentraler Bedeutung. Redundanzen<br />
und Notfallkonzepte sind ein absolutes<br />
Muss. Schwachstellen müssen schnell<br />
erkannt und behoben werden, was im<br />
Rahmen des Projekts «Sofortmassnahmen<br />
Rechenzentrum» umgehend geschehen<br />
ist.
Ökonomie<br />
Verpflichtung zur<br />
Exzellenz<br />
Das <strong>2009</strong> lancierte Qualitätsmanagementsystem hat sich bereits<br />
in der Startphase positiv ausgewirkt.<br />
Qualitätsmanagementsystem nach EFQM-Modell<br />
Die Abteilung Ökonomie hat sich zum Ziel gesetzt, ein Qualitäts-<br />
managementsystem nach dem Modell der European Foundation<br />
for Quality Management (EFQM) einzuführen und bis zum Sommer<br />
2010 die Stufe «Verpflichtung zu Excellence» zu erreichen.<br />
Im Frühjahr <strong>2009</strong> führten Experten der Hochschule für Wirtschaft<br />
Luzern ein Assessment durch. Basierend auf den Ergebnissen<br />
der qualitativen und quantitativen Befragungen des Kaders und<br />
der Mitarbeitenden wurden folgende Projekte gestartet:<br />
• Beherrschen der Prozesse;<br />
• Führen mit Kennzahlen;<br />
• Etablieren eines systematischen, kontinuierlichen Verbesserungsprozesses;<br />
• einheitliche Anwendung des Beurteilungs- und Fördergesprächs<br />
in der Ökonomie.<br />
Zusammenarbeit in Projektteams<br />
Die systematische Auseinandersetzung mit diesen Themen<br />
zwingt dazu, sich periodisch vom Tagesgeschäft zu lösen und<br />
gemeinsam an einer nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten. Neben<br />
den positiven Auswirkungen der Projektergebnisse für das<br />
LUKS profitiert das Ökonomiekader von der intensiven Zusammenarbeit<br />
und dem regelmässigen Gedankenaustausch in den<br />
Projektteams.<br />
Neue Aufgabenverteilung<br />
Die Berufsbilder in der Pflege haben sich geändert. So enthält<br />
das Pflichtenheft für den Beruf Fachfrau/Fachmann Gesundheit<br />
weniger Reinigungsaufgaben als früher in vergleichbaren Funktionen.<br />
Weil dies Auswirkungen auf den Reinigungsdienst hat,<br />
wurde gemeinsam mit dem Pflegedienst ein Konzept ausgearbeitet,<br />
das der veränderten Aufgabenstellung Rechnung trägt.<br />
Die Umsetzung, die bereits 2005 auf einer Pilotstation begonnen<br />
hatte, konnte Ende <strong>2009</strong> abgeschlossen werden. Damit ist die<br />
klare Abgrenzung zwischen Pflegedienst und Reinigungsdienst<br />
auf allen Bettenstationen des LUKS Luzern – mit Ausnahme der<br />
Intensivpflegestationen – vollzogen.<br />
Departement Betrieb und Infrastruktur<br />
Verändertes Rollenverständnis<br />
Ein Schwerpunkt im neuen Pflichtenheft ist die komplette Austrittsreinigung<br />
im Patientenzimmer. Die erweiterten Aufgaben haben<br />
zu einem neuen Rollenverständnis der Mitarbeitenden des<br />
Reinigungsdiensts geführt. So hat sich insbesondere ihr Verhältnis<br />
zu den Patienten und Angehörigen geändert. Die Ausführung<br />
von Reinigungsarbeiten im Patientenzimmer und die sich daraus<br />
ergebenden Kontakte verlangen zusätzlich zum fachlichen Knowhow<br />
Fingerspitzengefühl, Sozialkompetenz und nicht zuletzt<br />
Deutschkenntnisse. Die Mitglieder des Reinigungsdiensts treten<br />
den Patienten und Angehörigen aktiver und persönlicher gegenüber.<br />
Beispielsweise entwickeln sie ein Gefühl für Situationen,<br />
die den Patienten stören könnten, achten auf seine persönlichen<br />
Gegenstände oder gehen auch einmal auf eine private Frage<br />
ein.<br />
Allseitige Zufriedenheit<br />
Die Umstellungen haben auf allen Seiten zu einer grossen Zufriedenheit<br />
geführt. Für den Patienten ist es angenehmer, wenn er<br />
das gleichbleibende Mitglied des Reinigungsteams kennt. Durch<br />
den Kundenkontakt wird die Arbeit für die Mitarbeitenden des<br />
Reinigungsdiensts persönlicher und abwechslungsreicher. Zudem<br />
wird der Pflegedienst entlastet, weil die reinigungsspezifischen<br />
Arbeiten durch eine entsprechende Fachperson sauber<br />
und korrekt erledigt werden.<br />
75
76 Departement Betrieb und Infrastruktur<br />
Informatik<br />
Effizientes<br />
Videokonferenzsystem<br />
Mit standortübergreifenden Videokonferenzen lassen sich Zeit<br />
und Geld sparen. Am LUKS wurde ein veraltetes System durch<br />
ein modernes ersetzt.<br />
Erneuerung notwendig<br />
Seit 2002 bestand an den Standorten Luzern und Sursee ein auf<br />
der ISDN-Übertragungstechnologie bestehendes Videokonferenzsystem.<br />
Dieses wurde sowohl für Fortbildungen mit anderen<br />
Spitälern als auch für einzelne Sitzungen wie beispielsweise Tumorboards<br />
zwischen den beiden Standorten eingesetzt. Die Entwicklung<br />
bei den Videokonferenzsystemen war in den letzten<br />
Jahren rasant. Die technische Rückständigkeit der bestehenden<br />
Anlage gab den Benutzern immer wieder Anlass zu Reklamationen.<br />
Deshalb beschloss die Geschäftsleitung die Evaluation eines<br />
modernen Videokonferenzsystems, das die Bedürfnisse der heutigen<br />
Zeit abdecken und auch die beiden anderen LUKS-Standorte<br />
in Wolhusen und Montana einbinden sollte.<br />
Detaillierte Evaluation<br />
Das eingesetzte Projektteam ist in der Evaluationsphase wie<br />
folgt vorgegangen:<br />
1. Abklärung des ärztlichen und des nicht ärztlichen Bedarfs<br />
der Kliniken, Abteilungen und Institute;<br />
2. Definition un Ausschreibung der Kriterien für eine<br />
Test stellung (Einladungsverfahren);<br />
3. Durchführung eines Probelaufs über die drei Standorte<br />
Luzern, Sursee und Wolhusen;<br />
4. Nutzerbefragung und Auswertung der Nutzerantworten;<br />
5. technische Beurteilung des Systems und Ermittlung des<br />
Entwicklungspotenzials.<br />
Erfolgreiche Integration<br />
Während der Integrationsphase erfolgten als weitere Schritte:<br />
6. Bestimmung des Equipments (Monitore, Mikrofone,<br />
Lautsprecher) pro Raum;<br />
7. Einholen einer Offerte für zehn Raumsysteme;<br />
8. Organisation der Betreuung, Wartung und Zuständigkeiten;<br />
9. Genehmigung des Antrags durch den Geschäftsleitungsausschuss;<br />
10. Auslösung der Bestellungen und Ausrüstung der Räume;<br />
11. Schulung und Übergabe des Systems an die Benutzer.
Grosser Nutzen mit Sparpotenzial<br />
Jetzt sind standortübergreifende Videokonferenzen in guter Qua-<br />
lität möglich, zum Beispiel Rapporte, Tumorboards, Fallbespre-<br />
chungen, Fortbildungen und so weiter. Auf diese Weise können<br />
Zeit und Reisekosten eingespart werden. Auch Videokonferenzen<br />
mit Fachärzten aus anderen Spitälern sind kein Problem mehr.<br />
Sie erfolgen sicher und unkompliziert über das Internet – bei<br />
gleichbleibender Funktionalität und Qualität. Die Benutzer kön-<br />
nen nach einer einfachen Instruktion die Videokonferenzen<br />
selbstständig durchführen. Aufgrund der flexiblen Möglichkeiten<br />
besteht eine rege Nachfrage. Die Community wird laufend ausgebaut.<br />
Das Projekt konnte erfolgreich, zeitgerecht und budgetkonform<br />
durchgezogen und abgeschlossen werden.<br />
Technik, Bau und Sicherheit (TBS)<br />
Outsourcing versus<br />
Insourcing<br />
Die Abteilung TBS hat sich in den letzten Jahren marktorientiert<br />
weiterentwickelt und ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Die<br />
steigende Zahl von externen Kunden unterstreicht die positive<br />
Entwicklung.<br />
Mix interner und externer Kompetenzen<br />
Im Rahmen des Facility Managements des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s<br />
bietet die Abteilung TBS umfassende Dienstleistungspakete<br />
rund um den Arbeitsplatz an – aus einer Hand und in einem ausgewogenen<br />
Verhältnis von Nutzen und Kosten. Der Mix zwischen<br />
der internen Fachkompetenz und der Bestellerkompetenz für<br />
den Zukauf von Leistungen von aussen ist entscheidend, damit<br />
die Abteilung sowohl als interner Dienstleister als auch als Anbieter<br />
für Dritte konkurrenzfähig bleibt.<br />
Grosse Spitäler im Vorteil<br />
Bemerkenswert ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Abteilung<br />
TBS mit dem Wachstum der letzten Jahre – sei es durch die Fusion<br />
zum LUKS oder durch die stetige Zunahme von Drittkunden<br />
– kontinuierlich zugenommen hat. Grosse Spitäler sind gegenüber<br />
kleineren im Vorteil, weil Grösse zu Skaleneffekten führt,<br />
das heisst eine höhere Wirtschaftlichkeit zur Folge hat. Dies ist<br />
in praktisch allen Sparten des TBS-Dienstleistungsportfolios festzustellen<br />
– von der Medizintechnik über den technischen Pikettdienst<br />
bis zum Planmanagement für alle Standorte mit CAD<br />
(computer-aided design).<br />
Departement Betrieb und Infrastruktur<br />
77
78 Departement Betrieb und Infrastruktur<br />
Inhouse-Know-how in Medizintechnik<br />
In der Medizintechnik konzentriert sich der Aufwand von kleine-<br />
ren Spitälern vielfach auf administrative Arbeiten wie das Weiter-<br />
leiten von Reparatur- und Wartungsaufträgen an Dritte. Durch die<br />
Transporte werden die «Down-Zeiten», in denen Geräte nicht ver-<br />
wendet werden können, zwangsläufig länger. Dies bedeutet,<br />
dass kleinere Spitäler viel mehr in Ersatzgeräte investieren müs-<br />
sen als grössere Spitäler, die viele Arbeiten inhouse erledigen<br />
können. Durch das Auslagern geht auch internes Know-how ver-<br />
loren, das sowohl bei der Betreuung und Einweisung der Anwen-<br />
der als auch beim raschen Reagieren in Notsituationen von zentraler<br />
Bedeutung ist.<br />
Pikettdienst: 87 Prozent intern bewältigt<br />
Durch das grosse Volumen rechnet sich der Aufwand für einen<br />
technischen Pikettdienst, der dank umfassender Ausbildung in<br />
allen Bereichen in der Lage ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit aktiv<br />
einzugreifen, den Schaden zu beheben, die Anlagen in einen<br />
sicheren Zustand zu bringen oder auf schnellstem Weg vor Ort<br />
die notwendigen Massnahmen in die Wege zu leiten. Die Schlagkraft<br />
der TBS-Pikettmannschaft zeigt sich darin, dass von jährlich<br />
rund 700 Einsätzen ausserhalb der Arbeitszeit nur in rund 13 Prozent<br />
der Fälle auf Fremdhilfe zugegriffen werden muss. Wenn<br />
man die hohen Ansätze von Fremdfirmen für Pikett-, Nacht- und<br />
Wochenendeinsätze betrachtet, erkennt man unschwer, dass es<br />
sich lohnt, auf eigenes gut ausgebildetes Personal zugreifen zu<br />
können.<br />
Insourcing beim CAD-Planmanagement<br />
Es gibt auch Leistungen, die auf dem Markt kaum erhältlich sind,<br />
so beispielsweise im CAD-Bereich. Weil Spitalbauten – im Gegensatz<br />
zu den meisten anderen kommerziellen Gebäuden – durch<br />
den immer schneller werdenden Wandel in der medizinischen<br />
Versorgung eine stetige Baustelle sind, ist man aus betrieblichen<br />
Gründen in sehr hohem Mass auf aktuelle Pläne angewiesen.<br />
Dies betrifft nicht nur die Architektur der Gebäude, sondern auch<br />
eine Vielzahl von Angaben zu technischen Einrichtungen, die für<br />
die TBS-Fachleute notwendig sind, damit sie bei jedem Ereignis<br />
schnell intervenieren können. Um die notwendige Standardisierung<br />
der Daten sicherzustellen, hat die Abteilung TBS anlässlich<br />
der Fusion zum LUKS das gesamte Planwesen aller Standorte zusammengeführt<br />
und einzelne bisher externe Aufgaben einem<br />
Insourcing unterzogen. Auf diese Weise erreichte man bei gleichbleibenden<br />
Kosten beim Management der Plandaten eine grosse<br />
Effizienzsteigerung sowie einen einheitlichen Standard, was die<br />
Zusammenarbeit mit externen Architekten und Planern enorm<br />
erleichtert.
Fit für interne und externe Kunden<br />
Diese und weitere Beispiele geben der Abteilungsleitung die Ge-<br />
wissheit, auch zukünftige Herausforderungen als Chance nutzen<br />
zu können. Es geht darum, den erarbeiteten Vorteilen Sorge zu<br />
tragen, den Mitbewerbern auf dem Markt stets eine Nasenlänge<br />
voraus zu sein und damit auch für externe Kunden attraktiv zu<br />
bleiben.<br />
Public Private Partnership<br />
LUKS + AMTS = PPP<br />
Die Partnerschaft zwischen dem LUKS und der AMTS (Akademie<br />
für Medizinisches Training und Simulation) ist ein gelungenes<br />
Beispiel einer Public Private Partnership (PPP).<br />
Hochmoderne Infrastruktur<br />
Die Akademie für Medizinisches Training und Simulation (AMTS)<br />
auf dem Areal des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s ist ein wegweisendes<br />
Aus- und Weiterbildungszentrum für Chirurgen, Unfallmediziner<br />
und andere Spezialisten. In der neu ausgebauten ehemaligen<br />
Frauenklinik verfügt die AMTS auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern<br />
über eine hochmoderne Infrastruktur. Dazu gehören<br />
eine Aula für 70 bis 180 Personen, eine Halle für Unfallsimulation,<br />
ein vollständig eingerichteter Operationssaal, ein Intensivpflegeplatz,<br />
ein Schockraum mit CT-Simulator, Live-Übertragungsmöglichkeiten,<br />
ein Videokonferenzsystem, Sitzungs- und Workshopräume<br />
sowie eine Cafeteria. Mit dem AMTS-Gebäude konnte<br />
auch die Raumnot des LUKS entschärft werden. So befinden sich<br />
im 2. Stock die Ambulante Rehabilitation und die Dermatologie<br />
sowie im 3. Stock Büro- und Praxisräume.<br />
Public Private Partnership<br />
Das Zentrum mit nationaler und internationaler Ausstrahlung ist<br />
von grosser Bedeutung für die Region Luzern und das LUKS. Die<br />
Zusammenarbeit zwischen der AMTS, einer Aktiengesellschaft,<br />
und dem LUKS ist zudem ein Musterbeispiel für eine sogenannte<br />
Public Private Partnership. Die Kooperation zwischen dem privatrechtlichen<br />
und dem öffentlich-rechtlichen Unternehmen dient<br />
der optimalen Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im öffentlichen<br />
Interesse und der bestmöglichen Effizienz. Die Synergien, die<br />
sich aus dieser Public Private Partnership ergeben, stellen für<br />
beide Seiten einen echten Mehrwert dar.<br />
Departement Betrieb und Infrastruktur<br />
Attraktiver Kunde<br />
Für das Departement Betrieb und Infrastruktur handelt es sich<br />
bei der AMTS um einen attraktiven Kunden. Die Abteilung TBS hat<br />
das anspruchsvolle Projekt von Anfang an begleitet und bietet<br />
nach der Vollendung weiterhin ihre Dienstleistungen an. So ist<br />
sie verantwortlich für den Betrieb und die Instandhaltung der<br />
baulichen und technischen Infrastruktur sowie für die Energieund<br />
Medienversorgung. Zu den TBS-Leistungen gehören aber<br />
auch die Innenbegrünung, Dekorationen, die Sicherheitsprävention<br />
und ein 24-Stunden-Pikettdienst. Die Abteilung Ökonomie<br />
stellt ihre Dienste im Bereich der Reinigung und Verpflegung zur<br />
Verfügung.<br />
79
Departement Sursee<br />
81
82 Departement Sursee<br />
Departementsleiter<br />
Dr. Markus Wietlisbach<br />
« Die stark gestiegene<br />
Nachfrage nach Spitalleistungen<br />
in unserem Departement<br />
erfordert motivierte<br />
Fachpersonen, den Ausbau<br />
und die Pflege von guten<br />
Partnerschaften sowie<br />
eine stabile und moderne<br />
Infrastruktur. Das LUKS<br />
Sursee konnte <strong>2009</strong> in all<br />
diesen Bereichen wesentliche<br />
Meilensteine erreichen.»<br />
Dr. Markus Wietlisbach,<br />
Departementsleiter<br />
Klinik-/Bereichsleitungen<br />
Chirurgie & Orthopädie<br />
Dr. Alessandro Wildisen,<br />
Chefarzt<br />
Gynäkologie/Geburtshilfe<br />
Dr. Eduard Infanger,<br />
Chefarzt<br />
Medizin<br />
Prof. Dr. Adrian Schmassmann,<br />
Chefarzt<br />
Anästhesie<br />
Dr. Markus Wietlisbach,<br />
Chefarzt<br />
Betriebswirtschaft<br />
Florentin Eiholzer,<br />
Leiter<br />
Pflegedienst<br />
Dora Bremgartner,<br />
Leiterin<br />
Leitendes Personal<br />
Chirurgie & Orthopädie<br />
Dr. Alessandro Wildisen,<br />
Chefarzt<br />
PD Dr. Jens Decking<br />
Co-Chefarzt Orthopädie<br />
Dr. Stephanie Scherz,<br />
Leitende Ärztin<br />
Gynäkologie/Geburtshilfe<br />
Dr. Eduard Infanger,<br />
Chefarzt<br />
Dr. Maysoon Iraki,<br />
Co-Chefärztin<br />
Dr. Joachim Manstein,<br />
Leitender Arzt<br />
Medizin<br />
Prof. Dr. Adrian Schmassmann,<br />
Chefarzt<br />
Dr. Hans-Rudolf Frey,<br />
Co-Chefarzt<br />
Dr. Se-Il Yoon,<br />
Leitender Arzt Kardiologie<br />
Dr. Jörg Nossen,<br />
Leitender Arzt Kardiologie, Notfall<br />
& Intensivstation<br />
Dr. Roland Sperb,<br />
Leitender Arzt Onkologie<br />
Anästhesie<br />
Dr. Markus Wietlisbach,<br />
Chefarzt<br />
Dr. Rico Grimm,<br />
Co-Chefarzt<br />
Radiologie<br />
Dr. Stefan Stronski,<br />
Leitender Arzt/Standortleiter<br />
Dr. Christian Blumer,<br />
Co-Chefarzt
Zentrum für Endoskopie und Laparoskopie<br />
Sursee (ZELS)<br />
Gebündelte Kompetenz<br />
unter einem Dach<br />
ZELS ist das neue Kompetenzzentrum des LUKS Sursee für alle<br />
Erkrankungen im Bauchraum. Abklärungen und Behandlungen<br />
erfolgen interdisziplinär. Die Abläufe sind effizient und patientenfreundlich.<br />
Interdisziplinäre Plattform<br />
Das Zentrum für Endoskopie und Laparoskopie Sursee (ZELS)<br />
steht unter der gemeinsamen Leitung der drei Chefärzte Dr. Eduard<br />
Infanger (Gynäkologie/Geburtshilfe), Prof. Dr. Adrian Schmassmann<br />
(Medizin) und Dr. Alessandro Wildisen (Chirurgie). Somit<br />
vereinigt das ZELS das Know-how von Spezialisten verschiedener<br />
Fachgebiete. Die für die Schweiz einmalige interne Vernetzung<br />
ist auch ein Ausdruck des hervorragenden kollegialen Klimas innerhalb<br />
der Gastroenterologie, Gynäkologie und Viszeralchirurgie<br />
am LUKS Sursee. Das ZELS hat das klare Ziel, die Abklärungs- und<br />
Behandlungswege unter Einbezug modernster Techniken und<br />
Apparate schlanker und effizienter zu gestalten.<br />
Für alle Krankheiten im Bauchraum<br />
Viele klar definierte Krankheitsbilder können von den Spezialisten<br />
selbst behandelt werden. Es gibt aber ebenso viele komplexe<br />
Krankheiten im Bauchraum, die von Anfang an eine umfassende<br />
Zusammenarbeit und Absprache über verschiedene<br />
Disziplinen hinweg erfordern. Das ZELS hilft bei folgenden Krankheitsbildern:<br />
• alle Formen von Stuhlentleerungsstörungen, Inkontinenz und<br />
allgemeinen proktologischen (analen) Leiden;<br />
• akute oder chronische Bauchschmerzen;<br />
• chronisch entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn,<br />
Colitis ulcerosa usw.);<br />
• gastroösophageale Refluxkrankheit (Sodbrennen, Zwerchfellbruch);<br />
• komplexe Endometriose, nicht nur mit Befall der Frauenorgane,<br />
sondern auch des Darms, speziell des Mastdarms;<br />
• bösartige Tumoren des Ober- und Unterbauchs;<br />
• Gallenwegerkrankungen;<br />
• alle Fragen der Laparoskopie und der minimalinvasiven Chirurgie<br />
(«Schlüsselloch»-Chirurgie);<br />
• Tumor-Vorsorge und -Nachsorge (Onkologie).<br />
Mehrwert für die Patienten<br />
Departement Sursee<br />
Das ZELS bietet sowohl den Ärzten als auch den Patienten viele<br />
Vorteile. Der zuweisende Arzt verfügt mit dem ZELS über eine<br />
einfach zugängliche, zeitsparende und kompetente Abklärungs-<br />
plattform für Baucherkrankungen, während der Patient von einer<br />
raschen und wohnortsnahen Diagnostik und Behandlung profi-<br />
tiert. Abklärungen erfolgen in der Regel innert 24 bis 48 Stunden.<br />
Die Patienten können auf ein erstklassiges Serviceangebot zählen,<br />
ohne lange Wartezeiten auf sich nehmen zu müssen.<br />
Grosse Erfahrung, exzellente Resultate<br />
Die rasante Entwicklung der minimalinvasiven Chirurgie erfordert<br />
eine aufwendige, lange Ausbildung und eine entsprechende Ausrüstung.<br />
Dank langjähriger Erfahrung der Teamleader in minimalinvasiven<br />
Techniken wurden am Standort Sursee bewährte Methoden<br />
zur Routine – speziell in der Chirurgie der Karzinome, vor<br />
allem der kolorektalen Malignome, der Chirurgie der Adipositas,<br />
der Refluxchirurgie, aber auch in der Thorakoskopie. Die grosse<br />
Erfahrung erlaubt auch die Implementierung neuer Techniken<br />
wie der «Single Incision Laparoscopic Surgery» (SILS) oder der laparoskopischen<br />
Radiofrequenzablation maligner Tumore. Die<br />
entsprechenden Resultate sind exzellent. Dank der in den Operationssälen<br />
installierten hochmodernen Ausrüstung können<br />
komplexe, fortgeschrittene laparoskopische Eingriffe immer sicherer<br />
durchgeführt werden. Die Hightech-OPs am LUKS Sursee<br />
werden gerade auch von spezialisierten Firmen viel besucht und<br />
stellen eine ausgezeichnete Referenz dar.<br />
83
84 Departement Sursee<br />
Blickpunkte<br />
Anästhesie<br />
Projekt Schnittzeiten<br />
Wenn im Operationssaal (OP) schon morgens<br />
beim ersten Eingriff Verzögerungen<br />
auftreten, nimmt der Rückstand auf den<br />
Zeitplan im weiteren Verlauf des Tages<br />
ständig zu. Die Folgen sind ein überbelegter<br />
Operationssaal, teure Überzeit und unzufriedene<br />
Mitarbeiter. Um dies zu vermeiden,<br />
müssen die Schnittzeiten<br />
eingehalten werden. Am LUKS Sursee konzentrierte<br />
man sich auf die besonders<br />
wichtigen Morgenstunden. Ein wöchentliches<br />
Reporting zeigte allen Beteiligten –<br />
Pfl egestation, Anästhesie, OP-Personal<br />
und Operateuren – ihren Anteil an den<br />
Verzögerungen. Dies führte zu einer Halbierung<br />
der Schnittverzögerungen am<br />
Morgen. Bei knapp 20 Prozent der Fälle<br />
sind noch Verspätungen zu verzeichnen.<br />
Mit verschiedenen Massnahmen soll die<br />
Effi zienz im OP weiter gesteigert werden.<br />
ZELS<br />
Präsentation an der SURWA<br />
Im Oktober nahm das LUKS Sursee an der<br />
48. Surseer Gewerbeausstellung SURWA<br />
teil. Die Sonderausstellung zum Thema<br />
«Marke Region Sursee» zeigte auf spannende<br />
Weise, was die erweiterte Region<br />
am Sempachersee alles zu bieten hat. Als<br />
eines der modernsten Spitäler der Zentralschweiz<br />
konnte sich das LUKS Sursee<br />
als Gesundheitsmarke präsentieren. Das<br />
neue Zentrum für Endoskopie und Laparoskopie<br />
Sursee (ZELS), ein interdisziplinäres<br />
Angebot der Chirurgie, Gynäkologie und<br />
Medizin, wurde den Besuchern im persönlichen<br />
Gespräch, mit einem Filmbeitrag<br />
und an einem Laparoskopie-Übungsstand<br />
vorgestellt.<br />
Autoparkplätze<br />
Entspannung durch Provisorium<br />
Das LUKS Sursee erhielt im Juni <strong>2009</strong> von<br />
der lokalen Behörde die Bewilligung, an<br />
der Roman-Burri-Strasse einen temporären<br />
Parkplatz für maximal fünf Jahre zu<br />
errichten. Aufgrund des bisher äusserst<br />
akuten Parkplatzmangels erfolgte eine<br />
umgehende Realisierung, sodass bereits<br />
Mitte Oktober die zusätzlichen rund 100<br />
Autoabstellmöglichkeiten zur Verfügung<br />
standen. Weil das Parkplatzprovisorium<br />
bis 2014 befristet ist, laufen bereits Projektarbeiten<br />
für den Bau eines Parkhauses<br />
auf dem Spitalareal.
Medizin<br />
Umbau der Diagnostik<br />
Zwischen Oktober 2008 und Juni <strong>2009</strong> wurde die Abteilung Medizinische<br />
Diagnostik renoviert und modernisiert.<br />
Im Interesse der Patienten<br />
Durch das optimale Raumkonzept konnten in der Medizinischen<br />
Funktionsdiagnostik viele Verbesserungen erzielt werden. Ein<br />
neuer Vorbereitungsraum schützt die Intimsphäre der stationären<br />
Patienten. Auch das Angebot für die ambulanten Patienten<br />
wurde durch einen umgestalteten Empfang, ein modernes Warteareal<br />
und einen separierten Aufwachraum verbessert. Klar<br />
definierte Raumabschnitte und moderne Reinigungsabläufe<br />
erhöhen die Hygiene. Neu eingeführt wurde die digitale Bilddokumentation<br />
für Ultraschall- und Endoskopiebilder, die dank neuer<br />
Computersysteme in die elektronische Krankengeschichte<br />
übertragen werden können.<br />
Optimierte Arbeitsbedingungen<br />
Das neue Raumkonzept verbessert die Arbeitsbedingungen für<br />
Pflegende und Ärzte. Die Ärztebüros sind nun alle in der Medizinischen<br />
Diagnostik untergebracht und so eingerichtet, dass sie<br />
auch als Patientenbesprechungsräume genutzt werden können.<br />
Die Neuerungen haben zu Prozessoptimierungen und zu einer<br />
höheren Zufriedenheit sowohl der Patienten als auch der Angestellten<br />
geführt.<br />
Chirurgie und Orthopädie<br />
Eine Erfolgsgeschichte<br />
Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem LUKS Sursee<br />
und dem SPZ Nottwil auf dem Gebiet der Viszeralchirurgie wird<br />
weiter ausgebaut.<br />
Vertiefte Kooperation<br />
In der Viszeralchirurgie besteht schon seit Jahren, wie auch in<br />
anderen medizinischen Fachdisziplinen, eine enge Zusammenarbeit<br />
zwischen dem LUKS Sursee und dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum<br />
(SPZ) Nottwil. Seit der vollständigen Übernahme<br />
der Konsiliartätigkeit vertieft sich die Kooperation weiter – unter<br />
anderem im Rahmen des ZELS auf dem Gebiet der Gastroenterologie<br />
und Viszeralchirurgie mit eigens dafür zur Verfügung<br />
gestellten Untersuchungs- und Behandlungsräumen an der IVM<br />
(interventionelle Medizin) in Nottwil.<br />
Departement Sursee<br />
85
86 Departement Sursee<br />
Unkomplizierte Aufgabenteilung<br />
Die Anzahl Sprechstunden und die Behandlungen plegischer<br />
Patienten haben <strong>2009</strong> überdurchschnittlich stark zugenommen.<br />
Die Patienten des SPZ können nun die Sprechstunde in Nottwil<br />
besuchen, für spezielle Eingriffe im Rahmen des ZELS werden sie<br />
in Sursee behandelt und anschliessend zur Nachbehandlung, oft<br />
am gleichen Tag, wieder zurück nach Nottwil verlegt. Die ausgezeichnete,<br />
unkomplizierte und grosszügige Zusammenarbeit mit<br />
dem SPZ Nottwil ist nicht selbstverständlich und deshalb besonders<br />
erwähnenswert.<br />
Chirurgie und Orthopädie<br />
Varizentherapie mit Laser<br />
Das LUKS Sursee bietet eine neue Laserbehandlung von Krampf-<br />
adern an, die ambulant und schmerzarm durchgeführt werden<br />
kann. Das Verfahren und die Resultate begeistern Patientinnen<br />
und Patienten.<br />
Verbreitete Krampfaderleiden<br />
Jeder siebte Erwachsene leidet hierzulande unter einer Varikose<br />
(Krampfaderleiden) der unteren Extremitäten. Das klinische Spektrum<br />
ist dabei weit gefasst und reicht von ästhetischen Problemen,<br />
Schmerzen mit Schwellungszuständen oder Thrombosen<br />
(Verschluss von Blutgefässen) bis zum Ulcus cruris (chronische<br />
Wunde am Unterschenkel). Hauptsächlich betroffen sind dabei<br />
die Vena saphena magna (grosse Rosenvene) und die Vena saphena<br />
parva (kleine Rosenvene). Ersterkrankungen sind vor allem<br />
im dritten Lebensjahrzehnt zu beobachten.<br />
Die klassische Operation<br />
Am LUKS Sursee werden jeweils von September bis Mai rund 200<br />
Patienten aufgrund einer Varikose der unteren Extremitäten operiert.<br />
Dabei führt die klassische Operation zu einer Normalisierung<br />
der Druckverhältnisse und zu einer Durchbrechung des Rezirkulationskreislaufs.<br />
Trotzdem verhindert die Operation nicht in<br />
jedem Fall ein Rezidiv (Rückfall). Im Wundbereich der Crossektomie<br />
(Durchtrennung) und des Strippingskanals, wo die Vene herausgezogen<br />
worden ist, kommt es zudem gelegentlich zu einem<br />
grösseren Hämatom (Bluterguss) und zu Wundinfektionen. Ausserdem<br />
verbleiben dort auch grössere Narben.<br />
Das neue Verfahren<br />
Das Streben nach geringerer Invasivität – nach weniger in den<br />
Körper eindringenden Verfahren – führte zur Entwicklung endovenöser<br />
Therapien (ELVeS). Diese Therapieart wird ultraschall-
gesteuert durchgeführt, wobei eine thermische Induktion zur<br />
Phlebitis mit konsekutiver Obliteration der Vene führt. Das heisst,<br />
dass durch die kontrollierte Erhitzung, die durch einen Katheter<br />
mittels Laser erfolgt, die erkrankte Vene verklebt und sich in der<br />
Folge verschliesst. Damit ist das chirurgische Entfernen der Vene<br />
nicht mehr notwendig. Sie bildet sich zurück und wird vom Körper<br />
in Bindegewebe umgebaut. Der Vorteil dieser Methode liegt<br />
darin, dass sie ambulant in lokaler Tumeszenzanästhesie durchgeführt<br />
werden kann und vergleichsweise schmerzarm ist.<br />
Spezialisierung auf endovenöse Lasertherapien<br />
Bereits vor Jahren genoss Dr. Stephanie Scherz, Leitende Ärztin<br />
Chirurgie und Verantwortliche der endovenösen Therapien am<br />
LUKS Sursee, eine Ausbildung zur endovenösen Lasertechnik an<br />
der Charité Berlin – aktuell eines der grösseren europäischen<br />
Laserzentren – sowie diverse Weiterbildungen, unter anderem in<br />
Berlin, Aarau und Riga. Am LUKS Sursee begann Dr. Stephanie<br />
Scherz in Zusammenarbeit mit Dr. Jürg Nossen, Leitender Arzt<br />
Medizin, vor zwei Jahren mit endovenösen Lasertherapien nach<br />
einem klar definierten Protokoll.<br />
Glückliche Patientinnen und Patienten<br />
Am LUKS Sursee steht ein Lasergerät der neuesten Generation,<br />
das eigens für die hochmoderne Varizenbehandlung entwickelt<br />
worden ist, zur Verfügung. Die ersten Erfahrungen sind beeindruckend.<br />
Patienten und Therapeuten sind von den bisher erzielten<br />
Ergebnissen gleichermassen begeistert. Die Patienten sind über<br />
den echt minimalinvasiven, kaum schmerzhaften und ambulanten<br />
Eingriff in Lokalanästhesie überglücklich.<br />
Optimale Eingriffsergebnisse<br />
Die phlebologischen Kontrollen zeigen, dass die behandelten Venen<br />
bereits nach einem Monat in mehr als 90 Prozent der Fälle<br />
vollständig verschlossen sind. Komplikationen wurden bislang<br />
keine beobachtet. Die bisher eher kleineren Fallzahlen lassen<br />
aber noch keine endgültige Schlussfolgerung zu. In allen Fällen<br />
waren die Schmerzen durch die Gabe von Paracetamol beherrschbar.<br />
In der Zwischenzeit konnten zudem die postoperativen<br />
Schmerzen durch das Anpassen der Wellenlänge auf ein Minimum<br />
reduziert werden. Durch die Anwendung einer neuen<br />
Circumferential fibre (Ausdehnung) wurde eine weitere Optimierung<br />
des Eingriffsergebnisses erreicht.<br />
Trotz Wirtschaftlichkeit keine Pflichtleistung<br />
Die grösste Schwierigkeit der Methode liegt zurzeit bei der Abrechnung<br />
mit den Krankenversicherern, da die Lasertechnologie<br />
bisher keine Pflichtleistung darstellt. Aufgrund der laufenden<br />
Verhandlungen zwischen der Schweizerischen Gesellschaft für<br />
Departement Sursee<br />
87
88 Departement Sursee<br />
Angiologie und der Santésuisse, dem Verband der Schweizer<br />
Krankenversicherer, ist zu hoffen, dass diese effiziente und wirt-<br />
schaftliche Behandlung nicht mehr ausschliesslich Selbstzahlern,<br />
sondern einem grösseren Patientenkreis zugänglich gemacht<br />
wird.<br />
Gynäkologie und Geburtshilfe<br />
Neue Struktur, neue<br />
Technik<br />
Am LUKS Sursee wird die Professionalisierung in der Geburtshilfe<br />
und Gynäkologie weiter vorangetrieben.<br />
Zwei Verantwortungsbereiche<br />
Um den heutigen hohen Anforderungen gerecht zu werden, wurden<br />
in der Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie des LUKS Sursee<br />
Verantwortungsbereiche geschaffen. So ist neu Dr. Maysoon<br />
Iraki, Co-Chefärztin, für die gynäkologische Onkologie verantwortlich,<br />
während Dr. Joachim Manstein, Leitender Arzt, für die<br />
Geburtshilfe zuständig ist. Die Visitation verschiedener grösserer<br />
in- und ausländischer Kliniken bildete einen Teil der Vorbereitung<br />
dieser organisatorischen Massnahme. Die Gesamtverantwortung<br />
der Klinik obliegt nach wie vor Chefarzt Dr. Eduard Infanger.<br />
Steigende Nachfrage<br />
Dank steigender Nachfrage konnten die Angebote im Bereich der<br />
Geburtsvorbereitung ausgebaut werden. Eine weitere Ergänzung<br />
des Dienstleistungsangebots steht ebenso in Bearbeitung wie<br />
eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Neuen Frauenklinik<br />
am LUKS Luzern.<br />
Verbesserte Diagnostik<br />
Im Bereich der Ultraschallapparate konnten mit einer flächendeckenden<br />
Aufrüstung beziehungsweise dem Ersatz älterer Geräte<br />
die Möglichkeiten und die Qualität der Diagnostik erheblich verbessert<br />
werden.
Pflege<br />
Palliative Care<br />
Am LUKS Sursee wurde ein Konzept zur Betreuung von unheilbar<br />
kranken und sterbenden Menschen erarbeitet.<br />
Was heisst Palliative Care?<br />
Das LUKS Sursee definiert Palliative Care gemäss der Weltge-<br />
sundheitsorganisation (WHO) und der Schweizerischen Akade-<br />
mie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Demnach ist<br />
Palliative Care ein umfassender Betreuungsansatz, der die Le-<br />
bensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit einer un-<br />
heilbaren, lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert sind, för-<br />
dert. Durch vorbeugende und therapeutische Massnahmen<br />
werden Schmerzen und andere Beschwerden frühzeitig ange-<br />
gangen und gelindert. Entsprechend den Wünschen des Patien-<br />
ten werden physische, psychosoziale und spirituelle Aspekte be-<br />
rücksichtigt. Die Palliative Care erfolgt soweit möglich an dem<br />
Ort, den der Patient sich wünscht.<br />
Grundlage und Weiterentwicklung<br />
Die Erarbeitung des Konzepts «Umsetzung der Palliative Care am<br />
LUKS Sursee. Betreuung von unheilbar kranken und sterbenden<br />
Menschen» konnte abgeschlossen werden. Das Konzept definiert<br />
insbesondere die Strukturen und Prozesse im Bereich der Palli-<br />
ative Care, aus denen sich als Arbeitsmittel Handlungsanweisun-<br />
gen und Dokumentationsformulare für die Station ableiten lassen.<br />
Pflegefachpersonen mit Zusatzausbildung in Palliative Care<br />
unterstützen die Pflegefachpersonen auf den Abteilungen sowohl<br />
praktisch als auch theoretisch. Dazu gehören Beratung und<br />
Weiterbildung. Die Weiterentwicklung der Palliative Care am<br />
LUKS Sursee wird durch eine interdisziplinäre Projektgruppe gewährleistet.<br />
Departement Sursee<br />
89
Departement Wolhusen<br />
91
92 Departement Wolhusen<br />
Departementsleiter<br />
Dr. Richard F. Herzog<br />
«Die Fusion der <strong>Luzerner</strong><br />
Spitäler zum LUKS soll<br />
die Stärken der einzelnen<br />
Standorte fördern. Auch<br />
das LUKS Wolhusen hat<br />
viele Trümpfe, die es ausspielen<br />
kann. Nebst medizinischen<br />
Topleistungen<br />
unseres Spitals sind die<br />
menschliche Qualität unserer<br />
Mitarbeitenden, ihre<br />
grosse Empathie sowie<br />
ihre Verbundenheit mit<br />
dem Spital und der Region<br />
wesentliche Faktoren,<br />
um auch in Zukunft erfolgreich<br />
zu sein.»<br />
Dr. Richard F. Herzog,<br />
Departementsleiter<br />
Bereichsleitungen<br />
Chirurgie & Orthopädie<br />
Dr. Urs Diener,<br />
Chefarzt Chirurgie<br />
Dr. Richard F. Herzog,<br />
Chefarzt, Orthopädie<br />
Gynäkologie/Geburtshilfe<br />
Dr. Edith Vogel,<br />
Chefärztin<br />
Medizin<br />
Dr. Martin Peter,<br />
Chefarzt<br />
Anästhesie<br />
Dr. Stefan Zbinden,<br />
Chefarzt<br />
Betriebswirtschaft<br />
Josef Odermatt,<br />
Leiter<br />
Pflegedienst<br />
Judith Schwander,<br />
Leiterin<br />
Leitendes Personal<br />
Chirurgie & Orthopädie<br />
Dr. Urs Diener,<br />
Chefarzt Chirurgie<br />
Dr. Richard F. Herzog,<br />
Chefarzt, Orthopädie<br />
Dr. Pascal Schai,<br />
Leitender Arzt Orthopädie<br />
Gynäkologie/Geburtshilfe<br />
Dr. Edith Vogel,<br />
Chefärztin<br />
Dr. Hans Schori,<br />
Leitender Arzt<br />
Medizin<br />
Dr. Martin Peter,<br />
Chefarzt<br />
Dr. Tobias Ehmann,<br />
Co-Chefarzt<br />
Anästhesie<br />
Dr. Stefan Zbinden,<br />
Chefarzt<br />
Dr. Roger Schmid,<br />
Co-Chefarzt<br />
Radiologie<br />
Dr. Mike Fitze,<br />
Leitender Arzt
Spital Wolhusen<br />
Klein, aber fein<br />
Im grossen Verbund setzt das «kleine» LUKS Wolhusen auf seine<br />
besonderen Stärken.<br />
Guter Ruf<br />
Der Kampf der Leistungserbringer um Patienten wird immer härter.<br />
Dabei nimmt die einst so verpönte Werbung im Gesundheitsmarkt<br />
teilweise bedenkliche Formen an. Umso erfreulicher ist der<br />
gute Ruf, den das LUKS Wolhusen nicht mit teurer Werbung, sondern<br />
mit hervorragenden Leistungen erreicht hat. Entsprechend<br />
lang sind die Wartezeiten für elektive Behandlungen. Diese Wartezeiten<br />
beweisen die grosse Nachfrage, sind aber gleichzeitig ein<br />
bedeutender Wettbewerbsnachteil. Es ist deshalb wichtig, dass<br />
das LUKS Wolhusen über die erforderlichen Ressourcen verfügt,<br />
damit es durch Wachstum, hohe Fallzahlen (Caseload) und grosse<br />
Behandlungsqualität auch in Zukunft – unter dem neuen Fallpauschalensystem<br />
DRG – seinen Auftrag erfüllen kann.<br />
Positiver Geist<br />
Es gilt die Stärken des LUKS Wolhusen zu fördern. Die strategisch<br />
festgelegten Schwerpunkte müssen wahrnehmbar sein. Mit der<br />
Fusion der <strong>Luzerner</strong> Spitäler zum LUKS werden die Zusammenarbeit<br />
verstärkt und gleichzeitig die lokalen Kompetenzen gefördert.<br />
Auch wenn auf diesem Weg noch Hindernisse zu überwinden<br />
sind, ist das Bekenntnis zum jungen Konzern ungebrochen.<br />
Der positive Geist lebt weiter – zum Wohl und Erfolg des LUKS.<br />
Chirurgie und Orthopädie<br />
Der Erfolg und seine<br />
Schatten<br />
Die Nachfrage nach chirurgischen und besonders nach orthopädischen<br />
Leistungen ist sehr hoch. Dies dürfte in Zukunft zu längeren<br />
Betriebszeiten der Operationssäle führen.<br />
Wiederum mehr als 4000 Eingriffe<br />
Die Klinik für Chirurgie und Orthopädie blickt auf ein intensives<br />
und sehr erfolgreiches Jahr zurück. Mit vereinten Kräften ist es<br />
gelungen, das Rekordergebnis von mehr als 4000 Eingriffen im<br />
Jahr 2008 erneut zu übertreffen. Dies bei einer über vier Monate<br />
dauernden schwierigen Situation infolge von OP-Personalmangel<br />
und fehlender Leitung und dadurch reduziertem OP-Betrieb. Die<br />
Departement Wolhusen<br />
in der Orthopädie bereits bekannten wochenlangen Wartefristen<br />
für Patienten haben ein nicht mehr tolerables Ausmass ange-<br />
nommen und die Konkurrenzfähigkeit arg strapaziert. Durch den<br />
guten Ruf der Klinik und das Verständnis der Hausärzte konnte<br />
das Abwandern vieler Patienten trotzdem vermieden werden.<br />
Das verbliebene Personal hat die vakanten Aufgaben pflichtbewusst<br />
und kompetent übernommen und zahlreiche Überstunden<br />
geleistet, sodass das Schlimmste, nämlich der totale Kollaps, vermieden<br />
werden konnte.<br />
Ungebrochene Nachfrage<br />
Ab Mitte Jahr hat sich die Situation, auch durch die Anstellung<br />
von Temporärpersonal, markant und nachhaltig gebessert. Dazu<br />
beigetragen hat die Schaffung einer weiteren Oberarztstelle Orthopädie.<br />
Dadurch konnten auch die vorübergehend enormen<br />
Wartezeiten wieder etwas reduziert werden. Der Aufwärtstrend<br />
ist ungebrochen. Die Nachfrage nach chirurgischen und speziell<br />
orthopädischen Leistungen ist mit dem bestehenden Team und<br />
den räumlichen Ressourcen kaum noch zu decken. Um der Nachfrage<br />
auch in Zukunft genügen zu können, wird eine Ausweitung<br />
der Betriebszeiten der Operationssäle nicht zu vermeiden sein.<br />
93
94 Departement Wolhusen<br />
Blickpunkte<br />
Anästhesie<br />
10 Jahre akuter Schmerzdienst<br />
In den vergangenen zehn Jahren hat sich<br />
der Schmerzdienst stetig weiterentwi-<br />
ckelt. Bei der letzten Re-Zertifi zierung hat<br />
er die Bestnote erzielt.<br />
Einheitliches Schmerzkonzept<br />
Der Begriff «akute Schmerztherapie» ersetzt<br />
im stationären Bereich den bislang<br />
verwendeten Ausdruck der postoperativen<br />
Schmerztherapie. Die Grundsätze sind<br />
im Jahr 2000 in einem einheitlichen<br />
Schmerzkonzept der Standorte Wolhusen<br />
und Sursee defi niert worden. Das LUKS<br />
Wolhusen ist diesen Grundsätzen verpfl<br />
ichtet, doch sind standortspezifi sche<br />
Handlungsanweisungen notwendig, um<br />
den konkreten Anforderungen in Wolhusen<br />
gerecht zu werden.<br />
Kontinuierliches Analgesieverfahren<br />
Gerade die orthopädischen Eingriffe zählen<br />
mitunter zu den schmerzhaftesten<br />
Eingriffen überhaupt und verlangen meist<br />
ein über Tage dauerndes sogenanntes<br />
kontinuierliches Analgesieverfahren mittels<br />
Kathetertechnik. Hierbei kommen neben<br />
den rückenmarknahen Katheterverfahren<br />
vorwiegend kontinuierliche<br />
periphere Nervenblockaden zum Einsatz.<br />
Die peripheren Katheter werden mit der<br />
grösstmöglichen Sorgfalt standardmässig<br />
unter sonographischer Kontrolle eingelegt.<br />
Zur kontinuierlichen Applikation der<br />
Schmerzmedikation kommt eine Präzisionspumpe<br />
zum Einsatz. Die Pumpe wird<br />
für unterschiedliche schmerztherapeutische<br />
Verfahren eingesetzt und entsprechend<br />
dem gewählten Verfahren farblich<br />
gekennzeichnet. Über einen Druckknopf<br />
an der Pumpe kann der Patient aufgrund<br />
seiner Bedürfnisse die Schmerztherapie<br />
autonom mitgestalten.<br />
Sechsköpfi ges Kernteam<br />
Für die Schmerzerfassung, Planung und<br />
Kontrolle der Schmerztherapie ist ein<br />
sechsköpfi ges Kernteam, der sogenannte<br />
Schmerzdienst, zuständig. Das therapeutische<br />
Vorgehen wird täglich zusammen<br />
mit dem Kaderarzt Anästhesie evaluiert<br />
und gegebenenfalls angepasst. Zusätzlich<br />
sind alle involvierten Bereiche (Physiotherapie,<br />
Ärzte und Abteilungen) mit einem<br />
Vertreter in engem Kontakt mit dem<br />
Schmerzdienst.<br />
Zielorientierte<br />
Zusammenarbeit<br />
Erst die perfekt abgestimmte Kette von Indikationsstellung,<br />
Planung, Operation und<br />
korrekter Nachsorge garantiert dem Patienten<br />
das bestmögliche operative Resultat.<br />
Das LUKS Wolhusen bemüht sich um<br />
eine zielorientierte, auf das funktionelle<br />
Endergebnis ausgerichtete Zusammenarbeit.<br />
Die ausgereifte Kombination von unterschiedlichen<br />
Analgesieverfahren ist<br />
eine wesentliche Voraussetzung, um diesem<br />
Ziel gerecht zu werden.<br />
Bestnote bei Re-Zertifi zierung<br />
In den vergangenen zehn Jahren hat der<br />
Schmerzdienst einen Reifeprozess durchlaufen,<br />
der im Rahmen der letzten Re-Zertifi<br />
zierung im Jahr 2008 mit der Bestnote<br />
belohnt wurde. Auch in Zukunft sind weitere<br />
Prozessoptimierungen nur zu erreichen,<br />
wenn alle involvierten Disziplinen –<br />
Abteilungspfl ege, Schmerzdienst (Anästhesie),<br />
Operateur und Physiotherapie<br />
– eine Plattform für den gemeinsamen<br />
Austausch pfl egen. Diese Sozialkompetenz<br />
existiert am Standort Wolhusen und<br />
soll auch in Zukunft zum Wohl des Patienten<br />
konsequent weitergelebt werden.
Neuer Entwicklungsschub<br />
In der Allgemeinchirurgie führte die intensive interdisziplinäre<br />
und interkollegiale Zusammenarbeit zu einer starken Zunahme<br />
im Bereich der gastroenterologischen und der Schilddrüsenchirurgie,<br />
wo die letztjährigen Zahlen praktisch verdoppelt wurden.<br />
Die sehr hohe Patientenzufriedenheit ist Lohn und Motivation<br />
zugleich. Die laparoskopische Chirurgie erlebt international seit<br />
zwei Jahren einen erneuten Entwicklungsschub hin zu immer<br />
weniger Zugängen und einem neuen Instrumentarium. Am LUKS<br />
Wolhusen wurde bereits Anfang <strong>2009</strong> die SILS-Technik (Single Incision<br />
Laparoscopic Surgery, laparoskopische Operationen über<br />
einen einzigen Zugang) für ausgewählte Cholezystektomien eingeführt.<br />
So konnten an vorderster Front solide Erfahrungen gesammelt<br />
und die Technik weiterentwickelt werden. Eine personelle<br />
Verstärkung in der Chirurgie wird unumgänglich und ist in<br />
der Funktion eines Leitenden Arztes Chirurgie für 2010 vorgesehen.<br />
Durch kleinere bauliche Massnahmen konnten mit minimalen<br />
finanziellen Mitteln die Attraktivität und die Funktionalität der<br />
Sekretariate und der Anmeldung verbessert werden.<br />
10 Jahre Orthopädie in Wolhusen<br />
Per 1. Januar <strong>2009</strong> feierte die Orthopädie am LUKS Wolhusen ihr<br />
zehnjähriges Bestehen. Aus einer anfänglichen One-Man-Show<br />
wurde innert weniger Jahre ein Team, das aus einem Chefarzt,<br />
zwei Leitenden Ärzten und vier Oberärzten besteht. In dieser Zeit<br />
wurden zahlreiche Innovationen etabliert. Als erste Zentralschweizer<br />
Klinik verfügte die Orthopädie am LUKS Wolhusen<br />
über ein Navigationsgerät zur computergestützten Implantation<br />
von Hüft- und Knieprothesen. Als eine der ersten Kliniken weltweit<br />
führte die Wolhuser Orthopädie bereits 2001 komplexere<br />
Hüfteingriffe arthroskopisch durch und entwickelte im Jahr 2005<br />
in Zusammenarbeit mit der Industrie auch hierzu ein Navigationsprogramm.<br />
2001 wurden die Oberflächenersatzarthroplastik<br />
des Hüftgelenks und 2003 minimalinvasive Zugangstechniken<br />
eingeführt. Mit über 100 arthroskopischen Eingriffen an der Hüfte<br />
zählt die Orthopädie am LUKS Wolhusen heute definitiv zu den<br />
führenden Schweizer Kliniken in diesem Bereich. Auch die Oberflächenersatzarthroplastik<br />
am Hüftgelenk bleibt zentralschweizerisch<br />
eine Exklusivität des Standorts Wolhusen.<br />
Grosses Wachstumspotenzial<br />
Auch im Bereich der Schulterchirurgie hat der Trend zu minimalinvasiven<br />
arthroskopischen Techniken zugenommen, sodass Rotatorenmanschetten-Läsionen<br />
zunehmend ebenfalls arthroskopisch<br />
behandelt werden. Der gute Ruf führt zu Zuweisungen aus<br />
der ganzen Schweiz und immer mehr auch aus dem benachbarten<br />
Ausland. Innerhalb der letzten Jahre, speziell <strong>2009</strong>, ist es gelungen,<br />
mehrere Publikationen in renommierten Fachzeitschrif-<br />
Departement Wolhusen<br />
ten unterzubringen, was eine beachtliche Leistung für das<br />
ehemalige Regionalspital Wolhusen darstellt. Die diesbezügliche<br />
Bedeutung wurde auch durch mehrere Einladungen zu Gastrefe-<br />
raten an internationalen Kongressen bestätigt. Der Boom in der<br />
Orthopädie ist ungebrochen und ein grosses Wachstumspotenzial<br />
vorhanden.<br />
Innere Medizin<br />
«Aus der Region,<br />
für die Region»<br />
Die Klinik für Innere Medizin spielt in der regionalen Gesundheitsversorgung<br />
eine zentrale Rolle. Dabei bewährt sich die Zusammenarbeit<br />
mit den Hausärztinnen und Hausärzten in mehrfacher<br />
Weise.<br />
Spezielle Situation eines Landspitals<br />
Die Klinik für Innere Medizin ist ein Hauptpfeiler der medizinischen<br />
Grundversorgung in einer grossflächigen Region, die gut<br />
95
96<br />
Departement Wolhusen<br />
einen Drittel des Kantons Luzern einnimmt. Über viele Jahre ist<br />
ein ausgesprochen dichtes und tragfähiges Netzwerk in der regionalen<br />
Gesundheitsversorgung entstanden, besonders auch<br />
mit den Hausärztinnen und Hausärzten. Denn im Einzugsgebiet<br />
des LUKS Wolhusen, das grosse Teile des <strong>Luzerner</strong> Hinterlands<br />
und die Talschaft des Entlebuchs flussabwärts bis nach Malters<br />
umfasst, gibt es keine einzige Spezialarztpraxis für internistische<br />
Subdisziplinen. Es ist daher eine der zentralen Aufgaben der Medizinischen<br />
Klinik, auf hausärztliche Zuweisung die regionalen<br />
Bedürfnisse nach ambulanten fachärztlichen Abklärungen abzudecken.<br />
Mit einem kleinen Team von Kaderärzten wird die Spitalregion<br />
nahezu vollständig in den internistischen Fachgebieten<br />
Kardiologie, Gastroenterologie, Rheumatologie, Diabetologie-<br />
Endokrinologie und Onkologie versorgt. Die ambulanten Konsultationen<br />
sind deshalb dreimal häufiger als die stationären Behandlungen.<br />
Enge Zusammenarbeit mit LUKS Luzern<br />
Medizinische Abklärungen und Behandlungen werden immer<br />
komplexer und können oft nur noch von hoch spezialisierten<br />
Fachärzten angeboten werden. Es ist der Medizinischen Klinik<br />
gelungen, diese Aufgabe durch einen Schulterschluss mit Kader-<br />
ärzten des LUKS Luzern zu lösen. Fachärzte der Onkologie, Rheu-<br />
matologie, Angiologie und Kardiologie arbeiten in Teilzeitpensen<br />
sowohl in Luzern wie auch in Wolhusen und garantieren die ambulante<br />
medizinische Versorgung der Region. Bei den hospitalisierten<br />
Patienten dürfen der ganzheitliche Aspekt und der Überblick<br />
über die Behandlungskette nicht verloren gehen, was durch<br />
die enge Zusammenarbeit von Allgemeininternisten und Fachspezialisten<br />
gelungen ist. Noch gibt es aber Versorgungslücken<br />
und Engpässe. Nach wie vor fehlt ein Lungenfacharzt in Wolhusen.<br />
Zudem sind die Kapazitätsgrenzen in der Onkologie und der<br />
Gastroenterologie aus personellen Gründen längst erreicht, was<br />
zu Wartezeiten oder Verlegungen führt.<br />
Aufbau der <strong>Luzerner</strong> Akutgeriatrie<br />
Der Kanton Luzern hat eine sehr hohe Dichte an Pflege- und Altersheimen,<br />
er verfügt über etwa 60 Institutionen für die Langzeitpflege.<br />
Es fehlt aber eine akutgeriatrische Klinik, die zum Ziel<br />
hat, die Unabhängigkeit und Autonomie von betagten Patienten<br />
zurückzugewinnen, damit diese ihren Lebensabend in ihrer gewohnten<br />
Umgebung verbringen können. Es ist die Aufgabe einer<br />
Akutgeriatrie, unterstützende Netzwerke zu koordinieren und<br />
alle Gesundheitsdimensionen zu berücksichtigen – nicht nur die<br />
körperliche, sondern auch die soziale, psychische und funktionelle<br />
Gesundheit sowie die Lebens- und Wertvorstellung eines<br />
Patienten.<br />
Akutgeriatrische Station im LUKS Wolhusen<br />
Bereits 2005 hat der <strong>Luzerner</strong> Regierungsrat der Schaffung einer<br />
kantonalen Akutgeriatrie eine grosse Priorität zugeordnet. Der<br />
Spitalrat hat in der Folge ein Vorprojekt durchführen lassen und<br />
im Sommer <strong>2009</strong> dem Umsetzungskonzept zugestimmt. Dieses<br />
sieht vor, eine akutgeriatrische 10-Betten-Station im LUKS Wolhusen<br />
einzurichten und der Inneren Medizin organisatorisch anzugliedern.<br />
Die Akutgeriatrie beginnt also bescheiden, soll aber<br />
der Zündfunke für eine kantonale Akutgeriatrie sein, die im<br />
Endausbau etwa 5 Prozent der Akutbetten (also etwa 45 Betten)<br />
vorsieht.<br />
Das LUKS Wolhusen war Ende <strong>2009</strong> für den Betrieb einer akutgeriatrischen<br />
Bettenstation gerüstet, nachdem die Räumlichkeiten<br />
im Spätherbst <strong>2009</strong> bereitgestellt worden waren. Schwieriger<br />
gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten ärztlichen<br />
Leiter, der, so ist zu hoffen, in der ersten Hälfte 2010 die erste<br />
<strong>Luzerner</strong> Akutgeriatrie eröffnen wird.<br />
Eröffnung der Hausärztlichen Notfallpraxis<br />
Im Januar <strong>2009</strong> haben sich 22 Hausärzte zusammengefunden,<br />
die in den Räumlichkeiten der Medizinischen Tagesklinik Wolhusen<br />
einen hausärztlichen Notfalldienst für die regionale Bevölke-
ung anbieten. Diese Notfallpraxis wird fachlich und organisato-<br />
risch unabhängig vom Spital betrieben und ist ähnlich organisiert<br />
wie jene am LUKS Luzern. Sie ist an Werktagen von 18 bis 23 Uhr<br />
geöffnet, samstags von 12 bis 23 Uhr und sonntags von 8 bis 21<br />
Uhr. Bereits nach wenigen Monaten hat sich gezeigt, dass die<br />
Notfallpraxis in der dünn besiedelten und weitläufigen Region ein<br />
Erfolgsmodell ist. Deshalb schliessen sich ab Januar 2010 weitere<br />
acht Hausärzte aus der Region Willisau an. Die hohe zeitliche<br />
Präsenz der Landärzte wurde durch diese Konzentration auf eine<br />
zentrale Notfallversorgung in den Randzeiten deutlich reduziert.<br />
Zudem entstand eine Kultur des kollegialen Erfahrungsaustauschs<br />
zwischen den Grundversorgern und Spitalärzten. Assistenzärztinnen<br />
und -ärzte haben die Möglichkeit, von der Erfahrung<br />
eines Hausarztes zu profitieren. Umgekehrt können<br />
komplexe medizinische Situationen unkompliziert mit Spitalfachärzten<br />
diskutiert werden.<br />
Assistenzärzte in der Ausbildung bei Hausärzten<br />
Das Curriculum für werdende Allgemeinmediziner oder Internisten<br />
schreibt eine einjährige Weiterbildung in ambulanter Medizin<br />
vor. Seit Herbst 2008 befindet sich aus dem Assistenzarzt-Team<br />
der Medizinischen Klinik permanent eine Mitarbeiterin oder ein<br />
Mitarbeiter in einer mehrmonatigen Praxisassistenz bei niedergelassenen<br />
Hausärzten der Region. Es handelt sich um eine<br />
strukturierte Weiterbildung in Lehrarztpraxen, die von der Medizinischen<br />
Klinik finanziell mitgetragen wird. Die Vorteile sind<br />
mehrfach: Junge Ärzte lernen den Beruf des Grundversorgers<br />
kennen und schätzen und sie bringen diese Erfahrung zurück in<br />
die Klinik (die Rückkehr ist eine Bedingung). Zudem wird der Austausch<br />
zwischen Spital und hausärztlicher Grundversorgung intensiver<br />
und die Hausärzte erfahren eine Unterstützung durch<br />
die öffentliche Hand. Vielleicht lässt sich damit ein weiteres Ausdünnen<br />
der Hausarztpraxen verhindern, denn viele Grundversorger<br />
der Region nähern sich dem Pensionsalter. Die einjährige Erfahrung<br />
zeigt: Begeistert sind beide Seiten, sowohl die Spital- als<br />
auch die Hausärzte.<br />
Gynäkologie/Geburtshilfe<br />
Das 22 222. Baby!<br />
In der Geburtenabteilung des LUKS Wolhusen haben bisher<br />
22 489 Kinder das Licht der Welt erblickt. Die individuelle Betreuung,<br />
die hohe Kompetenz und die familiäre Atmosphäre finden<br />
regen Zuspruch.<br />
Die Zukunft der Geburtshilfe in Wolhusen<br />
Departement Wolhusen<br />
Im April <strong>2009</strong> gab die Zukunft der Geburtshilfe in Wolhusen in Po-<br />
litik und Bevölkerung erneut zu diskutieren. Trotzdem blieb das<br />
Personal motiviert und leistete einmal mehr enorme und ausgezeichnete<br />
Arbeit. An der Kadertagung Ende Oktober auf Menzberg<br />
war dies Anlass genug, um die Situation zu diskutieren und<br />
Lösungen für die Zukunft zu suchen. Auf allen Ebenen war eine<br />
starke Solidarität zu spüren. Die Geburtenzahl blieb auch in<br />
diesem Jahr konstant bei knapp 500. Am 13. Juni erblickte das<br />
22 222. Baby, ein kräftiger Knabe, das Licht der Welt. Seit der Eröffnung<br />
des Spitals wurden in Wolhusen bis zum 31. Dezember<br />
<strong>2009</strong> 22 489 Kinder geboren.<br />
Reichhaltiges Angebot<br />
Die Hebammen und Pflegefachfrauen boten rund um die Geburt<br />
wiederum zahlreiche Kurse an, die bei den Frauen auf grossen<br />
Anklang stiessen. Nebst «Kinästhetik Infant Handling», «Tragtuch<br />
binden», «Hebammensprechstunde», «Ambulante Stillberatung»,<br />
«Yoga» und so weiter konnte das Angebot durch «Akupunktur»<br />
erweitert werden. Einige Hebammen haben sich diesbezüglich<br />
intensiv weitergebildet. Sehr beliebt sind weiterhin die Kurse zur<br />
«Geburtsvorbereitung im Wasser» sowie «Rückbildungsgymnas-<br />
97
98 Departement Wolhusen<br />
tik und Beckenbodenarbeit im Wasser». Diese Kurse sind mehr-<br />
heitlich ausgebucht, sodass mangels Kapazitäten auch schon<br />
Frauen abgewiesen werden mussten.<br />
Beliebte Kindersegnung<br />
Jeden Dienstagabend findet in der Spitalkapelle eine Segnung für<br />
die Neugeborenen statt. Eltern segnen zusammen mit dem Seel-<br />
sorger ihre Kinder, unabhängig von Konfession und Religionszugehörigkeit.<br />
Sie danken Gott für die Geburt ihres Kindes und bitten<br />
um Schutz für ihr Neugeborenes. Oft sind auch Geschwister<br />
mit dabei. Diese Kindersegnung findet grosse Anerkennung und<br />
ist gerade auch bei Menschen beliebt, die der Kirche fernstehen.<br />
Die Spitalseelsorger engagieren sich stark für die feierliche Gestaltung<br />
dieser Segnung, die nicht mehr wegzudenken ist: Seit<br />
sieben Jahren ist sie fester Bestandteil der Geburtenabteilung.<br />
Attraktives Umfeld für junge Eltern<br />
Seit Jahren wird im benachbarten Personalhaus ein Familienwochenbett<br />
angeboten. Für das Wochenbett steht den jungen<br />
Eltern eine Dreizimmerwohnung zur Verfügung. Dieses Angebot<br />
wurde ergänzt durch das Familienwochenbett auf der Abteilung.<br />
In diesem Jahr hat sich eher eine Verlagerung auf die Abteilung<br />
gezeigt. Die Nähe zur Hebamme und zum Wochenbett-Team ist<br />
offenbar mehr gewünscht. Die Räumlichkeiten des Familienwochenbetts<br />
im Personalraum werden zusätzlich für die Hebammensprechstunde<br />
genutzt. Dies bietet den werdenden Eltern die<br />
Gelegenheit, mit der Hebamme in einer wohnlichen und ruhigen,<br />
von der Klinik abgesonderten Atmosphäre Gespräche zu führen.<br />
Radiologie<br />
Auf top getrimmt<br />
Die Gesamterneuerung der Radiologie erfolgte Schlag auf Schlag:<br />
im Januar in der Mammographie, im Juni mit dem neuen DR-<br />
Röntgensystem, im Dezember mit der Anbindung des radiologischen<br />
Bildgeräts im OP an das PACS.<br />
Mehr Effizienz, neue Möglichkeiten<br />
Die Modernisierung der Röntgenabteilung erfolgte über zwei Jahre.<br />
Ein neuer Gerätepark und bauliche Massnahmen waren notwendig<br />
geworden, um die zunehmende Anzahl der Untersuchungen<br />
weiterhin erfolgreich bewältigen zu können. Moderne<br />
Systeme erlauben in der täglichen Arbeit eine höhere Effizienz.<br />
Der Modernisierungsprozess begann mit der Einführung des<br />
PACS (Picture Archiving and Communication System) und eines<br />
neuen RIS (Radiology Information System) im August 2007.<br />
Gleichzeitig wurde der neue Rapportraum mit Beamer eingeweiht.<br />
Im November 2007 konnte der Ersatz des alten 1-Zeilen-<br />
Computertomographen (CT) durch ein modernstes 64-Zeilen-<br />
Multi-Slice-CT-Gerät realisiert werden. Dieses eröffnet ganz neue<br />
diagnostische Möglichkeiten und wird den Ansprüchen der modernen<br />
Medizin gerecht.<br />
Optimierte Raumverteilung<br />
Ende 2008/Anfang <strong>2009</strong> konnte die Röntgenabteilung durch den<br />
Umzug des Zentralsekretariats erweitert werden. Trotz der Vergrösserung<br />
ist die Abteilung kompakt geblieben: Der grosse<br />
Raum des ehemaligen Zentralsekretariats wurde in drei gleichmässige<br />
Räume unterteilt, sodass – zusammen mit dem ehemaligen<br />
Rapportraum – vier beieinanderliegende zusätzliche Räume<br />
entstanden. Damit konnten ein Warteraum für die ambulanten<br />
Patienten, eine Röntgenanmeldung/Sekretariat Radiologie und<br />
ein eigener Raum für die Mammographie eingerichtet werden.<br />
Vorher war die Mammographie lediglich durch einen Bleivorhang<br />
abgetrennt in einem der beiden Röntgenräume untergebracht.<br />
Positives Patientenecho<br />
Im vierten Raum nahm die Radiologie im März <strong>2009</strong> direkt neben<br />
der Mammographie ein eigenes Ultraschallgerät in Betrieb, das<br />
jeweils am Freitagvormittag auch dem Angiologischen Konsiliardienst<br />
zur Verfügung steht. Nach Ostern <strong>2009</strong> wurde die letzte<br />
Etappe in Angriff genommen: Die bisher eher düsteren Röntgenräume<br />
wurden renoviert, hell und freundlich gestaltet und die<br />
Geräte durch modernste DR-Systeme (Direct-Radiography-Systeme)<br />
ersetzt. Mitte Juni <strong>2009</strong> konnte das neue voll digitale Röntgen-<br />
und Durchleuchtungssystem in Betrieb genommen werden.
Im Dezember <strong>2009</strong> folgte die Anbindung des radiologischen Bild-<br />
geräts (BV) im OP an das PACS. Durch die Effizienzsteigerung<br />
konnte die zunehmende Zahl der Röntgenuntersuchungen aus<br />
den ambulanten Sprechstunden ohne zusätzlichen Aufwand be-<br />
wältigt werden. Patienten, die noch die alte Abteilung kannten,<br />
haben auf die Gesamterneuerung in zahlreichen Rückmeldungen<br />
sehr positiv reagiert.<br />
Pflege<br />
Stärkung der Palliative<br />
Care<br />
Palliative Care und patientenzentrierte Pflege richten sich nach<br />
dem Patienten aus und respektieren seine Autonomie. Am LUKS<br />
Wolhusen wurde ein neues Palliative-Care-Konzept eingeführt.<br />
Heilender versus palliativer Ansatz?<br />
In einem Akutspital steht meist die Heilung an erster Stelle. Deshalb<br />
war es für die Projektgruppe Palliative Care wichtig, sich<br />
bewusst mit der Haltung auseinanderzusetzen, dass der heilende<br />
und der palliative Ansatz gleichwertig sind. Die Selbstbestimmung<br />
respektive die Autonomie des Patienten widerspiegelt sich<br />
in der palliativen Betreuung und in der patientenzentrierten Pflege.<br />
Die Patienten sind Experten ihres eigenen Lebens und möchten<br />
in partizipativer Zusammenarbeit betreut werden.<br />
Interdisziplinär erarbeitetes Konzept<br />
Das Palliative-Care-Angebot am LUKS Wolhusen wurde interdisziplinär<br />
ausgearbeitet und eingeführt. Pflegedienst, ärztlicher<br />
Dienst, Seelsorge und Sozialdienst waren in die Erarbeitung des<br />
Konzepts eingebunden. Zur Kompetenzerweiterung in diesem<br />
Gebiet absolvierten im Vorfeld eine Pflegefachfrau die höhere<br />
Fachausbildung in Palliative Care (HöFa I) und zwei weitere Pflegefachpersonen<br />
einen Zertifikationskurs in Palliative Care.<br />
Linderung von Leiden und Schmerzen<br />
Das Palliative-Care-Konzept basiert auf dem neuen Artikel 32,<br />
Absatz 3 des überarbeiteten Spitalgesetzes: «Unheilbar kranke<br />
und sterbende Patientinnen und Patienten haben Anspruch auf<br />
eine angepasste Betreuung sowie auf Linderung ihrer Leiden und<br />
Schmerzen nach den Grundsätzen der Palliativmedizin und -pflege.»<br />
Richtungsweisend für die Erarbeitung waren die Grundlagen<br />
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften<br />
(SAMW), der Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Medizin,<br />
Pflege und Begleitung (SGPMP) sowie der «Liverpool Care<br />
Departement Wolhusen<br />
Pathway», der vom <strong>Kantonsspital</strong> St. Gallen ins Deutsche über-<br />
setzt und in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt<br />
wurde.<br />
Umsetzung in die Praxis<br />
Das von der Projektgruppe erarbeitete Konzept ist auf den<br />
Grundsätzen einer palliativen Betreuung aufgebaut. Für die Umsetzung<br />
in die Praxis wurden dazu verschiedene Unterlagen erarbeitet.<br />
Am LUKS Wolhusen hat man sich entschieden, die Patienten<br />
auf den verschiedenen Stationen zu betreuen. Die<br />
Patienten, Pflegefachpersonen und Ärzte werden von einem gut<br />
ausgebildeten Palliative-Care-Team unterstützt. Damit der Patient<br />
und seine Angehörigen eine qualitativ gute Betreuung erhalten,<br />
wird mit dem Betreuungsplan – analog zum «Liverpool Care<br />
Pathway» – gearbeitet. Das Palliative-Care-Team berät das interdisziplinäre<br />
Betreuungsteam des Patienten auf der Station, vernetzt<br />
interne und externe Dienste und ist bestrebt, die Qualität<br />
der palliativen Betreuung im Haus sicherzustellen und zu optimieren.<br />
Neues Bewusstsein für Palliative Care<br />
Seit der Einführung des Konzepts im Frühjahr <strong>2009</strong> hat sich gezeigt,<br />
dass der Patient und seine Angehörigen von der Kontinuität<br />
in der Betreuung und den vereinbarten Massnahmen profitieren<br />
können. Die neu geschaffenen Grundlagen führten zu einer<br />
verbesserten interdisziplinären Zusammenarbeit und haben zu<br />
einem erweiterten Verständnis von Palliative Care beigetragen.<br />
99
100 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Finanzen und Personal / Stabsstellen<br />
Departementsleiter<br />
Dr. sc. Hansjörg Schmid<br />
Dr. Guido Schüpfer<br />
Leiter Stab Medizin<br />
Jürg Aebi<br />
Leiter<br />
Stab Direktion<br />
bis 30.11.<strong>2009</strong><br />
Robert Bisig<br />
Leiter<br />
Stab Direktion<br />
ab 15.11.<strong>2009</strong><br />
Finanzen und Personal<br />
Leitendes Personal<br />
Leiter Finanzen<br />
Kurt Heinzer<br />
Leiter Personaldienst<br />
Hans-Rudolf Meier<br />
Stabsstellen<br />
Stab Medizin<br />
Leiter<br />
Dr. Guido Schüpfer, MBA HSG, PhD<br />
Leiterin Arbeitsmedizin<br />
Dr. Edith Betschart<br />
Leiter Klinische Systeme (CLS)<br />
Dr. Stefan Hunziker<br />
Leiter Medizinalcontrolling<br />
Dr. Karl-Friedrich Hanselmann<br />
Leiter Infektiologie und Spitalhygiene<br />
Dr. Marco Rossi<br />
Leiter Qualitäts- und Riskmanagement<br />
Dr. Thomas Kaufmann<br />
Stab Direktion<br />
Leiter<br />
Jürg Aebi (bis 30.11.<strong>2009</strong>)<br />
lic. iur. Robert Bisig (ab 15.11.<strong>2009</strong>)<br />
Leiter Kommunikation und Marketing<br />
Othmar Bertolosi<br />
Leiterin Multiprojektmanagement<br />
Prisca Birrer-Heimo<br />
Rechtsdienst<br />
Viktor Lang (bis 31.5.<strong>2009</strong>)
Kennzahlen <strong>2009</strong>
102 Jahresrechnung<br />
Bilanz per 31. Dezember <strong>2009</strong><br />
Aktiven in TCHF 31. 12. <strong>2009</strong> % 31. 12. 2008 %<br />
Umlaufvermögen<br />
Flüssige Mittel 10 224 5.1 15 133 7.4<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (inkl. angefangenen Arbeiten) 105 315 53.0 107 981 52.9<br />
Vorräte 20 823 10.5 17 111 8.4<br />
Transitorische Aktiven 1 276 0.6 913 0.4<br />
Umlaufvermögen 137 638 69.3 141 138 69.2<br />
Anlagevermögen<br />
Bauten, Anlagen und Maschinen 60 805 30.6 62 574 30.7<br />
Finanzanlagen 255 0.1 250 0.1<br />
Anlagevermögen 61 060 30.7 62 824 30.8<br />
Aktiven 198 698 100.0 203 962 100.0<br />
Passiven in TCHF<br />
Fremdkapital<br />
Kurzfristige Verbindlichkeiten 36 232 18.2 35 813 17.6<br />
Transitorische Passiven 7 199 3.6 831 0.4<br />
Langfristige Verbindlichkeiten 730 0.4 437 0.2<br />
Rückstellungen 25 296 12.7 20 897 10.2<br />
Kontokorrent Kanton 22 660 11.4 13 715 6.7<br />
Fremdkapital 92 117 46.4 71 692 35.1<br />
Eigenkapital<br />
Dotationskapital 123 457 62.1 123 457 60.5<br />
Reserven 5 120 2.6 0 0.0<br />
Jahresergebnis – 25 963 – 13.1 5 120 2.5<br />
Zweckgebundene Fonds 3 967 2.0 3 693 1.8<br />
Eigenkapital 106 581 53.6 132 270 64.9<br />
Passiven 198 698 100.0 203 962 100.0
Erfolgsrechnung<br />
Betriebsaufwand in TCHF 1. 1. – 31. 12. <strong>2009</strong> 1. 1. – 31. 12. 2008<br />
Personalaufwand 411 445 372 647<br />
Medizinischer Bedarf 132 916 125 589<br />
Übriger Sachaufwand 56 255 56 517<br />
Bauten, Anlagen und Maschinen 69 210 60 306<br />
Sachaufwand 258 381 242 412<br />
Betriebsertrag in TCHF<br />
Erträge aus Leistungen für Patienten 167 465 173 952<br />
Übrige Erträge 290 261 262 725<br />
Abgeltung Leistungsauftrag Kanton 186 791 183 265<br />
Total Betriebsertrag 644 517 619 942<br />
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag – 654 236<br />
Jahresergebnis – 25 963 5 120<br />
Inklusive <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana<br />
Jahresrechnung<br />
103
104 Jahresrechnung<br />
Mittelflussrechnung <strong>2009</strong><br />
Geldflussrechnung<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit in TCHF<br />
Jahresergebnis – 25 963<br />
+ Abschreibungen 25 083<br />
+ Zu- / Abnahme von Rückstellungen 4 399<br />
+ Ab- / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (inkl. angef. Arbeiten) 2 666<br />
+ Ab- / Zunahme der Vorräte – 3 713<br />
+ Ab- / Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzungen – 362<br />
+ Zu- / Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten 419<br />
+ Zu- / Abnahme der passiven Rechnungsabgrenzungen 6 369<br />
= Geldzufluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow) 8 898<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit<br />
– Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Anlagen und Maschinen – 23 314<br />
– Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen – 5<br />
= Geldabfluss aus Investitionstätigkeit – 23 319<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
+ Aufnahme / – Rückzahlung Dotationskapital 0<br />
+ Aufnahme / – Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten 9 238<br />
+ Zu- / Abnahme zweckgebundene Fonds 274<br />
= Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeit 9 512<br />
Total Geldfluss / Veränderung Flüssige Mittel (Fonds) – 4 909
Zusätzliche Informationen zum Abschluss <strong>2009</strong><br />
Rechnungslegungsgrundsätze<br />
Bis zum Abschluss der Umstellung der Rechnungslegung auf die<br />
Standards nach Swiss GAAP FER im Jahr 2011 erfolgt die Darstellung<br />
der Jahresrechnung inklusive Mittelflussrechnung und Anhang in<br />
einer einfachen Form.<br />
Bei der Erstellung der Jahresrechnung werden folgende Grundsätze<br />
beachtet:<br />
– Vollständigkeit<br />
– Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern Principle)<br />
– Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie<br />
von Aufwand und Ertrag (Bruttoprinzip)<br />
– Zeitliche Abgrenzung (Accrual Principle)<br />
Bewertungsgrundsätze<br />
Allgemein<br />
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Nominal- oder Anschaffungswerten<br />
abzüglich notwendiger Wertberichtigungen.<br />
Flüssige Mittel<br />
Die Flüssigen Mittel werden zum Nominalwert in die Bilanz eingestellt.<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum<br />
Nominalwert abzüglich pauschaler Wertberichtigungen bewertet.<br />
Angefangene Arbeiten<br />
Die Angefangenen Arbeiten sind zu verrechenbaren Preisen bewertet.<br />
Vorräte<br />
Die Bewertung der Vorräte erfolgt zum gleitenden Durchschnittspreis<br />
(Anschaffungs- oder Herstellungskosten).<br />
Anlagen und Maschinen<br />
Anschaffungen über 10 000 Franken werden aktiviert und linear<br />
über die Nutzungsdauer gemäss Richtlinien von REKOLE ® (*) vom<br />
Anschaffungswert abgeschrieben.<br />
Anlagekategorie Nutzungsdauer in Jahren<br />
Installationen 20<br />
Mobiliar und Einrichtungen 10<br />
Büromaschinen und Kommunikationssysteme 5<br />
Fahrzeuge 5<br />
Werkzeuge und Geräte 5<br />
Medizintechnische Apparate, Geräte und Instrumente 8<br />
Software-Upgrades 3<br />
Informatik-Hardware 4<br />
Informatik-Software 4<br />
Jahresrechnung<br />
Sachanlagen in Leasing<br />
Sachanlagen in Leasing werden bilanziert und ebenfalls über die<br />
Nutzungsdauer gemäss Richtlinien von REKOLE ® abgeschrieben.<br />
Finanzanlagen<br />
Beteiligungen sind zum Nominalwert bewertet.<br />
Verbindlichkeiten<br />
Verbindlichkeiten sind zum Nominalwert bewertet.<br />
Rückstellungen<br />
Die Höhe der einzelnen Rückstellungen wird nachvollziehbar berechnet<br />
oder zuverlässig geschätzt.<br />
Einmaleffekte im Jahresabschluss <strong>2009</strong><br />
Folgende ausserordentliche Einmaleffekte haben einen negativen<br />
Einfluss von CHF 19.4 Mio.:<br />
Sanierung <strong>Luzerner</strong> Pensionskasse (LUPK)<br />
Aufgrund der Unterdeckung der <strong>Luzerner</strong> Pensionskasse (LUPK) hat<br />
der Kanton Luzern Ende Januar 2010 einer Sanierung zugestimmt.<br />
Mit diesem Beschluss besteht für das LUKS eine wirtschaftliche Verpflichtung,<br />
die eine Abgrenzung der Sanierungskosten unabdingbar<br />
macht. Aufgrund des versicherten Anteils des LUKS an der LUPK<br />
wurde deshalb eine Rückstellung im Umfang von CHF 11.8 Mio.<br />
gebucht.<br />
Abschreibung Erhöhung Aktivierungsgrenze<br />
Per 1. Januar <strong>2009</strong> wurde die Aktivierungsgrenze in der Verordnung<br />
über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler,<br />
Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung<br />
(VKL) von CHF 3 000 auf CHF 10 000 angehoben. Infolge einer einheitlichen<br />
Bewertung der Anlagegüter sind diejenigen Anlagen, welche<br />
unterhalb der CHF-10 000er-Grenze liegen, mittels einer einmaligen<br />
Buchung abzuschreiben. Diese Einmalabschreibung belastet das<br />
Ergebnis mit CHF 7.556 Mio. zusätzlich.<br />
(*) Revision Kostenrechnung und Leistungserfassung (REKOLE ® ). Es handelt sich um eine<br />
national einheitliche Empfehlung vom Verband «H+ Spitäler der Schweiz» zum betrieblichen<br />
Rechnungswesen.<br />
105
106 Jahresrechnung<br />
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung<br />
An den Regierungsrat<br />
<strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>, Luzern<br />
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung bestehend aus<br />
Bilanz, Erfolgsrechnung, Mittelflussrechnung und Anhang (Seite 102<br />
bis 105) des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s für das am 31. Dezember <strong>2009</strong><br />
abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.<br />
Verantwortung des Spitalrates<br />
Der Spitalrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung<br />
mit dem Spitalgesetz, dem Leistungsauftrag 2008–2011<br />
und dem Finanzreglement verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet<br />
die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung<br />
eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer<br />
Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als<br />
Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der<br />
Spitalrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer<br />
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener<br />
Schätzungen verantwortlich.<br />
Verantwortung der Revisionsstelle<br />
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil<br />
über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere<br />
Prüfung in Übereinstimmung mit dem Spitalgesetz, dem Leistungsauftrag<br />
2008–2011 und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen.<br />
Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen<br />
und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob<br />
die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.<br />
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen<br />
zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung<br />
enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl<br />
der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des<br />
Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher<br />
falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen<br />
und Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt<br />
der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung<br />
der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden<br />
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber, um ein<br />
Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems<br />
abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung<br />
der An gemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden,<br />
der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine<br />
Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der<br />
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine<br />
aus reichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil<br />
bilden.<br />
Prüfungsurteil<br />
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das<br />
am 31. Dezember <strong>2009</strong> abgeschlossene Rechnungsjahr dem Spitalgesetz,<br />
dem Leistungsauftrag 2008–2011, dem Finanzreglement<br />
und den allgemeinen Vorschriften zur kaufmännischen Buchführung<br />
(Art. 957 ff. OR).<br />
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften<br />
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.<br />
Luzern, 12. April 2010<br />
FINANZKONTROLLE DES KANTONS LUZERN<br />
Marcel Hug Daniel Steffen
Risikobericht<br />
Ausgangslage<br />
Die Entwicklung des Gesundheitswesens in der Schweiz steht vor<br />
grossen Änderungen. Nicht zuletzt stellt die Einführung der Swiss-<br />
DRG besondere Anforderungen an die Marktteilnehmer.<br />
Die Unternehmensführung des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s sieht sich<br />
durch ihre verschiedenen Anspruchsgruppen zunehmend mit der<br />
Aufgabe konfrontiert, mittels messbarer Ziele mehr Transparenz<br />
zu schaf fen. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, nicht nur<br />
die betrieblichen Risiken zu kennen, sondern auch die strategischen<br />
Risiken und Marktrisiken zu steuern sowie kontrollieren zu können.<br />
Dies bedingt eine gesamtheitliche Überprüfung der Risiken auf allen<br />
Unternehmensebenen.<br />
Ein funktionierendes und effizientes Risikomanagement, eine gelebte<br />
Risiko- und Kontrollkultur sowie ein effizientes Frühwarn -<br />
sys tem entwickeln sich zunehmend zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor<br />
für Krankenhäuser und das Gesundheitssystem insgesamt.<br />
Das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> hat vor Jahren damit begonnen, sich systematisch<br />
und strukturiert mit dem Thema Risikomanagement auseinanderzusetzen.<br />
Hierzu gehören beispielsweise «CIRS» (Critical<br />
Incident Reporting System) oder die Einführung eines klinischen<br />
Risiko managements. Die Geschäftsleitung hat beschlossen, <strong>2009</strong> ein<br />
umfassendes Risikomanagement-System zu etablieren.<br />
Risikopolitik<br />
Das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>, ein als Zentrumsspital agierendes Unternehmen,<br />
ist im Rahmen seiner geschäftlichen Aktivitäten einer<br />
Reihe von Risiken ausgesetzt, die untrennbar mit unternehmerischem<br />
Handeln verbunden sind und sich trotz aller Sorgfalt nicht<br />
vollständig ausschliessen lassen. Basis für das Handeln aller am<br />
Risikomanagement-Prozess Beteiligten ist die von der Geschäftsleitung<br />
und dem Spitalrat definierte Risikopolitik und -strategie.<br />
Oberster Grundsatz dieser Politik ist es, die mit dem Leistungsauftrag<br />
des Kantons verbundenen Chancen zu nutzen, aber die mit<br />
dieser Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken nur dann einzugehen,<br />
wenn übergeordnete Un ternehmensziele nicht gefährdet sind. Das<br />
Risikobewusstsein der Führungskräfte und Mitarbeiter wird durch<br />
periodische Risikobeurteilungen geschärft.<br />
Risikomanagement-System<br />
Dem Spitalrat des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s obliegt die Gesamtverantwortung<br />
des Risikomanagements. In dessen Auftrag hat das Qualitäts-<br />
und Riskmanagement Richtlinien und Grundsätze für das Risikomanagement<br />
erlassen, die sowohl die frühzeitige Erkennung und<br />
Analyse von wesentlichen Risiken als auch die Ergreifung entsprechender<br />
Massnahmen ermöglichen. Zum Risikobeurteilungsprozess<br />
gehören die Vorgaben der systematischen Erfassung und Auswer-<br />
Jahresrechnung 107<br />
tung der Risiken, deren Priorisierung, die Beurteilung der Einflüsse<br />
auf das gesamte Unternehmen sowie die Einleitung und Überwachung<br />
von Massnahmen zur Vermeidung oder Minimierung von<br />
Risiken.<br />
Risikobeurteilung<br />
Für das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> wurde zusammen mit den Risikoverantwortlichen<br />
anhand vordefinierter Risikofelder die Analyse<br />
durchgeführt und die Risikosituation beurteilt.<br />
Beim <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> handelt es sich um ein wettbewerbstarkes<br />
Unternehmen. Die strategischen Risiken – unterstützt durch die<br />
zunehmende unternehmerische Selbstständigkeit – werden daher<br />
als beherrschbar eingeschätzt.<br />
Durch die hohe Wettbewerbsintensität und die Deregulierungstendenzen<br />
entstehen indessen nicht unerhebliche Marktrisiken.<br />
Vor dem Hintergrund des vorhandenen Kompetenzprofils sowie der<br />
bestehenden Wettbewerbsvorteile und der starken Marktposition<br />
lassen sich derzeit keine bestandesgefährdenden Risiken erkennen.<br />
Die Analyse der Finanzen inklusive Investitions- und Finanzierungsplan<br />
erfolgt auf Basis von betriebswirtschaftlichen Grundsätzen<br />
sowie Vergleichsdaten. Das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> kann aus finanzieller<br />
Perspektive als gesundes Unternehmen bezeichnet werden.<br />
Analysiert wurden Leistungserstellung als auch die klinischen und<br />
allgemeinen Unterstützungsprozesse. Aus dem laufenden Spitalbetrieb<br />
können trotz umfangreichen vorbeugenden Massnahmen<br />
wie intensive Mitarbeiterschulung, Prozessbeschreibungen und<br />
Sicherheitsmassnahmen Behandlungsfehler, aber auch technische<br />
Ausfälle nicht ganz ausgeschlossen werden. Für vordefinierte<br />
Szenarien wie beispielsweise Pandemie bestehen bereits entsprechende<br />
Dispositive und Krisenpläne.<br />
Besonders kritische Risiken wurden im Verantwortungsbereich der<br />
Informatik identifiziert. Dies bestätigte sich in der ergänzend durchgeführten<br />
vertieften Risikoanalyse. Ein Ausfall bzw. eine Fehlfunktion<br />
in der Informatik würde aufgrund der ausgeprägten Abhängigkeiten<br />
de facto alle Spitalbereiche tangieren und den Betrieb unter Umständen<br />
erheblich beeinträchtigen. Um die erkannten Risiken in diesem<br />
Bereich angemessen bewältigen zu können, wurden sechs Anträge,<br />
welche bereits 2010 umgesetzt werden könnten, an die Geschäftsleitung<br />
gestellt.<br />
Zusammenfassend ist die Risikosituation für den Betrachtungszeitraum<br />
für das gesamte Spital als gut und beherrschbar zu bezeichnen.<br />
Es bestehen keine bestandesgefährdenden Risiken.<br />
Dr. med. Ute Buschmann<br />
Riskmanagerin LUKS
108 Kennzahlen<br />
Personalaus- und weiterbildung <strong>2009</strong><br />
<strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>, Standorte Luzern, Sursee, Wolhusen, inkl. Montana<br />
Ärztliches Personal und andere AkademikerInnen im med. Bereich<br />
Total<br />
448<br />
Unterassistenzärzte/-ärztinnen 448<br />
Pflege 576<br />
Diplomniveau I + II 98<br />
Pflegefachfrau/-mann HF Akut E und KJFF 174<br />
Hebammen FH 32<br />
Fachangestellte/r Gesundheit 191<br />
Rettungssanitäter/in HF<br />
Zusatzausbildungen:<br />
9<br />
Anästhesie 20<br />
IPS/OPS 37<br />
Notfall 17<br />
Medizintechnik/-therapie 84<br />
Ergotherapeut/in FH 2<br />
Ernährungsberater/in FH 1<br />
Biomedizinische Analytiker/in HF 37<br />
Logopäde/in 2<br />
Fachperson MTRA HF 10<br />
Physiotherapeut/in FH 23<br />
Fachfrau/-mann Operationstechnik HF 7<br />
Medizinische/r Praxisassistent/in 2<br />
Verwaltung 26<br />
Kauffrau/Kaufmann 15<br />
Informatiker/in 8<br />
Fachfrau/-mann Kinderbetreuung 3<br />
Ökonomie 33<br />
Koch/Köchin 18<br />
Diätkoch/-köchin 2<br />
Gebäudereiniger/in / Hauswirtmitarbeiter/in 3<br />
Fachfrau/-mann Hauswirtschaft 6<br />
Logistiker/in EFZ 4<br />
Technik 4<br />
Fachmann Betriebsunterhalt 3<br />
Elektroniker/in 1<br />
Diverse Praktika 264<br />
Pflegedienst 246<br />
Verwaltung / zentrale Dienste 8<br />
Sozialarbeit 4<br />
Kinderkrippe 6<br />
Total 1 435<br />
Lehr- und Praktikumsverhältnisse, die ein Jahr und länger dauern: Anzahl Stellen<br />
Kürzere Anstellungen: Anzahl Köpfe
Chirurgie Luzern Sursee Wolhusen<br />
Allgemein- / Viszeral- / Unfallchirurgie / Orthopädie /<br />
Urologie / Herz- / Gefäss- / Thoraxchirurgie / Hand- /<br />
Plastische Chirurgie / Neurochirurgie / Wirbelsäulenchirurgie<br />
/ Mund- / Gesichts- und Kieferchirurgie<br />
Hals<br />
Tracheostomie 27<br />
Schilddrüse 72<br />
Nebenschilddrüse<br />
Thorax, Mamma<br />
17<br />
Thorakoskopische und offene Lungeneingriffe 190<br />
Pleuradrainagen 201<br />
Mammaeingriffe<br />
Gefässe<br />
31<br />
Varizen 560<br />
Arterien 619<br />
Pacemaker 72<br />
Port-à-Cath 140<br />
Oesophagus, Magen, Milz 3<br />
Gastrektomie 85<br />
Magenbypass 65<br />
Milz 22<br />
Zwerchfell / Fundoplicatio<br />
Gallenwege, Leber, Pankreas<br />
21<br />
Leber 39<br />
Gallenwege 11<br />
Cholezystektomie 409<br />
Pankreas<br />
Dünndarm, Appendix, Colon, Rektum<br />
29<br />
Dünndarm 220<br />
Appendektomie 476<br />
Colon 326<br />
Rektum<br />
Proktologie<br />
118<br />
Rektoskopien 759<br />
Hämorrhoiden / Fistel / Abszesse<br />
Hernien<br />
406<br />
Leisten-, Femoral- und Nabelhernien 694<br />
Bauchdecken / Narbenhernien<br />
Diverse Abdominaleingriffe<br />
Diagnostische und therapeutische Laparoskopien,<br />
189<br />
Adhäsiolysen<br />
Trauma, Innere Hernien<br />
441<br />
Nebennieren laparoskopisch<br />
Gynäkologische Eingriffe<br />
Weichteile allg., Radikale Lymphknotenausräumung<br />
11<br />
Wundversorgung 2 179<br />
Lokalanästhesien 1 311<br />
Ultraschall Abdomen / Weichteile, Transrektaler US<br />
Wirbelsäule<br />
1 019<br />
Infiltrationen<br />
Manuelle Medizin<br />
12<br />
Frakturstabilisation 44<br />
OSME<br />
Schultergürtel / Oberarm<br />
7<br />
Schulterprothese (Teil- / Totalprothesen / Prothesenwechsel) 75<br />
Kennzahlen 109<br />
Rotatorenmanschettennaht / -rekonstruktion + Acromioplastik 244<br />
Subacromiale Dekompression als alleinige OP inkl.<br />
AC-Resektion 201<br />
Arthroskopische Eingriffe inkl. Bicepstenodese 196<br />
(Débridement / Arthrolyse)<br />
Schulterstabilisation inkl. Labrum, SLAP (offen / endoskopisch) 61<br />
Operationen nicht näher bezeichnet 38<br />
Osteosynthese Clavicula / Glenoid / Scapula 74<br />
inkl. Stabilisation AC-Luxation 5<br />
Osteosynthese prox. Humerus / Humerusschaft 184<br />
OSME 164<br />
Narkosemobilisation 4<br />
Punktion / Infiltration 167<br />
Ellbogengelenk<br />
Teil- / Totalprothese inkl. Radiusköpfchenprothese 2<br />
Arthroskopie / Arthrotomie Ellbogen (diagnost. / therapeut.) 13<br />
OP bei Epicondylitis 16<br />
Operationen nicht näher bezeichnet 17<br />
Osteosynthese dist. Humerus / Olecranon / Radiusköpfchen 54<br />
OSME<br />
Unterarm / Hand<br />
28<br />
Dekompression Nerven 394<br />
Morbus Dupuytren 52<br />
Ringbandspaltung 137<br />
Handgelenksganglion 90<br />
Sehnennaht / Bandrekonstruktion 215<br />
Operationen nicht näher bezeichnet 681<br />
Osteosynthese Vorderarmschaft / dist. Radius und Ulna 420<br />
Osteosynthese Handwurzel / Mittelhand / Finger 224<br />
OSME 177<br />
Replantationen 9<br />
Punktion / Infiltration<br />
Beckengürtel / Oberschenkel<br />
12<br />
Femurkopfprothese 116<br />
Hüft-TP inkl. Oberflächenersatzprothese 477<br />
Hüftprothesenwechsel + Revision Hüft-TP 68<br />
Arthroskopie Eingriffe Hüfteingriffe 125<br />
(Débridement, Offset-Korrektur, Labrumrefix) 22<br />
Operationen nicht näher bezeichnet 152<br />
Osteosynthese Becken, prox. Femur und Femurschaft 248<br />
OSME 116<br />
Punktion / Infiltration<br />
Kniegelenk / Unterschenkel<br />
145<br />
Knie-TP / Hemiprothese Knie inkl. Revision TP mit Patellaersatz 350<br />
Knie-TP-Wechsel 23<br />
Arthroskopische Eingriffe (Meniscus / Débridement) +<br />
Arthrotomien<br />
1 006<br />
VKB- / HKB-Plastik (offen und arthroskopisch) 188<br />
Operationen an Bändern und Sehnen Kniebereich 90<br />
Umstellungs-Osteotomie dist. Femur / prox. Tibia /<br />
Unterschenkel-Schaft<br />
138<br />
Operationen nicht näher bezeichnet 122<br />
Osteosynthese dist. Femur 57<br />
Osteosynthese Patella 39<br />
Osteosynthese prox. Tibia und Fibula 68<br />
Osteosynthese Tibia- und Fibulaschaft 94<br />
OSME 154
110 Kennzahlen<br />
Narkosemobilisation 8<br />
Punktion / Infiltration 139<br />
Sprunggelenke / Fuss<br />
Arthroskopie / Arthrotomie OSG / USG 29<br />
Arthrodese / OSG / USG / Mittelfuss / Zehen 38<br />
Bandnaht / Bandplastik 44<br />
Hallux-Operation 102<br />
Operation an Metatarsale und Zehen II-V 46<br />
Operationen nicht näher bezeichnet 165<br />
Achillessehnenrekonstruktion 57<br />
Osteosynthese dist. Unterschenkel / OSG 306<br />
Osteosynthese Rückfuss / Mittelfuss / Zehen 79<br />
OSME 310<br />
Punktion / Infiltration 17<br />
Weichteil-OP (Hämatome / Infektionen / VW / Wund-<br />
versorgung [ Fremdkörper usw.] ) 488<br />
Knochentransplantationen 32<br />
sonstige Knocheneingriffe 196<br />
Hauttransplantationen 67<br />
Reposition von Luxationen 56<br />
Bühlaudrainagen 80<br />
Amputationen<br />
untere Extremität<br />
Hand- und plastische Chirurgie (exkl. Trauma)<br />
121<br />
CTS 168<br />
Dupuytren 37<br />
Plastische Eingriffe Mamma, Bauchdecke 152<br />
lokale Hautlappen 71<br />
gestielte musculo-cutane Lappen 24<br />
freie mikrochirurgische Lappenplastik 23<br />
lokal vaskulär gestielte Lappen<br />
Neurochirurgie<br />
30<br />
Zentrales Nervensystem 203<br />
Wirbelsäule (davon 100 komplexe WS)<br />
Herzchirurgie<br />
326<br />
Total Herzeingriffe 341<br />
Patienten mit 1 Herzeingriff 146<br />
Patienten mit mehreren Herzeingriffen 92<br />
Pacemaker, ICD-Eingriffe<br />
MGK Chirurgie<br />
320<br />
Traumatologie 973<br />
Korrektive Chirurgie inkl. LGK Spalten 137<br />
Tumorchirurgie 168<br />
Rekonstruktive Chirurgie 113<br />
Kiefergelenk-Chirurgie 236<br />
Implantat-Chirurgie – präprothetische Chirurgie 308<br />
Septische Chirurgie 157<br />
Kieferhöhlen-NNH-Chirurgie 90<br />
Oralchirurgie 2 658<br />
Speicheldrüsen-Chirurgie 6<br />
Plastische Chirurgie – Gesicht 23<br />
Nerv-Chirurgie 15<br />
Chirurgische Prothetik<br />
Urologische Eingriffe<br />
Niere / Nebenniere<br />
254<br />
Nephrektomie / Nierenteilresektion 29<br />
PNL 7<br />
perk. Nephrostomien 199<br />
Andere Nieren- / Nebenniere- / Harnleitereingriffe 3<br />
Nierenbecken- / Ureter<br />
Nierenbeckenplastiken (lap. + endosk.) 14<br />
URS 111<br />
Harnleiterstenteinlagen + -entnahmen 282<br />
ESWL 181<br />
Blase<br />
Radikale Zystektomie + Urinableitung 10<br />
TUR-B + Lithotrypsie 166<br />
Andere Blaseneingriffe<br />
Prostata + Harnröhre<br />
27<br />
Prostatektomie bei benigner Hyperplasie 233<br />
Radikale Prostatektomie, Brachytherapie 90<br />
Urethraeingriffe 29<br />
Andere Eingriffe an Prostata oder Harnröhre<br />
Scrotum und Penis<br />
8<br />
Retroperitoneale Lymphadenektomie bei Hodenkarzinom 6<br />
Eingriffe am Scrotum 290<br />
Eingriffe am Penis<br />
Diagnostische Eingriffe / Untersuchungen<br />
126<br />
Cystoskopien 1 355<br />
Pyelographien retro- und anterograd 205<br />
Cystographien / Urethrographien 217<br />
Blaseninstillationen 80<br />
Cystostomien / Cystostomiewechsel 1 344<br />
Nephrostomiewechsel 179<br />
Prostatabiopsien 305<br />
Prostata Goldmarker 52<br />
Urodynamische Untersuchungen + Uroflow 2 379<br />
Sonographien<br />
Stoma<br />
4 355<br />
Beratung stationär 964<br />
Beratung ambulant 623<br />
Neuanlagen 119<br />
Medizin Luzern Sursee Wolhusen<br />
Med. IPS 11.W<br />
Infektiologische Erkrankungen 28<br />
Pneumonologische Erkrankungen 67<br />
Herz- und Kreislaufstörungen 354<br />
Gastroenterologische Erkrankungen 55<br />
Stoffwechselkrankheiten 28<br />
Nephrologische Erkrankungen 23<br />
Neurologische Erkrankungen 265<br />
Intoxikationen 50<br />
Delirium tremens 3<br />
Kardiochirurgische Überwachung 80<br />
Total 953<br />
Davon maschinell beatmet 278<br />
Gastroenterologie<br />
Obere gastrointestinale Endoskopien (exkl. ERCP) 2 470<br />
Oesophagoskopien 54
Oesophagogastroduodenoskopien 2 868<br />
davon therapeutisch 136<br />
Sklerotherapie / Varizenligatur 101<br />
Bougierung / Ballon-Dilatation 211<br />
Oesophagus-Endoprothese 24<br />
Perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) 107<br />
Fremdkörper- / PEG-Entfernung 89<br />
Polypektomie 15<br />
Endoskopische Sondeneinlagen 101<br />
Laserbehandlung 50<br />
Obere Endosonographie<br />
Endoskopisch-retrograde Cholangio-<br />
Pankreatikographie (ERCP) 299<br />
davon therapeutisch 238<br />
Papillotomie / Steinextraktion 159<br />
Endoprothese 63<br />
Nasobiliäre Drainage 14<br />
Ballon-Dilatation 50<br />
Anorektoskopie (starr) 1 677<br />
davon therapeutisch 139<br />
Hämorrhoiden-Infrarotkoagulation / elast. Ligatur 107<br />
andere (Fissurbehandlungen usw.)<br />
Rektale Endosonographie<br />
32<br />
Koloskopie 2 429<br />
Partielle Koloskopie 771<br />
Totale Koloskopie / Ileo-Koloskopie 1 800<br />
davon therapeutisch 144<br />
Polypektomie 212<br />
Endoskopische Blutstillung 28<br />
Ballon-Dilatation 85<br />
Laserbehandlung 44<br />
Stent-Einlage 7<br />
Gastrographin-Oesophaguspassage 12<br />
Oesophagus-24-Std.-pH-Metrie 11<br />
Oesophagus-Perfusionsmanometrie 23<br />
Analmanometrie 5<br />
Kolon-Transitzeitbestimmung 16<br />
13-C-Atemtest 10<br />
Kapselendoskopie 25<br />
Perkutane Biopsien und Punktionen 1 927<br />
Menghini-Leberbiopsie 64<br />
Ultraschallgezielte Aszites-, Pleurapunktionen 57<br />
Abdomen-Sonographie 2 533<br />
Rehabilitation<br />
Tagesrehabilitation<br />
Cerebrovaskulärer Insult 38<br />
Subarachnoidalblutung 5<br />
Schädel-Hirn-Trauma 11<br />
Multiple Sklerose 1<br />
Hypoxische Hirnschädigung 3<br />
Entzündliche Hirnerkrankungen 5<br />
Polyradikulitis 6<br />
Hirntumoren<br />
Stationäre Patienten<br />
6<br />
Cerebrovaskulärer Insult 125<br />
Subarachnoidalblutung 12<br />
Kennzahlen 111<br />
Schädel-Hirn-Trauma 8<br />
Hirn-Schädeltumoren 12<br />
Entzündliche Hirnerkrankungen 9<br />
M. Parkinson 7<br />
Polyradikulitis 15<br />
Amputationen der Extremitäten 3<br />
Anoxische Hirnschädigung 10<br />
Subdural-/Epiduralhämatom 4<br />
Spinale Lähmungen 4<br />
Hämatologie<br />
Diagnosestatistik<br />
Akute Leukämien 29<br />
Myeloproliferative Syndrome 38<br />
Myelodysplastische Syndrome 6<br />
Anämien und andere Zytopenien, AA 120<br />
Paraproteinämien 40<br />
Thrombophilieabklärungen 272<br />
Hämostaseabklärungen 77<br />
Immunhämatologische Probleme 36<br />
Angiologie<br />
Kathetertechnische Eingriffe 260<br />
Anzahl Konsultationen / Konsilien total 6 826<br />
Laufbandteste 10<br />
Behandlung von Aneurysmata spuria 54<br />
Thromboinjektion 5<br />
Wundversorgung 1 303<br />
Kardiologie<br />
Invasive Kardiologie<br />
Linksherzkatheterismus 2 858<br />
Rechtsherzkatheterismus 551<br />
Periphere Angiographie 473<br />
Elektrophysiologische Diagnostik 225<br />
Biopsie 50<br />
Percutane koronare Intervention 1 372<br />
Percutane Ablation 165<br />
PFO / ASD / Valvuoplastie / percutaner Klappenersatz<br />
Nicht-invasive Kardiologie<br />
51<br />
Ruhe-EKG 14 618<br />
Belastungs-EKG 2 454<br />
Holter-EKG 1 983<br />
24-Std.-BD-Messung 277<br />
TT-Echokardiographie 6 503<br />
TE-Echokardiographie 330<br />
Stress-Echo 349<br />
Duplex Sonographie<br />
Herzschrittmacher<br />
1 066<br />
PM-Implantation 228<br />
ICD-Implantation 92<br />
PM-Kontrollen 1 728<br />
ICD-Kontrollen 599<br />
Ambulante Rehabilitation 177<br />
Raucherentwöhnung 71
112<br />
Kennzahlen<br />
Nephrologie<br />
Hämodialysen 8 564<br />
Akute Dialysen 120<br />
Hämofiltration 251<br />
Peritonealdialysen 287<br />
Neurologie<br />
EEG 1 078<br />
EMG (Elektromyographie und -neurographie) 1 164<br />
Duplex Sonographie 632<br />
Lumbalpunktion 123<br />
MS Selbstinstruktion 21<br />
Konsilien 5 130<br />
Medizinische Onkologie<br />
Hämoblastosen 20<br />
Maligne Lymphome 54<br />
Mammakarzinome 131<br />
Gynäkologische Tumoren 45<br />
HNO-Tumoren 37<br />
Lungenkarzinome 93<br />
Gastrointestinale Karzinome 163<br />
Urogenital-Tumoren 64<br />
Sarkome 16<br />
Hauttumore 22<br />
Unbekannter Primärtumor 18<br />
Hirn 35<br />
Pneumologie<br />
Lungenfunktionen / Plethysmographien / Spiroergometrien 2 777<br />
Unspezifische Bronchoprovokationsteste 183<br />
Bronchoskopien 383<br />
Pleuradrainagen 86<br />
Diagnostische Schlafuntersuchungen 433<br />
CPAP und Heimventilationseinstellungen 148<br />
Rheumatologie<br />
Ambulant untersuchte PatientInnen 3 878<br />
Konsilien bei stationären PatientInnen 541<br />
Spezialbehandlungen 1 630<br />
Sonographien am Bewegungsapparat 438<br />
DXA-Befundungen (gemeinsam mit Endokrinologie) 1 192<br />
Bewegungstherapie total 70 806<br />
stationär 46 845<br />
ambulant allgemein 20 824<br />
ambulant aufwendig 3 137<br />
Gruppentherapie 9 585<br />
stationär (Wassergruppe für Rückenpat.) 820<br />
ambulant (Gruppe für Rückenschule) 8 765<br />
Endokrinologie<br />
Konsilien ambulant 2 764<br />
Diabetische Fusssprechstunde 197<br />
Diabetes-Beratungen gesamt 3 233<br />
Ernährungsberatungen gesamt 3 228<br />
Feinnadelpunktion Schilddrüse 50<br />
Ultraschall Schilddrüse 335<br />
Dermatologie<br />
Physikalische Schädigungen<br />
Mechanisch bedingte Ulcera / Dekubitus 36<br />
Artefakt<br />
Epizoonosen / Infektionen / Venerologie<br />
54<br />
Skabies / Tierflöhe 60<br />
Mykose / Pityriasis versicolor 151<br />
Pyodermie / Erysipel / Impetigo contagiosa 106<br />
Erythrasma / Trichomykosis palmellina 8<br />
Herpes zoster / Herpes simplex 63<br />
Virus-Warzen / Mollusca contagiosa<br />
Allergie / Autoimmun- / Blasen-Erkrankungen<br />
239<br />
Urtikaria / Arzneimittelexanthem / Photodermatose 133<br />
Kontaktekzem, toxisches Ekzem 122<br />
Atopisches Ekzem / Neurodermitis / weitere Ekzeme 727<br />
Erythema exsudativum multiforme / Sweet-Syndrom 43<br />
Vaskulitis / Erythema nodosum<br />
Schleimhautpemphigoid, bullöses Pemphigoid,<br />
41<br />
Pemphigus vulgaris<br />
Entzündliche / degenerative Dermatosen<br />
unterschiedlicher Genese / Genodermatosen<br />
50<br />
Psoriasis / Pustulosen / Pruritus / Prurigo 276<br />
MUCHA-HABERMANN 3<br />
Akne vulgaris 186<br />
Nageldystrophie 67<br />
Alopezia (alle Formen) 46<br />
Mundschleimhaut- und Zungenveränderungen<br />
Haut-Tumoren<br />
34<br />
Gutartige Tumoren 755<br />
Präkanzerosen 435<br />
Basaliom / Spinaliom 265<br />
Malignes Melanom<br />
Phlebologie, Angiologie<br />
43<br />
CVI (Ulcera cruris, Komplikationen)<br />
Weitere<br />
112<br />
Pigmentstörungen 31<br />
Verhornungsstörungen 14<br />
Granuloma anulare 22<br />
Pigmentnaevi 521<br />
Weitere degenerative Veränderungen 259<br />
Spezialkliniken<br />
Augenklinik<br />
Lider, Tränenapparat, Orbita<br />
Grosse Lidoperationen 327<br />
Kleine Lidoperationen 194<br />
Enukleation / Evisceration / Orbitaeingriffe 8<br />
Wundversorgung der Lider 17<br />
Tränenwegseingriffe 37<br />
Kleine Eingriffe, DCR auf HNO<br />
Bindehaut<br />
15<br />
Kleine Operationen inkl. Pterygium<br />
Muskeln<br />
93<br />
Schieloperation am geraden Muskel 67<br />
Schieloperation am schrägen Muskel 13
Hornhaut und Sklera<br />
Perforierende Keratoplastik 17<br />
Perforierende Keratoplastik mit Kat Op 1<br />
Lamelläre Keratoplastik 18<br />
DSEK Endotheltransplantation 78<br />
Astigmatismus Keratotomie 1<br />
Hornhaut- und Skleranaht 13<br />
Sonstige Operationen an der Hornhaut, z.B CCL, Tätowage 149<br />
Linsen<br />
Katarakt Op mit IOL 2 510<br />
Katarakt Op ohne IOL 6<br />
Sekundärimplantation, IOL Wechsel u. Reposition, Artisan 81<br />
Phake IOL, ICL usw. 16<br />
Nachstar, vordere Vitrektomie 7<br />
Netzhaut / Glaskörper<br />
PPV 303<br />
Kombinierte PPV mit Phako und IOL 335<br />
Silikonölentfernung 41<br />
Intravitreale Injektion und GK Punktion 2 876<br />
Eingriffe mit dem Endoskop 4<br />
Plomben- und Cerclagenoperation 19<br />
Plomben- und Cerclagenentfernung 11<br />
Netzhautkryo allein 15<br />
Glaukom<br />
Phako+TE und Phako+RE-TE 52<br />
TE und RE-TE 39<br />
Glaukom grosse Revisionen 7<br />
Glaukom kleine Revisionen 22<br />
Tubes (Baerveldt, Ahmed, Molteno) 27<br />
Deep Sclerectomy 19<br />
Cyclo-Photokoagulation 43<br />
Verschiedenes<br />
Narkoseuntersuchung 40<br />
Bulbusperforationen 15<br />
Kleine Eingriffe, z.B. Temporalis Biopsie 44<br />
Kleine Eingriffe in der Vorderkammer 52<br />
Irisnaht / Irisrekonstruktion allein<br />
Laser<br />
6<br />
YAG Iridotomie 55<br />
YAG Kapsulotomie 232<br />
ALK und TTT 980<br />
PDT<br />
Excimereingriffe Augenklinik KSL<br />
9<br />
PTK 42<br />
OF-Ablation 355<br />
Enhancement<br />
Gesamteingriffe Augenklinik LUKS<br />
Excimereingriffe Sursee<br />
50<br />
OF-Ablation 160<br />
Enhancement 15<br />
Summe aller Eingriffe 9 536<br />
Hals-, Nasen-, Ohren-, Gesichts-Chirurgie<br />
Operationen und diagnostische Eingriffe<br />
Nase, Nasennebenhöhlen 1 471<br />
Speicheldrüsen, Rachen und Mundhöhle 733<br />
Gesicht und Hals 936<br />
Kennzahlen 113<br />
Endoskopische Eingriffe 558<br />
Ohrmuschel, Mittelohr, Schädelbasis 1 516<br />
Div. kleinere Behandlungen 1 175<br />
Total (Luzern, Wolhusen, Sursee, SPZ*) 6 389<br />
* inkl. Anteil konsiliarischer operativer Tätigkeit am Paraplegikerzentrum Nottwil (SPZ)<br />
Audiologie<br />
Ton- / Sprachaudiometrien, Hörgeräteexpertisen 6 781<br />
Objektive Audiometrieverfahren (OAE, BRA, Tymp)<br />
Neurootologie<br />
Vollständige Vestibularisprüfungen<br />
3 852<br />
(inkl. Videonystagmographie) 379<br />
Isolierte Lagerungsprüfung / Repositionen 571<br />
Hyperbare Sauerstofftherapien (Anzahl Fahrten)<br />
Phoniatrie und Kinderaudiologie<br />
147<br />
Erstuntersuchungen mit fachlicher Beurteilung 538<br />
Behandlung und regelmässige Kontrollen 1 232<br />
Gynäkologie / Geburtshilfe Luzern Sursee Wolhusen<br />
Operationen 5 753<br />
Geborene Kinder 3 063<br />
Frühgeborene 215<br />
US-Untersuchungen 28 309<br />
Kinderspital<br />
Zusammenfassung stationärer Bereich<br />
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 6.4<br />
Durchschnittliche Bettenbelegung in Prozent<br />
Interdisziplinäre Neonatologie und Intensivmedizin<br />
79.4<br />
Total<br />
Neonatologische / pädiatrisch-kinderchirurgische<br />
450<br />
Intensivstation 704<br />
Pflegetage 8 610<br />
Kat. Ia 1 131<br />
Kat. Ib 4 016<br />
Kat. II 2 106<br />
Kat. III 1 357<br />
42. SSW 3<br />
Total 450<br />
externe Transporte 125<br />
FKL-Transporte<br />
Konsiliardienst Neue Frauenklinik<br />
165<br />
Vorsorge-Untersuchung gesunder Neugeborener<br />
Ambulanter Bereich (Konsultationen) Notfallstation<br />
1 826<br />
Pädiatrie 7 735<br />
davon stationäre Aufnahmen 1 384<br />
Kinderchirurgie (inkl. Spezialsprechstunden) 7 826<br />
davon stationäre Aufnahmen 1 072<br />
Total Notfallstation<br />
Tagesklinik<br />
15 561<br />
Pädiatrie 3 907<br />
Kinderchirurgie 1 488
114<br />
Kennzahlen<br />
Spezialsprechstunden Pädiatrie (Konsultationen)<br />
Allgemeine Pädiatrie (inkl. Hämatologie und Infektiologie) 406<br />
Endokrinologie 441<br />
Funktionstests 67<br />
Gastroenterologie inklusive Cystische Fibrose 1 304<br />
Endoskopien GI-Trakt 163<br />
Kardiologie 1 218<br />
Farbdoppler-Echokardiographien 1 504<br />
Nephrologie 548<br />
Neuropädiatrie 2 896<br />
EEG 1 295<br />
Onkologie 643<br />
Neuerkrankungen total (Patienten) 22<br />
Pneumologie / Allergologie 985<br />
Lungenfunktionstests 569<br />
Bronchoskopien 11<br />
Allergietests 546<br />
Rheumatologie 466<br />
Gelenkspunktionen<br />
Operative Tätigkeit Kinderchirurgie<br />
36<br />
Neurochirurgie 59<br />
Kiefer- / Gesichts-Ohrchirurgie 307<br />
Eingriffe am Hals und Thorax 87<br />
Viszerale Chirurgie 450<br />
Minimal-invasive viszerale Eingriffe 40<br />
Urologie 506<br />
Herz- und Gefässchirurgie 83<br />
Traumatologie / Orthopädie 672<br />
Eingriffe an Haut und Weichteilen 826<br />
Diagnostische Eingriffe 307<br />
Total Eingriffe (im OP-Bereich)<br />
Konsiliar- und Liaisonpsychiatrischer<br />
Dienst (Patienten)<br />
3 337<br />
Pädiatrie 189<br />
Kinderchirurgie 38<br />
Total<br />
Ergotherapie<br />
227<br />
Stationäre Behandlungen 638<br />
Ambulante Behandlungen<br />
Physiotherapie<br />
1 395<br />
Stationäre Behandlungen 4 714<br />
Ambulante Behandlungen<br />
Sozialdienst<br />
2 604<br />
Beratungen<br />
Patientenschule<br />
581<br />
Anzahl Patienten<br />
Kinderschutz<br />
475<br />
Anzahl Patienten 60<br />
Institute Luzern Sursee Wolhusen<br />
Anästhesie<br />
Anästhesie<br />
Allgemeinanästhesie 15 850<br />
Regionalanästhesie 8 051<br />
Kombinationsanästhesie 2 408<br />
Stand by; Monitored Anesthesia Care (MAC) 5 744<br />
Anästhesien gesamt 32 053<br />
Rettungsdienst<br />
D1 888<br />
D2 4 591<br />
D3 6 159<br />
Gesamteinsätze 11 638<br />
Radio-Onkologie<br />
Tumorstatistik<br />
Haut 62<br />
Kopf / Hals 100<br />
Gehirn 31<br />
Thorax / Lunge 59<br />
Verdauungstrakt 94<br />
Urol. / männliches Genitale 92<br />
weibliches Genitale 59<br />
Mamma (männlich / weiblich) 306<br />
Knochen / Weichteile 21<br />
maligne Lymphome / Hämoblastosen 58<br />
Metastasen / Rezidive 309<br />
Auge 1<br />
Kinder 1<br />
unbekannter Primärtumor 9<br />
Lymphknoten-Rezidiv 7<br />
Total 1 209<br />
Apotheke (Einkaufspreis in CHF)<br />
Medikamentenverbrauch<br />
Nervensystem 4 205 759<br />
Herz und Kreislauf 982 374<br />
Lunge und Atmung 372 829<br />
Gastroenterologika 316 767<br />
Niere und Wasserhaushalt 1 968 111<br />
Blut 4 816 488<br />
Stoffwechsel inkl. Onkologika 20 229 910<br />
Onkologika 12 067 438<br />
Infektionskrankheiten 3 444 876<br />
Gynäkologika 396 485<br />
Dermatologika 707 160<br />
Ophthalmologika 4 399 889<br />
Oto-Rhino-Laryngologika 182 241<br />
Diagnostika 2 445 749<br />
Antidota 47 770<br />
Total alle Präparate 44 886 464
Medizin<br />
Kardiologie<br />
Publikationen<br />
Kurz DJ, Bernstein A, Hunt K, Radovanovic D, Erne P, Siudak Z, Bertel<br />
O. Simple point-of-care risk stratification in acute coronary syndromes:<br />
the AMIS model. Heart. <strong>2009</strong>; 95(8): 662–8<br />
Toggweiler S, Kobza R, Zuber M, Erne P. Short-term effects of right<br />
ventricular pacing on cardiorespiratory function in patients with a<br />
biventricular pacemaker. Congest Heart Fail. 2008; 14(6): 289–92<br />
Auf der Maur C, Hoffmann A, Brink T, Erne P. Cardiac computed<br />
tomography for the diagnosis of right ventricular implantable cardioverter-defibrillator<br />
lead perforation. Eur Heart J. <strong>2009</strong>; 30(7): 869<br />
Toggweiler S, Zuber M, Gerber K, Schlaepfer R, Erne P, Stulz P. Left<br />
ventricular mass regression following implantation of MIRA bileaflet<br />
valves in patients with severe aortic stenosis. Heart Vessels. <strong>2009</strong>;<br />
24(1): 37–40<br />
Roos M, Kobza R, Jamshidi P, Bauer P, Resink T, Schlaepfer R, Stulz P,<br />
Zuber M, Erne P. Improved cardiac performance through pacinginduced<br />
diaphragmatic stimulation: a novel electrophysiological<br />
approach in heart failure management? Europace. <strong>2009</strong>; 11(2): 191–9<br />
Pfisterer M, Buser P, Rickli H, Gutmann M, Erne P, Rickenbacher P,<br />
Vuillomenet A, Jeker U, Dubach P, Beer H, Yoon SI, Suter T, Osterhues<br />
HH, Schieber MM, Hilti P, Schindler R, Brunner-La Rocca HP; TIME-CHF<br />
Investigators. BNP-guided vs symptom-guided heart failure therapy:<br />
the Trial of Intensified vs Standard Medical Therapy in Elderly Patients<br />
with Congestive Heart Failure (TIME-CHF) randomized trial. JAMA.<br />
<strong>2009</strong>; 301(4): 383–92<br />
Erne P, Kobza R. Prevention of stroke in patients with atrial fibrillation<br />
by an atrial assistance device – an upstream therapy? Swiss Med<br />
Wkly. <strong>2009</strong>; 139(5–6): 58–9<br />
Zuber M, Cuculi F, Jost CA, Kipfer P, Buser P, Seifert B, Erne P. Value of<br />
brain natriuretic peptides in primary care patients with the clinical<br />
diagnosis of chronic heart failure. Scand Cardiovasc J. <strong>2009</strong>: 1–6<br />
Resink TJ, Philippova M, Joshi MB, Kyriakakis E, Erne P. Cadherins and<br />
cardiovascular disease. Swiss Med Wkly. <strong>2009</strong>; 139(9–10): 122–34<br />
Kobza R, Roos M, Niggli B, Abächerli R, Lupi GA, Frey F, Schmid JJ, Erne<br />
P. Prevalence of long and short QT in a young population of 41, 767<br />
predominantly male Swiss conscripts. Heart Rhythm. <strong>2009</strong>; 6(5):<br />
652–7<br />
Schoenenberger AW, Erne P. [Coronary artery disease – definitions<br />
andepidemiology]. Ther Umsch. <strong>2009</strong> Apr; 66(4): 223–9<br />
Schoenenberger AW, Erne P. [Pharmacotherapy in coronary artery<br />
disease]. Ther Umsch. <strong>2009</strong>; 66(4): 261–76<br />
Erne P, Corti R, Radovanovic D, Schoenenberger AW. [Treatment of<br />
acute coronary syndromes]. Ther Umsch. <strong>2009</strong>; 66(4): 309–16<br />
Philippova M, Joshi MB, Kyriakakis E, Pfaff D, Erne P, Resink TJ. A guide<br />
and guard: the many faces of T-cadherin. Cell Signal. <strong>2009</strong>; 21(7):<br />
1035–44<br />
Bayrakcioglu S, Erne P. [What is your diagnosis?]. Praxis (Bern 1994).<br />
<strong>2009</strong>; 98(9): 473–4<br />
Buechner SA, Philippova M, Erne P, Mathys T, Resink TJ. High T-cadherin<br />
expression is a feature of basal cell carcinoma. Br J Dermatol.<br />
<strong>2009</strong>; 161(1): 199–202<br />
Waksman R, Erbel R, Di Mario C, Bartunek J, de Bruyne B, Eberli FR,<br />
Erne P, Haude M, Horrigan M, Ilsley C, Böse D, Bonnier H, Koolen J,<br />
Publikationen<br />
Lüscher TF, Weissman NJ; PROGRESS-AMS (Clinical Performance<br />
Angiographic Results of Coronary Stenting with Absorbable Metal<br />
Stents) Investigators. Early- and long-term intravascular ultrasound<br />
and angiographic findings after bioabsorbable magnesium stent<br />
implantation in human coronary arteries. JACC Cardiovasc Interv.<br />
<strong>2009</strong>; 2(4): 312–20<br />
Radovanovic D, Erne P. Gender difference in the application of reperfusion<br />
therapy in patients with acute myocardial infarction. Cardiology.<br />
<strong>2009</strong>; 114(3): 164–6<br />
Schoenenberger AW, Kobza R, Jamshidi P, Zuber M, Abbate A, Stuck<br />
AE, Pfisterer M, Erne P. Sudden cardiac death in patients with silent<br />
myocardial ischemia after myocardial infarction (from the Swiss<br />
Interventional Study on Silent Ischemia Type II [SWISSI II]). Am J Cardiol.<br />
<strong>2009</strong>; 104(2): 158–63<br />
Joshi MB, Kyriakakis E, Pfaff D, Rupp K, Philippova M, Erne P, Resink<br />
TJ. Extracellular cadherin repeat domains EC1 and EC5 of T-cadherin<br />
are essential for its ability to stimulate angiogenic behavior of endothelial<br />
cells. FASEB J. <strong>2009</strong>; 23(11): 4011–21<br />
Stolt Steiger V, Goy JJ, Stauffer JC, Radovanovic D, Duvoisin N, Urban<br />
P, Bertel O, Erne P; AMIS Plus Investigators. Significant decrease in<br />
in-hospital mortality and major adverse cardiac events in Swiss<br />
STEMI patients between 2000 and December 2007. Swiss Med Wkly.<br />
<strong>2009</strong>; 139(31-32): 453–7<br />
Suter Y, Schoenenberger AW, Toggweiler S, Jamshidi P, Resink T, Erne<br />
P. Intravascular ultrasound-based left main coronary artery assessment:<br />
comparison between pullback from left anterior descending<br />
and circumflex arteries. J Invasive Cardiol. <strong>2009</strong>; 21(9): 457–60<br />
Kobza R, Schoenenberger AW, Erne P. Esophagus imaging for catheter<br />
ablation of atrial fibrillation: comparison of two methods with<br />
showing of esophageal movement. J Interv Card Electrophysiol. <strong>2009</strong><br />
Dec; 26(3): 159–64<br />
Schoenenberger AW, Jamshidi P, Zuber M, Stuck AE, Pfisterer M,<br />
Erne P. Coronary artery disease is common in asymptomatic patients<br />
with signs of myocardial ischemia. Eur J Intern Med. <strong>2009</strong>; 20(6):<br />
607–10<br />
Abächerli R, Zhou L, Schmid JJ, Kobza R, Niggli B, Frey F, Erne P. Correlation<br />
relationship assessment between left ventricular hypertrophy<br />
voltage criteria and body mass index in 41,806 Swiss conscripts.<br />
Ann Noninvasive Electrocardiol. <strong>2009</strong>; 14(4): 381–8<br />
Toggweiler S, Suter Y, Schoenenberger AW, Kaspar M, Jamshidi P,<br />
Erne P. Differences in coronary artery plaques between target and<br />
non-target vessels. J Invasive Cardiol. <strong>2009</strong>; 21(11): 584–7<br />
Cuculi F, Radovanovic D, Pedrazzini G, Regli M, Urban P, Stauffer JC,<br />
Erne P; AMIS Plus Investigators. Is pretreatment with Beta-blockers<br />
beneficial in patients with acute coronary syndrome? Cardiology.<br />
2010; 115(2): 91–7. Epub <strong>2009</strong> Nov 7<br />
Widimsky P, Wijns W, Fajadet J, de Belder M, Knot J, Aaberge L, Andrikopoulos<br />
G, Baz JA, Betriu A, Claeys M, Danchin N, Djambazov S, Erne<br />
P, Hartikainen J, Huber K, Kala P, Klinceva M, Kristensen SD, Ludman<br />
P, Ferre JM, Merkely B, Milicic D, Morais J, Noc M, Opolski G, Ostojic<br />
M, Radovanovic D, De Servi S, Stenestrand U, Studencan M, Tubaro<br />
M, Vasiljevic Z, Weidinger F, Witkowski A, Zeymer U; on behalf of the<br />
European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions.<br />
Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction<br />
in Europe: description of the current situation in 30 countries.<br />
Eur Heart J. <strong>2009</strong> Nov 19. [Epub ahead of print]<br />
115
116 Publikationen<br />
Schoenenberger AW, Radovanovic D, Stauffer JC, Windecker S, Urban<br />
P, Niedermaier G, Keller PF, Gutzwiller F, Erne P; For the AMIS Plus<br />
Investigators. Acute coronary syndromes in young patients: Presentation,<br />
treatment and outcome. Int J Cardiol. <strong>2009</strong> Nov 24<br />
Schwartz GG, Olsson AG, Ballantyne CM, Barter PJ, Holme IM, Kallend<br />
D, Leiter LA, Leitersdorf E, McMurray JJ, Shah PK, Tardif JC, Chaitman<br />
BR, Duttlinger-Maddux R, Mathieson J; dal-OUTCOMES Committees<br />
and Investigators. Rationale and design of the dal-OUTCOMES trial:<br />
efficacy and safety of dalcetrapib in patients with recent acute coronary<br />
syndrome. Am Heart J. <strong>2009</strong>; 158(6): 896–901.e3<br />
Zuber M, Zellweger M, Bremerich J, Auf der Mauer C, Buser PT.<br />
[Noninvasive diagnostic of coronary artery disease]. Ther Umsch.<br />
<strong>2009</strong>; 66(4): 241–51<br />
Chirurgie<br />
Unfallchirurgie<br />
Publikationen<br />
Brunner A, Horisberger M, Ulmar B, Hoffmann A, Babst R Classification<br />
systems for tibial plateau fractures: Does computed tomography<br />
scanning improve their reliability? Injury. <strong>2009</strong> Sept 8, Epub ahead of<br />
print PMID 19744652 PubMed – as supplied by publisher<br />
Brunner F, Sommer C, Bahrs C, Heuwinkel R, Hafner C, Rillmann P,<br />
Kohut G, Ekelund A, Muller M, Audigé L, Babst R Open reduction and<br />
internal fixation of proximal humerus fractures using a proximal<br />
humeral locked plate: a prospective multicenter analysis J Orthop<br />
Trauma <strong>2009</strong>; 23(3): 163–72 PMID 19516088 Pub Med – indexed for<br />
MEDLINE<br />
Brunner A, Honigmann P, Treumann T, Babst R The impact of stereovisualisation<br />
of three-dimensional CT datasets on the inter- and<br />
intraobserver reliability of the AO/OTA and Neer classifications in<br />
the assessment of fractures of the proximal humerus JBone Joint<br />
Surg Br. <strong>2009</strong>; 9(6): 766–71 PMID: 19483230 PubMed – indexed for<br />
MEDLINE<br />
Brunner A, Honigmann P, Horisberger M, Babst R Open reduction<br />
and fixation of medial Moore type II fractures of the tibial plateau<br />
by a direct dorsal approach Arch Orthop Trauma Surg <strong>2009</strong>; 129(9):<br />
1233–8. Epub <strong>2009</strong> Feb 24. PMID: 19238408 PubMed – indexed for<br />
MEDLINE<br />
Orthopädie<br />
Publikationen<br />
Chegini S, Beck M, Ferguson SJ. The effects of impingement and<br />
dysplasia on stress distributions in the hip joint during sitting and<br />
walking: a finite element analysis. J Orthop Res. <strong>2009</strong>, 27: 195–201<br />
Dudda M, Albers C, Mamisch TC, Werlen S, Beck M. Do Normal Radiographs<br />
Exclude Asphericity of the Femoral Head-Neck Junction? Clin<br />
Orthop Relat Res. <strong>2009</strong>, 467: 651–659<br />
Neumann M, Cui Q, Siebenrock KA, Beck M. Impingement-free Hip<br />
Motion: The «Normal» Angle Alpha after osteochondroplasty. Clin<br />
Orthop Relat Res. <strong>2009</strong>, 467: 699–703<br />
Kalhor M, Beck M, Huff TW, Ganz R. Capsular and pericapsular contributions<br />
to acetabular and femoral head perfusion. J Bone Joint<br />
Surg Am. <strong>2009</strong>, 91A: 409–18<br />
Bittersohl B, Steppacher S, Haamberg T, Kim YJ, Werlen S, Beck M,<br />
Siebenrock KA, Mamisch TC. Cartilage Damage in Femoroacetabular<br />
Impingement (FAI): Preliminary Results on Comparison of Standard<br />
Diagnostic versus Delayed Gadolinium-Enhanced Magnetic Resonance<br />
Imaging of Cartilage (dGEMRIC). Osteoarthritis and Cartilage.<br />
<strong>2009</strong>, 17: 1297–306<br />
Beck M. Groin Pain after Open FAI Surgery: The Role of Intraarticular<br />
Adhesions. Clin Orthop Relat Res <strong>2009</strong>, 467: 769–774<br />
Beck M, Fucentese SF, Staub L, Siebenrock K. Surgical dislocation of<br />
the hip for the treatment of femoroacetabular impingement: Technique<br />
and results. Orthopade. <strong>2009</strong>, 38: 412–418<br />
Beck M. Mechanische Ursachen der Hüftgelenksarthrose. Leading<br />
Opinions Orthopädie <strong>2009</strong>, 3: 14–16<br />
Beck M. Editorial: Gelenkerhaltende Hüftchirurgie. Leading Opinions<br />
Orthopädie <strong>2009</strong>, 3<br />
Herz-, Thorax-, Gefässchirurgie<br />
Publikationen<br />
Mihov D, Bogdanov N, Grenacher B, Gassmann M, Zünd G, Bogdanova<br />
A, Tavakoli R. Erythropoietin protects from reperfusion-induced<br />
myocardial injury by enhancing coronary endothelial nitric oxide<br />
production. Eur J Cardiothorac Surg <strong>2009</strong>; 35: 839–46<br />
Farand P, Brochu MC, Gervais A, Mueller X. Familial unruptured sinus<br />
of Valsalva aneurysm obstructing the right ventricular outflow tract.<br />
Can J Cardiol <strong>2009</strong>; 25: 227–8<br />
Duwe J, Habersaat A, Brunner D, Seelos R: Surveillance after EVAR: is<br />
a 6-month Ct-scan necessary? 7. Gemeinsamer Jahreskongress der<br />
SGC mit der Schweizerischen Gesellschaft für Herz-, Gefäss- und<br />
Thorax-Chirurgie. Montreux, 10.–12.06.<strong>2009</strong><br />
Stellmes A, Seelos R: Endovaskuläre Versorgung eines mykotischen<br />
A. spurium der thorakalen Aorta im Intervall nach Salmonella enteritidis<br />
Sepsis. 7. Gemeinsamer Jahreskongress der SGC mit der<br />
Schweizerischen Gesellschaft für Herz-, Gefäss- und Thorax-Chirurgie.<br />
Montreux, 10.–12.06.<strong>2009</strong><br />
Hand- und plastische Chirurgie<br />
Publikationen<br />
Hohendorf B, Treumann TC, von Wartburg U. Thenar-Hammer-<br />
Syndrom. Handchir Mikrochir Plast Chir <strong>2009</strong>; 41: 38–43<br />
Babst D, von Wartburg U. Häufige Krankheiten der Hand – ein Überblick.<br />
Podologie Schweiz, Offizielles Organ des Schweiz. Podologen<br />
Verbandes. <strong>2009</strong>; 8: 8–10<br />
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie<br />
Publikationen<br />
Helbling-Sieder C, Gebbers J-O, Kuttenberger J. Eosinophiles Granulom<br />
des Unterkiefers – Fallbericht. Schweiz Monatsschr Zahnmed<br />
<strong>2009</strong>; 119(9): 887–891<br />
Schache AG, Lieger O, Rogers P, Kelly A, Newman L, Kalavrezos N.<br />
Predictors of swallowing outcome in patients treated with surgery<br />
and radiotherapy for advanced oral and oropharyngeal cancer. Oral<br />
Oncol. <strong>2009</strong>; 45(9): 803–8. Epub <strong>2009</strong> Feb 28. PubMed PMID: 19251473<br />
Lieger O, Graf C, El-Maaytah M, Von Arx T. Impact of educational<br />
posters on the lay knowledge of school teachers regarding emergency<br />
management of dental injuries. Dent Traumatol. <strong>2009</strong>; 25(4):<br />
406–12. Epub <strong>2009</strong> 9. PubMed PMID: 19519860
Lieger O, Zix J, Kruse A, Iizuka T. Dental injuries in association with<br />
facial fractures. J Oral Maxillofac Surg. <strong>2009</strong> Aug; 67(8): 1680–4.<br />
PubMed PMID: 19615582<br />
Buchbeitrag<br />
Hardt N, Kuttenberger J. Craniofacial Trauma – Diagnosis and<br />
Management. Springer Verlag <strong>2009</strong><br />
Neurochirurgie<br />
Publikationen<br />
Bagley CA, Wilson S, Kothbauer KF, Bookland MJ, Epstein F, Jallo GI.<br />
Long term outcomes following resection of myxopapillary ependymomas.<br />
Neurosurg Rev. <strong>2009</strong>; 32(3): 321–34; discussion 334.<br />
Wörner J, Kothbauer K, Gerber H. Intrathecal morphine pump malfunction<br />
due to leakage ath the catheter connection site: a rare<br />
problem and its prevention. Anesth Analg. <strong>2009</strong>; 108(6): 1994–5; discussion<br />
1995<br />
Kothbauer KF, Deletis V. Intraoperative neurophysiology of the conus<br />
medullaris and cauda equina. Childs Nerv Syst. <strong>2009</strong> Nov 11. [Epub<br />
ahead of print]<br />
Sciubba DM, Liang D, Kothbauer KF, Noggle JC, Jallo GI. The evolution<br />
of intramedullary spinal cord tumor surgery. Neurosurgery. <strong>2009</strong>;<br />
65(6 Suppl): 84–91; discussion 91–2<br />
Buchkapitel<br />
Kothbauer KF (<strong>2009</strong>) Intracranial injury. In: Craniofacial Neurotraumatology.<br />
Hardt N, Kuttenberger JJ (eds), Springer, Berlin.<br />
Urologie<br />
Publikationen<br />
Dobry E., Danuser H. Bildgebung der Nieren und Harnwege. Ther.<br />
Umschau <strong>2009</strong>. 66. 39–42<br />
Danuser H., Baumeister P. Das Harnblasenkarzinom: Neues zur Epidemiologie.<br />
Diagnostik. Therapie und Nachsorge. Schweizerische<br />
Zeitschrift für Onkologie. <strong>2009</strong>. 3. 2–6<br />
Danuser H., Baumeister P., Schmid H.-P. Urologie zwischen Tradition<br />
und Innovation – Blasenkarzinom: Was haben wir in den letzten 10<br />
Jahren gelernt? J Urol Urogynäkol <strong>2009</strong>; 16(1) 23–26<br />
Buchkapitel<br />
Danuser H., Weiss R., Hauser D.S., Studer U.E., and Mevissen M.:<br />
Effect of K-channel openers and Serotonin receptor agonists and<br />
antagonists on ureter motility. In: Aspects of Pharmacology of the<br />
pyeloureter with clinical perspectives. Editors: J Mortensen. F. Adreasen.<br />
U. Simonsen <strong>2009</strong>.<br />
Viszeralchirurgie<br />
Publikationen<br />
Criblez D, Treumann T, Metzger J. Imaging studies in the diagnosis of<br />
functional abdominal disorders. Ther Umsch <strong>2009</strong>; 66: 25–30<br />
Nock-Ciocco C, Wüst MB, Metzger J et al. Phäochromozytom zum<br />
Ersten, zum Zweiten, zum Dritten … Schweiz Med Forum <strong>2009</strong>; 9:<br />
127–128<br />
Mujagic E, Zuber M, Metzger J, Hamel C, Oertli D, Frey DM. Randomized<br />
clinical trial of lichtenstein‘s operation versus mesh plug<br />
repair for inguinal herniaslong term results. Br. J. Surg 96 [S3], 1. <strong>2009</strong><br />
Bjorck M, Bruhin A, Cheatham M et al. Classification-important step<br />
to improve management of patients with an open abdomen. World J<br />
Surg <strong>2009</strong>; 33: 1154–1157<br />
Publikationen<br />
Fischer C, Nagel H, Metzger J. Image of the month. Gastrointestinal<br />
stromal tumor of the small bowel. Arch Surg <strong>2009</strong>; 144: 379–380<br />
Muller SA, Blauer K, Kremer M , Metzger J et al. Exact CT-Based Liver<br />
Volume Calculation Including Nonmetabolic Liver Tissue in Three-<br />
Dimensional Liver Reconstruction. J Surg Res <strong>2009</strong><br />
Scheiwiller A, Sykora M. Obesity surgery-useful knowledge in indication<br />
and follow up] Praxis <strong>2009</strong>; 98: 1155–1160<br />
Spezialkliniken<br />
Augenklinik<br />
Publikationen<br />
Menassa N, Bosshard PP, Kaufmann C, Grimm C, Auffarth GU, Thiel<br />
MA. Rapid detection of fungal keratitis using DNA-stabilizing FTA(R)<br />
filter paper. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010; 51(4): 1905–10<br />
Kaufmann C, Krishnan A, Landers J, Esterman A, Thiel MA, Goggin M.<br />
Astigmatic neutrality in biaxial microincision cataract surgery.<br />
J Cataract Refract Surg. <strong>2009</strong>; 35(9): 1555–62<br />
Cursiefen C, Bock F, Horn FK, Kruse FE, Seitz B, Borderie V, Früh B,<br />
Thiel MA, Wilhelm F, Geudelin B, Descohand I, Steuhl KP, Hahn A,<br />
Meller D. GS-101 antisense oligonucleotide eye drops inhibit corneal<br />
neovascularization: interim results of a randomized phase II trial.<br />
Ophthalmology. <strong>2009</strong>; 116(9): 1630–7<br />
Kaufmann C, Thiel MA, Esterman A, Dougherty PJ, Goggin M. Astigmatic<br />
change in biaxial microincisional cataract surgery with enlargement<br />
of one incision: a prospective controlled study. Clin Experiment<br />
Ophthalmol. <strong>2009</strong>; 37(3): 254–61<br />
Bochmann F, Howell JP, Meier C, Becht C, Thiel MA. The disc damage<br />
likelihood scale (DDLS): interobserver agreement of a new grading<br />
system to assess glaucomatous optic disc damage. Klin Monbl<br />
Augenheilkd. <strong>2009</strong>; 226(4): 280–3<br />
Bochmann F, Kaufmann C, Becht C, Bachmann LM, Thiel MA.<br />
Com parison of dynamic contour tonometry with Goldmann applanation<br />
tonometry following Descemet‘s stripping automated endothelial<br />
keratoplasty (DSAEK). Klin Monbl Augenheilkd. <strong>2009</strong>; 226(4):<br />
241–4<br />
Hasler S, Thiel MA, Becht CN. In vivo confocal microscopy of keratic<br />
precipitates in fuchs heterochromic uveitis syndrome. Klin Monbl<br />
Augenheilkd. <strong>2009</strong>; 226(4): 237–40<br />
Wyrsch S, Thiel MA, Becht CN. Safety of treatment with tacrolimus<br />
ointment for anterior segment inflammatory diseases. Klin Monbl<br />
Augenheilkd. <strong>2009</strong>; 226(4): 234–6<br />
Thiel MA, Kaufmann C, Dedes W, Bochmann F, Becht CN, Schipper I.<br />
Predictability of microkeratome-dependent flap thickness for DSAEK.<br />
Klin Monbl Augenheilkd. <strong>2009</strong>; 226(4): 230–3<br />
Lange AP, Bochmann F, Schmid MK, Thiel MA. The impact of infectious<br />
ocular emergencies on hospital resources. Klin Monbl Augenheilkd.<br />
<strong>2009</strong>; 226(4): 227–9<br />
Hasler S, Dedes W, Mathis A, Grimm F, Thiel MA. MoisturePlus contact<br />
lens solution as a source of acanthamoeba keratitis. Cornea. <strong>2009</strong><br />
Feb; 28(2): 219–20<br />
Thiel MA, Kaufmann C, Coster DJ, Williams KA. Antibody-based<br />
immunosuppressive agents for corneal transplantation. Eye (Lond).<br />
<strong>2009</strong>; 23(10): 1962–5<br />
117
118 Publikationen<br />
Bochmann F, Azuara-Blanco A. Transcameral suture to prevent tubecorneal<br />
touch after glaucoma drainage device implantation: a new<br />
surgical technique. J Glaucoma. <strong>2009</strong>; 18(8): 576–7<br />
Mohamed-Noor J, Bochmann F, Siddiqui MA, Atta HR, Leslie T, Maharajan<br />
P, Wong YM, Azuara-Blanco A. Correlation between corneal and<br />
scleral thickness in glaucoma. J Glaucoma. <strong>2009</strong>; 18(1): 32–6<br />
Ang GS, Bochmann F, Azuara-Blanco A. Argon laser peripheral iridoplasty<br />
for plateau iris associated with iridociliary cysts: a case report.<br />
Cases J. 2008; 1(1): 368<br />
Becht Ch. Common immune mediated disorders of the conjunctiva<br />
in a general practice. Praxis (Bern 1994). <strong>2009</strong> 15; 98(8): 429–32<br />
Wyrsch S, Thiel MA, Becht CN. Sicherheit der Behandlung entzündlicher<br />
Vorderabschnittserkrankungen mit Tacrolimus-Salbe. Klin Monatsbl<br />
Augenheilkd <strong>2009</strong>; 226: 234<br />
Lange AP, Bahar I, Sansanayudh W, Kaisermann I, Slomovic AR. Salzmann<br />
Nodules – A Possible New Ocular Manifestation of Crohn<br />
Disease. Cornea <strong>2009</strong>; 28(1): 85–6<br />
Becht C, Senn P, Lange AP. Delayed Occurrence of Subretinal Silicone<br />
Oil after Retinal Detachment Surgery in an Optic Disc Pit. Klin Monatsbl<br />
Augenheilkd <strong>2009</strong>; 226: 357–358<br />
Lange AP, Vandekerckhove K, Becht C, Zakrzewski PA, Schmid MK.<br />
Spontaneous Closure of a Traumatic Macular Hole. Klin Monatsbl<br />
Augenheilkd <strong>2009</strong>; 226: 359–360<br />
HNO<br />
Publikationen<br />
Linder T, Schlegel Ch, De Min Nicola, van der Westhuizen S. Active<br />
Middle Ear Implants in Patients Undergoing Subtotal Petrosectomy.<br />
Otol Neurotol <strong>2009</strong>; 30: 41–47<br />
Linder T. Akute Otitis media und akuter Tubenmittelohrkatarrh: In der<br />
Praxis behandeln oder überweisen – das Update. Hausarzt Praxis<br />
<strong>2009</strong>; 20: 6–8<br />
Röösli C, Bortoluzzi L, Linder TE, Müller W. Stellenwert der minimalinvasiven<br />
Chirurgie beim primären und sekundären Hyperpara -<br />
thy reoidismus. Laryngo-Rhino-Otologie <strong>2009</strong>; 7: 439–502<br />
Schlegel Ch, Linder T. Neue Entwicklungen in der Behandlung der<br />
Schwerhörigkeit. Hörakustik 2008; 10<br />
Soyka M, Schlegel Ch, Pabst G, Linder Th. Stapes only: do it, stage it<br />
or leave it? Schweiz Med Forum <strong>2009</strong>; 9; (Suppl. 49), 9–12<br />
Schlegel Ch. Die chronisch obstruierte Nase. CME zertifizierte Fortbildung.<br />
Hausarzt Praxis <strong>2009</strong>; 20: 8–10<br />
Pabst G. Speichelstein: wenn es beim Essen schwillt und schmerzt.<br />
Praxis 2008 3/4: 4–6<br />
Marchal F, Chossegros C, Pabst G et al. Salivary stones and stenosis.<br />
A comprehensive classification. Rev Stomatol Chir Maxillofac. <strong>2009</strong>;<br />
110 (1): e1–4<br />
Bucher A, Linder T, Gärtner M. Intratympanale Dexamethason- und<br />
Hyaluronsäure-Injektion beim Morbus Menière. Schweiz Med Forum<br />
<strong>2009</strong>; 9; (Suppl. 49), 38–42<br />
Nguyen BT, Müller W. Implantierbare Phrenicusstimulatoren. Schweiz<br />
Med Forum <strong>2009</strong>; 9; (Suppl. 49), 88–90<br />
Bücher/Buchkapitel<br />
Schlegel Ch, Briner HR. Otoplasty – A practical surgical guide. Silverbooklet<br />
Verlag Endopress Tuttlingen <strong>2009</strong><br />
Schlegel Ch. Sportverletzungen von Ohren, Gesichtsschädel und<br />
Halsweichteilen in «Sportverletzungen: Diagnose, Management und<br />
Begleitmassnahmen». 2. Auflage; Elsevier Verlag, München, Buchkapitel<br />
14<br />
Pabst G, Henseler M. Bildatlas für Plastisch rekonstruktive Eingriffe<br />
im Gesichtsbereich. 1. Auflage; <strong>2009</strong><br />
Neue Frauenklinik<br />
Publikationen<br />
K. Baessler, B. Schuessler, K.L. Burgio, K.H. Moore, P.A. Norton, S.L.<br />
Stanton. Pelvic Floor Re-education: Principles and Practice 2nd Edition.<br />
Springer Verlag London <strong>2009</strong>, ISBN–13: 9-781-852-339-685<br />
B. Schuessler, A. Kuhn. Physiologie und Pathophysiologie der Harnspeicherung;<br />
in Tunn – Hanzal – Perucchini, Urogynäkologie in Praxis<br />
und Klinik, 2. Auflage Walter de Gruyter Berlin – New York ISBN 978-<br />
3-11-020688-3<br />
T. Kavvadias, D. Kaemmer, U. Klinge, S. Kuschel, B. Schuessler. Foreign<br />
body reaction in vaginally eroded and noneroded polypropylene<br />
suburethral slings in the female: a case series; Int Urogynecol J Pelvic<br />
Floor Dysfunct. <strong>2009</strong><br />
Kinderspital<br />
Kinderchirurgie<br />
Publikationen<br />
Fette A, Schwöbel M.G. Small bowel eviszeration trough the rectum<br />
in childhood (letter). J Pediatr Surg (<strong>2009</strong>), 44 (1): 302–303<br />
Feichter S, Meier-Ruge W.A., Bruder E. The histopathology of gastrointestinal<br />
motility disorders in children. Seminars in Pediatric Surgery<br />
(<strong>2009</strong>) 18, 206–211<br />
Hacker H.W., Szavay Ph, Dittmann H., Haber H.P., Fuchs J. Pyeloplasty<br />
in children: is there a difference in patients with or without crossing<br />
lower pole vessel? Pediatr Surg Int (<strong>2009</strong>) 25: 607–611<br />
Hacker H.W., Winiker H., Caduff J., Schwöbel M.G. Inflammatory<br />
tumor of the prostate in a 4-year-old boy. J Pediatr Urol (<strong>2009</strong>) 5,<br />
516–518<br />
Feichter S., Kirchhoff Ph., Oertli D., Heizmann O. Abdominal wall rupture<br />
following a fit of coughing. Inj Extra (<strong>2009</strong>), doi: 10.1016/<br />
j.injury.<strong>2009</strong>.07.073<br />
Fette A, Feichter S, Haecker F.-M., Zettl A.S., Mayr J. Elastischstabile<br />
Markraumschienung (ESMS) von Unterarmschaftfrakturen im<br />
Kindesalter. Online publiziert 17.03.<strong>2009</strong>, Springer Medizin Verlag<br />
Bruhin A., Feichter S., Sykora M., Rosenkranz J., Metzger J.: Behandlung<br />
des offenen Abdomens beim septischen Patienten: ist der<br />
Abdominal-V.A.C. ® der Schlüssel für ein besseres Outcome?<br />
Zeitschrift für Wundheilung, Deutsche Gesellschaft für Wundheilung<br />
und Wundbehandlung e.V. <strong>2009</strong><br />
Pädiatrie<br />
Publikationen<br />
Gonzalez E, Neuhaus TJ, Kemper MJ, Girardin E. Proteomic analysis<br />
of mononuclear cells of patients with minimal-change nephrotic syndrome<br />
of childhood. Nephrol Dial Transplant <strong>2009</strong>; 24: 149–55<br />
Wühl E, Trivelli A, Picca S, Litwin M, Peco-Antic A, Zurowska A, Testa<br />
S, Jankauskiene A, Emre S, Caldas-Afonso A, Anarat A, Niaudet P, Mir<br />
S, Bakkaloglu A, Enke B, Montini G, Wingen A-M, Sallay P, Jeck N, Berg
U, Çaliskan S, Wygoda S, Hohbach-Hohenfellner K, Dusek J, Urasinski<br />
T, Arbeiter K, Neuhaus TJ, Gellermann J, Drozdz D, Fischbach M, Möller<br />
K, Wigger M, Peruzzi L, Mehls O, and Schaefer F for the ESCAPE<br />
Trial Group. Strict Blood-Pressure Control and Progression of Renal<br />
Failure in Children. N Engl J Med <strong>2009</strong>; 361: 1639–1650<br />
Ulmer FF, Landolt MA, Ha Vinh R, Huisman TAGM, Neuhaus TJ, Latal B<br />
and Laube GF. Intellectual and motor performance, quality of life and<br />
psychosocial adjustment in children with cystinosis. Pediatr Nephrol<br />
<strong>2009</strong>; 24: 1371–1378<br />
Drube J, Schiffer E, Mischak H, Kemper MJ, Neuhaus TJ, Pape L,<br />
Lichtinghagen R, Ehrich JH. Urinary proteome pattern in children with<br />
renal Fanconi syndrome. Nephrol Dial Transplant <strong>2009</strong>; 24: 2161–<br />
2169<br />
Kleinknecht M, Neuhaus TJ, Landolt MA. Pflegebedürfnisse transplantierter<br />
Jugendlicher: eine deskriptive Querschnittstudie in einem<br />
Schweizer Spital. Pflege <strong>2009</strong>; 22: 172–182<br />
Kleinknecht M, Neuhaus TJ, Gehring TM, Landolt MA. Die Beziehung<br />
zum interdisziplinären Behandlungsteam aus Sicht nierentransplantierter<br />
Jugendlicher. Pflege <strong>2009</strong>; 22: 287–296<br />
Eng PA. Immuntherapie im Kindesalter. Allergologie <strong>2009</strong>; 32: 441–<br />
45<br />
Eng PA. Immuntherapie bei Asthma – erfolgversprechend oder zu<br />
gefährlich? Revue Medicale Suisse <strong>2009</strong>: 62–63<br />
Ferrari G, Eng PA. Neurodermitis – der Einfluss der Ernährung. DoX-<br />
Medical <strong>2009</strong>: 21–23<br />
Roth S, Barrazzone C, Barben J, Casaulta C, Eigenmann P, Eng PA,<br />
Guinand S, Hafen G, Hammer J, Knöpfli B, Kühni C, Lauener R, Möller<br />
A, Oswald H, Regamey N, Regamey A, Schöni M, Trachsel D, Wildhaber<br />
J, Zanolari M, Frey U. Empfehlungen zur Behandlung der obstruktiven<br />
Atemwegserkrankungen im Kindesalter (SGPP/PIA–CH<br />
<strong>2009</strong>). Paediatrica <strong>2009</strong>; 20: 44–51<br />
Berger TM, Hofer A. Causes and circumstances of neonatal deaths<br />
in 108 consecutive cases over a 10-year-period at the Children‘s<br />
Hospital of Lucerne. Neonatology. <strong>2009</strong>; 95: 157–163<br />
Berger TM, Aebi C, Duppenthaler A, Stocker M. Prospective population-based<br />
study of RSV-related intermediate care and intensive<br />
care unit admissions in Switzerland over a four-year-period (2001–<br />
2005). Infection <strong>2009</strong>; 37: 109–116<br />
Stocker M, Fontana M, Wegscheider K, Berger TM. Effect of procalcitonin-guided<br />
decision making on duration of antibiotic therapy and<br />
outcome in neonatal early-onset sepsis: Prospective randomized<br />
intervention trial. Neonatology <strong>2009</strong>; 97: 165–174<br />
Berger TM, Fischer N, Adams M. Survival rates of ELBW infants with<br />
a gestational age between 22–26 weeks in Switzerland: impact of the<br />
Swiss guidelines for the care of infants born at the limit of viability.<br />
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed <strong>2009</strong>; 94: F407–F413<br />
Berger TM, Pilgrim S. Die Reanimation des Neugeborenen. Der Anaesthesist<br />
<strong>2009</strong>; 58: 39–50<br />
Pilgrim S, Stocker M, Berger TM. Die Reanimation des Neugeborenen.<br />
Up2Date Pädiatrie <strong>2009</strong>; 4: 121–140<br />
Jöhr M, Berger TM, Burki S, Schmid E. The use of remifentanil for inducing<br />
apnea during diagnostic imaging in sedated pediatric patient<br />
– response to Dr Fu Sue. Paediatr Anaesth <strong>2009</strong>; 19: 268<br />
Wörner J, Jöhr M, Berger TM, Christen P. [Infections with respiratory<br />
syncytial virus: Underestimated risk during anaesthesia in infants.]<br />
Der Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58: 1041–1044<br />
Publikationen<br />
Gerber AU, Baumann-Hölzle R, Berger TM, Brunner N, Grob D, Laffer<br />
UT, Lehmann A, Osterwalder J, Regamay C, Salathé M, Siegemund M,<br />
Stocker R, Stulz P, von Planta M, Weiss P, Zürcher Zenklusen R.<br />
Medizinisch-ethische Richtlinien und Empfehlungen der SAMW:<br />
Reani mationsentscheidungen. Schweizerische Ärztezeitung <strong>2009</strong>;<br />
90: 20–27<br />
Neilson ED, Adams MD, Orr CMD, Schelling DK, Eiben RM, Kerr DS,<br />
Bassuk AG, Bye AM, Childs A-M, Clarke A, Crow YJ, Dohna-Schwake<br />
C, Dueckers G, Gika AD, Gionnis D, Gorman M, Grattan-Smith PJ,<br />
Hackenberg A, Kuster A, Lentschig MG, Mastroyianni S, Perrier J,<br />
Schmitt-Mechelke T, Skardoutsou A, Uldall P, van der Knaap MS,<br />
Goglin KC, Tefft DL, Aubin C, de Jager P, Hafler D, Warman ML. Infection-triggered<br />
familial and recurrent cases of acute necrotizing<br />
encephalopathy caused by mutations in a nuclear pore gene,<br />
RANBP2. Am J Hum Genet <strong>2009</strong>; 84: 44–51<br />
Wohlrab G, Leiba H, Kaestle R, Ramelli G, Schmitt-Mechelke T, Schmitt<br />
B, Landau K. Vigabatrin therapy in infantile spasms: solving one problem<br />
and inducing another? Epilepsia <strong>2009</strong>; 50: 2006–2008<br />
Derek E. Neilson, Mark D. Adams, Caitlin M. D. Orr, Deborah K. Schelling,<br />
Robert M. Eiben, Douglas S. Kerr, Alexander G. Bassuk, Ann M.<br />
Bye, Anne-Marie Childs, Antonia Clarke, Yanick J. Crow, Christian<br />
Dohna-Schwake, Gregor Dueckers, Artemis D. Gika, Dimitris Gionnis,<br />
Mark Gorman, Padraic J. Grattan-Smith, Annette Hackenberg, Alice<br />
Kuster, Markus G. Lentschig, Sotiria Mastroyianni, Julie Perrier, Thomas<br />
Schmitt-Mechelke, Angeliki Skardoutsou, Peter Uldall, Marjo S.<br />
van der Knaap, Karrie C. Goglin, David L. Tefft, Cristin Aubin, Philip de<br />
Jager, David Hafler, Matthew L. Warman. Infection-triggered familial<br />
and recurrent cases of acute necrotizing encephalopathy caused by<br />
mutations in a nuclear pore gene, RANBP2. American Journal of<br />
Human Genetics 84 (<strong>2009</strong>); 44–51<br />
Online Publikationen (Printversion erscheint 2010)<br />
Sturm V, Menke MN, Landau K, Laube GF, Neuhaus TJ. Ocular involvement<br />
in paediatric haemolytic uraemic syndrome. Acta Ophthalmol.<br />
Mégevand C, Gervaix A, Heininger U, Berger C, Aebi C, Vaudaux B,<br />
Kind C, Gnehm HP, Hitzler M, Renzi G, Schrenzel J, François P; for the<br />
Paediatric Infectious Disease Group Switzerland Staphylococcus aureus<br />
Study Group. Molecular epidemiology of the nasal colonization<br />
by methicillin-susceptible Staphylococcus aureus in Swiss children.<br />
Clin Microbiol Infect<br />
Buchbeiträge<br />
Steurer M, Berger TM. Spezifische ethische Konflikte in der pädiatrischen<br />
und neonatologischen Intensivmedizin. Praxisbuch Ethik in<br />
der Intensivmedizin. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft,<br />
Berlin, <strong>2009</strong>.<br />
Institute<br />
Institut für Anästhesie<br />
Originalarbeiten<br />
Baumgart A, Denz C, Bender H, Bauer M, Hunziker S, Schüpfer G,<br />
Schleppers A. Simulationsbasierte Analyse neuer Therapieprinzipien<br />
– Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der OP-Prozesse. Anaesthesist<br />
<strong>2009</strong>; 58: 180–6<br />
119
120 Publikationen<br />
Bolliger D, Seeberger MD, Lurati Buse GA, Christen P, Rupinski B,<br />
Gurke L, Filipovic M. A preliminary report on the prognostic significance<br />
of preoperative brain natriuretic peptide and postoperative<br />
cardiac troponin in patients undergoing major vascular surgery.<br />
Anesth Analg <strong>2009</strong>; 108: 1069–75<br />
Grote R, Sydow K, Menzel M, Hunziker S, Schüpfer G. Überlappende<br />
Einleitung. Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58: 1045–1047<br />
Haberthür C, Mehlig A, Stover JF, Schumann S, Möller K, Priebe H-J,<br />
Guttmann J. Expiratory automatic endotracheal tube compensation<br />
reduces dynamic hyperinflation in a physical lung model. Critical<br />
Care <strong>2009</strong>; 13: R4 (doi: 10.1186/cc7693)<br />
Hunziker S,· Baumgart A,· Denz C, · Schüpfer G. Ökonomischer Nutzen<br />
der überlappenden Einleitung – Untersuchung mithilfe eines<br />
Computersimulationsmodells. Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58: 623–632<br />
Kaufmann T, Lay V, Brach M, Schüpfer G. Ein Vergleich von Registerdaten<br />
mit routinemässig erhobenen Datensätzen zur Messung der<br />
Outcome-Qualität – Erfahrungen aus dem QuaZentral-Projekt aus<br />
der Schweiz. Gesundheitsökonomie&Qualitätsmanagement. <strong>2009</strong>;<br />
14: 1–6<br />
Schley MT, Matthias Casutt M, Haberthür C, Dusch M, Rukwied R,<br />
Schmelz M, Schmeck J, Schüpfer GK, Konrad CJ. Long-acting local<br />
anesthetics attenuate the FMLP-induced acute lung injury in rats.<br />
Anesth Analg <strong>2009</strong>; 109: 880–5<br />
Schley M, Ständer S, Kerner J, Vajkoczy P, Schüpfer G, Dusch M,<br />
Schmelz M, Konrad C. Predominant CB2 receptor expression in endothelial<br />
cells of glioblastoma in humans. Brain Res Bull. <strong>2009</strong>; 79:<br />
333–7<br />
Schumann St, Burcza B, Haberthür C, Lichtwarck-Aschoff M, Guttmann<br />
J. Estimating intratidal nonlinearity of respiratory system mechanics:<br />
a model study using the enhanced gliding-SLICE method.<br />
Physiol Meas <strong>2009</strong>; 30: 1341–1356<br />
Weber J, Schley M, Casutt M, Gerber H, Schuepfer G, Rukwied R,<br />
Schleinzer W, Ueberall M, Konrad C. Tetrahydrocannabinol (Delta<br />
9-THC) Treatment in Chronic Central Neuropathic Pain and Fibromyalgia<br />
Patients: Results of a Multicenter Survey. Anesthesiology<br />
Research and Practice; <strong>2009</strong>; Article ID 827290, 9 pages. doi:<br />
10.1155/<strong>2009</strong>/827290<br />
Übersichten, Editorials, Fallberichte<br />
Balga I, Gerber H, Konrad C, Diebold J. Entwicklung eines Weichteilulkus<br />
nach Anlage eines Periduralkatheters. Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58:<br />
156–162<br />
Jöhr M. Das Kind mit schwierigen Venen. Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58: 861–<br />
862<br />
Jöhr M, Caduff JH, Berger TM. Cervical thymus and internal jugular<br />
vein cannulation. Paediatr Anaesth 2010; 20: 105<br />
Lerman J, Jöhr M. Inhalational anesthesia vs total intravenous anesthesia<br />
(TIVA) for pediatric anesthesia. Paediatr Anaesth <strong>2009</strong>; 19:<br />
521–534<br />
Schley M, Rössler M, Konrad CJ, Schüpfer G. Verletzung der V. subclavia<br />
mit einer Thoraxdrainage. Anaesthesist <strong>2009</strong>;58: 180–6<br />
Weiss M, Mauch J, Becke K, Schmidt J, Jöhr M. Die fiberoptisch unterstützte<br />
endotracheale Intubation durch die Larynxmaske im Kindesalter.<br />
Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58: 716–721<br />
Wörner J. Paracetamol als Risikofaktor für Asthma – muss die Verordnungspraxis<br />
geändert werden. Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58: 88–89<br />
Wörner J, Jöhr M. Dexamethason zur Prophylaxe von postoperativer<br />
Übelkeit und Erbrechen Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58: 303–305<br />
Wörner J, Jöhr M, Berger TM, Christen P. Infektionen mit dem «respiratory<br />
syncytial virus». Unterschätzte Gefahr bei Säuglingsnarkosen.<br />
Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58: 1041–1044<br />
Wörner J, Kothbauer K, Gerber H. Intrathecal morphine pump malfunction<br />
due to leakage at the catheter connection site: a rare problem<br />
and its prevention. Anesth Analg <strong>2009</strong>; 108: 1994–1995<br />
Wörner J, Rukwied R, Konrad C. Co-Analgetika – heute und morgen.<br />
Eine rezeptorbasierte Übersicht analgetischer Therapieoptionen.<br />
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther <strong>2009</strong>; 44: 736–44<br />
Bücher und Buchkapitel<br />
Baumgart A, Denz C, Schüpfer G. Entscheidungsunterstützung durch<br />
computergestützte Simulation. In: Management im OP. Bender, Biermann,<br />
Schüpfer, Wichtl (Editors). MEPS – Medical Event & Publisher<br />
Services GmbH, Nürnberg, <strong>2009</strong>: 79–90<br />
Jöhr M. Kinderanästhesie. 7. Auflage. München, Elsevier, <strong>2009</strong><br />
Kaufmann T, Schüpfer G. Fehlzeitenmanagement. In: Management im<br />
OP. Bender, Biermann, Schüpfer, Wichtl (Editors). MEPS – Medical<br />
Event & Publisher Services GmbH, Nürnberg, <strong>2009</strong>: 355–365<br />
Kaufmann T, Schüpfer G. Beschwerdemanagement. Grundzüge für<br />
OP-Manager. In: Management im OP. Bender, Biermann, Schüpfer,<br />
Wichtl (Editors). MEPS – Medical Event & Publisher Services GmbH,<br />
Nürnberg, <strong>2009</strong>: 375–383<br />
Palasser H, Schüpfer G. Hospital Governance als Corporate Governance<br />
Ausprägung. In: Management im OP. Bender, Biermann, Schüpfer,<br />
Wichtl (Editors). MEPS – Medical Event & Publisher Services<br />
GmbH, Nürnberg, <strong>2009</strong>: 37–42<br />
Palasser H, Schüpfer G. Investitionen – eine Einführung für OP-<br />
Manager. In: Management im OP. Bender, Biermann, Schüpfer, Wichtl<br />
(Editors). MEPS – Medical Event & Publisher Services GmbH, Nürnberg,<br />
<strong>2009</strong>: 209–214<br />
Schüpfer G. Management von Veränderungen (Change-Management).<br />
In: Management im OP. Bender, Biermann, Schüpfer, Wichtl<br />
(Editors). MEPS – Medical Event & Publisher Services GmbH, Nürnberg,<br />
<strong>2009</strong>: 11–18<br />
Schüpfer G, Konrad C. Consultants – Umgang mit Beratern und Beratungsunternehmen.<br />
In: Management im OP. Bender, Biermann,<br />
Schüpfer, Wichtl (Editors). MEPS – Medical Event & Publisher Services<br />
GmbH, Nürnberg, <strong>2009</strong>: 43–50<br />
Schüpfer G. Die lernende Gesundheitsorganisation – individuelles<br />
Lernen und Unternehmenswandel. In: Management im OP und OP-<br />
Management. MEPS – Medical Event & Publisher Services GmbH,<br />
Nürnberg, <strong>2009</strong>: 11–115<br />
Schüpfer G, Konrad C. Assessment und Personalgewinnung. In:<br />
Management im OP. Bender, Biermann, Schüpfer, Wichtl (Editors).<br />
MEPS – Medical Event & Publisher Services GmbH, Nürnberg, <strong>2009</strong>:<br />
367–373<br />
Schüpfer G, Frietsch T. Spezielles Op-Management im Traumazentrum<br />
(für gemischte Knochenchirurgie in Orthopädischen und Unfallchirurgischen<br />
Operations-Zentren) in Anästhesie im Traumazentrum.<br />
In: Frietsch T, Weiler-Lorentz A (eds). Anästhesie für Orthopädie und<br />
Traumatologie. Elsevier GmbH, ISBN 978–3–437–24450–6; München<br />
<strong>2009</strong>: 60–77
Schüpfer G. Unternehmen Krankenhaus: Die Anforderungen an den<br />
OP-Manager. In: OP-Management 2. erweiterte und aktualisierte Auflage.<br />
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH&<br />
Co. KG, Berlin <strong>2009</strong>: 9–22<br />
Schüpfer G. Innovationsmanagement im OP Bereich. In: OP-Management<br />
2. erweiterte und aktualisierte Auflage. MWV Medizinisch<br />
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH& Co. KG, Berlin <strong>2009</strong>:<br />
163–168<br />
Guido Schüpfer G, Schmid H. Investitionsrechnung. OP-Management<br />
2. erweiterte und aktualisierte Auflage. MWV Medizinisch Wissenschaftliche<br />
Verlagsgesellschaft mbH& Co. KG, Berlin <strong>2009</strong>: 169–176<br />
Schüpfer G. Umgang mit Veränderungen ( «Changemanagement»).<br />
In: OP-Management 2. erweiterte und aktualisierte Auflage. MWV<br />
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH& Co. KG,<br />
Berlin <strong>2009</strong>: 177–181<br />
Schüpfer G: Handlungsanleitung für einen OP-Manager zur Evaluation<br />
eines OP-Bereiches. In: OP-Management 2. erweiterte und aktualisierte<br />
Auflage. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft<br />
mbH& Co. KG, Berlin <strong>2009</strong>: 559–565<br />
Schüpfer G. Kostenmanagement für OP-Manager – eine Übersicht.<br />
In: OP-Management 2. erweiterte und aktualisierte Auflage. MWV<br />
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH& Co. KG,<br />
Berlin <strong>2009</strong>: 567–569<br />
Tschudi O, Schüpfer G. Materialwirtschaft – Handlungsfelder für das<br />
OP-Management. In: Management im OP. Bender, Biermann, Schüpfer,<br />
Wichtl (Editors). MEPS – Medical Event & Publisher Services<br />
GmbH, Nürnberg, <strong>2009</strong>: 193–208<br />
Tschudi O, Schüpfer G. Innovationsmanagement im OP Bereich. In:<br />
OP-Management 2. erweiterte und aktualisierte Auflage. MWV Medizinisch<br />
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH& Co. KG, Berlin<br />
<strong>2009</strong>: 621–626<br />
Pathologie<br />
Publikationen<br />
Schmid L, Müller M, Treumann T, Arnold W, Möller B, Aeberli D, Villiger<br />
PM. Induction of Complete and Sustained Remission of Rheumatoid<br />
Pachymeningitis by Rituximab. Arthritis & Rheumatism <strong>2009</strong>; 60(6):<br />
1632–1634<br />
Schoepfer AM, Gonsalves N, Bussmann C, Conus S, Simon HU, Straumann<br />
A, Hirano I. Esophageal Dilation in Eosinophilic Esophagitis:<br />
Effectiveness, Safety, and Impact on the Underlying Inflammation.<br />
Am J Gastroenterol <strong>2009</strong> Nov 24 (Epub ahead of print)<br />
Honigmann P, Walz A, Bussmann C, Lerf B. Spontaneous bleeding of<br />
an Abrikossoff‘s tumor – a case report. J Cardiothorac Surg <strong>2009</strong>;<br />
4: 57<br />
Balga I, Gerber H, Konrad C, Diebold J. Entwicklung eines Weichteilulkus<br />
nach periduraler Langzeitinfusion. Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58(2):<br />
156–162<br />
Varella-Garcia M, Diebold J, Eberhard DA, Geenen K, Hirschmann A,<br />
Kochx M, Nagelmeier I, Rüschoff J, Schmitt M, Arbogast S, Cappuzzo<br />
F. EGFR fluorescence in situ hybridisation assay: guidelines for application<br />
to non-small-cell lung cancer. J Clin Pathol <strong>2009</strong>; 62(11): 970–7<br />
Schwarz E, Hürlimann S, Soyka JD, Bortoluzzi L, Strobel K. FDG-positive<br />
Warthin‘s tumors in cervical lymph nodes mimicking metastases<br />
in tongue cancer staging with PET/CT. Otolaryngol Head Neck Surg<br />
<strong>2009</strong>; 140(1): 134–5<br />
Publikationen<br />
Schley M, Rössle M, Konrad CJ, Schüpfer G. Verletzung der V. subclavia<br />
mit einer Thoraxdrainage. Anaesthesist <strong>2009</strong>; 58: 387–390<br />
Zentrum für LaborMedizin (ZLM)<br />
Publikation<br />
Zanolari P, Robert N, Lyashchenko KP, Pfyffer GE, Greenwald R, Esfandiari<br />
J, Meylan M. Tuberculosis caused by Mycobacterium microti in<br />
South American Camelids. J Vet Intern Med <strong>2009</strong>; 23: 1266–72<br />
Schmid P, Brodmann D, Fischer AG, Wuillemin WA. Study of bioaccumulation<br />
of dalteparin at prophylactic dose in patients with impaired<br />
renal function. J Thromb Haemost <strong>2009</strong>; 7: 552–8<br />
Carrier M, Righini M, Karami Djurabi R, Huisman MJ, Perrier A, Wells<br />
PS, Wuillemin WA, Le Gal G. VIDAS© D-dimer in combination with<br />
clinical pre-test probability to rule out pulmonary embolism. A systematic<br />
review of the management outcome studies. Thromb Haemost<br />
<strong>2009</strong>; 101: 886–92<br />
Zieger B, Jenny A, Tsakiris DA, Bartsch I, Sandrock K, Schubart C,<br />
Schäfer S, Busse A, Wuillemin WA. A large Swiss family with Bernard-<br />
Soulier syndrome – Correlation phenotype and genotype. Hämostaseologie<br />
<strong>2009</strong>; 29: 161–7<br />
Schmid P, Brodmann D, Odermatt Y, Fischer AG, Wuillemin WA. Study<br />
of bioaccumulation of dalteparin at a therapeutic dose in patients<br />
with renal insufficiency. J Thromb Haemost <strong>2009</strong>; 7: 1629–32<br />
Merlo CM, Wuillemin WA. Diagnostik und Therapie der Anämie in<br />
der Praxis. Schweizerische Rundschau für Medizin, PRAXIS <strong>2009</strong>; 98:<br />
191–199<br />
Schmid P, Fischer A, Wuillemin WA. Low-molecular weight heparin in<br />
patients with renal insufficiency. SMW <strong>2009</strong>; 139: 438–452<br />
Bounameaux H, Wuillemin WA, Lüscher TF. Die neuen Empfehlungen<br />
des American College of Chest Physicians (ACCP) über antithrombotische<br />
Behandlung. (dt und fr) SMF <strong>2009</strong>; 9: 429–430<br />
Wuillemin WA, de Moerloose P, Jäger K. 8. ACCP Guidelines on<br />
antithrombotic Therapy. Prävention der venösen Thromboembolie<br />
in der Chirurgie und Medizin. Antithrombotische prophylaxe und<br />
Therapie in der Schwangerschaft. (dt und fr) SMF <strong>2009</strong>; 9: 436–437<br />
Wuillemin WA, Schorno HX. Niedrig dosierte Vitamin-K-Tropfen bei<br />
oraler Antikoagulation. Leserbrief. SMF <strong>2009</strong>; 9: 599<br />
Levi M, Hobbs FDR, Jacobson AK, Pisters R, Prisco D, Bernardo A,<br />
Haas M, Heidrich J, Rosenberg M, Nielsen JD, Wuillemin WA. Improving<br />
antithrombotic management in patients with atrial fibrillation:<br />
current status and perspectives. Semin Thromb Haemost <strong>2009</strong>; 35:<br />
527–542<br />
Institut für Radio-Onkologie<br />
Publikationen<br />
Greiner R. Radiotherapie beim Mammakarzinom: Editorial: Strahlentherapie<br />
beim Mammakarzinom: Evidenz im Wandel. Schweizer Zeitschrift<br />
für Onkologie 5/<strong>2009</strong>, 1<br />
Thum P, Di Lenardo F, Greiner R. Radiotherapien beim Mammakarzinom:<br />
Die Strahlentherapie beim primären Brustkrebs. Indikation und<br />
Durchführung. Schweizer Zeitschrift für Onkologie 5/<strong>2009</strong>, 6–11<br />
Nitsche M, Collen T, Gruber G. Radiotherapien beim Mammakarzinom:<br />
Akzelerierte, partielle Radiotherapie der Mamma (APBI): Rationale,<br />
Technik und Perspektiven. Schweizer Zeitschrift für Onkologie<br />
5/<strong>2009</strong>, 12–15<br />
121
122<br />
Publikationen<br />
Departemente<br />
Wolhusen<br />
Publikationen<br />
Brunner A, Horisberger M, Herzog R. Evaluation of a computed tomography-based<br />
navigation system prototype for hip arthroscopy in the<br />
treatment of femoroacetabular cam-impingement. Arthroscopy<br />
<strong>2009</strong>; 25(4): 382–391<br />
Brunner A, Horisberger M, Herzog R. Sports and recreation activity<br />
of patients with femoroacetabular impingement before and after<br />
arthroscopic osteoplasty. Am J Sports Med <strong>2009</strong>; 37: 917–922<br />
Stijak L, Radonjic V, Nikolic V, Blagojevic Z, Herzog R. The position<br />
of the anterior cruciate ligament in frontal and sagital plane and its<br />
relation to the inner side of the lateral femoral condyle. Knee Surg<br />
Sports Traumatol Arthrosc <strong>2009</strong>, 17(8): 887–894<br />
Schai P, Herzog R. Die Oberflächenersatz-Arthroplastik des Hüftgelenkes<br />
– die moderne Version des künstlichen Hüftgelenkersatzes.<br />
Der <strong>Luzerner</strong> Arzt <strong>2009</strong>/4; 11/79: 52–55<br />
Ott K., Diener U. Einsatz von Hyaluronan in der V.A.C.Therapie bei<br />
tiefen Wundhöhlen unter dem besonderen Aspekt der Lymphozele,<br />
ZfW <strong>2009</strong>, No A104–7<br />
H.P. Brunner-La Rocca, M. Maeder, S. Muzzarelli, P. Rickenbacher, M.<br />
Gutmann, U. Jeker, B. Julius, M. Peter, R. Schindler, M. Pfisterer for the<br />
TIME-CHF investigators. Does Response to Therapy Differ Between<br />
Preserved and Reduced LV Systolic Function in Heart Failure? Results<br />
from TIME-CHF. Abstract American College of Cardiology (ACC)<br />
<strong>2009</strong>
Spitalstrasse<br />
6000 Luzern 16<br />
Telefon 041 205 11 11<br />
info@ksl.ch<br />
www.ksl.ch 950007