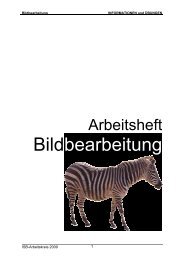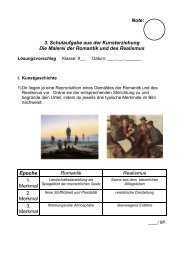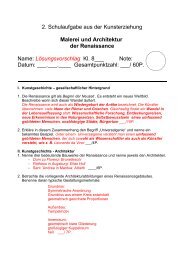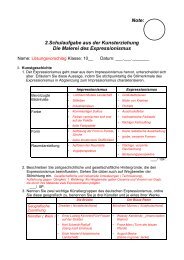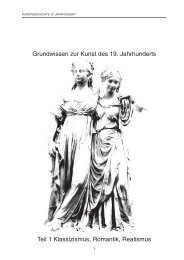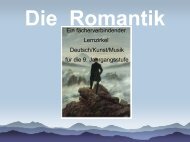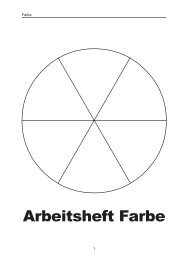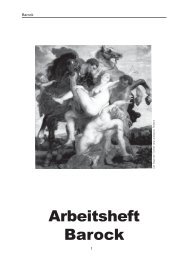Kunst des 20. Jahrhunderts - Expressionismus - kunst-rs-bayern.de
Kunst des 20. Jahrhunderts - Expressionismus - kunst-rs-bayern.de
Kunst des 20. Jahrhunderts - Expressionismus - kunst-rs-bayern.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Stilepochen <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>20.</strong> <strong>Jahrhun<strong>de</strong>rts</strong>: Die Klassische Mo<strong>de</strong>rne<br />
<strong>Expressionismus</strong><br />
Erarbeitet vom Arbeitskreis <strong>Kunst</strong>erziehung 2010<br />
Leitung <strong><strong>de</strong>s</strong> Arbeitskreises<br />
Elisabeth Mehrl, ISB<br />
Mitglie<strong>de</strong>r <strong><strong>de</strong>s</strong> Arbeitskreises:<br />
Jens Knaudt, Renate Stieber, Otmar Wagner<br />
verantwortlich für <strong>de</strong>n Inhalt: Renate Stieber
Zeitgeschichtlicher<br />
Hintergrund<br />
Eine neue Einstellung<br />
über <strong>Kunst</strong><br />
und Gesellschaft<br />
entsteht.<br />
2<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Der <strong>Expressionismus</strong> entsteht in Deutschland in einer schwierigen Umbruchphase.<br />
Die Jahrtausendwen<strong>de</strong> war von enormen Fortschritten in Technik, Wissenschaft und<br />
Wirtschaft geprägt. Das Kaiserreich war auch durch weitreichen<strong>de</strong> und ergiebige<br />
Kolonien eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Wirtschaftsmacht und Zentrum <strong>de</strong>r Wissenschaften. Nach<br />
<strong>de</strong>m gewonnenen Krieg 1870/71 war Deutschland auch politisch selbstbewusst,<br />
national und militaristisch eingestellt. Die Situation ve<strong>rs</strong>chlechterte sich, viele sahen<br />
in einem Krieg die einzige Lösung. Die bedrücken<strong>de</strong> Lage vor, während und nach<br />
<strong>de</strong>m E<strong>rs</strong>ten Weltkrieg löste bei vielen Menschen in Deutschland eine innere Krise<br />
aus. Die Begeisterung am technischen Fortschritt verflog. Statt<strong><strong>de</strong>s</strong>sen litten viele an<br />
<strong>de</strong>r Verlogenheit, <strong>de</strong>m Chaos und <strong>de</strong>r Sinnlosigkeit <strong><strong>de</strong>s</strong> mo<strong>de</strong>rnen Lebens. Maler wie<br />
Schriftsteller hatten zunächst noch <strong>de</strong>n E<strong>rs</strong>ten Weltkrieg als eine erneuern<strong>de</strong> Kraft<br />
herbeigesehnt, welche die überkommene bürgerliche Gesellschaft hinwegfegen<br />
könnte. Dieses Bild vom Krieg än<strong>de</strong>rte sich bald durch die Schreckenseindrücke<br />
vieler Künstler, die selbst das Ausmaß <strong>de</strong>r Vernichtung und <strong><strong>de</strong>s</strong> Elends als Soldaten<br />
an <strong>de</strong>r Front erleben. Bei <strong>de</strong>r Rückkehr wur<strong>de</strong>n die zahlreichen ve<strong>rs</strong>törten und oft<br />
verwun<strong>de</strong>ten Kriegsheimkehrer zu Außenseitern in <strong>de</strong>r Gesellschaft, während die<br />
neuen Reichen, die am Krieg gut verdient haben, aufstiegen.<br />
Die „Gol<strong>de</strong>nen Zwanziger“ brachen an und vertieften die Kluft innerhalb <strong>de</strong>r Gesellschaft.<br />
Eine traditionell und national eingestimmte bürgerliche Schicht beher<strong>rs</strong>chte<br />
jedoch weiterhin mit alten Wertvo<strong>rs</strong>tellungen die Politik im <strong>de</strong>utschen Kaiserreich.<br />
Das Programm <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong> ist eigentlich vor allem negativ <strong>de</strong>finiert: nicht<br />
bürgerlich, nicht konventionell, nicht an <strong>de</strong>n alten Werten orientiert. Einer<br />
bürgerlichen Ästhetik - die naturalistisch, dabei von <strong>de</strong>n traditionellen<br />
Schönheitsi<strong>de</strong>alen bestimmt ist und „zum Schönen, Wahren, Guten erziehen“ will -<br />
wird vor allem durch die nord<strong>de</strong>utsche expressionistische <strong>Kunst</strong> und die Literatur<br />
eine „Ästhetik <strong><strong>de</strong>s</strong> Hässlichen“ entgegengesetzt. Das Hässliche, Kranke und<br />
Wahnsinnige wird zum Gegenstand ihrer Da<strong>rs</strong>tellungen.<br />
Der <strong>Expressionismus</strong> befasst sich in <strong>de</strong>r Bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n <strong>Kunst</strong> wie in <strong>de</strong>r Literatur jetzt<br />
sehr stark mit <strong>de</strong>n negativ besetzten Themen Krieg, Angst und Weltuntergang<br />
(Apokalypse). Die Großstadt mit ihren vielen interessanten Figuren wird zum<br />
Bildmotiv, dabei sind es bei <strong>de</strong>n Künstlern <strong>de</strong>r Brücke vor allem die Außenseiter <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft, die in <strong>de</strong>n Werken dargestellt wer<strong>de</strong>n. Die Maler <strong><strong>de</strong>s</strong> Blauen Reiter<br />
fin<strong>de</strong>n ihre Bildmotive dagegen vor allem in <strong>de</strong>r - vom Menschen unberührten - Natur.<br />
Von allen Künstlern wird diese Natürlichkeit, Unschuld und Unverfälschtheit als<br />
neues I<strong>de</strong>al empfun<strong>de</strong>n: die <strong>Kunst</strong> <strong>de</strong>r Urvölker wird zum Vorbild und löst darin die<br />
<strong>Kunst</strong> <strong>de</strong>r Antike ab.<br />
Einige Künstler greifen nach <strong>de</strong>m 1. Weltkrieg ihre Kriegserlebnisse in ihren Bil<strong>de</strong>rn<br />
auf. Nach<strong>de</strong>m mit <strong>de</strong>m Krieg eigentlich die Erwartung auf einen revolutionören<br />
Neubeginn verknüpft war, führte die Enttäuschung über gleichbleiben<strong>de</strong> Her<strong>rs</strong>chaftsverhältnisse<br />
und soziale Ungerechtigkeit nach Kriegsen<strong>de</strong> und die Grausamkeit <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Kriegsgeschehens selbst zu äuße<strong>rs</strong>t gesellschaftskritischen Da<strong>rs</strong>tellung. Wegen<br />
dieser Einstellung, aber auch wegen <strong>de</strong>r zunehmen<strong>de</strong>n Verfremdung und Abstraktion<br />
wer<strong>de</strong>n die expressionistischen Maler mit Beginn <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Her<strong>rs</strong>chaft<br />
als „entartet“ abgelehnt.<br />
Die neuen Strömungen wer<strong>de</strong>n aber bis zur Machtergreifung <strong>de</strong>r Nationalsozialisten<br />
von Teilen <strong>de</strong>r Gesellschaft durchaus auch wertgeschätzt. Dies zeigt sich u. a. in<br />
<strong>de</strong>r Gründung <strong><strong>de</strong>s</strong> Bauhauses in Dessau und in <strong>de</strong>r Berufung von „mo<strong>de</strong>rnen“<br />
Künstlern als Professoren - wie Max Beckmann in Frankfurt o<strong>de</strong>r Wassily<br />
Kandinsky am Bauhaus in Dessau. In Deutschland entwickeln sich u. a. in Berlin<br />
und München Zentren <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne. Dies en<strong>de</strong>t jedoch durch die rigi<strong>de</strong> <strong>Kunst</strong>politik<br />
<strong>de</strong>r Nationalsozialisten. Viele Künstler gehen ins Exil, v. a. nach Amerika, so dass<br />
nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg alle mo<strong>de</strong>rnen Strömungen von dort her kommen.<br />
Aufgabe:<br />
Informiere dich über die gesellschaftliche Situation <strong>de</strong>r Zeit von 1905 bis<br />
1920 und e<strong>rs</strong>telle eine Übe<strong>rs</strong>icht mit wichtigen Daten und Informationen.
3<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Definition <strong><strong>de</strong>s</strong> Stilbegriffs: expression (lat. expressio = Ausdruck), <strong>Expressionismus</strong> meint eine<br />
Steigerung <strong><strong>de</strong>s</strong> Ausdrucks durch Kontraste, durch Farbe und Form. Die äußere Welt wird nicht so<br />
wie<strong>de</strong>rgegeben, wie sie objektiv zu sehen ist, statt<strong><strong>de</strong>s</strong>sen spielen die subjektive Empfindung <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Künstle<strong>rs</strong> und <strong>de</strong>r gewollte Ausdruck dieser Empfindung eine wichtige Rolle.<br />
Karl Schmidt-Rottluff,<br />
Pomme<strong>rs</strong>che Moorlandschaft, 1938<br />
Grundgedanken<br />
Vorbil<strong>de</strong>r<br />
Max Pechstein,<br />
Palau-Triptychon, 1917<br />
Franz Marc,<br />
Der Tiger, 1912<br />
Expression ist gleichbe<strong>de</strong>utend mit „starkem Ausdruck“, <strong>Expressionismus</strong> kann somit<br />
<strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n als Ausdrucks<strong>kunst</strong> mit <strong>de</strong>m Ziel <strong>de</strong>r Ausdruckssteigerung. Den Begriff<br />
<strong>Expressionismus</strong> gibt es auch in <strong>de</strong>r Literatur, im Theater und in <strong>de</strong>r Musik.<br />
Eine <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen <strong>Expressionismus</strong> entsprechen<strong>de</strong> Bewegung sind die Fauves („Die<br />
Wil<strong>de</strong>n“) in Frankreich.<br />
Die Expressionisten streben nicht nach einer naturgetreuen Wie<strong>de</strong>rgabe <strong>de</strong>r Dinge. Sie<br />
wollen die Welt nicht in ihrer flüchtigen, oberflächlichen E<strong>rs</strong>cheinung einfangen, wie es die<br />
Impressionisten taten. Der <strong>Expressionismus</strong> wird <strong><strong>de</strong>s</strong>halb auch als Gegenbewegung<br />
zum Impressionismus ve<strong>rs</strong>tan<strong>de</strong>n. Statt<strong><strong>de</strong>s</strong>sen ve<strong>rs</strong>uchen sie beim Betrachter eine emotionale<br />
Wirkungen hervorzurufen. Es geht <strong>de</strong>n Künstlern darum, das innere Wesen <strong>de</strong>r<br />
Dinge und Figuren sowie ihr eigenes seelisches Erleben zum Ausdruck zu bringen.<br />
Die Wurzeln <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong> liegen im späten 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt, bei Malern wie<br />
Vincent van Gogh und Paul Gauguin, die in <strong>de</strong>r Malerei bereits nach einer Ausdruckssteigerung<br />
von Form und Farbe gesucht hatten. In <strong>de</strong>r Weiterentwicklung <strong>de</strong>r impressionistischen<br />
Malerei fan<strong>de</strong>n sie zu intensiven, kontrastreichen Farbtönen und geschlossener<br />
Form. Dabei wur<strong>de</strong> die realistische Da<strong>rs</strong>tellung zunehmend aufgegeben zugunsten<br />
einer auf das Wesentliche reduzierten Form.<br />
Ein weiteres Vorbild bil<strong>de</strong>te die <strong>Kunst</strong> <strong>de</strong>r Naturvölker, <strong>de</strong>ren Werke zu Beginn <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
<strong>20.</strong> Jh. durch <strong>de</strong>n wachsen<strong>de</strong>n Kolonialhan<strong>de</strong>l in großer Zahl nach Europa gelangen.<br />
Die Expressionisten erkannten in <strong>de</strong>ren <strong>Kunst</strong>werken - zum Beispiel in <strong>de</strong>n Masken<br />
und Skulpturen Afrikas und Ozeaniens -, dass nicht die Wie<strong>de</strong>rgabe <strong>de</strong>r Wirklichkeit<br />
wichtig ist, son<strong>de</strong>rn die freie und unverfälschte Ausdrucksfähigkeit.<br />
Auch die mittelalterliche <strong>Kunst</strong> sah man als unabhängig von <strong>de</strong>r Vorgabe durch die<br />
sichtbare Welt, v. a. in <strong>de</strong>n plastischen wie malerischen Da<strong>rs</strong>tellungen von Dämonen,<br />
von Figuren und Tieren. Das Vorbild <strong>de</strong>r ausdrucksstarken Altarbil<strong>de</strong>r von Grünewald<br />
(Isenheimer Altar) o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Kathedralplastik lässt sich in expressionistischen Werken<br />
wie<strong>de</strong>rfin<strong>de</strong>n.<br />
Schließlich wur<strong>de</strong>n die Bil<strong>de</strong>r von Kin<strong>de</strong>rn zum Vorbild, da diese ihre Gefühle spontan<br />
zum Ausdruck bringen.
Die typischen Gestaltungsmittel<br />
Form<br />
Malweise<br />
Farbe<br />
Komposition<br />
Raum<br />
Franz Marc,<br />
Blaues Pferd,<br />
1911<br />
4<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Die Steigerung <strong><strong>de</strong>s</strong> Ausdrucks wird durch die Reduzierung <strong>de</strong>r Linien und Flächen auf<br />
das Wesentliche erreicht. Die Formen e<strong>rs</strong>cheinen teilweise grob und verzerrt, zum Teil<br />
vereinfacht - je nach beabsichtigtem Ausdruck.<br />
Eine realistische Wie<strong>de</strong>rgabe von Oberfläche bzw. Stofflichkeit, Proportionen und Details<br />
steht nicht im Vor<strong>de</strong>rgrund und wird aufgegeben zu Gunsten <strong><strong>de</strong>s</strong> Ausdrucks.<br />
Die in <strong>de</strong>r Regel spontane, ungestüme Malweise lässt keine Details zu. Eine plastische<br />
Wirkung <strong>de</strong>r Gegenstän<strong>de</strong> fehlt, wenn die Farben ohne Mo<strong>de</strong>llierung aufgetragen wer<strong>de</strong>n.<br />
An<strong>de</strong>re Künstler betonen in vereinfachten Formen gera<strong>de</strong> die Plastizität unter Verzicht<br />
auf Details. Eine stoffliche Wie<strong>de</strong>rgabe wird dagegen in <strong>de</strong>r Regel aufgegeben, dagegen<br />
ist <strong>de</strong>r Pinselduktus sichtbar und unte<strong>rs</strong>treicht die Form bzw. <strong>de</strong>n Ausdruck.<br />
Die Farbe ist das wichtigste Ausdrucksmittel <strong>de</strong>r Expressionisten. Farben wer<strong>de</strong>n oft großflächig<br />
in ungebrochenen Farbtönen aufgetragen. Dabei wird auf die Lokal- o<strong>de</strong>r E<strong>rs</strong>cheinungsfarbe<br />
fast vollständig verzichtet, im Mittelpunkt steht die Ausdrucksfarbe, wobei auch die<br />
Farbsymbolik eine Rolle spielen kann bzw. eine eigene Symbolsprache entwickelt wird<br />
(s. Franz Marc). Die Intensität <strong>de</strong>r Farben wird durch starke Kontraste (Hell-Dunkel,<br />
Komplementärkontrast, Warm-Kalt, Leuchtend-Matt) gesteigert.<br />
Die Künstler verwen<strong>de</strong>n die traditionellen Mittel zum Ausdruck von Ruhe und Dynamik.<br />
Pe<strong>rs</strong>pektivische Mittel wer<strong>de</strong>n zum Beispiel genutzt, um beson<strong>de</strong><strong>rs</strong> enge, ineinan<strong>de</strong>rgeschobene<br />
Räume mit entsprechend beengter Wirkung darzustellen. Zum großen Teil<br />
wird auf eine wirklichkeitsgetreue Raumda<strong>rs</strong>tellung völlig verzichtet.<br />
Aufgabe:<br />
Das vorliegend<strong>de</strong> Bildbeispiel zeigt „Das blaue Pferd“ von Franz Marc.<br />
Wen<strong>de</strong> die allgemeinen Gestaltungsmerkmale auf dieses Gemäl<strong>de</strong> an.
Die <strong>de</strong>utsche Künstlervereinigung „Die Brücke“<br />
1905 grün<strong>de</strong>n in Dres<strong>de</strong>n einige junge Architektu<strong>rs</strong>tu<strong>de</strong>nten<br />
- Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-<br />
Rottluff, Erich Heckel und Fritz Bleyl - die Künstlervereinigung<br />
„Die Brücke“. Später schließt sich Otto<br />
Pechstein an, für kurze Zeit gehört auch Emil Nol<strong>de</strong><br />
zur Gruppe. Die Künstler arbeiten zunächst eng<br />
zusammen und entwickeln einen unverwechselbaren<br />
„Brücke“-Stil; sie diskutieren ausführlich ihre Grundgedanken<br />
und Ziele, teilen sich Atelier und Mo<strong>de</strong>lle. Als<br />
Finanzierung ihrer Arbeit grün<strong>de</strong>n sie eine För<strong>de</strong>rgruppe<br />
von passiven Mitglie<strong>de</strong>rn, die als Jahresgabe<br />
eine Mappe mit Grafiken <strong>de</strong>r Brücke-Künstler erhielten.<br />
1911 sie<strong>de</strong>lt die Gruppe nach Berlin um, löst sich<br />
dort jedoch schon 1913 auf. Die einzelnen Künstler<br />
entwickeln sich sehr unte<strong>rs</strong>chiedlich weiter.<br />
Als Grundgedanken ihrer <strong>Kunst</strong> formulieren sie es,<br />
alte Traditionen zu überwin<strong>de</strong>n, überkommene<br />
Normen abzulegen und eine Gesellschaft bzw. eine<br />
<strong>Kunst</strong> zu schaffen, die die Jugend und die „schaffen<strong>de</strong><br />
Generation“ vertritt. In ihren Schriften beschreiben sie<br />
als Ziel, „unverfälscht und unmittelbar das<br />
wie<strong>de</strong>rzugeben, was einen zum Schaffen drängt“. „Im<br />
Glauben an eine gemeinsame Zukunft“ wollen sie mit<br />
diesen Gedanken und mit <strong>de</strong>r neuen <strong>Kunst</strong> „die<br />
Jugend <strong>de</strong>r Welt“ ansprechen.<br />
Themen und<br />
Techniken<br />
Gestaltungsmittel<br />
Künstler und Werke<br />
5<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Ein großes Thema ist die Großstadt in ihren ve<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong>nen, meist negativen Facetten:<br />
ihre Anonymität, die Falschheit <strong>de</strong>r Gesellschaft, ihre Außenseiter, die Einsamkeit,<br />
die Gewalt. Hässliches wird in Form von verzerrten Grimassen, in Bil<strong>de</strong>rn von<br />
Sucht, Krankheit o<strong>de</strong>r Tod schonungslos zur Schau gestellt. Im Gegensatz dazu<br />
wer<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Vorbild <strong>de</strong>r „primitiven“ <strong>Kunst</strong> die Menschen als Aktda<strong>rs</strong>tellung in<br />
freier Natur gemalt.<br />
Die Brücke-Künstler ent<strong>de</strong>cken für sich <strong>de</strong>n Holzschnitt wie<strong>de</strong>r, eine druckgrafische<br />
Technik, die flächige und ausdrucksstarke Wirkungen ermöglicht.<br />
Die Farben wer<strong>de</strong>n kontrastierend und z. T. disharmonisch verwen<strong>de</strong>t, häufig wirken<br />
sie grell; sie sollen in <strong>de</strong>r Regel einen bestimmten Stimmungs- und Gefühlswert<br />
vermitteln.<br />
Die Formen sind scharf und kantig, sie wer<strong>de</strong>n oft mit schwarzen Konturen betont.<br />
Die Wirklichkeit wird vereinfacht o<strong>de</strong>r auch verzerrt wie<strong>de</strong>rgegeben. Die Dinge sind<br />
zwar erkennbar, die Gesichter wirken jedoch oft maskenhaft, die Figuren wer<strong>de</strong>n<br />
typisiert.<br />
Die Pe<strong>rs</strong>pektive wird zum Teil mit traditionellen Mitteln im Bild wie<strong>de</strong>rgegeben, meist<br />
jedoch ebenfalls verzerrt und ve<strong>rs</strong>choben. Innenräume wirken wie enge Guckkästen.<br />
Zum großen Teil verzichten die Künstler auch auf eine naturgetreue pe<strong>rs</strong>pektivische<br />
Wirkung, die Bil<strong>de</strong>r wirken dann flächig.<br />
Ernst Ludwig Kirchner Potsdamer Platz<br />
Erich Heckel Der Dorfteich<br />
Karl Schmitt-Rottluff Selbstbildnis<br />
Ernst Ludwig Kirchner,<br />
Eine Künstlergemeinschaft, 1925<br />
AUFGABE:<br />
Gestalte eine informative Übe<strong>rs</strong>icht mit Abbildungen von Werken <strong>de</strong>r hier genannten<br />
Künstler.
Der Blaue Reiter<br />
Themen<br />
Gestaltungsmittel<br />
Künstler und Werke<br />
6<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Diese Künstlergruppe entsteht 1911 in München. Auf <strong>de</strong>r Grundlage von Gesprächen<br />
und gemeinsamer Arbeit entwickeln die einzelnen Künstler einen neuen Stil. Dabei<br />
wahrt - im Gegensatz zur „Brücke“ von Anfang an je<strong>de</strong>r Künstler seine individuelle<br />
Eigenart. Gemeinsam ist ihnen allen <strong>de</strong>r Hang zur Philosophie, v. a. <strong>de</strong>r Ve<strong>rs</strong>uch,<br />
Mensch und Natur als Einheit zu sehen und sich in die Natur hineinzuve<strong>rs</strong>etzen. Der<br />
Mensch soll sich als Teil <strong>de</strong>r Schöpfung ve<strong>rs</strong>tehen und sich mit <strong>de</strong>r Natur verbun<strong>de</strong>n<br />
fühlen. Der <strong>Kunst</strong> wird eine fast religiöse Aufgabe zugedacht, weil sie zum inneren<br />
Wesen <strong>de</strong>r Dinge vordringt.<br />
Der Name „Blauer Reiter“ wird von Kandinsky und Marc (Marc liebt Pfer<strong>de</strong>,<br />
Kandinsky malte Reiter...., so heißt es in <strong>de</strong>n Schriften über <strong>de</strong>n U<strong>rs</strong>prung <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Namens) entwickelt und ist zunächst für eine <strong>Kunst</strong>zeitschrift gedacht, die Beiträge<br />
über die Mo<strong>de</strong>rne enthalten soll. Die e<strong>rs</strong>te Ausstellung <strong>de</strong>r Gruppe fin<strong>de</strong>t 1911 statt.<br />
Schon 1913, löst sich die Künstlergruppe jedoch auf. Kandinsky emigriert nach<br />
Russland, Marc und Macke fallen bald danach im Krieg, in <strong>de</strong>n sie sich freiwillig<br />
gemel<strong>de</strong>t haben.<br />
Häufig wer<strong>de</strong>n Landschaften, in Einklang mit <strong>de</strong>r Natur leben<strong>de</strong> Menschen und Tiere,<br />
Stillleben und Porträts gemalt.<br />
Typisch für die Malerei dieser Künstler sind die vereinfachte, später zunehmend<br />
abstrahierte Formgebung sowie starke, leuchten<strong>de</strong>, kontrastreiche, dabei aber<br />
harmonische Farben. Die realistische Wie<strong>de</strong>rgabe <strong><strong>de</strong>s</strong> Raums wird aufgegeben.<br />
Franz Marc Zwei Katzen<br />
Wassily Kandinsky Improvisation/Klamm<br />
Gabriele Münter Winterlandschaft bei Murnach<br />
Paul Klee Villa R<br />
August Macke Vor <strong>de</strong>m Hutla<strong>de</strong>n<br />
Wassily Kandinsky malt zunächst jugendstilhafte Motive (Märchen, Feste) und<br />
wen<strong>de</strong>t sich dann einer freieren Da<strong>rs</strong>tellungsweise zu mit stark vereinfachten Formen,<br />
schwungvoller Pinselführung und starker Farbigkeit mit großer Leuchtkraft. Er betont,<br />
dass die Farben - wie Musik - einen bestimmten Klang hätten (Farbklang - Klangfarbe)<br />
und Bil<strong>de</strong>r wie Musik erlebbar wären (= Synästhesie). Nach<strong>de</strong>m er seine Bil<strong>de</strong>r<br />
zunächst „Impression“ nennt (Eindrücke <strong>de</strong>r äußeren Wirklichkeit), bezeichnet er sie<br />
später als „Improvisationen“, d. h. er spielt mit <strong>de</strong>n gesammelten Eindrücken und<br />
schafft freie Zusammenhänge. Schließlich entwickelt er eine völlig gegenstandslose<br />
<strong>Kunst</strong>, diese Bil<strong>de</strong>r heißen nun - wie in <strong>de</strong>r Musik - „Kompositionen“. Er wird damit<br />
zum Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r abstrakten Malerei.<br />
Bei Franz Marc steht das Tier in <strong>de</strong>r freien Natur im Vor<strong>de</strong>rgrund. Im Tier sieht er die<br />
Unschuld und Reinheit <strong>de</strong>r Natur verkörpert. In <strong>de</strong>n frühen Bil<strong>de</strong>rn vereinfacht und<br />
harmonisiert er die Natureindrücke: Starkfarbige plastische Tierkörper sind typisch<br />
dafür. Auch dieser Künstler löst sich jedoch immer mehr von <strong>de</strong>r gegenständlichen<br />
Da<strong>rs</strong>tellung. Er bezieht die Umgebung und das Licht als Strahl in die Da<strong>rs</strong>tellung ein,<br />
die Formen durchdringen und übe<strong>rs</strong>chnei<strong>de</strong>n sich.<br />
Alexej Jawlensky nimmt vor allem die Menschen zum Thema seiner Bil<strong>de</strong>r. In seiner<br />
Spätphase beschränkt er sich ganz auf die Da<strong>rs</strong>tellung <strong><strong>de</strong>s</strong> menschlichen Gesichts<br />
und vereinfacht die Abbildung immer mehr zum Sinnbild, zum Meditationsbild.<br />
August Macke betont in seiner <strong>Kunst</strong> die Farbigkeit und Fröhlichkeit <strong>de</strong>r Welt, seine<br />
lebensfrohen Bi<strong>de</strong>r nehmen Menschen in <strong>de</strong>r Stadt und in <strong>de</strong>r Natur zum Thema. Eine<br />
Reihe von Aquarellen entsteht auf einer Reise nach Tunis, die er zusammen mit <strong>de</strong>m<br />
Maler Paul Klee unternimmt. Sie fallen durch die einfachen Farbflächen und die<br />
kräftigen Farben auf - ein Einfluss <strong>de</strong>r nordafrikanischen Kultur und Landschaft.<br />
AUFGABE:<br />
Gestalte eine informative Übe<strong>rs</strong>icht mit Abbildungen von Werken <strong>de</strong>r hier genannten<br />
Künstler <strong><strong>de</strong>s</strong> Blauen Reiter.
Gedanken<br />
Themen<br />
Gestaltungsmittel<br />
7<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
AUFGABE:<br />
Stelle Grundgedanken, Bildthemen sowie Gestaltungsmittel <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen<br />
Künstlergruppen <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong> einan<strong>de</strong>r gegenüber in <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Tabelle.<br />
Die Brücke Der Blaue Reiter
Lebensdaten<br />
Zitat<br />
Wichtige Stationen<br />
seines Lebens<br />
Kurzcharakteristik<br />
Hauptwerke<br />
geboren 1880 in München, gefallen 1916 bei Verdun, Frankreich<br />
8<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Franz Marc<br />
„Ich suche mich einzufühlen in das Zittern und Rinnen <strong><strong>de</strong>s</strong> Blutes <strong>de</strong>r Natur, in <strong>de</strong>n Bäumen,<br />
in <strong>de</strong>n Tieren, in <strong>de</strong>r Luft (...). Wie sieht ein Pferd die Welt o<strong>de</strong>r ein Adler, ein Reh<br />
o<strong>de</strong>r ein Hund? Wie armselig, seelenlos ist unsere Konvention, Tiere in eine Landschaft zu<br />
ve<strong>rs</strong>etzen, die unseren Augen zugehört, statt uns in die Seele <strong><strong>de</strong>s</strong> Tieres zu ve<strong>rs</strong>enken, um<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong>sen Bil<strong>de</strong>rkreis zu erraten? ... Wir wer<strong>de</strong>n nicht mehr <strong>de</strong>n Wald o<strong>de</strong>r das Pferd malen,<br />
wie sie uns gefallen o<strong>de</strong>r scheinen, son<strong>de</strong>rn wie sie wirklich sind, wie sich <strong>de</strong>r Wald o<strong>de</strong>r<br />
das Pferd selbst fühlen, ihr absolutes Wesen, das hinter <strong>de</strong>m Schein lebt, <strong>de</strong>n wir nur<br />
sehen. ... Wir müssen von nun an lernen, die Tiere und Pflanzen auf uns zu beziehen und<br />
unsere Beziehung zu ihnen in <strong>de</strong>r <strong>Kunst</strong> da<strong>rs</strong>tellen.“<br />
Nach <strong>de</strong>m Studium eröffnet er in München sein e<strong>rs</strong>tes Atelier und lernt auf Reisen nach<br />
Paris die Werke <strong>de</strong>r Impressionisten und van Goghs kennen. Die Ablehnung seiner<br />
Arbeiten in <strong>de</strong>n offiziellen <strong>Kunst</strong>ausstellungen führt 1911 zur Gründung <strong><strong>de</strong>s</strong> Blauen Reiter<br />
(gemeinsam mit Wassiliy Kandinsky). 1912 macht er die Bekanntschaft <strong><strong>de</strong>s</strong> französischen<br />
Male<strong>rs</strong> Robert Delaunay, <strong><strong>de</strong>s</strong>sen kubistische und vorwiegend gegenstandslosen Arbeiten<br />
ihn stark beeinflussen. 1914 zieht er in ein Haus in Kochel, wo bereits Kandinsky und<br />
Gabriele Münter leben. Im E<strong>rs</strong>ten Weltkrieg wird er eingezogen, er fällt 1916. Die Nationalsozialisten<br />
diffamieren seine Arbeit als entartete <strong>Kunst</strong>. Zahlreiche Werke wer<strong>de</strong>n beschlagnahmt<br />
und aus <strong>de</strong>n Musseen verbannt, zum Teil ins Ausland verkauft o<strong>de</strong>r vernichtet.<br />
Franz Marc gehört zu <strong>de</strong>n bekanntesten <strong>de</strong>utschen Maleren. Er ist ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r<br />
Vertreter <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong> und <strong>de</strong>r Künstlervereinigung „Blauer Reiter“. Seine Arbeiten<br />
zwischen 1911 und 1914 sind wegbereitend für die <strong>Kunst</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>20.</strong> <strong>Jahrhun<strong>de</strong>rts</strong>.<br />
Wesentlich für seine Malerei ist die Farbgebung, hier entwickelt er eine eigene Symbolik:<br />
Gelb steht für das Weibliche, Blau ist die Farbe <strong><strong>de</strong>s</strong> Männlichen und <strong><strong>de</strong>s</strong> Geistes, Rot die<br />
Farbe <strong>de</strong>r Lebenskraft. In <strong>de</strong>r Verbindung von Weiblichem und Männlichem entsteht Grün,<br />
die Farbe <strong>de</strong>r Natur. Die Mischung von Blau = Geist und Rot = Lebenskraft ergibt das<br />
Violett, die Farbe <strong>de</strong>r Mystik, Symbol <strong><strong>de</strong>s</strong> Durchdringens <strong>de</strong>r Geheimnisse <strong><strong>de</strong>s</strong> Lebens.<br />
Orange schließlich ist die warme Farbe von Er<strong>de</strong> und Leben, gemischt aus <strong>de</strong>m weiblichen<br />
Gelb und <strong>de</strong>r Lebenskraft Rot.<br />
Berühmt gewor<strong>de</strong>n ist Franz Marc durch seine Tierda<strong>rs</strong>tellungen von Füchsen, Katzen,<br />
Kühen, Pfer<strong>de</strong>n, Rehen o<strong>de</strong>r Tigern, z. B.:<br />
Die kleinen blauen Pfer<strong>de</strong>, 1911<br />
Gelber Tiger, 1912<br />
Kämpfen<strong>de</strong> Formen, 1914
Lebensdaten<br />
Zitat<br />
Wichtige Stationen<br />
seines Lebens<br />
Kurzcharakteristik<br />
Hauptwerke<br />
geboren 1866 in Moskau, gestorben 1944 in Paris<br />
9<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
„Diese Pole (1. die große Abstraktion, 2. die große Realistik) eröffnen zwei Wege, die<br />
schließlich zu einem Ziel führen. Zwischen diesen zwei Polen liegen viele<br />
Kombinationen <strong>de</strong>r ve<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong>nen Zusammenklänge <strong><strong>de</strong>s</strong> Abstrakten mit <strong>de</strong>m Realen.<br />
Diese bei<strong>de</strong>n Elemente waren in <strong>de</strong>r <strong>Kunst</strong> immer vorhan<strong>de</strong>n.“<br />
Der Rechtswissenschaftler zieht 1896 nach München, um <strong>Kunst</strong> zu studieren. In <strong>de</strong>n<br />
frühen Werken 1901 bis 1906 verbin<strong>de</strong>t Kandinsky Elemente <strong>de</strong>r russischen Volks<strong>kunst</strong><br />
mit <strong>de</strong>korativen, flächenhaften Elementen <strong><strong>de</strong>s</strong> Jugendstils. Daneben experimentiert<br />
er mit <strong>de</strong>r impressionistischen Malerei. Seit 1908 lebt er im süd<strong>de</strong>utschen<br />
Murnau. Zusammen mit Franz Marc grün<strong>de</strong>t Kandinsky 1911 die Künstlergruppe<br />
„Blauer Reiter“. Die <strong>Kunst</strong> Kandinskys entwickelt sich immer mehr zu reinen, vom<br />
Gegenstand losgelösten Farbharmonien. Folgerichtig mün<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Weg in <strong>de</strong>r Abstraktion.<br />
Die Bil<strong>de</strong>r dieser Phase sind vom Gegen- und Miteinan<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Formen, Linien und<br />
Flächen sowie von <strong>de</strong>r Dominanz <strong>de</strong>r Farben über die Formen bestimmt. Unregelmäßige<br />
Farbflächen gehen konturlos und weich ineinan<strong>de</strong>r über. 1911 e<strong>rs</strong>cheint seine<br />
wichtige Schrift „Über das Geistige in <strong>de</strong>r <strong>Kunst</strong>“. Nach einem längeren Aufenthalt in<br />
Russland (als Russe ist er zur Zeit <strong><strong>de</strong>s</strong> 1. Weltkriegs in Deutschland unerwünscht)<br />
wird er 1922 als Lehrer ans Bauhaus nach Weimar berufen, dort wan<strong>de</strong>lt sich <strong>de</strong>r Stil<br />
seiner Kompositionen: Geometrische Formen wie Kreise, Dreiecke und Rechtecke<br />
ordnet er zu präzis konstruierten Gemäl<strong>de</strong>n.1928 wird er <strong>de</strong>utscher Staatsbürger. 1933<br />
wird ihm die Unterrichtserlaubnis entzogen, das Bauhaus geschlossen; seine <strong>Kunst</strong><br />
wird als „entartet“ beurteilt. Kandinsky emigriert nach Frankreich.<br />
Kandinsky zählt zu <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utendsten Malern <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>20.</strong> <strong>Jahrhun<strong>de</strong>rts</strong> und zum Mitbegrün<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r abstrakten Malerei. Er will in seiner Malerei das Geistige mit Farben und<br />
Formen zum Ausdruck bringen und Kompositionen analog zur Musik schaffen. Er war<br />
Synästhet, empfand also Farben nicht nur als optische, son<strong>de</strong>rn z. B. auch als akustische<br />
Reize und ordnete ihnen Klänge, Gerüche, Formen zu. So empfand er Gelb als<br />
eine „spitze“ Farbe, die sich in Verbindung mit <strong>de</strong>r spitzen Form <strong><strong>de</strong>s</strong> Dreieckes steigere.<br />
Daher ve<strong>rs</strong>uchte er Bil<strong>de</strong>r zu malen, wie man Musik komponiert; er verglich die Harmonie<br />
von Farben mit <strong>de</strong>r Harmonie von Klängen und sprach von „Farbklängen“, er betitelt<br />
seine Bil<strong>de</strong>r mit Begriffen aus <strong>de</strong>r Musik (Improvisation, Komposition).<br />
Kirche in Murnau, 1910<br />
Träumerische Improvisation, 1913<br />
Roter Fleck, 1921<br />
Gelb-Rot-Blau, 1925<br />
Der Pfeil, 1943<br />
Wassily Kandinsky<br />
Allerheiligen II, 1910/11
Lebensdaten<br />
Zitat<br />
Wichtige Stationen<br />
seines Lebens<br />
Kurzcharakteristik<br />
Hauptwerke<br />
geboren 1880 in Aschaffenburg,<br />
gestorben (Selbstmord)1938 in Davos, Schweiz<br />
10<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
„Es ist <strong><strong>de</strong>s</strong>halb nicht richtig, meine Bil<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Maßstab <strong>de</strong>r naturgetreuen<br />
Richtigkeit zu beurteilen, <strong>de</strong>nn sie sind keine Abbildungen bestimmter Dinge o<strong>de</strong>r<br />
Wesen, son<strong>de</strong>rn selbstständige Organismen aus Linien, Flächen und Farben, die<br />
Naturformen nur soweit enthalten, als sie als Schlüssel zum Ve<strong>rs</strong>tändnis notwendig<br />
sind. Meine Bil<strong>de</strong>r sind Gleichnisse, nicht Abbildungen. Formen und Farben sind<br />
nicht an sich schön, son<strong>de</strong>rn die, welche durch seelisches Wollen hervorgebracht<br />
sind. Es ist etwas Geheimes, was hinter <strong>de</strong>n Menschen und Dingen und hinter <strong>de</strong>n<br />
Farben und Rahmen liegt, und das verbin<strong>de</strong>t alles wie<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Leben und <strong>de</strong>r<br />
sinnfälligen E<strong>rs</strong>cheinung, das ist das Schöne, das ich suche.“<br />
1905 grün<strong>de</strong>t er zusammen mit Erich Heckel und Karl Schmitt-Rottluff in Dres<strong>de</strong>n die<br />
Künstlervereinigung „Die Brücke“. Beeinflusst von <strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckung <strong>de</strong>r „primitiven“<br />
Malerei ozeanischer Völker und von <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong><strong>rs</strong>etzung mit Van Gogh und<br />
Gauguin sucht die Gruppe neue Ausdrucksformen in <strong>de</strong>r <strong>Kunst</strong>. Kirchner verzichtet<br />
auf räumlichen und plastischen Illusionismus, vereinfacht die Formen zu klaren<br />
Flächen und intensiviert die Farbigkeit, in<strong>de</strong>m er mit starken Farbkontrasten arbeitet.<br />
1911 zieht Kirchner nach Berlin und beginnt seine be<strong>de</strong>utendste Schaffensperio<strong>de</strong>. In<br />
ausdrucksstarken, aggressiven Szenen gestaltet er die ve<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong>nen Facetten <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Großstadtlebens. Die dargestellten Figuren wirken maskenhaft und überlängt, die<br />
Proportionen und <strong>de</strong>r Raum sind verzerrt, die Farbigkeit ist grell. Ab 1920 lebt und<br />
arbeitet Kirchner in <strong>de</strong>r Schweiz. In dieser Phase entwickelt er in seinen Landschaftsbil<strong>de</strong>rn<br />
einen ruhigeren Stil. Der Bildaufbau wird statischer, die Farben wer<strong>de</strong>n gedämpfter.<br />
Mit Ausbruch <strong><strong>de</strong>s</strong> 1. Weltkrieges mel<strong>de</strong>t sich Kirchner an die Front, ist aber<br />
<strong>de</strong>n Belastungen nicht gewachsen und wird entlassen. Auch unter <strong>de</strong>r Diskriminierung<br />
im Dritten Reich lei<strong>de</strong>t Kirchner, seine Werke wer<strong>de</strong>n als entartet gebrandmarkt.<br />
Nach Jahren mehrerer körperlicher und seelischer Krisen begeht er Selbstmord.<br />
Kirchner ist als Maler und Grafiker einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Vertreter <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong>.<br />
Bevorzugte Bildthemen waren Hektik, Einsamkeit und Deka<strong>de</strong>nz <strong><strong>de</strong>s</strong> Großstadtlebens,<br />
Porträts, Akte in freier Natur, Landschaften; vor allem seine Holzschnitte, für<br />
die starre, scharfkantige Formen kennzeichnend sind, waren beispielgebend für die<br />
Druckgrafik <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong>.<br />
Die Ba<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n, 1909<br />
Selbstbildnis mit Mo<strong>de</strong>ll, 1910<br />
Potsdamer Platz, Berlin, 1914<br />
Farbentanz, 1932<br />
Waldinneres, 1938<br />
Ernst Ludwig Kirchner<br />
Davos im Schnee, 1923
Lebensdaten<br />
Zitat<br />
Wichtige Stationen<br />
seines Lebens<br />
Kurzcharakteristik<br />
Hauptwerke<br />
Helles Haus, 1914<br />
geboren 1887 in Mesche<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Ruhr,<br />
gestorben (gefallen) 1914 in Frankreich<br />
11<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
„Er hat von uns allen <strong>de</strong>r Farbe <strong>de</strong>n hellsten und reinsten Klang gegeben, so klar und<br />
hell wie sein ganzes Wesen war.“ (Franz Marc 1914 über seinen Freund August<br />
Macke)<br />
Macke studiert in Düsseldorf und setzt sich - nachlesbar an seinen zahlreichen<br />
Skizzenbüchern - mit klassischen Werken und <strong>de</strong>m in Deutschland damals noch<br />
wenig bekannten Impressionismus auseinan<strong>de</strong>r, vor allem Manet und Cezanne haben<br />
ihn beeindruckt. Bei seinen Reisen lernt er u. a. Matisse kennen, er studiert bei<br />
Corinth. 1910 zieht er an <strong>de</strong>n Tegernsee, 1911 schließt Macke sich dort <strong>de</strong>r Künstlergruppe<br />
„Blauer Reiter“ an.<br />
1914 unternimmt er mit Paul Klee die berühmte Tunisreise, die seine Sensibilität für<br />
Lichteffekte ve<strong>rs</strong>tärkt. Seine dort gemalten Aquarelle weisen eine stark vereinfachte<br />
Gegenständlichkeit und einen flächigen Farbauftrag mit hellen, leuchten<strong>de</strong>n Farben<br />
auf.<br />
Gleich nach Beginn <strong><strong>de</strong>s</strong> 1. Weltkrieges wird Macke eingezogen und fällt an <strong>de</strong>r<br />
Westfront.<br />
In seinem künstlerischen Schaffen wird Macke sowohl von <strong>de</strong>n Impressionisten als<br />
auch von <strong>de</strong>n Kubisten beeinflusst. Er splittet die Bildgegenstän<strong>de</strong> auf und ordnet sie<br />
in einem flächigen, harmonischen Bildaufbau in leuchten<strong>de</strong>n Farben an.<br />
Seine bevorzugten Motive sind <strong>de</strong>r Mensch in <strong>de</strong>r Landschaft o<strong>de</strong>r in eleganter<br />
Großstadtumgebung.<br />
Vor <strong>de</strong>m Hutla<strong>de</strong>n, 1913<br />
Mädchen unter Bäumen, 1914<br />
Tunesische Landschaft, 1914<br />
Serie von Aquarellen <strong>de</strong>r Tunisreise, 1914<br />
August Macke
Selbstbildnis mit rotem Schal, 1917<br />
Max Beckmann, Der Zirkuswagen, 1940<br />
12<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Max Beckmann<br />
Eine wichtige Einzelfigur unter <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen<br />
Expressionisten, <strong>de</strong>r keiner Gruppe angehörte, ist MAX<br />
BECKMANN (1884 - 1950).<br />
In <strong>de</strong>n Zwanziger Jahren genoss er internationale Anerkennung<br />
und erhielt eine Professur an <strong>de</strong>r Frankfurter<br />
Stä<strong>de</strong>l-<strong>Kunst</strong>schule. Doch von <strong>de</strong>n Nationalsozialisten<br />
wird er diffamiert und 1933 entlassen. Er ging nach<br />
Jahren <strong>de</strong>r Ablehnung unter <strong>de</strong>m Eindruck von Hitle<strong>rs</strong><br />
„Kulturre<strong>de</strong>“ gegen die sog. Entartete <strong>Kunst</strong> 1937<br />
zunächst nach Amsterdam, dann nach Amerika, um<br />
ungestört arbeiten zu können. Er kam nie wie<strong>de</strong>r nach<br />
Deutschland zurück.<br />
Seine kompliziert aufgebauten und schwer zu<br />
<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Bil<strong>de</strong>r (häufig nehmen sie ihr Thema aus <strong>de</strong>n<br />
großen Sagen <strong>de</strong>r Mythologie und verknüpfen sie mit<br />
<strong>de</strong>r Zeitgeschichte) erkennt man an <strong>de</strong>n meist bühnenartig<br />
aufgebauten, dichtgedrängten Figuren, die scharf<br />
mit schwarzen Konturen abgegrenzt wer<strong>de</strong>n.
Das rosafarbene Atelier, 1911<br />
Die Trauer <strong><strong>de</strong>s</strong> Königs, 1952<br />
13<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
HENRI MATISSE<br />
Henri Matisse (1869 - 1954) ist <strong>de</strong>r bekannteste Vertreter <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
französischen <strong>Expressionismus</strong>. Sein Vorbild waren die<br />
späten Impressionisten, v. a. Paul Cezanne. Seine Bil<strong>de</strong>r sind<br />
flächig und in starken Farben angelegt. Er bleibt dabei immer<br />
gegenständlich, so sehr auch die Formen vereinfacht sind,<br />
doch wird er mit seinen flächigen, <strong>de</strong>korativen Formen zu<br />
einem Vorläufer <strong>de</strong>r abstrakten <strong>Kunst</strong>. Im Spätwerk gestaltet<br />
er Collagen aus farbigen Papieren und ausdrucksstarke<br />
Scherenschnitte.<br />
Die französischen Impressionisten erhielten die Bezeichnung<br />
„Les Fauves“, die Wil<strong>de</strong>n, wegen ihrer leuchten<strong>de</strong>n Farbigkeit<br />
und <strong>de</strong>r oft ungestümen Malweise. Diese starken Farben, die<br />
typisch für sie sind, richten sich nicht mehr nach <strong>de</strong>r Wirklichkeit.<br />
Vielmehr soll ein ausdrucksvoller Gesamtklang<br />
entstehen.<br />
Weitere Vertreter <strong><strong>de</strong>s</strong> Fauvismus waren u. a. Andre Derain<br />
und Raoul Dufy. Es han<strong>de</strong>lt sich hier aber um keine feste<br />
Künstlergruppe wie bei <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Expressionisten.
Bildanalyse: Franz Marc, Blaues Pferd<br />
Franz Marc, Blaues Pferd, 1911<br />
14<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Marc hat eine eigene Philosophie zur<br />
Symbolik und zur Wirkung <strong>de</strong>r Farben<br />
entwickelt:<br />
GELB steht für ihn für das Weibliche.<br />
ROT für die Lebenskraft<br />
BLAU für das Männliche und die<br />
geistige Kraft.<br />
Aus <strong>de</strong>m Weiblichen und <strong>de</strong>r Lebenskraft<br />
entsteht die Farbe für Wärme und<br />
Lebendigkeit, das ORANGE.<br />
Die Farbe GRÜN, die für alle lebendige<br />
Natur steht, setzt sich aus <strong>de</strong>m<br />
Weiblichen und <strong>de</strong>m Männlichen - aus<br />
Gelb und Blau - zusammen.<br />
Die Farbe <strong>de</strong>r Mystik, das VIOLETT,<br />
enthält Lebenskraft (Rot) und Geist<br />
(Blau).<br />
In seinen Bil<strong>de</strong>rn wollteFranz Marc<br />
immer das harmonische Gleichgewicht<br />
<strong>de</strong>r Farben erreichen, so kommen<br />
meist alle sechs Grundfarben im Bild<br />
vor - wie in einem Farbkreis.<br />
Wie alle Künstler <strong><strong>de</strong>s</strong> Blauen Reiter -<br />
<strong>de</strong>ren Werke in <strong>de</strong>r Regel tatsächliche<br />
alle Hauptfarben aufweisen - war er<br />
immer auf <strong>de</strong>r Suche nach <strong>de</strong>m<br />
harmonischen Gesamtklang.<br />
Aufgabe:<br />
E<strong>rs</strong>telle einen Farbauszug <strong>de</strong>r von Marc verwen<strong>de</strong>ten Hauptfarben.<br />
Vergleiche das Gemäl<strong>de</strong> mit einer Fotografie <strong><strong>de</strong>s</strong> gleichen Motivs (Form, Farbe).
John Constable, Der Heuwagen, 1821<br />
Bei<strong>de</strong> Werke ....<br />
Unte<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong><br />
15<br />
Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />
Wassily Kandinsky, Kirche in Murnau,<br />
Aufgabe:<br />
Beschreibe Ähnlichkeiten und Unte<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong> in Bezug auf Wie<strong>de</strong>rgabe <strong>de</strong>r Realität, Farbe und<br />
Malweise zwischen bei<strong>de</strong>n Werken stichpunktartig.