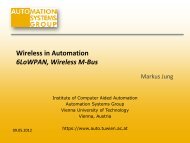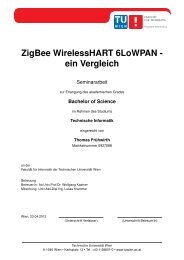Raumautomation - Technische Universität Wien
Raumautomation - Technische Universität Wien
Raumautomation - Technische Universität Wien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Raumautomation</strong><br />
VU Heim- und Gebäudeautomation<br />
Lukas Krammer<br />
Matr.Nr.: 0525332<br />
lukas.krammer@gmx.at<br />
<strong>Technische</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Wien</strong><br />
Daniel Lechner<br />
Matr.Nr.: 0325612<br />
daniel.lechner@student.tuwien.ac.at<br />
<strong>Technische</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Wien</strong><br />
Werner Luckner<br />
Matr.Nr.: 0525048<br />
werner.luckner@gmx.at<br />
<strong>Technische</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Wien</strong><br />
16. Juni 2008<br />
1
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einführung 3<br />
1.1 Zweckbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
1.2 Heimbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
2 Funktionen der <strong>Raumautomation</strong> 5<br />
2.1 Beleuchtung und Beschattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
2.2 Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik . . . . . . . . . . . . . 7<br />
2.3 Wetterschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
2.4 Sicherheitstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
2.4.1 Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
2.4.2 Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />
3 Planung und Integration 10<br />
3.1 Planung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />
3.2 Sensoren und Aktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
3.3 Raumbediengeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
3.4 Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
3.4.1 KNX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
3.4.2 LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
3.4.3 BACnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
3.4.4 Andere Protokolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
2
1 Einführung<br />
<strong>Raumautomation</strong> ist ein Teil der Gebäudeautomation und beschäftigt sich<br />
mit der Steuerung von gewerkeübergreifenden Abläufen und Funktionen innerhalb<br />
eines Raumes. Dabei werden folgende Raumtypen unterschieden: [1]<br />
individuelle Räume Ein individueller Raum kann abhängig von der Art<br />
des Gebäudes ein Wohnraum, Kinderzimmer, oder Hotelzimmer sein<br />
aber auch ein Einzel- oder Gruppenbüro.<br />
Gemeinschaftsräume Die Definition von Gemeinschaftsräumen reicht von<br />
Treppenhäusern über Gänge und Speisesälen bis hin zu Kinos und Konzertsälen.<br />
Zweckräume Zweckräume sind z.B. Technikräume in einem größeren Gebäude,<br />
Lagerräume und Fertigungshallen.<br />
Ziel der <strong>Raumautomation</strong> ist es einerseits den Komfort für die Nutzer des<br />
Raumes zu erhöhen und andererseits durch effiziente Nutzung der Ressourcen<br />
Energie und dadurch auch Kosten zu sparen. Hierbei ist der Begriff der<br />
Behaglichkeit von großer Bedeutung. Behaglichkeit hat sehr viele Aspekte,<br />
angefangen von der Raumarchitektur an sich, bis hin zur <strong>Raumautomation</strong>.<br />
Behaglichkeit ist sowohl im privaten Wohnbereich als auch in Büroräumen<br />
von enormer Bedeutung.<br />
Behaglichkeit ist ein subjektives Gefühl der Menschen in einem Raum<br />
und wird durch verschiedenste Aspekte beeinflusst. Zum einen spielt die architektonische<br />
Gestaltung eines Raumes eine erhebliche Rolle für das Wohlbefinden.<br />
So ist es dass der Raum abhängig von der jeweiligen Verwendung<br />
genügend groß bzw. genügend hoch ist. Weiters kann die Fensterfläche und<br />
damit die Zufuhr von natürlichem Licht sowie die Ausrichtung des Raumes<br />
(an den Himmelsrichtungen) zu einem Gefühl der Behaglichkeit beitragen.<br />
[1]<br />
Weiters ist es aber auch wichtig das richtige Raumklima zu schaffen.<br />
Wichtige Parameter dafür sind Temperatur, sowie Luftfeuchtigkeit und nicht<br />
zuletzt Sauerstoff- bzw. CO2-Gehalt der Raumluft. [2]<br />
Wie aus diesem kurzen Abriss der Parameter eines Raumes zu erkennen<br />
ist, bedarf es zur optimalen Nutzung eines Raumes ein gewerkeübergreifendes<br />
System, dass alle Prozesse innnerhalb eines Raumes steuert und damit neben<br />
den baulichen Maßnahmen erheblich zur Steigerung der Behaglichkeit,<br />
sowie zur energieeffizienten Nutzung des Raumes bzw. des Gebäudes beitragen<br />
kann.<br />
3
1.1 Zweckbauten<br />
In Bürogebäuden gibt es neben der direkten Kostenersparnis durch Energieeffizienz,<br />
auch ein großes Potential bei der Produktivitätssteigerung. Da dieses<br />
Potential aber nicht direkt ersichtlich ist, beziehungsweise oftmals nicht genau<br />
beziffert werden kann, wurde dieses Thema in der Vergangenheit häufig<br />
vernachlässigt. Mittlerweile existieren zahlreiche Studien, die den Einfluss<br />
von Umweltfaktoren auf die Produktivität von ” Büroarbeitern“ bestätigen.<br />
Einige wissenschaftliche Studien, wie z.B. ” Using Office Design to Increase<br />
Productivity“ von Michael Brill (vgl. BOSTI [3]) wiesen allerdings schon<br />
Ende der 60er Jahre auf diesen Umstand hin.<br />
Laut [1] zählen mangelnde Luftqualität, sowie Lichtprobleme und unkomfortable<br />
Raumtemperaturen zu den größten Stressfaktoren im Büro. Als<br />
Hauptbelastungen für die Mitarbeiter gelten schlechte Klimatisierung, stickige<br />
und trockene Luft und störende Kabel ganz oben auf der Liste. Erkältungen,<br />
Augenreizungen, Kopfschmerzen, Ermüdungen und Konzentrationsschwächen<br />
sind Folgen dieser Belastungen und werden häufig als ” Sick-<br />
Building-Syndrome“ zusammengefasst.<br />
Abbildung 1: Systemkosten (aus [4])<br />
Verschiedene Untersuchungen (zum Beispiel [3, Economic Benifits] oder<br />
[4, Life-Cycle Costs Analysis (LCCA)]) weisen darauf hin, dass über 80% (bei<br />
manchen Publikationen sogar über 90%) der Kosten für Gebäude, Technologie,<br />
Instandhaltung und Personal für Personalkosten aufgewendet werden<br />
(siehe Abbildung 1). Die Schaffung der Infrastruktur schlägt sich dagegen<br />
nur mit wenigen Prozent nieder. Nicht zuletzt deshalb wird in der jüngeren<br />
Vergangenheit vermehrt in das Gebiet der Heim- und Gebäudeautomation<br />
und speziell der <strong>Raumautomation</strong> investiert. Die sinkenden Preise der Automatisierungstechnik<br />
tragen natürlich auch dazu bei.<br />
4
1.2 Heimbereich<br />
Im Heimbereich ist das Einsparungspotential nicht so groß wie in Zweckbauten.<br />
Dennoch befinden sich bereits heute zahlreiche Steuerungen und Regelungen<br />
in den Installationen. Wird eine neue Anlage installiert, gehören<br />
eine ausgeklügelte Brennersteuerung sowie eine optimierte Raumtemperaturregelung<br />
zum Standard. Üblicherweise sind unterschiedliche Programme<br />
beziehungsweise Szenen (meist mit Zeitsteuerung) bereits ab Werk vorprogrammiert.<br />
Ebenso werden häufig Bewegungsmelder für die Beleuchtung und die<br />
dafür notwendige Präsenzerkennung eingesetzt. Viele dieser Sensoren messen<br />
selbsttätig die vorhandene Helligkeit und schalten das Licht nur bei unzureichenden<br />
Lichtverhältnissen ein.<br />
Diese Beispiele zeigen, dass <strong>Raumautomation</strong> teilweise schon Einzug in<br />
den Privatbereich gehalten hat. Die erwähnten unterschiedlichen Systeme<br />
sind allerdings oftmals nicht aufeinander abgestimmt. Bereits erfasste Daten<br />
können meistens nicht verwendet werden und müssen gegebenenfalls mehrfach<br />
erfasst werden. Eine Verknüpfung der Gewerke ist oft gar nicht oder nur<br />
mit hohem Aufwand möglich.<br />
Neben energieoptimierenden Maßnahmen steht auch im Heimbereich das<br />
Wohlbefinden im Vordergrund. Mithilfe der <strong>Raumautomation</strong> soll auch hier<br />
das ” Sick-Building-Syndrome“ verhindern werden.<br />
2 Funktionen der <strong>Raumautomation</strong><br />
Wie in der Einführung schon erwähnt gibt es eine große Menge von Sensoren<br />
und Aktuatoren die in einem modernen Raum vorhanden sind. Diese Funktionen<br />
sind in Prozesse und Abläufe integriert, die in heutigen Gebäuden<br />
noch großteils manuell ausgeführt werden müssen. Daher ist es ein Ziel, die<br />
Teilprozesse innerhalb eines Raumes wie z.B. Lichtregelung und Temperaturregelung<br />
unter Berücksichtigung von allen Teilsystem innerhalb eines Raumes<br />
optimal zu steuern.<br />
2.1 Beleuchtung und Beschattung<br />
Es dürfte klar ersichtlich sein, dass gute Beleuchtung einen wesentlichen Produktivitätsfaktor<br />
in Bürogebäuden darstellt. Die wichtigste Kunstlichtquelle<br />
in Bürogebäuden sind Fluoreszenzleuchten. Der Grund dafür ist der, im<br />
Vergleich zu Glühlampen, relativ hohe Wirkungsgrad (d.h. höhere Lichtausbeute<br />
bei gleichem oder geringerem Energieverbrauch). Fluoreszenzleuchten<br />
5
enötigen zum Betrieb ein Vorschaltgerät. In den letzten Jahren werden dabei<br />
größtenteils elektronische Vorschaltgeräte mit Dimmfunktion verbaut.<br />
Die zweite wichtige Lichtquelle in Bürobauten ist das Tageslicht, welches<br />
von den Mitarbeitern als das angenehmste Licht wahrgenommen wird. Aus<br />
diesem Grund, und aufgrund des möglichen Einsparungspotentials durch<br />
Ausnützung des Sonnenlichts, werden Arbeitsplätze heute so entworfen, dass<br />
der Tageslichtanteil so hoch wie möglich ist.Damit die Mitarbeiter nicht vom<br />
direkt einstrahlenden Sonnenlicht geblendet werden, müssen Blendschutzeinrichtungen<br />
wie Jalousien angebracht werden. Durch die Möglichkeiten der<br />
<strong>Raumautomation</strong> ist es nun möglich je nach Jahreszeit, Sonnenstand und<br />
damit auch der Tageszeit optimale Lichtbedingen für den Nutzer des Raumes<br />
einzustellen. So wird über Helligekeitssensoren an der Fassade und im<br />
Raum die Lichtstärke und die Richtungs des einstrahlenden Tageslichts gemessen<br />
und aufgrund dieser Daten entschieden, ob und wie stark Kunstlicht<br />
unterstützend eingesetzt werden muss, bzw. die ideale Stellung der Jalousien<br />
zu bestimmen um eine Blendung zu verhindern. Dadurch ist es möglich<br />
dem Nutzer über den ganzen Tag gleiche Lichtverhältnisse anzubieten (Konstantlichtregelung).<br />
Abbildung 2 veranschaulicht das Einsparungspotential<br />
im Jahresverlauf im Bereich der Beleuchtung durch den Einsatz von <strong>Raumautomation</strong><br />
(vgl. zu diesem Abschnitt [1]).<br />
Abbildung 2: Energieeinsparungspotential durch <strong>Raumautomation</strong> im Bereich<br />
der Beleuchtung (Bildquelle: [1, S. 44])<br />
Ein weiterer Vorteil im Bereich der Komfortsteigerung, der durch <strong>Raumautomation</strong><br />
realisiert werden kann, ist die sogenannte Szenensteuerung. Mittels<br />
Szenensteuerung ist es möglich, über das Raumbediengerät verschiede-<br />
6
ne Lichtszenen, wie zum Beispiel für Präsentationen (Jalousien geschlossen,<br />
Kunstlicht niedrig oder aus), Bildschirmarbeit, usw. abzuspeichern und auf<br />
einen Knopfdruck wieder aufzurufen.<br />
Ein weiterer Aspekt im Bereich der Beleuchtung ist das automatische<br />
Ausschalten der Beleuchtung in jenen Räumen, welche nicht genutzt werden.<br />
Eine automatische Abschaltung wird in klassischen Installationen üblicherweise<br />
mit Zeitschaltuhren realisiert. Da diese Vorgehensweise aber in vielen<br />
Fällen sehr ineffizient ist (man denke zum Beispiel daran, dass sich jemand<br />
länger als die Standardarbeitszeit an seinem Arbeitsplatz aufhält), wird bei<br />
der <strong>Raumautomation</strong> bevorzugt der Weg der Präsenzerkennung gegangen.<br />
Das heißt, dass das Licht zwar prinzipiell zeitgesteuert ausgeschaltet wird,<br />
aber diese Abschaltung nicht passiert, wenn für das System ersichtlich ist,<br />
dass sich noch jemand im Raum befindet. Die Präsenzerkennung kann auf<br />
unterschiedliche Weise vorgenommen werden. So kann diese über Bewegungsbzw.<br />
Infrarotsensoren im Raum realisiert werden. Eine weitere sehr häufig<br />
genutze Möglichkeit ist eine sogenannte Präsenztaste am Raumbediengerät.<br />
2.2 Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik<br />
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die Behaglichkeit der Mitarbeiter<br />
in Büroräumen sind die Gewerke der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik<br />
(HLK-Technik). Seit einigen Jahrzehnten ist man bestrebt Gebäude voll zu<br />
klimatisieren. Diese Anlagen lieferten jedoch nicht immer die Ergebnisse die<br />
von ihnen erwartet wurden. Bei vielen Anlagen war eine Öffnung der Außenfenster<br />
gar nicht mehr möglich und die Frischluftzufuhr war ausschließlich<br />
über die Klimaanlage möglich.<br />
In den letzten Jahren hat ein Umdenken begonnen und man versucht ein<br />
geeignetes Optimum für das Zusammenspiel zwischen Lüftung über die Außenfenster<br />
und der Lüftung über die Klimaanlage zu finden, was sich auch<br />
wiederum positiv auf die Energieeffizienz auswirkt. Außerdem ist es durch<br />
die Verwendung von <strong>Raumautomation</strong>sfunktionen möglich die Zufuhr der<br />
Außenluft über die Fenster in die Regulierung der Raumtemperatur miteinzubeziehen.<br />
So ist es beispielsweise gängige Praxis, im Sommer in den<br />
Nächten die Fenster zu öffnen, damit die kühle Außenluft in das Gebäude<br />
einströmen kann, um die Klimaanlage zu entlasten. Dazu ist noch zu sagen,<br />
dass die Fenster dabei durch einen motorbetriebenen Mechanismus geöffnet<br />
und geschlossen werden können. Natürlich hat der Benutzer jederzeit die<br />
Möglichkeit über das Raumbediengerät die Fenster manuell zu öffnen. Dabei<br />
wird beim Öffnen des Fensters automatisch die Lüftung über die Klimaanlage<br />
ausgeschaltet um Energieverschwendung zu vermeiden. Außerdem<br />
wird bei zu großen Abweichungen der Raumtemperatur von der eingestell-<br />
7
ten Solltemperatur automatisch die Schließung der Fenster eingeleitet. Aus<br />
Sicherheitsgründen muss das Schließen des Fensters sehr langsam erfolgen.<br />
Eine weitere wichtige Komponente zur Regulierung der Raumtemperatur<br />
sind die Jalousien, welche idealerweise außen angebraucht werden sollten,<br />
wenn dieses das Design des Gebäudes erlaubt. Dadurch kann beispielsweise<br />
im Sommer durch automatische Beschattung durch die Jalousien die<br />
Gebäudekühlung unterstützt werden. Wie schon bei der Beleuchtung (siehe<br />
Kapitel 2.1) ist auch im Bereich der HLK-Technik die Präsenzerkennung sehr<br />
wichtig. Mit Hilfe der Präsenzerkennung muss nicht ständig die Raumtemperatur<br />
auf dem Sollwert gehalten werden, sondern nur dann wenn der Raum<br />
gerade genutzt wird. Allerdings sollte auch darauf geachtet werden, dass die<br />
Raumtemperatur ungenutzter Räume nicht zu sehr von der Solltemperatur<br />
abweicht, da sonst die Zeit bis zum Erreichen der idealen Temperatur mitunter<br />
längere Zeit in Anspruch nehmen kann.Außerdem ist es aus der Sicht der<br />
Energieeffizienz oft besser die Temperatur eines Raumes in einem gewissen<br />
Bereich zu halten, als die Tempteratur erst beim Betreten auf den Sollwert<br />
zu regeln. Die Realisierung dieser Funktion kann wie bei der Beleuchtung aus<br />
einer Kombination von einer Zeitschaltung und der Präsenzerkennung realisiert<br />
werden. Aufgrund der Trägheit von HLK-Systemen hat sich außerdem<br />
herausgestellt, dass es als angenehmer empfunden wird, wenn die Regelung<br />
der Raumtemperatur schon eine halbe Stunde vor dem Betreten des Raumes<br />
(also z.B. eine halbe Stunde vor dem Beginn der Arbeitszeit) einsetzt.Eine<br />
weitere Möglichkeit, die beispielsweise für eher selten oder unregelmäßig genutzte<br />
Räume (z.B. Besprechungszimmer und Konferenzräume) ist die Verbindung<br />
der Klimaregelung mit einem Kalender, in dem der Raum für einen<br />
gewissen Zeitraum reserviert werden kann. Mit Hilfe dieses Kalenders kann<br />
der Raum dann automatisch, schon eine gewissen Zeit vor dem Eintreffen der<br />
Personen auf die ideale Raumtemperatur gebracht werden. Natürlich ist auch<br />
bei der Regelung des Raumklimas, wie auch bei der Beleuchtung, jederzeit ein<br />
Eingreifen des Benutzers eines Raumes möglich. So sieht man in den meisten<br />
Fällen einen gewissen Bereich, um die voreingestellte Idealtemperatur, vor,<br />
indem der Benutzer die Temperatur selbst wählen kann (z.B. ±3 ◦ C). Auf diese<br />
Weise wird auch der Tatsache, dass Frauen ein anderes Kälteempfinden als<br />
als Männer haben, Rechnung getragen. Abbildung 3 zeigt den Temperaturbereich,<br />
in welchem sich die meisten Mengschen wohlfühlen. Die Einstellung der<br />
individuellen Raumtemperatur erfolgt wiederum über das Raumbediengerät.<br />
2.3 Wetterschutz<br />
Auch beim Schutz des Gebäudes vor Wetterschäden kann die <strong>Raumautomation</strong><br />
helfen. So können im Zusammenspiel mit außen montierten Windsensoren<br />
8
Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Oberflächentemperatur und Lufttemperatur<br />
(Bildquelle: [5])<br />
die Jalousien beim Überschreiten einer bestimmten Windgeschwindigkeit eingefahren<br />
werden. Weiters können durch, an der Fassade angebrachte Regensensoren,<br />
bei einsetzendem Regen die Fenster teilweise oder ganz geschlossen<br />
werden. Diese Sensoren können von mehreren bzw. allen Räumen gemeinsam<br />
genutzt werden.<br />
2.4 Sicherheitstechnik<br />
2.4.1 Security<br />
Ein weiterer wichtiger Teil der <strong>Raumautomation</strong> ist Security. Wichtig im<br />
Bereich der Security ist die Überwachung von Räumen mithilfe von Kameras<br />
und Bewegungsmeldern. Diese Daten können dazu verwendet werden,<br />
um Einbrüche und Diebstähle in den Räumen zu verhindern bzw. um eine<br />
Überwachung des Raumes durch das Facility Management zu gewährleisten.<br />
Oft sind Überwachungseinrichtungen mit elektronischen Zutrittskontrollen<br />
gekoppelt.<br />
Weiters ist es möglich Komponenten zur Identifikation von Personen, wie<br />
z.B. Fingerprintreader oder elektronische Zahlenschlösser zu integrieren um<br />
einer Person automatisch mithilfe von automatischen Schlössern oder Zugangsschranken<br />
Zutritt zu einem Raum zu gewähren. [1]<br />
9
Wichtig bei der Integration solcher System ist ein hohes Maß an Sicherheit<br />
der Komponenten selbst, sowie der Kommunikationsnetze mithilfe dessen<br />
die einzelnen Komponenten kommunizieren. Ein solches System sollte<br />
deshalb auch nicht durch Angriffe von außen ausgehebelt oder ausgeschaltet<br />
werden können. Dabei spielt, vorallem bei drahtlosen Systemen, Datenverschlüsselung<br />
eine entscheidende Rolle. Bei drahtgebundenen Systemen sollte<br />
entweder auch Datenverschlüsselung verwendet werden, oder sichergestellt<br />
sein, dass kein Zugang zum physikalischen Datennetz von außerhalb besteht.<br />
2.4.2 Safety<br />
Der Begriff Safety im Kontext der <strong>Raumautomation</strong> beschäftigt sich vor<br />
allem mit Gefahrenmeldeeinrichtungen wie z.B. Rauchmelder und Einrichtungen<br />
für die Sicherheit wie z.B. Brandschutzklappen oder automatische<br />
Feuerlöschanlagen. Hierbei ist es extrem wichtig, dass die Funktion dieser<br />
Anlagen sichergestellt ist und ein Ausfall des Systems oder Teilen davon sofort<br />
bemerkt wird.<br />
Wird ein Brand in einem Raum entdeckt, so müssen sofort alle Brandschutzklappen<br />
geschlossen werden, um die Sauerstoffzufuhr zum Brandherd<br />
zu unterbinden und die Ausweitung des Brandes zu verhindern. Zusätzlich<br />
müssen noch Entrauchungsklappen sowie Ventilatoren zum Absaugen der<br />
Rauchgase aktiviert werden. Weiters müssen in den betroffenen Räumen des<br />
Gebäudes die automatischen Löschanlagen aktiviert werden, sofern solche<br />
vorhanden sind. [1]<br />
3 Planung und Integration<br />
3.1 Planung<br />
Die Planung von modernen Gebäuden sollte so erfolgen, dass das Gebäude flexibel<br />
genutzt werden kann. Ein Konzept ist es, eine Ebene des Gebäudes in sogenannte<br />
Raummodule zu unterteilen, wobei ein Raummodul die kleinstmögliche<br />
Raumeinheit innerhalb eines Gebäudes ist. Durch eine Aneinanderreihung<br />
dieser Module sollte es möglich sein, die Struktur eines Gebäudes zu verändern<br />
ohne größere Änderungen der baulichen Struktur oder der Gebäudetechnick<br />
durchführen zu müssen. <strong>Raumautomation</strong>ssysteme bieten bei diesem Konzept<br />
den erheblichen Vorteil, dass kaum Änderungen an der vorhandenen<br />
Infrastruktur (wie z.B. Verkabelung, Lampen, Klimageräte) durchgeführt<br />
werden müssen, sondern lediglich das System softwaremäßig mit der neuen<br />
Raumkonfiguration abgestimmt werden muss.<br />
10
Bei der Projektierung eines solchen Gebäudes kann man davon ausgehen,<br />
dass es zumeist nicht mehr als 20 verschiedenartige Raumtypen gibt. Diese<br />
generischen Raumtypen und deren Anforderungen können dann zur Projektierung<br />
der tatsächlichen Räume herangezogen werden. Diese Methode führt<br />
zu einer enormen Vereinfachung der Konzeptionierung eines Gebäudes. [1]<br />
3.2 Sensoren und Aktuatoren<br />
Ein modernes <strong>Raumautomation</strong>ssystem besteht aus einer Vielzahl von Sensoren<br />
und Aktuatoren die über ein Kommunikationsnetzwerk miteinander<br />
verbunden sind. Bei Kommunikationssystemen gibt es eine Vielzahl von Topologien<br />
(z.B. Bus, Stern, Ring). In <strong>Raumautomation</strong>ssystemen wird meist<br />
eine hierarchische Bustopologie bevorzugt.<br />
Bei der Platzierung der Aktuatoren gibt es zwei verschiedene Ansätze. [1]<br />
Zentrale Platzierung der Sensoren und Aktoren Es gibt die Möglichkeit<br />
alle Aktuatoren in einem Raumverteiler zusammenzufassen und<br />
die tatsächlichen Verbraucher dann über eine konventionelle Verkabelung<br />
anzuschließen. Solche Raumverteiler können bereits vorinstalliert<br />
und konfiguriert geliefert werden und beschleunigen die Installation des<br />
Gebäudes.<br />
Der Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass möglicherweise größere<br />
Distanzen zwischen Aktuator und dem eigentlichen Verbraucher liegen,<br />
die dann durch eine aufwendige Installation an den Raumverteiler angeschlossen<br />
werden muss.<br />
Dezentrale Platzierung der Aktoren Es werden die Aktoren so nahe<br />
wie möglich an den Verbrauchern platziert. Bei manchen Verbrauchern<br />
ist es sogar möglich, die Aktuatoren direkt einzubauen. Diese Aktuatoren<br />
können sich in den verschiedensten Teilen eine Raumes befinden<br />
und müssen durch eine Busleitung miteinander verbunden sein.<br />
3.3 Raumbediengeräte<br />
Raumbediengeräte dienen dazu sämtliche Abläufe in einem Raum (Licht,<br />
Jalousien, Temperatur) lokal einzustellen. Dies erhöht einerseits den Komfort<br />
der Personen in einem Raum. Andererseits können diese Einstellungen zentral<br />
vom Facility Management geändert werden. Dies ist z.B. der Fall, falls beim<br />
Verlassen des Raumes vergessen wird das Licht abzuschalten. [6]<br />
11
3.4 Standards<br />
Abbildung 4: Raumbediengerät (Bildquelle: [6])<br />
Im folgenden Abschnitt soll ein kurzer Abriss über die handelsüblichen Systeme<br />
gegeben werden.<br />
3.4.1 KNX<br />
EIB/KNX verfolgt grundsätzlich einen dezentralen Ansatz. Sowohl die Verdrahtung,<br />
als auch die Steuerung und Logik sind dezentral aufgebaut. Die<br />
betroffenen Sensoren und Aktoren erkennen sozusagen selbstständig welche<br />
Aktionen ausgeführt werden müssen und kommunizieren autark (entsprechende<br />
Projektierung und Programmierung vorausgesetzt).<br />
Oftmals kommt es aber zu Situationen, die mit den KNX ” Hausmitteln“<br />
nicht zu lösen sind. Ein einfaches Beispiel wäre eine Aktion, die das Einschalten<br />
des Lichts (Befehl ” Ein“ am Bus mit bestimmter Adresse) und gleichzeitig<br />
das Runterfahren einer Jalousie (Befehl ” Ab“ am Bus) auslösen soll.<br />
Herkömmliche Sensoren, wie Taster, Bewegungsmelder, etc. können beim<br />
Eintreten eines Ereignisses nur einfache Telegramme aussenden. Szenen können<br />
dazu verwendet werden, um diese Funktionen zu realisieren. Für einfache<br />
12
logische Verknüpfungen stehen sogenannte Verknüpfungsgeräte zur Verfügung.<br />
Eine große Anzahl an Logikverküpfungen werden mit einem Logikmodul<br />
ausgewertet. [7]<br />
Für komplexere Steuerungen, die über einfache Logikverknüpfungen hinausgehen,<br />
werden am Markt einige Geräte angeboten. Viele Raumcontroller<br />
beherrschen erweiterte Aufgaben, die für die Zwecke der <strong>Raumautomation</strong><br />
zugeschnitten sind. Wenngleich die Logik pro Raum innerhalb eines Raumcontrollers<br />
zusammengefasst wird, kann diese Lösung noch als dezentral angesehen<br />
werden.<br />
Andere Geräte, die Funktionen der <strong>Raumautomation</strong> abdecken, sitzen<br />
zentral an einer Stelle im Gebäude und steuern die betroffenen Aktoren. Oftmals<br />
wird für diesen Ansatz ein zentraler EIB/KNX-Server eingesetzt. Es<br />
existieren einige proprietäre und freie Implementierungen, um einen normalen<br />
PC in einen KNX-Server zu verwandeln. Anstatt der Verwendung eines<br />
PCs, können auch Steuergeräte mit Touchpanels verwendet werden. Diese<br />
sind meistens billiger, auf Dauerbetrieb ausgelegt und weniger fehleranfällig.<br />
Einige Firmen (zum Beispiel Divus Domus, Moeller, . . . ) bieten solche Steuergeräte<br />
an. Diese werden ebenfalls zentral im Gebäude platziert. Es existieren<br />
aber auch offene Implementierungen, wie zum Beispiel das Projekt LEIBnix<br />
1 . Es setzt einen Microcontroller für die nötigen Berechnungen und die<br />
Kommunikation ein.<br />
3.4.2 LON<br />
LON setzt den Grundgedanken der dezentralen Intelligenz konsequenter um<br />
als KNX. Ähnlich wie bei KNX, können auch bei LON die vorhandenen Applikationen<br />
des Herstellers eines Gerätes für Automatisierungsaufgaben verwendet<br />
werden. LON bietet hierfür für die Gerätehersteller die Möglichkeit,<br />
ihre ” Plug-Ins“ in Neuron C zu programmieren. Da LON grundsätzlich den<br />
Anspruch erhebt, auch komplexere Automatisierungsaufgaben erfüllen zu<br />
können, ist die Projektierung oftmals etwas komplizierter als bei KNX. Für<br />
die Verarbeitung von größeren Datenmengen, kommt LON die im Vergleich<br />
höhere Datenübertragungsrate entgegen.<br />
Die Programme zum Beispiel für eine Konstantlichtregelung sind also –<br />
so wie dies auch bei einigen KNX-Geräten der Fall sein kann – im Schalt-<br />
/Dimmaktor hinterlegt. Zusätzliche Steuergeräte sind in diesem Fall nicht<br />
nötig. [8]<br />
Dennoch werden auch bei der <strong>Raumautomation</strong> mit LON üblicherweise<br />
Raumcontroller eingesetzt, die komplexere Steuerungsaufgaben übernehmen.<br />
1 http://leibnix.sourceforge.net und http://www.leibnix.de/<br />
13
Damit ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei einer möglichen Implementierung<br />
mittels KNX.<br />
3.4.3 BACnet<br />
BACnet eignet sich gründsätzlich für alle Ebenen der Gebäudeautomation,<br />
wird aber hauptsächlich in der Managementebene eingesetzt. Es sind aber<br />
zahlreiche Raumcontroller verfügbar, die auf der Basis von BACnet arbeiten.<br />
Die Anbindung von Sensoren und Aktoren erfolgt aber meistens über ein<br />
anderes Protokoll, also zum Beispiel KNX oder LON.<br />
In BACnet sind die Fähigkeiten von Geräten über sogenannte Device<br />
Profiles geregelt. Diese geben eine Mindestanforderung an die zu implementierenden<br />
Funktionen eines Gerätes vor. Einfache Schalt- oder Stelleinrichtungen<br />
beziehungsweise Messwertaufnehmer sind in dem Profil Smart Actuator<br />
beziehungsweise Smart Sensor zusammengefasst. Für Funktionen der<br />
<strong>Raumautomation</strong> ist jedoch erweiterte Funktionalität notwendig, die sich mit<br />
Application Specific Controller, Advanced Application Controller oder Building<br />
Controller realisieren lassen. Die Application Specific Controller sind<br />
meist vom Hersteller programmiert und lassen nur eine Konfiguration über<br />
festgelegte Parameter zu. Höheren Anforderungen der Programmierbarkeit<br />
genügt der Advanced Application Controller. Der Building Controller ist frei<br />
programmierbar und kann für vielfältige Aufgaben eingesetzt werden.<br />
3.4.4 Andere Protokolle<br />
Neben den oben genannten Protokollen existieren noch eine Vielzahl weiterer.<br />
KNX, LON und BACnet dürften am Besten für <strong>Raumautomation</strong> geeignet<br />
sein beziehungsweise haben sich behaupten können. Viele der anderen Protokolle<br />
decken nur einen Teilbereich der <strong>Raumautomation</strong> ab und werden<br />
daher – falls verwendet – in eine KNX-, LON- oder BACnet-Umgebung eingebunden.<br />
Exemplarisch möchten wir an dieser Stelle zwei nennen, um zu<br />
zeigen, dass für bestimmte Aufgaben nach wie vor andere Protokolle verwendet<br />
werden.<br />
DALI 2 ist ein speziell auf Lichtsteuerungen zugeschnittes Steuerprotokoll.<br />
MBUS 3 ist ein Feldbus für die Erfassung von Verbrauchsdaten.<br />
2 Digital Addressable Lighting Interface, http://www.dali-ag.org<br />
3 Metering Bus, http://www.m-bus.com<br />
14
Literatur<br />
[1] R. Staub, “<strong>Raumautomation</strong> im bürogebäude: Moderne<br />
gebäudeautomation als voraussetzung für produktivität und behaglickeit.”<br />
Verlag Moderne Industrie, 86895 Landsberg/Lech, 2001.<br />
[2] D.-I. K.Scherer, “Gerwerkeübergreifende systemlösungen im wohnbereich<br />
- status und zukunftspotentiale,” in 6. VDI-TGA-Fachtagung Ëlektrotechnik<strong>Raumautomation</strong><br />
VDI-Berichte 1816, VDI-Gesellschaft <strong>Technische</strong><br />
Gebäudeausrüstung, 2004 2004.<br />
[3] BOSTI Associates, “the buffalo organization for social and technological<br />
innovation.”<br />
[4] National Institute of Building Sciences, “Whole building design guide.”<br />
[5] A. Heidemann, “Integrationsplanung als voraussetzung für eine optimale<br />
raumfunktionalität,” <strong>Raumautomation</strong> - 6. VDI-TGA-Fachtagung Elektrotechnik<br />
- VDI Berichte 1816, 2004.<br />
[6] Ma-Lik, “<strong>Raumautomation</strong>,” Mai 2008. Version vom 14.Mai.2008, http:<br />
//de.wikipedia.org/wiki/<strong>Raumautomation</strong>.<br />
[7] H. Leicenroth, EIB-Anwenderhandbuch. Huss-Medien GmbH, 2003.<br />
[8] H. Merz, T. Hansemann, and C. Hübner, Gebäudeautomation - Kommunikationssysteme<br />
mit EIB/KNX, LON und BACnet. Carl Hanser Verlag<br />
München, 2007.<br />
15