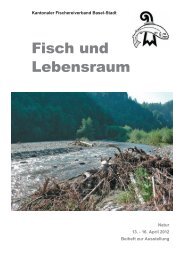Fisch und Nachhaltigkeit - Kantonaler Fischerei-Verband Basel-Stadt
Fisch und Nachhaltigkeit - Kantonaler Fischerei-Verband Basel-Stadt
Fisch und Nachhaltigkeit - Kantonaler Fischerei-Verband Basel-Stadt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong><br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
Natur<br />
10. – 13. Februar 2011<br />
Beiheft zur Ausstellung
70.8 % unserer Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Die Meere enthalten 96 % des gesamten Salzwasservorrats<br />
der Erde, dies sind über 1350 Millionen Tonnen Wasser.<br />
Über 9 Kilogramm <strong>Fisch</strong>, Krustentiere <strong>und</strong> Muscheln verspeisen wir pro Kopf <strong>und</strong> Jahr.<br />
Allein in den vergangenen drei Jahren hat der Konsum um ein Viertel<br />
auf 71 000 Tonnen zugenommen<br />
<strong>Fisch</strong>e essen ist ges<strong>und</strong> <strong>und</strong> gut. Aber nicht um jeden Preis.<br />
Das weltweite rücksichtslose Befischen der Meere, der Flüsse <strong>und</strong> Seen<br />
ist der Tod des Lebensraums Gewässer.
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong><br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
Beiheft zur Ausstellung<br />
1. Auflage, 6. NATUR Messe, <strong>Basel</strong><br />
© 2011<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
www.basler-fischerei.ch<br />
Jörg Alioth<br />
Mühlemattstr. 11<br />
4414 Füllinsdorf<br />
Natel 079 706 00 68<br />
joerg.alioth@bluewinch<br />
Natur<br />
10. – 13. Februar 2011<br />
Beiheft zur Ausstellung
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
4<br />
Liebe Besucherinnen <strong>und</strong> Besucher der Ausstellung,<br />
liebe <strong>Fisch</strong>erei- <strong>und</strong> Naturfre<strong>und</strong>e<br />
Ich stelle mir die Freizeitfi scherinnen <strong>und</strong> -fi scher als Zeitgenossen vor, die mit Angel <strong>und</strong><br />
Netz, aber auch mit List <strong>und</strong> Können auf die Jagd gehen.<br />
Ich weiss auch, dass sie sich für saubere Gewässer <strong>und</strong> die Revitalisierung naturnaher Lebensräume<br />
im Interesse der Wasserbewohner einsetzen. Sie sind also gleichzeitig Feinde<br />
einzelner <strong>und</strong> Verbündete vieler <strong>Fisch</strong>e. Vor allem aber sind sie Naturfre<strong>und</strong>e, die sich für<br />
die Balance als Prinzip <strong>und</strong> für die <strong>Nachhaltigkeit</strong> aus Überzeugung engagieren.<br />
«Le monde est fragile. Prenons-en soin! » Das ist die Botschaft meiner Neujahrskarte. Und<br />
die gleiche Botschaft - nehmen wir Acht auf unsere Welt! - verbreiten die <strong>Fisch</strong>erinnen <strong>und</strong><br />
<strong>Fisch</strong>er - mit ihrem freiwilligen Einsatz Jahr für Jahr, <strong>und</strong> aktuell mit ihrer Sonderausstellung<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong> an der 6. NATUR Messe in <strong>Basel</strong>. Das Thema ist wichtig <strong>und</strong><br />
dringend. Bekanntlich ist die Hochseefi scherei alles andere als nachhaltig <strong>und</strong> der Balance<br />
verpfl ichtet.<br />
Wenn das Meer systematisch leergefi scht wird <strong>und</strong> immer mehr Arten vom Aussterben<br />
bedroht sind, dann ist es nicht zu früh, sondern höchste Zeit, Gegenruder zu geben. Die<br />
Sonderausstellung bietet Aufklärung. Und Aufklärung ist die Voraussetzung für ein Umdenken.<br />
Den Basler <strong>Fisch</strong>erinnen <strong>und</strong> <strong>Fisch</strong>ern danke ich für ihren unermüdlichen Einsatz <strong>und</strong><br />
die Ausstellung. Ihnen, liebe Besucherin, lieber Besucher wünsche ich Kurzweil <strong>und</strong> viele<br />
Einblicke.<br />
Micheline Calmy-Rey<br />
B<strong>und</strong>espräsidentin<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Lieber Messe-Besucherinnen <strong>und</strong> -Besucher<br />
Liebe <strong>Fisch</strong>erinnen <strong>und</strong> <strong>Fisch</strong>er<br />
Die <strong>Fisch</strong>erinnen <strong>und</strong> <strong>Fisch</strong>er waren die Naturschützer der ersten St<strong>und</strong>e. Lange bevor<br />
Umweltschutz ein öffentliches Thema wurde, schrieben sich die organisierten Angelfi scher<br />
Gewässerschutz, Artenschutz <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong> auf ihre Fahnen.<br />
Der Kantonale <strong>Fisch</strong>erei-<strong>Verband</strong> <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> (KFVBS) engagiert sich seit 70 Jahren für<br />
die Natur <strong>und</strong> gilt mit dem 1983 lancierten Lachs-Wiederansiedlungsprojekt in der Schweiz<br />
als echter Pionier.<br />
Mit seiner Sonderausstellung zum Thema <strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong> an der<br />
6. NATUR Messe <strong>Basel</strong> leistet der KFVBS einen wesentlichen Beitrag zur Information <strong>und</strong><br />
Sensibilisierung der Bevölkerung.<br />
Ich gratuliere dem Kantonalverband <strong>und</strong> seinen Vereinen für den professionellen Auftritt<br />
<strong>und</strong> danke allen Beteiligten für ihren vorbildlichen Einsatz.<br />
Roland Seiler<br />
Zentralpräsident<br />
Schweizereischer <strong>Fisch</strong>erei-<strong>Verband</strong> SFV<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
5
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
6<br />
Liebe Besucherinnen <strong>und</strong> Besucher der Messe Natur<br />
Das Prinzip der Nachhaltigen Entwicklung gilt auch für die <strong>Fisch</strong>erei: Wirtschaftliche, gesellschaftliche<br />
<strong>und</strong> ökologische Anliegen müssen sich auf Dauer die Waage halten, ansonsten<br />
gelangt das Gesamtsystem in Schiefl age. Die Ausstellung “<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>”<br />
des Kantonalen <strong>Fisch</strong>ereiverbands <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> zeigt eindrücklich, welche Konsequenzen<br />
beispielsweise ein rücksichtsloses Befi schen der Weltmeere nach sich zieht. Geht der aktuelle<br />
Trend weiter, nimmt die Biodiversität massiv Schaden, versiegt zunehmend eine<br />
wichtige Nahrungsquelle <strong>und</strong> droht letztlich der Verlust von unzähligen Arbeitsplätzen. Eine<br />
Wende ist dringend nötig. Auch wenn die Schweiz politisch direkt wenig Einfl uss auf diese<br />
Entwicklung nehmen kann, ist es umso wichtiger, dass wir uns als Konsumentinnen <strong>und</strong><br />
Konsumenten bewusst verhalten.<br />
Aber auch bei uns in der Schweiz müssen wir zu unseren Gewässer Sorge tragen. Auch<br />
hier ist ein Ausgleich der verschiedenen Interessen nötig. Deshalb fördern wir in der Region<br />
die Revitalisierung der Gewässer <strong>und</strong> die Verbesserung der Situation für Wanderfi sche<br />
wie der Lachs. Ich möchte an dieser Stelle dem Kantonalen <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>und</strong> deren<br />
Mitgliedsorganisationen für ihr wertvolles Engagement danken. Sie leisten gerade mit dieser<br />
Ausstellung eine wichtige Aufklärungsarbeit.<br />
Christoph Brutschin<br />
Regierungsrat des Kantons <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong><br />
Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales <strong>und</strong> Umwelt<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Liebe Besucher<br />
Liebe Mitglieder<br />
Liebe Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Bekannte des KFVBS<br />
Geschätzte Damen <strong>und</strong> Herren<br />
Die Schweiz ist ein Gebirgsland mit Wiesen <strong>und</strong> Weiden <strong>und</strong> Kühen – <strong>und</strong> mit einer zunehmenden<br />
Vorliebe für Meeresfrüchte. Über 9 Kilogramm <strong>Fisch</strong>, Krustentiere <strong>und</strong> Muscheln<br />
verspeisen wir pro Kopf <strong>und</strong> Jahr. Allein in den vergangenen drei Jahren hat der Konsum<br />
um ein Viertel zugenommen – auf gesamthaft 71 000 Tonnen. Doch viele der Meeres-Delikatessen<br />
benötigen dringend eine Auszeit. Der weitaus grösste Teil der <strong>Fisch</strong>erei basiert<br />
nämlich nicht auf dem Prinzip der <strong>Nachhaltigkeit</strong>. Leider kursieren zum Thema <strong>Fisch</strong> oft<br />
falsche Vorstellungen <strong>und</strong> zahlreiche fatale Irrtümer.<br />
Mit unserer Sonderausstellung <strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong> wollen wir Ihnen Informationen<br />
<strong>und</strong> Einblicke geben <strong>und</strong> Sie in den Ausstellungsbereichen für das komplexe Thema sensibilisieren.<br />
Die Vereine des Kantonalen <strong>Fisch</strong>erei-<strong>Verband</strong>s <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS freuen sich, Ihnen<br />
das Beiheft zur Sonderausstellung – <strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong> zu präsentieren.<br />
Wir bedanken uns beim BAFU B<strong>und</strong>esamt für Umwelt in Bern, beim Lotteriefonds <strong>Basel</strong>-<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> bei unseren Partnern <strong>und</strong> Sponsoren für die Unterstützung.<br />
Ein spezielles Dankeschön dem Modell-Schiffbau-Club <strong>Basel</strong> mscb für seine fi ligranen<br />
Modellarbeiten, dem Wissenschaftsjournalisten Gregor Klaus, welcher uns Textmaterial<br />
zur Verfügung gestellt hat, dem Zoo <strong>Basel</strong> für die Meerfi sche, dem <strong>Fisch</strong>ereiaufseher <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong><br />
für die Unterstützung beim <strong>Fisch</strong>transport, der Aquakultur Frutigen für die Störe<br />
<strong>und</strong> dem Internationalen Maritimen Museum Hamburg, welches uns mit Leihmaterial <strong>und</strong><br />
Software geholfen hat.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>erei-<strong>Verband</strong> <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong><br />
Vorstand KFVBS<br />
www.basler-fi scherei.ch<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
7
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
8<br />
Verharren Sie einen Moment<br />
Sie sehen in unserer Ausstellung das Modell einer der majestätischsten Tiere der Welt. Einen<br />
grossen weissen Hai. Unter Experten gilt er bereits als biologisch ausgestorben! Dies<br />
ist ein Beispiel für unzählige Tierarten der Meere, die durch die Menschen ausgelöscht<br />
werden. Das Ökosystem der Meere steht vor dem Kollaps. Denken Sie nach! Brauchen wir<br />
die Meere zum Überleben unserer Art?<br />
Mahnmal aus dem Roten Meer / Shark-Projekt.<br />
- ISST- man so etwas wirklich?<br />
Die Flosse wird abgeschnitten <strong>und</strong> den sterbenden Hai schmeisst<br />
man zurück ins Meer!<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Inhalt<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
Seite<br />
<strong>Fisch</strong>fang 10<br />
Fangmethoden 11<br />
Schiffstypen 13<br />
Überfischung 14<br />
Aquakultur 16<br />
Bedrohte <strong>Fisch</strong>e 17<br />
Wanderfische 18<br />
Lebendes Fossil in Not 20<br />
Aquakultur im Binnenland 21<br />
Ungewohnte <strong>Fisch</strong>e in Aquakultur 24<br />
Häufige Irrtümer um den <strong>Fisch</strong>fang 25<br />
Positive Entwicklungen <strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong> 28<br />
Wir sind alle gefordert, «aufmerksam» zu sein 32<br />
Unser Leitbild 34<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
9
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
10<br />
<strong>Fisch</strong>fang<br />
<strong>Fisch</strong>erei ist für Millionen von Menschen die Existenzgr<strong>und</strong>lage.<br />
Aber: Laut Welternährungsorganisation FAO<br />
sind weltweit 52% der <strong>Fisch</strong>bestände bis an ihre maximal<br />
nutzbare Grenze befi scht; 17% überfi scht <strong>und</strong> 7%<br />
der kommerziell wichtigen <strong>Fisch</strong>arten erschöpft.<br />
<strong>Fisch</strong>fang seit Menschengedenken<br />
Seit Urzeiten fängt der Mensch <strong>Fisch</strong>. Entlang der Küsten, Flüsse <strong>und</strong> Seen war er die<br />
Hauptnahrung. <strong>Fisch</strong>fang gab es schon in der Altsteinzeit. Felsenmalereien prähistorischer<br />
Zeit <strong>und</strong> Reliefbilder in Grabkammern zeigen die Bedeutung des <strong>Fisch</strong>es. Homer besingt<br />
im 8. Jh. v. Chr. den <strong>Fisch</strong>fang. Platon (427-347 v. Chr.) beschreibt Fangtechniken: <strong>Fisch</strong>en<br />
mit dem Netz, dem Stab, der Reuse <strong>und</strong> dem Angelhaken. Nach dem römischen Schriftsteller<br />
Aelian (2. Jh. n. Chr.) ist das <strong>Fisch</strong>en mit Stock, Speer, Dreizack oder mehrzinkiger<br />
Harpune die männlichste <strong>und</strong> mutigste Fangmethode.<br />
Die <strong>Fisch</strong>erei war lange Zeit ein Erwerbszweig, der in kleinem Rahmen betrieben wurde,<br />
Kommerzieller <strong>Fisch</strong>fang<br />
Heute wird <strong>Fisch</strong>fang überwiegend industriell betrieben: Etwa 3,5 Mio. große <strong>und</strong> kleine<br />
Fangschiffe der Hochsee-, Küsten- <strong>und</strong> Binnenfi scherei bringen jährlich Millionen Tonnen<br />
<strong>Fisch</strong> an Land. Nur etwa zwei Drittel kommen auf den Teller, ein Drittel wandert in die<br />
<strong>Fisch</strong>mehlfabriken <strong>und</strong> wird zu Tierfutter verarbeitet. Zwischen 17 <strong>und</strong> 39 Mio. Tonnen <strong>Fisch</strong>e<br />
<strong>und</strong> andere Meerestiere werden als Beifang wieder über Bord geworfen.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Fangmethoden<br />
Sardinen, die im offenen Meer schwimmen, müssen auf<br />
andere Weise gefangen werden als etwa Seezungen, die<br />
am Meeresgr<strong>und</strong> leben, oder Thunfi sche, die in Schwärmen<br />
unterwegs sind. Es gibt verschiedene Fangmethoden;<br />
Hightech <strong>und</strong> Satellitenkommunikation unterstützen<br />
das Aufspüren der <strong>Fisch</strong>e. Auch Flugzeuge oder Hubschrauber<br />
werden eingesetzt.<br />
Schleppnetze<br />
<strong>Fisch</strong>arten, die im offenen Meer leben, wie Heringe oder Makrelen, werden mit einem<br />
breiten Schleppnetz gefangen – von einem oder zwei Booten (Trawler) nachgeschleppt.<br />
Schwimmer oben <strong>und</strong> Gewichte unten halten es offen. Schleppnetze verschiedenster Art<br />
sind bis zu 70 m lang mit einer bis zu 100 m breiten Öffnung. Für den Fang von Plattfi schen<br />
etwa werden Gr<strong>und</strong>schleppnetze verwendet.<br />
<strong>Fisch</strong>en mit dem Schleppnetz<br />
Treibnetze<br />
Ein Treibnetz ist für <strong>Fisch</strong>e wie eine unsichtbare Wand. Die senkrecht schwimmenden,<br />
rechteckigen Netztücher reichen von 26 m (Heringsfang) bis zu 100 km Länge (Thunfi schfang).<br />
Die <strong>Fisch</strong>e bleiben mit den Köpfen in den Netzmaschen hängen. Delfi ne, Haie <strong>und</strong><br />
Meeresschildkröten verenden ebenfalls in den Netzen, weshalb diese weltweit geächtet<br />
sind. Die UN verbot ihren Einsatz 1991. In der EU galt bis Ende 2001 eine Ausnahmeregelung<br />
für bis zu 2,5 km lange Treibnetze. 2002 wurde ihr Einsatz verboten. Dennoch<br />
schätzte die Umweltschutzorganisation Greenpeace für 2006 allein im Mittelmeer 400 bis<br />
500 Treibnetzfi scher.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
11
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
12<br />
<strong>Fisch</strong>en mit der<br />
Ringwade; Reuse<br />
<strong>Fisch</strong>en mit der<br />
Langleine<br />
Ringwaden<br />
Die bis zu 2000 m langen <strong>und</strong> bis in eine Tiefe von 200 m reichenden Netze werden<br />
in der Hochseefi scherei benutzt, vor allem für den Fang von Schwarmfi schen<br />
wie Hering, Sardine, Makrele oder Thunfi sch. Die Ringwade wird ringförmig um<br />
einen <strong>Fisch</strong>schwarm ausgelegt, dann mit der unteren Leine zugezogen. Der gesamte<br />
<strong>Fisch</strong>schwarm ist mit einem Schlag gefangen. Problem: hohe Beifänge<br />
von Delfi nen, Schildkröten <strong>und</strong> jungen Thunfi schen.<br />
Korb-(Reusen-)fischerei<br />
Krebse, Hummer, Langusten <strong>und</strong> Garnelen werden in zylindrischen oder quadratischen<br />
Körben (Reusen) aus Holz, Korbgefl echt oder Metall gefangen. Sie werden per Leine vom<br />
Meeresboden eingeholt.<br />
Langleinen<br />
Ringwade<br />
Langleinen<br />
Reuse<br />
Eines der ältesten <strong>Fisch</strong>fanggeräte ist der Angelhaken. Auch in der kommerziellen <strong>Fisch</strong>erei<br />
wird er eingesetzt – bis zu 20 000 an unzähligen Schnüren entlang einer bis zu 130 km<br />
langen Hauptleine. So werden Kabeljau, Schwarzer Seehecht, Thunfi scharten, Heilbutt<br />
<strong>und</strong> Haie gefangen. Problem: Während des Setzens der Leinen stürzen sich oft Seevögel<br />
auf die Köder. Beim Absinken der Leine hängen sie am Haken <strong>und</strong> ertrinken. Rochen <strong>und</strong><br />
Meeresschildkröten fallen den Langleinen ebenfalls zum Opfer.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Schiffstypen<br />
1885 lief der erste deutsche <strong>Fisch</strong>dampfer, die «Sagitta»,<br />
zum <strong>Fisch</strong>fang auf hoher See aus. Heute werden<br />
in der Hochseefi scherei Logger, Trawler <strong>und</strong> <strong>Fisch</strong>fabrikschiffe<br />
eingesetzt. Logger sind 30 bis 40 m lange<br />
Schiffe, die das Netz meist von der Schiffsseite aus- <strong>und</strong><br />
wieder einbringen. Ihre Gesamttonnage liegt bei gut<br />
300 Bruttoregistertonnen (BRT). Fabrikschiffe erreichen<br />
2700 bis 3200 BRT. Der <strong>Fisch</strong>dampfer «Sagitta» kam auf<br />
148 BRT.<br />
Kutter<br />
<strong>Fisch</strong>kutter oder auch Krabbenkutter sind im Gegensatz zu Trawlern kleinere Motorschiffe<br />
für die Küstenfi scherei <strong>und</strong> die kleine Hochseefi scherei.<br />
Trawler<br />
Hecktrawler haben das Fangdeck im Bereich des Achterschiffes, Seitentrawler im Bereich<br />
des Mittschiffes. Hecktrawler haben sich heute durchgesetzt. Die alten Segeltrawler konnten<br />
die Netze bis in 55 bis 75 m Tiefe auswerfen, moderne Trawler fi schen oft bis in eine<br />
Tiefe von 920 m. Je nach Einsatz sind sie mit Verarbeitungs- <strong>und</strong> Konservierungsanlagen<br />
ausgestattet. Sie können mehrere Wochen oder Monate auf See fi schen, bis die Lagerräume<br />
komplett gefüllt sind.<br />
Fabrikschiff<br />
oben: einfahrende <strong>Fisch</strong>kutter<br />
rechts: die «Bremen» ein modernes<br />
Fangschiff für den internationalen<br />
Einsatz<br />
Auf den großen Hochseefi schereischiffen kann der Fang direkt an Bord zerlegt, fi letiert<br />
<strong>und</strong> ausgenommen, verpackt <strong>und</strong> tiefgefroren werden. Fabrikschiffe verarbeiten in einer<br />
einzigen St<strong>und</strong>e mehr <strong>Fisch</strong> als ein <strong>Fisch</strong>erboot im 16. Jh. in einer gesamten Saison einholen<br />
konnte. Eines der größten Fabrikschiffe der Welt ist die «Atlantic Navigator». Das<br />
4 065-t-Schiff ist 96 m lang mit 200 Mann Besatzung. Gearbeitet wird in zwei Schichten à<br />
100 Mann. Der Supertrawler kann bis zu 1 200 t <strong>Fisch</strong> täglich fangen.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
13
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
14<br />
Fang im Schleppnetz<br />
Überfi schung<br />
Die Welternährungsorganisation FAO der Vereinten Nationen<br />
warnt vor Überfi schung der Meere. Überfi schte<br />
Meere sind vor allem der Südost-Atlantik, der Südost-<br />
Pazifi k, der Nordost-Atlantik sowie die Lebensräume der<br />
Thunfi scharten im Atlantik <strong>und</strong> Indischen Ozean. Laut<br />
FAO-Bericht 2007 hat der <strong>Fisch</strong>fang die Rekordmenge<br />
von 95 Mio. Tonnen pro Jahr erreicht. 85,8 Mio. Tonnen<br />
kommen aus dem Meer, 9,2 Mio. Tonnen aus Binnengewässern.<br />
Von den Beständen in den Weltmeeren sind<br />
17% überfi scht. Am stärksten sind Riesenhaie, Kabeljau,<br />
Seehecht, Granatbarsch <strong>und</strong> Roter Thunfi sch bedroht.<br />
«Im Jahr 2048 gibt es keinen <strong>Fisch</strong> mehr»<br />
14 Meeresbiologen <strong>und</strong> Wirtschaftswissenschaftler haben die Entwicklung der <strong>Fisch</strong>bestände<br />
in den Weltmeeren über die vergangenen r<strong>und</strong> 50 Jahre analysiert. Ihr Fazit: «Wenn<br />
der Artenverlust im Meer weiter so anhält wie heute, dann werden wir noch erleben, dass<br />
es keinen Seefi sch mehr gibt – noch vor dem Jahr 2050. Das Ende der <strong>Fisch</strong>erei ist also in<br />
Sicht, <strong>und</strong> wir sollten etwas dagegen tun», so Boris Worm von der Dalhousie University im<br />
kanadischen Halifax. Und Carl Folke, Professor für Naturressourcen-Management an der<br />
Universität Stockholm, meint: «Man schaut nicht auf das Ökosystem, in das eine <strong>Fisch</strong>art<br />
eingeb<strong>und</strong>en ist. Das muss sich ändern. Wir dürfen das Meer nicht länger als riesige Lagerstätte<br />
ansehen, aus dem wir nach Belieben Ressourcen herausholen können!» (Quelle:<br />
FAO; Deutschlandfunk)<br />
Die Kabeljaufi scherei <strong>und</strong> ihre Entwicklung<br />
In 1000 Tonnen<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Laichbiomasse<br />
Gesamtfang<br />
B pa = Vorsorgereferenzpunkt<br />
Grenzwert für die Laichbiomasse.<br />
Wird er unterschritten, besteht die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass B lim erreicht wird.<br />
B lim = Limitreferenzpunkt<br />
Grenzwert für die Laichbiomasse. Unterhalb<br />
von Blim ist nicht mehr gewährleistet, dass<br />
sich der Bestand erholen kann. B pa<br />
0<br />
1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
B lim
Steinbutt <strong>und</strong> Scholle – sinkende Fangmasse<br />
Der Steinbutt ist ein Plattfi sch. Seine Augen liegen auf seiner linken Körperfl anke. Die Unterseite<br />
(rechte Körperfl anke) ist weiß, die schuppenlose Oberseite passt sich an die Umgebung<br />
an <strong>und</strong> ist mit großen Knochenhöckern versehen, die wie kleine Steine aussehen,<br />
von denen der <strong>Fisch</strong> seinen Namen erhalten hat.<br />
Der Steinbutt lebt an den europäischen Küsten des Atlantischen Ozeans, des Mittelmeeres<br />
sowie der Nord- <strong>und</strong> Ostsee auf Sand <strong>und</strong> Geröll in Tiefen von 20 bis 70 Metern. Er erbeutet<br />
vornehmlich am Boden lebende kleine <strong>Fisch</strong>e, aber auch Krebse <strong>und</strong> Weichtiere. Der<br />
fast kreisr<strong>und</strong>e, schuppenlose, sehr geschätzte Speisefi sch erreicht eine durchschnittliche<br />
Länge von 50 bis 70 Zentimetern, wird seltener auch bis zu einem Meter lang, wobei er<br />
dann ein Gewicht von mehr als 20 Kilogramm erreicht. Im Handel wird er auch als Turbutt<br />
bezeichnet (die englische <strong>und</strong> französische Bezeichnung lautet «turbot»).<br />
Steinbutt (links) <strong>und</strong> Scholle (rechts) zwei beliebte Plattfi sche in Atlantik, Nordsee, Ostsee <strong>und</strong> Mittelmeer,<br />
Die Scholle oder der Goldbutt gehört zur Ordnung der Plattfi sche. Der Name wurde erst im<br />
16. Jahrh<strong>und</strong>ert geprägt, im Bezug zur «Scholle» (Gr<strong>und</strong>, Boden).<br />
Die Scholle trägt die Augen auf der rechten Körperfl anke. Die Augenseite ist braun, gelegentlich<br />
grau-braun <strong>und</strong> mit charakteristischen orange-rötlichen Punkten gesprenkelt<br />
(Zweitname «Goldbutt», sie gehört aber nicht zu den – linksäugigen – Butten).<br />
Schollen kommen an fast allen europäischen Küsten vor: vom Weißen Meer bis zur portugiesischen<br />
Atlantikküste, aber auch in Nord- <strong>und</strong> westlicher Ostsee, sowie im westlichen<br />
Mittelmeer. Die schwarmbildende Scholle lebt über Sand- <strong>und</strong> Schlickgr<strong>und</strong> in Tiefen von<br />
1 bis 200 Meter, im Mittelmeer auch bis 400 Meter Tiefe.<br />
Die Scholle ist in der Lage, sich zur Tarnung dem Untergr<strong>und</strong> farblich anzupassen <strong>und</strong><br />
gräbt sich außerdem bei Gefahr durch Schlagen des Flossensaums (aus Rücken- <strong>und</strong><br />
Afterfl osse) oberfl ächlich in den Sand ein.<br />
Ausgewachsene Schollen haben eine Körperlänge von 40 bis maximal 70 Zentimeter. Sie<br />
werden bis zu 45 Jahre alt <strong>und</strong> wiegen dann bis zu 7 Kilogramm.<br />
Kleinere <strong>Fisch</strong>e als Folge der Übernutzung<br />
Die Scholle ist einer der wirtschaftlich wichtigsten Speisefi sche. Es werden weltweit<br />
100 000 bis 120 000 Tonnen pro Jahr hauptsächlich mit dem Schleppnetz gefangen. Die<br />
späte Geschlechtsreife der <strong>Fisch</strong>e führt unter der Bedingung der starken Befi schung zu<br />
ständig abnehmendem Bestand. Früher wurden gelegentlich bis zu 50 Jahre alte Schollen<br />
von knapp einem Meter Länge <strong>und</strong> einem Gewicht von 7 Kilogramm gefangen; heute liegen<br />
die durchschnittlichen Fanggrößen hingegen bei 25 bis 40 Zentimeter. Damit werden<br />
große Teile der Schollenpopulationen bereits vor der Geschlechtsreife gefangen. Dies führt<br />
vielerorts zu einer Überfi schung der Bestände. Überfi schung führt in der Regel zu tiefen<br />
Beständen, nicht aber zur Ausrottung von Arten.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
15
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
16<br />
Aquakultur<br />
Hier werden Meerestiere, Süß- oder Salzwasserfi sche unter kontrollierten Bedingungen<br />
gezüchtet. Aquakultur ist ein stark wachsender Industriezweig: Etwa 46 Mio. Tonnen <strong>Fisch</strong><br />
<strong>und</strong> Meeresfrüchte stammen aus Zuchtanlagen. Weltweit werden über 200 <strong>Fisch</strong>arten,<br />
Muscheln, Krustentiere, Reptilien, Amphibien <strong>und</strong> Algenarten außerhalb ihrer natürlichen<br />
Lebensräume gezüchtet. Etwas mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion fi ndet im<br />
Salzwasser an den Küsten statt, davon 90 % in Asien, 4 % in Europa, 2 % in Südamerika.<br />
Probleme der konventionelle Aquakultur: Die Tiere haben wenig Platz, sind anfällig für<br />
Krankheiten <strong>und</strong> bekommen Antibiotika. Chemikalien werden gegen Algenwuchs eingesetzt.<br />
70 % des weltweit produzierten <strong>Fisch</strong>öls <strong>und</strong> 34 % des <strong>Fisch</strong>mehls werden laut einer<br />
WWF-Studie in Aquakulturen verfüttert. Demnach sind etwa 4 kg frei lebender <strong>Fisch</strong> für<br />
1 kg <strong>Fisch</strong>fl eisch aus Aquakultur nötig.<br />
Immer mehr <strong>Fisch</strong>e aus Aquakultur<br />
Mio. Tonnen <strong>Fisch</strong>fang Aquakultur weltweit ohne China Aquakultur<br />
70<br />
2020<br />
(Prognose)<br />
60<br />
50<br />
1985<br />
1990<br />
1996 2001<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
1973<br />
oben: «Karpfenernte» in der Aquakultur<br />
links: Aquakultir in Asien<br />
unten: Austernzucht auf Sylt<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Bedrohte <strong>Fisch</strong>e<br />
«Der <strong>Fisch</strong> ist in der Schweiz ist nicht betroffen!»<br />
Falsch! Verantwortung für <strong>Fisch</strong>e betrifft nicht nur unseren<br />
Umgang mit den Meeres-Delikatessen. Die meist<br />
bedrohte Tiergruppe in der Schweiz sind die <strong>Fisch</strong>e. Ihre<br />
Lebensräume sind bedroht.<br />
Von ursprünglich 55 in der Schweiz heimischen <strong>Fisch</strong>arten sind: 8 ausgestorben, 6 vom<br />
Aussterben bedroht, 5 stark gefährdet, 13 verletzlich, 9 potenziell gefährdet. Nur gerade 14<br />
<strong>Fisch</strong>arten (25 %) sind nicht gefährdet.<br />
nicht gefährdet:<br />
14 Arten<br />
potenziell<br />
gefährdet: 9 Arten<br />
Gefährdungseinstufung der 55 <strong>Fisch</strong>arten der Schweiz.<br />
Die Überfischung ist nicht der Gr<strong>und</strong><br />
Wenn im fein abgestimmten Gleichgewicht zwischen Lebensraum <strong>und</strong> <strong>Fisch</strong> Unstimmigkeiten<br />
auftreten, wird der <strong>Fisch</strong> gestört. Er wandert in einen geeigneteren Lebensraum ab<br />
oder stirbt im schlimmsten Fall lokal aus. In der Schweiz sind 75% der vorkommenden<br />
<strong>Fisch</strong>arten in ihrem Bestand mehr oder weniger stark bedroht oder ausgestorben. Speziell<br />
sind die Wanderfi sche betroffen.<br />
Gefährdungsursachen<br />
Vor dem Bau der Kläranlagen war es hauptsächlich der knappe Sauerstoff, der die <strong>Fisch</strong>e<br />
schädigte, heute nimmt die Bedeutung hormonähnlicher Substanzen <strong>und</strong> anderer<br />
Mikroverunreinigungen zu. Seit dem 19. Jahrh<strong>und</strong>ert wurden zudem Gewässer in grossem<br />
Massstab korrigiert <strong>und</strong> verbaut. Wichtige Strukturen der Lebensräume sind in der Folge<br />
verschw<strong>und</strong>en. Weitere Gefährdungsursachen können sein: das Aussetzen gebietsfremder<br />
<strong>Fisch</strong>arten <strong>und</strong> fi schfressende Vögel. Falsch verstandene Tierliebe ist es auch, <strong>Fisch</strong>e<br />
aus dem Aquarium im nächstbesten Weiher einzusetzen, wo sie die Amphibien bedrohen.<br />
Handlungsbedarf: Schutz <strong>und</strong> Förderung<br />
ausgestorben:<br />
8 Arten<br />
verletzlich:<br />
13 Arten<br />
vom Aussterben<br />
bedroht: 6 Arten<br />
ausgestorben<br />
vom Aussterben bedroht<br />
stark gefährdet<br />
verletzlich<br />
potentiell gefährdet<br />
nicht gefährdet<br />
stark gefährdet:<br />
5 Arten<br />
Um diesem <strong>Fisch</strong>rückgang entgegen zu wirken, sind zum Beispiel die Nase <strong>und</strong> der Rheinlachs<br />
geschützt <strong>und</strong> dürfen nicht befi scht werden. Die älteste Massnahme zur Förderung<br />
der <strong>Fisch</strong>e ist der Besatz. Mit dem künstlichen Ausbrüten <strong>und</strong> der Aufzucht von Jungfi -<br />
schen soll der fehlende Laicherfolg überbrückt oder eine starke Befi schung ausgeglichen<br />
werden. Zur Zeit werden in der Region <strong>Basel</strong> die folgenden <strong>Fisch</strong>arten durch Besatz gefördert:<br />
Bachforelle, Lachs, Nase.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
17
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
18<br />
Wanderfi sche<br />
Wanderfi sche wechseln den Lebensraum während der<br />
unterschiedlichen Phasen ihres Lebenszyklusses. Barrieren<br />
oder Bereiche mit einer Filterwirkung, die nur<br />
schwer passierbar sind, stellen für Wanderfi sche eine<br />
zusätzliche Beeinträchtigung dar.<br />
Bei Wanderfi schen sind die Orte, die sie in verschiedenen Phasen ihres Lebens aufsuchen<br />
räumlich weit getrennt. Am einen Orten suchen sie beispielsweise Nahrung am anderen<br />
geeignete Brutplätze. Bei Langdistanzwanderfi schen fi ndet ein Teil des Lebenszyklusses<br />
gar in den Weltmeeren statt. Sie werden unterschieden in anadromen Arten, welche die<br />
Flüsse hinauf in ihre Laichgebiete schwimmen <strong>und</strong> die katadromen Arten, die zur Fortpfl anzung<br />
fl ussabwärts ins Meer ziehen.<br />
Langdistanz-Wanderfische<br />
Von den folgenden Langdistanz-Wanderfi schen sind alle heute ausgestorben bis auf den<br />
Aal, der sich jedoch nur dank Besatz gehalten hat: Lachs, Meerforelle, Maifi sch, Stör,<br />
Flussneunauge, Meerneunauge <strong>und</strong> Aal.<br />
Ursprünglich in der Schweiz heimische Langdistanz-<br />
Wanderfi sche (von oben links nach unten rechts):<br />
Lachs, Meerforelle, Maifi sch, Stör, Flussneunauge,<br />
Meerneunauge <strong>und</strong> Aal.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Kurzdistanz-Wanderfische<br />
Kurzdistanz-Wanderfi sche legen innerhalb des Binnengewässernetzes teilweise ansehnliche<br />
Strecken zwischen verschiedenen Teillebensräumen zurück. Zu den in der Region<br />
<strong>Basel</strong> heimischen <strong>und</strong> gefährdeten Arten gehören: Äsche, Nase, Barbe, Strömer <strong>und</strong> teilweise<br />
die Bachforelle<br />
Auch nicht wandernde <strong>Fisch</strong>arten wechseln generell zwischen verschiedenen Teillebensräumen<br />
hin <strong>und</strong> her, doch ist die Distanz dazwischen meist gering. Ein Beispiel ist das<br />
Bachneunauge, das sich als Querder (Jugendstadium) im sandig-schlammigen Sediment,<br />
als Adulttier auf der kiesigen Gewässersohle aufhält.<br />
Ursprünglich in der Region <strong>Basel</strong> heimische Kurzdistanz-Wanderfi<br />
sche (von oben links nach unten<br />
rechts): Äsche, Nase, Barbe, Strömer <strong>und</strong> Bachforelle.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
19
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
20<br />
Lebendes Fossil in Not<br />
Zu den Süsswasserfi schen, die selbst Angler nur vom<br />
Hörensagen kennen, gehört der Stör. Einzeltiere dieser<br />
urzeitlichen <strong>Fisch</strong>art sind früher im Rhein bis <strong>Basel</strong><br />
hoch gewandert. Wo er im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert noch vorgekommen<br />
ist, hat man den Weibchen nachgestellt. Als<br />
Kaviar sind die Eier des Störs eine sehr gefragte Delikatesse.<br />
Sie stammen heute wegen der Überfi schung praktisch<br />
nur noch aus der Zucht.<br />
Urtümliche <strong>Fisch</strong>art<br />
Es gibt <strong>Fisch</strong>e im Süsswasser, die kennen selbst Angler nur aus Lehrbüchern oder vom<br />
Hörensagen. Eine dieser zoologischen Raritäten ist der Stör. Die haiartige Schwanzfl osse<br />
verrät, dass die Art mit einem Alter von 200 Millionen Jahren zu den stammesgeschichtlich<br />
ältesten Knochenfi schen gehört. Der Gemeine Stör lebt überwiegend in den Flüssen der<br />
nördlichen Atlantik- <strong>und</strong> Ostseeküste. Weitere Arten kommen im Schwarzen <strong>und</strong> Kaspischen<br />
Meer oder in den Nordrussischen Flusssystemen vor. Der älteste verbürgte Bericht<br />
über den Stör stammt vom griechischen Schriftsteller Herodot, der den Riesenfi sch bereits<br />
450 v.Chr. erwähnt hat.<br />
Der eigenartige Körperbau wie zum Beispiel die schuppenlose, mit einigen<br />
Knochplatten belegte Haut zeigen, dass der Stör stammesgeschichtlich<br />
sehr alt ist.<br />
Stark bedrohter Wanderfisch<br />
Der Gemeine oder Baltische Stör erreicht eine Länge von etwa 2,5 Metern <strong>und</strong> ein Gewicht<br />
von 110 kg. Sehr alte Tiere mit 6 Meter Länge <strong>und</strong> bis 1000 kg Gewicht gibt es heute nicht<br />
mehr.<br />
Der Atlantische Stör ist ein anadromer Wanderer, der sich die meiste Zeit im Meer über<br />
dem Kontinentalschelf aufhält. Zur Laichzeit nehmen die Tiere weite Strecken auf sich <strong>und</strong><br />
wandern die Flüsse hoch. Je nach Gebiet beginnt die Laichzeit zwischen Februar <strong>und</strong> Juli.<br />
Er legt seine Eier im tiefen strömenden Wasser auf steinigem Gr<strong>und</strong> ab. Die jungen Störe<br />
bleiben nach dem Schlüpfen für etwa 3 bis 5 Jahre in den Flussgebieten, bevor sie zu ihrer<br />
ersten Wanderung ins Meer aufbrechen. Der früher gelegentlich bis in die Region <strong>Basel</strong><br />
wandernde Stör ist heute in der Schweiz ausgestorben, im Niederrhein selten wie die blaue<br />
Mauritius <strong>und</strong> wertvoll wie die englische Königskrone.<br />
Staustufen <strong>und</strong> Fang als Bedrohung<br />
Mit den Barteln erk<strong>und</strong>et der Stör den Gewässergr<strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> lässt alles Essbare in seinem unterständigen<br />
M<strong>und</strong> verschwinden.<br />
Die Art war im Hochrhein immer eine Rarität. Aus der Zeit von 1586 – 1854 sind lediglich<br />
7 Nachweise bekannt. Der Stör war so selten, dass er in <strong>Basel</strong> gegen Entgelt zur Schau<br />
gestellt wurde. Eine natürliche Ausbreitungsbarriere stellten vermutlich die Stromschnellen<br />
von Laufenburg dar. Selbst in den Flusssystemen Russlands, wo der Stör noch lange häufi<br />
g war, ist er als Folge der intensiven Befi schung heute fast ausgestorben.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Aquakultur im Binnenland<br />
Auch im Binnenland werden <strong>Fisch</strong>e in Aquakultur gezüchtet<br />
<strong>und</strong> aufgezogen. Da die Gewässer abgeschlossen<br />
sind, können die Lebensbedingungen besser kontrolliert<br />
werden. Verluste <strong>und</strong> Beeinträchtigungen der <strong>Fisch</strong>e<br />
werden auf diese Weise verkleinert <strong>und</strong> der Ertrag<br />
erhöht.<br />
Die einzelnen Schritte der Aquakultur umfassen in der Regel alle Lebensphasen von der<br />
Befruchtung der Eier, dem Ausbrüten der Eier über die Aufzucht der Jungfi sche bis zum<br />
Fang der <strong>Fisch</strong>e.<br />
Viele Pächter von <strong>Fisch</strong>gewässern wie der Kantonale <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> ziehen<br />
selbst Eier von Bachforellen (Salmo trutta fario) auf. Wirtschaftlich interessant für professionelle<br />
<strong>Fisch</strong>züchter in der Region ist hauptsächlich die Regenbogenforelle (Oncoryhnchus<br />
mykiss).<br />
Streifen der Elterntiere<br />
Beim Streifen von Rognern (weibliche Tiere) <strong>und</strong> Milchnern (männliche Tiere) werden den<br />
laichbereiten Tieren durch leichten Druck auf den Bauch die Eier (Rogen) <strong>und</strong> die Spermien<br />
(Milch) ausgepresst. Aus Rognern der Forelle mit einem Gewicht von 2 kg können bis<br />
3500 Eier gewonnen werden.<br />
Die befruchteten Eier werden mit sauberem Wasser gewaschen <strong>und</strong> anschliessend in Einheiten<br />
von 10 000 auf die Brutkästen verteilt.<br />
Die Wassertemperatur bestimmt das Entwicklungstempo der Eier. Die ideale Wassertemperatur<br />
für das Erbrüten liegt zwischen 4 <strong>und</strong> 11°C. Temperaturen aussserhalb dieses<br />
Bereichs können Verluste bis 30% sowie Fehlentwicklungen <strong>und</strong> Missbildungen verursachen.<br />
Die Eientwicklung der Regenbogenforellen dauert 360 Tagesgrade, das heisst bei konstant<br />
10°C vergehen von der Befruchtung bis zum Schlüpfen 36 Tage. Das Augenpunktstadium<br />
tritt nach 200 bis 220 Tagesgraden ein. Bis zu dieser Entwicklungsphase sind die Eier sehr<br />
empfi ndlich <strong>und</strong> sollten nicht transportiert oder berührt werden.<br />
Abstreifen der Eier eines Rogners der Forelle (links) <strong>und</strong> Augenpunktstadium bebrüteter Eier (rechts).<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
21
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
22<br />
Pflege der Forellenbrut<br />
Nachdem innerhalb von 2 bis 3 Tagen (bei 10°C Wassertemperatur) alle Eier geschlüpft<br />
sind, müssen die Eischalen mit einem Saugball vorsichtig herausgenommen werden, um<br />
das Verstopfen der Siebeinsätze im Ablauf der Unterstromkästen zu vermeiden. Oftmals<br />
müssen die Siebe jetzt zweimal pro Tag gereinigt werden.<br />
Die geschlüpften <strong>Fisch</strong>chen besitzen einen Dottersack, der zu Beginn noch grösser als das<br />
Tier selbst ist. Der Züchter nennt dies die «Dottersackbrut». Dottersackbrütlinge ernähren<br />
sich während 12 – 15 Tage einzig aus ihrem Dottervorrat. Dieser enthält alle forellenspezifi<br />
schen, lebensnotwendigen Nährstoffe. Die Brutkasteneinsätze werden während der<br />
Dottersackphase abgedeckt gehalten, damit die Zuchtbedingungen den Verhältnissen im<br />
Gewässer möglichst gut entsprechen. In freier Natur leben die Brütlinge in den Zwischenräumen<br />
der Kiessohle.<br />
Augenpunktstadium<br />
leben in Zwischenräumen<br />
der Kiessohle<br />
Haben die Forellenbrütlinge etwa 90% ihres Dottervorrats aufgezehrt, beginnt man mit der<br />
Fütterung. Diese Phase dauert r<strong>und</strong> 10 – 15 Tage. Danach können die heranwachsenden<br />
Brütlinge grössere Futterbrocken aufnehmen. Die Nahrung besitzt einen hohen Proteingehalt<br />
von 49%, um der natürlichen Kost aus Gewässerkleintieren wie Bachfl ohkrebsen<br />
möglichst nahe zu kommen.<br />
Hälterung <strong>und</strong> Fütterung von Jungforellen<br />
Dottersackstadium<br />
Wenn die Jungforellen auf eine Länge von r<strong>und</strong> 6 cm angewachsen sind, werden sie vom<br />
Langstrombecken in R<strong>und</strong>strombecken oder direkt in einen Aufzuchtweiher überführt. Das<br />
R<strong>und</strong>becken ermöglicht dem Züchter eine bessere Kontrolle der <strong>Fisch</strong>e als im Weiher. Bei<br />
den R<strong>und</strong>becken werden nur zirka 1000 – 1500 Jungfi sche aufgezogen, in einem Weiher<br />
je nach Grösse 20 000 – 50 000 Tiere. Nach einem Jahr haben die Forellen eine Grösse<br />
von 10 – 14 cm erreicht <strong>und</strong> mehrere Phasen an der Futterkörnung durchlaufen von 00<br />
Körnung bis 2 – 2,5 mm Körnung.<br />
Viele Pächter von <strong>Fisch</strong>gewässern wie der Kantonale <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> ziehen<br />
selbst Eier von Bachforellen (Salmo trutta fario) auf. Diese werden meist als Brütlinge<br />
oder Sömmerlinge in die Gewässer eingesetzt.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Hälterung von Brütlingen in einem Langstrombecken.<br />
Zucht von Regenbogenforellen<br />
Die Regenbogenforelle wird in erster Linie für den Konsum gezüchtet <strong>und</strong> aufgezogen.<br />
Was im Restaurant als Forelle blau oder Forelle nach Müllerin-Art serviert wird, sind in den<br />
allermeisten Fällen Regenbogenforellen aus einer Zucht.<br />
Es gibt in der Schweiz zwei Typen von <strong>Fisch</strong>zuchtbetrieben. In den klassischen Zuchtbetrieben<br />
werden die Forellen in 20 Monaten auf 300 g herangezogen. Durch Mastfutter mit<br />
einem hohen Protein- <strong>und</strong> Fettanteil kann der Züchter in einer kürzeren Zeit einen höheren<br />
Ertrag erwirtschaften.<br />
Die Biozucht muss der Werthaltung des biologischen Produktes gerecht werden. Das<br />
heisst Naturweiher, wenige <strong>Fisch</strong>e im Weiher <strong>und</strong> Fütterung mit Futter, welches aus biologisch<br />
angebauten Naturprodukten wie Getreide <strong>und</strong> Fett hergestellt wird. Deshalb sind die<br />
Kosten höher, als bei der klassischen Zucht.<br />
Für eine erfolgreiche Zucht, ob konventionell oder biologisch, sind die Hygiene <strong>und</strong> das<br />
saubere Arbeit mit den <strong>Fisch</strong>en unabdingbar <strong>und</strong> entscheiden schliesslich über den Erfolg<br />
der Bemühungen.<br />
Teich in einer <strong>Fisch</strong>zuchtanstalt (links) <strong>und</strong> Forellen im Teich (rechts).<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
23
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
24<br />
Ungewohnte <strong>Fisch</strong>e in Aquakultur<br />
Neben den Forellenzuchten gibt es in der Schweiz neu eine Eglizucht in Raron VS <strong>und</strong><br />
eine Störzucht in Frutigen BE, welche auf einen Absatz auf dem Konsummarkt ausgerichtet<br />
sind. Diese beiden innovativen Projekte verwenden Wasser, das aus dem Inneren des<br />
Lötschbergtunnels nach Süden <strong>und</strong> Norden abgeleitet wird <strong>und</strong> eine Temperatur von 18<br />
– 20°C aufweist.<br />
Die beiden Anlagen sind leistungsfähige, professionelle Produktionsstätten für die Zucht<br />
von Süsswasserfi schen. Die beiden Arten, Egli (oder Flussbarsch) <strong>und</strong> Sibirischer Stör<br />
haben sich als geeignet erwiesen.<br />
Bisher stammten lediglich 10% des Jahreskonsums von 6000 Tonnen Egli aus der Schweiz.<br />
Der Rest wurde aus Osteuropa <strong>und</strong> Russland importiert. Mit einer modernen Zucht- <strong>und</strong><br />
Verarbeitungsanlage kann der schweizerische Anteil an der Egliproduktion erhöht werden.<br />
Mit 40 Tonnen Störfl eisch <strong>und</strong> 2 – 3 Tonnen Kaviar pro Jahr kann die Zucht dazu beitragen,<br />
dass der Fangdruck auf wilde Störe kleiner wird.<br />
Betrieb zur Störzucht in Frutigen (BE). Das<br />
20° warme Wasser aus dem Lötschbergtunnel<br />
ist geeignet für die Zucht von <strong>Fisch</strong>en,<br />
die in freier Natur in wärmerem Wasser vorkommen.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Häufi ge Irrtümer um dem <strong>Fisch</strong>fang<br />
Neun Irrtümer über den <strong>Fisch</strong>bestand <strong>und</strong> den <strong>Fisch</strong>fang<br />
in den Meeren sind immer wieder zu hören. Diese häufi -<br />
gen Aussagen gehen von falschen Annahmen aus. Leider<br />
sind wir noch weit von einer nachhaltigen <strong>Fisch</strong>erei in<br />
den Weltmeeren entfernt.<br />
«Die Weltmeere sind voller <strong>Fisch</strong>»<br />
Würden die Meere nachhaltig befi scht, wäre diese Aussage absolut korrekt. Die<br />
meisten <strong>Fisch</strong>arten haben ein extrem hohes Fortpfl anzungsvermögen. Von der natürlichen<br />
Überschussproduktion kann der Mensch einen beachtlichen Teil entnehmen, ohne die Bestände<br />
zu gefährden. Die meisten <strong>Fisch</strong>bestände werden sogar produktiver, wenn sie befi<br />
scht werden. Bei vielen <strong>Fisch</strong>beständen ist die Erntemenge heute aber viel zu hoch angesetzt.<br />
Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO werden von den weltweit<br />
kommerziell genutzten <strong>Fisch</strong>beständen 52 Prozent bis an ihre Grenze genutzt, 19 Prozent<br />
sind überfi scht <strong>und</strong> 7 Prozent bereits erschöpft. Trotz immer neuer <strong>und</strong> modernerer Technologien<br />
<strong>und</strong> zunehmendem <strong>Fisch</strong>ereidruck stagniert die Fangmenge seit über zehn Jahren.<br />
Begehrte Raubfi scharten wie Thunfi sch, Schwertfi sch, Marlin, Hai <strong>und</strong> Fl<strong>und</strong>er haben<br />
einen besonders dramatischen Niedergang erlitten: Meeresbiologen schätzen, dass sie<br />
nur noch zehn Prozent der ursprünglichen Biomasse erreichen. Es muss von einer massiven<br />
Überfi schung gesprochen werden.<br />
«Überfischte Bestände können sich wieder erholen»<br />
Dieser Annahme sind Grenzen gesetzt, wie folgendes Beispiel belegt: Bis in die<br />
1970er-Jahre herrschte die Überzeugung, dass die Kabeljaubestände vor Neuf<strong>und</strong>land<br />
unerschöpfl ich seien. Dann wurden die Fangmengen immer geringer, die gefangenen <strong>Fisch</strong>e<br />
immer kleiner. 1992 geschah das Unvorstellbare: Der Kabeljau verschwand, zehntausende<br />
von <strong>Fisch</strong>ern wurden über Nacht arbeitslos. Die intensive <strong>Fisch</strong>erei hat die gesamte<br />
Nahrungskette umgekrempelt. Heute dominieren Krabben das Ökosystem. Es gibt offenbar<br />
einen «tipping point», an dem es kein Zurück mehr gibt. Noch ist bei der Mehrzahl der<br />
Bestände der Kipp-Punkt nicht erreicht. Die Bestände könnten sich also wieder erholen,<br />
wenn der <strong>Fisch</strong>ereidruck nachlassen würde. Doch <strong>Fisch</strong> hat sich zur Massenware entwickelt.<br />
Die Überkapazitäten der <strong>Fisch</strong>fangfl otten führen zusammen mit einer uneinsichtigen<br />
<strong>Fisch</strong>ereipolitik dazu, dass weiterhin zu viele Schiffe Jagd auf zu wenige <strong>Fisch</strong>e machen.<br />
Ist ein Bestand weggefi scht, weichen die <strong>Fisch</strong>er kurzerhand auf andere Arten aus. Das<br />
zeigt auch der wechselnde Inhalt der <strong>Fisch</strong>stäbchen: In der fettigen Teighülle steckte ursprünglich<br />
Kabeljau. Als dieser selten wurde, musste Seelachs in das Deckmäntelchen.<br />
Heute bestehen die <strong>Fisch</strong>stäbchen meistens aus Alaska Seelachs.<br />
«Es werden nur ganz bestimmte Arten befischt»<br />
Das ist die Mär von der effi zienten <strong>Fisch</strong>erei! Die Realität ist höchst unerfreulich: 40%<br />
dessen, was in die Netze der <strong>Fisch</strong>industrie geht, ist Beifang. Der WWF schätzt die Gesamtmenge<br />
der nebenbei <strong>und</strong> meist ungewollt gefangenen Meerestiere auf jährlich mindestens<br />
39 Millionen Tonnen. Das gesamte Spektrum der Meeresfauna wird aus dem Meer<br />
gezogen: Delfi ne, Vögel, Schildkröten, Haie, <strong>Fisch</strong>e mit wenig kommerziellem Wert, Seesterne,<br />
Muscheln <strong>und</strong> Korallen. «Die Liste ist endlos», sagt Jennifer Zimmermann, Projektleiterin<br />
Konsum <strong>und</strong> Wirtschaft beim WWF Schweiz. Ein Grossteil des Beifangs wird<br />
verletzt oder tot wie Müll ins Meer verklappt. Diese fi nsterste Seite der <strong>Fisch</strong>erei ist nicht<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
1<br />
2<br />
3<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
25
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
26<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
nur ökologisch höchst bedenklich, sondern auch ökonomischer Unsinn, weil sich auch<br />
unverkäufl iche Jungtiere wichtiger Speisefi sche im Beifang befi nden. Die gigantische Verschwendung<br />
natürlicher Ressourcen trägt damit zur Überfi schung bei.<br />
«Die Lebensgemeinschaften auf dem Meeresboden sind von der<br />
Überfischung nicht betroffen»<br />
Völlig falsch. Gr<strong>und</strong>schleppnetze können den marinen Lebensraum verwüsten. Einige<br />
Netze sind mit schweren Eisenketten ausgerüstet, die über den Seeboden gezogen werden,<br />
um <strong>Fisch</strong>e aufzuscheuchen, die am Boden leben. Der Meeresgr<strong>und</strong> wird dadurch umgepfl<br />
ügt, Korallen werden zerschlagen. Je nach Fanggerät <strong>und</strong> Beschaffenheit des Meeresbodens<br />
ist der Schaden vergleichbar mit dem Abholzen des tropischen Regenwaldes.<br />
«Eine Beschränkung der <strong>Fisch</strong>erei hätte verheerende ökonomische<br />
Konsequenzen»<br />
Das ist – mit Verlaub – Quatsch. Tatsache ist, dass die Ozeane mehr <strong>Fisch</strong> mit weniger<br />
Aufwand liefern könnten – wenn die <strong>Fisch</strong>ereien endlich nachhaltig gelenkt würden. Weltbank<br />
<strong>und</strong> FAO haben darauf hingewiesen, dass Missmanagement <strong>und</strong> Überkapazitäten<br />
dramatische wirtschaftliche Verluste für die weltweite <strong>Fisch</strong>ereiwirtschaft nach sich ziehen.<br />
Für die vergangenen drei Jahrzehnte werden die Verluste auf knapp eineinhalb Billionen<br />
Euro geschätzt. Dazu ein Beispiel: Hätte die EU sich rechtzeitig auf eine nachhaltige Bewirtschaftung<br />
der Kabeljaubestände in der Nordsee verständigt, wäre die Population dort<br />
heute so gross, dass die <strong>Fisch</strong>er gefahrlos 140 000 Tonnen im Jahr fangen könnten – anstatt<br />
24 000 Tonnen wie im Jahr 2009. Ein im Oktober 2010 präsentierter Managementplan<br />
von Kieler Wissenschaftlern fordert nun eine Stabilisierung <strong>und</strong> Aufstockung der <strong>Fisch</strong>bestände.<br />
Dies würde langfristig 60 Prozent höhere Erträge von viermal grösseren Beständen<br />
erbringen. Die Realität sieht leider anders aus: «In den Gewässern der EU werden die<br />
Bestände so gemanagt, dass sie gerade nicht zusammenbrechen», sagt Rainer Froese,<br />
<strong>Fisch</strong>biologe am Kieler Leibnitz Institut für Meereswissenschaften. «Diese Politik ist weder<br />
wirtschaftlich noch ökologisch vertretbar.»<br />
«Meeresschutzgebiete senken den Fangertrag»<br />
Das Gegenteil ist der Fall. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass befi schte Gebiete<br />
im Vergleich zu Gebieten mit eingestreuten Meeresschutzgebieten gleiche Erträge liefern<br />
können. Ein biblisches W<strong>und</strong>er? Keineswegs! Die überzähligen Larven von Meeresorganismen<br />
aus den Reservaten gelangen in die überfi schten Zonen <strong>und</strong> können später als erwachsene<br />
Tiere abgefi scht werden. Reservate dienen somit als wertvolle Reservoire, aus<br />
denen eine ständige Wiederbesiedlung annähernd leergefi schter Gebiete stattfi nden kann.<br />
Da die Anzahl abwandernder Jungtiere aus den Reservaten mit ihren ungenutzten <strong>und</strong> daher<br />
relativ stabilen Ökosystemen nur geringen Schwankungen unterworfen ist, wirken sich<br />
Schutzgebiete stabilisierend auf die Fangerträge der <strong>Fisch</strong>industrie aus. Die Einrichtung<br />
von Meeresschutzgebieten ist daher nicht nur ökologisch sondern auch ökonomisch sinnvoll.<br />
«Wir fordern deshalb bereits seit Jahren ein Netzwerk von Meeresschutzgebieten auf<br />
40 Prozent der globalen Meeresfl äche», sagt Yves Zenger von Greenpeace Schweiz.<br />
«<strong>Fisch</strong>e haben kein Schmerzempfinden»<br />
Ein schrecklicher Irrtum. <strong>Fisch</strong>e sind keine Refl exmaschinen. Sie schreien zwar nicht<br />
wie das Schwein am Spiess, empfi nden aber nachweislich Stress <strong>und</strong> Angst. Während<br />
das Schlachten von Kalb, Schaf <strong>und</strong> Schwein möglichst schmerzfrei über die Bühne gehen<br />
soll, nehmen die Fang-, Zucht- <strong>und</strong> Schlachtmethoden beim <strong>Fisch</strong> keinerlei Rücksicht<br />
auf das Leiden der Tiere. Das Töten beschränkt sich darauf, die Tiere ersticken zu lassen.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
«Würde die Schmerzempfi ndlichkeit der <strong>Fisch</strong>e endlich allgemein akzeptiert, bekäme die<br />
<strong>Fisch</strong>industrie ein ernsthaftes Problem», sagt Heinzpeter Studer von fair-fi sh.<br />
«<strong>Fisch</strong>e aus Aquakulturen können bedenkenlos konsumiert werden»<br />
Schön wärs. Räuberisch lebende Zuchtfi sche wie der Lachs sind auf tierisches Eiweiss<br />
angewiesen, um hohe Erträge zu liefern. Dies führt zur grotesken Situation, dass heute in<br />
konventionellen Zuchten fast gleich viel <strong>Fisch</strong>e verbraucht wie gewonnen wird. Viele Aquakulturen<br />
tragen deshalb zur Überfi schung der Weltmeere bei. Viele <strong>Fisch</strong>zuchtanlagen sind<br />
zudem nicht artgerecht eingerichtet, <strong>und</strong> die Besatzdichte ist meist viel zu hoch. <strong>Fisch</strong>farmen<br />
im Meer, in Seen oder an Bächen belasten die Umwelt, indem aus ihnen Kot, Futterreste,<br />
Pestizide <strong>und</strong> Medikamente in die Umwelt gelangen. Problematisch sind auch die<br />
Millionen von Zuchtlachsen, die jährlich aus den Farmen entweichen <strong>und</strong> ein genetisches<br />
Chaos unter den Wildbeständen anrichten sowie Krankheiten <strong>und</strong> Parasiten übertragen.<br />
Jennifer Zimmermann vom WWF sieht dennoch Möglichkeiten für verantwortungsbewusst<br />
geführte Aquakulturen. «Immer empfehlenswert sind <strong>Fisch</strong>e aus Biozuchten, da dort nur<br />
<strong>Fisch</strong>mehl- <strong>und</strong> -öl aus Abfällen der Speisefi schindustrie verfüttert werden dürfen, <strong>und</strong><br />
auch die anderen Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden müssen.»<br />
«Die <strong>Fisch</strong>erei entlastet den Druck auf die Landökosysteme»<br />
Das ist nur die halbe Wahrheit. Ein internationales Team aus Wissenschaftlern hat festgestellt,<br />
dass die Jagd auf die Wildtiere in den Savannen <strong>und</strong> Regenwäldern Westafrikas<br />
von der Verfügbarkeit von <strong>Fisch</strong> gesteuert wird. Besonders stark ist der Druck auf die<br />
Wildtiere in jenen Jahren, in denen die Netze der <strong>Fisch</strong>er praktisch leer sind. Wenn die<br />
<strong>Fisch</strong>er dagegen mit reicher Beute heimkehren, müssen deutlich weniger Wildtiere ihr Leben<br />
lassen. Dies deutet darauf hin, dass die Menschen in Westafrika ihren Proteinbedarf<br />
bevorzugt aus <strong>Fisch</strong> decken; steht <strong>Fisch</strong> aber nicht zur Verfügung, greift man auf Buschfl<br />
eisch zurück. Die Zukunft der 400 Säugetierarten, die in Westafrika gegessen werden,<br />
hängt demnach vor allem vom Zustand der <strong>Fisch</strong>bestände vor der Küste ab. Diese werden<br />
aber immer intensiver befi scht. Schlechte Karten also für die Wildtiere Westafrikas. Denn<br />
nach einem Kollaps der <strong>Fisch</strong>bestände würden die meisten Wildtiere Westafrikas innerhalb<br />
weniger Jahre der Jagd zum Opfer fallen.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
8<br />
9<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
27
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
28<br />
Positive Entwicklungen <strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
Kleine Lichtblicke <strong>und</strong> kleine Schritte zur Vernunft<br />
Weniger <strong>Fisch</strong>e im Netz bei unseren Nachbarn: Im Nordatlantik sowie der Nord- <strong>und</strong> Ostsee<br />
dürfen im laufenden Jahr insgesamt weniger <strong>Fisch</strong>e gefangen werden als 2010. Darauf<br />
einigten sich die zuständigen EU-Minister in Brüssel. Die EU-Länder unterzeichneten nach<br />
einem 17 St<strong>und</strong>en langen Verhandlungsmarathon einen Kompromiss für die Aufteilung der<br />
Fangmengen im Nordatlantik <strong>und</strong> in der Nordsee. Für r<strong>und</strong> 90 Bestände schraubte die EU<br />
die Quoten zurück. Die meisten Quoten gelten für die Fänge ab dem 1. Januar 2011.<br />
Für unsere Nachbarn, die deutsche <strong>Fisch</strong>erei, bedeutet das für 2011 einen Rückgang beim<br />
Kabeljau um ein Fünftel auf etwa 2900 Tonnen. Beim Seelachs soll der Ertrag um 13 Prozent<br />
auf r<strong>und</strong> 10 000 Tonnen sinken. Die EU-Kommission hatte den Mitgliedstaaten noch<br />
härtere Einschnitte vorgeschlagen. Brüssel stützt sich beim Kampf gegen die drohende<br />
Ausrottung vieler <strong>Fisch</strong>arten auf Experten des Internationalen Rates für Meeresforschung<br />
(ICES). In Europa gelten fast 90 Prozent der Bestände als überfi scht.<br />
Kontrollen gefordert<br />
Politiker, <strong>Fisch</strong>industrie, aber auch Umweltschutzorganisationen wie WWF begrüssten,<br />
dass sich der Kompromiss an wissenschaftlichen Erkenntnissen zum <strong>Fisch</strong>bestand orientiere.<br />
Nach Ansicht der <strong>Fisch</strong>ereiexpertin beim WWF Deutschland, Karoline Schacht,<br />
gibt es keine andere Möglichkeit: «Wenn der <strong>Fisch</strong> erst einmal weg ist, nützen taktische<br />
politische Spielereien nichts mehr.»<br />
Der WWF fordert daher mehr Kontrollen auf den Kuttern. Die Umweltschützer kritisieren,<br />
dass zu kleine oder zu viel gefi schte Tiere einfach zurück ins Wasser geworfen werden.<br />
Greenpeace will zudem, dass die europäische Fangfl otte verkleinert wird. Die <strong>Fisch</strong>er selber<br />
tragen in ihrem eigenem Interesse mit neuen Fangmethoden <strong>und</strong> Spezialnetzen dazu<br />
bei, die Überfi schung von einzelnen Arten <strong>und</strong> die Beifänge zu reduzieren.<br />
Die unselektive Befi schung mit Schleppnetzen kann optimiert werden.<br />
Entwicklung neuer Fangmethoden<br />
Für die Fangmethoden in der modernen <strong>Fisch</strong>erei gibt es sowohl national als auch international<br />
festgelegte Vorschriften. Darin werden zum Beispiel die Art <strong>und</strong> Größe der Netze<br />
sowie deren Beschaffenheit defi niert. So müssen für einige <strong>Fisch</strong>arten ganz bestimmte<br />
Maschenweiten eingehalten werden, um den Nachwuchs nicht zu gefährden. Darüber hinaus<br />
gibt es Schongebiete <strong>und</strong> Schonzeiten, etwa für Bereiche, in denen sich bestimmte<br />
Arten zur Laichzeit vermehrt ansammeln. Auch verschiedene Aufwuchsgebiete mit einer<br />
besonders hohen Konzentration an Jungfi schen werden als so genannte «Schutzzonen»<br />
für die <strong>Fisch</strong>erei gesperrt. Eine weitere Massnahme ist das Festlegen von Mindestanlandegrössen<br />
- auch so wird abgesichert, dass keine Tiere zu jung gefangen werden.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Verantwortungsbewusste Netzzüge auf Schweizer Seen<br />
Auch in der Schweiz gibt es <strong>Fisch</strong>er, die vom Verkauf ihrer Fänge leben. Der Verzehr einheimischer<br />
<strong>Fisch</strong>e beträgt nicht einmal 6 % des Gesamtfi schkonsums in der Schweiz. Der<br />
weitaus grösste Anteil der gehandelten <strong>Fisch</strong>e stammen aus dem Meer.<br />
Durch die von den Kantonen überwachten Schonvorschriften wird gewährleitet, dass die<br />
<strong>Fisch</strong>erei nachhaltig betrieben wird. Das Credo der Schweizer Berufsfi scher lautet: «Ein<br />
<strong>Fisch</strong> muss mindestens einmal in seinem Leben ablaichen können. Dann ist er gross genug,<br />
um von uns gefangen zu werden. Damit ist gewährleistet, dass sich die Tiere auch<br />
vermehren können.»<br />
Zu diesem Zweck wurde in Verordnungen festgelegt, dass die Netz eine minimale Maschenweite<br />
nicht unterschreiten <strong>und</strong> gewisse Arten während ihrer Fortpfl anzungszeit nicht<br />
befi scht werden dürfen. Zudem wird bei auch der Bestand häufi g befi schter Arten durch<br />
Besatz gestützt.<br />
Sachk<strong>und</strong>ige Angler<br />
Alle <strong>Fisch</strong>erinnen <strong>und</strong> <strong>Fisch</strong>er, ob Berufsleute oder Hobbyangller, müssen in der Schweiz<br />
eine Prüfung ablegen <strong>und</strong> so ihre Kenntnisse der heimischen <strong>Fisch</strong>fauna <strong>und</strong> der verantwortungsvollen<br />
<strong>Fisch</strong>erei unter Beweis stellen. Im Jahr 2009 wurde dazu der Sachk<strong>und</strong>enachweis<br />
eingeführt, für dessen Umetzung sich die kantonalen <strong>Fisch</strong>ereiverwaltungen <strong>und</strong><br />
die <strong>Fisch</strong>ereiverbände gemeinsam einsetzen.<br />
Unsere <strong>Fisch</strong>e brauchen Schutz <strong>und</strong> Lebensraum.<br />
Eine richtige Annahme. Der Kantonale <strong>Fisch</strong>erei-<strong>Verband</strong> <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong>, KFVBS, trägt mit<br />
einer Vielzahl von Aktivitäten dazu bei, unsere einheimische <strong>Fisch</strong>fauna, die Wanderfi sche<br />
im Fliessgewässer, Rhein, Wiese <strong>und</strong> Birs zu hegen <strong>und</strong> zu pfl egen. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen<br />
die Aufgaben der Artenerhaltung <strong>und</strong> Wiederansiedlung bedrohter <strong>Fisch</strong>e. Diese Aufgaben<br />
werden von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Frondienste im Bereich der<br />
Aufrechterhaltung Gewässersauberkeit, der Naturpfl ege, dem <strong>Fisch</strong>besatz <strong>und</strong> Monitoring,<br />
Arbeiten in der Gewässerrenaturierung <strong>und</strong> Revitalisierung, Freizeit <strong>und</strong> Jugendförderung,<br />
sind einige Beispiele. Der <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong> zeichnet sich durch dynamische Projekte<br />
<strong>und</strong> Arbeiten r<strong>und</strong> um <strong>und</strong> zu Gunsten der <strong>Fisch</strong>fauna in der REGIO BASILIENSIS aus.<br />
Als erster <strong>Fisch</strong>ereiverband hat er bereits vor dem Brand Sandoz Schweizerhalle im 1983<br />
das erste Schweizer Wiederansiedlungsprojekt für den Lachs im Rhein, initiert. Für 2012<br />
plant der KFVBS das erste trinationale Lachssymposium in <strong>Basel</strong>.<br />
Weitere Informationen: www.basler-fi scherei.ch<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
29
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
30<br />
Was können Konsumentinnen <strong>und</strong> Konsumenten gegen die Überfischung<br />
tun?<br />
Wir sind der Schlüssel zur Lösung aller Umweltprobleme, denn letztendlich hängt von<br />
unserem Einkaufverhalten die Art der Bewirtschaftung der Meere ab. Verschiedene Ratgeber<br />
helfen dabei, sich im immer reichhaltigeren <strong>Fisch</strong>sortiment zurechtzufi nden. WWF,<br />
Greenpeace <strong>und</strong> fair-fi sh geben Empfehlungen für einen verantwortungsvollen <strong>Fisch</strong>konsum<br />
(siehe links unten). Fazit: Verzichten Sie auf gewisse <strong>Fisch</strong>- <strong>und</strong> Krebsarten. Essen<br />
Sie seltener <strong>und</strong> bewusster <strong>Fisch</strong>. Kaufen Sie <strong>Fisch</strong> aus ges<strong>und</strong>en Beständen, der mit<br />
schonenden Fangmethoden gefangen wurde. Coop <strong>und</strong> Migros – die führenden Schweizer<br />
Detailhändler – machen uns dabei das Leben leichter: Mit ihrem Beitritt zur WWF Seafood<br />
Group haben sie sich verpfl ichtet, ihr Angebot schrittweise auf <strong>Fisch</strong>e <strong>und</strong> Meeresfrüchte<br />
aus nachhaltigen Quellen umzustellen. «So können sich alle K<strong>und</strong>innen <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en ohne<br />
schlechtes Gewissen im reichhaltigen Coop-<strong>Fisch</strong>sortiment bedienen», sagt Silvio <strong>Basel</strong>gia,<br />
verantwortlicher für <strong>Fisch</strong> bei Coop. Bis Ende 2012 sollen auch alle Konservenfi sche<br />
der Eigenmarke Coop aus umweltschonender, bestandserhaltender <strong>Fisch</strong>erei stammen. In<br />
Restaurants <strong>und</strong> Hotels werden die Speisekarten heute teilweise mit Angaben <strong>und</strong> Labels<br />
ausgestattet. Fish4Future ist seit 2008 das erste <strong>und</strong> führende Label in der Gastronomie.<br />
Bio- <strong>und</strong> Umweltsiegel sind beim Einkauf generell eine wichtige Orientierungshilfe.<br />
«Wer auf das blaue Label des Marine Stewardship Council (MSC) achtet, kann bewusst<br />
einen umweltverträglichen <strong>Fisch</strong>fang unterstützen», sagt Jennifer Zimmermann vom WWF.<br />
«Auch <strong>Fisch</strong>e <strong>und</strong> Meeresfrüchte mit Bio-Labels sind immer empfehlenswert».<br />
Wegweiser für den <strong>Fisch</strong>markt<br />
Der Einkaufsratgeber «<strong>Fisch</strong>e <strong>und</strong> Meeresfrüchte<br />
2010» des WWF:<br />
www.wwf.ch/fi sch > Einkaufsratgeber<br />
Der WWF Einkaufsratgeber <strong>Fisch</strong>e <strong>und</strong> Meeresfrüchte<br />
ist auch als App für iPhone <strong>und</strong> Android<br />
Smartphones erhältlich.<br />
Der <strong>Fisch</strong>führer von Greenpeace:<br />
www.greenpeace.ch > Aktiv werden > Ratgeber ><br />
<strong>Fisch</strong>führer<br />
Empfehlungen von fair-fi sh:<br />
www.fair-fi sh.ch > Geniessen > was kaufen?<br />
Seafood-Labels im Test<br />
www.wwf.ch/fi sch > Seafood-Labels<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Beispiele: Aktuelle Einschätzung verschiedener <strong>Fisch</strong>arten<br />
<strong>Fisch</strong>art Aktuelle Bewertung WWF Schweiz<br />
Makrele<br />
(Scomber scombrus)<br />
Alaska Seelachs<br />
(Theragra chalcogramma)<br />
Kabeljau, Dorsch<br />
(Gadus morhua)<br />
Wolfsbarsch<br />
(Dicentrarchus labrax)<br />
Roter Thun<br />
(Thunnus thynnus)<br />
Atlantischer Heilbutt<br />
(Hippoglossus hippoglossus)<br />
Empfehlenswert: Wildfang aus dem Nordostatlantik mit<br />
MSC-Label*.<br />
Empfehlenswert: Wildfang (nur Nordost-Pazifi k). Managment<br />
effektiv; allerdings Bestände in den letzten Jahren<br />
zurückgegangen. Besser: MSC-Alaska Seelachs<br />
Wildfang aus dem Nordostatlantik bedenklich.<br />
Alternative(n): MSC-Kabeljau oder Kabeljau aus der Barentsee<br />
Wildfang aus Mittelmeer bedenklich. Bestand vermutlich<br />
voll ausgeschöpft <strong>und</strong> überfi scht. Alternative: Bio-Wolfsbarsch<br />
Hände weg! Reagiert anfällig auf Überfi schung. Auf der<br />
Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN.<br />
Hände weg von Wildfang aus Nordost- <strong>und</strong> Nordwestatlantik.<br />
Als langsam wachsende Tiefsee-Art sehr anfällig<br />
auf Überfi schung. Gr<strong>und</strong>schleppnetze produzieren viel<br />
Beifang <strong>und</strong> schädigen die Bodenlebensräume. Alternative:<br />
MSC-Heilbutt aus Pazifi k<br />
*MSC steht für schonende, bestandeserhaltende <strong>Fisch</strong>erei. Der Beifang, sowie andere Auswirkungen der<br />
<strong>Fisch</strong>erei auf die Meeresumwelt müssen minimiert werden. Zudem muss die <strong>Fisch</strong>erei einen griffi gen Managementplan<br />
vorweisen.<br />
Situation Thunfisch <strong>und</strong> was man darüber wissen sollte!<br />
Unter der Sammelkategorie «Thunfi sch» werden verschiedene Thunfi sch-Arten zusammengefasst,<br />
die teilweise sehr unterschiedlich sind. Alle sind jedoch in den tropischen <strong>und</strong><br />
gemäßigten Weltmeeren zu Hause, wo sie ausgedehnte Wanderungen durchführen. Thunfi<br />
sche sind schnellschwimmende Raubfi sche. Ihre Fangründe erstrecken sich über den<br />
Pazifi k, Atlantik <strong>und</strong> den Indischen Ozean.<br />
Skipjack oder Bonito (links) <strong>und</strong> Gelfl ossenthun(rechts) auf dem Markt .<br />
Die am häufi gsten vorkommenden Arten sind der Skipjack / Bonito (Katsuwonus pelamis)<br />
<strong>und</strong> der Gelbfl ossenthun (Thunnus albacares). Skipjack macht r<strong>und</strong> sechzig Prozent des<br />
weltweiten Thunfi schfanges (2007) aus. Der <strong>Fisch</strong> erreicht bis zu 70 Zentimeter Länge <strong>und</strong><br />
5 Kilogramm Gewicht. Er wird vorrangig als Konserve verarbeitet. Gelbfl ossenthun kann<br />
bis zu 2,4 Meter Länge sowie 200 Kilogramm erreichen <strong>und</strong> wird vor allem frisch oder gefroren,<br />
teilweise auch als Dosenthun angeboten. Seine Fänge machen r<strong>und</strong> ein Viertel der<br />
weltweiten Thunfi sch-Fänge aus.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
31
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
32<br />
Wir sind alle gefordert, «aufmerksam» zu sein.<br />
Auch bei uns im Binnenland Schweiz.<br />
Sensibles Nahrungsnetz<br />
Die Ozeane beherbergen eine gewaltige Menge an Leben, das in teils spektakulärer Form<br />
vorkommt, von bizarren Tiefsee-Lebewesen über elegante Raubfi sche bis hin zu gigantischen<br />
Säugetieren. Doch es sind mikroskopische Winzlinge wie Kiesel- <strong>und</strong> Grünalgen,<br />
Dinofl agellaten <strong>und</strong> Cyanobakterien, die all das erst ermöglichen:<br />
Phytoplankton ist das erste Glied in der Nahrungskette der Meere. Es wird von Zooplankton<br />
gefressen, das wiederum vielen anderen Tieren als Nahrung dient, die ihrerseits von<br />
anderen Meeresbewohnern vertilgt werden.<br />
Der Mensch ist offenbar gerade dabei, der Nahrungspyramide in den Ozeanen das F<strong>und</strong>ament<br />
wegzuschlagen. Inzwischen gilt es als ausgemacht, dass die durch den Klimawandel<br />
steigenden Temperaturen an der Wasseroberfl äche die Menge des Phytoplanktons<br />
verringern. Wie groß der Effekt aber ist, <strong>und</strong> wie er sich in den vergangenen Jahrzehnten<br />
entwickelt hat, war bisher unbekannt.<br />
Phytoplanktongemeinschaft aus mikroskopisch kleinen Algen.<br />
Erschreckende Prognosen<br />
Jetzt liegen die Zahlen vor - <strong>und</strong> sie sind erschreckend. Seit 1899 ist die Masse des Phytoplanktons<br />
im globalen Durchschnitt um jährlich ein Prozent gesunken, berichtet ein internationales<br />
Forscherteam. Insbesondere ab Mitte des vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erts seien die<br />
Zahlen zuverlässig, sagte Boris Worm von der Dalhousie University im kanadischen Halifax,<br />
einer der Autoren der Studie. Seit 1950 sei die Masse an Phytoplankton im weltweiten<br />
Durchschnitt um 40 Prozent zurückgegangen.<br />
«Einen entsprechenden Verdacht gab es schon lange», sagte Worm «Aber diese Zahlen<br />
haben uns überrascht.» Über die Auswirkungen des Phytoplankton-Schw<strong>und</strong>s könne man<br />
derzeit nur spekulieren. «Im Gr<strong>und</strong>e sollte man davon ausgehen, dass ein solch massiver<br />
Rückgang schon jetzt spürbare Folgen hat», sagte Worm. Allerdings gehe es vor allem um<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
den offenen Ozean - <strong>und</strong> dort sei die Datenlage zur Fauna außerordentlich dünn. «Insbesondere<br />
der Teil der Nahrungskette zwischen Phytoplankton <strong>und</strong> Großfi schen hat die<br />
Menschheit bisher kaum interessiert.»<br />
«Die gesamte Nahrungskette wird sich zusammenziehen»<br />
Mit anderen Worten: Es könnte sein, dass die Effekte des rapiden Phytoplankton-Rückgangs<br />
im offenen Meer den Menschen bisher einfach entgangen sind. Das aber, so befürchtet<br />
Worm, wird nicht lange so bleiben. Sollte sich der Trend fortsetzen <strong>und</strong> die Phytoplankton-Masse<br />
weiterhin um ein Prozent pro Jahr abnehmen, «wird sich die gesamte<br />
Nahrungskette zusammenziehen».<br />
Andere Fachleute äußern sich ebenfalls beeindruckt von der schieren Größe des Effekts.<br />
«Ein Rückgang von 40 Prozent in 60 Jahren - das ist so gravierend, dass es beinahe<br />
unglaublich ist», sagt Heinz-Dieter Franke von der Biologischen Anstalt Helgoland des<br />
Alfred-Wegener-Instituts für Polar- <strong>und</strong> Meeresforschung. Allerdings warnt er davor, den<br />
Phytoplankton-Rückgang nur auf den Temperaturanstieg zurückzuführen. Denn er sorge<br />
zugleich für einen höheren Nährstoff-Eintrag über die Luft. Auch andere Einfl üsse wie etwa<br />
die Veränderung der Wolkenbildung <strong>und</strong> damit der Sonneneinstrahlung existierten – <strong>und</strong><br />
verkomplizierten die Lage.<br />
Kritische Folgen für die <strong>Fisch</strong>erei<br />
Die Folgen ihrer Aktivität auf den Ozeanen bekommen die Menschen schon heute zu spüren:<br />
Viele Speisefi scharten sind extrem überfi scht, beliebte Spezies wie etwa der Rote<br />
Thun sind inzwischen akut vom Aussterben bedroht. Schon jetzt warnen Forscher vor einem<br />
Kollaps der <strong>Fisch</strong>erei bis zum Jahr 2050. Der Rückgang des Phytoplanktons könnte<br />
diese Situation noch verschärfen.<br />
Der Kieler Fachmann Franke befürchtet deshalb auch, dass sich die größten Folgen in der<br />
<strong>Fisch</strong>erei zeigen werden. «Wenn die Gesamtproduktivität der Ozeane um 40 Prozent sinkt,<br />
müssten die Erträge der <strong>Fisch</strong>erei um mindestens den gleichen Wert zurückgehen».<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
33
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
34<br />
Unser Leitbild<br />
Der Kantonale <strong>Fisch</strong>ereiverband ist eine Dachorganisation,<br />
in der alle im Kanton <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> ansässigen <strong>Fisch</strong>ereivereine<br />
organisiert sind. Er setzt die lange Tradition<br />
der <strong>Fisch</strong>erei in <strong>Basel</strong> fort <strong>und</strong> engagiert sich für intakte<br />
<strong>Fisch</strong>bestände.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>erei-<strong>Verband</strong> <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
An einem fi schreichen Fluss gelegen, kann die Basler <strong>Fisch</strong>erei auf eine lange Tradition<br />
zurückblicken. In einer Stiftungsurk<strong>und</strong>e vom 15. Februar 1354 erlaubte Bischof Johann<br />
den <strong>Fisch</strong>ern <strong>und</strong> Schiffl euten zu <strong>Basel</strong>, eine eigene Zunft zu gründen. In der Zunftordnung<br />
vom Jahr 1420 legten sie umfassende Bestimmungen über ihr Handwerk fest. Im Jahre<br />
1941 entstand der heutige Kantonale <strong>Fisch</strong>erei-<strong>Verband</strong> <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> (KFVBS). Der <strong>Verband</strong><br />
ist Mitglied des Schweizerischen <strong>Fisch</strong>erei-<strong>Verband</strong>s (SFV).<br />
Eine Pioniertat war das 1983 ins Leben gerufene Projekt zur Wiederansiedlung des Lachses<br />
in <strong>Basel</strong>. Es war der Vorreiter für die koordinierten Bemühungen zur Wiedereinführung<br />
dieses Wanderfi sches im gesamten Rhein.<br />
Beispiele für Akvitivtäten: Rhyybutzete (links) <strong>und</strong> Jungfi scherkurse (rechts).<br />
Unser Leitbild<br />
Der KFVBS versteht sich als Dienstleister gegenüber seinen Mitgliedern <strong>und</strong> der Öffentlichkeit<br />
<strong>und</strong> hat die folgenden Aufgaben:<br />
• Förderung der Basler Binnenfi scherei<br />
• Förderung der Basler Fliessgewässer<br />
• Unterstützung seiner Mitglieder mit Rat <strong>und</strong> Tat<br />
• Mitarbeit an den Zielen des Arten-, Umwelt- <strong>und</strong> Gewässerschutzes<br />
Der <strong>Verband</strong> berücksichtigt dabei die regionalen Interessen <strong>und</strong> arbeitet mit anderen Institutionen<br />
sowie den Fachbehörden zusammen.<br />
Nachwuchsförderung <strong>und</strong> Beratung<br />
Zu den wichtigsten Aufgaben gehören die Schulung <strong>und</strong> Beratung seiner Mitglieder auf<br />
dem Gebiet der Hege der <strong>Fisch</strong>bestände, der Gewässerpfl ege, des <strong>Fisch</strong>habitats- <strong>und</strong><br />
Artenschutzes, der Arterhaltung <strong>und</strong> Wiederansiedlung gefährdeter <strong>Fisch</strong>arten in vorhandene<br />
bzw. neu zu schaffende Habitate <strong>und</strong> Biotope.<br />
Der <strong>Verband</strong> motiviert seine Mitglieder <strong>und</strong> bezieht die Vereine in seine Strategien <strong>und</strong><br />
Konzepte ein. Er ist in parteipolitischen <strong>und</strong> religiösen Fragen neutral.<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS
Liebe Besucher<br />
Ich bin ein ges<strong>und</strong>es Nahrungsmittel.<br />
Du darfst mich essen.<br />
Bitte kontrolliere aber von wo ich komme <strong>und</strong> ob ich<br />
vom Aussterben bedroht bin!<br />
www.basler-fi scherei.ch<br />
Wie kann ich für die Zukunft mithelfen?<br />
Werden Sie auch als Nichtfi scher Mitglied im Kantonalen <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong>.<br />
Sie unterstützen damit unsere Projekte zu Gunsten der Natur <strong>und</strong> <strong>Fisch</strong>fauna in der Region<br />
<strong>Basel</strong>.<br />
Nehmen Sie als Unternehmung mit uns Kontakt auf. Werden Sie unser Partner. Profi lieren<br />
Sie sich mit einer Sponsorenleistung.<br />
Mit Ihrer Goodwillspende an den Kantonalen <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>.<br />
Vermerk Natur 2011.<br />
Basler Kantonalbank<br />
Postfach<br />
4002 <strong>Basel</strong><br />
SWIFT BKBBCHBB<br />
IBAN CH48 0077 0016 5521 7960 6<br />
<strong>Kantonaler</strong> <strong>Fisch</strong>ereiverband <strong>Basel</strong>-<strong>Stadt</strong> KFVBS<br />
<strong>Fisch</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
35
Printed by<br />
Scali Copy Shop, <strong>Basel</strong>