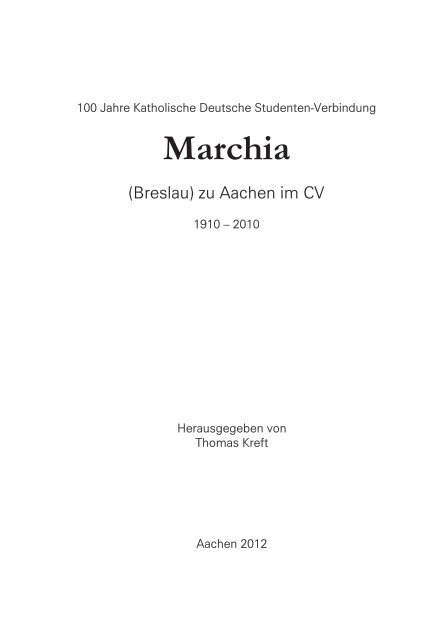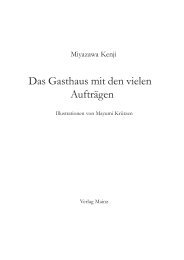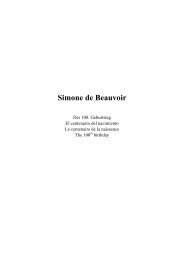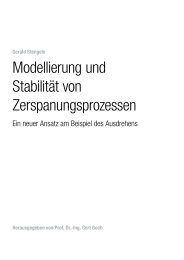(S. 131) Die älteste Gruppenaufnahme der KDStV Marchia aus dem ...
(S. 131) Die älteste Gruppenaufnahme der KDStV Marchia aus dem ...
(S. 131) Die älteste Gruppenaufnahme der KDStV Marchia aus dem ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
100 Jahre Katholische Deutsche Studenten-Verbindung<br />
<strong>Marchia</strong><br />
(Breslau) zu Aachen im CV<br />
1910 – 2010<br />
Her<strong>aus</strong>gegeben von<br />
Thomas Kreft<br />
Aachen 2012
Impressum:<br />
100 Jahre Katholische Deutsche Studenten-Verbindung <strong>Marchia</strong> (Breslau)<br />
zu Aachen im CV 1910 – 2010<br />
Her<strong>aus</strong>gegeben von Thomas Kreft<br />
ISBN-10: 3-86130-432-5<br />
ISBN-13: 978-3-86130-432-6<br />
Vertrieb:<br />
Herstellung:<br />
1. Auflage 2012<br />
© Verlagsh<strong>aus</strong> Mainz GmbH Aachen<br />
Süsterfeldstr. 83,<br />
52072 Aachen<br />
Tel. 0241/87 34 34<br />
Fax 0241/87 55 77<br />
www.Verlag-Mainz.de<br />
Druck und Verlagsh<strong>aus</strong> Mainz GmbH Aachen<br />
Süsterfeldstr. 83<br />
52072 Aachen<br />
Tel. 0241/87 34 34<br />
Fax 0241/87 55 77<br />
www.DruckereiMainz.de<br />
www.Druckservice-Aachen.de<br />
Layout: Thomas Kreft<br />
printed in Germany<br />
Umschlagvor<strong>der</strong>seite:<br />
�������������������<br />
<strong>Gruppenaufnahme</strong> zum 100-jährigen Bestehen <strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong><br />
im Jahre 2010 vor <strong>dem</strong> Hauptgebäude <strong>der</strong> RWTH Aachen (S. <strong>131</strong>)<br />
<strong>Die</strong> <strong>älteste</strong> <strong>Gruppenaufnahme</strong> <strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong><br />
Jahre 1910 in Breslau (S. 18)<br />
Bibliografische Information <strong>der</strong> Deutschen Bibliothek<br />
<strong>Die</strong> Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in <strong>der</strong> Deutschen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.<br />
Das Werk ist einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung<br />
ist ohne Zustimmung des Her<strong>aus</strong>gebers außerhalb <strong>der</strong> engen Grenzen des Urhebergesetzes<br />
unzulässig und strafbar. Das gilt insbeson<strong>der</strong>e für Vervielfältigungen, Übersetzungen,<br />
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
<strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> im CV<br />
Gründung: 22. Juli 1910 in Breslau<br />
Aufnahme <strong>der</strong> Rheno-Saxonia Köthen: 2. Juli 1911<br />
Einstellung des Verbindungsbetriebes: 8. Juni 1936<br />
Reaktivierung: 14. Januar 1950 in Aachen<br />
Farben: rot-weiß-rosa, Fuchsenband rot-weiß-rot<br />
Wahlspruch: Mens agitat molem!<br />
Zirkel:<br />
3
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
4<br />
Inhalt<br />
7 Vorwort des Her<strong>aus</strong>gebers<br />
Thomas Kreft<br />
VERBINDUNGSLEBEN<br />
11 Der Name <strong>Marchia</strong><br />
Wappen, Farben, Wahlspruch und Liedgut als äußere Zeichen <strong>der</strong> Verbindung<br />
1) <strong>Die</strong> Ausgangslage S. 11 � 2) Der Chronist Johannes Mnich S. 12 � 3) <strong>Die</strong> Gründung <strong>der</strong><br />
<strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> S. 13 � 4) Woher kamen die ersten Märker? S. 23 � 5) Landesbezüge S. 26<br />
� 6) <strong>Die</strong> Farben S. 31 � 7) Das Wappen S. 33 � 8) Liedgut S. 39 � 9) Der Wahlspruch<br />
»Mens agitat molem« S. 43 � 10) »Breslau« als Namenzusatz S. 45 � 11) Resultate S. 47<br />
Thomas Kreft<br />
55 Rheno-Saxonia Köthen<br />
Eine Verbindung mit Pfiff<br />
1) <strong>Die</strong> Rheno-Guestfalia Aachen S. 56 � 2) Gründung und Name <strong>der</strong> Rheno-Saxonia Köthen<br />
S. 57 � 3) Wappen und Fahne S. 58 � 4) Das Verbindungsh<strong>aus</strong> S. 62 � 5) Das Köthener<br />
Polytechnikum S. 64 � 6) Studentenleben S. 66 � 7) Liedgut und Couleurpfiff S. 69 �<br />
8) Das Streben in den CV S. 71 � 9) 1911: Fusion mit <strong>Marchia</strong> S. 72 � 10) Nachleben S. 77<br />
Heinz Gelhoit<br />
81 Von Breslau nach Aachen<br />
Eine Dokumentation <strong>der</strong> Jahre 1933-1950 <strong>aus</strong> Unterlagen des Märker-Archivs<br />
Volker Wahlen und Dominikus Klinke<br />
95 <strong>Die</strong> Jahre 1985 bis 2010 im Rückblick<br />
1) Renovierungen am Märkerh<strong>aus</strong> S. 95 � 2) Personelle Situation S. 98 � 3) CV und<br />
Altherrenzirkel S. 100 � 4) Eine neue Satzung und GO S. 100 � 5) <strong>Die</strong> Leistungen einzelner<br />
Bundesbrü<strong>der</strong> S. 101 � 6) Das Verbindungsleben in <strong>der</strong> Überschau S. 104<br />
Dominikus Klinke<br />
115 Das 100. Stiftungsfest<br />
Dominikus Klinke<br />
125 Breslau – die Stadt meiner Väter<br />
Ansprache des Altherrenseniors anlässlich des Aka<strong>dem</strong>ischen Festaktes zum 100. Stiftungsfest<br />
<strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> am 22. Mai 2010
Inhaltsverzeichnis<br />
129 Das 100. Stiftungsfest im Bild<br />
Marek Ha�ub<br />
137 Von Wroc�aw über Breslau nach Aachen<br />
Über das Zusammengehörigkeitsgefühl in <strong>der</strong> Schlesischen Gelehrtenrepublik<br />
Festrede zum 100-jährigen Bestehen <strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong><br />
Thomas Kreft<br />
KORPORATIONSHÄUSER<br />
149 <strong>Die</strong> Breslauer Märkerheime<br />
1) Neue Gasse 25: Zimmer beim Gastwirt Mergner S. 149 � 2) Karlstraße 44: Etage im<br />
Stadtpalais S. 150 � 3) Intermezzo im Vinzenzh<strong>aus</strong> S. 155 � 4) Neue Gasse 27: endlich ein<br />
eigenes H<strong>aus</strong> S. 156<br />
Holger Dux<br />
162 <strong>Die</strong> Häuser <strong>der</strong> Aachener Korporationen<br />
1) Einführung S. 163 � 2) 1871 bis 1899: Gründung. Frühe studentische Verbindungen<br />
S. 164 � 3) 1900 bis 1914: Kaiserzeit. Erste Verbindungshäuser entstehen S. 169 � 4) 1919<br />
bis 1932: Blüte. Positive Entwicklungen trotz Inflation und Besatzungszeit S. 174 � 5) 1933<br />
bis 1944: Verbot. <strong>Die</strong> Korporationen zur Zeit des Nationalsozialismus S. 179 � 6) 1945 bis<br />
1959: Neubeginn. Das Leben <strong>der</strong> Korporationen in Aachen wird vielfältiger S. 181 �<br />
7) 1959 bis 1968: Unruhige Zeiten. Spätphase eines positiven Trends S. 191 � 8) 1970 bis<br />
2010: Heute. Bestandssicherung o<strong>der</strong> Alternativen S. 194<br />
Thomas Kreft<br />
203 Das Märkerh<strong>aus</strong> als Kulturerbe<br />
Zur Baugeschichte <strong>der</strong> Villa Otto Peltzer in Aachen<br />
1) Äußere Glie<strong>der</strong>ung S. 204 � 2) Das Innere S. 210 � 3) Historische technische Ausstattung<br />
S. 213 � 4) Außenanlagen S. 215<br />
Karlheinz Dannert<br />
217 <strong>Die</strong> Aachener Familie Otto Peltzer und<br />
ihre Villa in <strong>der</strong> Nizzaallee 4<br />
Ulrich Kalla<br />
225 <strong>Die</strong> ersten Jahre auf <strong>dem</strong> Aachener Märkerh<strong>aus</strong><br />
5
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
6<br />
Thomas Kreft<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
SPORT UND FREIZEIT<br />
231 Sport in in <strong>Marchia</strong>s Breslauer Zeiten<br />
1) Meister im F<strong>aus</strong>tball: <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Bericht des Sportwarts S. 231 � 2) Der Märker-Kegelklub<br />
S. 233<br />
Hans Hollingsh<strong>aus</strong>en und Andreas Dassen<br />
235 Märkertreffen im Ötztal<br />
1) Der Ursprung S. 235 � 2) Wie es weiterging S. 236 � 3) Alternativprogramme S. 237 �<br />
4) Spündchen – Chef des Basislagers S. 237 � 5) Venter Bergfest S. 239 � 6) Runden<br />
S. 240 � 7) Unter neuer Leitung S. 240 � 8) Bewährtes und Neues S. 240 � 9) Gottesdienst<br />
in <strong>der</strong> Venter Dorfkirche S. 241 � 10) Genießer und Gipfelstürmer S. 241 � 11) Routinetreffen<br />
und Beson<strong>der</strong>heiten S. 242 � 12) Vent-Nachtreffen auf <strong>dem</strong> Winterfest S. 243 �<br />
13) Bilanz S. 244<br />
Franz-Josef <strong>Die</strong><strong>der</strong>ich, Volker Schiel und Christian Entrup<br />
245 Märkersegeln in Holland<br />
1) Der Ursprung S. 245 � 2) Erstmals offiziell S. 246 � 3) Pfingst-Segeln S. 246 � 4) Auf<br />
neuen Booten S. 248 � 5) Zelten direkt am Bootssteg S. 250<br />
Dominikus Klinke et al.<br />
MARCHIA IN DATEN<br />
251 Chronik <strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong><br />
Einschließlich <strong>der</strong> katholischen Studentenverbindungen<br />
Rheno-Guestfalia Aachen und Rheno-Saxonia Köthen<br />
1) Gedanken zur Chronik S. 251 � 2) Zeittafel S. 253; darin: »<strong>Die</strong> Kasse schließt mit einem<br />
Minus von 9 Milliarden« S. 262; »Oos wie fies«: Wie die <strong>Marchia</strong> zu ihrem H<strong>aus</strong> kam<br />
S. 289; Wie die Laterne vom »Postwagen« zum Märkerh<strong>aus</strong> gelangte S. 298; <strong>Marchia</strong> und<br />
die CV-Aka<strong>dem</strong>ie S. 313<br />
384 Übersichten<br />
1) Amtsträger 1985 bis 2010 S. 384 � 2) <strong>Die</strong> 1985 bis 2010 verstorbenen Bundesbrü<strong>der</strong> S. 386<br />
388 Bibliographie<br />
390 Register<br />
399 Abkürzungen
Vorwort des Her<strong>aus</strong>gebers<br />
Mit einem großen Fest vollendete sie im Sommer 2010 ihre ersten hun<strong>der</strong>t Jahre:<br />
die Katholische Deutsche Studenten-Verbindung <strong>Marchia</strong> (Breslau) zu Aachen im<br />
CV. Was ihr zweites Jahrhun<strong>der</strong>t bringen wird, entzieht sich zwar <strong>der</strong> menschlichen<br />
Erkenntnis. Eines aber wage ich vor<strong>aus</strong>zusagen: Auch 2110 werden sich die Märker<br />
dafür interessieren, was ein Säkulum zuvor geschah. Sie werden es hier in diesem<br />
Opus nachlesen können, das 13 Autoren mit viel Engagement erarbeitet haben.<br />
BISHERIGE GESCHICHTSSCHREIBUNG<br />
Bereits die vorigen Generationen haben in diesem Sinne ihre Zeit festgehalten. Zum<br />
10. Stiftungsfest 1920 legte Bbr. Johannes Mnich die erste Jubiläums-Publikation<br />
vor. Es handelt sich um ein DIN-A5-Heft zu 32 Seiten, von <strong>der</strong> Gattung her eine<br />
Chronik, wobei diese zehn Jahre in fünf zeitliche Abschnitte unterteilt sind: Vorbereitung<br />
zur Gründung, Gründung, Zeit bis zum 1. Weltkrieg, Kriegszeit, Zeit nach<br />
<strong>dem</strong> Krieg. Eine knappe Bewertung dieses Werkes und seines Autors liefert <strong>der</strong><br />
Beitrag »Der Name <strong>Marchia</strong>« im vorliegenden Buch.<br />
Zum 20. Stiftungsfest 1930 kam eine zweite Schrift im gleichen Format zu 48 Seiten<br />
her<strong>aus</strong>. Sie enthält einen neu gesetzten, aber inhaltlich unverän<strong>der</strong>ten Nachdruck<br />
<strong>der</strong> Mnich-Chronik sowie einen zweiten Teil von Bbr. Gerhard Traub. Traub<br />
setzte die chronologische Form fort, stellte aber einen sachlich geglie<strong>der</strong>ten Teil<br />
voran mit <strong>dem</strong> Titel »Form und Geist«.<br />
<strong>Die</strong> Märkerchroniken von Günther Sebulke, Heinz Gelhoit, Johannes Mnich und Gerhard Traub<br />
(Fotos/Graphiken: Kreft)<br />
7
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
8<br />
Aachener Dom<br />
Vorwort<br />
Dass 1935 zum 25-jährigen Bestehen keine Festschrift erschien,<br />
beruht auf <strong>dem</strong> vorgesehenen Zehnjahresrhythmus. 1<br />
Zum 25. Stiftungsfest kam stattdessen eine Bierzeitung<br />
her<strong>aus</strong>, welche die Verbindungsgeschichte in Karikaturen<br />
darstellt. 1940 stand nach Einstellung des Verbindungsbetriebes<br />
1936 eine weitere Publikation nicht zur Debatte, und<br />
1950 verdrängte die vordringliche Aufgabe <strong>der</strong> Reaktivierung<br />
in Aachen den Gedanken an eine Märkerchronik. Erst 1960<br />
folgte eine weitere Publikation <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong>, nun zum 50jährigen<br />
Jubiläum. Bbr. Günther Sebulke übernahm die Autorenschaft.<br />
Er überarbeitete die Texte von Mnich und Traub<br />
und führte sie im gleichen Stile fort. Ebenso verfuhr Bbr.<br />
Heinz Gelhoit mit seiner Märkergeschichte zum 75. Stiftungsfest 1985; inzwischen<br />
hatte man sich für einen 25-Jahre-Rythmus entschieden. Einen Überblick <strong>der</strong> Publikationen<br />
bietet die Bibliographie am Ende <strong>der</strong> jetzigen Publikation.<br />
100 JAHRE MARCHIA<br />
Zum 100-jährigen Bestehen auf die bisherige Geschichtsschreibung wie<strong>der</strong>um<br />
weitere 25 Jahre aufzupflanzen, erwies sich indes als nicht mehr praktikabel. Deshalb<br />
liegt <strong>dem</strong> neuen Werk »100 Jahre <strong>Marchia</strong>« die Gemeinschaftsarbeit mehrerer<br />
Autoren und Bearbeiter zu Grunde, die sich ihrem Part umso gründlicher widmen<br />
konnten. Vor allem gehörte zu den Zielen – im Gegensatz<br />
zu den Gepflogenheiten bei Bundesgeschichten und allgemein<br />
bei Vereinschroniken – die Quellen zu nennen. Rückgrat<br />
<strong>der</strong> Publikation ist eine umfangreiche Chronik, welche<br />
die Ereignisse ohne Wertung in einer Zeittafel auflistet.<br />
Einige frühe Phasen <strong>der</strong> Verbindung werden geschichtswissenschaftlich<br />
neu aufgearbeitet, während die<br />
Autoren <strong>der</strong> Beiträge über die jüngeren Ereignisse noch<br />
die Erinnerung mit heranziehen<br />
konnten. Manche Phasen <strong>der</strong><br />
Verbindungsgeschichte, allen<br />
voran die Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
mit <strong>der</strong> Nazi-Diktatur, bedürfen<br />
generell einer gründlichen, wissenschaftlichen Analyse.<br />
<strong>Die</strong> Zeittafel bietet hierzu aber bereits eine Grundlage.<br />
Vieles <strong>der</strong> vergangenen Geschichtsschreibung erwies<br />
sich inzwischen als überholt, weil neue Quellen bekannt<br />
wurden o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Fragestellungen die Beiträge<br />
regieren. Möge auch die nächste Generation <strong>aus</strong> ihrer<br />
Sicht beherzt neue Antworten suchen und finden.<br />
Breslauer Rath<strong>aus</strong><br />
Der Gegenwart und <strong>der</strong> Wurzel <strong>der</strong> Verbindung wird durch zwei graphische Miniaturen<br />
in <strong>der</strong> Kopfzeile Rechnung getragen: das Breslauer Rath<strong>aus</strong> und <strong>der</strong> Aachener<br />
Dom als bekannte Wahrzeichen dieser Städte, verbunden durch eine Linie.<br />
Längere Zitate sind mit einem begleitenden Seitenbalken versehen. Sie fallen als<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Ausarbeitungen dadurch besser auf.<br />
1 Sebulke 1960, S. 5.
Vorwort<br />
QUELLENLAGE<br />
Trotz <strong>der</strong> Aktenverluste im Laufe <strong>der</strong> geschichtlichen Wirren verfügt die <strong>Marchia</strong><br />
heute über ein sehr umfangreiches Archiv. <strong>Die</strong>s verdankt sie hauptsächlich <strong>dem</strong><br />
langjährigen Archivar Bbr. Heinz Gelhoit, <strong>der</strong> dieses Amt von 1980 bis 2007 innehatte.<br />
Um sein Ziel zu erreichen, unternahm er unzählige Reisen zu alten Bundesbrü<strong>der</strong>n<br />
und in diverse Archive. Dazu <strong>der</strong> Amtsträger 1995 in einem Bericht in den<br />
Märker-Blättern: 2<br />
Bei diesen Reisen habe ich mich auch stets bemüht, die im jeweiligen Umkreis wohnenden<br />
AHAH zu besuchen. Da nun durch die intensive Beschäftigung mit <strong>der</strong> Märkergeschichte<br />
bei mir ein detailreiches Wissen entstanden war, entwickelte sich bei diesen<br />
Besuchen meist eine angeregte Unterhaltung über <strong>Marchia</strong>, bei <strong>der</strong> manche weitere<br />
Einzelheiten aufgedeckt werden konnten.<br />
Im Laufe <strong>der</strong> Gespräche wurde dann auch so manches gerettete Erinnerungsstück hervorgeholt<br />
und stolz vorgeführt. Mit beson<strong>der</strong>er Freude kann ich feststellen, daß fast<br />
<strong>aus</strong>nahmslos diese für die Märkergeschichte wertvollen Stücke später <strong>dem</strong> Archivar<br />
übereignet wurden.<br />
Das Archiv <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> enthält nun neben vielen Originalstücken auch etliche Kopien<br />
wichtiger Schriftstücke an<strong>der</strong>er Institutionen, vor allem <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> CV-Archiv.<br />
Das hat die Forschung für die nun vorgelegten Beiträge sehr erleichtert.<br />
Schon früh hatte die <strong>Marchia</strong><br />
begonnen, eigene Periodika<br />
her<strong>aus</strong>zugeben. Am<br />
Anfang stehen die Correspondenzblätter.<br />
Erhalten<br />
sind lediglich zwei Ausgaben:<br />
Nr. 3 vom 5. Juni 1913<br />
und Nr. 4 vom 25. Juli 1913.<br />
Sie tragen die Untertitel<br />
»Erstes« bzw. »Zweites Cor-<br />
respondenzblatt des S.-S.<br />
1913«. Denkbar ist also ein<br />
Historische Bil<strong>der</strong> im Kneipsaal des Märkerh<strong>aus</strong>es<br />
Beginn im Wintersemester 1912/13. Vermutlich brachte <strong>der</strong> 1. Weltkrieg das Aus.<br />
1926 kam die erste Märker-Blätter-Ausgabe her<strong>aus</strong>. <strong>Die</strong>se Semesterzeitschrift<br />
schaffte es in Breslau bis zur Nr. 16 im Dezember 1934. Dazu gehört auch die Son<strong>der</strong>nummer<br />
von 1930 mit persönlichen Erinnerungen <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Verbindung.<br />
Parallel lief die Zeitschrift »Aus <strong>der</strong> Altherrenschaft« von 1927 bis zur Nr.<br />
12, die im Oktober 1936 nach <strong>der</strong> Einstellung des Verbindungsbetriebes erschien.<br />
Im Übrigen bediente sich die <strong>Marchia</strong> weit mehr als heute <strong>der</strong> CV-Zeitschrift »Aca<strong>dem</strong>ia«<br />
für Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Verbindungsleben, die insbeson<strong>der</strong>e für die Phasen<br />
ohne eigenes Publikationsorgan eine unentbehrliche Quelle ist.<br />
In <strong>der</strong> Aachener Zeit lebten die Märker-Blätter wie<strong>der</strong> auf. Noch vor <strong>der</strong> Reaktivierung<br />
<strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> gab Bbr. Johannes Gebel die Nr. 1 und 2 her<strong>aus</strong>, doch begann er<br />
die dritte Ausgabe nach <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>begründung abermals mit <strong>der</strong> Nr. 1, nach <strong>der</strong><br />
2 Heinz Gelhoit, 15 Jahre Archivar <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong>, in: Märker-Blätter 77 (März 1995), S. 41-48, hier S.<br />
42. Vgl. auch dens., Archiv <strong>der</strong> alten Rheno-Saxonia Cöthen an <strong>Marchia</strong> übergeben, in: Märker-<br />
Blätter 62 (Nov. 1987), S. 23-25.<br />
9
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
10<br />
Vorwort<br />
die Aachener Folge bis heute gezählt wird. Redakteure waren: Johannes Gebel bis<br />
Nr. 3, Hans Sebulke: Nr. 4 bis 19; Edgar Jesse: Nr. 20 bis 29; Wilfried Becker: Nr.<br />
30 bis 34; Paul Schubert: Nr. 35; Heinz Borgmann: Nr. 36 bis 39. Bbr. Hans Hollingsh<strong>aus</strong>en<br />
betreut die Blätter seit <strong>der</strong> Nr. 40 und kommt damit auf mehr Ausgaben<br />
als alle an<strong>der</strong>en Redakteure zusammen. 3 Eine Son<strong>der</strong><strong>aus</strong>gabe erschien im<br />
Jahre 2000 zur Dokumentation des 50. Winterfestes, das zugleich als 90. Stiftungsfest<br />
gefeiert wurde.<br />
DANKSAGUNG<br />
All jenen, die am Gelingen dieses umfangreichen Buches mitgewirkt haben, möchte<br />
ich an dieser Stelle für ihren Einsatz danken, zunächst den Autoren. Frühzeitig konnte<br />
ich zwei Persönlichkeiten gewinnen, die sich in Aachen bereits einen guten Ruf<br />
mit geschichtlichen Arbeiten erworben haben. Herr Dr. Holger Dux, renommierter<br />
Bauhistoriker, hat einen umfassenden Beitrag über die Verbindungshäuser <strong>der</strong><br />
Kaiserstadt beigesteuert. Herr Karlheinz Dannert hat die Geschichte <strong>der</strong> Familie<br />
Otto Peltzer erhellt, die das heutige Märkerh<strong>aus</strong> einst baute und bewohnte.<br />
Im Zeichen polnisch-deutscher Völkerverständigung steht die Festrede von Herrn<br />
Professor Dr. Marek Ha�ub von <strong>der</strong> Universität Breslau, welche er freundlicherweise<br />
in schriftlicher Form zur Verfügung stellte. Aus den Reihen <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> engagierten<br />
sich als Autoren: Christian Entrup, Dr. Andreas Dassen, Franz-Josef <strong>Die</strong><strong>der</strong>ich,<br />
Heinz Gelhoit, Hans Hollingsh<strong>aus</strong>en, Dr. Ulrich Kalla, Dominikus Klinke, Volker<br />
Schiel und Dr. Volker Wahlen.<br />
Vielfältig ist <strong>der</strong> Aufwand, den eine Publikation dieser Größenordnung mit sich<br />
bringt. <strong>Die</strong>s umfasst das Sichten und Einscannen <strong>der</strong> Fotos, das Herstellen <strong>der</strong><br />
Karten, das Korrekturlesen nebst Einpflege <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen sowie das Erstellen des<br />
Registers. Bei <strong>der</strong> Arbeit erwies sich vor allem Bbr. Dominikus Klinke, bis Ende<br />
2010 Altherrensenior <strong>Marchia</strong>e, als »rechte Hand« des Her<strong>aus</strong>gebers. Desweiteren<br />
wirkten mit: Frau Ursula Brammertz sowie die Bundesbrü<strong>der</strong> André Bräkling (Senior<br />
im Sommersemester 2010), AHx Franz-Josef <strong>Die</strong><strong>der</strong>ich, Hans Hollingsh<strong>aus</strong>en, Dr.<br />
Ulrich Kalla, Julian Krick (Senior im Wintersemester 2011/12), Felix Müller, AHxx Dr.<br />
Armin Olbrich, Erhard Edler von Pollak, Franz-Josef Stobbe, AHxxxx Dr. Norbert<br />
Tolksdorf und AHxxx Dr. Volker Wahlen. 4 Für seine studentengeschichtlichen Hinweise<br />
danke ich Herrn Dr. Harald Lönnecker.<br />
Last but not least danke ich meiner lieben Ehefrau Ute für ihre Geduld, die sie<br />
mir bei <strong>der</strong> Erstellung dieser Publikation entgegenbrachte.<br />
Aachen, im Dezember 2011 Dr. Thomas Kreft, Archivar <strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong><br />
3 Märker-Blätter 44 (Dez. 1973), S. 2 und 100 (Aug. 2006), S. 17-19.<br />
4 <strong>Die</strong> im Korporationswesen üblichen Kürzel AHx etc. bezeichnen die Ämter des Vorstandes des<br />
Altherrenverbandes: Altherren-Senior, Consenior, Schriftführer, Kassierer.
Thomas Kreft<br />
Der Name <strong>Marchia</strong><br />
Wappen, Farben, Wahlspruch und Liedgut als<br />
äußere Zeichen <strong>der</strong> Verbindung<br />
»Nomen est omen« – <strong>der</strong> Name ist Zeichen. Wie fast alle studentischen Korporationen<br />
trägt auch die 1910 gegründete Katholische Deutsche Studentenverbindung<br />
<strong>Marchia</strong> einen individuell <strong>aus</strong>gewählten Namen. Welche Zeichen dieser Name setzt,<br />
was sich die Grün<strong>der</strong> bei seiner Wahl dachten – wer weiß das noch wirklich genau<br />
nach einem Jahrhun<strong>der</strong>t, das diesem Bund zwei Weltkriege und eine Diktatur, Verbot<br />
und Vertreibung, wirtschaftliche Not und Studentenrevolten entgegengeschleu<strong>der</strong>t<br />
hat?<br />
Bei <strong>dem</strong> Versuch, <strong>der</strong> ur-<br />
sprünglichen Bedeutung des<br />
Namens <strong>Marchia</strong> auf die Spur zu<br />
kommen, wurde schnell deutlich,<br />
dass auch an<strong>der</strong>e Identität<br />
stiftende Elemente wie Wappen,<br />
Farben, Wahlspruch und Liedgut<br />
bei <strong>der</strong> Analyse eine Rolle<br />
spielen. <strong>Die</strong>se äußeren Zeichen<br />
erwiesen sich selbst als so komplex,<br />
dass Einzeluntersuchungen<br />
darüber notwendig wurden und<br />
im Folgenden hier ebenfalls<br />
ihren Platz bekommen. <strong>Die</strong>se<br />
geschichtswissenschaftliche<br />
Aufarbeitung geschieht bewusst<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Jubiläumspublikation,<br />
um nicht nur die Ergebnisse,<br />
son<strong>der</strong>n auch den spannenden<br />
Weg dorthin einer breiten<br />
Leserschaft zugänglich zu<br />
machen.<br />
1) <strong>Die</strong> Ausgangslage<br />
DAS »H« IM NAMEN<br />
Eine immer wie<strong>der</strong> gestellte Frage lautet: Wie<br />
spricht man den Namen »<strong>Marchia</strong>« richtig <strong>aus</strong>? Nicht<br />
selten kommen Außenstehende in die Verlegenheit<br />
um die richtige Aussprache – obwohl gar nicht verlangt<br />
wird, den Namen fremdländisch zu sprechen.<br />
Offenbar bereitet die Buchstabenfolge »chi« Schwierigkeiten.<br />
Warum? Schon die Geographen des 16.<br />
Jh. haben »<strong>Marchia</strong>« – latinisiert für »Mark« – als Territorialbezeichnung<br />
auf ihren Landkarten festgehalten.<br />
Das »h« in <strong>dem</strong> Wort zeigte an, dass das c als k<br />
<strong>aus</strong>zusprechen sei, also »Markia«. Ohne das h hieße<br />
es »Marzia«.<br />
Soweit sich durch mündliche Überlieferung zurückverfolgen<br />
lässt, haben sich die Märker jedoch von<br />
diesem philologischen Hintergrund gelöst und<br />
sprechen den Namen ihrer <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> so <strong>aus</strong><br />
wie ein deutsches Wort mit ch wie in Weiche o<strong>der</strong><br />
Arche.<br />
<strong>Die</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> folgt <strong>dem</strong> weit verbreiteten Brauch studentischer Korporationen,<br />
einen landschaftlichen Namen zu wählen, und zwar in <strong>der</strong> latinisierten Form.<br />
Zu Deutsch heißt <strong>Marchia</strong> Mark, weshalb sich die Mitglie<strong>der</strong> Märker nennen. Interessant<br />
ist nun die Frage, auf welches Gebiet sich die <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> eigentlich<br />
bezieht – sofern sich <strong>der</strong> Name überhaupt verorten lässt. Es gibt kein Dokument<br />
<strong>aus</strong> <strong>der</strong> Gründungsphase, welches die Wahl des Namens <strong>Marchia</strong> erläutert. <strong>Die</strong><br />
einzige erhaltene schriftliche Aussage, die überhaupt etwas dazu mitteilt, stammt<br />
11
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
12<br />
Verbindungsleben<br />
von 1920. In <strong>der</strong> Festschrift »<strong>Die</strong> ersten 10 Jahre Märkergeschichte« formuliert<br />
Bundesbru<strong>der</strong> Johannes Mnich dort:<br />
Sie waren sich bewusst, daß sie getreu ihrem Namen als Märker auf vorgeschobenem<br />
Posten zu kämpfen, die Grenzmark des CV im Osten mit zu verteidigen haben würden.<br />
[…] Der Name »<strong>Marchia</strong>« ist hergekommen von <strong>dem</strong> Herzogtum Mark, jenem Teil <strong>der</strong><br />
»roten Erde«, von <strong>dem</strong> <strong>der</strong> Dichter sagt: »Dort, wo <strong>der</strong> Märker das Eisen reckt …« Auch<br />
die Mark Brandenburg, woher sich verschiedene Cartellbrü<strong>der</strong> angesagt hatten, spielte<br />
bei <strong>der</strong> Auswahl des Namens eine Rolle. Ihr sind <strong>der</strong> märkische Adler in unserem Wappen<br />
und die Grundfarben rot-weiß entlehnt. 1<br />
<strong>Die</strong>se hier wie<strong>der</strong>gegebene Stelle wurde bisher oft zitiert, 2 aber nie näher analysiert.<br />
In jüngerer Zeit bot die mehrdeutige Formulierung Stoff für freie Interpretationen.<br />
Zum Wintersemester 1995/96 setzten die Chargen einen Klappentext ins Programmheft,<br />
<strong>der</strong> mit diesem Satz beginnt:<br />
Der Name <strong>Marchia</strong> bezieht sich auf die Grafschaft Mark, <strong>dem</strong> heutigen Märkischen<br />
Kreis, ebenso die Farben Rot und Weiß, die bei uns mit Rosa ergänzt wurden.<br />
Der Text wurde unverän<strong>der</strong>t bis 2009 in den Semesterprogrammen publiziert. Seit<br />
<strong>dem</strong> Sommersemester 2010 heißt es an gleicher Stelle:<br />
Der Name <strong>Marchia</strong> leitet sich wohl in erster Linie von <strong>der</strong> Mark Brandenburg ab, worauf<br />
<strong>der</strong> rote Adler im Wappen und die Grundfarben Rot-Weiß verweisen. Letzteres wurde<br />
aber auch oft auf die Grafschaft Mark bezogen.<br />
<strong>Die</strong>se neuere Auslegung relativiert zwar die engere Definition von 1995, greift aber<br />
ebenfalls zu kurz, wie wir bei näherer Betrachtung <strong>der</strong> Quellen und Indizien im Folgenden<br />
sehen werden. Begrüßenswert ist gewiss, dass die Frage nach <strong>der</strong> Bedeutung<br />
des Namens <strong>Marchia</strong> an sich in <strong>der</strong> Verbindung durch<strong>aus</strong> relevant war und ist.<br />
2) Der Chronist Johannes Mnich<br />
Johannes Mnich<br />
(Archiv <strong>Marchia</strong>)<br />
Wie ist zunächst die Mnich’sche Chronik als Geschichtsquelle zu<br />
werten? Johannes Mnich wurde 1896 in Krappitz (Oberschlesien)<br />
geboren, erwarb das Abitur in Oppeln und studierte Jura an <strong>der</strong><br />
Universität Breslau. Am 20. Juli 1917 trat er <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> bei, wo<br />
er mehrere Chargenämter bekleidete: Consenior im Wintersemester<br />
1918/19 sowie Fuchsmajor ebenfalls im Wintersemester<br />
1918/19, im 2. Zwischensemester 1919 und im Wintersemester<br />
1919/20. 1925 promovierte er zum Dr. jur. und wurde schließlich<br />
Landgerichtsdirektor in Brünn und Dortmund. Der Nachruf in den<br />
Märker-Blättern von 1957 bescheinigt ihm einen »untadeligen<br />
Charakter«. 3<br />
1 Mnich 1920, S. 10.<br />
2 Traub 1930, S. 7; Sebulke 1960, S. 11; Gelhoit 1985, S. 17.<br />
3 Archiv <strong>Marchia</strong>, Bbr. I 167; Wilhelm Pachur in den Märker-Blättern 16 (Dezember 1957), S. 2.
Der Name <strong>Marchia</strong><br />
Im Sommersemester 1920 publizierte Mnich im offiziellen Auftrag 4 »<strong>Die</strong> ersten<br />
10 Jahre Märkergeschichte«. Für die Jahre 1917 bis 1920 tritt er selbst als Zeitzeuge<br />
auf. Das Wissen über die Zeit vor seiner Recipierung bei <strong>Marchia</strong> muss er <strong>aus</strong><br />
diversen schriftlichen Unterlagen o<strong>der</strong> <strong>aus</strong> mündlichen Informationen geschöpft<br />
haben. Ein Vergleich mit den Beständen im Archiv <strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> zeigt, dass<br />
<strong>der</strong> Autor das Aktenmaterial gewissenhaft <strong>aus</strong>gewertet hat, etwa die Rundschreiben<br />
<strong>der</strong> Gründungskommission o<strong>der</strong> den Antrag zur Aufnahme in den CV. Auch die<br />
Festschrift zum zehnjährigen Bestehen <strong>der</strong> Rheno-Saxonia hat Mnich gekannt und<br />
zitiert. Sie inspirierte ihn auch bei <strong>der</strong> eigentümlichen Formulierung, die Gründung<br />
sei »in aller Stille« erfolgt. 5<br />
Im Hinblick auf die zitierte Stelle zum Namensbezug ist die Beurteilung schwieriger,<br />
denn dazu kennen wir die Quellen nicht. Es ist ganz offensichtlich, dass hier<br />
mehrere Überlieferungsstränge unterschiedlicher Qualität zusammenfließen. Im<br />
Streit um den Bezug auf Brandenburg o<strong>der</strong> die Grafschaft Mark ist Mnich als Oberschlesier<br />
als neutral einzustufen.<br />
Wie gerade Mnich zu <strong>der</strong> Aufgabe kam, im Alter von 24 Jahren die Märkerchronik<br />
zu schreiben, ist nicht mehr zu ermitteln. Auch über das Echo <strong>der</strong> Festschrift wissen<br />
wir nicht viel. <strong>Die</strong> vermeintliche Kritik in <strong>der</strong> Son<strong>der</strong><strong>aus</strong>gabe <strong>der</strong> Märker-Blätter<br />
vom Sommer 1930 berührt Mnichs Erklärung zum Namen <strong>Marchia</strong> nicht. 6 Für die<br />
generelle Korrektheit <strong>der</strong> Chronik spricht, dass <strong>der</strong> Text inhaltlich unverän<strong>der</strong>t im<br />
Herbst 1930 ein zweites Mal erschien, 7 die Verbindung also keine Notwendigkeit<br />
einer Überarbeitung sah.<br />
3) <strong>Die</strong> Gründung <strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong><br />
DIE VORGESCHICHTE<br />
<strong>Die</strong> Geschichte des CVs reicht in Breslau bis zur Gründung <strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> Winfridia<br />
1856 zurück, die zusammen mit Aenania München im selben Jahr den Cartellverband<br />
ins Leben rief. Durch Teilung gründete die stark wachsende Winfridia im vierten<br />
Jahrzehnt ihres Bestehens zwei Tochterverbindungen: Rheno-Palatia (1900) und<br />
Salia (1904); vgl. Schema auf S. 49. <strong>Die</strong>se Korporationen waren allein <strong>der</strong> Universität<br />
angeglie<strong>der</strong>t, denn die Technische Hochschule gab es noch nicht. <strong>Die</strong> TH stand<br />
damals aber schon in Planung, Baubeginn war im Herbst 1905. 8 Auf <strong>der</strong> 44. Cartellversammlung<br />
1908 in Düsseldorf brachte Winfridia die Gründung einer weiteren CV-<br />
Verbindung zur Diskussion, die an <strong>der</strong> Technischen Hochschule bestehen sollte.<br />
<strong>Die</strong> Sache wurde aber zunächst ad acta gelegt, denn Baltia Danzig und Borusso-<br />
Saxonia Berlin erklärten, die Gründung werde ihnen schaden, da dann die Unter-<br />
4 Laut Titeldaten »im Auftrage des Konvents«; das Protokoll ist nicht mehr vorhanden.<br />
5 Weiteres dazu unten im Kapitel »Was geschah am 22. Juli?«.<br />
6 Muschalle 1930, S. 5: Der Passus »Wohl werden Einzelheiten an<strong>der</strong>s <strong>aus</strong>sehen, als sie unser<br />
lieber Mnich in seiner schönen Schrift zum ersten Dezennium geschil<strong>der</strong>t hat« in <strong>der</strong> Einleitung<br />
seiner Erinnerungen ist dahingehend gemeint, dass Muschalle Ergänzungen liefert. Vor allem<br />
vermisste Muschalle in Mnichs Chronik »das wirkliche Leben«, die Anekdoten, gegenüber den<br />
»dürftigen amtlichen Quellen«.<br />
7 1930 zusammen mit <strong>der</strong> Fortsetzung von Gerhard Traub zum 20. Stiftungsfest.<br />
8 Festschrift zur Eröffnung, Breslau 1910, ND in: Gesellschaft TH Breslau, S. 35; Maria Rochowicz-<br />
Lewandowska: Technische Universität Wroc�aw. Das Gebäudeensemble <strong>der</strong> ehemaligen Technischen<br />
Hochschule, Breslau 2005, S. 4.<br />
13
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
14<br />
Verbindungsleben<br />
stützung <strong>der</strong> Schlesier für sie entfallen werde. 9 Aufgrund <strong>der</strong> Errichtung eines eigenen<br />
Verbindungsh<strong>aus</strong>es nahm Winfridia dann von einer weiteren Teilung Abstand. 10<br />
Schließlich nahm <strong>der</strong> CV-Altherrenzirkel Breslau die Sache in die Hand. 1909 hatte<br />
er die Cartellversammlung in Breslau organisiert. 11 Ob die neue Verbindung dort<br />
Thema war, ist nicht bekannt; das Protokoll fehlt im CV-Archiv. <strong>Die</strong> ersten konkreten<br />
Schritte scheint <strong>der</strong> Philisterzirkel erst Anfang 1910 mit <strong>der</strong> Bildung einer Gründungskommission<br />
gesetzt zu haben. Ihr gehörten an: <strong>der</strong> Vorstand des Breslauer<br />
Altherrenzirkels, hinzugewählte »technische« Altherren (damit sind Ingenieure gemeint)<br />
und je ein Vertreter <strong>der</strong> Breslauer Verbindungen. Fe<strong>der</strong>führend waren Dr.<br />
Josef Boenigk (Winfridia, Altherrensenior Saliae) als Vorsitzen<strong>der</strong> und Dr. Cosmas<br />
Hoffmann (Winfridia) als Schriftführer und Kassierer. 12 Wahrscheinlich gehörte auch<br />
Joseph Frerich (Herzynia Freiburg), den Mnich und Muschalle zu den Grün<strong>der</strong>n<br />
zählen, zu diesem Personenkreis. 13<br />
Das Vorhaben stieß in ganz Schlesien, vor allem aber im katholischen und industriell<br />
geprägten Oberschlesien auf zustimmendes Interesse. <strong>Die</strong> Initiative gab wohl<br />
auch den Anstoß zum Zusammenschluss <strong>der</strong> verschiedenen schlesischen CV-<br />
Philisterzirkel zum Altherrenverband Schlesien. Laut CV-Handbuch von 1913 gehörten<br />
die schlesischen Philisterzirkel zu den <strong>älteste</strong>n überhaupt. 14 <strong>Die</strong> Gründung des<br />
Schlesischen Altherrenverbandes erfolgte am 26. April 1910.<br />
DIE »HEIßE« PHASE<br />
Direkt am ersten Tage seines Bestehens beschloss <strong>der</strong> Convent des Schlesischen<br />
Altherrenverbandes am 26. April, die Gründung <strong>der</strong> projektierten TH-Verbindung zu<br />
beför<strong>der</strong>n. 15 Das bedeutete vor allem, das Startkapital zusammenzubekommen und<br />
Cartellbrü<strong>der</strong> für die Gründungsmannschaft zu gewinnen. <strong>Die</strong> Geldfrage erwies sich<br />
als geringere Hürde. Eine spontane Sammlung <strong>der</strong> Conventsteilnehmer brachte<br />
bereits 352 Mark. 16 Ein Spendenaufruf erhöhte die Summe auf 1380 Mark. 17 Bereits<br />
am 2. Juli 1910 meldete Boenigk in einem Rundschreiben, das <strong>dem</strong> Kontext nach<br />
an den ganzen CV ging, die notwendigen finanziellen Mittel seien vorhanden. 18<br />
Weiter heißt es in <strong>dem</strong> Schreiben:<br />
<strong>Die</strong> provisorische Konstituierung <strong>der</strong> neuen Verbindung soll möglichst Ende des laufenden<br />
Sommersemesters stattfinden. <strong>Die</strong> Verbindung ist dann bei Eröffnung <strong>der</strong> Hochschule<br />
im Oktober bereits in Tätigkeit, wodurch die Keilarbeit geför<strong>der</strong>t und erleichtert<br />
wird.<br />
9 C.V.-Protokoll, Kopie im Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1910.<br />
10 Heckel 1931, S. 17-19; Gelhoit 1985, S. 14; Gelhoit 2009, S. 215.<br />
11 Aca<strong>dem</strong>ia 22 (1909), S. 101f (15. Juli) und 169-177 (15. September).<br />
12 Brief von Josef Boenigk vom 2. Juli 1910 an den Vorortspräsidenten. Darin heißt es, die Gründungskommission<br />
sei »bereits vor mehreren Monaten« zusammengetreten. Kopie im Archiv <strong>Marchia</strong>,<br />
Mch Brs I 1910. Mnich 1920, S. 8.<br />
13 Mnich 1920, S. 12; Muschalle 1930, S. 5.<br />
14 Herman Jos. Wurm: Handbuch für den Cartellverband <strong>der</strong> katholischen deutschen Studentenverbindungen,<br />
Berlin 1913, S. 94.<br />
15 Aca<strong>dem</strong>ia 23 (15. Mai 1910), S. 37f; Rundschreiben des Altherrenbundes, Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch<br />
Brs I, 1910.<br />
16 Rundschreiben ebd.<br />
17 Rundschreiben ebd.; Mnich 1920, S. 9.<br />
18 CV-Archiv, Kopie im Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1910. Auch Mnich 1920, S. 8f.
Der Name <strong>Marchia</strong><br />
Boenigk erläutert im weiteren Text die Chancen, die sich potenziell durch die Technischen<br />
Hochschulen für den Cartellverband ergeben und kommt schließlich zum<br />
wesentlichen Punkt:<br />
Wir bitten daher im Interesse des C.V. die verehrlichen Cartellbrü<strong>der</strong>, sich für die dringend<br />
notwendige Werbung von Burschen und Füchsen für die neue Verbindung nachdrücklich<br />
zu interessieren und solche, die übertreten wollen, alsbald zu veranlassen,<br />
sich bis zum 14. Juli bei <strong>dem</strong> Unterzeichneten anzumelden.<br />
Das Ergebnis war denkbar mager. Am 16. Juli meldete Boenigk <strong>dem</strong> Vorort, dass<br />
sich nur zwei Burschen, drei Füchse und ein Inaktiver gemeldet hätten. 19 Nun ist es<br />
bei einem Wechsel in eine an<strong>der</strong>e Verbindung so geregelt, dass <strong>der</strong> Betreffende<br />
nach Abschluss seines Studiums bei seiner Urverbindung philistriert wird – mit<br />
Ausnahme von Übertritten während <strong>der</strong> Fuchsenzeit. <strong>Die</strong>s gestaltete sich für die<br />
übertrittwilligen Füchse als Problem, welches Boenigk mit einer Ausnahmeregelung<br />
zu lösen gedachte. Dem gab die Augsburger Cartellversammlung einige Wochen<br />
später statt. 20<br />
Während des Sommersemesters fanden schließlich neun aktive Bundesbrü<strong>der</strong><br />
zur <strong>Marchia</strong>: drei Burschen <strong>der</strong> Rheno-Palatia (Georg Glasneck, Wilhelm Moser und<br />
Edwin Feyer), zwei von <strong>der</strong> Winfridia (Viktor Schramm und Heinz Ziegler) und einer<br />
von <strong>der</strong> Salia (Hans Abmeier). Ferner wechselten zwei Füchse zur <strong>Marchia</strong>, nämlich<br />
Franz Muschalle (Winfridia) und Joseph Ukoszek (Salia). Als Alte Herren wurden<br />
Boenigk, Hoffmann und Frerich Märker. 21 Aus Aachen kam Heinrich Lütke (Baltia<br />
und Franconia) hinzu.<br />
Der 22. Juli 1910 schließlich gilt als offizieller Gründungstag <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong>. <strong>Die</strong>ses<br />
inhaltlich kaum dokumentierte Datum bedarf einer näheren Betrachtung. Doch<br />
zunächst die weiteren Schritte <strong>der</strong> Gründungsphase: Am 21. August reichte Bundesbru<strong>der</strong><br />
Glasneck den Anmeldungsantrag beim stellvertretenden Rektor <strong>der</strong><br />
Technischen Hochschule ein, 22 womit wohl ein kommissarischer Amtsträger gemeint<br />
ist.<br />
Der erste ordentliche Rektor war zwei Tage zuvor eingesetzt worden, 23 was aber<br />
vielleicht noch nicht allgemein bekannt war. Dass dabei die Farben mitgeteilt wurden,<br />
erwähnt Mnich deshalb, weil diese bald darauf noch einmal geän<strong>der</strong>t wurden<br />
(s.u.). Der erste offizielle Rektor, Prof. Rudolf Schenck, antwortete am 19. September,<br />
von <strong>der</strong> Konstituierung »gern Kenntnis« genommen zu haben und lud zu einer<br />
Besprechung ein, über <strong>der</strong>en Verlauf aber nichts überliefert ist. 24<br />
Schließlich wurden die Chargen gewählt. Heinrich Lütke bekleidete das Amt des<br />
Aktivenseniors. <strong>Die</strong> Wahl mag nicht zuletzt deshalb auf Lütke gefallen sein, weil<br />
Rektor Schenck sein Doktorvater war und man sich dadurch einen kurzen Draht zur<br />
Hochschule erhoffte. <strong>Die</strong>ser Vorteil wird im CV-Aufnahmeantrag vom 3. November<br />
19 <strong>Die</strong>s geht <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Beilage X zur TO <strong>der</strong> Cartellversammlung in Augsburg hervor. Kopie im Archiv<br />
<strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1910.<br />
20 Protokoll <strong>der</strong> C.V., Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1910.<br />
21 Mnich 1920, S. 12; Muschalle 1930, S. 5.<br />
22 Mnich 1920, S. 10; ebenfalls Sebulke 1960, S. 11.<br />
23 Königliche Technische Hochschule zu Breslau: Programm für das Studienjahr 1910-1911, nachgedruckt<br />
mit neuer Paginierung in: Gesellschaft TH Breslau, S. 152.<br />
24 Mnich 1920, S. 10.<br />
15
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
16<br />
Verbindungsleben<br />
betont. 25 Es gab aber noch einen an<strong>der</strong>en Grund, den <strong>der</strong> nunmehr 85-jährige Lütke<br />
im Jahre 1971 <strong>der</strong> Verbindung darlegte:<br />
Inzwischen beendete ich in Aachen meine gut gediehenen Vorarbeiten für die Doktorarbeit<br />
und fuhr am 8. September 1910 nach Breslau, wo zwischendurch die »<strong>Marchia</strong>«<br />
gegründet [worden] war, die <strong>aus</strong> 8-9 jungen Cartellbrü<strong>der</strong>n <strong>der</strong> drei Universitäts-CV-<br />
Verbindungen Winfridia, Rheno-Palatia und Salia bestand. Drei Breslauer Cartellphilister<br />
Frerich, Boenigk und Hoffmann hatten sich als helfende Paten und Gründungsphilister<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
<strong>Die</strong>se letzteren holten mich am Hauptbahnhof Breslau ab und hießen mich in Breslau<br />
ganz herzlich willkommen, baten mich dann aber dringend, daß ich als Neutraler das<br />
»Seniorat« <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> übernähme, worüber sich die Gründungsverbindungen bislang<br />
noch nicht hätten einigen können. Nach längerem Gespräch habe ich dann zugesagt<br />
und wurde so »Gründungssenior <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong>«, worauf ich heute noch stolz bin. 26<br />
Seit wann Lütke die drei Alten Herren bereits kannte, wann er zum ersten Male in<br />
Breslau weilte, lässt sich nicht mehr ermitteln. <strong>Die</strong> weiteren Chargen waren Hans<br />
Abmeier als Fuchsmajor, Heinz Ziegler als Consenior, Wilhelm Moser als Scriptor<br />
(Schriftführer) und Edwin Feyer als Quaestor (Kassierer). 27 Zuvor gab es Ferienvertreter,<br />
die »auf häufig täglichen Sitzungen« mit den Alten Herren Boenigk und<br />
Hoffmann die »letzten Vorbereitungen für das öffentliche Auftreten <strong>der</strong> Korporation«<br />
organisierten. Sie mieteten zwei Zimmer über <strong>der</strong> Gastwirtschaft Mergner in <strong>der</strong><br />
Neuen Gasse 25 als Verbindungsheim und ließen Wichs und Fahne anfertigen. 28 Zu<br />
einem nicht bekannten Datum wurde <strong>der</strong> Altherrenbund <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> ins Leben<br />
gerufen und zu seinem Vorsitzenden Joseph Frerich gewählt. 29<br />
Am 22. Oktober trugen die Märker erstmals in <strong>der</strong> Öffentlichkeit Band und Mütze.<br />
30 Der 16. November brachte die Aufnahme in den CV (s.u.). Mit <strong>dem</strong> Publikationsfest<br />
am 23. bis 25. November fand die Gründung <strong>der</strong> <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> ihren Abschluss.<br />
WAS GESCHAH AM 22. JULI?<br />
Das vorangehende Kapitel zeigt, dass die Gründung <strong>Marchia</strong>s sich nicht auf ein<br />
Datum reduzieren lässt, son<strong>der</strong>n eine Phase von etwa einem Dreivierteljahr umfasst.<br />
<strong>Die</strong> Verbindungschroniken aber nennen den 22. Juli 1910 als Gründungstag.<br />
Als die Verbindung 2010 den 100. Jahrestag beging, kam die Frage zur Sprache,<br />
was an diesem Tage genau passierte. Eine klare Antwort zu geben, ist bei den heute<br />
noch verfügbaren Quellen schwierig. Wir wollen nachfolgend einen Versuch<br />
wagen. 31<br />
25 »Und für unsere vorzügliche Stellung im Rahmen <strong>der</strong> technischen Korporationen, zu <strong>der</strong> uns<br />
vornehmlich die langjährige Bekanntschaft unseres Seniors mit <strong>dem</strong> bis 1912 ernannten Rektors<br />
verhalf […]« (Archiv <strong>Marchia</strong>, Brs I, 1910; Gelhoit 1985, S. 22).<br />
26 Brief an die <strong>Marchia</strong> vom 23. Juni 1971. Anlass ist die Absage zur Teilnahme am Stiftungsfest; die<br />
historischen Ausführungen gibt er eingedenk seines 60. Doktorjubiläums und 85. Geburtstages<br />
1971. Archiv <strong>Marchia</strong>, Bbr. I 9.<br />
27 Aca<strong>dem</strong>ia 23 (1. Dezember 1910), Beilage S. 18.<br />
28 Mnich 1920, S. 10.<br />
29 Muschalle 1930, S. 7.<br />
30 Mnich 1920, S. 10f.<br />
31 Einen ersten Absatz liefert Märker-Blätter-Redakteur Hans Hollingsh<strong>aus</strong>en in einem Bericht über<br />
den Gründungstag 100 Jahre <strong>Marchia</strong>, Märker-Blätter 108 (August 2010), S. 26-29.
Der Name <strong>Marchia</strong><br />
Das Datum ist in vier Textstellen erwähnt. Im CV-Aufnahmegesuch vom 3. November<br />
heißt es lediglich:<br />
Am 22. Juli wurde <strong>der</strong> Name <strong>Marchia</strong> erwählt. 32<br />
Auch Johannes Mnich hält sich zehn Jahre später eher knapp. Interessant ist die<br />
Gegenüberstellung <strong>der</strong> von ihm benutzten Vorlage <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Festschrift <strong>der</strong> Rheno-<br />
Saxonia Köthen von 1907 (linke Spalte):<br />
Am 19. März 1896 wurde in aller<br />
Stille von sieben begeisterten<br />
jungen Leuten die katholisch<br />
aka<strong>dem</strong>ische Verbindung »Rheno-Saxonia«<br />
gegründet. 33<br />
Unter den externen Druckwerken heißt es im CV-Gesamtverzeichnis vom Juni 1911:<br />
Gegründet den 22. Juli 1910.<br />
… und auf <strong>der</strong> unten im Kapitel über das Wappen erläuterten Couleurtafel von<br />
1912/13:<br />
Gestiftet 22. Juli 1910. Stiftungsfeier im Wintersemester.<br />
So wurde am 22. Juli 1910 in aller Stille die geplante<br />
Verbindung unter <strong>dem</strong> Namen »Katholische<br />
Deutsche Studentenverbindung <strong>Marchia</strong>« gegründet<br />
und zu ihrem Wahlspruch: Mens agitat molem!<br />
gewählt. Sieben Cartellbrü<strong>der</strong>, übergetreten von<br />
Winfridia, Rheno-Palatia und Salia waren es, die das<br />
kleine Schifflein bestiegen […] 34<br />
<strong>Die</strong> Gegenüberstellung dieser Quellen erweckt den Eindruck, dass <strong>der</strong> Tag erst<br />
rückwirkend zum Gründungstag wurde. Hierzu könnte die CV-Bürokratie geführt<br />
haben, die nach einem festen Datum verlangte. Das Couleurblatt ist gegenüber<br />
<strong>dem</strong> CV-Verzeichnis zwar keine originäre Quelle mehr, zeigt aber die zeitliche Diskrepanz<br />
zwischen Stiftungstag und Stiftungsfest im jährlichen Veranstaltungskalen<strong>der</strong>.<br />
<strong>Die</strong>s än<strong>der</strong>te sich erst am 15. Januar 1913 durch den CC-Beschluss, das Stiftungsfest<br />
fortan stets in zeitlicher Nähe zum 22. Juli zu feiern. 35 Zweitens sei daran<br />
erinnert, dass man noch am 2. Juli 1910 eine provisorische Konstituierung erst zum<br />
Ende des laufenden Sommersemesters zum Ziele gesetzt hatte.<br />
Bemerkenswert ist, dass man <strong>aus</strong>gerechnet denjenigen Tag als Gründungsdatum<br />
für würdig befand, an <strong>dem</strong> man sich auf den Verbindungsnamen geeinigt hatte.<br />
<strong>Die</strong> früheste Erwähnung des Namens <strong>Marchia</strong> liefert <strong>der</strong> bereits genannte Antrag<br />
zur Fuchsenregelung, welcher <strong>der</strong> Cartellversammlung am 20.-24. August 1910<br />
vorlag. Kein Dokument vor <strong>dem</strong> 22. Juli erwähnt den Namen. Sogar in <strong>der</strong> am 16.<br />
Juli abgeschickten Erstfassung des besagten Antrags war lediglich von <strong>der</strong> »neue[n]<br />
Cartellverbindung an <strong>der</strong> Technischen Hochschule zu Breslau« die Rede. 36 Erst recht<br />
ist keine Diskussion über alternative Namensvorschläge bezeugt.<br />
32 CV-Archiv, Kopie Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1910/11.<br />
33 Behner, Hermann: Festschrift zur Feier des 10. Stiftungsfestes <strong>der</strong> Aka<strong>dem</strong>ischen Verbindung<br />
»Rheno-Saxonia«. Köthen 1907, S. 5.<br />
34 Mnich 1920, S. 9.<br />
35 Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1913.<br />
36 Der Text ist inseriert in das Rundschreiben des Vororts vom 18. Juli.<br />
17
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
18<br />
Verbindungsleben<br />
Das <strong>älteste</strong> Märker-Foto zeigt stehend Viktor Schramm, Heinz Ziegler, Wilhelm Moser; sitzend Georg Glasneck,<br />
Edwin Feyer, Heinrich Lütke, Hans Abmeier, Joseph Ukoszek. (Mnich, S. 13; Gelhoit 1985, S. 23)<br />
Das mag daran liegen, dass <strong>der</strong> Name <strong>Marchia</strong> schon zehn Jahre zuvor ins Spiel<br />
gebracht und nun wie<strong>der</strong> aufgegriffen worden war. Darauf ist an an<strong>der</strong>er Stelle<br />
zurückzukommen.<br />
Außer <strong>der</strong> Einigung in <strong>der</strong> Namensfrage ist die Festlegung des Wahlspruchs bezeugt.<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> bleibt nicht viel: <strong>Die</strong> Entscheidung, die Verbindung an <strong>der</strong> TH<br />
und im Rahmen des Cartellverbandes zu gründen, war längst gefallen. <strong>Die</strong> Beantragung<br />
<strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> bei <strong>der</strong> Hochschulbehörde folgte erst einen Monat später, <strong>der</strong><br />
Aufnahmeantrag an den CV, dessen Abstimmungsergebnis und die Publikationsfeier<br />
sind noch weniger in den Zusammenhang zu bringen. Auch die Chargenwahl<br />
geschah erst zu Beginn des Wintersemesters. Ein möglicher Verhandlungsgegenstand<br />
am 22. Juli dürften die Farben gewesen sein, die zumindest am 21. August<br />
bereits feststanden. Band und Mütze in Märkerfarben waren am 22. Juli allerdings<br />
noch nicht vorhanden.<br />
Nach diesen Erwägungen erklärt sich nun auch <strong>der</strong> Passus »in aller Stille«: Es<br />
war eine Veranstaltung im kleinen Kreise unter Ausschluss <strong>der</strong> Öffentlichkeit und<br />
ohne Feierlichkeiten. Dass Mnich die Formulierung <strong>der</strong> Festschrift <strong>der</strong> Rheno-<br />
Saxonia entnommen hatte, spielt dabei an sich keine Rolle. Interessanter ist die<br />
Siebenzahl. Der Personenkreis, <strong>der</strong> am 22. Juli zusammengetreten war, dürfte sich<br />
auf die Gründungsmitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Verbindung reduzieren. <strong>Die</strong>se insgesamt zwölf<br />
Märker waren im Laufe des Sommersemesters beisammen gekommen, müssen<br />
deshalb aber nicht zwangsläufig alle am 22. Juli dabei gewesen sein. Gesichert sind<br />
die Alten Herren Boenigk und Hoffmann. Frerich ist wahrscheinlich auch schon<br />
hinzuzurechen. Er wird zu den Grün<strong>der</strong>n gezählt und wurde später erster Altherrensenior.<br />
Seine früheste Nennung im Zusammenhang mit <strong>Marchia</strong> fällt auf den 8.<br />
September, den Tag <strong>der</strong> Besprechung mit Heinrich Lütke wegen des Seniorats.
Der Name <strong>Marchia</strong><br />
Unklar war bisher, ob Heinrich Lütke am 22. Juli in Breslau war. Er war als Doktorand<br />
von <strong>der</strong> TH Aachen an die TH Breslau gewechselt, weil sein Doktorvater Rudolf<br />
Schenck als Professor für physikalische Chemie zum 17. Mai 1910 dorthin berufen<br />
worden war. 37 Schenck beerbte damit den am 3. April 1910 bei einer Ballonfahrt<br />
tödlich verunglückten Prof. Richard Abegg. 38 Schließlich wurde Schenck »durch<br />
Allerhöchsten Erlaß« vom 19. August 1910 zum ersten Rektor <strong>der</strong> TH Breslau ernannt.<br />
39 Zeitlich kommt die<br />
Involvierung Lütkes zum<br />
Stichtag also infrage. Von<br />
seiner Anwesenheit bei <strong>der</strong><br />
Sitzung am 22. Juli zeugen<br />
konkret die Angaben, dass<br />
er den Wahlspruch vorschlug<br />
und dass dieser<br />
Wahlspruch an jenem Tage<br />
beschlossen worden war,<br />
wobei noch die Möglichkeit<br />
besteht, dass er den Vorschlag<br />
vor <strong>dem</strong> Termin<br />
geäußert hatte. Jedenfalls<br />
hatte Lütke danach an <strong>der</strong><br />
weiteren Ausgestaltung <strong>der</strong><br />
Verbindung wohl keinen<br />
wesentlichen Anteil, denn<br />
wie erwähnt, hatte er noch<br />
bis September in Aachen<br />
zu tun.<br />
Schwieriger ist die Einschätzung<br />
zur Aktivitas. Am<br />
16. Juli standen, wie be-<br />
<strong>Die</strong> Gründungsaktivitas in <strong>der</strong> Bierzeitung von 1935 (Archiv <strong>Marchia</strong>)<br />
reits angeführt, drei Burschen (davon ein Inaktiver) und drei Füchse zum Beitritt<br />
bereit. Es ist also gut möglich, dass man durch nochmaliges Nachfassen auf sechs<br />
Burschen (ohne Lütke) kam. Von den Füchsen hatte sich einer vom Beitrittsgedanken<br />
wie<strong>der</strong> verabschiedet, so dass die beiden bekannten übrig blieben. Aus <strong>der</strong><br />
Rückschau zählte Mnich den erst später als Senior reaktivierten Alten Herrn Lütke<br />
zur Aktivitas. Das ergibt eine Zahl von sieben Burschen, auf die <strong>der</strong> Chronist die<br />
37 Programm <strong>der</strong> Königlichen Technischen Hochschule zu Aachen für das Studienjahr 1910/1911, S.<br />
170. In einem Artikel <strong>der</strong> Aachener Volkszeitung vom 11. März 1960 anlässlich Schencks 90. Geburtstag<br />
(Archiv <strong>der</strong> RWTH Aachen, Personalakte Schenck) heißt es: »Im Mai ging Professor Dr.<br />
Schenck nach Breslau […]«.<br />
38 Königliche Technische Hochschule zu Breslau: Programm für das Studienjahr 1910/1911, nachgedruckt<br />
mit neuer Paginierung in: Gesellschaft TH Breslau, S. 154.<br />
39 Ebd. S. 153. <strong>Die</strong> Verfügung, dass die Amtszeit des Rektors jeweils am 1. Juli beginnt (ebd. S.<br />
112), betraf somit erst den Beginn <strong>der</strong> zweiten Amtszeit; das Datum bei Sebulke 1960, S. 11, ist<br />
zu korrigieren. Lütke selbst nennt in <strong>der</strong> Rückschau (Brief an die <strong>Marchia</strong> vom 23. Juni 1971): »Mit<br />
meiner Doktorarbeit begann ich Anfang Februar 1910 […], bis mein Doktor-Vater, Prof. Schenck,<br />
Mitte Juni mitteilte, daß er – ganz unerwartet für ihn und auch für mich – zum Ersten Rektor an<br />
die neue T.H. Breslau berufen sei und seine neue Stellung schon am 1. Juli, also in zwei Wochen,<br />
antreten müsse.«<br />
19
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
20<br />
Verbindungsleben<br />
Siebenzahl <strong>der</strong> Rheno-Saxonia nun übertragen konnte. Es handelt sich also nicht<br />
um die Gesamtzahl <strong>der</strong> insgesamt wohl zwölf Anwesenden.<br />
Festzuhalten bleibt: <strong>Die</strong> rückwirkende Benennung des 22. Julis 1910 als Gründungsdatum<br />
geschah nicht willkürlich, son<strong>der</strong>n weil an diesem Datum wesentliche<br />
äußere Zeichen – Name, Wahlspruch und wahrscheinlich auch die Farben – beschlossen<br />
worden waren. Der 22. Juli ist vermutlich auch <strong>der</strong> erste Tag, an <strong>dem</strong> die<br />
Gründungskommissare erstmals die beitrittsinteressierten Studenten mit an den<br />
Tisch holten.<br />
MARCHIÆ AUFNAHME IN DEN CV<br />
Weil die <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> gänzlich von CVern und für den CV ins Leben gerufen worden<br />
war, stand auch ihre Mitgliedschaft im CV als Ziel fest. <strong>Die</strong> Frage war nur, wie.<br />
Auf <strong>der</strong> Augsburger Cartellversammlung (20.-24. August 1910) wurde die Gründung<br />
bereits »mit stürmischem Beifall« begrüßt, man befand über die spätere Philistrierung<br />
<strong>der</strong> Märkerfüchse, obwohl <strong>Marchia</strong> noch keine CV-Verbindung war. 40<br />
Erst am 3. November 1910 beantragte <strong>Marchia</strong> die Aufnahme in den CV, und<br />
zwar als voll berechtigte Verbindung. Man hatte es nun sehr eilig, wie wir <strong>dem</strong><br />
beigefügten Anschreiben von Senior Lütke an den Vorortspräsidenten entnehmen:<br />
Wie Du <strong>aus</strong> unserem Gesuch ersiehst, haben wir als Tag für unser Publikationsfest den<br />
23. November (d.h. in drei Wochen) festgesetzt, da dieser Termin uns am günstigsten<br />
liegt. Um nun dann auch wirklich CVer zu sein, bedarf es <strong>der</strong> sofortigen Erledigung unseres<br />
Antrages. 41<br />
<strong>Die</strong> Entscheidung sollte per Ausnahmegesuch durch schriftliche Abstimmung geschehen.<br />
Normalerweise hätte man bis zur nächsten Cartellversammlung warten<br />
müssen, doch aufgrund <strong>der</strong> verbandsnahen Gründung gestattete <strong>der</strong> Vorort die<br />
Ausnahme. Als Frist legte er den 16. November fest. Das Votum fiel einstimmig für<br />
<strong>Marchia</strong> <strong>aus</strong>. 42 Seit <strong>dem</strong> 16. November 1910 ist die <strong>KDStV</strong> <strong>Marchia</strong> also Mitglied<br />
des CV. Vorortspräsident Georg Stöckl widmet <strong>dem</strong> Vorgang in seinem Tätigkeitsbericht<br />
für das Wintersemester 1910/11 folgende Zeilen:<br />
In ganz beson<strong>der</strong>em Maße können wir unserer Freude Ausdruck geben<br />
über den Zuwachs, den <strong>der</strong> CV unter <strong>dem</strong> V.O. Rheno-Franconia erfahren hat; die Anzahl<br />
<strong>der</strong> Corporationen erhöhte sich um 10. Alan Bo, Arm-Fbg, Frc-Cz wurden auf <strong>der</strong> CV<br />
zu Augsburg als vollberechtigte Verbindung aufgenommen.<br />
Desgleichen wurde <strong>der</strong> Aufnahmeantrag <strong>Marchia</strong>s an <strong>der</strong> technischen Hochschule zu<br />
Breslau, die von C-Br mit tatkräftiger Unterstützung des schlesischen A. H. Zirkels ins<br />
Leben gerufen wurde, durch CV Beschluß vom 16. Nov. angenommen u. als 71. vollberechtigte<br />
Verbindung in den CV eingereiht. 43<br />
40 Mnich 1920, S. 11; Zitat <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Begründung des Aufnahmeantrags vom 3. November.<br />
41 CV-Archiv; Kopie Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1910/11.<br />
42 VII. Rundschreiben des Vororts (Kopie im Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1910): »Der am 16. November<br />
zur Abstimmung fällige Antrag betreffend Aufnahme <strong>Marchia</strong>s als vollberechtigte Verbindung<br />
in den CV ist mit 56 Stimmen angenommen.« <strong>Die</strong> übrigen Verbindungen hatten zu spät o<strong>der</strong> gar<br />
nicht abgestimmt. Mnich 1920, S. 11, nennt irrtümlich den 19. November. Erst an diesem Tag<br />
wurde das Ergebnis offenbar <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> mitgeteilt (Gelhoit 1985, S. 22).
Der Name <strong>Marchia</strong><br />
<strong>Die</strong> Hektik lässt sich mit <strong>der</strong> zunächst ungewissen Rechtslage erklären. Im Vorfeld<br />
<strong>der</strong> Augsburger Cartellversammlung war noch nicht klar, ob man auch durch einen<br />
Teilungsbeschluss Mitglied werden könne. Das war aber nicht möglich, weil es sich<br />
nicht um eine Teilung im engeren Sinne handelte und die neue Verbindung nicht an<br />
<strong>der</strong>selben Hochschule gegründet werden sollte, an <strong>der</strong> die abgebenden Korporationen<br />
bestanden. 44<br />
DAS TH-MONOPOL DER MARCHIA<br />
Bei <strong>der</strong> Gründung <strong>Marchia</strong>s hatte sich <strong>der</strong> Breslauer CV (kurz: BrCV) darauf verständigt,<br />
dass allein <strong>Marchia</strong> Studenten <strong>der</strong> Technischen Hochschule aufnehmen dürfe,<br />
aber umgekehrt <strong>Marchia</strong> auch Studenten <strong>der</strong> Universität. Das geht <strong>aus</strong> einigen<br />
späteren Quellen hervor. Eine ähnliche Konstellation gab es im Münchener CV. Dort<br />
waren allein Vindelicia an <strong>der</strong> Technischen und Moenania an <strong>der</strong> Tierärztlichen<br />
Hochschule berechtigt, durften aber an<strong>der</strong>erseits selbst auch Universitätsstundenten<br />
aufnehmen. 45<br />
Dass die Regelung mit <strong>der</strong> Zeit bei den an<strong>der</strong>en Verbindungen Unmut <strong>aus</strong>löste,<br />
ist verständlich. Schon 1912 wurde sie bei einer BrCV-Sitzung in Frage gestellt, aber<br />
nicht verworfen. 46 Ende 1919 nahmen zwei <strong>der</strong> drei an<strong>der</strong>en CV-Verbindungen auf<br />
eigene F<strong>aus</strong>t TH-Studenten auf. <strong>Marchia</strong> trug den Fall <strong>dem</strong> Vorort vor und bekam<br />
Recht. 47<br />
Eine interessante Quelle zum Monopol ist folgen<strong>der</strong> Passus <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Semesterbericht<br />
von 1919/20:<br />
Unsere Keiltätigkeit, insbeson<strong>der</strong>e an <strong>der</strong> T.H., die ja fortan glücklicherweise uns allein<br />
vom Breslauer CV überlassen blieb (1. C.C.-Protokoll ad 1), hatte den Erfolg, dass wir im<br />
Laufe des Semesters nicht weniger als 15 stramme Neufüchse, darunter sechs Techniker,<br />
rezipieren konnten. 48<br />
Der Text belegt, dass die Vereinbarung von Anfang an galt. Der Schriftführer hatte<br />
das Protokoll des ersten Cumulativ-Convents offensichtlich noch vor sich liegen.<br />
Auch das quantitative Verhältnis <strong>der</strong> Studenten kommt zum Ausdruck – es waren<br />
mehr Märker an <strong>der</strong> Universität eingeschrieben als an <strong>der</strong> TH. Das Recht, an <strong>der</strong><br />
Universität zu werben, war also von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung. 49 1931 stellten<br />
allein die Geisteswissenschaften 65 Prozent <strong>der</strong> Aktivitas. 50 Allerdings waren auch<br />
die Universitätsstudenten verpflichtet, an <strong>der</strong> TH Vorlesungen zu belegen. 51<br />
43 CV-Archiv Nr. 4741; Kopie im Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1910. – <strong>Die</strong> an<strong>der</strong>en sechs waren die am<br />
15. März 1911 vom Katholisch-Deutschen Verband (KDV) in den CV übergetretenen Verbindungen<br />
Sauerlandia Münster, Novesia Bonn, Bavaria Berlin, Tuisconia München, Erwinia Straßburg, Palatia<br />
Marburg. Obwohl älter, rangieren sie nach Aufnahmedatum in <strong>der</strong> CV-Nummernfolge hinter<br />
<strong>Marchia</strong>.<br />
44 VI. Rundschreiben des Vororts vom 8. November (Kopie im Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1910)<br />
45 Mnich 1920, S. 26.<br />
46 Muschalle 1930, S. 9.<br />
47 Mnich 1920, S. 26f; Gelhoit 1985, S. 37, nennt Rheno-Palatia und Salia.<br />
48 Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1920, Semesterbericht.<br />
49 Mnich 1920, S. 12f; Muschalle 1930, S. 9.<br />
50 Sebulke 1960, S. 202: Philosophische Fakultät 28,56 %, Jura 24,28 %, Theologie 12,24 %.<br />
51 Mnich 1920, S. 12f.<br />
21
äpölküplküplüplüplüplü<br />
lüplä<br />
k<br />
22<br />
Verbindungsleben<br />
»Schon bald nach <strong>der</strong> Gründung« erteilte <strong>der</strong> Universitätsrektor <strong>Marchia</strong> das<br />
Recht, so die Märkerchronik, dort eingeschriebene Studenten aufzunehmen, 52 was<br />
vor<strong>aus</strong>setzt, dass <strong>Marchia</strong> auch an <strong>der</strong> Universität als Korporation offiziell anerkannt<br />
war. Einen Stehconvent eröffnete die <strong>Marchia</strong> dort allerdings erst zum Wintersemester<br />
1923/24. 53 An <strong>der</strong> TH war <strong>der</strong> Stehconvent von Anfang an Usus. <strong>Die</strong> Alten<br />
Herren Boenigk, Hoffmann und Frerich hatten die Verbindungstafel gestiftet, die in<br />
<strong>der</strong> Hochschule hing und an <strong>der</strong> man sich täglich mit Band und Mütze zum Aust<strong>aus</strong>ch<br />
von Neuigkeiten traf. 54<br />
KONSOLIDIERUNG UND FUSION MIT DER RHENO-SAXONIA KÖTHEN<br />
<strong>Die</strong> Startsituation <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> war durch zwei gegensätzliche Tendenzen geprägt.<br />
Einerseits die erfolgreiche Außendarstellung: Laut <strong>dem</strong> Lagebericht zum CV-<br />
Aufnahmeantrag vom 3. November gehörte <strong>Marchia</strong> <strong>der</strong> Kommission zur Ausarbeitung<br />
<strong>der</strong> Krankenkassenstatuten sowie <strong>dem</strong> Ausschuss an, <strong>der</strong> die feierliche Hochschuleinweihung<br />
im Beisein des Kaisers vorbereitete. Bei <strong>der</strong> Einweihung selbst<br />
repräsentierte <strong>Marchia</strong> mit einer Chargiertenabordnung. 55<br />
An<strong>der</strong>erseits war die Mitglie<strong>der</strong>entwicklung bedenklich schwach. Im Sommer<br />
1910 hatte <strong>Marchia</strong> sieben Burschen und zwei Füchse. Ende Oktober »wurde <strong>der</strong><br />
Betrieb mit fünf Bundesbrü<strong>der</strong>n, zu denen bald vier neue hinzukamen«, eröffnet. 56<br />
Am 3. November (CV-Antrag) zählte man sechs Burschen und zwei Füchse. <strong>Die</strong><br />
Aca<strong>dem</strong>ia listet zum 1. Dezember vier aktive und zwei inaktive Burschen sowie drei<br />
Füchse, das CV-Verzeichnis 1911 zählt zwei Urmitglie<strong>der</strong> und fünf Bandinhaber,<br />
jedoch keinen Fuchsen zur Aktivitas.<br />
Als Ursache wurde die schleppende Entwicklung <strong>der</strong> TH <strong>aus</strong>gemacht. Laut CV-<br />
Antrag waren 46 Vollstudenten immatrikuliert, das Vorlesungsverzeichnis nennt<br />
57. 57 <strong>Die</strong> unterschiedlichen Zahlen ergeben sich wohl <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> abweichenden Datum<br />
<strong>der</strong> Erhebung. So o<strong>der</strong> so war die Grundlage schmal, um allen acht im Jahre<br />
1910 bereits an <strong>der</strong> TH existierenden Korporationen 58 hinreichend Nachwuchs zu<br />
bieten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei weitem nicht alle Studenten in die<br />
Verbindungen gingen. 59<br />
Als außerordentlicher Glücksfall erwies sich die Anfrage <strong>der</strong> katholischen Studentenverbindung<br />
Rheno-Saxonia Köthen, mit <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> zu fusionieren. <strong>Die</strong>se Fusion<br />
wurde am 2. Juli 1911 besiegelt, wobei die Rheno-Saxonia unter Aufgabe von Namen<br />
und Farben ganz in <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> aufging. <strong>Die</strong> Rhein-Sachsen erreichten dadurch<br />
das Ziel, in den CV zu kommen (vgl. hierzu den anschließenden Beitrag über<br />
die Rheno-Saxonia). Gewiss, hinsichtlich dessen, dass die an<strong>der</strong>en TH-<br />
Verbindungen auf ihre Weise weiterkamen und dass <strong>Marchia</strong> den engagierten CV-<br />
52 Mnich 1920, S. 13.<br />
53 Semesterbericht 1923/24, Archiv <strong>Marchia</strong>, Mch Brs I, 1923.<br />
54 Mnich 1920, S. 14.<br />
55 Aca<strong>dem</strong>ia 23 (15. Dezember 1910), S. 326.<br />
56 Mnich 1920, S. 11.<br />
57 Königliche Technische Hochschule zu Breslau: Programm für das Studienjahr 1910/1911, nachgedruckt<br />
mit neuer Paginierung in: Gesellschaft <strong>der</strong> Freunde <strong>der</strong> Technischen Hochschule Breslau:<br />
<strong>Die</strong> Technische Hochschule Breslau, o. O., o. J. [1985], S. 155.<br />
58 Gelhoit 2009, S. 91.<br />
59 Nach Hochrechnungen waren um 1900 in Breslau nur 45% aller Studenten in Verbindungen aktiv<br />
(Gelhoit 2009, S. 87).
Der Name <strong>Marchia</strong><br />
Altherrenverband Schlesien im Rücken hatte, hätte man <strong>Marchia</strong> durch<strong>aus</strong> den<br />
Fortbestand <strong>aus</strong> eigener Kraft zutrauen können. Nun aber war <strong>Marchia</strong> »mit einem<br />
Schlage nach Winfridia die bestfundierte Verbindung« � so urteilte Emil Wilczek<br />
später, <strong>der</strong> die Fusion von Seiten <strong>der</strong> Rheno-Saxonia vorangetrieben hatte. Mehr<br />
noch: Gegenüber an<strong>der</strong>en Verbindungen gleichen Alters bescheinigt er <strong>Marchia</strong><br />
»einen Vorsprung von 15 Jahren«. 60<br />
Zweifellos bedeutete die Fusion personell und finanziell eine erhebliche Stärkung.<br />
Das CV-Verzeichnis vom Juli 1912 listet 44 Alte Herren, davon kamen 7 von<br />
an<strong>der</strong>en CV-Verbindungen und 37 von <strong>der</strong> Rheno-Saxonia, sowie 29 Studenten,<br />
davon 5 <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> CV und 24 von <strong>der</strong> Rheno-Saxonia. Am 1. Januar 1912 wurde das<br />
neue Märkerheim in <strong>der</strong> Karlstraße 44 eingeweiht, das Sommersemester brachte<br />
vier und das Wintersemester fünf Füchse. 61 Man war für Notzeiten gerüstet, so<br />
dass die <strong>Marchia</strong> während des Weltkrieges den Betrieb aufrechterhalten konnte. 62<br />
4) Woher kamen die ersten Märker?<br />
<strong>Die</strong> Gründungskommission scheint sich mit <strong>dem</strong> Namensbezug <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> nicht<br />
explizit befasst zu haben, zumindest ist nichts an<strong>der</strong>es bekannt. Das würde bedeuten,<br />
dass diese Frage den Märkern selbst überlassen blieb. Der Name einer Studentenkorporation<br />
hängt häufig mit <strong>der</strong> Heimat ihrer Mitglie<strong>der</strong> zusammen. Johannes<br />
Mnich begründet den mutmaßlichen Namensbezug auf Brandenburg damit, dass<br />
sich von dort »verschiedene Cartellbrü<strong>der</strong> angesagt« hätten. An<strong>der</strong>erseits nennt er<br />
die Grafschaft Mark als namengebend. Es ist also zu klären, <strong>aus</strong> welchen Gegenden<br />
die ersten Märker aber stammten.<br />
Von den zwölf Gründungsmärkern kamen acht <strong>aus</strong> Schlesien (Glasnek, Hoffmann,<br />
Moser, Schramm, Ziegler, Feyer, Muschalle, Ukoszek), zwei <strong>aus</strong> Westfalen<br />
(Frerich, Lütke) und je einer <strong>aus</strong> Ostpreußen (Boenigk) und Nie<strong>der</strong>sachsen (Abmeier);<br />
Brandenburg ist in diesem Personenkreis nicht vertreten. 63 Ausgerechnet die<br />
beiden Westfalen waren es, die die Spitzenämter <strong>der</strong> Verbindung bekleideten:<br />
Heinrich Lütke, <strong>der</strong> erste Aktivensenior <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong>, war 1886 in Dortmund-Marten<br />
geboren und in Bochum-Höntrop aufgewachsen. Er stammte somit <strong>aus</strong> <strong>der</strong> alten<br />
Grafschaft Mark, die Mnich als Namen gebend für die <strong>Marchia</strong> favorisiert. 1905<br />
begann Lütke sein Schiffb<strong>aus</strong>tudium in Danzig und trat <strong>der</strong> Baltia bei. 1906 sattelte<br />
er um auf Eisenhüttenkunde an <strong>der</strong> RWTH Aachen, wo er bei <strong>der</strong> Franconia Aufnahme<br />
fand. 1910 wechselte er während seiner Promotion zur Technischen Hochschule<br />
Breslau (mit <strong>der</strong> Matrikel-Nummer 3) und wurde am 8. April 1911 <strong>der</strong>en<br />
erster Doktor-Absolvent. Als er <strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> beitrat, hatte er das Hauptexamen bereits<br />
in <strong>der</strong> Tasche. Nach seiner Promotion verließ Lütke Schlesien und machte<br />
Karriere an mehreren westdeutschen Standorten. 1920 gründete er in Aachen die<br />
<strong>KDStV</strong> Kaiserpfalz mit. Nach <strong>dem</strong> 2. Weltkrieg engagierte er sich für die Wie<strong>der</strong>herstellung<br />
<strong>der</strong> <strong>Marchia</strong> in Aachen. 1975 verstarb Heinrich Lütke im Alter von 90 Jahren.<br />
64<br />
60 Emil Wilczek, Erinnerungen an die Fusion <strong>Marchia</strong>–Rheno-Saxonia, in: Märker-Blätter, Son<strong>der</strong>nummer<br />
November 1930, S. 11-15, hier S. 15.<br />
61 Mnich 1920, S. 20.<br />
62 Mnich 1920, S. 23.<br />
63 Archiv <strong>Marchia</strong>, Bbr. I 1-10, 12-13; CV-Verzeichnisse und Aca<strong>dem</strong>ia-Beilagen 1910-1912.<br />
64 Archiv <strong>Marchia</strong>, Bbr. I 9; Märker-Blätter 39 (Juni 1971), S. 2 und 48 (Juli 1976), S. 7f.<br />
23