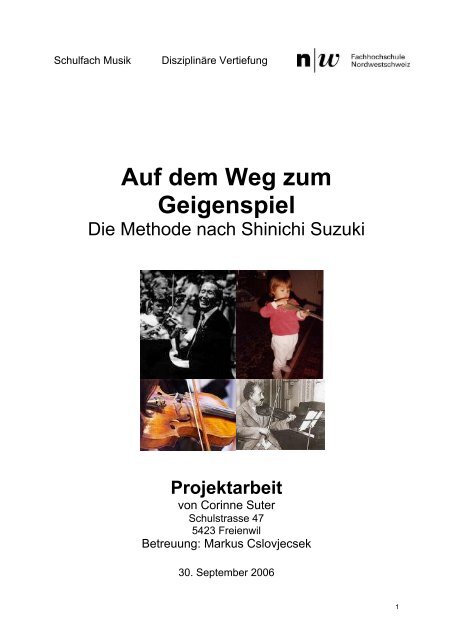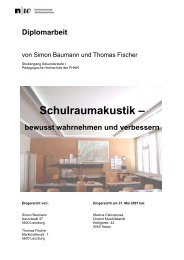Auf dem Weg zum Geigenspiel - schulfachmusik.ch
Auf dem Weg zum Geigenspiel - schulfachmusik.ch
Auf dem Weg zum Geigenspiel - schulfachmusik.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
S<strong>ch</strong>ulfa<strong>ch</strong> Musik Disziplinäre Vertiefung<br />
<strong>Auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zum</strong><br />
<strong>Geigenspiel</strong><br />
Die Methode na<strong>ch</strong> Shini<strong>ch</strong>i Suzuki<br />
Projektarbeit<br />
von Corinne Suter<br />
S<strong>ch</strong>ulstrasse 47<br />
5423 Freienwil<br />
Betreuung: Markus Cslovjecsek<br />
30. September 2006<br />
1
Inhaltsverzei<strong>ch</strong>nis<br />
1. Vorwort S. 3<br />
2. <strong>Weg</strong>e <strong>zum</strong> <strong>Geigenspiel</strong> S. 5<br />
2.1 Shini<strong>ch</strong>i Suzuki: Biographie S. 5<br />
2.2 Die Methode na<strong>ch</strong> Shini<strong>ch</strong>i Suzuki S. 8<br />
3. Eigene Untersu<strong>ch</strong>ungen S. 12<br />
3.1 Meine Lernbiographie S. 12<br />
3.2 Interview mit Lisa und Takuya Segawa S. 14<br />
3.3 Besu<strong>ch</strong> in der Suzuki-S<strong>ch</strong>ule Züri<strong>ch</strong> S. 18<br />
4. Mutterspra<strong>ch</strong>enmethode S. 21<br />
4.1 Wie das Kind spre<strong>ch</strong>en lernt S. 21<br />
4.2 Synthese: Inwiefern lassen si<strong>ch</strong> Prinzipien des Spra<strong>ch</strong>-<br />
erwerbs auf das Erlernen eines Instrumentes übertragen? S. 23<br />
5. Konklusion S. 25<br />
6. Na<strong>ch</strong>wort S. 28<br />
7. Quellen S. 29<br />
2
1. Vorwort<br />
Seit meinem a<strong>ch</strong>ten Lebensjahr spiele i<strong>ch</strong> Violine und seit bald sieben Jahren au<strong>ch</strong> in einem<br />
Or<strong>ch</strong>ester. Der Begriff „Musik“ ist für mi<strong>ch</strong> somit eng mit der Violine verbunden.<br />
Mir war sofort klar, dass i<strong>ch</strong> diese Fa<strong>ch</strong>arbeit in Verbindung zu <strong>dem</strong> Instrument Violine<br />
ma<strong>ch</strong>en wollte. I<strong>ch</strong> hatte zwar gewusst, dass es eine japanis<strong>ch</strong>e Geigens<strong>ch</strong>ule gab, bei<br />
wel<strong>ch</strong>er Kinder s<strong>ch</strong>on sehr früh zu spielen beginnen. Genaueres war mir jedo<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t bekan-<br />
nt. Erst im Gesprä<strong>ch</strong> mit einer Freundin stiess i<strong>ch</strong> auf den Namen Suzuki-Methode. So<br />
ma<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> im Internet kundig über die Grundprinzipien dieser Methode. Je mehr i<strong>ch</strong> er-<br />
fuhr, desto grösser wurde mein Interesse, so dass i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> ents<strong>ch</strong>ied, die Suzuki-Methode<br />
<strong>zum</strong> Thema meiner Fa<strong>ch</strong>arbeit zu ma<strong>ch</strong>en.<br />
Die Entwicklung einer Fragestellung war jedo<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t ganz einfa<strong>ch</strong>. Mir war bewusst, dass es<br />
im Rahmen einer sol<strong>ch</strong>en Arbeit ni<strong>ch</strong>t mögli<strong>ch</strong> ist, herauszufinden, ob die Suzuki-Methode<br />
nun besser als andere Methoden sei oder ni<strong>ch</strong>t. Dazu wären Langzeitstudien mit Versu<strong>ch</strong>s-<br />
personen nötig. Anahand der Lektüre von Fa<strong>ch</strong>literatur, von Gesprä<strong>ch</strong>en und eines Besu<strong>ch</strong>s<br />
in der Suzuki-S<strong>ch</strong>ule könnte i<strong>ch</strong> mir jedo<strong>ch</strong> ein Bild von dieser Methode ma<strong>ch</strong>en. Im Laufe<br />
des Literaturstudiums weckte dann die Idee von Suzuki, den Erwerb der Mutterspra<strong>ch</strong>e auf<br />
das Erlernen eines Instruments zu übertragen, mein besonderes Interesse. So bes<strong>ch</strong>äftigte<br />
i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> zusätzli<strong>ch</strong> mit <strong>dem</strong> Prozess des Spra<strong>ch</strong>erwerbs bei Kindern.<br />
Entspre<strong>ch</strong>end soll meine Fa<strong>ch</strong>arbeit die folgenden Fragen untersu<strong>ch</strong>en:<br />
Worin besteht die Suzuki-Methode?<br />
Wel<strong>ch</strong>es sind ihre Stärken und S<strong>ch</strong>wä<strong>ch</strong>en?<br />
Kann der Prozess des Mutterspra<strong>ch</strong>erwerbs auf das Erlernen eines Musikinstruments<br />
übertragen werden?<br />
Zuerst mö<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> mit der Biographie von Shini<strong>ch</strong>i Suzuki befassen, um zu erfahren,<br />
was für eine Persönli<strong>ch</strong>keit hinter dieser Methode steht und wie er auf seien Ideen gestossen<br />
ist (2.1). Dana<strong>ch</strong> werde i<strong>ch</strong> seine Methode in ihren Grundprinzipien genauer vorstellen (2.2).<br />
Um mi<strong>ch</strong> besser in die Lage eines japanis<strong>ch</strong>en Kindes, das na<strong>ch</strong> der Suzuki-Methode Violine<br />
spielen lernt, versetzten zu können, und um mögli<strong>ch</strong>st detaillierte Verglei<strong>ch</strong>kriterien zu<br />
haben, will i<strong>ch</strong> mir in einem speziellen Kapitel meine eigenen Lernbiographie als Geigen-<br />
s<strong>ch</strong>ülerin vergegenwärtigen (3.1). In den folgenden Kapiteln präsentiere i<strong>ch</strong> meine eigenen<br />
Untersu<strong>ch</strong>ungen, nämli<strong>ch</strong> ein Interview mit zwei Personen, wel<strong>ch</strong>e in Japan die Suzuki-<br />
Methode kennen gelernt haben (3.2), sowie meinen Besu<strong>ch</strong> in der Suzuki-S<strong>ch</strong>ule Züri<strong>ch</strong><br />
(3.3). Das Thema des vierten Kapitels ist der Spra<strong>ch</strong>erwerb von Kindern und die Frage, in-<br />
wiefern dessen Me<strong>ch</strong>anismen auf das Erlernen eines Instruments übertragen werden kön-<br />
nen. Abs<strong>ch</strong>liessen mö<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong> meine Arbeit mit einer persönli<strong>ch</strong>en Konklusion, in wel<strong>ch</strong>er i<strong>ch</strong><br />
3
meine S<strong>ch</strong>lüsse aus meinen Untersu<strong>ch</strong>ungen und Re<strong>ch</strong>er<strong>ch</strong>en ziehe und ein persönli<strong>ch</strong>es<br />
Urteil entwickle.<br />
An dieser Stelle mö<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> bei allen bedanken, die mi<strong>ch</strong> bei dieser Arbeit unterstützt<br />
haben. Besonderen Dank ri<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong> an Lisa und Takuya Segawa sowie an Martin Rüttimann,<br />
wel<strong>ch</strong>e si<strong>ch</strong> Zeit genommen haben, mir ihr Wissen und ihre Erfahrungen mitzuteilen.<br />
Herzli<strong>ch</strong>en Dank gilt meinem Betreuer Markus Cslovjecsek, der mir stets beratend zur Seite<br />
stand.<br />
4
2. <strong>Weg</strong>e <strong>zum</strong> <strong>Geigenspiel</strong><br />
2.1 Shini<strong>ch</strong>i Suzuki: Biographie<br />
Abb. 1: Shini<strong>ch</strong>i Suzuki<br />
„Bis zu unserem Tod dürfen wir weder Zeit no<strong>ch</strong> Mühe<br />
s<strong>ch</strong>euen, um unsere S<strong>ch</strong>wä<strong>ch</strong>en in Verdienste zu ver-<br />
wandeln.“<br />
(S. Suzuki, in www.suzuki-luzern.<strong>ch</strong>/suzuki, Abfrage vom<br />
10.9.06)<br />
Shini<strong>ch</strong>i Suzuki wurde am 17. Oktober 1898 in Nagoya,<br />
Japan geboren. Sein Vater Masaki<strong>ch</strong>i Suzuki war der<br />
Gründer der grössten Geigenfabrik der Welt. S<strong>ch</strong>on Suzukis<br />
Urgrossvater hatte <strong>zum</strong> Nebenverdienst japanis<strong>ch</strong>e Zupf-<br />
instrumente gebaut. Shini<strong>ch</strong>is Vater, der im Jahre 1859<br />
geboren wurde, interessierte si<strong>ch</strong> aber sehr für westli<strong>ch</strong>e<br />
Musikinstrumente. So erfors<strong>ch</strong>te er die Geige und versu<strong>ch</strong>te au<strong>ch</strong>, ein sol<strong>ch</strong>e zu bauen.<br />
Na<strong>ch</strong> vielen Misserfolgen stellte er 1888 seine erste Geige her. Bald darauf erfolgte bald die<br />
Gründung einer Fabrik, die si<strong>ch</strong> auf den Geigenbau spezialisierte. Sie bes<strong>ch</strong>äftigte rund<br />
1100 Arbeiter, und es konnten tägli<strong>ch</strong> bis zu 400 Geigen und 4000 Bögen produziert werden.<br />
(vgl. Suzuki 1994)<br />
Shini<strong>ch</strong>i Suzuki wu<strong>ch</strong>s im Umfeld dieser Fabrik auf und half dort später, als er die Handels-<br />
s<strong>ch</strong>ule besu<strong>ch</strong>te, während der langen Sommerferien mit. Dabei lernte er viel über den<br />
Geigenbau. (vgl. Suzuki 1994) Do<strong>ch</strong> die Beziehung zu diesem Instrument entwickelte si<strong>ch</strong><br />
erst später. „Dabei war i<strong>ch</strong> in einer Geigenfabrik aufgewa<strong>ch</strong>sen, und wenn i<strong>ch</strong> mit meinen<br />
Ges<strong>ch</strong>wistern Streit bekam, s<strong>ch</strong>lugen wir mit den Geigen aufeinander los, die wir damals für<br />
eine Art Spielzeug hielten.“ (Suzuki 1994, S. 86) Die Liebe <strong>zum</strong> Klang der Violine entdeckte<br />
Shini<strong>ch</strong>i Suzuki mit <strong>dem</strong> Erwerb seiner ersten S<strong>ch</strong>allplatte. In der Zeit vor <strong>dem</strong> Abs<strong>ch</strong>luss der<br />
Handelss<strong>ch</strong>ule erwarb die Familie einen Plattenspieler, und so kaufte si<strong>ch</strong> Shini<strong>ch</strong>i eine<br />
S<strong>ch</strong>allplatte mit <strong>dem</strong> Ave Maria von S<strong>ch</strong>ubert. (vgl. Suzuki 1994)<br />
„Der liebli<strong>ch</strong>e Klang von Mis<strong>ch</strong>a Elmans <strong>Geigenspiel</strong> versetzte mi<strong>ch</strong> in tiefes Entzücken. Sein<br />
sanfter Ton, mit <strong>dem</strong> er die Melodie spielte, kam wie aus einem Traum. I<strong>ch</strong> war gewaltig be-<br />
eindruckt. Was für eine Vorstellung, dass eine Geige, die i<strong>ch</strong> als Spielzeug betra<strong>ch</strong>tet hatte,<br />
einen derart s<strong>ch</strong>önen Klang hervorzubringen vermo<strong>ch</strong>te!“ (Suzuki 1994, S. 87)<br />
Suzuki war so gerührt, dass er kurzerhand eine Geige aus der Fabrik mit na<strong>ch</strong> Hause nahm<br />
und versu<strong>ch</strong>te, Elmans Ausführungen na<strong>ch</strong>zuahmen. Er besass keine Noten, und so ver-<br />
5
su<strong>ch</strong>te er das zu spielen, was er hörte. Tag für Tag hörte er si<strong>ch</strong> eine <strong>Auf</strong>nahme von Haydns<br />
Menuett an, bis es ihm s<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> gelang, das Stück zu spielen. (vgl. Suzuki 1994)<br />
Ab <strong>dem</strong> 17. Lebensjahr erlernte Suzuki das <strong>Geigenspiel</strong> autodidaktis<strong>ch</strong> mit Hilfe seiner<br />
S<strong>ch</strong>allplatten. Erst mit einundzwanzig Jahren ging er dann na<strong>ch</strong> Tokio und lernte die violini-<br />
stis<strong>ch</strong>e Grundte<strong>ch</strong>nik. Seine Geigenlehrerin riet ihm, Musik zu studieren, do<strong>ch</strong> er merkte<br />
bald, dass ihn die vorhandenen Ausbildungsmögli<strong>ch</strong>keiten ni<strong>ch</strong>t <strong>zum</strong> Ziel bringen konnten,<br />
wel<strong>ch</strong>es er anstrebte. Das Spiel der Absolventen hatte seiner Meinung na<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t annährend<br />
die Qualität der Musik auf seinen S<strong>ch</strong>allplatten. So setzte er den privaten Violinunterri<strong>ch</strong>t fort.<br />
Suzuki pflegte Kontakt mit <strong>dem</strong> Fürsten Tokugawa. Diese Freunds<strong>ch</strong>aft ermögli<strong>ch</strong>te ihm im<br />
Oktober 1920 die Überfahrt na<strong>ch</strong> Europa. Der Fürst s<strong>ch</strong>lug Suzuki vor, in Deuts<strong>ch</strong>land zu<br />
bleiben, um dort Geige zu studieren. So begann Suzuki mit 22 Jahren bei Karl Klingler in<br />
Berlin sein Studium. (vgl. C.M. Barrett 1995)<br />
In Deuts<strong>ch</strong>land lernte Suzuki viel über Kunst und über das virtuose <strong>Geigenspiel</strong>. Er war oft<br />
Gast im Hause Klingler und konnte dort Bekannts<strong>ch</strong>aft mit wi<strong>ch</strong>tigen Persönli<strong>ch</strong>keiten<br />
ma<strong>ch</strong>en. So lernte er Albert Einstein kennen, mit wel<strong>ch</strong>em er dann intensiven Kontakt pflegte<br />
und au<strong>ch</strong> ab und zu musizierte. In Berlin lernte er au<strong>ch</strong> seine zukünftige Ehefrau Waltraud<br />
Prange kennen. Sie stammte aus einer Musikerfamilie und studierte Gesang.<br />
Eine wi<strong>ch</strong>tige Einsi<strong>ch</strong>t gewann Suzuki in Deuts<strong>ch</strong>land beim Erlernen der deuts<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>e.<br />
Suzuki war beeindruckt, mit wel<strong>ch</strong>er Fertigkeit kleine Kinder Deuts<strong>ch</strong> spra<strong>ch</strong>en. Er hörte<br />
Zweijährige mit der grössten Mühelosigkeit und Geläufigkeit plappern, währenddessen er<br />
selber mit jeder Silbe und je<strong>dem</strong> Satz zu kämpfen hatte. Damals fragte si<strong>ch</strong> Suzuki <strong>zum</strong><br />
ersten Mal, ob man Kindern andere s<strong>ch</strong>wierige Dinge ni<strong>ch</strong>t ebenso lei<strong>ch</strong>t beibringen könne<br />
wie das Erlernen der Mutterspra<strong>ch</strong>e. Das war eine der Erfahrungen, die zur späteren Ent-<br />
wicklung der Mutterspra<strong>ch</strong>enmethode führte. (vgl. C.M. Barrett 1995)<br />
Na<strong>ch</strong> a<strong>ch</strong>t Jahren kehrte er zusammen mit seiner Ehefrau na<strong>ch</strong> Japan zurück. Dort gab er<br />
Geigenunterri<strong>ch</strong>t, wurde Direktor einer Musiks<strong>ch</strong>ule und war später Dirigent des Tokyo String<br />
Or<strong>ch</strong>estras. (vgl. www.wikipedia.org/wiki/Shini<strong>ch</strong>iSuzuki, Abfrage 10.9.06) Ab 1930<br />
unterri<strong>ch</strong>tete er am kaiserli<strong>ch</strong>en Konservatorium in Tokio. Während dieser Zeit fragte ihn<br />
einer seiner erwa<strong>ch</strong>senen Studenten, ob er seinen vierjährigen Sohn, To<strong>ch</strong>iya Eto, unter-<br />
ri<strong>ch</strong>ten könne. „Hier kam ihm die Idee, die er später <strong>zum</strong> Kern seiner Unterri<strong>ch</strong>tsmethode<br />
ma<strong>ch</strong>te; er wollte den Jungen auf dieselbe Art und Weise unterri<strong>ch</strong>ten, wie ein kleines Kind<br />
die Mutterspra<strong>ch</strong>e lernt.“ (www.mi<strong>ch</strong>ael-koeppe.de/Suzuki_Methode/Biografie, Abfrage vom<br />
10.9.06) Suzuki stand vor einer neuen Herausforderung. Er begann für To<strong>ch</strong>iya Eto Stücke<br />
zu sammeln, von wel<strong>ch</strong>en dieser lernen konnte und wel<strong>ch</strong>e ihm au<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> Freude bereiten<br />
sollten. Der zweite kleine S<strong>ch</strong>üler war Koji Toyoda. Beide wurden erfolgrei<strong>ch</strong>e Geiger.<br />
Toyoda war der erste japanis<strong>ch</strong>e Konzertmeister des Berliner Symphonieor<strong>ch</strong>esters. (vgl.<br />
6
C.M. Barrett 1995) Suzuki selbst betonte aber immer wieder: „This was the result of<br />
education – not genius.“ (C. M. Barrett 1995, S. 27)<br />
Suzuki arbeitete über zehn Jahre an der Entwicklung seiner speziellen Unterri<strong>ch</strong>tsmethode,<br />
und es dauerte no<strong>ch</strong> zehn weitere Jahre, bis das erste Heft seiner Geigens<strong>ch</strong>ule ver-<br />
öffentli<strong>ch</strong>t wurde. Na<strong>ch</strong> <strong>dem</strong> zweiten Weltkrieg, im Jahre 1945 gründete Shini<strong>ch</strong>i Suzuki das<br />
Talent-Erziehungsinstitut in Matsumoto. (vgl. www.suzuki-luzern.<strong>ch</strong>/suzuki, Abfrage vom<br />
10.9.06)<br />
Das erste Konzert in Matsumoto fand 1947 mit rund 100 Kindern statt. 1964 folgte das erste<br />
Kon-zert in Übersee, in den USA. Heute werden weltweit über 500’000 Kinder na<strong>ch</strong> der<br />
Methode von Shini<strong>ch</strong>i Suzuki unterri<strong>ch</strong>tet. (vgl. www.mi<strong>ch</strong>ael-koeppe.de/<br />
Suzuki_Methode/Biografie, Abfrage vom 10.9.06)<br />
„Bis <strong>zum</strong> S<strong>ch</strong>luss galt sein Leben<br />
der unaufhörli<strong>ch</strong>en Arbeit, der<br />
beständigen Bemühung um<br />
Verbesserung, Vertiefung und<br />
Weiterentwicklung seiner<br />
Methode.“ (www.suzuki-luzern.<strong>ch</strong>/<br />
suzuki, Abfrage vom 10.9.06)<br />
Shini<strong>ch</strong>i Suzuki verstarb 1998 fast<br />
hundertjährig in seiner<br />
Heimatstadt, Nagoya. (vgl.<br />
www.wikipedia.org/<br />
Shini<strong>ch</strong>i_Suzuki, Abfrage vom<br />
10.9.06)<br />
Abb. 2: Suzuki mit einigen seiner jungen S<strong>ch</strong>üler<br />
7
2.2 Die Methode na<strong>ch</strong> Shini<strong>ch</strong>i Suzuki<br />
„Oh, – sieh einmal an, japanis<strong>ch</strong>e Kinder können alle japanis<strong>ch</strong> spre<strong>ch</strong>en! Dieser plötzli<strong>ch</strong>e<br />
Einfall versetzte mi<strong>ch</strong> in Verblüffung. In der Tat, alle Kinder der Welt spre<strong>ch</strong>en ihre Mutter-<br />
spra<strong>ch</strong>e mit der grössten Geläufigkeit. (..) Ist das ni<strong>ch</strong>t der Beweis eines aufsehener-<br />
regenden Talentes? Wie, mit wel<strong>ch</strong>en Mitteln kommt es dazu? I<strong>ch</strong> musste mi<strong>ch</strong> beherrs<strong>ch</strong>en,<br />
um meine Freude über diese Erkenntnis ni<strong>ch</strong>t in die Welt hinauszus<strong>ch</strong>reien.“ (Suzuki 1994,<br />
S. 13)<br />
Diese Erkenntnis stand ganz zu Beginn der Methode von Shini<strong>ch</strong>i Suzuki, wel<strong>ch</strong>e au<strong>ch</strong><br />
Mutterspra<strong>ch</strong>enmethode genannt wird. Suzuki war s<strong>ch</strong>on während seines <strong>Auf</strong>enthalts in<br />
Deuts<strong>ch</strong>land beeindruckt von den Spra<strong>ch</strong>fähigkeiten kleiner Kinder. Die oben erwähnte Er-<br />
kenntnis liess ihn dann über das Erziehungssystem na<strong>ch</strong>denken. „Wenn sie nun alle so<br />
lei<strong>ch</strong>t und geläufig japanis<strong>ch</strong> spre<strong>ch</strong>en, muss da do<strong>ch</strong> ein Geheimnis liegen, und zwar in der<br />
Ausbildung. Tatsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> werden alle Kinder überall in der Welt dur<strong>ch</strong> eine perfekte Methode<br />
erzogen: dur<strong>ch</strong> die Mutterspra<strong>ch</strong>e. Warum dann diese Methode ni<strong>ch</strong>t au<strong>ch</strong> auf andere Ver-<br />
anlagungen anwenden?“ (Suzuki 1994, S.14)<br />
Suzuki war der Überzeugung, dass der Mens<strong>ch</strong> ohne Begabung geboren wird. Was aus <strong>dem</strong><br />
Mens<strong>ch</strong>en werde, das werde dur<strong>ch</strong> seine Umgebung bestimmt. Shini<strong>ch</strong>i Suzuki verglei<strong>ch</strong>t in<br />
seinem Bu<strong>ch</strong> „Erziehung ist Liebe“ die Fähigkeit mit <strong>dem</strong> Samen einer Pflanze. Der Samen<br />
benötigt Zeit und au<strong>ch</strong> Anreize um zu keimen. Trägt man <strong>dem</strong> Keimling ni<strong>ch</strong>t Sorge, so wird<br />
er wieder verwelken. So ist es au<strong>ch</strong> beim Entwickeln einer Fähigkeit, es brau<strong>ch</strong>t Zeit, die<br />
ri<strong>ch</strong>tige Umgebung, Geduld und Wiederholung. In seinem Bu<strong>ch</strong> zeigt Suzuki anhand einiger<br />
Beispiele, dass Fähigkeiten dur<strong>ch</strong>aus entwickelt werden können. So gab er seiner Unter-<br />
ri<strong>ch</strong>tsmethode au<strong>ch</strong> den treffenden Namen Talenterziehung.<br />
Na<strong>ch</strong> Suzuki werden Kinder ni<strong>ch</strong>t mit einem Tonempfinden geboren. Hört ein Kind das<br />
S<strong>ch</strong>laflied immer wieder mit fals<strong>ch</strong>en Melodietönen, so gewöhnt si<strong>ch</strong> sein Gehör daran, und<br />
es eignet si<strong>ch</strong> jeden fals<strong>ch</strong>en Ton an. Später wird es s<strong>ch</strong>wierig sein, dies umzulernen. So<br />
haben die Umgebung und die Erziehungsweise eine sehr zentrale Rolle in der Entwicklung<br />
eines Kindes. (vgl. Suzuki 1994)<br />
„ (...) so glaube i<strong>ch</strong>, dass wir uns im Allgemeinen nur die Eltern anzusehen brau<strong>ch</strong>en, um zu<br />
erraten, wie die Kinder einmal sein werden.“ (Suzuki 1994, S. 30)<br />
So entwickelte er seine Methode in enger Anlehnung an die mutterspra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Erziehung.<br />
Deshalb wird sie au<strong>ch</strong> Mutterspra<strong>ch</strong>enmethode genannt.<br />
8
Die Hauptmerkmale der Suzuki-Methode sind:<br />
- Sehr früher Lernbeginn (im Alter von zwei bis vier Jahren)<br />
- Lernen dur<strong>ch</strong> Na<strong>ch</strong>ahmung und praktis<strong>ch</strong>es Tun, ni<strong>ch</strong>t hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> über den Verstand<br />
- Viel Musik hören<br />
- Zuerst <strong>Geigenspiel</strong> na<strong>ch</strong> Gehör, Notenlesen wird erst später eingeführt<br />
- Einbeziehung der Eltern in den Lernprozess<br />
- Einzel- und Gruppenunterri<strong>ch</strong>t<br />
- Ein festes Basisrepertoire<br />
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Suzuki-Methode, Abfrage vom 10.9.06)<br />
Früher Lernbeginn<br />
Suzuki erkannte, si<strong>ch</strong>erli<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> die Beoba<strong>ch</strong>tung der Kinder beim Spra<strong>ch</strong>erwerb, die<br />
enorme Lernfähigkeit kleiner Kinder. „ (... ) Darüber hinaus wird ein Kind erst vom fünften<br />
oder se<strong>ch</strong>sten Lebensjahr an beurteilt. Niemand s<strong>ch</strong>eint si<strong>ch</strong> darum zu kümmern, was zuvor<br />
ges<strong>ch</strong>ehen ist, wie das Kind in seiner frühesten Kindheit erzogen wurde. Alle Kinder, die<br />
sa<strong>ch</strong>kundig und verständnisvoll erzogen werden, errei<strong>ch</strong>en einen hohen Bildungsgrad, aber<br />
diese Erziehung muss vom Tage der Geburt an beginnen.“ (Suzuki 1994, S. 15)<br />
Suzuki betonte, wie kritis<strong>ch</strong> die früheste Kindheit ist. Die guten oder s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ten Fähigkeiten<br />
von Kindern werden oft erst in ihrem fünften oder se<strong>ch</strong>sten Lebensjahr beurteilt, und bis zu<br />
dieser Zeit wurde ja s<strong>ch</strong>on erzieheris<strong>ch</strong> auf sie eingewirkt. (vgl. Suzuki 1994)<br />
Lernen dur<strong>ch</strong> Na<strong>ch</strong>ahmung und praktis<strong>ch</strong>es Tun<br />
Die Lehrperson spielt <strong>dem</strong> Kind vor, und das Kind versu<strong>ch</strong>t, die Haltung und die Bewe-<br />
gungen na<strong>ch</strong>zuahmen. Da die Haltung von grösster Wi<strong>ch</strong>tigkeit ist, kontrolliert und korrigiert<br />
die Lehrperson sie immer wieder. Bei einem meiner Interviews habe i<strong>ch</strong> zu<strong>dem</strong> gehört, dass<br />
viele Kinder zu Beginn eine Pappgeige in der Hand halten und an dieser die<br />
Bewegungsabläufe üben.<br />
Viel Musik hören<br />
Suzuki legte grossen Wert darauf, dass die Kinder s<strong>ch</strong>on früh mit<br />
Musik in Kontakt kommen. Das Musikhören im Säuglingsalter trägt zur<br />
späteren Musikalität bei. Zum Suzuki-Notenheft gibt es eine CD,<br />
wel<strong>ch</strong>e das Kind so oft wie mögli<strong>ch</strong> hören und mit wel<strong>ch</strong>er es au<strong>ch</strong><br />
üben soll. (vgl. Suzuki 1994)<br />
Abb. 3: Suzuki - CD<br />
9
Zuerst <strong>Geigenspiel</strong> na<strong>ch</strong> Gehör, Notenlesen wird erst später eingeführt<br />
Lange bevor es s<strong>ch</strong>reiben lernt, kann das Kleinkind s<strong>ch</strong>on spre<strong>ch</strong>en. Diese Reihenfolge<br />
übernimmt au<strong>ch</strong> Suzuki bewusst. Das Kind lernt alle Stücke über das Gehör dur<strong>ch</strong> Na<strong>ch</strong>-<br />
ahmen der Lehrperson oder der Eltern. Das Kind erlebt so die Musik von Anfang an als ein<br />
lebendiges Ganzes und muss somit vorerst ni<strong>ch</strong>t analytis<strong>ch</strong> arbeiten. Das Notenlesen wird<br />
erst im vierten Band eingeführt. In den Bänden 1 bis 3 sind zwar alle Stücke notiert, das Kind<br />
lernt und spielt aber alles immer auswendig. (vgl. Suzuki 1994; www.suzuki-luzern.<strong>ch</strong>,<br />
Abfrage vom 10.9.06)<br />
Einbeziehung der Eltern in den Lernprozess<br />
Die aktive Mitarbeit von Mutter oder Vater ist von grundlegender Bedeutung, denn diese<br />
sollen die Kinder zu Hause beim tägli<strong>ch</strong>en Üben anleiten und ermutigen. Na<strong>ch</strong> der Idee von<br />
Shini<strong>ch</strong>i Suzuki beginnt ein Elternteil ebenfalls mit <strong>dem</strong> Geigenunterri<strong>ch</strong>t. Zuerst lernt die<br />
Mutter oder der Vater ein Stück, so dass sie oder er zu Hause eine gute Lehrperson sein<br />
kann. Da Kinder vorwiegend zu Hause erzogen werden, ist es na<strong>ch</strong> Suzuki unentbehrli<strong>ch</strong>,<br />
dass mindestens ein Elternteil die Erfahrungen mit <strong>dem</strong> Instrument selbst ma<strong>ch</strong>t. Nur so<br />
können <strong>dem</strong> Kind au<strong>ch</strong> zu Hause eine gute Körperhaltung und die ri<strong>ch</strong>tige Einstellung <strong>zum</strong><br />
Üben weitergegeben werden. Bei drei- bis vierjährigen Kindern verwendet Suzuki zu<strong>dem</strong> das<br />
Vorbild eines Elternteils, um überhaupt den Wuns<strong>ch</strong>, Geige zu spielen, zu wecken. So hört<br />
ein sol<strong>ch</strong>es Kind zuerst zu Hause nur die S<strong>ch</strong>allplattenaufnahmen und sieht, wie seine<br />
Mutter oder sein Vater und andere Kinder Unterri<strong>ch</strong>t erhalten. Dadur<strong>ch</strong> wird das Kind bald<br />
au<strong>ch</strong> das Verlangen empfinden selbst zu spielen.<br />
Spielt das Kind dann au<strong>ch</strong> Geige, nimmt ein Elternteil weiter Lektionen, um ihm immer ein<br />
Stück voraus zu sein. Der Vorteil davon ist, dass die Kinder ein solides instrumental-<br />
te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>es Niveau und eine positive Einstellung zu ihrem<br />
Instrument und zur Musik im Allgemeinen erhalten. (vgl.<br />
Suzuki 1994 und www.suzuki-luzern.<strong>ch</strong>, Abfrage vom<br />
10.9.06)<br />
Einzel- und Gruppenunterri<strong>ch</strong>t<br />
In der Suzuki-Methode wird mit <strong>dem</strong> Kind einerseits indi-<br />
viduell gearbeitet, andererseits lernt es die Mögli<strong>ch</strong>keit des<br />
gemeinsamen Musizierens kennen. Na<strong>ch</strong> Suzuki soll das<br />
Zusammenspiel mit anderen Kindern die musikalis<strong>ch</strong>en<br />
Lernziele erweitern und zuglei<strong>ch</strong> eine stark motivierende<br />
Funktion haben. (vgl. www.suzuki-luzern.<strong>ch</strong>, Abfrage vom<br />
10.9.06)<br />
Abb. 4: Suzuki während eines<br />
Konzerts<br />
10
Ein festes Basisrepertoire<br />
Die Suzuki Violin S<strong>ch</strong>ool umfasst zehn Bände. Diese führen von einfa<strong>ch</strong>en Kinderliedern<br />
über sorgfältig ausgewählte Stücke bis zu Konzerten von Mozart und Ba<strong>ch</strong>. Das erste Stück<br />
im ersten Heft ist „Twinkle, Twinkle, Little Star“. Jedes Kind beginnt mit diesem Stück. Na<strong>ch</strong><br />
<strong>dem</strong> Thema des Liedes und den dazugehörenden Variationen geht es weiter <strong>zum</strong> zweiten<br />
Stück. Das Heft wird S<strong>ch</strong>ritt für S<strong>ch</strong>ritt dur<strong>ch</strong>gearbeitet, wobei der persönli<strong>ch</strong>e Eigenrhythmus<br />
eines jeden Kindes bea<strong>ch</strong>tet wird. Das Besondere ist nun, dass jedes bereits gespielte Stück<br />
im Basisrepertoire vorhanden bleibt. Bei meinem Unterri<strong>ch</strong>tsbesu<strong>ch</strong> konnte i<strong>ch</strong> beoba<strong>ch</strong>ten,<br />
wie jedes Kind zu Beginn ein Stück aus <strong>dem</strong> Repertoire auswählen konnte, wel<strong>ch</strong>es es dann<br />
spielte. Der Lehrer begründete mir dies folgendermassen: „Wenn ein Kind ein neues Wort<br />
gelernt hat, legt es dieses ja au<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t einfa<strong>ch</strong> auf die Seite und verwendet es nie mehr.“<br />
Zu<strong>dem</strong> können die bereits behandelten Stücke später vertieft und ihr Spiel verbessert<br />
werden. Denn au<strong>ch</strong> die Tonbildung, das heisst die Qualität des Violintones, ist ein wi<strong>ch</strong>tiges<br />
Element der Suzuki-Methode. (vgl. Farga 1983)<br />
Shini<strong>ch</strong>i Suzuki setzte grossen Wert auf das tägli<strong>ch</strong>e Üben. „Der <strong>Weg</strong> zur Aneignung einer<br />
Fähigkeit führt über die ri<strong>ch</strong>tige Methode und häufiges Üben. (...) Wer ni<strong>ch</strong>t ausrei<strong>ch</strong>end übt,<br />
kann au<strong>ch</strong> keine Fähigkeiten erlangen.“ (Suzuki 1994, S. 119) Hier muss jedo<strong>ch</strong> erwähnt<br />
werden, dass es keineswegs Suzukis Ideal war, dass alle seine S<strong>ch</strong>üler und S<strong>ch</strong>ülerinnen<br />
eine Karriere in Musik ma<strong>ch</strong>en sollten. Dies betonte er immer wieder. „Der Zweck der Talent-<br />
erziehung besteht in der Heranbildung von Kindern, ni<strong>ch</strong>t etwa um Berufsmusiker aus ihnen<br />
zu ma<strong>ch</strong>en, sondern einfa<strong>ch</strong> gute Musiker, die au<strong>ch</strong> auf je<strong>dem</strong> anderen Fa<strong>ch</strong>gebiet, für das<br />
sie si<strong>ch</strong> einmal ents<strong>ch</strong>eiden, grosse Ges<strong>ch</strong>ickli<strong>ch</strong>keit beweisen.“ (Suzuki 1994, S. 99)<br />
11
3. Eigene Untersu<strong>ch</strong>ungen<br />
3.1 Meine eigene Lernbiographie<br />
Abb. 5: Als Dreijährige mit meiner<br />
Pappgeige<br />
Weihna<strong>ch</strong>tslieder mit meiner Kartongeige.<br />
S<strong>ch</strong>on früh entwickelte si<strong>ch</strong> bei mir eine Liebe zur Violine.<br />
Als i<strong>ch</strong> mit zwei Jahren an einem Geburtstagsfest ein<br />
Geigenduo Ungaris<strong>ch</strong>e Musik spielen hörte, gefiel mir das<br />
so sehr, dass i<strong>ch</strong> ab jenem Zeitpunkt Geige spielen wollte.<br />
Da i<strong>ch</strong> damals no<strong>ch</strong> etwas zu klein war, bastelte mir mein<br />
Bruder eine Geige aus Pappkarton. (Dur<strong>ch</strong> die Ausein-<br />
andersetzung mit der Suzuki-Methode erfuhr i<strong>ch</strong>, dass<br />
dies bei Suzuki teilweise au<strong>ch</strong> gema<strong>ch</strong>t wird.) Als Bogen<br />
diente mir ein brauner Filzstift. So spielte i<strong>ch</strong> oft und gerne<br />
auf dieser Geige. Wie die Abbildung 5 zeigt, war die<br />
Haltung meines linken Armes no<strong>ch</strong> ziemli<strong>ch</strong> fals<strong>ch</strong>. I<strong>ch</strong><br />
spielte oft vor der Familie und diese musste dann dazu<br />
singen. So begleitete i<strong>ch</strong> an Weihna<strong>ch</strong>ten au<strong>ch</strong> die<br />
Als i<strong>ch</strong> fünf Jahre alt war, besu<strong>ch</strong>ten meine Eltern und i<strong>ch</strong> eine S<strong>ch</strong>nupper-Geigenstunde.<br />
Die Geigenlehrerin war spezialisiert auf den Unterri<strong>ch</strong>t mit kleinen Kindern. I<strong>ch</strong> konnte<br />
einigen Kindern beim Violinunterri<strong>ch</strong>t zus<strong>ch</strong>auen. Ans<strong>ch</strong>liessend führten meine Eltern ein<br />
Gesprä<strong>ch</strong> mit der Geigenlehrerin. Do<strong>ch</strong> sie merkten, dass diese Lehrerin mi<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t als<br />
S<strong>ch</strong>ülerin haben wollte. Sie fragte meine Eltern immer wieder, ob i<strong>ch</strong> wirkli<strong>ch</strong> Geige spielen<br />
wolle oder ob das einfa<strong>ch</strong> nur ihr Wuns<strong>ch</strong> sei. Obwohl mein Vater in seiner Kindheit Geige<br />
gespielt hatte und seine Geige au<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> im Haus war, weiss i<strong>ch</strong>, dass es ni<strong>ch</strong>t meine Eltern<br />
waren, die diesen Wuns<strong>ch</strong> hatten, sondern i<strong>ch</strong>. Heute kann i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t mehr genau an all<br />
meine Gedanken und Gefühle erinnern, aber auf jeden Fall begann i<strong>ch</strong> dann ni<strong>ch</strong>t mit<br />
Violinstunden bei dieser Lehrerin. Womögli<strong>ch</strong> spürte i<strong>ch</strong> ihre negative Einstellung und wollte<br />
darum im Augenblick ni<strong>ch</strong>t mehr Geigenunterri<strong>ch</strong>t nehmen.<br />
Da mein Wuns<strong>ch</strong> aber in den darauf folgenden Jahren ni<strong>ch</strong>t na<strong>ch</strong>liess, begann i<strong>ch</strong> anfangs<br />
zweiter Primars<strong>ch</strong>ulklasse mit Geigenunterri<strong>ch</strong>t. Damals war i<strong>ch</strong> a<strong>ch</strong>t Jahre alt. Der Unter-<br />
ri<strong>ch</strong>t fand einmal in der Wo<strong>ch</strong>e bei meiner Lehrerin Mira Baumann statt, von ihr war i<strong>ch</strong> von<br />
Beginn weg begeistert.<br />
Als i<strong>ch</strong> begonnen habe, mi<strong>ch</strong> mit meiner eigenen Lernbiographie zu bes<strong>ch</strong>äftigen, ist mir<br />
bewusst geworden, wie viel davon i<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>on vergessen hatte. An einige Episoden kann i<strong>ch</strong><br />
mi<strong>ch</strong> jedo<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> erinnern. In der ersten Unterri<strong>ch</strong>tsstunde lernte i<strong>ch</strong>, die Violine ri<strong>ch</strong>tig zu<br />
12
halten. Die Stütze musste so montiert werden, dass man die Geige, au<strong>ch</strong> ohne sie mit der<br />
Hand halten zu müssen, einklemmen kann.<br />
Zu Beginn spielte i<strong>ch</strong> nur die leeren Saiten und lernte so, mit <strong>dem</strong> Bogen ri<strong>ch</strong>tig über diese<br />
Saiten zu strei<strong>ch</strong>en. I<strong>ch</strong> spielte Stücke aus der Geigens<strong>ch</strong>ule von Egon Sassmannshaus.<br />
Diese Geigens<strong>ch</strong>ule ist mit vielen Abbildungen sehr kinderfreundli<strong>ch</strong> gestaltet. Neue Griff-<br />
stellungen werden mit Darstellungen des Griffbretts eingeführt. Sassmannshaus führt die<br />
vers<strong>ch</strong>iedenen Griffstellungen und Tonarten s<strong>ch</strong>rittweise ein.<br />
Wie au<strong>ch</strong> bei der Suzuki-Methode ist der Einbezug der Eltern wi<strong>ch</strong>tig. Zu<strong>dem</strong> betont Sass-<br />
mannshaus in seinem Vorwort, wie wi<strong>ch</strong>tig die Spielfreude des Kindes für weitere Fort-<br />
s<strong>ch</strong>ritte ist. „Theoretis<strong>ch</strong>e Erklärungen und Zei<strong>ch</strong>nungen sollen den Eltern die Mögli<strong>ch</strong>keit<br />
geben, etwas Einblick in die griffte<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>en Besonderheiten des Instruments zu gewinnen.<br />
Dem Kind selbst mute man nur soviel Theorie zu, wie notwendig ist, um die spielte<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>en<br />
<strong>Auf</strong>gaben zu lösen. Musizierfreude ist die beste Voraussetzung für weitere Forts<strong>ch</strong>ritte.“<br />
(Sassmanshaus 1976, S.4)<br />
Die Finger werden in diesem Heft s<strong>ch</strong>rittweise eingeführt. Im Verglei<strong>ch</strong> dazu werden beim<br />
ersten Stück im ersten Suzuki-Heft bereits drei Finger gebrau<strong>ch</strong>t.<br />
I<strong>ch</strong> spielte vorwiegend Stücke aus Sassmannshaus. Beim Stöbern in meinen alten Noten<br />
habe i<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> Stücke aus anderen Geigens<strong>ch</strong>ulen und sogar den zweiten sowie den vierten<br />
Band der Suzuki-Geigens<strong>ch</strong>ule gefunden. Darob war i<strong>ch</strong> zuerst sehr überras<strong>ch</strong>t, denn i<strong>ch</strong><br />
habe das <strong>Geigenspiel</strong> ja na<strong>ch</strong> der traditionellen<br />
Methode und ni<strong>ch</strong>t na<strong>ch</strong> Suzuki erlernt. Mir<br />
wurde aber dann ersi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>, dass i<strong>ch</strong> einfa<strong>ch</strong><br />
vereinzelt Stücke aus diesem Heft gespielt<br />
habe. Offenbar ist es no<strong>ch</strong> oft der Fall, dass<br />
man im traditionellen Unterri<strong>ch</strong>t Stücke aus<br />
Suzukis Heften nimmt. Dies zeigt, dass das<br />
Repertoire, wel<strong>ch</strong>es er zusammengetragen<br />
hat, au<strong>ch</strong> in der traditionellen Methode an-<br />
wendbar ist.<br />
Abb. 6: Beim <strong>Geigenspiel</strong> als Primars<strong>ch</strong>ülerin<br />
Obwohl mi<strong>ch</strong> eine meiner damaligen Lehrerinnen als sehr aktiv und aufgeweckt bes<strong>ch</strong>rieb,<br />
war i<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t immer sehr motiviert <strong>zum</strong> Üben. Blicke i<strong>ch</strong> zurück, wird mir klar, dass mir<br />
Forts<strong>ch</strong>ritte in meinem <strong>Geigenspiel</strong> in der Primars<strong>ch</strong>ulzeit ni<strong>ch</strong>t so wi<strong>ch</strong>tig waren. Dies wurde<br />
dann anders, als i<strong>ch</strong> älter wurde. Aber während meiner Kantonss<strong>ch</strong>ulzeit übte i<strong>ch</strong> sehr viel,<br />
war motiviert und ambitioniert. Während der Primars<strong>ch</strong>ule hingegen musste i<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> oft <strong>zum</strong><br />
Üben ermahnt werden. Diese Rolle hatte mein älterer Bruder inne, und so führte er bald ein<br />
„Punkte-System“ ein. Für 15 Minuten Geigeüben gab es einen Punkt. Eine gewisse Anzahl<br />
Punkte konnte i<strong>ch</strong> dann gegen eine Musik-CD eintaus<strong>ch</strong>en. Ein sol<strong>ch</strong>es Belohnungssystem<br />
13
ist für Kinder im Primars<strong>ch</strong>ulalter si<strong>ch</strong>er sehr motivierend und oft au<strong>ch</strong> nötig. Dies zeigt, wie<br />
wi<strong>ch</strong>tig es ist, dass die Familie einbezogen ist und das Kind betreut. In diesem Alter fällt es<br />
ihm no<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>wer, an das tägli<strong>ch</strong>e Üben zu denken, und es ist si<strong>ch</strong> dessen Wi<strong>ch</strong>tigkeit und<br />
Bedeutung no<strong>ch</strong> gar ni<strong>ch</strong>t bewusst. Heute bin i<strong>ch</strong> dankbar, dass meine Familie mi<strong>ch</strong> immer<br />
wieder <strong>zum</strong> Üben ermahnt hat.<br />
3. 2 Interview mit Lisa und Takuya Segawa<br />
Lisa Segawa-Beyeler wurde als S<strong>ch</strong>weizerin in Wettingen geboren und heiratete einen<br />
Japaner. Als ihre Kinder klein waren, lebte die Familie Segawa einige Jahre in Tokio. Dort<br />
begann Takuya, der älteste Sohn, als Vierjähriger mit <strong>dem</strong> Geigenunterri<strong>ch</strong>t na<strong>ch</strong> der<br />
Suzuki-Methode. Als er sieben Jahre alt war, kehrte die Familie na<strong>ch</strong> Wettingen zurück.<br />
Takuya spielt heute no<strong>ch</strong> mit viel Freude Geige.<br />
Am 30. August 2006 durfte i<strong>ch</strong> mit Lisa und Takuya über ihre Erfahrungen mit der Suzuki-<br />
Methode spre<strong>ch</strong>en.<br />
Es war Takuyas Grossmutter, die es an der Zeit fand, dass er ein Instrument spielen lerne.<br />
Da man an der nä<strong>ch</strong>stliegenden Musiks<strong>ch</strong>ule nur Klavier und Geige belegen konnte,<br />
besu<strong>ch</strong>te Takuya zuerst von beiden Instrumenten eine Lektion und ents<strong>ch</strong>ied si<strong>ch</strong> dann für<br />
die Geige. Takuyas Lehrer war ein sehr guter Geiger und Konzertmeister eines ange-<br />
sehenen japanis<strong>ch</strong>en Or<strong>ch</strong>esters. Als Lehrer war er re<strong>ch</strong>t streng. Der Violinunterri<strong>ch</strong>t, den<br />
der Knabe einmal pro Wo<strong>ch</strong>e besu<strong>ch</strong>te, begann jeweils mit einer Verbeugung. Zu Beginn<br />
musste si<strong>ch</strong> Takuya immer auf einen Karton stellen, auf wel<strong>ch</strong>em die Fussabdrücke ersi<strong>ch</strong>t-<br />
li<strong>ch</strong> waren. Dies dient dazu, dass das Kind in korrekter Haltung dasteht. Seine Mutter Lisa<br />
bekam den <strong>Auf</strong>trag, ihm eine Pappgeige zu basteln. Mit dieser konnte er zuerst die Haltung<br />
üben. Lisa selbst nahm keinen Unterri<strong>ch</strong>t, obwohl dies in den Lehrbü<strong>ch</strong>ern oft als Teil der<br />
Methode bes<strong>ch</strong>rieben wird. Sie begleitete Takuya jedo<strong>ch</strong> immer <strong>zum</strong> Unterri<strong>ch</strong>t, so dass sie<br />
wusste, was zu Hause geübt werden sollte. „Es gab einige Mütter, wel<strong>ch</strong>e s<strong>ch</strong>on Geige<br />
spielen konnten. Diese spielten ihren Kindern dann zu Hause vor. I<strong>ch</strong> hatte immer das<br />
Gefühl, dass sol<strong>ch</strong>e Kinder s<strong>ch</strong>on s<strong>ch</strong>neller Forts<strong>ch</strong>ritte ma<strong>ch</strong>ten“, beri<strong>ch</strong>tete Lisa.<br />
Au<strong>ch</strong> Takuya spielte ohne Noten. Immer vor <strong>dem</strong> Eins<strong>ch</strong>lafen hörte er si<strong>ch</strong> das Tonband des<br />
ersten Suzuki-Bandes an. „So konnte i<strong>ch</strong> jedes Stück, sogar jeden einzelnen Ton auswendig<br />
und kannte alle Stücke s<strong>ch</strong>on, bevor i<strong>ch</strong> sie gespielt hatte“, erzählte Takuya.<br />
14
Neben <strong>dem</strong> Einzelunterri<strong>ch</strong>t hatte er jeden zweiten Sonntag Gruppenunterri<strong>ch</strong>t. Dort trafen<br />
si<strong>ch</strong> alle S<strong>ch</strong>ülerinnen und S<strong>ch</strong>üler seines Lehrers und spielten gemeinsam. Da in der<br />
Suzuki-Methode alle das glei<strong>ch</strong>e Repertoire haben, ist dies kein Problem. Die Kinder spielen<br />
so lange mit, wie sie die Stücke selbst beherrs<strong>ch</strong>en. Dana<strong>ch</strong> hören sie den fortges<strong>ch</strong>rittenen<br />
Mits<strong>ch</strong>ülern zu oder gehen na<strong>ch</strong> Hause.<br />
Takuya erzählte, dass au<strong>ch</strong> er mit „Twinkle, Twinkle, Little Star“ begann und daran fast ein<br />
ganzes Jahr übte. „Das Problem ist, dass dieses Stück für den Anfang viel zu s<strong>ch</strong>wierig ist“,<br />
sagte Takuya. Sein Bruder lernte in der S<strong>ch</strong>weiz Geige spielen. Im Unters<strong>ch</strong>ied zu Takuya<br />
spielte er, wie au<strong>ch</strong> i<strong>ch</strong> damals, zuerst einfa<strong>ch</strong> leere Saiten. Takuya ist der Meinung, dies sei<br />
für einen Anfänger angemessen. In „Twinkle, Twinkle, Little Star“ müssen nämli<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>on<br />
Se<strong>ch</strong>zehntel und A<strong>ch</strong>tel gespielt werden. Zu<strong>dem</strong> werden bereits die ersten drei Finger ver-<br />
wendet. Dies sei für einen Anfänger definitiv zu s<strong>ch</strong>wierig, meint Takuya, der das Spielen<br />
dieses Stücks mit all den dazugehörenden Variationen überhaupt ni<strong>ch</strong>t als motivierend<br />
empfand. „Als Takuya dann <strong>zum</strong> zweiten Stück kam, waren seine Finger so auf die Abfolge<br />
des ersten Stücks programmiert, dass er ri<strong>ch</strong>tig Mühe hatte, sie in einer anderen Reihenfolge<br />
zu bewegen“, erinnerte si<strong>ch</strong> Lisa.<br />
Speziell an der Suzuki-Geigens<strong>ch</strong>ule ist, dass die Hefte keine zusätzli<strong>ch</strong>en Etüden oder<br />
Übungen enthalten. Alles basiert auf den von Shini<strong>ch</strong>i Suzuki ausgewählten Stücken. Takuya<br />
kritisierte, dass man wegen dieses vorgegebenen Programms viel weniger auf das einzelne<br />
Kind eingehen könne.<br />
Takuya und Lisa betonten, man müsse si<strong>ch</strong> im Blick auf die Suzuki-Methode der kulturellen<br />
Unters<strong>ch</strong>iede bewusst sein. In Japan habe die S<strong>ch</strong>ule einen anderen Stellenwert als bei uns.<br />
Es herrs<strong>ch</strong>e ein stärkerer Drill. Takuya meint, dass die japanis<strong>ch</strong>en Eltern ihre Kinder bei-<br />
nahe über ihre s<strong>ch</strong>ulis<strong>ch</strong>en Leistungen definierten. Die Kinder würden von klein auf von den<br />
Eltern gefördert oder gar gepusht. Mit vier Jahren begännen die meisten s<strong>ch</strong>on zu lesen oder<br />
besu<strong>ch</strong>ten das Frühenglis<strong>ch</strong>. Lisa erzählte weiter von Japan:<br />
Die Bildung hat in Japan einen sehr hohen Stellenwert. Sie beginnt eigentli<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>on, bevor<br />
das Baby auf die Welt kommt – so werden <strong>zum</strong> Beispiel s<strong>ch</strong>on vor der Geburt Kinderlieder<br />
gehört. Man überlässt das Kind in Japan au<strong>ch</strong> viel weniger si<strong>ch</strong> selbst, sondern fördert es<br />
dauernd aktiv. So gehen Kinder s<strong>ch</strong>on vor <strong>dem</strong> Kindergarten beispielsweise in Englis<strong>ch</strong>-<br />
lektionen, <strong>zum</strong> Malen, Turnen oder eben in den Geigenunterri<strong>ch</strong>t. Dies ist in Japan ganz<br />
selbstverständli<strong>ch</strong>, und alle ma<strong>ch</strong>en das so. Spielen hat einen geringeren Stellenwert als bei<br />
uns. In der S<strong>ch</strong>weiz hat man eher Momente, in denen man einmal ni<strong>ch</strong>ts vorhat. In Japan<br />
erlebte i<strong>ch</strong> das anders, wir lebten in Tokio, und dies ist eine sehr hektis<strong>ch</strong>e Stadt. Im<br />
japanis<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>ulsystem sind die Eintrittsprüfungen an die Universitäten sehr wi<strong>ch</strong>tig, was<br />
einen zusätzli<strong>ch</strong>en Druck ausma<strong>ch</strong>t. Und s<strong>ch</strong>on vor der Ho<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>ulstufe ist es für japanis<strong>ch</strong>e<br />
15
Eltern wi<strong>ch</strong>tig, in wel<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>ule ihr Kind geht. So hatten wir bei beiden Kindern sogar für den<br />
Kindergarten <strong>Auf</strong>nahmegesprä<strong>ch</strong>e und <strong>Auf</strong>nahmetests.<br />
„So, wie wir das in Japan miterlebt haben, würde es in der S<strong>ch</strong>weiz ni<strong>ch</strong>t funktionieren“,<br />
sagte Lisa. „Das <strong>Geigenspiel</strong>en, wie i<strong>ch</strong> es in Japan kennen lernte, war für mi<strong>ch</strong> ein<br />
Kulturs<strong>ch</strong>ock!“, erzählte sie weiter. Es sei erwartet worden, dass man mit seinem Kind jeden<br />
Tag übe, ging man auf Reisen, musste die Geige automatis<strong>ch</strong> mit. Lisa kann si<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t<br />
vorstellen, dass viele so kleine Kinder gerne jeden Tag üben. „Die Suzuki-Methode<br />
funktioniert in Japan nur wegen der Mütter, denn diese üben tägli<strong>ch</strong> mit den Kindern und<br />
gehen mit ihnen in den Unterri<strong>ch</strong>t“, war ihr Fazit.<br />
Als klaren Vorteil der Suzuki-Methode nannte mir Takuya die ausgeprägte S<strong>ch</strong>ulung des<br />
Gehörs. Diese habe ihm sehr viel gebra<strong>ch</strong>t, und er könne au<strong>ch</strong> heute no<strong>ch</strong> von seinem sen-<br />
sibilisierten und gut ausgebildeten Gehör profitieren. Zu<strong>dem</strong> findet er, mit vier Jahren wäre<br />
das Notenlesen ja wirkli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t sinnvoll. Der frühe Beginn habe ihm te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t viel<br />
gebra<strong>ch</strong>t, dafür aber musikalis<strong>ch</strong>, fasste Takuya seine Erfahrungen zusammen.<br />
Beide finden au<strong>ch</strong>, dass das <strong>Geigenspiel</strong> in der Suzuki-Methode re<strong>ch</strong>t stark me<strong>ch</strong>anisiert<br />
werde. Den me<strong>ch</strong>anis<strong>ch</strong>en Klang, den die Kinder teilweise produzieren, begründete Takuya<br />
jedo<strong>ch</strong> folgendermassen: „Es klingt oft etwas me<strong>ch</strong>anis<strong>ch</strong>, weil die Kinder no<strong>ch</strong> so jung sind.<br />
Man brau<strong>ch</strong>t eine gewisse Reife als Mens<strong>ch</strong>, um eine gewisse Musikalität erzeugen zu<br />
können.“<br />
Als die Familie Segawa dann wieder in der S<strong>ch</strong>weiz war und Vortragsübungen der<br />
Musiks<strong>ch</strong>ule hörte, bemerkte sie klare Unters<strong>ch</strong>iede. „I<strong>ch</strong> hatte das Gefühl, dass die Kinder<br />
in Japan viel besser spielten“, beri<strong>ch</strong>tete Lisa. Aber die Lehrerin in der S<strong>ch</strong>weiz habe<br />
grossen Wert darauf gelegt, dass die Kinder ni<strong>ch</strong>t verkrampft seien. Lisa denkt, dass man<br />
hier auf andere Dinge a<strong>ch</strong>tet: „Man<strong>ch</strong>mal hatte i<strong>ch</strong> das Gefühl, der Lehrer in Japan und die<br />
Lehrerin in der S<strong>ch</strong>weiz sagten das Gegenteil.“ Sathoshi, der jüngere Sohn, erlernte, wie<br />
erwähnt, das <strong>Geigenspiel</strong> in der S<strong>ch</strong>weiz. „I<strong>ch</strong> denke, Sathoshi hat hier den einfa<strong>ch</strong>eren<br />
Einstieg gehabt. Aus meiner Si<strong>ch</strong>t war dies kindgere<strong>ch</strong>ter“, erklärte Lisa. Bei beiden Söhnen<br />
war jedo<strong>ch</strong> die Betreuung dur<strong>ch</strong> die Eltern sehr wi<strong>ch</strong>tig. Bei einem kleinen Kind müsse man<br />
zu Hause so oder so s<strong>ch</strong>auen, dass geübt werde, egal, na<strong>ch</strong> wel<strong>ch</strong>er Methode es<br />
unterri<strong>ch</strong>tet werde, meinte Lisa. Es war ihr wi<strong>ch</strong>tig, dass sie au<strong>ch</strong> in der S<strong>ch</strong>weiz an den<br />
Unterri<strong>ch</strong>tslektionen teilnahm, so dass au<strong>ch</strong> sie hörte, was die Lehrkraft sagte und was beim<br />
Üben bea<strong>ch</strong>tet werden sollte.<br />
Die Gruppenstunden und die gemeinsamen Treffen der Suzuki-S<strong>ch</strong>ule in Japan empfand<br />
Lisa vorwiegend als positiv. Die Kinder wie au<strong>ch</strong> die Eltern lernten einander kennen und<br />
konnten zusammen Anlässe besu<strong>ch</strong>en. Lisa empfand jedo<strong>ch</strong> als Na<strong>ch</strong>teil, dass dies au<strong>ch</strong><br />
einen gewissen Druck zur Folge gehabt habe. Da alle dasselbe spielen, kann nämli<strong>ch</strong> sehr<br />
gut vergli<strong>ch</strong>en werden, wie weit ein Kind s<strong>ch</strong>on ist.<br />
16
Lisa erzählte weiter von der jährli<strong>ch</strong>en Zusammenkunft im Frühling, an wel<strong>ch</strong>er si<strong>ch</strong> Kinder<br />
mit ihren Eltern aus ganz Japan trafen. Man veranstaltete ein grosses Konzert, bei wel<strong>ch</strong>em<br />
alle Stücke aus allen Suzuki-Bänden gespielt wurden. Begonnen wurde mit Band 10, den<br />
s<strong>ch</strong>wierigsten Stücken. So standen zu Beginn nur die Besten auf der Bühne. Dann wurden<br />
rückwärts sämtli<strong>ch</strong>e Repertoire-Stücke gespielt, bis am S<strong>ch</strong>luss alle, au<strong>ch</strong> die Kleinsten, auf<br />
der Bühne standen und „Twinkle, Twinkle, Little Star“ spielten. Dieses Konzert, da sind si<strong>ch</strong><br />
Mutter und Sohn einig, ist für die Beteiligten auf jeden Fall ein riesiges Erlebnis, wel<strong>ch</strong>es<br />
motiviert und Identifikation s<strong>ch</strong>afft.<br />
Zu erwähnen ist jedo<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong>, dass viele Kinder am Ende der Primars<strong>ch</strong>ule das <strong>Geigenspiel</strong><br />
wieder aufgeben. Als Grund nannte Takuya den sehr grossen Druck. Hinzu komme der<br />
s<strong>ch</strong>ulis<strong>ch</strong>e Stress, wel<strong>ch</strong>er es s<strong>ch</strong>wierig ma<strong>ch</strong>e, tägli<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> viel zu üben.<br />
Im Weiteren spra<strong>ch</strong>en wir no<strong>ch</strong> über Suzukis Ansatz der Talenterziehung. Takuya meinte,<br />
dass er motoris<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t so stark sei, was ihm vor allem zu Beginn Mühe bereitet habe. Heute<br />
beherrs<strong>ch</strong>t er das <strong>Geigenspiel</strong> jedo<strong>ch</strong> auf einem sehr hohen Niveau, was Suzukis Ansatz,<br />
dass Fähigkeiten dur<strong>ch</strong>aus entwicklungsfähig seien, in einem gewissen Masse bestätigen<br />
kann.<br />
I<strong>ch</strong> fragte die beiden dann no<strong>ch</strong>, wel<strong>ch</strong>e Methode sie weiterempfehlen würden.<br />
„Weil i<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>weizerin bin und ni<strong>ch</strong>t Japanerin, würde i<strong>ch</strong> die traditionelle Methode<br />
weiterempfehlen, weil sie mir persönli<strong>ch</strong> mehr entspri<strong>ch</strong>t“, sagte Lisa. Au<strong>ch</strong> Takuya meinte,<br />
er würde hier in der S<strong>ch</strong>weiz keine Suzuki-S<strong>ch</strong>ule besu<strong>ch</strong>en. „Zu<strong>dem</strong> finde i<strong>ch</strong> die hiesigen<br />
Instrumenten-Vorstellungs-Tage für ein Kind sehr wertvoll. Da sieht und hört es viele ver-<br />
s<strong>ch</strong>iedene Instrumente und kann dann ents<strong>ch</strong>eiden, wel<strong>ch</strong>es davon es selbst spielen<br />
mö<strong>ch</strong>te.“ Na<strong>ch</strong> Lisa kommt es vorwiegend darauf an, ob man in Japan oder in der S<strong>ch</strong>weiz<br />
wohnt: „Damals in Japan war das einfa<strong>ch</strong> normal. Hier in der S<strong>ch</strong>weiz wäre i<strong>ch</strong> nie im Traum<br />
auf die Idee gekommen, ein sol<strong>ch</strong> kleines Kind in den Violinunterri<strong>ch</strong>t zu s<strong>ch</strong>icken.“ Lisa<br />
empfand diese Zeit als ziemli<strong>ch</strong> anstrengend.<br />
Beide sind der Meinung, dass man in der S<strong>ch</strong>weiz die Suzuki-Methode si<strong>ch</strong>er ni<strong>ch</strong>t voll-<br />
ständig übernehmen könne. Die Methode enthalte aber viele gute Ansätze, wel<strong>ch</strong>e man<br />
au<strong>ch</strong> bei uns anwenden könne, wie <strong>zum</strong> Beispiel die Gehörbildung und den Gruppen-<br />
unterri<strong>ch</strong>t. Und obwohl der Einstieg mit <strong>dem</strong> ersten Stück zu s<strong>ch</strong>wierig sei, gebe es in<br />
Suzukis Lehrwerk dur<strong>ch</strong>aus andere für den traditionellen Violinunterri<strong>ch</strong>t sehr geeignete<br />
Stücke.<br />
17
3. 3 Besu<strong>ch</strong> in der Suzuki-S<strong>ch</strong>ule Züri<strong>ch</strong><br />
Entdeckt habe i<strong>ch</strong> die „Suzuki Violins<strong>ch</strong>ule Luzern/Züri<strong>ch</strong>“ im Internet. Geleitet wird diese<br />
S<strong>ch</strong>ule von einer Familie Rüttimann. Das Ehepaar Peter und Marianna Rüttimann sowie ihr<br />
Sohn Martin unterri<strong>ch</strong>ten in Luzern und Züri<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> der Suzuki-Methode.<br />
I<strong>ch</strong> setzte mi<strong>ch</strong> in den Sommerferien telefonis<strong>ch</strong> mit der Familie in Verbindung. Am 7.<br />
September 2006 durfte i<strong>ch</strong> dann von 16.00 bis 19.30 Uhr in Züri<strong>ch</strong> <strong>dem</strong> Unterri<strong>ch</strong>t von vier<br />
Kindern und einem Erwa<strong>ch</strong>senen beiwohnen. Dana<strong>ch</strong> hatte i<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> die Gelegenheit, mit<br />
<strong>dem</strong> Lehrer, Martin Rüttimann, zu spre<strong>ch</strong>en und ihm einige Fragen zu stellen.<br />
Die Kinder, die <strong>zum</strong> Unterri<strong>ch</strong>t kamen, waren alle zwis<strong>ch</strong>en vier und se<strong>ch</strong>s Jahre alt. I<strong>ch</strong><br />
mö<strong>ch</strong>te nun anhand der Unterri<strong>ch</strong>tslektion des ersten Kindes meine Beoba<strong>ch</strong>tungen er-<br />
zählen.<br />
Der erste S<strong>ch</strong>üler war ein vierjähriger Knabe. Er spielt seit drei Viertel Jahren Geige. Seine<br />
Mutter begleitete ihn und hatte ebenfalls eine Geige bei si<strong>ch</strong>. Die Lektion begann mit einer<br />
traditionellen japanis<strong>ch</strong>en Verbeugung. Dies überras<strong>ch</strong>te mi<strong>ch</strong>. Der Lehrer erklärte mir<br />
jedo<strong>ch</strong> später, er lege auf diese Geste Wert, da sie den Beginn und das Ende der Lektion<br />
anzeige. Dies sei für das Kind wi<strong>ch</strong>tig, es sei ein Zei<strong>ch</strong>en, dass man si<strong>ch</strong> ab diesem Zeit-<br />
punkt nur no<strong>ch</strong> auf das <strong>Geigenspiel</strong> konzentriere. Na<strong>ch</strong> der Verbeugung stellte si<strong>ch</strong> der<br />
Junge vor den Lehrer hin und sagte: „I<strong>ch</strong> heisse xy, komme aus Endingen und spiele nun<br />
Häns<strong>ch</strong>en Klein.“ Dies fiel ihm sehr s<strong>ch</strong>wer, und er spra<strong>ch</strong> ganz leise. Do<strong>ch</strong> der Lehrer<br />
beharrte darauf und sagte es ihm einige Male vor. Dana<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>altete der Lehrer das CD-<br />
Gerät ein, und der Junge spielte zur Klavierbegleitung von der CD seine Stücke. Er spielte<br />
alles auswendig. Der Klang verriet, wie klein die Geige des Jungen war, und den<br />
Bewegungsabläufen sah man an, dass er no<strong>ch</strong> sehr klein war. Do<strong>ch</strong> er spielte sehr s<strong>ch</strong>nell,<br />
und seine Finger wussten genau, wohin sie gehörten. Ab und zu korrigierte der Lehrer die<br />
Haltung des Jungen. Dies ma<strong>ch</strong>te er <strong>zum</strong> Beispiel dur<strong>ch</strong> Zure<strong>ch</strong>trücken der Violine des<br />
Knaben oder in<strong>dem</strong> er diesen fragte: „Bist du zufrieden mit deinem Handgelenk?“ Daraufhin<br />
korrigierte der Junge seine Haltung sofort. So spielte er zuerst drei Stücke aus seinem<br />
Repertoire, woraufhin der Lehrer ihn lobte. Dann erzählte er <strong>dem</strong> Lehrer, was er auf heute<br />
geübt habe, und spielte es ihm dana<strong>ch</strong> vor. Der Lehrer spielte zwis<strong>ch</strong>endur<strong>ch</strong> als Hilfe mit<br />
<strong>dem</strong> Kind mit, hörte jedo<strong>ch</strong> immer wieder auf, um <strong>dem</strong> Kind besser zuhören zu können. Zu<br />
meinem Erstaunen spra<strong>ch</strong> der Lehrer s<strong>ch</strong>on über Phrasierungen. So fragte er: „Spielt man<br />
hier immer alles glei<strong>ch</strong> laut?“ <strong>Auf</strong> einer leeren Saite übten sie dann gemeinsam die<br />
Phrasierung. Der Junge spielte au<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>on die G-Dur-Tonleiter, worauf ihn der Lehrer fragte,<br />
18
ob der zweite Finger auf der D-Saite nun ho<strong>ch</strong> oder tief sei. Mi<strong>ch</strong> erstaunte, dass s<strong>ch</strong>on so<br />
viel Theorie behandelt wurde. Die Mutter des Knaben beri<strong>ch</strong>tete dann, dass er die G-Dur-<br />
Tonleiter jeden Tag fünf Mal geübt habe. <strong>Auf</strong> <strong>dem</strong> Griffbrett des Jungen klebten vers<strong>ch</strong>ieden-<br />
farbige Punkte, dies erinnerte mi<strong>ch</strong> an meine Anfänge, denn mit sol<strong>ch</strong>en Punkten arbeitete<br />
i<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong>. Es fiel mir auf, dass der Lehrer <strong>dem</strong> Knaben oft vorspielte, teilweise au<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te<br />
Versionen. Dana<strong>ch</strong> fragte er dann <strong>zum</strong> Beispiel: „Kannst du mir helfen? Was muss i<strong>ch</strong><br />
verändern?“<br />
Abb. 7: Knaben beim Unterri<strong>ch</strong>t<br />
Na<strong>ch</strong> etwa zwanzig Minuten kam die Mutter<br />
an die Reihe. Sie hatte glei<strong>ch</strong>zeitig mit ihrem<br />
Kind begonnen, Geige zu spielen. Der Lehrer<br />
zeigte der Mutter, was ihr Sohn üben solle.<br />
Dann wurde sie unterri<strong>ch</strong>tet. Au<strong>ch</strong> sie spielte<br />
auswendig. Na<strong>ch</strong> einer weiteren Viertel-<br />
stunde kam der nä<strong>ch</strong>ste S<strong>ch</strong>üler mit seiner<br />
Mutter. Die beiden Knaben spielten nun no<strong>ch</strong><br />
gemeinsam. Der Lehrer sagte, was beim<br />
einen und was beim anderen besonders gut<br />
sei. Er hielt die Knaben an, si<strong>ch</strong> gegenseitig<br />
zu beoba<strong>ch</strong>ten. So konnten sie voneinander<br />
profitieren.<br />
Der Lehrer ers<strong>ch</strong>ien mir ziemli<strong>ch</strong> streng, und im Unterri<strong>ch</strong>t herrs<strong>ch</strong>ten klare Regeln. Er<br />
arbeitete viel mit der Körperspra<strong>ch</strong>e, so gab er klare Zei<strong>ch</strong>en, <strong>zum</strong> Beispiel signalisierte er<br />
dur<strong>ch</strong> die unter den Arm geklemmte Geige einen Unterbru<strong>ch</strong> im Spiel. Na<strong>ch</strong><strong>dem</strong> gemeinsam<br />
musiziert worden war, ma<strong>ch</strong>te si<strong>ch</strong> der erste Knabe mit seiner Mutter wieder auf den Heim-<br />
weg, und die Einzellektion des zweiten Kindes begann. Sie hatte denselben Ablauf wie die<br />
vorherige.<br />
Im Ans<strong>ch</strong>luss hatte i<strong>ch</strong> die Gelegenheit, mit einigen Eltern zu spre<strong>ch</strong>en. Alle hatten mit und<br />
au<strong>ch</strong> wegen ihrem Kind mit <strong>dem</strong> Violinunterri<strong>ch</strong>t begonnen. Das tägli<strong>ch</strong>e Üben ist ihnen sehr<br />
wi<strong>ch</strong>tig. Sie s<strong>ch</strong>ienen von der Suzuki-Methode sehr begeistert zu sein und s<strong>ch</strong>ilderten aus-<br />
s<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> positive Erfahrungen, beispielsweise die Gruppenstunden.<br />
Als alle S<strong>ch</strong>üler und S<strong>ch</strong>ülerinnen mit ihren Eltern gegangen waren, konnte i<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> mit <strong>dem</strong><br />
Lehrer spre<strong>ch</strong>en.<br />
Gegründet wurde die S<strong>ch</strong>ule von seinem Vater im Jahre 1977, na<strong>ch</strong><strong>dem</strong> dieser in Japan<br />
gewesen war und von Shini<strong>ch</strong>i Suzuki persönli<strong>ch</strong> unterri<strong>ch</strong>tet worden war. Er erzählte mir,<br />
die Suzuki-S<strong>ch</strong>ule Züri<strong>ch</strong> Luzern habe mittlerweile zirka 100 S<strong>ch</strong>ülerinnen und S<strong>ch</strong>üler.<br />
19
Neben den Atelier-Gruppen einmal im Monat gebe es au<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> einmal im Jahr in den<br />
Sommerferien ein Lager.<br />
<strong>Auf</strong> die Frage, ob die Unterri<strong>ch</strong>tsmethoden hier in der S<strong>ch</strong>weiz Unters<strong>ch</strong>iede <strong>zum</strong> Suzuki-<br />
Unterri<strong>ch</strong>t in Japan aufweise, antwortete mir Herr Rüttimann: „Man kann es so sagen, es gibt<br />
viele Gemeinsamkeiten.“ Als eine sol<strong>ch</strong>e erwähnte er die Verbeugung zu Beginn der Stunde.<br />
Na<strong>ch</strong>her s<strong>ch</strong>weifte er jedo<strong>ch</strong> ab. Er habe die Erfahrung gema<strong>ch</strong>t, dass die Kinder die<br />
Disziplin und die Arbeit der Suzuki-Methode au<strong>ch</strong> wirkli<strong>ch</strong> wollten und s<strong>ch</strong>ätzten. Herr<br />
Rüttimann betonte jedo<strong>ch</strong> sehr: „Wir unterri<strong>ch</strong>ten Kinder, ni<strong>ch</strong>t Stücke! Jeder hat sein<br />
Tempo.“ Es gehöre zur Methode, dass alle dieselben Stücke spielten und zwar in der<br />
glei<strong>ch</strong>en Reihenfolge, weil jedes Stück einen besonderen S<strong>ch</strong>werpunkt habe. Jedes Heft sei<br />
klar aufgebaut und so werde na<strong>ch</strong> und na<strong>ch</strong> Neues eingeführt. Die Stücke wie au<strong>ch</strong> die<br />
Hefte nähmen aufeinander Bezug. „Das Besondere an den Suzuki-Heften ist, dass keine An-<br />
weisungen für die Lehrer drin stehen, und darum gibt es eine Suzuki-Ausbildung. Das ist<br />
eine Zusatzausbildung na<strong>ch</strong> <strong>dem</strong> Konservatorium“, beri<strong>ch</strong>tete er weiter. Einer der grössten<br />
Vorteile an der Suzuki-Methode ist na<strong>ch</strong> Rüttimann, dass si<strong>ch</strong> ihre Stücke so gut für Kinder<br />
eignen und sie diese gerne spielen.<br />
20
4. Mutterspra<strong>ch</strong>enmethode<br />
4. 1 Wie das Kind spre<strong>ch</strong>en lernt<br />
Da si<strong>ch</strong> die Methode von Shini<strong>ch</strong>i Suzuki stark am Prozess des Erwerbs der Mutterspra<strong>ch</strong>e<br />
orientiert, habe i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> vertieft mit diesem Thema befasst. Dazu habe i<strong>ch</strong> das Bu<strong>ch</strong> „Wie<br />
das Kind spre<strong>ch</strong>en lernt“ von Jerome Bruner gelesen. In den folgenden Abs<strong>ch</strong>nitten mö<strong>ch</strong>te<br />
i<strong>ch</strong> seine Erkenntnisse und Si<strong>ch</strong>tweisen zusammenfassen.<br />
Jerome Bruner setzt den S<strong>ch</strong>werpunkt immer wieder auf die Kultur. Eine seiner Haupt-<br />
aussagen ist, dass das Phänomen Spra<strong>ch</strong>e nur unter Einbezug der Kultur verstanden<br />
werden kann. So endet das Bu<strong>ch</strong> mit den Worten: „I<strong>ch</strong> habe eine Ansi<strong>ch</strong>t des Spra<strong>ch</strong>erwerbs<br />
vorzustellen versu<strong>ch</strong>t, wel<strong>ch</strong>e dessen Kontinuität mit und Abhängigkeit von <strong>dem</strong> Erwerb der<br />
Kultur betont. Die Kultur besteht aus symbolis<strong>ch</strong>en Verfahren, Begriffen und Unter-<br />
s<strong>ch</strong>eidungen, die nur dur<strong>ch</strong> die Spra<strong>ch</strong>e mögli<strong>ch</strong> werden. Sie wird <strong>dem</strong> Kind dur<strong>ch</strong> den<br />
Spra<strong>ch</strong>erwerb selber übermittelt. Entspre<strong>ch</strong>end lässt si<strong>ch</strong> das Wesen der Spra<strong>ch</strong>e ni<strong>ch</strong>t ohne<br />
Einbezug ihrer kulturellen Einbettung verstehen.“ (Bruner 2002, S. 116)<br />
In den Kapiteln 1 und 2 befasst si<strong>ch</strong> Bruner mit <strong>dem</strong> <strong>Weg</strong> von der vorspra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en zur<br />
spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Kommunikation. Er betont, dass beim Spra<strong>ch</strong>erwerb eines Kindes au<strong>ch</strong> der<br />
Aspekt der Funktion und der kommunikativen Absi<strong>ch</strong>t berücksi<strong>ch</strong>tigt werden muss. Bruner<br />
erklärt, dass der Spra<strong>ch</strong>erwerb des Kindes s<strong>ch</strong>on beginnt, bevor es seine erste lexiko-<br />
grammatis<strong>ch</strong>e Äusserung von si<strong>ch</strong> gibt, nämli<strong>ch</strong> dadur<strong>ch</strong>, dass Mutter und Kind einen<br />
Rahmen für ihre Interaktionen s<strong>ch</strong>affen. Dieser Rahmen ist inszeniert und zu Beginn vom<br />
Erwa<strong>ch</strong>senen stark kontrolliert. Ein Spiel kann beispielsweise ein sol<strong>ch</strong>er Rahmen sein.<br />
Bruner nennt dies Transaktionsrahmen. Er stellt für das Kind ein Hilfssystem <strong>zum</strong> Spra<strong>ch</strong>-<br />
erwerb dar. Dieses Hilfssystem wird LASS genannt, was für „Language Acquisition Support<br />
System“ steht. Zu<strong>dem</strong> geht Bruner von einer angeborenen Spra<strong>ch</strong>lernfähigkeit aus, wel<strong>ch</strong>e<br />
na<strong>ch</strong> Noam Chomsky „Language Acquisition Device“ (LAD) genannt wird. Diese Spra<strong>ch</strong>-<br />
begabung kann jedo<strong>ch</strong> nur funktionieren, wenn si<strong>ch</strong> ein Erwa<strong>ch</strong>sener mit <strong>dem</strong> Kind in einen<br />
sol<strong>ch</strong>en Rahmen begibt. Aus der We<strong>ch</strong>selbeziehung zwis<strong>ch</strong>en den Spra<strong>ch</strong>lernme<strong>ch</strong>anismen<br />
und <strong>dem</strong> Hilfssystem kann si<strong>ch</strong> der Spra<strong>ch</strong>erwerb entwickeln.<br />
Na<strong>ch</strong> Bruner geht der Eintritt in die Spra<strong>ch</strong>gemeins<strong>ch</strong>aft ganz klar und automatis<strong>ch</strong> mit <strong>dem</strong><br />
Eintritt in die jeweilige Kultur und Gesells<strong>ch</strong>aft einher.<br />
Im zweiten Kapitel sagt Bruner, die Kultur zwinge den Mens<strong>ch</strong>en eigentli<strong>ch</strong> zur Spra<strong>ch</strong>e.<br />
„Denn i<strong>ch</strong> bin der <strong>Auf</strong>fassung, dass gerade die <strong>Auf</strong>gabe, Kultur als notwendige Form der<br />
Weltbewältigung zu benützen, den Mens<strong>ch</strong>en zu Spra<strong>ch</strong>e zwingt.“ (Bruner 2002, S. 17)<br />
Weiter sagt er von Säuglingen, dass ihr Verhalten s<strong>ch</strong>on sehr früh die Züge eines Mittel-<br />
21
Zweck-Zusammenhanges aufweise. Au<strong>ch</strong> der Spra<strong>ch</strong>erwerb erfüllt für das Kind einen Zweck<br />
oder eine Funktion. Na<strong>ch</strong> Bruner helfen vier kognitive Anlagen, <strong>dem</strong> Kind beim<br />
Spra<strong>ch</strong>erwerb: Mittel-Zweck-Bereits<strong>ch</strong>aft, Transaktionalität (Transaktion = Erfahrungs-<br />
prozess, in wel<strong>ch</strong>em jeder S<strong>ch</strong>ritt vom Ergebnis des vorhergehenden abhängt (Bruner 2002,<br />
S 133)), Systematik und Abstraktheit (Bruner 2002, S. 24). Bruner erläutert au<strong>ch</strong>, wie das<br />
Kind beim Spra<strong>ch</strong>erwerb unterstützt werden kann. Der Erwa<strong>ch</strong>sene hat ni<strong>ch</strong>t nur die Rolle<br />
des Modells inne, sondern eine weit aktivere. Der Erwa<strong>ch</strong>sene soll die Rolle eines willigen<br />
Spre<strong>ch</strong>partners einnehmen. Es ist au<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong>aus wi<strong>ch</strong>tig, mit <strong>dem</strong> Kind zu verhandeln.<br />
Zu<strong>dem</strong> sollte der Erwa<strong>ch</strong>sene das Niveau seiner Spra<strong>ch</strong>e <strong>dem</strong> Kind anpassen. Diese<br />
Anpassung muss aber flexibel bleiben, so dass auf kindli<strong>ch</strong>e Forts<strong>ch</strong>ritte entspre<strong>ch</strong>end<br />
reagiert werden kann. Der Rahmen, in wel<strong>ch</strong>em sol<strong>ch</strong>e spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Interaktionen<br />
stattfinden, soll <strong>dem</strong> Kind vertraut sein. Bruner nennt sol<strong>ch</strong>e Situationen au<strong>ch</strong> „Formate“. Er<br />
definiert sie folgendermassen: „Ein Format ist ein standardisiertes Interaktionsmuster<br />
zwis<strong>ch</strong>en einem Erwa<strong>ch</strong>senen und einem Kleinkind, wel<strong>ch</strong>es als ursprüngli<strong>ch</strong>er Mikrokos-<br />
mos feste Rollen enthält, die mit der Zeit vertaus<strong>ch</strong>bar werden.“ (Bruner 2002, S. 103) Diese<br />
Formate sind <strong>dem</strong> Kind eine grosse Hilfe und bringen es auf <strong>dem</strong> <strong>Weg</strong> zur Spra<strong>ch</strong>e voran.<br />
Im dritten Kapitel geht er auf das Thema „Spiel und Spra<strong>ch</strong>e“ genauer ein. Spiele sind sol<strong>ch</strong>e<br />
oben erwähnten Formate. Anhand des Beispiels von zwei Knaben erläutert Bruner die<br />
Funktion und die Bedeutung von Spielformaten. Das Vers<strong>ch</strong>winden und Wiederers<strong>ch</strong>einen<br />
von Gegenständen ist ein Beispiel für ein sol<strong>ch</strong>es Spielformat. Spiele dienen dazu, die frühe<br />
Kommunikation exemplaris<strong>ch</strong> zu strukturieren. Bruner zeigt eindrückli<strong>ch</strong>, wie sol<strong>ch</strong>e Spiel-<br />
inhalte plötzli<strong>ch</strong> gekonnt auf die Realität übertragen werden. Zu Beginn steuert die Mutter<br />
das Spiel no<strong>ch</strong> re<strong>ch</strong>t stark, do<strong>ch</strong> mit der Zeit wä<strong>ch</strong>st die Initiative des Kindes immer mehr,<br />
das Spiel wird vielfältiger und Rollen werden neu verteilt. Die Mutter übergibt Neues na<strong>ch</strong><br />
und na<strong>ch</strong> <strong>dem</strong> Kind, dies nennt Bruner das „Übergabe-Prinzip“.<br />
Im vierten und fünften Kapitel befasst si<strong>ch</strong> Bruner vertieft mit der Entwicklung des Bedeutens<br />
bzw. des Bittens. Dazu benutzt er wieder die Beispiele mit den zwei Knaben und ihren<br />
Eltern. Au<strong>ch</strong> in diesen Kapiteln wird die grosse Bedeutung des Gesprä<strong>ch</strong>spartners, des Kon-<br />
textes und der Kultur ersi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>.<br />
Im se<strong>ch</strong>sten und letzten Kapitel werden die wi<strong>ch</strong>tigsten Erkenntnisse zusammengefasst und<br />
S<strong>ch</strong>lüsse gezogen. Bruner betont no<strong>ch</strong>mals, wie wi<strong>ch</strong>tig die Kommunikation mit den Mitmen-<br />
s<strong>ch</strong>en für das Kind ist. (vgl. Bruner 2002)<br />
„Denn ob der Mens<strong>ch</strong> nun arm oder rei<strong>ch</strong> mit angeborenen Fähigkeiten für die lexiko-<br />
grammatis<strong>ch</strong>e Spra<strong>ch</strong>e ausgerüstet sei – er muss auf jeden Fall no<strong>ch</strong> lernen, wie die<br />
Spra<strong>ch</strong>e zu gebrau<strong>ch</strong>en ist. Dies kann ni<strong>ch</strong>t in vitro gelernt werden. Der Gebrau<strong>ch</strong> der<br />
Spra<strong>ch</strong>e lässt si<strong>ch</strong> nur dur<strong>ch</strong> ihren kommunikativen Einsatz lernen.“ (Bruner 2002, S. 101)<br />
22
4. 2 Synthese<br />
Inwiefern lassen si<strong>ch</strong> Prinzipien des Spra<strong>ch</strong>erwerbs auf das Erlernen eines<br />
Instrumentes übertragen?<br />
Wie ma<strong>ch</strong>t dies die Suzuki-Methode?<br />
In einem ersten S<strong>ch</strong>ritt mö<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong> untersu<strong>ch</strong>en, inwiefern si<strong>ch</strong> Bruners Spra<strong>ch</strong>er-<br />
werbstheorie mit der Suzuki-Methode verbinden lässt und wo Unters<strong>ch</strong>iede vorliegen.<br />
Bruner betont die Wi<strong>ch</strong>tigkeit der Interaktion mit einem Erwa<strong>ch</strong>senen. Er spri<strong>ch</strong>t in diesem<br />
Zusammenhang von Formaten und Hilfssystemen. Dieser Ansatz ist au<strong>ch</strong> in der Suzuki-<br />
Methode zu erkennen, denn Suzuki legt, wie erwähnt, sehr grossen Wert auf den Einbezug<br />
der Eltern (vgl Kap. 2.2, S. 10). In<strong>dem</strong> au<strong>ch</strong> sie Geige spielen, werden sie zu musikalis<strong>ch</strong>en<br />
Gesprä<strong>ch</strong>spartnern. Die Eltern sollen bei Bruner wie bei Suzuki eine aktive, das heisst<br />
motivierende und anspornende Rolle übernehmen. Weiter spri<strong>ch</strong>t Bruner von der Wi<strong>ch</strong>tigkeit<br />
der vertrauten Umgebung und der Routine. In der Suzuki-Methode wird die vertraute Umge-<br />
bung dur<strong>ch</strong> die Anwesenheit der Mutter im Unterri<strong>ch</strong>t ges<strong>ch</strong>affen (vgl. Kap. 2.2, S. 10). Au<strong>ch</strong><br />
die Routine ist in der Methode von Shini<strong>ch</strong>i Suzuki verankert; er plädierte für tägli<strong>ch</strong>es Üben<br />
(vgl. Kap. 2.2, S. 11). Diese Kontinuität ist bei Suzuki au<strong>ch</strong> darin zu erkennen, dass die<br />
Kinder immer wieder dieselben Stücke spielen. (vgl. Kap. 2.2, S. 11).<br />
Bruner geht von einer angeborenen Spra<strong>ch</strong>begabung aus. Dies widerspri<strong>ch</strong>t der Suzuki-<br />
Methode, denn Suzuki geht davon aus, dass kein Mens<strong>ch</strong> mit Talent geboren werde,<br />
sondern alles im Laufe des Lebens erlernt werden könne (vgl. Kap. 2.2, S. 8). Weiter betont<br />
Bruner au<strong>ch</strong> immer wieder die Zweckmässigkeit des Spra<strong>ch</strong>erwerbs. Die Spra<strong>ch</strong>e erfüllt <strong>dem</strong><br />
Kind einen Zweck und führt es an ein Ziel. Bruner behauptet sogar, die Kultur zwinge ein<br />
Kind zur Spra<strong>ch</strong>e. Hierin sehe i<strong>ch</strong> einen ents<strong>ch</strong>eidenden Unters<strong>ch</strong>ied <strong>zum</strong> Erwerb<br />
musikalis<strong>ch</strong>er Fähigkeiten wie des <strong>Geigenspiel</strong>s. Der Spra<strong>ch</strong>erwerb ist für das Kind kulturell<br />
unentbehrli<strong>ch</strong>. Ohne Spra<strong>ch</strong>e kann es si<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t ausdrücken, keine Wüns<strong>ch</strong>e und Sorgen<br />
formulieren und si<strong>ch</strong> mit nieman<strong>dem</strong> verständigen. Ist dieser Sinn und Zweck ni<strong>ch</strong>t eine<br />
einzigartige Motivation? Obwohl das <strong>Geigenspiel</strong>, und dies bestätige i<strong>ch</strong> gerne, erhöhte<br />
Lebensqualität s<strong>ch</strong>affen kann, ist dies meiner Meinung na<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t mit der Bedeutung des<br />
Spra<strong>ch</strong>erwerbs verglei<strong>ch</strong>bar. Kann ein Kind ni<strong>ch</strong>t spre<strong>ch</strong>en, beeinträ<strong>ch</strong>tigt dies seinen Alltag<br />
grundlegend. Der Spra<strong>ch</strong>erwerb ist bei Kindern in der Regel so erfolgrei<strong>ch</strong>, weil ihm ein<br />
existenzieller Zweck zu Grunde liegt. Dies ist beim <strong>Geigenspiel</strong> ni<strong>ch</strong>t der Fall.<br />
Im Zuge der Interaktion mit einem Erwa<strong>ch</strong>senen spri<strong>ch</strong>t Bruner von der „Feinabstimmung“<br />
seitens der Eltern und von der damit erforderli<strong>ch</strong>en Flexibilität und Sensibilität. Ob so etwas<br />
23
in der Suzuki-Methode bea<strong>ch</strong>tet wird, ist wahrs<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong> Ansi<strong>ch</strong>tssa<strong>ch</strong>e. Zwar soll na<strong>ch</strong><br />
Suzuki, der persönli<strong>ch</strong>e Eigenrhythmus des Kindes bea<strong>ch</strong>tet werde, do<strong>ch</strong> stellt si<strong>ch</strong> die<br />
Frage, ob wirkli<strong>ch</strong> eine „Feinabstimmung“ vorliegt, wenn alle Kinder dieselben Stücke spielen<br />
(vgl. Kap. 2.2, S. 10).<br />
Bruner betont stets die Wi<strong>ch</strong>tigkeit des spieleris<strong>ch</strong>en Aspekts. Viellei<strong>ch</strong>t fehlt dieser der<br />
Suzuki-Methode ein biss<strong>ch</strong>en, was au<strong>ch</strong> erklären würde, dass sie teilweise als ni<strong>ch</strong>t so<br />
kindgere<strong>ch</strong>t empfunden wird (vgl. Kap. 3.2, S. 17). Dabei darf man die kulturellen Unter-<br />
s<strong>ch</strong>iede, wie sie von Lisa Segawa s<strong>ch</strong>on eindrückli<strong>ch</strong> erläutert wurden, ni<strong>ch</strong>t unbea<strong>ch</strong>tet<br />
lassen.<br />
Somit wäre i<strong>ch</strong> bei Bruners Hauptanliegen, der Kultur, angelangt. Beim Lesen seines Werks<br />
ist mir sofort aufgefallen, wie zentral der kulturelle Kontext des Spra<strong>ch</strong>erwerbs ist. Und vom<br />
kulturellen Kontext stark geprägt ist au<strong>ch</strong> die Suzuki-Methode. (vgl. Kap. 3.2) Sie wurde von<br />
einem Japaner entwickelt und zuerst in Japan angewendet. So ist es ni<strong>ch</strong>t verwunderli<strong>ch</strong>,<br />
dass in den Augen europäis<strong>ch</strong>er Mens<strong>ch</strong>en, die si<strong>ch</strong> für Musikkultur interessieren, einige<br />
ihrer Aspekte ungewohnt ers<strong>ch</strong>einen.<br />
Verglei<strong>ch</strong> der Aussagen<br />
Bruner Suzuki<br />
Formate, Hilfssysteme Einbezug der Eltern, sie spielen au<strong>ch</strong> Geige<br />
Vertraute Umgebung, Routine Anwesenheit der Eltern in den Stunden<br />
Kontinuität Tägli<strong>ch</strong>es Üben, Liedrepertoire<br />
Angeborene Spra<strong>ch</strong>begabung Alle Fähigkeiten werden erst im Laufe des Lebens<br />
erlernt<br />
Zweck „Talenterziehung ist Lebenserziehung“ (Suzuki<br />
1994, S.105) Sie strebt dana<strong>ch</strong> Vors<strong>ch</strong>ulkinder zu<br />
vorzügli<strong>ch</strong>en Mens<strong>ch</strong>en zu formen (vgl. Suzuki<br />
1994)<br />
Feinabstimmung seitens der Eltern Eigenrhythmus des Kindes bea<strong>ch</strong>ten, mit Kind zu<br />
Hause üben<br />
Kultur Familiäres Umfeld<br />
24
5. Konklusion<br />
In diesem Kapitel mö<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong> auf die Fragen, wel<strong>ch</strong>e i<strong>ch</strong> mir zu Beginn gestellt habe, zurück-<br />
kommen. Worin besteht die Suzuki-Methode? Wel<strong>ch</strong>es sind ihre Stärken und S<strong>ch</strong>wä<strong>ch</strong>en?<br />
Kann der Prozess des Mutterspra<strong>ch</strong>erwerbs auf das Erlernen eines Musikinstruments über-<br />
tragen werden?<br />
I<strong>ch</strong> habe versu<strong>ch</strong>t, diese Fragen im Laufe meiner Arbeit zu beantworten, und mö<strong>ch</strong>te nun<br />
meine S<strong>ch</strong>lussfolgerungen ziehen und meine persönli<strong>ch</strong>e Meinung formulieren.<br />
Suzukis Idee, den Spra<strong>ch</strong>erwerb auf das Erlernen von anderen Dingen zu übertragen,<br />
s<strong>ch</strong>eint mir sehr wertvoll. Er hat die Me<strong>ch</strong>anismen des Mutterspra<strong>ch</strong>erwerbs, erkannt und<br />
versu<strong>ch</strong>t, sie auf das Erlernen des <strong>Geigenspiel</strong>s zu übertragen. Wie die Synthese (unter 4.2)<br />
gezeigt hat, ist dies ni<strong>ch</strong>t immer ganz einfa<strong>ch</strong>. Dur<strong>ch</strong> die Auseinandersetzung mit Bruners<br />
Spra<strong>ch</strong>erwerbstheorie habe i<strong>ch</strong> einen Hauptunters<strong>ch</strong>ied erkannt, denjenigen des Zwecks. I<strong>ch</strong><br />
bin der Meinung, dass gerade die existenzielle Unentbehrli<strong>ch</strong>keit den Erwerb der Mutter-<br />
spra<strong>ch</strong>e so einzigartig ma<strong>ch</strong>t. Trotz<strong>dem</strong> finde i<strong>ch</strong>, dass Suzuki viele wi<strong>ch</strong>tige Faktoren<br />
gekonnt übertragen hat.<br />
So hat er die Wi<strong>ch</strong>tigkeit des Einstiegsalters erkannt. Entspre<strong>ch</strong>end ist das Prinzip des<br />
frühen Lernbeginns au<strong>ch</strong> in Anlehnung an den Spra<strong>ch</strong>erwerb entstanden. I<strong>ch</strong> kann mi<strong>ch</strong><br />
Suzuki ans<strong>ch</strong>liessen, wenn er sagt, es sei fals<strong>ch</strong>, die Kinder erst im Alter von sieben Jahren<br />
zu beurteilen. Die Phase vor <strong>dem</strong> S<strong>ch</strong>uleintritt ist für die kindli<strong>ch</strong>e Entwicklung sehr wi<strong>ch</strong>tig.<br />
Im diesem Alter ist ein Kind meist au<strong>ch</strong> sehr lernfreudig und lernfähig. Wenn es mit drei oder<br />
vier Jahren s<strong>ch</strong>on den Wuns<strong>ch</strong> äussert, Geige zu spielen (und dass dies vorkommt, zeigt mir<br />
meine eigene Biographie), soll es dur<strong>ch</strong>aus die Mögli<strong>ch</strong>keit erhalten, Geigenunterri<strong>ch</strong>t zu<br />
nehmen. Mein Besu<strong>ch</strong> in der Suzuki-S<strong>ch</strong>ule Züri<strong>ch</strong> hat mir jedo<strong>ch</strong> gezeigt, dass die Methode<br />
na<strong>ch</strong> Suzuki für meine Vorstellung teilweise wirkli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t sehr kindgere<strong>ch</strong>t ist. Es ging mir<br />
etwas zu militäris<strong>ch</strong> zu und her. Meiner Meinung na<strong>ch</strong> geht das Spieleris<strong>ch</strong>e verloren. Do<strong>ch</strong><br />
dies ist eine rein subjektive Empfindung und hat si<strong>ch</strong>erli<strong>ch</strong> mit meinem persönli<strong>ch</strong>en kultu-<br />
rellen Hintergrund zu tun. Der frühe Umgang mit Musik und mit einem Instrument sollte <strong>dem</strong><br />
Kind in erster Linie Freude bereiten.<br />
In der Suzuki-Methode lernen die Kinder über praktis<strong>ch</strong>es Tun und Na<strong>ch</strong>ahmung. Das Na<strong>ch</strong>-<br />
ahmen ist speziell für ein kleines Kind no<strong>ch</strong> von sehr grosser Bedeutung. Es hat au<strong>ch</strong> keinen<br />
grossen Sinn, ihm mit Worten zu erklären, wie es die Geige halten oder wie es spielen soll.<br />
Der <strong>Weg</strong> über das praktis<strong>ch</strong>e Tun ist si<strong>ch</strong>er effizienter und für das Kind besser zugängli<strong>ch</strong>.<br />
Die Idee, während langer Zeit über das Gehör zu lernen, finde i<strong>ch</strong> sehr wertvoll. Denn wer<br />
liest s<strong>ch</strong>on, bevor er ri<strong>ch</strong>tig spre<strong>ch</strong>en kann? Der Verzi<strong>ch</strong>t auf Noten hat ja au<strong>ch</strong> mit <strong>dem</strong> Alter<br />
25
der S<strong>ch</strong>ülerinnen und S<strong>ch</strong>üler zu tun. Dieser Aspekt ist dur<strong>ch</strong>aus kindgere<strong>ch</strong>t. So wird das<br />
Gehör s<strong>ch</strong>on sehr früh ges<strong>ch</strong>ult und sensibilisiert. Während meiner Kantonss<strong>ch</strong>ulzeit habe<br />
i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> beim Erlernen der Intervalle, Drei- und Vierklänge au<strong>ch</strong> oft gefragt, ob mir dies als<br />
kleines Kind ni<strong>ch</strong>t viel lei<strong>ch</strong>ter gefallen wäre. Eine frühe Gehörbildung ist si<strong>ch</strong>erli<strong>ch</strong> sehr<br />
effizient und trägt viel zur Musikalität eines Mens<strong>ch</strong>en bei. Zu<strong>dem</strong> fasziniert mi<strong>ch</strong>, dass die<br />
Kinder bei der Suzuki-Methode alles auswendig spielen. Hier habe i<strong>ch</strong> etwas entdeckt, das in<br />
meiner Ausbildung zu kurz gekommen ist. Das Auswendiglernen ist nämli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t nur ein<br />
Automatisieren, man muss si<strong>ch</strong> dazu die Melodie innerli<strong>ch</strong> vorstellen können und dann den<br />
entspre<strong>ch</strong>enden Ton drücken respektive den Finger auf das Griffbrett setzen. Das Noten-<br />
lesen gehört meiner Ansi<strong>ch</strong>t na<strong>ch</strong> hingegen ab <strong>dem</strong> Primars<strong>ch</strong>ulalter au<strong>ch</strong> <strong>zum</strong> Spielen<br />
eines Instrumentes, so wie auf dieser Stufe au<strong>ch</strong> das Lesen erlernt wird. Der Notentext öffnet<br />
weitere Türen. So kann man musizieren, ohne die entspre<strong>ch</strong>enden Stücke vorher gekannt zu<br />
haben. Do<strong>ch</strong> sollte das Auswendigspielen ni<strong>ch</strong>t in Vergessenheit geraten. Es kann ab und zu<br />
eingesetzt werden, denn das Si<strong>ch</strong>lösen vom Notentext kann unter Umständen die Musikalität<br />
und den Ausdruck fördern.<br />
Ein weiteres Element der Suzuki-Methode ist der starke Einbezug der Eltern. So lernt, wie<br />
erwähnt, die Mutter oder der Vater im Idealfall ebenfalls Geige zu spielen. I<strong>ch</strong> sehe ein, dass<br />
dies <strong>dem</strong> Üben zu Hause si<strong>ch</strong>er förderli<strong>ch</strong> ist, da der betreffende Elternteil genau Bes<strong>ch</strong>eid<br />
weiss. I<strong>ch</strong> kann mir jedo<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> vorstellen, wel<strong>ch</strong> ein <strong>Auf</strong>wand dadur<strong>ch</strong> für Mütter oder Väter<br />
entsteht. So etwas kann man ni<strong>ch</strong>t automatis<strong>ch</strong> von Eltern erwarten. Die Anwesendheit<br />
während der Lektionen und die Betreuung zu Hause beim Üben finde i<strong>ch</strong> jedo<strong>ch</strong>, vor allem<br />
am Anfang und bei kleinen Kindern, sehr wi<strong>ch</strong>tig.<br />
Gruppenstunden sind bekanntli<strong>ch</strong> ein Teil der Methode. Die Idee des gemeinsamen Musi-<br />
zierens spri<strong>ch</strong>t mi<strong>ch</strong> sehr an, denn es ist in der musikalis<strong>ch</strong>en wie au<strong>ch</strong> mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en<br />
Entwicklung allgemein wi<strong>ch</strong>tig, dass man si<strong>ch</strong> in eine Gruppe einzufügen lernt und auf<br />
andere eingehen kann. Darüber hinaus ist das Spielen in der Gruppe für die Kinder si<strong>ch</strong>er<br />
sehr motivierend. Au<strong>ch</strong> i<strong>ch</strong> spiele lieber im Or<strong>ch</strong>ester mit anderen zusammen als nur für<br />
mi<strong>ch</strong> allein.<br />
Zuletzt mö<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> zur Idee des Basisrepertoires äussern. Es ers<strong>ch</strong>eint mir sinnvoll,<br />
s<strong>ch</strong>on gespielte Stücke ab und zu wieder hervorzunehmen und diese weiter zu verfeinern.<br />
Der Verglei<strong>ch</strong> <strong>zum</strong> Worts<strong>ch</strong>atz ers<strong>ch</strong>eint mir sehr überzeugend. Die strikte Erarbeitung aller<br />
Stücke aus den Heften und das Einhalten ihrer Reihenfolge ers<strong>ch</strong>einen mir weniger<br />
anspre<strong>ch</strong>end. I<strong>ch</strong> finde, dass dies zu wenig Individualisierung zulässt. Ein Kind hat viellei<strong>ch</strong>t<br />
mehr Mühe mit der Bogenhand, während das andere S<strong>ch</strong>wierigkeiten mit <strong>dem</strong> Handgelenk<br />
der linken Hand hat. Die Probleme, wel<strong>ch</strong>e si<strong>ch</strong> beim Erlernen eines Instruments ergeben<br />
können, sind so vielfältig, dass mir für eine individuelle Förderung zusätzli<strong>ch</strong>e Übungen und<br />
26
Stücke wüns<strong>ch</strong>bar ers<strong>ch</strong>einen. Zu<strong>dem</strong> finde i<strong>ch</strong> es au<strong>ch</strong> für die Lehrerin oder den Lehrer<br />
etwas langweilig, wenn man immer dieselben Stücke spielt.<br />
Persönli<strong>ch</strong> sehe i<strong>ch</strong> in der Suzuki-Methode viele gute Ansätze, i<strong>ch</strong> würde sie jedo<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t<br />
vollständig adaptieren. Diese Methode muss zwingend im Zusammenhang mit der japa-<br />
nis<strong>ch</strong>en Kultur gesehen werden. Würde mein Kind Geige spielen wollen, würde i<strong>ch</strong> es sehr<br />
wahrs<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t in den Suzuki-Unterri<strong>ch</strong>t s<strong>ch</strong>icken. Wäre i<strong>ch</strong> Geigenlehrerin, würde i<strong>ch</strong><br />
gewisse Ansätze der Suzuki-Methode in meinen Unterri<strong>ch</strong>t einfliessen lassen. Das wären<br />
beispielsweise die S<strong>ch</strong>ulung des Gehörs, das Auswendigspielen oder au<strong>ch</strong> das Musizieren<br />
in Gruppen.<br />
27
6. Na<strong>ch</strong>wort<br />
Im Laufe dieser Arbeit erhielt i<strong>ch</strong> einen guten Einblick in die Methode von Shini<strong>ch</strong>i Suzuki.<br />
I<strong>ch</strong> konnte sie mit meinem eigenen Violinunterri<strong>ch</strong>t verglei<strong>ch</strong>en. Zu<strong>dem</strong> erkannte i<strong>ch</strong> die<br />
Parallelen seiner Methode <strong>zum</strong> Erwerb der Mutterspra<strong>ch</strong>e. Die Lektüre des Werks<br />
„Erziehung ist Liebe“ von Suzuki hat mi<strong>ch</strong> besonders fasziniert, da es sehr persönli<strong>ch</strong> seine<br />
Erfahrungen und Gedanken vermittelt. Es öffnete si<strong>ch</strong> für mi<strong>ch</strong> ein spannendes, jedo<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong><br />
breites Themenfeld. So war es teilweise s<strong>ch</strong>wierig, mein Thema einzugrenzen.<br />
Die Gesprä<strong>ch</strong>e mit der Familie Segawa und mit Herrn Rüttimann waren sehr informativ und<br />
berei<strong>ch</strong>ernd und haben mir sehr geholfen Vor- und Na<strong>ch</strong>teile der Methode zu erkennen und<br />
mir meine eigene Meinung zu bilden.<br />
Die Auseinandersetzung mit meinem Thema erweiterte ni<strong>ch</strong>t nur meinen kulturellen<br />
Wissenshorizont und mein methodis<strong>ch</strong>es Bewusstsein, sonder vertiefte au<strong>ch</strong> die Einsi<strong>ch</strong>t in<br />
meine eigene Lernbiographie.<br />
28
7. Quellen<br />
Bü<strong>ch</strong>er<br />
Suzuki, Shini<strong>ch</strong>i (1994): Erziehung ist Liebe. Kassel: Gustav Bosse Verlag<br />
Barrett, Carolyn M. (1995): The Magic of Matsumoto: The Suzuki Method of Education. Palm<br />
Springs: ETC Publications.<br />
Sassmannshaus, Egon (1976): Früher Anfang auf der Geige, Band 2. Kassel: Bärenreiter-<br />
Verlag Karl Vötterle GmbH &Co<br />
Farga, Franz (1983): Geigen und Geiger. Rüs<strong>ch</strong>likon-Züri<strong>ch</strong>, Stuttgart, Wien: Albert Müller<br />
Verlag, AG<br />
Bruner; Jerome (2002): Wie das Kind spre<strong>ch</strong>en lernt. Bern: Hans Huber Verlag<br />
Internetseiten<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Suzuki-Methode, Abfrage vom 10.9.06<br />
by: wikipedia, Titel: Suzuki-Methode, 16. Juli 2006<br />
http://www.suzuki-luzern.<strong>ch</strong>/suzuki.html, Abfrage vom 10.9.06<br />
by: Deuts<strong>ch</strong>es Suzuki Institut, 2005 Titel: Die Suzuki Methode<br />
http://www.mi<strong>ch</strong>ael-koeppe.de/Suzuki_Methode/Biografie/biografie.html, Abfrage vom<br />
10.9.06<br />
© 1998 bei Mi<strong>ch</strong>ael Köppe & Stefan Oefner, Titel: Biografie<br />
Bilder<br />
Titelblatt: (Abfragen vom 16.9.06)<br />
http://core.ecu.edu/hist/wilburnk/SuzukiPianoBasics/News/suzukiphoto.jpg (Bild Suzuki)<br />
http://designladen.com/musikinstrumente/source/image/geige-dsc02254.jpg (Bild Geige)<br />
http://www.stadtar<strong>ch</strong>iv-s<strong>ch</strong>affhausen.<strong>ch</strong>/pictures/Einstein%20mit%20Geige.jpg (Bild Einstein)<br />
Abb. 1: Shini<strong>ch</strong>i Suzuki: http://www.suzuki-music-method.<strong>ch</strong>/index_d.php Abfrage vom<br />
10.9.06<br />
Abb. 2: Suzuki 1994, S. 32<br />
Abb. 3: http://www.musicroom.com/images/catalogue/productpage/IMP4363A.jpg Abfrage<br />
vom 25.9.06<br />
Abb. 4: http://www.tonak.is/suzukideild/Shini<strong>ch</strong>i%20suzuki.jpg Abfrage vom 10.9.06<br />
Abb. 5 – 7: eigene Fotographien<br />
29