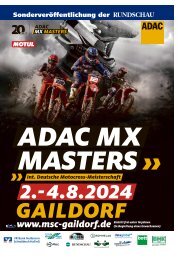unternehmen Oktober 2014
unternehmen Oktober 2014
unternehmen Oktober 2014
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Wirtschaftsmagazin im Südwesten Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> | 3,00 €<br />
4 197821 303000 4 1<br />
Da springt<br />
der Funke über<br />
Das Handwerk setzt um, was die Forschung erfindet.<br />
Aber wo ist die Schnittstelle? Tobias Mehlich und<br />
Werner Tillmetz über ihre zündende Initiative.<br />
Finanzieren Kaufen statt gründen – Tipps für angehende Unternehmer SEITE 22<br />
Nutzfahrzeuge Wie die Zukunft auf deutschen Straßen aussieht SEITE 42<br />
Umfrage Wofür sich Führungskräfte Zeit nehmen SEITE 51
Besser vernetzt mit M-net IP-VPN über den<br />
eigenen MPLS-Backbone.<br />
eine<br />
sichere<br />
Verbindung<br />
Kostenlose Infoline:<br />
Tel.: 0800 7767887<br />
m-net.de/ipvpn<br />
ab<br />
199 €<br />
netto monatlich 1<br />
1) Angebot gültig vom 01.10.14 bis 31.01.15 nur für Neubestellungen mit 36 Monaten Mindestvertragslaufzeit.<br />
Preis zzgl. MwSt. Enthalten sind max. vier Standorte, ein Standort mit 4,6 Mbit/s SDSL und höchstens drei weitere<br />
Standorte mit max. 2,3 Mbit/s SDSL.
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[inhalt]<br />
Liebe Leserin, Lieber Leser,<br />
Irmgard Städele,<br />
Redaktion <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Politiker und Journalisten teilen sich das<br />
traurige Schicksal, dass sie oft heute schon<br />
über Dinge reden, die sie erst morgen ganz<br />
verstehen. Das hat Altkanzler Helmut<br />
Schmidt einmal gesagt. Das Mitgefühl von<br />
Unternehmern, Selbstständigen und Führungskräften<br />
dürfte sich da freilich in Grenzen<br />
halten: Mit ihren Entscheidungen stellen<br />
sie heute die Weichen für die Zukunft<br />
ihrer Unternehmen. Wer Entwicklungen<br />
verschläft, landet schneller als er denkt auf<br />
dem Abstellgleis. Das hohe Tempo der Entwicklungen<br />
trifft das Handwerk (Titelinterview<br />
Seite 12), den Maschinenbau mit dem<br />
Thema „Industrie 4.0“ (Seite 28) , die Nutzfahrzeugbranche<br />
mit dem autonom fahrenden<br />
Lkw (Seite42) ... Nicht zu langsam,<br />
nicht zu schnell. Das ist das Meisterstück.<br />
Sich Zeit zu nehmen, ist wichtig. Wie das<br />
geht, zeigt unsere Umfrage (Seite 51).<br />
Eine anregende Lektüre wünscht<br />
Ihre Irmgard Städele<br />
[sicherheit]<br />
6 Gute Wolken, schlechte Wolken<br />
Wie tückisch Clouds sein können<br />
[titelthema]<br />
12 e inladung zum Anfassen Tobias<br />
Mehlich und Werner Tillmetz im<br />
Gespräch<br />
[finanzieren]<br />
22 Chefsessel zu vergeben Was ist<br />
wichtig beim Unternehmenskauf?<br />
[machen]<br />
26 Vielversprechendes Haustürgeschäft<br />
Frustfreie Paketzustellung<br />
32 Tischlein deck dich Burger Zelte &<br />
Catering feiert den Fünfzigsten<br />
40 Lisa, Thomas und der Kessel nr. 2<br />
Bio-Chips – knusperfrischer Genuss aus<br />
Amtszell<br />
48 Tante emma atmet auf<br />
Lebensmittel-Großhandel Utz gibt<br />
Dorfläden eine Perspektive<br />
[führen]<br />
36 Die teuren Fehler der Vorgesetzten<br />
Warum schlechte Führung Geld kostet<br />
[spezial]<br />
28 evolution der Maschinen Das Internet<br />
dringt in die Produktion vor<br />
[bewegen]<br />
42 Fahren muss der Fahrer nicht Der<br />
autonome Lkw ist fast schon Realität<br />
45 Mit „rotem bus“ in rente: ein<br />
Visionär fährt ab Omnibus-Entwickler<br />
Franz Krieglsteiner steigt aus<br />
[leben]<br />
51 Ach du liebe Zeit!<br />
Führungskräfte, ihr Leben, ihre Uhren<br />
[namen & nachrichten]<br />
4 n eues Zentrum will einwanderer<br />
locken<br />
10 schwere Zeiten<br />
21 ZF Friedrichshafen trennt<br />
sich von Lenksysteme-Tochter<br />
47 ZU-Präsident Jansen geht vorzeitig<br />
54 Abschalten in natur und sonne<br />
54 Impressum<br />
40 42<br />
36 48<br />
28<br />
3
[namen & nachrichten] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Neues Zentrum will Einwanderer locken<br />
Foto: © Dariusz T. Oczkowicz, ars digital media services / Fotolia.com<br />
Gute Fachkräfte braucht die Region: Wenn sie aus dem Ausland kommen, erhalten sie künftig Unterstützung.<br />
Die Region braucht Fachkräfte.<br />
Darum soll sich künftig das neue<br />
„Welcome Center“ der Ulm/Oberschwaben<br />
der IHK Ulm kümmern.<br />
„Es stellt für Ulm einen<br />
zweiten Turm dar, der neue Menschen<br />
anzieht!“ Mit diesen Worten<br />
eröffnete Irmgard Otto, Referentin<br />
für Fachkräftesicherung<br />
im baden-württembergischen<br />
Wirtschaftsministerium das<br />
Center. Ziel des Centers sei es,<br />
dem Fachkräftemangel „mit einer<br />
neuen Willkommenskultur<br />
für Immigranten zu begegnen“,<br />
erklärt Center-Verantwortliche<br />
Nadine Schilder. Das Center<br />
übernimmt eine Art Lotsenfunktion.<br />
So helfen die Mitarbeiter<br />
Einwanderern bei Behördengängen,<br />
beraten sie über Kinderbetreuungsangebote<br />
und Sprachkurse<br />
oder unterstützen sie auch,<br />
wenn es um die Anerkennung<br />
beruflicher Qualifikationen geht.<br />
IHK-Geschäftsführer Otto Sälzle<br />
erklärt den Hintergrund: „Für<br />
uns ist es ganz wichtig, Unternehmen<br />
und ausländische Fachkräfte<br />
näher zusammenzubringen,<br />
denn der demografische<br />
Wandel und die Rente mit 63 sorgen<br />
dafür, dass wir unsere Region<br />
dringend attraktiver für Zuwanderer<br />
machen müssen.“ Allen Beteiligten<br />
sei es deshalb wichtig,<br />
die Institution möglichst langfristig<br />
zu betreiben.<br />
Die Idee der „Welcome Center“<br />
stammt vom Land. Insgesamt<br />
gibt es für elf Zentren 2 Millionen<br />
Euro, die mehrheitlich aus dem<br />
europäischen Sozialfonds kommen.<br />
Nach Ulm fließt eine Anschubfinanzierung<br />
von 93.000<br />
Euro, den Rest der Kosten für die<br />
2,5 Stellen trägt die IHK.<br />
Den 30.000 Unternehmen in der<br />
Re gion fehlen im Moment rund<br />
12.000 Fachkräfte, mehrheitlich<br />
solche mit dualer Ausbildung. [!]<br />
GABRIEL BOCK<br />
Parkraum-Wunder aus dem Allgäu<br />
Mit spektakulären Projekten hat<br />
die Klaus Multiparking GmbH<br />
aus Aitrach bei Memmingen in<br />
den vergangenen 50 Jahren Aufmerksamkeit<br />
erregt. Mit raffinierten<br />
Erfindungen und solider<br />
handwerklicher Fertigung erarbeiteten<br />
sich die Allgäuer auf<br />
dem Gebiet raumsparender benutzerfreundlicher<br />
Parksysteme<br />
international Ansehen. Weltweit<br />
gibt es kaum eine Metropole, in<br />
der nicht Parklösungen aus Aitrach<br />
zu finden sind. Ob London,<br />
Rom, Los Angeles, Tokio: Überall<br />
stehen architektonisch spektakuläre<br />
Bauten, die mit Klaus-<br />
Parksystemen bestückt sind.<br />
Neuerdings sind es spektakulärekirchturmhohe<br />
Parktürme. In<br />
ihnen werden die Autos am Fuß<br />
in Empfang genommen und automatisch<br />
auf Etagen mit leeren<br />
Parkboxen gehievt. Aus denen<br />
werden sie wie von Geisterhand<br />
wieder abgerufen.<br />
Das war vor 50 Jahren anders. Als<br />
Firmengründer Kaspar Klaus, die<br />
Idee hatte, wegen der sich abzeichnenden<br />
Parkplatznot zwei<br />
Autos per Rampe übereinander<br />
abzustellen, wurde er belächelt.<br />
Der Kölner Rheinauhafen: In der längsten öffentlichen Tiefgarage Europas<br />
kommen auch technische Lösungen von Klaus Multiparking zum Einsatz.<br />
Doch er behielt Recht. In rascher<br />
Folge kamen mehrstöckige Plattformen,<br />
die seitlich verschiebbar<br />
waren, und kreisförmige drehbare<br />
Scheiben dazu. Sie waren nicht<br />
nur platz- sondern auch zeitsparend,<br />
weil der lästige Gegenverkehr<br />
entfiel. Damit war das<br />
Grundprinzip für die heute nach<br />
dem Fahrstuhlprinzip arbeitenden<br />
Parktürme erfunden. Heute<br />
zählt Klaus Multiparking bei Autoparksystemen<br />
zu den Weltmarktführern,<br />
kooperiert mit 65<br />
Vertriebspartnern weltweit und<br />
hat Anlagen mit mehr als 700.000<br />
Stellplätzen ausgeliefert. Allesamt<br />
wurden von den 140 Mitarbeitern<br />
im Werk in Aitrach konzipiert<br />
und gefertigt. [!] HAM<br />
4
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[namen & nachrichten]<br />
Je größer die Firma, desto satter das Gehalt<br />
Führungskräfte und Spezialisten<br />
im kaufmännischen Bereich<br />
konnten sich 2013 im Durchschnitt<br />
über 3,3 Prozent höhere<br />
Bezüge freuen. Nach dem Vergütungsreport<br />
der Managementberatung<br />
Kienbaum erhalten Führungskräfte<br />
durchschnittlich<br />
eine Vergütung von 124.000 Euro<br />
im Jahr, während Spezialisten auf<br />
64.000 Euro und Sachbearbeiter<br />
auf 47.000 Euro kommen.<br />
Die Unternehmensgröße beeinflusst<br />
die Vergütung von Führungskräften<br />
in kaufmännischen<br />
Funktionen erheblich: Eine kaufmännische<br />
Führungskraft in einem<br />
Unternehmen mit mehr als<br />
5000 Beschäftigten verdient mit<br />
151.000 Euro durchschnittlichem<br />
Jahresgehalt gut 75 Prozent<br />
Verdienst im kaufmännischen Bereich<br />
124.000 €/Jahr (Führungskräfte)<br />
64.000 €/Jahr (Spezialisten)<br />
Quelle: Kienbaum Consultants International GmbH<br />
47.000 €/Jahr (Sachbearbeiter)<br />
Grafik: mediaservice ulm<br />
mehr als eine Führungskraft in<br />
einem Unternehmen mit bis zu<br />
50 Mitarbeitern: Sie erhält 86.000<br />
Euro. 86 Prozent der Manager erhalten<br />
einen Bonus. Im Schnitt<br />
beträgt dieser 24.000 Euro; das<br />
entspricht 17 Prozent der Gesamtdirektvergütung.<br />
Bei den<br />
Spezialisten und Sachbearbeitern<br />
sind die Unterschiede nicht<br />
ganz so groß: Unternehmen mit<br />
mehr als 5000 Beschäftigten zahlen<br />
ihren kaufmännischen Spezialisten<br />
im Schnitt 75.000 Euro im<br />
Jahr, bei kleinen Firmen erhalten<br />
diese 55.000 Euro. Bei den Sachbearbeitern<br />
reicht die Bandbreite<br />
von 52.000 Euro bis 41.000 Euro.<br />
Für die Studie hat Kienbaum<br />
4600 Positionen in 577 Unternehmen<br />
analysiert. [!]<br />
OS<br />
Kohler fördert faire Löhne<br />
und Klimaprojekt<br />
Ugandische Frauen bei der Ernte von Bio-Baumwolle.<br />
Was Modeketten nach Skandalen<br />
in der Textilproduktion erst lernen<br />
müssen, ist bei Kohler Standard.<br />
Das auf Einrichtungshaus<br />
aus Erolzheim (Kreis Biberach)<br />
hat laut Firmenchef Peter Kohler<br />
schon immer auf die Herkunft<br />
und die Produktion der Textilien<br />
geachtet. Die Wäsche der Marke<br />
„Cotonea“ besteht aus Biobaumwolle,<br />
die ohne Pestizide, Gentechnik<br />
und Kunstdünger in<br />
Uganda angebaut wird. Faire Löhne<br />
und Abnahmepreise sowie<br />
gute Arbeitsbedingungen seien<br />
garantiert und würden überprüft.<br />
In Indien unterstützt das<br />
Familien<strong>unternehmen</strong>, das elf<br />
Mitarbeiter beschäftigt, ein Klimaprojekt,<br />
das der Bevölkerung<br />
zu günstigen Brennstoffen ohne<br />
CO2-Ausstoß verhilft. [!] OS<br />
Kaserne wird zum<br />
Energie-Lernpark<br />
Ein grünes Gewerbegebiet, ein<br />
Lern- und Energiepark sowie eine<br />
Akademie für Nachhaltigkeit: Das<br />
ist auf 77 Hektar Fläche auf dem<br />
ehemaligen Gelände der Oberschwabenkaserne<br />
in Hohentengen<br />
geplant. Das ganze firmiert<br />
unter dem Namen Ehoch4. Die<br />
spielerische Vermittlung von Wissen<br />
rund um die Energie soll von<br />
2016 an jährlich tausende Kinder<br />
zwischen 2 und 15 Jahren anlocken.<br />
Dahinter steckt der Ravensburger<br />
Spieleverlag. Auch ein<br />
Wissenschaftscampus ist vorgesehen.<br />
Alle dortigen Einrichtungen<br />
sollen mit vor Ort erzeugter Energie<br />
versorgt werden. Das Investitionsvolumen<br />
beträgt mehr als<br />
50 Millionen Euro. [!] OS<br />
1000 neue Arbeitsplätze<br />
mit L-Bank-Förderung<br />
Die Förderung der L-Bank hat in<br />
der Region Ulm zahlreiche Investitionen<br />
ausgelöst. Im ersten<br />
Halbjahr unterstützte das landeseigene<br />
Förderinstitut 274 Unternehmen<br />
aus dem IHK-Bezirk<br />
Ulm mit rund 93 Millionen Euro.<br />
Das sind 82 Prozent mehr als im<br />
Vorjahr. Dies führte zu Investitionen<br />
von 163 Millionen Euro. Fast<br />
300 neue Arbeitsplätze sind entstanden.<br />
Neben IHK-Firmen wurden<br />
auch 685 Betriebe der Handwerkskammer<br />
Ulm unterstützt.<br />
Die Darlehen von 196 Millionen<br />
Euro (plus 14 Prozent) lösten Investitionen<br />
von mehr als 337 Millionen<br />
Euro aus. Dadurch werden<br />
in den Handwerksfirmen 1000<br />
Jobs geschaffen. [!]<br />
OS<br />
5
[rubrik] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Foto: © Pixsooz / Fotolia.com<br />
guteWolken,schlechteWolken<br />
Wer braucht heute noch eigene teure Server und IT-Spezialisten, wo es doch Clouds gibt? Doch so manche Wolke, vor<br />
allem in den USA, kann tückisch sein. Wo lauert Gewittergefahr? Ein Überblick.<br />
Schöne neue Welt. Von jedem Gerät an jedem Ort kann man auf Firmendaten zugreifen. Aber Achtung. Nicht jeder Cloud kann man trauen.<br />
Sie ist kompliziert, teuer und für viele<br />
unerlässlich: IT (Information Technologies),<br />
also elektronische Datenverarbeitung.<br />
Kaum ein Unternehmen kommt<br />
noch ohne IT-basierte Verarbeitung von Daten<br />
aus. Ob Kundendaten, Wissensmanagement<br />
oder Verwaltung, alles wird elektronisch<br />
gemacht. Natürlich vernetzt, damit alle<br />
immer auf dem aktuellen Stand sind.<br />
Problemlos ist die IT freilich nicht. Einfach<br />
den Rechner anschalten und loslegen, klappt<br />
nur dann, wenn die Voraussetzungen stimmen.<br />
Für ein funktionierendes System sind<br />
ausreichende technische Kapazitäten nötig –<br />
und Leute, die für Wartung und Bereitstellung<br />
sorgen. Aber Fachleute und Technik kosten so<br />
viel, dass es sich für viele Unternehmen nicht<br />
lohnt, sie selbst im Betrieb anzustellen.<br />
Angesichts dessen<br />
verwundert es<br />
nicht, dass das sogenannte<br />
Cloud-<br />
Computing seit<br />
der Jahrtausendwende<br />
immer<br />
beliebter wird.<br />
„Unter Cloud-<br />
Computing versteht<br />
IT-Professor Philipp Brune<br />
man die<br />
erklärt die Cloud.<br />
skalierbare Bereitstellung<br />
verschiedener<br />
IT-Dienstleistungen in einem entfernten<br />
Rechenzentrum über das Internet, es ist<br />
eine besondere Form des IT-Outsourcings“,<br />
erklärt Professor Philipp Brune von der Hochschule<br />
Neu-Ulm (HNU). Er ist wissenschaftlicher<br />
Leiter des Rechenzentrums der HNU und<br />
Experte in Sachen Cloud-Computing.<br />
ameriKaNerDomiNiereN<br />
Lag das deutsche Marktvolumen von Cloud-<br />
Diensten 2013 noch bei 4,52 Milliarden Euro,<br />
wird es im laufenden Jahr auf voraussichtlich<br />
6,62 Milliarden Euro und 2015 auf 9,23 Milliarden<br />
Euro anwachsen. Das prognostiziert<br />
eine Studie der Münchner Experton-Group.<br />
Dominiert wird der Markt von den großen US-<br />
Anbietern wie salesforce.com und den Cloud-<br />
Diensten von Google, Apple und Microsoft.<br />
Laut dem Computermagazin „c‘t“ befinden<br />
sich 90 Prozent der globalen Cloud-Kapazität<br />
in den USA.<br />
Es gibt jedoch auch Cloud-Anbieter mit Rechenzentren<br />
in Europa. Im Großraum Ulm<br />
6
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[sicherheit]<br />
Cloud-Dienstleistungen:Diedreitypen<br />
Partner auf<br />
Augenhöhe<br />
Kopiersysteme<br />
» Multifunktionale Systeme<br />
» Managed Print Services<br />
» Dokumentenmanagement<br />
» Analyse & Optimierung<br />
grundsätzlich wird zwischen drei Arten<br />
von Cloud-Dienstleistungen unterschieden,<br />
erklärt Experte Philipp Brune.<br />
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) bezeichnet<br />
die reine Bereitstellung technischer<br />
Leistungen, also von Rechenkapazität<br />
oder Speicherplatz. Die Verwaltung<br />
und Betreuung übernimmt der Kunde<br />
selbst. IaaS ist die häufigste Form von<br />
Cloud-Computing.<br />
Platform-as-a-Service (PaaS) beinhaltet<br />
für den Kunden die Möglichkeit, in<br />
der Cloud selbst Anwendungen zu entwickeln<br />
oder zu betreiben.<br />
Die vielleicht bekannteste Cloud-Form<br />
ist Software-as-a-Service (SaaS). Hierbei<br />
nutzt der Kunde Software auf dem<br />
Cloud-Speicher, die vom Dienstleister<br />
angeboten, betreut und verwaltet wird.<br />
Der Unterschied zum Mieten eines Servers<br />
besteht darin, dass beim Cloud-<br />
Computing flexibel auf den aktuellen Bedarf<br />
an technischen Ressourcen reagiert<br />
werden kann. „Man bezahlt nur, was gerade<br />
benötigt wird. Gleichzeitig kann der<br />
Anbieter ungenutzte Kapazität anderweitig<br />
verkaufen“, erläutert der Professor.<br />
Die Vorteile für den Kunden: Er spart sich<br />
eine eigene IT-Abteilung und Betreuung.<br />
Die Flexibilität des Cloud-Computings<br />
macht zudem eine einfache Anpassung<br />
der IT-Strukturen auf Veränderungen und<br />
Fortschritt möglich.<br />
Gab<br />
IT-Lösungen<br />
» IT-Infrastruktur & Sicherheit<br />
» Medien- & Konferenztechnik<br />
» Cloud-Dienste & Storage<br />
» Virtualisierungskonzepte<br />
stellt beispielsweise auch die Wilken-Gruppe<br />
ein Rechenzentrum mit entsprechenden<br />
Dienstleistungen zur Verfügung. Der Geschäftsführer<br />
des Zentrums, Harald Varel,<br />
skizziert das Konzept: „Wir bieten Software<br />
und IT-Infrastruktur auf lokaler Ebene an und<br />
stellen auf den Kunden abgestimmte Lösungen<br />
bereit.“<br />
Das Rechenzentrum selbst ist ein mannshoher,<br />
schwarzer Block mit einer Grundfläche<br />
von zwei auf fünf Metern. Er besteht aus mehreren<br />
Recheneinheiten, von denen jede den<br />
Stromverbrauch eines Mehrfamilienhauses<br />
hat. Das gesamte Zentrum benötigt täglich etwa<br />
1350 kWh. Insgesamt werden hier am Tag<br />
mehr als 30 Terrabyte Daten verarbeitet und<br />
den Unternehmen, die sie auslagern, wieder<br />
zur Verfügung gestellt. Das Gesamtvolumen<br />
der Daten beträgt etwa ein Petabyte, das sind<br />
eine Million Gigabyte. Auch andere Unternehmen<br />
vermitteln lokale und internationale<br />
Clouds und betreuen sie, so zum Beispiel auch<br />
der Ulmer IT-Spezialist Fritz und Macziol.<br />
Cloud-Direktor Jörg Mecke sagt: „Uns ist es<br />
wichtig, dass der Kunde keinen Unterschied<br />
zur IT ohne Cloud bemerkt.“ Fritz und Macziol<br />
bietet sowohl die Betreuung von Clouds an,<br />
die ein Unternehmen selbst errichtet, als auch<br />
eine Übernahme der IT-Auslagerung an auswärtige<br />
Rechenzentren. Hier bleibt die Wahl<br />
des Cloud-Standortes dem Auftraggeber überlassen.<br />
Bei dem Ulmer IT-Spezialisten wird<br />
Flexibilität als der größte Vorteil der Clouds<br />
gesehen. Gute Cloudlösungen lassen sich<br />
nach den Worten Meckes auf die Bedürfnisse<br />
und Wünsche des Kunden anpassen.<br />
Bei der Auslagerung von Unternehmensdaten<br />
ist die Sicherheit das zentrale Thema. Gerade<br />
Büroeinrichtungen<br />
» Sitzmöbel & Arbeitsplätze<br />
» Beleuchtung & Beschattung<br />
» Akustik & Ergonomie<br />
» Planung & Konzeption<br />
Günzburg • Biberach • Dillingen • Eisleben<br />
www.feha.de<br />
7
[sicherheit] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Rechenzentren benötigen außerordentlich viel Energie. Das Ulmer Unternehmen Wilken hat daher ein eigenes Blockheizkraftwerk.<br />
wenn es um Kundendaten geht, darf nichts<br />
passieren. Für den Schutz muss jedes Unternehmen<br />
garantieren. Das kann zum Problem<br />
für Firmen werden, die Cloud-Anbieter in den<br />
USA nutzen. Diese unterliegen dem sogenannten<br />
„Patriot Act“. Das nach den Anschlägen<br />
vom 11. September 2001 entstandene Gesetz<br />
verpflichtet Unternehmen in den USA,<br />
den Geheimdiensten auch ohne richterliche<br />
Anordnung Zugriff auf ihre Server zu geben.<br />
Wird hierbei gegen das deutsche Bundesdatenschutzgesetz<br />
verstoßen, so drohen dem<br />
deutschen Kunden des US-Anbieters möglicherweise<br />
juristische Probleme. Die Folge<br />
können Bußgelder und Schadenersatzzahlungen<br />
sein.<br />
Der europäische Gerichtshof entschied 2011,<br />
dass personenbezogene Daten nur noch eingeschränkt<br />
in die USA gelangen dürfen. „Der<br />
Ausweg aus der problematischen Situation<br />
ist, einen regionalen oder zumindest nationalen<br />
Cloud-Anbieter zu wählen“, sagt Brune.<br />
Diese sind den deutschen Gesetzen unterworfen<br />
und bieten häufig eine höhere Transparenz<br />
ihrer Strukturen. Auch Microsoft plant<br />
nun Clouds in Deutschland.<br />
In jüngster Zeit tauchen Berichte auf, dass Hacker<br />
sensible Daten von Clouds gestohlen haben.<br />
Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Veröffentlichung<br />
privater Fotos etlicher<br />
Prominenter. Die Bilder wurden aus Cloud-<br />
Speichern des US-Konzernriesen Apple entwendet.<br />
Für ein Unternehmen wäre der Diebstahl<br />
von Know-how oder Kundendaten eine<br />
Katastrophe. Zudem stellt sich die Frage nach<br />
Problemen beim technischen Betrieb des Rechenzentrums.<br />
Ein Ausfall der Datenzentren,<br />
etwa wegen eines Stromausfalls, könnte fatal<br />
sein, denn plötzlich wären sämtliche Kunden<br />
von ihrer IT-Verwaltung abgeschnitten.<br />
DasProblemistDerKUNDe<br />
Ist die Auslagerung also leichtsinnig? Nein,<br />
findet Brune: „Gerade die auf die Wirtschaft<br />
spezialisierten Anbieter von Cloud-Computing<br />
haben oft mehr Erfahrung und Wissen<br />
beim Thema Sicherheit und auch höhere<br />
Standards, als dies bei ihren Kunden der Fall<br />
ist. Oft gelangen die Hacker viel einfacher an<br />
die Zugangsdaten der Nutzer und kommen<br />
darüber an die Datenbanken.“ Auch Harald<br />
Varel bestätigt, dass die meisten Sicherheitsprobleme<br />
beim Kunden entstehen. „Wir versuchen,<br />
unsere Kunden mit Beratung und<br />
durch besonders<br />
restriktive Sicherheitsmechanismen<br />
zu einem sicheren<br />
Umgang<br />
mit ihren Passwörtern<br />
zu bewegen“,<br />
sagt er. Bei Wilken<br />
legt man besonderen<br />
Wert auf Virenabwehr<br />
und Wilken-Geschäftsführer<br />
Ausfallsicherheit Dr. Harald Varel.<br />
des Rechenzentrums.<br />
Das steht in einem alarmgesicherten<br />
bunkerartigen Raum mit Sicherheitsschleuse<br />
und eigenem Kühlsystem, die Firma verfügt<br />
in Ulm zudem über ein eigenes Blockheizkraftwerk<br />
und ein Notstromaggregat.<br />
Worauf muss ein Unternehmen also achten,<br />
wenn es einen Cloud-Dienst nutzen möchte?<br />
„Das A und O ist Information“, sagt Brune: „Ich<br />
muss wissen, welche Form von Cloud-Computing<br />
ich benötige und welchen Kriterien<br />
der Dienst genügen sollte.“ Für Unternehmen,<br />
die ihre komplette IT auslagern wollen, bietet<br />
sich ein sogenannter IaaS-Dienst (siehe Info-<br />
Kasten) an. Brune zufolge spricht viel für An-<br />
8
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[sicherheit]<br />
bieter in der Nähe: Bei ihnen kann man vor<br />
Ort genau in Augenschein nehmen, wie die<br />
Daten aufbewahrt werden. Das ist sogar<br />
Pflicht. Der Paragraph 11 des Bundesdatenschutzgesetzes<br />
besagt, dass jeder, der personenbezogene<br />
Daten extern verwalten lässt,<br />
sich von der Einhaltung der Sicherheitsstandards<br />
überzeugen muss.<br />
WindowsXPalssicherheitsrisiko<br />
it-KoNgressiNNeU-Ulm<br />
Anhaltspunkte für die Sicherheit von Daten<br />
und Rechenzentren können auch verschiedene<br />
Zertifikate bieten. Technische Maßnahmen<br />
etwa werden von der ISO-Norm ISO<br />
27001 erfasst, während der Tüv Zertifikate für<br />
Infrastruktur und Prozesse ausstellt. Auch das<br />
Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer vergibt<br />
Zertifikate für Rechenzentren aus.<br />
Allerdings bremst eine Sache in Deutschland,<br />
die Ausbreitung der Cloud-Dienste, gibt Brune<br />
zu bedenken: „Ein großes Problem ist die<br />
Breitband-Anbindung.“ Zwar sind die Rechenzentren<br />
oft sehr gut und bei mehreren Providern<br />
angebunden, jedoch sind die Internet-<br />
Leitungen zu den potenziellen Kunden oft<br />
sehr schlecht. Das bestätigen auch die Ulmer<br />
IT-Anbieter. Baden-Württembergs Ministerpräsident<br />
Winfried Kretschmann (Grüne) hat<br />
das auch erkannt. Er will den Ausbau der<br />
Breitbandversorgung vorantreiben, vor allem<br />
im ländlichen Raum, wo viele mittelständische<br />
Weltmarktführer ihren Sitz haben. Statt<br />
12 Millionen Euro will die Landesregierung<br />
den Breitbandausbau künftig jährlich mit 30<br />
Millionen Euro fördern.<br />
Eine Möglichkeit für Unternehmer und Entscheider,<br />
mit regionalen Anbietern ins Gespräch<br />
zu kommen und sich über sie und ihre<br />
Dienste zu informieren, bietet am 13. November<br />
in der Hochschule Neu-Ulm der „IT-Kongress<br />
Neu-Ulm/Ulm <strong>2014</strong>“. Das Forum für<br />
Wirtschaft und IT-Fachwelt legt einen besonderen<br />
Fokus auf Cloud-Computing und Informationssicherheit.<br />
[!] Gabriel bock<br />
DURCHBLICK<br />
IN WOLKIGEN<br />
ZEITEN!<br />
Damit Sie die echten Informationen<br />
zwischen all den „IT Buzzwords“<br />
finden, haben wir für Sie die Cloud<br />
Bibliothek entwickelt.<br />
Sie erhalten dort Studien, Whitepaper<br />
oder Leitfäden – kostenfrei und<br />
von Experten für Experten.<br />
Diepopulärstenbetriebssysteme sind<br />
die der Windows-Reihe des Softwareriesen<br />
Microsoft. Diese werden immer wieder<br />
für ihre Anfälligkeit gegenüber Hacking<br />
kritisiert. IT-Experten bestätigen<br />
zwar, dass es manchmal Lücken in den<br />
Systemen gibt, jedoch sind die meisten<br />
von ihnen dann kein Thema mehr, wenn<br />
auf regelmäßige Updates und aktuellen<br />
Virenschutz geachtet wird.<br />
Ein großes Problem stellt aber Windows<br />
XP dar. Für das veraltete Betriebssystem<br />
entwickelt Microsoft keine Sicherheitspatches<br />
mehr, und auch der Support ist<br />
eingestellt. Das bedeutet, dass neue Sicherheitslücken<br />
nicht mehr geschlossen<br />
werden. Obwohl der US-Konzern mittlerweile<br />
vor der Nutzung des XP-Systems<br />
warnt, verwenden es noch immer viele<br />
Betriebe und Privatpersonen. Sein Marktanteil<br />
liegt <strong>2014</strong> bei etwa 23 Prozent.<br />
Dabei ist klar, dass jeder Rechner mit<br />
dem veralteten Betriebssystem und Zugang<br />
zu sensiblen Daten ein besonderes<br />
Sicherheitsrisiko darstellt.<br />
Der Umstieg auf eine aktuelle Windows-<br />
Version empfiehlt sich also dringend. Viele<br />
Unternehmen überspringen hierbei den<br />
XP-Nachfolger Windows 7, dessen Updates<br />
2020 eingestellt werden und stellen<br />
gleich auf das aktuelle Windows 8.1 um.<br />
Andere wiederum entscheiden sich, auf<br />
dessen Nachfolger Windows 9 zu warten;<br />
der ist für April 2015 angekündigt. Gab<br />
www.cloudbib.de<br />
Wir verstehen IT!<br />
Mehr als 20 Standorte weltweit –<br />
mit Hauptsitz in Ulm.<br />
Telefon +49 731 1551-0 · www.fum.de<br />
9
[namen & nachrichten] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
ÖMA Kisslegg<br />
zieht um nach<br />
Lindenberg<br />
Die Vertriebsgesellschaft Ökologische<br />
Molkereien Allgäu<br />
(ÖMA) stößt am Standort Kisslegg<br />
an Kapazitätsgrenzen und<br />
verlagert deshalb ihren Firmensitz<br />
nach Lindenberg. Dort<br />
übernimmt sie Gewerbeflächen<br />
des Schmelzkäseproduzenten<br />
Schreiber und ein großes Kühllager.<br />
Die ÖMA beliefert ausschließlich<br />
den ökologischen<br />
Fachhandel. Sie wurde 1985 in<br />
einer Garage gegründet. Seither<br />
wuchs sie kontinuierlich. Zuletzt<br />
erwirtschaftete sie mit 50<br />
Mitarbeitern einen Jahresumsatz<br />
von 35 Millionen Euro.<br />
Steigtechnik<br />
gehört zu den 50<br />
Besten Bayerns<br />
Besondere Ehrung für die Günzburger<br />
Steigtechnik GmbH: Das<br />
Familien<strong>unternehmen</strong> mit 250<br />
Mitarbeitern darf sich mit dem<br />
Titel „Bayerns Best 50“ schmücken.<br />
Der Hersteller von Leitern<br />
zähle zu den Wachstumsmotoren<br />
des Freistaats und sei der<br />
bayerische Vertreter in der<br />
Champions League des Mittelstands,<br />
sagte die bayerische<br />
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner<br />
(CSU). Das Unternehmerehepaar<br />
Ferdinand und Ruth<br />
Munk wurde auch für das Bekenntnis<br />
zum Standort Günzburg<br />
und für die Qualifizierung<br />
der Mitarbeiter gewürdigt.<br />
Edelmann<br />
investiert<br />
in Ungarn<br />
Der Verpackungshersteller<br />
Edelmann (Heidenheim) vergrößert<br />
sein Werk in Ungarn<br />
für fünf Millionen Euro. Ende<br />
des Jahres soll ein neues Gebäude<br />
mit 14.000 Quadratmetern<br />
Schwere Zeiten<br />
Der Wegfall der Milchquote in der EU im Frühjahr 2015 löst<br />
Ängste bei Landwirten im Südwesten aus. „Die kleinen Betriebe<br />
auf der Schwäbischen Alb oder im Allgäu werden es schwer<br />
haben“, sagte der Landeschef des Bundesverbandes Deutscher<br />
Milchviehhalter, Karl-Eugen Kühnle. Im Norden seien die<br />
Böden leichter zu bearbeiten, dort sei Großlandwirtschaft besser<br />
möglich. Heute gibt es in Baden-Württemberg noch 9000<br />
Milchviehhöfe, das sind weniger als die Hälfte als 1996.<br />
Fläche im Werk Zalaegerszeg<br />
im Osten des Landes bezogen<br />
werden. Das soll die Basis sein,<br />
um das Geschäft in Zentral- und<br />
Osteuropa auszuweiten. Bis<br />
2016 entstehen dort 100 neue<br />
Jobs. Im Jahr 2013 erzielte Edelmann<br />
mit 2200 Mitarbeitern an<br />
13 Standorten einen Umsatz<br />
von 233 Millionen Euro.<br />
Stadtwerk am<br />
See steigert<br />
Gewinn deutlich<br />
Das Stadtwerk am See (Friedrichshafen/Überlingen)<br />
hat im<br />
ersten vollen Geschäftsjahr seit<br />
Foto: © Thomas Neumahr / Fotolia.com<br />
der Fusion im <strong>Oktober</strong> 2012 den<br />
Gewinn um ein Drittel auf 9,8<br />
Millionen Euro steigern können.<br />
Der Umsatz sank im Jahr 2013<br />
um knapp 2 Prozent auf 180 Millionen<br />
Euro. Die Einbußen im<br />
Energiegeschäft konnte das Unternehmen<br />
mit 311 Mitarbeitern,<br />
das im Herbst 2012 aus der<br />
Fusion der Stadtwerke Friedrichshafen<br />
und Überlingen<br />
hervorgegangen ist, mit dem<br />
Wassergeschäft mehr als ausgleichen.<br />
„Die Einmalkosten aus<br />
der Fusion sind 2013 entfallen,<br />
die Synergien kommen mehr<br />
zum Tragen“ , erklärten die Geschäftsführer<br />
Alfred Müllner<br />
und Klaus Eder. An die Gesellschafter<br />
– die Städte Friedrichshafen<br />
und Überlingen – überweist<br />
das Unternehmen für 2013<br />
insgesamt 12 Millionen Euro.<br />
Uzin Utz erhält<br />
Preis von<br />
„familiyNET“<br />
Der Bauchemiespezialist Uzin<br />
Utz AG (Ulm) ist im Rahmen<br />
von „familyNET“ für sein Engagement<br />
zur besseren Vereinbarkeit<br />
von Beruf und Familie ausgezeichnet<br />
worden. Das<br />
landes weite Projekt wird unter<br />
anderem unterstützt durch das<br />
Landeswirtschaftsministerium<br />
sowie die Metall- und Chemieindustrie.<br />
Uzin Utz erhielt den<br />
Preis, weil das Unternehmen individuelles<br />
Coaching, Mentoring,<br />
flexible Arbeitszeitmodelle,<br />
Führen in Teilzeit sowie zahlreiche<br />
Workshops anbietet. Zuletzt<br />
kam der Hersteller von Spezialchemikalien<br />
und Geräten für die<br />
Bodenbearbeitung auf einen Jahresumsatz<br />
von 217 Millionen<br />
Euro mit 950 Mitarbeitern.<br />
Cooper Standard<br />
verlagert Stellen<br />
nach Serbien<br />
Der in Lindau ansässige Automobilzulieferer<br />
Cooper Standard<br />
denkt an die Verlagerung<br />
eines Großteils der Arbeitsplätze<br />
vom Bodensee nach Serbien.<br />
Fast 40 Prozent der knapp 1000<br />
Arbeitsplätze in Lindau sollen<br />
trotz einer Standortsicherungsvereinbarung<br />
von der Maßnahme<br />
betroffen sein. In erster Linie<br />
geht es um lohnintensive<br />
Tätigkeiten in der Produktion.<br />
In Serbien liegt der Stundenlohn<br />
bei 3,50 Euro. Seit Jahren<br />
bemühen sich die Beschäftigten<br />
in Lindau, durch Lohnverzicht<br />
ihre Arbeitsplätze zu erhalten.<br />
Als das Unternehmen zur Metzeler-Gruppe<br />
gehörte, war es eines<br />
der größten Arbeitgeber in<br />
Lindau. [!]<br />
10
Gutes Geld – gutes Gewissen.<br />
Unser Engagement<br />
für Bildung.<br />
Sparkassen fördern Bildung in allen Regionen Baden-Württembergs. Im<br />
Rahmen unseres sozialen Engagements ermöglichen wir Bildungsangebote für alle<br />
Teile der Bevölkerung. Wir fördern gemeinnützige Vorhaben im Bildungsbereich<br />
mit jährlich über 16 Mio. Euro in 21 Stiftungen. Denn Wissen ist der wichtigste<br />
Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Das ist gut für die Menschen und gut<br />
für Baden-Württemberg. www.gut-fuer-bw.de<br />
Sparkassen. Gut für Baden-Württemberg.<br />
11
[titelthema] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
12
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[titelthema]<br />
Einladung<br />
zumAnfassen<br />
Wie funktioniert eine Brennstoffzelle? Was tun, wenn ein E-Auto brennt? Wie<br />
verhält sich Wasserstoff? Antworten gibt das Ulmer WBZU -– Handwerkern,<br />
Studenten, Schülern. Anfassen ist dabei fast immer erlaubt. Dr.TobiasMehlich<br />
und Prof.WernerTillmetz über das Tête-à-Tête von Handwerk und Forschung.<br />
Wer Handwerker sucht, tut das in Werkstätten oder<br />
auf dem Bau. Seit einiger Zeit tauchen sie aber<br />
auch mitten in der Ulmer Wissenschaftsstadt auf<br />
dem Oberen Eselsberg vermehrt auf – in Seminaren<br />
und Laboren. Was steckt dahinter?<br />
Dr. Tobias Mehlich: Das Handwerk macht sich fit für die<br />
Zukunft – im Weiterbildungszentrum für innovative<br />
Energietechnologien der Handwerkskammer Ulm,<br />
dem WBZU. Es ist eine Schnittstelle zwischen Praxis<br />
und Forschung.<br />
Will das Handwerk selbst forschen?<br />
Mehlich: Nein, es geht darum, den Kunden Erfindungen<br />
möglichst rasch anzubieten. Zum Handwerk zählt<br />
eben nicht nur der Schuster, der nach herkömmlicher<br />
Methode Schuhe besohlt. Wir wollen ein traditionelles<br />
Handwerk, aber wir wollen auch ein Handwerk, das die<br />
moderne Welt gestaltet. Wir entwickeln neue Betätigungsfelder<br />
und Geschäftsideen.<br />
Und wieso suchen Sie, Professor Tillmetz, als Wissenschaftler<br />
und Leiter des Zentrums für Sonnenenergie-<br />
und Wasserstoff-Forschung (ZSW) die<br />
Nähe zum Handwerk?<br />
Professor Werner Tillmetz: Mich hat schon immer nicht<br />
nur die pure Forschung angetrieben. Die dient im<br />
universitären Bereich dem reinen Erkenntnisgewinn.<br />
Das ist für mich persönlich eher sekundär. Mir ist die<br />
Anwendung wichtig: Wie kann ich das nutzen? Wie<br />
kann die Wirtschaft damit Geld verdienen? Wie kann<br />
man eine neue Technologie nachhaltig nutzen? Wir in<br />
Deutschland haben ein Umsetzungs-Problem. Wir sind<br />
immer wieder Forschungsweltmeister, aber verkaufen<br />
tun andere.<br />
An welche Beispiele denken Sie?<br />
Tillmetz: Kameras. Da waren wir einst Weltmarktführer.<br />
Hochwertige Kameras kamen aus Deutschland.<br />
Wie viele produzieren wir heute noch? Es gibt viele andere<br />
Beispiele. Wo mechanische Technologien von etwas<br />
Neuem, Besseren verdrängt werden, ist auch das<br />
oft bei uns erfunden worden. Nehmen Sie den Computer,<br />
entwickelt von Konrad Zuse, das Fax von Siemens ...<br />
Und wer macht das Geschäft? Apple, Samsung, Panasonic<br />
... Das treibt mich um, weil ich seit Jahrzehnten an<br />
neuen Technologien arbeite, lange in der Industrie –<br />
und jetzt seit fast zehn Jahren hier in der Forschung.<br />
Wie kommt das Handwerk ins Spiel?<br />
Tillmetz: Die Idee ist vor gut eineinhalb Jahren entstanden.<br />
Grundgedanke: Mit dem Handwerk sind wir direkt<br />
am Nutzer neuer Technologien dran. So erfahren<br />
wir, was er nicht oder anders will – und wieso. Das ist<br />
eine Chance, vom reinen Forschungsweltmeister wegzukommen.<br />
Hat die Kooperation schon unmittelbaren Nutzen<br />
für Ihre Forschung gebracht?<br />
Tillmetz: Noch nicht direkt. Aber vor gut einem Jahr<br />
war ich mit meinem Auto beim Kundendienst. Bei der<br />
Gelegenheit habe ich den Meister gefragt, was er von<br />
Elektromobilität hält – einem der Schlüsselthemen an<br />
unserem ZSW.<br />
Und?<br />
Tillmetz: „Totaler Blödsinn“, sagte er.<br />
Wer wie Sie Batterien entwickelt, muss da wohl erst<br />
mal schlucken, oder?<br />
Sie verbinden Handwerk und Forschung: Tobias Mehlich (li.), Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, und Professor<br />
Werner Tillmetz, Leiter des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, vor einem Blockheizkraftwerk.<br />
ZurPerson<br />
Langweilig dürfte es<br />
Tobias Mehlich (47)<br />
so schnell nicht werden.<br />
Als Hauptgeschäftsführer<br />
der<br />
Handwerkskammer<br />
Ulm vertritt er seit<br />
dem Jahr 2010 rund<br />
18.000 Betriebe. In<br />
seiner Freizeit engagiert<br />
er sich für Musik<br />
– als Vorsitzender<br />
des Vereins Kinderund<br />
Jugendchor „Ulmer<br />
Spatzen“. Der<br />
Jurist, der mit seiner<br />
Familie (verheiratet,<br />
drei Kinder) in Ulm<br />
wohnt, stammt aus<br />
dem hessischen Bad<br />
Nauheim.<br />
ZurPerson<br />
WernerTillmetz gehört<br />
zu den führenden<br />
Brennstoffzellenund<br />
Batterieexperten<br />
in Deutschland. Der<br />
59-jährige Professor<br />
folgte 2004 dem Ruf<br />
der Uni Ulm. Seither<br />
leitet er den Geschäftsbereich<br />
Elektrochemische<br />
Energietechnologien<br />
am<br />
Zentrum für Sonnenenrgie-<br />
und Wasserstoffforschung.<br />
Der<br />
gebürtige Oberbayer<br />
wuchs in Lindau auf,<br />
wo er noch heute mit<br />
seiner Frau und seinen<br />
beiden Kindern<br />
(15 und 21) lebt.<br />
13
[titelthema] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Tillmetz: Ich wollte wissen, warum. Seine Antwort:<br />
„Mein Geld verdiene ich heute mit Öl-, mit Zündkerzen-<br />
und Zahnriemenwechsel. Das gibt es im E-Auto<br />
nicht mehr. Wie soll ich also damit etwas verdienen?“<br />
Mehlich: Genau darum geht es: zeigen, welche Geschäftsideen<br />
hinter neuen Technologien stecken könnten und<br />
dem Handwerk das nötige Wissen vermitteln.<br />
Konnten Sie die Sicht des Kfz-Meisters nachvollziehen,<br />
Herr Professor Tillmetz?<br />
Tillmetz: Klar. Tatsächlich informieren die Autohersteller<br />
ihre Vertragspartner in den Werkstätten nicht über<br />
die Arbeitsinhalte rund um das E-Auto. Ihnen ist wohl<br />
nicht bewusst, dass man den Umgang mit einer komplett<br />
neuen Technologie auch gelernt haben muss.<br />
Über das WBZU und die Handwerkskammer erreichen<br />
Sie die Handwerker …<br />
Tillmetz: So ist es. Wir können an die Basis gehen. Wir<br />
setzen uns mit den Handwerkern aus den Werkstätten<br />
zusammen und erklären ihnen, wie ein Elektroauto<br />
funktioniert, wo Wartungsbedarf auftreten kann und<br />
worauf man achten muss. Mit den Leuten kann man<br />
sehr fundiert diskutieren.<br />
Mehlich: Auch deshalb muss das Handwerk nahe bei der<br />
Forschung sein. Bringt die Forschung etwas auf den<br />
Weg, müssen wir wissen, wohin die Reise geht und wie<br />
die Betriebe damit Umsatz machen können. Gibt es nur<br />
noch Autos mit Brennstoffzellen, muss ein Lehrling<br />
nicht mehr lernen, wie man einen Auspuff schmiert,<br />
sondern wie man mit Wasserstoff umgeht.<br />
Im WBZU spielen nicht nur die E-Autos eine Rolle?<br />
Mehlich: Das geht viel weiter. Die Energiewende betrifft<br />
die verschiedensten Handwerksgebiete: Elektromobilität,<br />
Energieeffizienz von Heizungen, Energiegewinnung<br />
aus Sonne und Wind, Speichertechnik für Häuser.<br />
Das wird auch die Ausbildung in vielen Berufen<br />
verändern. Die Nähe zur Forschung hilft uns, die Ausbildungsordnungen<br />
anzupassen.<br />
Diese Impulse könnten von Ulm aus das Handwerk<br />
im ganzen Land revolutionieren?<br />
Mehlich: Was wir hier am WBZU machen, hat eine bundesweite<br />
Leuchtturmfunktion.<br />
Dann sind Sie Trendsetter?<br />
Mehlich: Oder Versuchskaninchen. Es ist ein Versuch,<br />
den wir starten, es gilt auch Gräben zu überwinden.<br />
Forscher haben ihre eigene Sprache, Handwerker<br />
auch ...<br />
Bevor einer fragt: Auch Tobias Mehlich weiß, dass man mit<br />
Krawatte nicht Löcher in Betonklötze bohrt. Für den Fotografen<br />
machte er eine Ausnahme.<br />
14
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[titelthema]<br />
Tillmetz: Die Übersetzung hinzubekommen, komplizierte<br />
Sachverhalte verständlich zu erklären – das ist<br />
die große Kunst. Wir haben am WBZU talentierte Leute<br />
dafür, und auch im Handwerk beherrschen das viele.<br />
Um beim Kfz-Mechaniker zu bleiben: Bisher schulen<br />
die Meister den Umgang mit dem Vergaser, künftig<br />
müssen sie erklären, wie das mit Batterien und E-Autos<br />
geht. Wir können also entweder eigene Leute einsetzen<br />
oder wir versorgen die Ausbilder im Handwerk mit<br />
Wissen.<br />
Wie wird das Wissen vermittelt?<br />
Tillmetz: Das ist das Einmalige am WBZU: Wir haben in<br />
sieben Labors Technik zum Anfassen – Knöpfe drücken,<br />
Messkurven anschauen … Man erlebt praxisnah,<br />
wie eine Brennstoffzellenbatterie funktioniert.<br />
Mehlich: Hier können Handwerker durch Erfahrung lernen,<br />
Wissen wird nicht einfach an der Tafel präsentiert.<br />
Man muss es in ihre Sprache übersetzen und vor allem<br />
in ihre Methoden transferieren.<br />
Komplizierte Inhalte herunterzubrechen, wird in<br />
der Welt der Wissenschaft nicht unbedingt besonders<br />
geschätzt. Wie gehen Sie damit um, Herr Professor<br />
Tillmetz?<br />
Tillmetz: Vielleicht müsste man in die Belohnungssysteme<br />
der Wissenschaft eingreifen: Man macht am ehesten<br />
das, wofür man belohnt wird. Für Forscher an Universitäten<br />
sind dazu möglichst viele Veröffentlichungen<br />
in den Wissenschaftsjournalen wichtig. Wer einfache<br />
Anfassen erlaubt: Am Weiterbildungszentrum<br />
wird Wissen<br />
nicht dröge an der Tafel<br />
oder in Präsentationen vermittelt.<br />
Symbiose Integrieren, modifizieren,<br />
neu gestalten – USM Möbelbausysteme<br />
verleihen Ideen konkrete Gestalt.<br />
Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen<br />
beim autorisierten Fachhandel.<br />
buchbrunnenweg 16, 89081 ulm-jungingen, tel. 0731-96 77 00<br />
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt<br />
contact@fey-objektdesign.de, www.fey-objektdesign.de<br />
15
[titelthema] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Wie reagieren die Studenten?<br />
Tillmetz: Wir nutzen die Labors im WBZU für die ganz<br />
normale Praktikumsausbildung der Studenten. In einem<br />
internationalen Masterstudiengang lernen sie<br />
Batterien, Brennstoffzellen und so weiter kennen – an<br />
den gleichen Apparaturen und Geräten wie die Handwerker.<br />
Die meisten sind begeistert und wollen auch<br />
ihre Master- oder Doktorarbeit am ZSW machen.<br />
Gibt es gemischte Projekte, bei denen Handwerker<br />
und Studenten zusammen arbeiten und lernen?<br />
Mehlich: Noch nicht, das wäre spannend. Aber schon<br />
jetzt gehen Praktikanten von der Universität hier genauso<br />
ein und aus wie die Handwerker.<br />
Das WBZU steht also auch für die Durchlässigkeit<br />
von Bildungs- und Karrierewegen?<br />
Mehlich: Eines Tages werden wir die Meisterabsolventen<br />
mit den Doktoranden mischen können. Das muss<br />
das Ziel sein. Wir werden hier hochwertige Ausbildungsinhalte<br />
anbieten können, die man anderswo<br />
nicht bekommt.<br />
Welche Themen außer der Brennstoffzelle werden<br />
in der Kooperation zwischen WBZU und ZSW beleuchtet?<br />
Welche Handwerkszweige können profitieren?<br />
Tillmetz: Am ZSW arbeiten wir stark an der Kraft-Wärme-Kopplung<br />
– mit und ohne Brennstoffzelle. Das Thema<br />
hat die Handwerker vor einigen Jahren kalt erwischt.<br />
Für uns wurde es zu einer tollen Erfolgsstory.<br />
Die Fachverbände der Handwerker fragten uns: „Wir<br />
müssen jetzt Kraft-Wärme-Kopplungen einbauen, wie<br />
denn?“ Klassisch schließt der Elektriker den Strom an,<br />
der Installateur die Gasleitung oder die Wärmeversorgung.<br />
Beides zusammen geht laut klassischer Handwerkerordnung<br />
nicht.<br />
Professor Tillmetz hat‘s in der<br />
Hand: eine komplette Brennstoffzelle<br />
mit 20 Einzelzellen.<br />
An den Modellen in Labor 4<br />
wird demonstriert, wie so ein<br />
System funktioniert.<br />
Formulierungen benutzt, kommt da nicht weiter.<br />
Übersetzungen, wie wir sie brauchen, machen diese<br />
Wissenschaftler gewöhnlich nicht. Bei mir ist das<br />
anders.<br />
Sie legen keinen Wert auf Publikationen?<br />
Tillmetz: Nein. Ich will Umsetzungen<br />
hinbekommen. In dem anderen<br />
System stecke ich auch nicht drin.<br />
Mehlich: Professor Tillmetz macht<br />
genau das, was hier schon immer<br />
passieren sollte: Universität, Hochschulen<br />
und Unternehmen in einer<br />
Wissenschaftsstadt angesiedelt –<br />
um Nähe zu schaffen und Übersetzungen<br />
anzuschieben.<br />
Wasserstoff<br />
macht<br />
erstmal<br />
Angst<br />
Werner Tillmetz<br />
Darauf nimmt die Kraft-Wärme-Kopplung aber keine<br />
Rücksicht ...<br />
Tillmetz: Richtig. Auf Bitte der Fachverbände schafften<br />
wir solche Geräte an, um daran eine herstellerneutrale<br />
Ausbildung anzubieten. Wir haben in einem Tageskurs<br />
ein Grundverständnis vermittelt.<br />
Mehlich: … und das alles gewerkeübergreifend.<br />
Tillmetz: Genau, und das ist wichtig.<br />
Kraft-Wärme-Kopplung spielt<br />
eine Riesenrolle in der Energiewende,<br />
aber das Prinzip dahinter<br />
verstehen viele noch nicht.<br />
Sie schulen am WBZU auch Feuerwehrleute<br />
und Rettungskräfte.<br />
Warum?<br />
Tillmetz: Dahinter steckt die Elektromobilität.<br />
Die Fahrzeuge kann<br />
man mit Wasserstoff ausrüsten oder mit Batterien.<br />
Wasserstoff ist bei vielen negativ belegt. Wasserstoff<br />
macht erstmal Angst.<br />
Klingt eben nach Bombe …<br />
Tillmetz: Ja, oder nach Hindenburg-Syndrom. Dabei<br />
16
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[titelthema]<br />
sind die Menschen beim Zeppelin-Absturz damals in<br />
Lakehurst nicht wegen des Wasserstoffs ums Leben<br />
gekommen, sondern wegen der brennenden Stoffbahnen.<br />
Zurück zu den Rettungskräften. Was lernen sie<br />
hier?<br />
Tillmetz: Wir zeigen ihnen, dass Wasserstoff als solcher<br />
nicht gefährlich ist. Er ist sogar viel, viel weniger gefährlich<br />
als Benzin. Wir zeigen, wie man mit Wasserstoff<br />
umgeht – und mit Batterie-getriebenen Fahrzeugen.<br />
Was tut man, wenn sie gegen einen Baum fahren?<br />
Ganz normal löschen? Man muss viele Details beachten.<br />
Die erklären wir in den Schulungen. Zurzeit gibt es<br />
noch fast keine Vorschriften, die den Umgang mit diesen<br />
Technologien auch in Gefahrensituationen regeln.<br />
Die Autobauer geben aber doch Informationen zu<br />
ihren Fahrzeugen und dem Umgang mit ihnen?<br />
Tillmetz: Sie statten ihre Fahrzeuge mit einer Rettungskarte<br />
aus. Darauf können die Feuerwehrleute nachlesen,<br />
wo Hochspannungsleitungen verlaufen und sie<br />
mit ihrer Rettungsschere nicht reinfahren dürfen. Aber<br />
was man macht, wenn die Batterie brennt, erfährt man<br />
nicht.<br />
Was sollte man tun?<br />
Tillmetz: Für Feuerwehrleute und Rettungskräfte gilt:<br />
Personen retten, löschen so viel und so gut es geht, und<br />
dann das Fahrzeug stehen lassen und warten. Nicht in<br />
brennendem Zustand abschleppen; das Feuer erlischt<br />
von selbst. Es ist etwas ganz anderes, wenn eine Lithium-Ionen-Batterie<br />
brennt als wenn ein Benzintank<br />
brennt. Das muss man wissen.<br />
Wo ist der große Unterschied?<br />
Tillmetz: Bei einer brennenden Batterie lässt sich das<br />
Feuer nicht durch Sauerstoff-Entzug ersticken. Sie<br />
brennt auch ohne dass von außen Sauerstoff dazukommt.<br />
Deshalb hilft nur: Abwarten, bis sie entladen<br />
ist. Die richtige Reaktion: Ruhig Blut, nicht nervös werden!<br />
Es kann an die zehn Jahre dauern, bis Vorschriften<br />
für solche Gefahrensituationen entstehen, weil diese<br />
so viele Gremien passieren müssen. Wir helfen den<br />
Leuten jetzt.<br />
Seien es Handwerker oder Rettungskräfte, Sie reden<br />
mit Anwendern. Werden Sie durch diesen Dialog<br />
zuweilen auf Schwierigkeiten aufmerksam, die<br />
Ihnen sonst womöglich nicht aufgefallen wären?<br />
Tillmetz: Ja. Dieser Rückfluss ist für mich mindestens<br />
genauso wichtig wie der Wissenstransfer in die andere<br />
So sehen die Eingeweide des<br />
kleinen Blockheizkraftwerks<br />
aus. Für Laien gilt hier aber:<br />
Finger weg – was Tobias<br />
Mehlich respektvoll beachtet.<br />
17
[titelthema] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Im WBZU arbeiten Forscher und Handwerker eng zusammen. Die Verantwortung tragen Prof. Werner Tillmetz (links) und Tobias Mehlich.<br />
EinLeuchtturmprojekt<br />
inDeutschland<br />
DasWeiterbildungszentrum für innovative<br />
Energietechnologien Ulm (WBZU) am<br />
Ulmer Eselsberg verzahnt Wissenschaft<br />
und Technik. Seine Kernaufgabe besteht<br />
darin, neue Energietechnologien wie<br />
Brenn stoffzellen, Wasserstoff, Batterien<br />
und Miniblockheizkraftwerke in der Praxiseinführung<br />
zu begleiten und die entsprechenden<br />
Berufsgruppen frühzeitig weiterzubilden.<br />
Die Handwerkskammer Ulm hat<br />
das WBZU, in dem fünf Mitarbeiter tätig<br />
sind, zu Jahresbeginn übernommen, sie<br />
ist bundesweit die erste Hand werks institu<br />
tion, die selbst angewandte Forschung<br />
betreibt.<br />
Prof.Dr.WernerTillmetz war bis Ende<br />
2013 Vorstandschef des WBZU, seither<br />
steht er dessen Beirat vor. Tillmetz leitet<br />
das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung<br />
Baden-Württemberg<br />
(ZSW) in Ulm. Insgesamt beschäftigt das<br />
ZSW mit Hauptsitz in Stuttgart 220 Mitarbeiter,<br />
in Ulm sind es 110 Beschäftigte plus<br />
70 wissenschaftliche Hilfskräfte. Das ZSW<br />
in Ulm stand zuletzt wegen einer Explosion<br />
in den Schlagzeilen, die eines der 15 Labore<br />
verwüstete und 300.000 Euro Schaden<br />
anrichtete. Grund war eine defekte<br />
Gasleitung. Das Labor ist wieder instandgesetzt,<br />
verletzt wurde niemand. AMB<br />
Richtung. Wir müssen wissen, welche Probleme es in<br />
der Handhabung geben kann.<br />
Mehlich: Das gilt auch für die Speichertechnologie, die<br />
nach und nach in den Haushalten Einzug halten soll.<br />
Der Forscher lernt vom Anwender: Gibt es Beispiele?<br />
Tillmetz: Die gibt es, aber spontan<br />
fällt mir nichts Plakatives ein.<br />
Mehlich: Wenn wir unsere Arbeit<br />
hier gut machen, dann kann ich mir<br />
vorstellen, dass immer mehr Lernprozesse<br />
auch in die andere Richtung<br />
laufen. Die Handwerker zum<br />
Beispiel, die Speicher einbauen und<br />
warten, können enorm viel einspeisen.<br />
Tillmetz: Jetzt hätte ich ein Beispiel<br />
parat.<br />
Nur raus damit ...<br />
Tillmetz: Wenn ein Elektroauto einen Crash hat, gehen<br />
die Schalter der Batterie automatisch auf, weil die Batterie<br />
die Spannungsquelle ist (mit 400 Volt). Lösen sich<br />
Handwerker<br />
können<br />
enormviel<br />
einspeisen<br />
Tobias Mehlich<br />
die Schalter oder Verbindungsklammern, ist das ganze<br />
Fahrzeug spannungsfrei. Das ist auch richtig so.<br />
Aber?<br />
Tillmetz: Man kann dann nicht mehr schauen, was in<br />
der Batterie passiert. Die Verbindung zu den vielen Sensoren<br />
in der Batterie wird gekappt, wenn die Schalter<br />
aufgehen. Dann ist sie eine stromlose<br />
schwarze Kiste. Die Feuerwehrleute<br />
vor Ort können dann<br />
nicht wissen, ob die Batterie kaputt<br />
ist oder nur abgeschaltet und<br />
sicher. Das gibt uns in unserer Forschung<br />
am ZSW Stoff zum Nachdenken:<br />
Wie könnte man die abgekoppelte<br />
Batterie testen? Solche<br />
Prozesse sind wichtig für uns.<br />
Weil Sie in weniger alltagstauglichen Kategorien<br />
denken?<br />
Tillmetz: Wir Wissenschaftler sind oft ganz stolz, wenn<br />
wir den Wirkungsgrad verbessern. Dann kommt der<br />
Kunde und fragt: Wirkungsgrad? Er will wissen, wie<br />
lang die Batterie durchhält, wie sie gewartet wird. Sol-<br />
18
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[titelthema]<br />
che Fragestellungen kommen einem begeisterten Forscher<br />
oft gar nicht in den Sinn.<br />
Mehlich: Der Dialog verhilft den Wissenschaftlern ein<br />
Stückweit zur Markt- und Anwendungsorientierung.<br />
Guter Wirkungsgrad ist sicher ein gutes Verkaufsargument.<br />
Aber ich sollte nicht jede Viertelstunde zum<br />
Nachjustieren eines Speichers in den Keller müssen.<br />
Wie viel Personal hält die ganzen Seminare im<br />
WBZU am Laufen?<br />
Mehlich: Momentan fünf Festangestellte. Sie gehören<br />
zur Weiterbildungsakademie des Handwerks mit insgesamt<br />
etwa 50 Beschäftigten. Dazu kommen freie Dozenten<br />
auf Honorarbasis.<br />
Tillmetz: Die Dozenten kommen zum Teil von uns, dem<br />
ZSW, oder von befreundeten Instituten.<br />
Wie ist die Resonanz auf das Angebot des WBZU?<br />
Mehlich: Schon ganz gut. Aber wir müssen noch mehr<br />
dafür trommeln.<br />
Tillmetz: Im Schnitt haben wir über den Verein WBZU<br />
e.V. etwa 1000 Leute pro Jahr erreicht.<br />
Im Gespräch (von links):<br />
Wirtschaftsressortleiterin<br />
Karen Emler, der technische<br />
Leiter des WBZU Peter Pioch<br />
und Tobias Mehlich.<br />
Das Foto links zeigt das Herzstück<br />
einer Brennstoffzelle:<br />
die (einlaminierte) Polymermembran.<br />
Anzeige<br />
Partner der Kanzlei (von links nach rechts): Stefan M. Senft, Sven Hendrik Schmidt, Dr. Wolfgang Weitzel, Stephan Zeitler, Hans-Christian Weitzel<br />
DR. WEITZEL & PARTNER<br />
Patent- und Rechtsanwälte mbB, Heidenheim – Berlin<br />
Friedenstraße 10<br />
89522 Heidenheim<br />
seit 1971<br />
Tel. 07321/9352-0<br />
Fax 07321/9352-49<br />
Wir aktivieren Ihr Ideenpotenzial!<br />
• Patente<br />
• Marken<br />
• Designschutz<br />
• Lizenzverträge<br />
• Patentbewertung<br />
• Gutachten<br />
• Arbeitnehmererfinderrecht<br />
• Verletzungsrecht<br />
Aktive Begleitung Ihrer Projekte,<br />
z. B. durch ...<br />
• Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter<br />
für schützenswerte Ideen,<br />
• Markenschöpfung, Branding,<br />
• Kreativsitzungen<br />
... von den ersten Ideen bis zur<br />
Marktreife und darüber hinaus.<br />
Weltweit aktiv, vor Ort für Sie da.<br />
Wir schützen für Sie ...<br />
• Ihre Entwicklungen und Ideen,<br />
• das Design Ihrer Produkte,<br />
• die Werbekennzeichen Ihrer<br />
Produkte und Dienstleistungen<br />
...vor unerwünschter<br />
Nachahmung.<br />
info@weitzel-patente.de<br />
www.weitzel-patente.de<br />
19
[titelthema] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Wer behauptet, Forschung<br />
macht keinen Spaß?! Der Gokart<br />
läuft mit einer Brennstoffzelle<br />
und wurde im Rahmen<br />
einer Studienarbeit<br />
gebaut.<br />
DAS INTERvIEW FÜHRTE<br />
KAREN EMLER, LEITERIN<br />
WIRTScHAFTSREDAKTION<br />
SÜDWEST PRESSE<br />
FOTOS:<br />
OLIvER ScHULZ<br />
DOKUMENTATION:<br />
ISABELLA BURK<br />
Mehlich: Ursprünglicher Auftrag des Vereins war die<br />
Information der Öffentlichkeit über neue Energietechnologien<br />
wie die Brennstoffzelle. Als Handwerk sehen<br />
wir den Auftrag weiter.<br />
Nämlich?<br />
Mehlich: Zum Beispiel Berufsorientierung. Hier sind<br />
ständig Schülergruppen unterwegs.<br />
Die Schüler sehen an dieser Schnittstelle zwischen<br />
Forschung und Handwerk, was heute alles zu einem<br />
modernen Handwerk dazugehört?<br />
Mehlich: Exakt. Wir wollen gut qualifizierte junge Leute<br />
für das Thema Energiewende interessieren, sie für die<br />
Mitarbeit gewinnen, sei es als Handwerker, als Forscher<br />
oder als Industriefertiger. Wir bemühen uns auch, verstärkt<br />
Hochschulabbrecher für das Handwerk zu gewinnen.<br />
30 Prozent der jungen Menschen, die ein Studium<br />
beginnen, verpeilen sich.<br />
Was haben Sie vor?<br />
Mehlich: Wir wollen sie gezielter abholen als bisher,<br />
ihnen Perspektiven zeigen. Dabei kann das WBZU mit<br />
all der sichtbaren neuen Technologie helfen. Und Tür<br />
an Tür mit Hochschule und Universität können diese<br />
jungen Leute sehen, dass es auch im Handwerk tolle<br />
Berufe gibt.<br />
Zurück zur Schnittstelle Forscher – Anwender.<br />
Klopfen auch Hersteller bei Ihnen an, um zu erfahren,<br />
wie anwendertauglich ihre Produkte sind?<br />
Tillmetz: Wir haben schon den einen oder anderen Prototyp<br />
hier stehen.Die Anwender mit den Entwicklern<br />
in der Industrie zusammenzubringen – das wäre ein<br />
schönes Thema für die Zukunft. Aber schon jetzt kommen<br />
Firmen, die eine Technologie verstehen wollen.<br />
Zum Beispiel?<br />
Tillmetz: Eine unserer Brennstoffzellen ist perfekt für<br />
Notstromversorgung, primär in der Telekommunikation.<br />
Mit ihr würde das Handynetz bei Stromausfall<br />
lange weiter funktionieren. Die üblichen Bleibatterie-<br />
Sicherungen in Mobilfunkstationen sind nach einer<br />
Stunde leer. Mit Brennstoffzelle und Wasserstoff arbeitet<br />
das Netz wochenlang. Manche Vertreter der Telekommunikationsindustrie<br />
haben sich die Technologie<br />
im WBZU angeschaut und danach solche Geräte<br />
gekauft – um sich gegen einen Blackout zu wappnen.<br />
20
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> [namen&nachrichten]<br />
ZFFriedrichshafentrennt<br />
sichvonLenksysteme-Tochter<br />
ZF Friedrichshafen gibt seine Hälfte am Gemeinschafts<strong>unternehmen</strong><br />
ZF Lenksysteme<br />
an Bosch ab. Der Stuttgarter Autozulieferer<br />
übernimmt damit die vollständige Kontrolle<br />
über den Spezialisten für elektronische Lenkungen.<br />
ZF Friedrichshafen wirft damit Ballast<br />
auf dem Weg zur 9,5 Milliarden Euro teuren<br />
Übernahme des US-Wettbewerbers TRW<br />
ab. Die US-Amerikaner sind eine gute Ergänzung<br />
für ZF. Sie sind spezialisiert auf Sicherheitsprodukte<br />
wie Airbags, Gurte, Brems- oder<br />
Fahrer-Assistenzsysteme. Der Chef von ZF<br />
Friedrichshafen, Stefan Sommer, betonte, er<br />
sehe „viele Symmetrien“ in den Kulturen beider<br />
Firmen. ZF steigt durch den Zukauf mit<br />
dann rund 30 Milliarden Euro Umsatz und<br />
insgesamt 138.000 Mitarbeitern unter die Top<br />
drei im weltweiten Zulieferer-Geschäft auf.<br />
Bosch-Chef Volkmar Denner indes freut sich<br />
über den Zukauf der ZF Lenksysteme (Schwäbisch<br />
Gmünd), die zuletzt mit 13.000 Mitarbeitern<br />
an 18<br />
Standorten einen<br />
Jahresumsatz von<br />
4,1 Milliarden Euro<br />
erzielte. Am<br />
Stammsitz auf der<br />
Ostalb sind mehr<br />
als 5000 Beschäftigte<br />
tätig. Rund 60<br />
Prozent des Umsatzes<br />
macht ZFLS Stefan Sommer, der Chef<br />
mit Elektrolenkungen.<br />
„Mit der<br />
der ZF Friedrichshafen.<br />
kompletten Übernahme von ZFLS stärkt<br />
Bosch die Position für eine aktive Gestaltung<br />
der Zukunft der Mobilität“, sagte Denner.<br />
Denn ZFLS zähle „zu den Technologieführern<br />
im Zukunftsfeld Elektrolenkung“. Das sei „die<br />
Basistechnologie für automatisiertes Fahren,<br />
für effizientere Fahrzeuge und auch für Elektroautos“,<br />
sagte der Bosch-Chef. [!] KER<br />
FKIRCHHOFF .<br />
SYSTEMBAU<br />
R<br />
IHR STARKER PARTNER<br />
Hoch- und Ingenieurbau<br />
Schlüsselfertigbau<br />
Neubau eines<br />
Verwaltungsgebäudes<br />
für die<br />
URACA GmbH & Co. KG<br />
Architektur: Hank + Hirth, Eningen<br />
Fotografie: Oliver Starke<br />
Dethleffsbaut<br />
20Stellenab<br />
Das Geschäft der jahrzehntelang erfolgsverwöhnten<br />
Branche der Reisemobil- und Caravanbauer<br />
verläuft seit geraumer Zeit ausgesprochen<br />
holprig. Das trifft auch den<br />
Reisemobil- und Caravanhersteller Dethleffs<br />
aus Isny. Dessen Umsatz verringerte sich im<br />
Geschäftsjahr 2013/<strong>2014</strong> um rund drei Prozent<br />
auf 335 Millionen Euro, der Absatz von<br />
Reisemobilen sank von 8144 auf 7968 Exemplare.<br />
Bei den Caravans, deren Preise deutlich<br />
unter denen der Reisemobile liegen, stiegen<br />
die Verkaufszahlen um 111 auf 2526 Stück.<br />
Als Konsequenz aus dem unbefriedigenden<br />
Ergebnis bauten die Dethleffs-Verantwortlichen<br />
20 von 779 Stellen ab. Zudem streben sie<br />
an, das Unternehmen schneller als bisher geplant<br />
zur „Volumen-Marke“ umzubauen – mit<br />
Fahrzeugen in modernem Design, die dem<br />
Mainstream der Branche folgen. Dadurch soll<br />
der Umsatz auf 351 Millionen Euro klettern.<br />
Im Gegenzug wird das „Luxus-Segment“<br />
schrittweise verkleinert. Gleichzeitig investiert<br />
Dethleffs 7,3 Millionen Euro, vor allem in<br />
den Bau einer neuen Fertigungsstraße für<br />
Fußböden. [!]<br />
HAM<br />
Biomilch-Bauern<br />
erwägenKlage<br />
Der Streit zwischen der Großmolkerei Omira<br />
und ihren Biomilchlieferanten geht in eine<br />
neue Runde. Als die Genossenschaft die Sparte<br />
Biomilch aufgab, gingen die Erzeuger davon<br />
aus, dass sie mit Ende der Belieferung ihre<br />
Geschäftsanteile an der Omira ausgezahlt bekommen.<br />
Doch zu einer fristgerechten Kündigung<br />
kam es nicht. Vielmehr versuchte Omira,<br />
die Bio-Genossen mit Aufhebungsverträgen<br />
aus dem Geschäft zu drängen. Von Überbrückungshilfen<br />
wie Abstandszahlungen oder<br />
die sofortige Auszahlung der Geschäftsanteile<br />
war seitens der Omira nicht die Rede.<br />
Schlimmstenfalls wollte die Molkerei die Biomilch<br />
zum Preis für normale Milch bei den<br />
Biobauern abholen. Das würde beachtliche elf<br />
Cent pro Kilogramm Biomilch ausmachen.<br />
Diese Regelung empfinden die Biobauern als<br />
Nötigung und wollen notfalls klagen. Betroffen<br />
sind rund 12o Bio-Landwirte, die jährlich<br />
25 Millionen Liter geliefert haben. Aktuell<br />
verarbeitet die Omira mit ihren rund 600 Mitarbeitern<br />
jährlich etwa 1 Milliarde Kilo Milch<br />
an den Standorten in Ravensburg, Rottweil<br />
und Neuburg an der Donau. [!] HAM<br />
Bauen Sie mit uns<br />
für die Zukunft -<br />
wir freuen uns auf<br />
Ihre Anfrage!<br />
f-k-systembau@f-kirchhoff.de<br />
21<br />
www.fk-systembau.de
[finanzieren] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Chefsesselzuvergeben<br />
Viele Firmen in Baden-Württemberg suchen händeringend nach einem Nachfolger. Kaufen statt Gründen wird für<br />
angehende Unternehmer zu einer Alternative. Auf welche Punkte es bei einer Übernahme zu achten gilt.<br />
Nach Zahlen des Instituts für Mittelstandsforschung<br />
(IfM) gab es im vergangenen<br />
Jahr 338.000 Existenzgründungen<br />
bei gleichzeitig 354.000 Pleiten. Einer<br />
der Gründe für diese negative Bilanz ist, dass<br />
die Geschäftsidee oder das Produkt der Jung<strong>unternehmen</strong><br />
oft noch nicht ausgereift genug<br />
ist, um sich am Markt durchzusetzen. „Dazu<br />
kommt, dass man am Anfang an so vieles denken<br />
und sich darum kümmern muss – nicht<br />
nur im operativen Geschäft, sondern auch um<br />
die Verwaltungsaufgaben“, sagt Johann Alt,<br />
Prokurist bei der Kaechele GmbH in Laichingen.<br />
„Das ist schon sehr viel Aufwand für einen<br />
Unternehmer in der Gründungsphase.“<br />
EiNübErsChaubarEsrisiko<br />
Alt und sein Partner Thomas Grabensee nahmen<br />
einen anderen Weg und stiegen als Gesellschafter<br />
bei Kaechele ein. „Die Übernahme<br />
eines bestehenden Unternehmens<br />
erschien uns einfacher als eine Neugründung“,<br />
erzählt Alt, „zwar ist dabei nicht alles<br />
so, wie man es sich idealerweise wünscht,<br />
aber es sind funktionierende Strukturen vorhanden.<br />
An Verbesserungen kann man dann<br />
Schritt für Schritt arbeiten.“ Zudem sind die<br />
Produkte ebenso wie der Markt erprobt, es<br />
gibt Kundenverbindungen – und überprüfbare<br />
Geschäftszahlen der vergangenen Jahre, so<br />
dass sich das unternehmerische Risiko recht<br />
gut einschätzen lässt. Im Fall von Alt und Grabensee<br />
kam dazu, dass Dieter Fiebelkorn, bis<br />
dahin Alleininhaber und Geschäftsführer des<br />
Herstellers für Hotelwäsche und Objektausstattung,<br />
schon seit längerem auf der Suche<br />
nach einem Partner war, der das Unternehmen<br />
weiterführt, wenn er in ein paar Jahren<br />
in den Ruhestand geht.<br />
Nach Schätzung des IfM steht allein in Baden-<br />
Württemberg bei 17.000 Unternehmen pro<br />
Altinhaber Dieter Fiebelkorn (links) will sich in<br />
ein paar Jahren zurückziehen – Thomas Grabensee<br />
(Mitte) und Johann Alt übernehmen.<br />
22
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[finanzieren]<br />
Joachim Rupp, Finanzierungsexperte<br />
der IHK Ulm<br />
Jahr die Nachfolge<br />
an, davon bei etwa<br />
500 bis 600 Firmen<br />
in der Region Ulm.<br />
Immer seltener<br />
bleibt die unternehmerische<br />
Führung<br />
in der Familie<br />
– oft, weil der<br />
Nachwuchs andere<br />
Pläne hat. Einen<br />
Partner von außen<br />
aufzunehmen, ist<br />
dann meist die einzige Möglichkeit, den Fortbestand<br />
der Firma zu sichern und einen Verkauf<br />
an externe Dritte zu verhindern. In der<br />
IHK Ulm betreut Nachfolgemoderator Joachim<br />
Rupp das Thema. Der Finanzierungsexperte<br />
hilft, potenzielle Kandidaten zu finden<br />
und auszuwählen und kümmert sich um die<br />
Nachbetreuung. Allerdings gilt es beim Einstieg<br />
in bestehende Unternehmen eine hohe<br />
Hürde zu meistern: die Finanzierung.<br />
„Eine Unternehmensbewertung vom Sechsbis<br />
Achtfachen des Jahresergebnisses vor Zinsen,<br />
Steuern und Abschreibungen ist üblich“,<br />
weiß Klaus Windheuser, Leiter Financial Engineering<br />
der Mittelstandsbank in der Commerzbank.<br />
„Da kommt selbst bei einem Mittelständler<br />
schnell ein Millionenbetrag<br />
zusammen.“ Und den wollen die Alteigentümer<br />
oft bar haben, um ihren Lebensabend finanzieren<br />
zu können. Da kommen selbst Gutverdiener<br />
an ihre Grenzen. Viele Unternehmer<br />
in spe sind daher auf die Hilfe ihrer Hausbank<br />
und anderer Finanziers angewiesen – etwa eines<br />
Finanzinvestors.<br />
Mitunter kommt auch eine interne Lösung<br />
zustande, in der Fachsprache Managementbuy-out<br />
(MBO) genannt. Genau das haben<br />
Anita Thierer, Julia Bug und Ana Touza Suarez<br />
auf die Beine gestellt. Eher ungeplant haben<br />
die drei vor rund einem dreiviertel Jahr die<br />
Ulmer Filmproduktionsgesellschaft Ulmedia<br />
übernommen, bei der sie zuvor angestellt waren.<br />
„Für uns war es ein Schock, als wir erfuhren,<br />
dass der Alteigentümer aufhören und<br />
verkaufen will“, erzählt Geschäftsführerin<br />
Bug, „aber dann griffen wir zu, weil wir hoffen,<br />
dass wir die Kunden halten können, die<br />
wir uns bei einer Neugründung mühsam hätten<br />
erarbeiten müssen.“ Dass der MBO weitgehend<br />
reibungslos klappte, hatte auch damit<br />
zu tun, dass die drei den Kauf aus eigenen Mitteln<br />
finanzieren konnten. Zudem ließen sie<br />
sich von einem Experten der staatlichen Förderbank<br />
KfW unterstützen und beraten. Er<br />
erklärte, welche Schritte als nächstes notwendig<br />
sind und warnte vor Fußangeln.<br />
DiEwiChtigstENrEgElN<br />
Ohne Rat keine Tat<br />
Der Kauf und die Übergabe eines Unternehmens<br />
ist ein komplexer Prozess, mit dem beide<br />
Seiten meist keine Erfahrung haben. Kaufinteressenten<br />
sollten einen Steuerberater<br />
oder Wirtschaftsprüfer hinzuziehen, um deren<br />
Expertise für den Due-Diligence-Prozess<br />
parat zu haben (siehe nächster Punkt). Der<br />
Der perfekte Partner für Ihren Erfolg.<br />
Das Sparkassen-Finanzkonzept<br />
Sparkasse Ulm<br />
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2<br />
89073 Ulm<br />
Tel 0731 101-0<br />
Tel 0731 101-100<br />
kontakt@sparkasse-ulm.de<br />
www.sparkasse-ulm.de<br />
23
[finanzieren] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Investors die Eigenkapitalquote des Ziel<strong>unternehmen</strong>s<br />
und damit das Rating. Ansprechadressen<br />
bei Finanzinvestoren vermittelt<br />
die IHK ebenso wie viele Hausbanken.<br />
Auch so kann man zum Unternehmer werden: Als ihr Chef überraschend aufhörte, übernahmen sie die<br />
Agentur (von links): Julia Bug, Anita Thierer und Ana Touza Suarez.<br />
Steuerfachmann hilft auch bei der Frage, ob<br />
es für die neuen Eigentümer besser ist, selbstständig<br />
zu werden oder angestellt zu sein. „Genauso<br />
wichtig ist ein Rechtsanwalt, da ein bestehendes<br />
Unternehmen meist sehr viele<br />
Verträge im Einkaufs- und Vertriebsbereich<br />
hat. Hinzu kommen häufig Kooperationsvereinbarungen,<br />
die alle rechtlich vor dem Kauf<br />
geprüft werden müssen“, rät Windheuser.<br />
Commerzbank-Experte<br />
Klaus Windheuser.<br />
Drum prüfe, wer sich ewig bindet<br />
Bevor Käufer und Alteigentümer über den<br />
Preis sprechen können, steht eine Due-Diligence<br />
an: Bei diesem<br />
Prozess öffnet<br />
der Unternehmer<br />
– vereinfacht gesagt<br />
– seine Bücher<br />
für einen externen<br />
Steuerberater oder<br />
Wirtschaftsprüfer,<br />
der die Firma<br />
gründlich durchleuchtet.<br />
Ziel ist es,<br />
das Unternehmen<br />
zu bewerten und<br />
herauszufinden,<br />
ob es größere Risiken oder Altlasten gibt. Ist<br />
das der Fall, kann der Käufer das bei seinem<br />
Preisgebot berücksichtigen. Faustregel: Je größer<br />
das Projekt ist, desto größere Ressourcen<br />
sollten auf die Due-Diligence verwendet werden.<br />
Doch auch bei kleineren Übernahmen<br />
geht nichts ohne Prüfung: „Eine Basis-Due-<br />
Diligence ist immer notwendig, und es ist unser<br />
Anspruch als finanzierende Bank, diese zu<br />
bekommen“, sagt Windheuser.<br />
Wo soll’s hingehen?<br />
Außer der Due-Diligence verlangt die finanzierende<br />
Bank üblicherweise einen Business-<br />
Plan vom Kaufinteressenten. „Wichtig für den<br />
neuen Eigentümer ist, dass er eine Idee hat,<br />
wo er mit dem Unternehmen hin will“, sagt<br />
Peter Sachse, Geschäftsführer des Finanzinvestors<br />
VR Equitypartner.<br />
Es darf ein bisschen mehr sein<br />
Die Grundregel lautet: Wer einen Unternehmenskauf<br />
voll finanziert, wird von der Zinslast<br />
erwürgt. Das machen meist auch die<br />
Banken nicht mit. Der Finanzrahmen sollte<br />
nicht zu knapp kalkuliert werden. „Mit dem<br />
Kaufpreis allein ist es noch nicht getan“,<br />
sagt Ulmedia-Geschäftsführerin Bug, „Insgesamt<br />
mussten wir noch einmal etwas<br />
mehr als ein Drittel der Kaufsumme für<br />
Sonder- und Folgekosten, etwa die Notarkosten,<br />
einkalkulieren.“<br />
Auf zur Partnersuche<br />
Ein Alleingang bei einem Unternehmenskauf<br />
ist nicht nur schwer zu stemmen, auch<br />
das finanzielle Risiko steigt erheblich. Sinnvoll<br />
ist es, über die Beteiligung eines Partners<br />
nachzudenken – etwa eines Finanzinvestors.<br />
Der bringt nicht nur Geld, sondern<br />
auch unternehmerische Expertise und ein<br />
breites Netzwerk mit. „Der Einstieg eines<br />
Finanzinvestors signalisiert Vertrauen in<br />
die neuen Eigentümer und hilft, weitere Finanzmittel<br />
zu akquirieren – und zwar nicht<br />
nur auf der Eigenkapital-, sondern auch auf<br />
der Darlehensseite“, weiß Sachse. So erhöht<br />
sich dank der finanziellen Beteiligung des<br />
Nicht gleich im Galopp lossprinten<br />
Einer der Hauptfehler ist ein unrealistischer<br />
Zeithorizont. Interessenten sollten sich einen<br />
Projektplan machen, um Abhängigkeiten auf<br />
der Vertrags- und Finanzierungsseite erkennen<br />
und berücksichtigen zu können. Sonst<br />
kann es passieren, dass zum Beispiel eine bestimmte<br />
Unterlage noch nicht vorliegt, die<br />
aber für den nächsten Schritt nötig ist. Das<br />
kann das ganze Projekt gefährden. „Wenn<br />
wirklich alle Voraussetzungen und offenen<br />
Fragen geklärt sind, kann so eine Transaktion<br />
innerhalb von sechs Monaten ablaufen“, sagt<br />
Windheuser. „Im Regelfall liegt ein realistischer<br />
Zeithorizont bei ein bis zwei Jahren.“<br />
Die Chemie muss stimmen<br />
Ausführliche Gespräche helfen zu erkennen,<br />
ob das Zwischenmenschliche stimmt. Es<br />
kommt immer wieder vor, dass sich mehrere<br />
Manager für einen Kauf zusammenfinden,<br />
dann aber nach einigen Monaten oder Jahren<br />
feststellen, dass sie überhaupt nicht zusammenpassen.<br />
Das heißt dann oft, sich hochkompliziert<br />
und mühsam wieder auseinanderdividieren<br />
zu müssen. [!] ThOmAs LuThER<br />
solide,erfolgreich,<br />
alteingesessensucht…<br />
angehendeunternehmer, die statt zu<br />
gründen einen bestehenden Betrieb<br />
übernehmen wollen, stehen meist vor<br />
der Frage: Wo und wie lassen sich überhaupt<br />
Firmen finden, für die ein Nachfolger<br />
gesucht wird? Umgekehrt<br />
suchen Unternehmen, die keinen Nachfolger<br />
haben, nach einer Anlaufstelle,<br />
bei der sie mit potenziellen Käufern in<br />
Kontakt kommen können. Die Industrie-<br />
und Handelskammern haben daher<br />
zusammen mit weiteren Partnern die<br />
Unternehmensbörse www.nexxtchange.org<br />
ins Leben gerufen. Auf der<br />
Online-Plattform finden sich mehr als<br />
10.000 Inserate zur Unternehmensnachfolge<br />
– neben Angeboten auch Gesuche<br />
von Existenzgründern, die eine<br />
Nachfolge antreten möchten. Aber<br />
auch viele Sparkassen und genossenschaftliche<br />
Institute betreiben entsprechende<br />
Marktplätze.<br />
LuT<br />
24
Über 62.500 cbm Raum und 300 Designmarken.<br />
Nehmen Sie viel Zeit mit – oder:<br />
Möbel Inhofer GmbH & Co. KG, Ulmer Str. 50, 89250 Senden<br />
DEUTSCHLANDS GROSSER DESIGN-TREFFPUNKT<br />
www.interni.de • info@interni.de • Germanenstraße 2 • 89250 Senden/Iller<br />
Fon 07307/ 856000 • Fax 07307/ 856100 • offen: Mo - Sa 10 - 19 Uhr<br />
25
[machen] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
VielversprechendesHaustürgeschäft<br />
Lange Schlangen am Postschalter. Packstation mit Fehlfunktion. Wer seine Nerven schonen will, hat eine andere<br />
Möglichkeit. Mit der Entwicklung zweier Brüder: Die Huckepack-Boxlässt sich leicht an die Tür hängen.<br />
Weihnachten 2012 standen Dominik<br />
Spaun und sein Bruder Marco im<br />
Grunde mit leeren Händen da. Die<br />
Geschenke, die sie im Internet bestellt hatten,<br />
waren nicht mehr rechtzeitig zugestellt worden.<br />
Noch am selben Abend setzten sich die 30<br />
und 23 Jahre alten Brüder aus Ettenbeuren bei<br />
Günzburg mit Stift und Papier unter den<br />
Christbaum und überlegten, wie man in Zukunft<br />
endlosen Schlangen in der Post und<br />
an Packstationen entgehen könnte. Metallboxen<br />
müsste man entwickeln. Überdimensionierte<br />
Briefkästen, die außen an der Hausoder<br />
Wohnungstür hängen. So klein wie<br />
möglich, so groß wie nötig, am besten ausziehbar.<br />
Zum Einhängen, damit nichts angebohrt<br />
werden muss. Wichtig in Mietshäusern.<br />
Zudem müsste die Box für jeden Paketboten<br />
– ob von DHL, GLS, Hermes, UPS, TNT oder<br />
DPD – zu öffnen sein. Aber bitteschön nicht<br />
für den Nachbarn.<br />
Weil Dominik Spaun Wirtschaftsingenieur<br />
ist und Marco Spaun Maschinenbautechniker,<br />
war klar, dass das Produkt auch auf den<br />
Markt kommen sollte. Es sollte eine Nische<br />
füllen und damit die Welt der Online-Shopper<br />
wieder ein Stück bequemer machen. Fast 2,7<br />
Milliarden Paket- und Expresssendungen<br />
wurden im vergangenen Jahr versandt. Das<br />
sind fast vier Prozent mehr als im Vorjahr –<br />
und knapp 60 Prozent mehr als im jahr J000.<br />
NureiNerHatdeNScHlüSSel<br />
Nicht lange nach jenem bescherungsarmen<br />
Weihnachtsfest stellte Marco Spaun einen<br />
Prototyp aus Aluminium her: 40 Zentimeter<br />
breit, 40 Zentimeter tief, 60 Zentimeter hoch.<br />
Der Eigentümer braucht zum Öffnen einen<br />
Schlüssel; er muss auch dafür sorgen, dass die<br />
Box für den Boten geöffnet ist. Der Bote dreht<br />
dann den Griff, klick, das Schloss rastet ein.<br />
Ruckzuck hat die Tür die Box huckepack genommen.<br />
Wer hat’s erfunden? Marco (links) und Dominik<br />
Spaun.<br />
26
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[machen]<br />
Obwohl beide Brüder nicht mehr daheim<br />
wohnen, wurde die elterliche Garage in<br />
Beschlag genommen. „Darin befindet sich<br />
jetzt unsere Montagelinie“, sagt der 23-jährige<br />
Marco und lacht. Aufgebaut wurde das<br />
Start-up hauptsächlich am Wochenende,<br />
wenn sein älterer Bruder frei hatte, der wochentags<br />
in München bei der Deutschen Bahn<br />
arbeitet.<br />
KeiNeZeitVergeudeN<br />
Mit der Zeit verwandelten die Brüder fast die<br />
komplette erste Etage des Elternhauses in ein<br />
Büro: Schreibtische, an den Wänden Konstruktionszeichnungen,<br />
Balkon mit Ausblick<br />
auf die ruhige Siedlung im Lärchenweg. Mittlerweile<br />
offizielle Adresse der Huckepack UG<br />
– wie die beiden ihr Unternehmen nannten.<br />
Ein Jahr dauerte der Entwicklungsprozess. Eine<br />
Hürde: Die Steuernummer ließ lange auf<br />
sich warten. Schnell dagegen war ein Metallbetrieb<br />
in Memmingen gefunden, der bereit<br />
war, die Boxen in kleiner Auflage herzustellen.<br />
Marco Spaun vollendete sie in der Garage.<br />
Die erste Serie – 50 Stück – ist mittlerweile<br />
verkauft. Derzeit wird die zweite produziert.<br />
100 Stück. Ein Patent wurde angemeldet, ein<br />
Logo entworfen, Dominik Spauns Frau Julia<br />
kümmerte sich um die Kommunikation: Flyer,<br />
Homepage, Pressetexte.<br />
Mit Aufhängung kostet Huckepack rund 220<br />
Euro. Dominik Spaun: „Ein Luxusprodukt für<br />
jeden, der nicht in der Schlange am Postschalter<br />
stehen und seine Zeit vergeuden will.“<br />
Noch. Günstiger lässt sich das Produkt aktuell<br />
nicht herstellen. „Aber wir arbeiten an einem<br />
Einsteigermodell, so groß wie ein Schuhkarton.“<br />
Für 99 Euro. Auch in Sachen Ästhetik<br />
WegvomSchalter,fertig,los…<br />
Wenn niemand zu Hause ist, legt der DHL-Zusteller die Sendung in den Paketkasten im Vorgarten.<br />
Die Hausbesitzer öffnen die Box mit einem Schlüsselchip.<br />
sehen die Jungunternehmer Optimierungsmöglichkeiten.<br />
Nicht jeder steht auf Aluminium.<br />
Die Idee: Der Kunde soll seine individuelle<br />
Box gestalten können. Er lädt ein Foto im<br />
Internet hoch oder „einen coolen Spruch“.<br />
Wenn die Firma gut läuft, soll aus dem Nebenein<br />
Vollzeitjob werden. Rückblickend würden<br />
sich die Spauns früher ums Marketing kümmern,<br />
früher Prototypen bauen und mehr<br />
auchdiedeutschePost bietet seit dem<br />
Frühjahr Paketkästen an, die Hausbesitzer<br />
im Vorgarten aufstellen können. Die<br />
kleinste kostet 99 Euro und fasst 78 Liter.<br />
Für 1,99 Euro im Monat kann die Box auch<br />
gemietet werden. Die Kästen sind im Prinzip<br />
eine Weiterentwicklung der Packstationen,<br />
an denen per Zugangscode ausschließlich<br />
DHL-Pakete rund um die Uhr<br />
abgeholt, aber auch versandt werden können.<br />
In Berlin testet der Bonner Konzern<br />
gerade den Paket-Butler, eine Lösung für<br />
Haus- und Wohnungstüren. Aber auch andere<br />
Firmen drängen ins Haustürgeschäft,<br />
unter anderem „LockTec“, „Max Knoblock“<br />
und „Onebox.me“. Viele sind noch<br />
in der Konzeptphase. Die Boxen können<br />
oft von mehreren Parteien eines Mehrfamilienhauses<br />
genutzt werden. Die Huckepack-Boxen<br />
sind seit Mai im Handel. Isa<br />
Wert auf individuelle Gestaltung legen.<br />
Schließlich gehört Deutsche Post zu ihren<br />
Konkurrenten. Diese bietet seit dem Frühjahr<br />
eigene Kästen an, lässt aber nur Pakete hinein,<br />
die über ihre Tochter DHL versandt werden.<br />
Angst, vom Riesen plattgemacht zu werden,<br />
haben die Brüder nicht: „Unsere Box nimmt<br />
alles.“ Vielleicht liegt bald auch das Sonntagsfrühstück<br />
drin. [!] Isabella Hafner<br />
DEKRA Akademie qualifiziert:<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
EU-Kraftfahrer/-in Weiterbildung Lkw/Bus<br />
Ladungssicherung<br />
Gefahrgutfahrer/-in und Gefahrgutbeauftragte/-r<br />
Sicherheitsbeauftragte/-r<br />
Fachkraft Lagerlogistik und Logistikmeister/-in<br />
Gabelstapler<br />
Brandschutzhelfer/-in<br />
Regalprüfer/-in<br />
Elektrotechnische Unterweisung<br />
SAP (auch berufsbegleitend)<br />
u.v.w.m.<br />
DEKRA Akademie GmbH | Tel.: 0731.93769-0 | www.dekra-akademie.de/ulm<br />
27
[spezial] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
EvolutionderMaschinen<br />
Ist denn gerade wieder Revolution? Kommt das Schlagwort Industrie4.0ins Spiel, spricht alle Welt davon. Ei gentlich<br />
handelt es sich um eine Evolution. Die Vernetzung von Maschine und Internet wird die Produktion umwälzen.<br />
Die vierte industrielle Revolution, kurz<br />
Industrie 4.0 genannt, bietet ein immenses<br />
Potenzial, die Prozesse im verarbeitenden<br />
Gewerbe durch dezentrale Intelligenz<br />
produktiver zu gestalten. Aber warum<br />
eigentlich ist das die vierte Revolution? Die<br />
erste tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung<br />
der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse<br />
ging Ende des 18. Jahrhunderts mit<br />
der Einführung mechanischer Produktionsanlagen<br />
und anschließend mit der Dampfmaschine<br />
einher. Die zweite steht in Verbindung<br />
mit elektrischer Energie und dem Beginn der<br />
arbeitsteiligen Massenproduktion. Computergestützte<br />
Automatisierung ab Mitte der<br />
1960er Jahre löste den nächsten großen Umbruch<br />
aus. Nun ist die vierte Revolution im<br />
Gange, die Vernetzung der Produktion durch<br />
die Informationstechnik. In der klugen Fabrik<br />
der Zukunft kommuniziert alles miteinander<br />
– Maschine, Komponenten, Menschen, vergleichbar<br />
einem sozialen Netzwerk.<br />
ZuMBEIspIEl„pulsE“<br />
Die Revolution hat unterschiedliche Namen.<br />
Innerhalb der in Dornstadt ansässigen Asys-<br />
Gruppe beispielsweise heißt sie „Pulse“. Dahinter<br />
steckt ein mobiles Assistenzsystem zur<br />
Steuerung und Überwachung von Fertigungslinien<br />
über Tablet-Computer. Waren essenzielle<br />
Informationen bislang nur stationär an<br />
der Anlage selbst zu bekommen, sind sie nun<br />
überall verfügbar. Schalter oder Signalleuchten<br />
an Einzelkomponenten von Produktionsstraßen<br />
sind daher überflüssig, dem kleinen<br />
Helfer sei’s gedankt. Zum „mobilen Assistenzsystem“<br />
aufgerüstet, vermittelt es dem Bediener,<br />
übersichtlich präsentiert, sämtliche wesentlichen<br />
Maschineninformationen einer<br />
Anlage: „Pulse“ visualisiert die gesamte Fertigungslinie.<br />
Der Bediener kann bei Stillstand<br />
In der Fabrik von morgen kommunizieren nicht<br />
nur Menschen mit Maschinen, sondern auch Bauteile<br />
und Fertigungslinien untereinander.<br />
28
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[spezial]<br />
schnell reagieren, aber auch seine nächsten<br />
Tätigkeiten vorausschauend planen, erklärt<br />
Klaus Mang, Geschäftsführer des Automatisierungsspezialisten.<br />
Nach Zeit und Priorität<br />
geordnet, zeigt ein „Task-Manager“ alle anstehenden<br />
Aufgaben und Warnungen an, inbegriffen<br />
eventueller Stillstände. Im speziellen<br />
Fall von Asys geht es beispielsweise um den<br />
Füllstand von Be- und Entladesystemen. Dem<br />
Bediener wird rechtzeitig signalisiert, zu welchem<br />
Zeitpunkt er für Nachschub sorgen<br />
muss.<br />
Schon heute lässt sich die Produktion mit mobilen Assistenzsystemen optimieren .<br />
DIEproDuktIonänDErtsIch<br />
Sind Maschinen bis heute üblicherweise auf<br />
einen einmal definierten Arbeitsschritt festlegt,<br />
so sind sie künftig in der Lage, sich immer<br />
wieder an sich verändernde Anforderungen<br />
anzupassen. Die Werkstoffe und Objekte<br />
tragen Barcodes oder kleine Funk-Chips, so<br />
genannte RFID, auf der Oberfläche, deren Informationen<br />
von Scannern oder Computern<br />
ausgelesen werden. Damit teilen sie der Maschine<br />
mit, was sie mit ihnen machen soll.<br />
Auf diese Weise entfällt das zeitaufwendige<br />
Umprogrammieren der Maschinen. Dadurch<br />
kann möglicherweise sogar die Produktion<br />
von Kleinstserien rentabel werden. Da in der<br />
Industrie 4.0 die Abläufe so transparent werden<br />
wie nie, behalten die Verantwortlichen<br />
jederzeit den Überblick und können flexibel<br />
reagieren. Gibt es irgendwo einen Engpass,<br />
kann die Produktion an anderer Stelle erhöht<br />
und der Ausfall kompensiert werden. Die Zauberformel<br />
der vierten Revolution lautet: Die<br />
DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR IHRE WERBUNG!<br />
CONSTRUCTION<br />
Egal ob für Techniker, Konstrukteure, Ingenieure oder Planer - CONSTRUCTION ist das<br />
Multitasking-Schreibwerkzeug mit Symbolkraft für Ihre Kampagne!<br />
Wasserwaage und Lineal<br />
Schlitz-/ und Kreuzschraubendreher<br />
Stylus-Aufsatz<br />
Die ersten 25 Besteller erhalten ein Exemplar kostenlos!<br />
Ab 100 Stück kostenlose Lasergravur.<br />
9,50 € / Stück<br />
ab 100 Stück, zzgl. MwSt.<br />
Ihr Werbeartikelpartner vor Ort:<br />
Kugelschreiber<br />
Hätten Sie‘s gewusst?<br />
Mit einem Schreibgerät erreicht<br />
Ihre Werbebotschaft den<br />
Empfänger mind 1 x pro Tag!<br />
PIP20/YE<br />
gelb<br />
PIP20/BK<br />
schwarz<br />
PIP20/BL<br />
blau<br />
PIP20/RD<br />
rot<br />
PIP20/SI<br />
silber<br />
Einfach Musterbestellung in der gewünschten Farbe mit dem Stichwort<br />
„UNTERNEHMEN!“ an die angegebene Adresse senden.<br />
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot!<br />
29
[spezial] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Produktion soll flexibler und effizienter werden,<br />
Zeit sparen und Rohstoffe. Asys aus Dornstadt<br />
beispielsweise verspricht durch den Einsatz<br />
seines Assistenzsystems eine höhere<br />
Effizienz der Produktionslinien. Asys-Chef<br />
Mang begründet das so: „Pulse“ unterstütze<br />
vorausschauendes Planen und reduziere unproduktive<br />
Nebenzeiten.<br />
supErhIrnchEcktAufträgE<br />
Die Perspektiven von „Industrie 4.0“ sind jedoch<br />
viel weiter gespannt. In der „vernetzten<br />
Fabrik“ der Zukunft werden intelligente Maschinen<br />
und Produkte, Lagersysteme und<br />
Betriebsmittel konsequent mittels Informationstechnologie<br />
verzahnt. Beim österreichischen<br />
Maschinenbauer Geislinger, Zulieferer<br />
optimismusimMaschinenbau<br />
von Großmotorenbauern mit Sitz in Salzburg,<br />
ist ein Leitstand zum Gehirn der Produktion<br />
geworden. Das Arbeitsprogramm wurde von<br />
einem Meister auf einen selbstoptimierenden<br />
Fertigungsleitstand übertragen. Dieser überschaut<br />
sowohl alle Aufträge als auch alle Störungen<br />
und kann stündlich die Neuplanung<br />
der Aufträge vornehmen. Dieses Superhirn<br />
teilt den Bearbeitungsmaschinen die Aufträge<br />
zu, denn es weiß: Sind Materialien und Werkzeuge<br />
vor Ort? Stehen die erforderlichen Mitarbeiter<br />
zur Verfügung? Ist das CNC-Programm<br />
fertig? Gibt es irgendwo Störungen?<br />
Bei Geislinger sind laut Werksleiter Josef<br />
Tinzl täglich bis zu 2500 Fertigungsaufträge<br />
im Umlauf, die per Leitsystem optimal den<br />
140 Arbeitsplätzen zugeordnet werden.<br />
Die Maschinenbauer im Südwesten erwarten für dieses Jahr ein Umsatzplus von 4,3 Prozent.<br />
DasJahr<strong>2014</strong> verlief für den baden-württembergischen<br />
Maschinenbau bislang<br />
besser als 2013. Der Branchenverband<br />
VDMA erwartet ein Wachstum von 4,3<br />
Prozent. Mit jetzt mehr als 300.000 Beschäftigten<br />
–so vielen wie seit Beginn der<br />
1990er Jahre nicht mehr (2010: 275.000)<br />
– bleibt der von mittelständischen Unternehmen<br />
geprägte Maschinen- und Anlagenbau<br />
der mit Abstand größte industrielle<br />
Arbeitgeber im Südwesten. „Vor allem<br />
der deutsche Markt erweist sich derzeit<br />
als Zugpferd“, sagt Christoph Hahn-<br />
Woernle, Vorsitzender des Verbands Deutscher<br />
Maschinen- und Anlagenbau VDMA.<br />
Zuletzt berichteten 53 Prozent der an der<br />
jüngsten Konjunkturumfrage beteiligten<br />
Unternehmen von einer sehr guten oder<br />
guten Auftragslage. Im entsprechenden<br />
Vorjahreszeitraum waren es nur 33 Prozent.<br />
18 Prozent der Unternehmen sprechen<br />
von einer schwachen oder schlechten<br />
Lage. 26 Prozent rechnen für die<br />
nächsten Monate mit einer weiteren Aufwärtsentwicklung,<br />
64 Prozent mit einer<br />
konstanten Auftragslage. Der Bedarf an<br />
qualifizierten Fachkräften dürfte daher<br />
weiterhin hoch bleiben.<br />
Als Zielmärkte, die sich positiv entwickeln,<br />
nennen 73 Prozent der Unternehmen<br />
Deutschland an erster Stelle, gefolgt von<br />
den USA und China. Als eher schwach<br />
werden Russland, Frankreich, Indien und<br />
Brasilien angesehen. 79 Prozent der Firmen<br />
rechnen auch im kommeden Jahr mit<br />
steigenden Umsätzen.<br />
tv<br />
Industrie 4.0 bedeutet also nicht, dass smarte<br />
Produktionssysteme alle Aufgaben übernehmen.<br />
Während durch das Zusammenwachsen<br />
von IT und Automatisierungstechnik einfache<br />
Tätigkeiten tendenziell noch stärker entfallen,<br />
steigen die Ansprüche auf der anderen<br />
Seite. Gefragt sind nun Kompetenzen bei der<br />
Koordinierung von Abläufen und der Steuerung<br />
von Kommunikation, was oft eigenverantwortliche<br />
Entscheidungen nötig macht.<br />
DAsAutosAgt,wAsfEhlt<br />
„Industrie 4.0“ ist ein Thema, das sowohl die<br />
produzierende Industrie mitsamt den Anlagen-<br />
und Maschinenbauern betrifft, als auch<br />
die IT-Branche. Während in vielen Branchen<br />
wie Banken und Versicherungen die einstmals<br />
analogen Prozesse<br />
bereits komplett<br />
digitalisiert<br />
sind, ist die Digitalisierungswelle<br />
in<br />
der Fertigungsindustrie<br />
gerade erst<br />
angekommen. IT-<br />
Anbieter stehen<br />
parat, haben sie<br />
doch in anderen<br />
Branchen schon IBM-Chefin<br />
ein hohes Prozess- Martina Koederitz.<br />
und Fertigungswissen<br />
gesammelt. Herausforderung für die<br />
Industrie ist es, rechtzeitig die nötigen Fachkräfte<br />
auszubilden oder zu rekrutieren. Martina<br />
Koederitz, die Vorsitzende der Geschäftsführung<br />
der IBM Deutschland GmbH<br />
(Ehningen) und Präsidiumsmitglied im Branchenverband<br />
Bitkom, regt an, dass etwa Wirtschaftsinformatiker<br />
zusätzliche Module aus<br />
den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik<br />
belegen. Ebenso können Abläufe genau<br />
auf die Möglichkeiten der Belegschaft<br />
abgestimmt werden. Das eröffnet Chancen<br />
beispielsweise auch für Ältere. Ihre Zwischenbilanz<br />
zum Thema „Industrie 4.0“ fällt so aus:<br />
„Den Unternehmen fließt ein riesiger Schatz<br />
an Daten zu, die ihnen helfen, Kunden besser<br />
zu verstehen, Prozesse zu optimieren oder<br />
neue Absatzmärkte zu entdecken.“<br />
Auch die Abläufe der Fahrzeugindustrie werden<br />
sich nachhaltig verändern. Zentrale Bauteile<br />
von Autos sind künftig so ausgestattet,<br />
dass sie permanent Daten über ihren Zustand<br />
sammeln und rechtzeitig ein Signal geben,<br />
wenn ein Austausch ansteht – noch bevor sie<br />
ausfallen würden. Das System teilt der Werk-<br />
30
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[spezial]<br />
statt mit, dass Ersatz nötig ist. Die Bestellung<br />
enthält bereits die genauen Typen-Angaben<br />
sowie die Information, wo und wann der Austausch<br />
stattfinden kann. Sollte das Bauteil erst<br />
produziert werden müssen, konfigurieren<br />
sich in der Fabrik des Herstellers die Maschinen<br />
selbst gemäß den Anforderungen.<br />
DErstAnDDErDIngE<br />
Die vierte Revolution hat zwar schon begonnen.<br />
Einzelne Komponenten gibt es bereits,<br />
aber die Vernetzung geht noch kaum über die<br />
Grenzen eines Werkes, Unternehmens und<br />
eines Landes hinaus. Die kommunizierende<br />
Fabrik der Zukunft ist potenziell global vernetzt.<br />
Sie erfordert darüber hinaus die Entwicklung<br />
intelligenterer Monitoring- und<br />
autonomer Entscheidungsprozesse. Beim Verband<br />
der Maschinenbauer erwartet man sich<br />
dadurch vollkommen neuartige Geschäftsmodelle<br />
und die Erschließung erheblicher<br />
Optimierungspotenziale in Produktion und<br />
Logistik. [!] thomas vogel Künftig tragen nicht nur große Maschinenbau-Komponenten, sondern auch kleine Werkstoffe Minichips.<br />
Foto: © Zbynek Jirousek / Fotolia.com<br />
31
[machen] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Tischleindeckdich<br />
Ob Grillabend im überschaubaren Kreis oder Vier-Gänge-Menü für 3000 Gäste. BurgerZelte&Cateringhat sich zum<br />
Party-Spezialisten entwickelt. In diesem Jahr hat das Unternehmen selbst etwas zu feiern – den Fünfzigsten.<br />
Heiner Burger hatte einen guten Überblick<br />
von seinem Süßwarenstand aus,<br />
nicht nur aufs Publikum. So entging<br />
ihm nicht, wenn nebenan der Bär steppte. Um<br />
in höhere Umsatzregionen vorzustoßen,<br />
müsste man Festwirt sein, sinnierte der gelernte<br />
Kaufmann, der seit 1964 mit seinem<br />
Vater über die Jahr- und sonstigen Märkte tingelte.<br />
Vier Jahre später, im studentenbewegten<br />
Jahr 1968, verpasste er seinem beruflichen<br />
Leben den entscheidenden Kick. Erstmals trat<br />
Burger als Festwirt auf den Plan, damals noch<br />
mit einem Leihzelt, gleichwohl vom Start weg<br />
überaus erfolgreich. Das erste eigene schaffte<br />
er 1970 an, und von nun an ging’s – bergauf.<br />
MiTZuCkerwaTTegiNg‘slos<br />
Im 50. Jahr ihrer Gründung heißt die Firma<br />
„Burger Zelte & Catering“, dem stark erweiterten<br />
Leistungsspektrum Rechnung tragend.<br />
Schon seit 1997 steht sie unter der Leitung Peter<br />
Burgers, seines Sohnes, und dessen Ehefrau<br />
Angelika. Burgers<br />
Aktivitäten<br />
nicht wahrzunehmen,<br />
dürfte<br />
schwerfallen. Auf<br />
dem Ulmer Weihnachtsmarkt,<br />
den<br />
der Firmengrün-<br />
Orientierte sich 1968 neu:<br />
Heiner Burger.<br />
der mitbegründet<br />
hat, gehört der<br />
Burger-Imbiss quasi<br />
schon zum Inventar.<br />
Präsent ist<br />
Burger bei zahlreichen<br />
Vereins-, Stadt- und sonstigen Festivitäten,<br />
bei Events und Open-airs im nahen und<br />
weiteren 200-Kilometer-Umkreis mit „Fliegenden<br />
Bauten“ – der Zeltverleih steuert rund<br />
ein Drittel zu den Umsätzen bei und bildet so-<br />
Mit bis zu 250 Arbeitskräften bekocht und bewirtet<br />
Burger seine Kunden, wenn gewünscht, auch<br />
mit 30.000 Essen am Tag. Satt wird jeder.
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[machen]<br />
Ob klein oder groß, ob Ulmer Wilhelmsburg oder Idyll im Hinterland: Die Zeltlösungen sind flexibel.<br />
mit trotz starken Wettbewerbs weiter ein festes<br />
Standbein. Seit einigen Jahren rückt die<br />
Firma verstärkt auf der Catering-Schiene nach<br />
vorne. Nur die Festwirt-Zeit ist so gut wie vor<br />
vorbei. Während Vater Heiner (72) in den<br />
Hoch-Zeiten dieser bier- und damals auch<br />
noch rauchgeschwängerten Geselligkeitsorte<br />
bis zu fünf Zelte gleichzeitig bewirtschaftete,<br />
ist heute dieses Geschäftsfeld einzig auf das<br />
Kinder- und Heimatfest in Laupheim geschrumpft.<br />
Die Zeit der „Festwochen“ landauf,<br />
landab sei zu Ende gegangen mit der rapiden<br />
Zunahme der Dorf-, Stadt-, Vereins-, Straßenund<br />
sonstigen Feste in immenser Zahl. „Und<br />
wegen der Einführung der Sommerzeit.“ Wie<br />
das? „Ha“, antwortet Burger-Senior mit der Expertise<br />
des gebürtigen Ulmers, „in Schwaben<br />
arbeitet man, bis es dunkel wird …“<br />
DaseNDeDerFesTwoCheN<br />
Das könnte bereits das Finale sein. Tatsächlich<br />
aber ist es der Ausgangspunkt für eine<br />
erstaunliche Expansion, verbunden mit einer<br />
konsequenten Diversifizierung der Angebote.<br />
„Unser Vorteil“, sagt Peter Burger: „Läuft’s in<br />
einem Bereich mal nicht so gut, können wir<br />
das an andere Stelle meist ausgleichen.“<br />
Die klassischen Imbissstände werden daher<br />
ebenfalls noch auf die Reise geschickt auf<br />
Märkte, Feste oder wo auch immer „schnelles<br />
Essen“ gefragt sei. Außerdem spielt heute die<br />
Komplettbetreuung von Firmen- wie kulturellen<br />
Veranstaltungen eine immer wichtigere<br />
Rolle: Das Burger-Team übernimmt dabei<br />
auf Wunsch alles, was zu einer Groß-Feier dazugehört,<br />
angefangen von der Organisation<br />
NEUBAU IM GEWERBEGEBIET »ULM-NORD« – WWW.GEWERBE-ULM.DE<br />
Hallen- / Büroflächen in variabler Größe von 200 bis 5.000 qm zu vermieten<br />
33
[machen] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
und Planung über die Bereitstellung von Zelt<br />
samt Ausstattung bis hin zu Bewirtschaftung,<br />
Kinderbetreuung und Kulturprogramm.<br />
Zwar gebe es gerade im Catering viele Anbieter.<br />
Doch in der Größenordnung „von 300 Essen<br />
aufwärts“, in der sich Burger vornehmlich<br />
bewegt, schon nicht mehr sehr viele. Ordern<br />
die Kunden dann noch 3000 punktgenau zu<br />
servierende Vier-Gänge-Menus oder 30.000<br />
Essen über den Tag verteilt, wird der Kreis der<br />
Mitbewerber nach seinen Worten schon sehr<br />
übersichtlich – damit ist man auch schon bei<br />
den Alleinstellungsmerkmalen der Burgers<br />
angelangt.<br />
gehTNiChT,giBT‘sNiChT<br />
Solche Großaufträge wickelt selbst die im 400<br />
Einwohner zählenden Weinried (Landkreis<br />
Unterallgäu) ansässige Firma trotz Routine,<br />
besten Kontakten zu Lieferanten und der<br />
schier unerschöpflichen<br />
Lagerbestände<br />
an Equipment<br />
nicht mit<br />
einem Fingerschnippen<br />
ab. Flattert<br />
der Auftrag<br />
dann auch noch<br />
kurz vor knapp herein,<br />
und das womöglich<br />
in der heißen<br />
Festles-Zeit<br />
Setzt auf mehrere Standbeine:<br />
Peter Burger von Juni bis Juli,<br />
dann dürfte im beschaulich<br />
am Ortsrand gelegenen Firmensitz<br />
auch mal Hektik ausbrechen. Das umschreibt<br />
Burger in schwäbischer Unaufgeregtheit mit<br />
„Nachdenken“. „Kunden zu eröffnen, tut uns<br />
leid, das geht jetzt nicht“, sei selbst in einer<br />
solchen Situation für ihn ausgeschlossen, sagt<br />
der Inhaber. Ebenso tabu ist übrigens, dass<br />
während einer Veranstaltung das Essen ausgeht.<br />
Selbst wenn, um ein Beispiel zu nennen,<br />
800 Gäste angemeldet sind, aber wider Erwarten<br />
die doppelte Zahl erscheine, müsse eine<br />
Lösung gefunden werden, beschreibt der Firmenchef<br />
die Anforderung an sich und sein<br />
Team.<br />
Versuchsballon„Feuerwurst“<br />
Burgers Feuerwurst mit Chili-Note: Ist sie zu scharf, bist du zu schwach.<br />
PeterBurger leistet sich mit der „Feuerwurst“<br />
ein Experimentierfeld, das auch<br />
ihm immer wieder veritable Überraschungen<br />
abnötigt. Die Idee entstand mit<br />
den Würsten mit der Chili-Note, die ihm<br />
ein fränkischer Metzger auf die Roste lieferte.<br />
Den Namen ließ sich Burger später<br />
markenrechtlich schützen. Seitdem ist<br />
ihm die scharfe Rote, mit großem Einsatz<br />
im regionalen Funk und Fernsehen beworben,<br />
wichtig und wertvoll. Und sie ist<br />
zur Eigenmarke an seinen Imbiss-Ständen<br />
geworden. Zusammen mit dem jetzigen<br />
Lieferanten, dem Söflinger Metzger<br />
Raimund Hörmann, plant Burger nun als<br />
wasChMasChiNeFürZelTe<br />
Rasch auf alle Eventualitäten reagieren zu<br />
können, ist der Grund dafür, dass Burger die<br />
nötige Ausrüstung komplett selbst vorhält,<br />
darunter eine kleine Flotte an Lkw bis hin zur<br />
Kuchengabel, von Koch- und Kühlgerätschaften<br />
bis hin zu den Zelten verschiedener Größe.<br />
Deren Obergrenze, peilt Burger über den<br />
Daumen, liege bei einer Kapazität von 10.000<br />
Plätzen, die Modulbauweise macht’s möglich.<br />
In einer der Lagerhallen findet sich sogar eine<br />
hauseigene „Waschmaschine“ zur Säuberung<br />
der Zeltplanen. Ein propperes Erscheinungsbild<br />
werde von den Kunden, darunter Konzerne,<br />
Kommunen und Firmen, schlicht vorausgesetzt.<br />
Nach spätestens zehn Jahren seien die<br />
Planen reif für den Austausch.<br />
Ein voll ausgestattetes Zelt entspreche Investitionen<br />
von etwa einer halben Million Euro,<br />
verrät Burger. Den Jahresumsatz behält der<br />
Unternehmer lieber für sich. Da sich das<br />
Hauptgeschäft auf die wärmeren Monate im<br />
nächsten Schritt den Markteintritt in den<br />
Lebensmitteleinzelhandel. Damit, räumt<br />
Burger ein, habe sich für ihn eine völlig<br />
neue Welt aufgetan – in welcher umfängliche<br />
rechtliche Vorschriften, Verpackungsmodalitäten<br />
und Fooddesigner<br />
vorerst eine weitaus größere Rolle als<br />
das Produkt selbst spielen. Geplant sei,<br />
zunächst in einigen inhabergeführten regionalen<br />
Märkten zu starten. Um in die<br />
Reiche der großen Konzerne zu gelangen,<br />
seien dann nochmals größere Hürden zu<br />
überwinden: „Ganz andere Liga.“ Eine<br />
Wurst als Hobby? Weit gefehlt. Burger<br />
hofft auf ein zusätzliches Standbein. TV<br />
Jahr konzentriert, ist der Personalstand stark<br />
schwankend. Im Winter seien 20 Stamm-Mitarbeiter<br />
an Bord, im Sommer 40. Dazu kämen<br />
dann phasenweise mehr als 200 temporäre<br />
Kräfte, vom Koch bis zur Bedienung, teils wiederum<br />
schon lange mit dabei, teils über spezialisierte<br />
Agenturen vermittelt. „Es wird immer<br />
schwieriger, Leute zu finden“, stimmt<br />
Peter Burger schließlich doch noch ein Klagelied<br />
an. An den Löhnen, die schon jetzt<br />
deutlich über dem Mindestlohn liegen, kann<br />
das seiner Meinung nach nicht liegen. Schon<br />
eher daran, dass die Leute mittlerweile lieber<br />
selbst auf Feste gehen, also dort kräftig zuzupacken.<br />
[!] <br />
ThomasVogel<br />
34
2av ist ein Büro für Mediale Raumgestaltung<br />
sowie für die Gestaltung von klassischen<br />
und neuen Medien. Seit 2005 realisieren wir<br />
interdisziplinäre Projekte, von der inhaltlichen<br />
Konzeption über die Gestaltung bis hin zur<br />
technischen Umsetzung.<br />
2av GmbH<br />
Keltergasse 3, 89073 Ulm<br />
T + 49 (0) 731 - 708 99 00<br />
www.2av.de | mail@2av.de<br />
Darwineum Rostock, Dauerausstellung seit September 2012<br />
35
[führen] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
DieteurenFehlerderVorgesetzten<br />
Unternehmen unterschätzen oft das Thema Fluktuation. In unserer Serie GuteLeutefindenundhaltenerläutern<br />
zwei Experten, warum schlechte Führungskräfte zum Kostenfaktor werden und welche Lösungsansätze es gibt.<br />
Viele Manager kommen ihre Unternehmen<br />
teuer zu stehen. Sie sind schlechte<br />
Führungskräfte, gehen nicht auf die<br />
zentralen Bedürfnisse und Erwartungen ihrer<br />
Mitarbeiter ein. „Die Qualität der Führung<br />
und die Unternehmenskultur haben direkte<br />
Auswirkungen auf die Verweildauer von Beschäftigten<br />
in Unternehmen“, sagt Marco<br />
Nink, Seniorberater im Beratungs<strong>unternehmen</strong><br />
Gallup. Nach der Engagement-Studie des<br />
Marktforschungsinstituts sind nur 16 Prozent<br />
der Arbeitnehmer in Deutschland bereit, sich<br />
für ihre Firma freiwillig einzusetzen. Mehr als<br />
zwei Drittel leisten Dienst nach Vorschrift,<br />
17 Prozent haben innerlich gekündigt.<br />
Mitunter höre er die Meinung, Unternehmen<br />
müssten doch froh sein, wenn Mitarbeiter, die<br />
innerlich gekündigt haben, freiwillig gehen.<br />
Doch das hält er angesichts des Fachkräftemangels<br />
für eine gefährliche Fehleinschätzung.<br />
„Da sind viele Beschäftigte darunter, die<br />
das Unternehmen gar nicht loswerden will.“<br />
Viele Firmen vergessen, dass sie damit Erfahrung,<br />
Fachwissen und Netzwerke verlieren.<br />
„Wenn der Mitarbeiter zum Wettbewerber<br />
geht oder sich selbstständig macht, verstärkt<br />
sich die Konkurrenzsituation“, sagt Nink.<br />
Auch könne eine Sogwirkung entstehen nach<br />
dem Motto: Einer geht und andere gehen mit<br />
– nicht nur Kollegen, sondern auch Kunden.<br />
Der gemeine Mitarbeiter reagiert auf Tritte des Chefs mit Flucht. Das aber kommt die Firma teuer.<br />
Besser,aBernichtperFekt<br />
Weitere Nachteile: Neue Mitarbeiter zu finden,<br />
kostet Zeit, Geld und Ressourcen. Nach<br />
Angaben der Bundesagentur für Arbeit dauert<br />
es im Schnitt 81 Tage, bis Unternehmen Stellen<br />
mit Fachkräften besetzen können. „Bis jemand<br />
Neues am Arbeitsplatz angekommen,<br />
eingearbeitet ist und die Spielregeln im Unternehmen<br />
kennt, vergehen 12 bis 18 Monate“,<br />
sagt Nink. Den größten Einfluss auf Mitarbeiter<br />
haben Vorgesetzte. Einer Studie zufolge<br />
können 75 Prozent aller Kündigungsgründe<br />
von der direkten Führungskraft beeinflusst<br />
werden. „Es läuft heutzutage am Arbeitsplatz<br />
36
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[führen]<br />
Managementtrainer<br />
Rainer Gerke.<br />
zwar vieles besser,<br />
aber längst noch<br />
nicht alles perfekt.<br />
Mitarbeiter werden<br />
zwar weniger<br />
demotiviert, aber<br />
durch Führungsverhalten<br />
noch<br />
lange nicht zu<br />
Höchstleistung<br />
angespornt“, sagt<br />
Nink.<br />
Viele Arbeitnehmer<br />
steigen hochmotiviert ein, werden zunehmend<br />
desillusioniert und verabschieden<br />
sich irgendwann ganz. Mangelnde Führungsqualitäten<br />
werden so zum Kostenfaktor. Ein<br />
Grund hierfür ist: „Gute Fachkräfte sind nicht<br />
unbedingt gute Führungskräfte“, erklärt<br />
Nink. So sieht es auch der Ulmer Managementtrainer<br />
Rainer Gerke. In vielen Firmen<br />
würden Führungskräfte nach ungeeigneten<br />
Kriterien herausgesucht, etwa weil sie schon<br />
lange im Unternehmen sind. „Mitunter haben<br />
Unternehmenslenker regelrecht Angst, von<br />
außen einzustellen und bevorzugen interne<br />
Lösungen“, sagt Gerke, der lange Personaldirektor<br />
im Stuttgarter Mahle-Konzern war.<br />
„Neue Gedanken regen zur kritischen Betrachtung<br />
der Prozessabläufe an.“ Wichtig sei<br />
auch ein Personalentwicklungsprogramm,<br />
das auf das Unternehmen und seine Größe zugeschnitten<br />
ist. Damit kann eine Firma bei<br />
Bewerbern und den eigenen Mitarbeitern<br />
punkten. Die Grundlagen, um an die richtigen<br />
Mitarbeiter zu kommen und sie zu halten,<br />
sind sinnvolle Arbeit, innovatives Klima, fairer<br />
Dialog, variable Arbeitszeitorganisation<br />
und flexible Arbeitsorganisation.<br />
Ein Riesenthema ist laut Nink auch die in vielen<br />
Unternehmen mangelnde Feedback-Kultur.<br />
Die Devise laute häufig: Nicht geschimpft<br />
ist gelobt genug. Zudem machten sich die<br />
Führungskräfte nicht die Bedürfnisse und Erwartungen<br />
ihrer Mitarbeiter bewusst. Doch<br />
das sei nötig, um gut zu führen. Laut Gerke<br />
solangedauertdie<br />
stellenbesetzung<br />
Firmenkönnenderzeit freie Stellen<br />
schneller besetzen als 2013, doch die<br />
Suche dauert lange. Die durchschnittliche<br />
Vakanzzeit in Tagen (in Klammern<br />
der Vorjahreswert) laut Bundesagentur<br />
für Arbeit: Gesundheits und Pflegeberufe<br />
167 (175). Maschinen und Fahrzeugtechnik<br />
(akad. technische Berufe)<br />
120 (135), IT- und Softwareentwicklung<br />
117 (121), Fachkräfte Automatisierungs-/Elektrotechnik<br />
124 (127), Fachkraft<br />
Energietechnik 115 (116). AMB<br />
tun sich viele Personalchefs schwer, bei Firmenchefs<br />
mit diesen Themen durchzudringen.<br />
Vielleicht hilft da eine Zahl des Gallup-<br />
Instituts: 19 Prozent der Führungskräfte<br />
hatten in den vergangenen Monaten Kontakt<br />
mit einem Headhunter – und 12 Prozent der<br />
Beschäftigten. [!] ALEXANDER BÖGELEIN<br />
GUTE LEUTE MUSS<br />
MAN EBEN HABEN.<br />
apv personal service GmbH / Frauenstraße 2 / 89073 Ulm<br />
0731 14 03 50 / bewerbung@apv-personal.de / www.apv-personal.de<br />
37
Anzeige<br />
Veranstaltungsort der SÜDWEST PRESSE-Vortragreihe: Die Hochschule für angewandte Wissenschaften (HNU) in Neu-Ulm<br />
Foto: HNU<br />
Ich werde besser!<br />
Im Januar 2015 startet die von der SÜDWEST PRESSE veranstaltete achtteilige Vortragsreihe an der Hochschule für<br />
angewandte Wissenschaften in Neu-Ulm. 8 TOP-Referenten, 8 Themen, 8 Mal die Möglichkeit, sich persönlich weiter zu<br />
entwickeln, Erfolge zu sichern und besser zu werden.<br />
Alltag und Beruf stellen immer neuen Anforderungen<br />
– besser, schneller und noch leistungsfähiger<br />
muss man sein, um nach oben zu<br />
klettern. Für viele bedeutet beruflicher Erfolg<br />
auch oft persönlicher Erfolg. Man misst sich<br />
an Stressresistenz, Geduld, Führungsfähigkeiten<br />
– Wettbewerbsfähigkeit ist wichtiger denn<br />
je, auch im persönlichen Bereich.<br />
Doch wie wird man beruflich und persönlich<br />
erfolgreich? Wie wird man besser? Was macht<br />
besser eigentlich aus? Wie wird man wettbewerbsfähig?<br />
Wie verschafft man sich Respekt,<br />
wie motiviert man sich und andere, wie gelingt<br />
es einem, trotz Dauerstress ruhig zu bleiben<br />
und die Dinge strukturiert anzugehen?<br />
MIT SÜDWEST IMPULS –<br />
VORSPRUNg DURcH WISSEN!<br />
Die neue achtteilige Seminarreihe, die von der<br />
SÜDWEST PRESSE an der Hochschule Neu-<br />
Ulm veranstaltet wird, lehrt sie, lässt sie sich<br />
weiterentwickeln und sichert Ihnen neue persönliche<br />
und berufliche Erfolge. Jeder Abend<br />
steht unter einem Motto an dem einer unserer<br />
acht TOP-Experten referiert.<br />
• René Borbonus – Rhetorikspezialist; Der, der<br />
Ihrer Überzeugung Kraft schenkt<br />
• Monika Matschnig – Dipl. Psychologin und<br />
Expertin für Körpersprache, Wirkung & Performance<br />
• Gereon Jörn – Experte für das Menscheln und<br />
für empfängerorientierte Kommunikation<br />
• Sabine Asgodom – Bestsellerautorin und<br />
Fernseh-Coach<br />
• Christian Bischoff – Life-Coach und Sachbuchautor<br />
• Peter Brandl – Berufspilot, Unternehmer,<br />
Autor<br />
• Johannes Warth – Ermutiger und Überlebensberater<br />
• Prof. Dr. Gunter Dueck – Experte für Innovation,<br />
IT, Management und professionelle Bildung<br />
Die Experten aus ganz Deutschland helfen Ihnen<br />
an acht Seminarabenden sehr unterhaltsam<br />
und wissensreich ein besseres Ich zu<br />
werden – respektvoller, authentischer, sozial<br />
kompetenter, gelassener, selbstbewusster,<br />
anmutiger, achtsamer und innovativer!<br />
Buchen Sie jetzt unter www.sprecherhaus.de<br />
Ihre Tickets zum Vorteilspreis und sichern Sie<br />
sich Plätze um mit Vorsprung ins neue Jahr zu<br />
starten – das Jahr das uns alle besser und erfolgreicher<br />
werden lässt.<br />
Als Abonnent der SÜDWEST PRESSE erhalten<br />
Sie bei Buchung bis zum 15. <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
einen Frühbucherrabatt von 44 € auf das<br />
8er-Abo. Sie zahlen nur 299 € statt 343 €.<br />
SÜDWEST PRESSE<br />
38
SÜDWEST IMPULS<br />
VORSPRUNG DURCH WISSEN<br />
WISSENSIMPULSE IN 8 UNTERHALTSAMEN VORTRAGSABENDEN<br />
Seien Sie dabei, wenn die gefragtesten TOP Experten Deutschlands zu Gast in Ulm sind. Die SÜDWEST PRESSE veranstaltet in Kooperation<br />
mit der Agentur SPRECHERHAUS® erstmals eine 8-teilige Seminarreihe für Ihren Vorsprung durch Wissen.<br />
Wir bieten Ihnen gebündeltes Wissen – Seminarwissen verdichtet auf einen 1.5 stündigen Vortragsabend, um Zeit und Kosten zu<br />
sparen. Sie verbringen Vortragsabende mit Wissensimpulsen, Spaß und Geselligkeit. Wir suchen Wissensquellen, die uns weiter<br />
bringen. SÜDWEST IMPULS ist eine wertvolle Quelle für Ulm und die Region. Wir wünschen allen Teilnehmern wissensreiche<br />
Vortrags stunden und zahlreiche Erfolgserlebnisse bei der Anwendung des Wissens!<br />
Veranstaltungort:<br />
HNU – Hochschule für Angewandte Wissenschaften<br />
Wileystraße 1, 89231 Neu-Ulm<br />
Einzelkarte 59,– € 49,– €*<br />
8er-Abo 413,– € 343,– €*<br />
Sie erhalten eine steuerfähige Rechnung für Ihre Weiterbildung.<br />
*Vorteilspreis als Abonnent der SÜDWEST PRESSE „abomax“<br />
Jeweils donnerstags von 19.30 bis 21.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).<br />
Infos und Buchung: www.sprecherhaus.de oder rufen Sie unser Kundentelefon an: +49 (0) 2561 69565-170<br />
1<br />
2 3<br />
4<br />
29.01.2015 | René Borbonus<br />
Respekt!<br />
Ansehen gewinnen bei Freund und<br />
Feind<br />
26.02.2015 | Monika Matschnig 26.03.2015 | Gereon Jörn<br />
Wirkung<br />
Authentizität, Souveränität,<br />
Präsenz<br />
Gewinne die Menschen!<br />
Sie erfahren, wie Sie selbst und<br />
andere ticken.<br />
23.04.2015 | Sabine Asgodom<br />
Die zwölf Schlüssel<br />
zur Gelassenheit<br />
Energie und Lebensfreude steigern<br />
„ Um Spuren zu hinterlassen braucht man<br />
ein Profil!“<br />
„ Es gibt 6000 verschiedene Sprachen.<br />
Aber nur eine Sprache die alle Menschen<br />
verbindet: die KÖRPERSPRACHE.“<br />
„ Menschen lieben Menschen, welche so sind<br />
wie Sie selbst, oder so, wie sie selbst gern<br />
sein möchten.“<br />
„ Gelassenheit brauchen alle – Frau, Mann,<br />
jung, alt, angestellt, selbstständig oder<br />
im Unruhestand!“<br />
5 6 7<br />
8<br />
© CommonLense.de<br />
24.09.2015 | Christian Bischoff 22.10.2015 | Peter Brandl 19.11.2015 | Johannes Warth<br />
17.12.2015 | Prof. Dr. Gunter Dueck<br />
Selbstvertrauen<br />
Die Kunst, Dein Ding zu machen<br />
Hurricane Management<br />
Führen in stürmischen Zeiten<br />
Achtsamkeit –<br />
oder was ERFOLGt daraus?<br />
Das Neue und seine Feinde<br />
Innovationen voranbringen<br />
„ Jeder Meister seines Fachs hat eines Tages<br />
als totale Katastrophe angefangen.“<br />
„ Menschen versagen nicht, sie funktionieren<br />
– man sollte nur wissen wie!“<br />
„ Nur wer selbst brennt kann andere<br />
entzünden!“<br />
(Irgendein Brenner)<br />
„ Innovation heute ist wie Wollen, Wandel<br />
morgen ist wie Müssen“
[machen] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Lisa,ThomasundderKesselNr.2<br />
Chips sind nicht gleich Chips. Ganz besondere kommen aus zwei großen Kesseln im oberschwäbischen Amtzell – von<br />
der AromaSnacksGmbH&Co. Und das auch noch ganz in Bio.<br />
Umgeben von Feldern, auf denen Rollrasen<br />
produziert wird, steht das Gebäude<br />
der Aroma Snacks GmbH & Co. KG.<br />
Geschäftsführender Gesellschafter ist Jochen<br />
Krumm. Der 44-Jährige hat eine Produktion<br />
für Kesselchips in Bio-Qualität aufgebaut. Dabei<br />
hat er zur rechten Zeit eine Marktlücke<br />
entdeckt. Inzwischen produziert Krumm mit<br />
20 Mitarbeitern einerseits sein eigenes Produkt,<br />
das er nach seiner Frau „Lisa‘s Kartoffelchips“<br />
nannte. Diese stellt er ausschließlich in<br />
Bioqualität her. Andererseits produziert er für<br />
die Eigenmarken großer Handelsketten – sowohl<br />
konventionell als auch in Bioqualität.<br />
Gerade während der Fußball-Weltmeisterschaft<br />
hatte der Mittelständler viel zu tun,<br />
weil der Handel bei solchen Großereignissen<br />
mehr Verkaufsflächen für Knabberartikel zur<br />
Verfügung stellt.Das freut Krumm natürlich,<br />
dessen Familien<strong>unternehmen</strong> im vergangenen<br />
Jahr deutlich mehr als 2 Millionen Euro<br />
Umsatz erzielen konnte.<br />
Krumm, der aus Ravensburg stammt, hat eine<br />
ungewöhnliche Biografie. Nach seiner Schulzeit<br />
macht er zunächst eine Banklehre. „Dort<br />
habe ich mich nicht wohlgefühlt.“ Also zieht<br />
es den jungen Mann nicht lange nach dem Abschluss<br />
nach Südafrika. Dort absolviert er eine<br />
weitere Ausbildung -– als Koch und als<br />
Konditor. In Kapstadt betreibt er zehn Jahre<br />
lang ein deutsches Restaurant und Café mit<br />
allem, was dazugehört wie Schwarzwälder<br />
Kirschtorte oder Brezeln, berichtet der zweifache<br />
Familienvater.<br />
Der Kinder wegen zog es Krumm und seine<br />
Frau Anfang des neuen Jahrtausends wieder<br />
zurück in die oberschwäbische Heimat. Er<br />
heuert bei einem Würzmittel- und Aromenhersteller<br />
an, ist unter anderem für den englischen<br />
Markt zuständig. Bei seinen Besuchen<br />
in Großbritannien entdeckt er zum ersten Mal<br />
Kesselchips. Anders als normale Chips sind<br />
sie nicht aus einer Breimasse hergestellt und<br />
dann gepresst. Hier werden die Kartoffeln in<br />
etwas dickere Scheiben geschnitten und dann<br />
in Sonnenblumenöl frittiert. So arbeitet<br />
Krumm. „Im Sommer sind die Chips etwas<br />
heller, weil die Kartoffeln frisch vom Feld<br />
kommen“, erläutert der Unternehmer.<br />
SoKLAppT‘SAuCHimHANdeL<br />
Bis die Produktion in Amtzell anläuft, vergeht<br />
aber noch eine ganze Weile. Doch das Thema<br />
Kesselchips hat ihn gepackt. Er lässt eine Verpackung<br />
entwerfen und versucht sein Glück.<br />
Er will ausprobieren, ob es in Deutschland einen<br />
Markt für Kesselchips aus England gibt.<br />
Von 2005 an vertreibt er zunächst die kleinen<br />
in England abgefüllten Beutel an Hotels und<br />
Gaststätten. „Wenn man in der Gastronomie<br />
Fuß fasst, ist das ein guter Indikator dafür, dass<br />
Waschen, schneiden, frittieren. Auch im Schneiden<br />
liegt der Unterschied zu normalen Chips: Die<br />
werden aus einer Art Brei gepresst.<br />
40
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[machen]<br />
es auch im Handel klappen könnte.“ Einige<br />
Jahre beobachtet er, wie sich das Geschäft entwickelt.<br />
2011 schließlich macht er sich selbstständig<br />
und zieht eine eigene Produktion auf.<br />
Er holt die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft<br />
Baden-Württemberg (MBG) mit ins<br />
Boot. Sie hält eine stille Beteiligung an dem<br />
Unternehmen. Dies gilt als Eigenkapital.<br />
GeHeimNiSSeAuSAmeriKA<br />
Knapp 4 Millionen Euro investiert der Schwabe<br />
in Gebäude, Förderbänder und Maschinen.<br />
Mit der Finanzierung habe er keine Probleme<br />
gehabt. Ein Grund für die positiven Gespräche<br />
sei sicherlich auch die schon vorhandene<br />
positive Historie gewesen. Während des Baus<br />
der Produktionsstätte im Jahr 2011 geht<br />
Krumm mit seinem Betriebsleiter bei Maschinenherstellern<br />
in Amerika in die Lehre, um<br />
sich in die Geheimnisse des Kesselchipskochens<br />
einweihen zu lassen. Die zwei riesigen<br />
Kessel in der Fabrik sind das Herzstück der<br />
Produktion. Um die Qualität sicherzustellen,<br />
wird nur in Chargen<br />
von 50 Kilo<br />
produziert. Nach<br />
dem Waschen werden<br />
die Kartoffeln<br />
angeraut und dann<br />
maschinell in<br />
Scheiben geschnitten.<br />
Über ein Förderband<br />
gelangen<br />
sie in einen der beiden<br />
Stahlbehälter, Chips-Fan Jochen Krumm.<br />
Geschäftsführer und<br />
der 3000 Liter Sonnenblumenöl<br />
fasst. Mit einem großen Paddel<br />
bewegt ein Mitarbeiter die Chips hin und her.<br />
Sieben Minuten, dann sind sie goldbraun. Der<br />
Namen des zuständigen Mitarbeiters ist auf<br />
der Chipspackung aufgedruckt. „Gekocht von<br />
Thomas in Kessel Nummer 2.“ Das schaffe<br />
Vertrauen beim Verbraucher.<br />
Bei Krumm kommt vor allem Bioland-Qualität<br />
in die Tüte. Die Kartoffeln stammen von<br />
Bauern aus der Region. Vor dem Würzen werden<br />
die Chips von Hand verlesen, verkochen<br />
Scheiben aussortiert. „Die Mitarbeiter haben<br />
ein besseres Auge als jede Maschine“, ist<br />
Krumm überzeugt. Bei den Gewürzmischungen<br />
seien Geschmacksverstärker sowie Farboder<br />
Konservierungsstoffe tabu.<br />
uNTerderWASSerLiNie<br />
Der Unternehmer bietet seine Marke in vier<br />
Geschmacksrichtungen an. In Deutschland<br />
sei auf dem Markt der Paprika-Geschmack<br />
vorherrschend, in Italien besonders die Meersalz-Variante.<br />
Der mediterrane Geschmack sei<br />
im Kommen. Der Exportanteil des Unternehmens<br />
beträgt 30 Prozent. „Wir haben keine<br />
Angst vor dem Export“, sagt der Unternehmer,<br />
der auch schon Abnehmer in Südostasien<br />
beliefert. Wichtig: Der Container mit den<br />
Chips müsse unterhalb der Wasserlinie in<br />
dem Schiff verstaut sein – Sonne würde ihnen<br />
schaden. In Deutschland gibt es Lisa‘s<br />
Chips in Bioläden und zunehmend im Einzelhandel.[!]<br />
Oliver Schmale<br />
Visionen Gestalt geben<br />
Anzeige<br />
Um Design kommt niemand herum. Es ist längst ein Erfolgsfaktor geworden.<br />
Gestaltung und damit Kundenakzeptanz entscheidet über die Zukunft. Schon<br />
unterschwellige Kleinigkeiten geben bei der Einprägsamkeit den Ausschlag.<br />
Erfahrung und Kontinuität spielen im Bereich<br />
der Außendarstellung eine maßgebliche Rolle.<br />
eisele.kuberg.design entwickelt seit rund 25<br />
Jahren stimmige Konzepte, sucht ein ausgewogenes<br />
Verhältnis zwischen Funktion und Emotion,<br />
setzt Ideen pragmatisch um, optimiert<br />
den Materialeinsatz und verbindet technische<br />
Anforderungen mit überzeugender Usability.<br />
„Gestaltung ist unsere Passion“, sagen Frank<br />
Eisele und Heike Kuberg. Ihr sechsköpfiges<br />
kreatives Kernteam wird nach Bedarf projektorientiert<br />
erweitert. Zuverlässige Schnelligkeit<br />
gehört neben absoluter Präzision und ständig<br />
aktuellem Know-how zu den Kompetenzen.<br />
eisele.kuberg.design analysiert Markt, Wettbewerb<br />
und Zielgruppen, erkennt Trends, formuliert<br />
Visionen und entwickelt in direkter<br />
Abstimmung mit den Entscheidungsträgern<br />
Designstrategien für die Zukunft. Dabei reicht<br />
der Kundenkreis vom Weltkonzern bis zum<br />
Klein<strong>unternehmen</strong>. Ob Industrie-, Kommunikations-<br />
oder Corporate-Design – eisele.kuberg.design<br />
simuliert und visualisiert Produktkonzepte<br />
fotorealistisch und setzt diese in<br />
reale Produkte um, die auf Dauer von vielen<br />
Tausend Menschen benutzt werden. „Virtuelle<br />
Modelle machen sichere Entscheidungen kostengünstig.<br />
Ideen und Produktkonzepte werden<br />
visuell erleb- und einschätzbar“, erklären<br />
die beiden diplomierten Designer.<br />
Oderstraße 1 · 89231 Neu-Ulm<br />
www.eiselekubergdesign.de<br />
41
Ein Radar mit einer Reichweite von 250 Metern, Nahbereichsensor bis 70 Meter und diverse Kameras zur Identifikation von Fußgängern und Hindernissen<br />
sowie viel Technik machen aus diesem Actros-Modell von Mercedes den Lkw der Zukunft.<br />
Fahren muss der Fahrer nicht<br />
Windschnittige Brummis mit Spoilern brausen selbstgesteuert über die Autobahnen und warnen sich gegenseitig vor<br />
Staus. Ein futuristisches Szenario? Mitnichten. Denn der autonome Lkw wird kommen. Und zwar in naher Zukunft.<br />
Von außen betrachtet sieht alles ganz<br />
normal aus. Der Lastwagen schnurrt<br />
mit einer Geschwindigkeit von 80<br />
Stundenkilometern über die Autobahn, fährt<br />
nicht zu nahe auf den Vordermann auf, lässt<br />
sich nicht zu weit zurückfallen. Bei einem<br />
Blick ins Cockpit erkennt man, dass sich das<br />
Steuerrad wie von Geisterhand bewegt, während<br />
sich der Fahrer genüsslich zurücklehnt<br />
und seine Unterlagen studiert.<br />
Bei so einer Szene läuft es wohl vielen kalt den<br />
Rücken hinunter. Nicht so Dr. Micha Alexander<br />
Lege. Der Geschäftsführer der Spedition<br />
Wiedmann & Winz GmbH in Geislingen ist<br />
vom Mercedes Benz Future Truck 2025 begeistert.<br />
Denn der autonom fahrende Lkw, den der<br />
Stuttgarter Konzern diesen Sommer auf einem<br />
Teilstück der A14 bei Magdeburg präsentiert<br />
hat, ist für ihn die Zukunft: „Mit diesem<br />
Lkw kann man<br />
den Fahrerarbeitsplatz<br />
effizienter<br />
gestalten, da der<br />
Chauffeur bereits<br />
während der Fahrt<br />
mit der nächsten<br />
Abladestation<br />
kommunizieren<br />
oder sich einen<br />
Parkplatz an der Spediteur Dr. Micha<br />
Raststelle reservieren<br />
kann.“<br />
Alexander Lege<br />
Möglich wird dies durch moderne Telematik<br />
sowie die intelligente Vernetzung aller bereits<br />
existierender Sicherheitssysteme, die zum<br />
Beispiel automatisch und permanent einen<br />
gebührenden Abstand zum Vordermann oder<br />
auch zum Fahrbahnrand kontrollieren und<br />
einhalten – durch Kameras, Radarsensoren<br />
und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen<br />
den Fahrzeugen. Die Brummis der Zukunft<br />
sprechen miteinander, und nicht mehr<br />
die Fahrer. Für den Geschäftsführer ist der<br />
Zukunfts-Truck, wenn er denn bis 2025<br />
kommt, fast schon revolutionär. Er ist für ihn<br />
nicht nur aus Effizienzgründen ein Muss, sondern<br />
auch aus wirtschaftlichen Gründen.<br />
„Wenn alle mitmachen, kann man mit autonom<br />
fahrenden Lkws sogar die unliebsamen<br />
Elefantenrennen verhindern. Aber vor allem<br />
kann man mit ihnen wieder neue Fahrer gewinnen.“<br />
Denn die Suche nach geeignetem<br />
Führerhaus-Personal gestaltet sich seit Jahren<br />
schwierig: „Unregelmäßige Arbeitszeiten und<br />
das schlechte Image des Berufsbilds Trucker<br />
tragen dazu bei. Deshalb ist eine attraktive<br />
Ausstattung des rollenden Arbeitsplatzes<br />
42
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[bewegen]<br />
Der Autopilot manövriert den Lkw, das gibt dem Fahrer Zeit für die Feinabstimmung seiner Tour.<br />
wichtig. Komfort und Ergonomie werden sich<br />
weiter steigern und auch steigern müssen.“<br />
So sieht das auch Andrea Marongiu: „Die Kabine<br />
eines Lkw wird bald schon so gemütlich<br />
wie ein Wohnzimmer sein.“ Auch der Geschäftsführer<br />
des Verbandes Spedition und<br />
Logistik Baden-Württemberg e.V. (VSL) weiß,<br />
dass die Entwicklung der Lastwagen in den<br />
kommenden Jahren noch viele weitere Stufen<br />
durchlaufen wird: „Die Sicherheit für die Fahrer<br />
und die anderen Verkehrsteilnehmer wird<br />
sich noch weiter erhöhen. Integrierte Systeme<br />
zur Abstandsregelmessung werden bald alle<br />
Fahrzeuge in sich haben.“<br />
Lege schätzt besonders die Fortschritte in der<br />
Telematik. Speziell die Fahrzeug-Managementsysteme,<br />
mit denen Flottenbesitzer die<br />
Logistik der Transporte steuern können, haben<br />
sich für den international agierenden Spediteur<br />
bis heute sehr gut entwickelt: „In Zukunft<br />
werden diese Systeme noch feinere<br />
Auswertungen der Lkws auf der Straße übermitteln,<br />
so dass wir die Fahrer noch besser von<br />
der Zentrale aus coachen können.“<br />
Man könnte fast sagen: Nichts ist unmöglich.<br />
So ist auch die 360 Grad-Kamera, mit der der<br />
Fahrer vom Cockpit aus alle Seiten des Fahrzeuges<br />
überwachen kann, längst keine Utopie<br />
mehr. Lege: „Das ist eine sehr wichtige Hilfe<br />
für unsere Fahrer, denn eine Vielzahl an Unfällen,<br />
die viel Geld verschlingen, passieren<br />
beim Rangieren und eben nicht auf den Autobahnen.“<br />
nichts ist unmÖgLich<br />
Um den Lkw fit für die Zukunft zu machen,<br />
müssen Ingenieure, Spediteure und Logistiker<br />
noch andere Aufgaben meistern. Die gesetzlich<br />
vorgeschriebenen Euro-6-Motoren<br />
mit deutlich verbesserter Abgasrückgewinnung<br />
spielen bereits eine große Rolle, die Umwelt<br />
und Betriebskasse entlasten. „Wenn man<br />
livekonzepte Michael Köstner
[bewegen] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
bei einem Dieselbedarf von 3 Millionen Litern<br />
im Jahr den Kraftstoffverbrauch um zehn Prozent<br />
senken kann, ist dies ein enormes Einsparpotenzial.<br />
Heute verbrauchen unsere<br />
Lkw noch bis zu 26 Liter auf 100 Kilometer.<br />
Das ist bereits ein hervorragender Schnitt,<br />
doch da ist noch mehr drin“, sagt Speditionschef<br />
Lege. Für den Unternehmer, der tagtäglich<br />
bis zu 150 Fahrzeuge auf die Straße<br />
schickt, gibt es aber noch andere Stellschrauben,<br />
damit die Brummis nicht mehr so oft an<br />
die Zapfsäulen müssen. Dazu zählen unter anderem<br />
Reifen mit optimiertem Rollwiderstand:<br />
„Hier gibt es in den Bereichen Profil<br />
und Gummimischung noch erhebliche Unterschiede<br />
und Verbesserungspotenzial.“ Dazu<br />
gehört für ihn auch das System der elektrischen<br />
Reifendruckkontrolle, die dem Fahrer<br />
automatisch im Display des Cockpits anzeigt,<br />
wenn ein Rad Luft verliert und damit den<br />
Kraftstoffverbrauch nach oben treibt: „Im<br />
Lkw der Zukunft wird sich bei einem Luftabfall<br />
der Reifen von selbst wieder aufpumpen.<br />
ReiFen pumpt sich seLbst auF<br />
Auch Matthias Wissmann, Präsident des Verbands<br />
der Automobilindustrie, hält die weitere<br />
Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und<br />
damit der CO2-Emissionen für die zentrale<br />
Herausforderung: „Allerdings sind schwere<br />
Nutzfahrzeuge nicht vergleichbar mit Pkw<br />
und Transportern, für die es bereits EU-weite<br />
CO2-Regulierungen gibt. Die Nutzfahrzeugbranche<br />
ist wie eine Fußballmannschaft. Es<br />
gibt nicht nur Abwehrspieler, sondern auch<br />
ein Mittelfeld und Stürmer. Beim schweren<br />
Lkw ist die Variantenvielfalt<br />
der<br />
Fahrzeuge so groß,<br />
dass es keinen<br />
CO2-Einheitswert<br />
geben kann“, betonte<br />
Wissmann<br />
im Vorfeld der IAA<br />
Nutzfahrzeuge in<br />
Hannover: „Die<br />
Bandbreite reicht<br />
vom Baustellenkipper<br />
über Liefer-<br />
Matthias Wissmann<br />
VDA-Präsident<br />
fahrzeuge bis zum<br />
Fernverkehrs-Lkw.“<br />
Mit Blick auf die weltweit größte Nutzfahrzeugschau<br />
sprach sich Wissmann für größere<br />
Flexibilität bei den Fahrzeugabmessungen sowie<br />
für mehr Aerodynamik und zusätzlichen<br />
Bauraum für alternative Antriebe aus: „Auch<br />
traum oder wirklichkeit: Lastwagen am bande<br />
die ideen, wie man das Speditionsgewerbe<br />
für die Zukunft fit machen kann, sind<br />
so vielseitig wie die Güter, die auf den Ladeflächen<br />
der Lkw über unsere Straßen<br />
transportiert werden. Dies gilt nicht nur<br />
für Deutschland und Europa. Auch in den<br />
USA sind Ingenieure, Hersteller und Logistiker<br />
kräftig am tüfteln. So werden in<br />
der Nähe der stark frequentierten Häfen<br />
damit können wir CO2-Emissionen senken.“<br />
Und er wirbt für den Lang-Lkw. Der sei ein<br />
wichtiges Instrument für mehr Effizienz und<br />
Klimaschutz. Schon heute zeige der Feldversuch,<br />
wie mit vergleichsweise einfachen Mitteln<br />
die Kapazität des Straßengüterverkehrs<br />
erhöht werden kann.<br />
es wiRd nicht dunkeL<br />
Auch für Andrea Marongiu ist die überlange<br />
Lkw-Kombination, bei der an den Aufliegern<br />
ein langer Anhänger angekoppelt wird, ein<br />
Schritt in die richtige Richtung. Umfassende<br />
Ladungen können auf diese Weise von drei<br />
Lastwagen auf nur zwei Fahrzeuge verteilt<br />
werden. Dennoch müssten sich deutsche Autofahrer<br />
keine Sorgen machen, dass es nun<br />
bald dunkel wird auf unseren Straßen, da<br />
schier endlos lange Straßen-Züge an ihnen<br />
vorbeidonnern. Roadtrains wird es auch weiterhin<br />
nur in Australien geben: „Der getestete<br />
Lang-Lkw misst höchstens 25,25 Meter.“ Der<br />
VSL-Geschäftsführer bedauert es, dass sich einige<br />
Bundesländer dem obengenannten Versuch<br />
nicht anschließen, darunter auch Bayern<br />
von Los Angeles und Long Beach zu Testzwecken<br />
Autobahnen mit Oberleitungssystemen<br />
für schwere Lkw eingerichtet.<br />
Ist dies auch bei uns vorstellbar? „Warum<br />
nicht?“, fragt Andrea Marongiu vom Verband<br />
Spedition und Logistik Baden-Württemberg<br />
e.V. (VSL): „Die Technik für das<br />
Projekt in Kalifornien stammt jedenfalls<br />
aus Deutschland.“<br />
loe<br />
und Baden-Württemberg: „Man sollte es einfach<br />
versuchen und nicht grundsätzlich ablehnen.<br />
Die Testfahrten mit dem Lang-Lkw<br />
finden ja nicht in den Städten, sondern ausschließlich<br />
auf Langstrecken statt.“ Mittlerweile<br />
fahren im Rahmen des Feldversuchs 79<br />
Fahrzeuge auf festgelegten Routen. Nach Einschätzung<br />
des VDA zeigen die bisherigen Erfahrungen,<br />
dass der Lang-Lkw die Erwartungen<br />
erfülle: „Weniger Fahrten, weniger<br />
Spritverbrauch und damit auch weniger CO2-<br />
Emissionen.“<br />
Ob stromlinienförmige Fahrerhäuser in<br />
Leichtbauweise oder schnittige Heckspoiler<br />
am Trailer. Die Ingenieure der Nutzfahrzeug-<br />
Hersteller haben noch viele Ideen in ihren<br />
Schubladen, wie der Lkw in Zukunft attraktiver<br />
werden und vor allem wettbewerbsfähig<br />
bleiben kann – für die Spediteure und natürlich<br />
auch die Brummifahrer. Für sie wird es<br />
interessant bleiben, sich umfassend über die<br />
neuesten Entwicklungen in der Branche zu<br />
informieren. In der Pause am Rastplatz oder<br />
eben auch während der Fahrt. [!]<br />
stefan loeffler<br />
44
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[bewegen]<br />
Franz Krieglsteiner von Evobus machte nie ein Geheimnis aus seinen Ideen.<br />
mit „Rotem bus“ in Rente:<br />
ein Visionär fährt ab<br />
Panoroma-Dächer in Reisebussen, mehr Beinfreiheit durch versetzte Sitze<br />
und die Zielangabe in der Windschutzscheibe: Omnibus-Entwickler<br />
Franz krieglsteiner hat mit seinen Ideen 40 Jahre lang die Branche geprägt.<br />
Wir gestalten mit<br />
Franz Krieglsteiner sitzt an seinem<br />
Schreibtisch und fühlt sich pudelwohl.<br />
Dabei sieht er sich selbst als Mitglied einer<br />
aussterbenden Spezies. „Heutzutage ist es<br />
gang und gäbe, dass man in Unternehmen<br />
nach fünf Jahren neue Aufgaben übernimmt“,<br />
erklärt der langjährige Leiter des Entwicklungs-<br />
und Konstruktionsbereiches „Innenraum/Ausstattung<br />
Reisebusse und Kundensonderwünsche<br />
Gesamtfahrzeug“ der<br />
Neu-Ulmer Evobus GmbH. Er ist seinem Spezialgebiet<br />
jedoch seit 40 Jahren treu geblieben.<br />
Dafür konnte der Illerkirchberger nun einen<br />
Preis entgegennehmen, den es in dieser Form<br />
noch nie gegeben hat. Der Busprofi mit Leib<br />
und Seele wurde vom Internationalen Bustouristikverband<br />
RDA in Köln mit dem Innovations-<br />
und Marketing-Sonderpreis „Roter Bus“<br />
für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Glastrophäe<br />
und Urkunde zieren nun sein Büro im<br />
Evobus-Entwicklungsgebäude in Neu-Ulm.<br />
Von hier aus drückt Franz Krieglsteiner mit<br />
seinen Mitarbeitern den aktuellen Reisebus-<br />
Generationen von Setra und Mercedes-Benz<br />
seinen Stempel auf. Dazu zählen unter anderem<br />
das große Glasdach, das den Reisenden<br />
eine Panoramasicht vermittelt oder auch die<br />
Idee einer versetzt angeordneten Bestuhlung,<br />
die dafür sorgt, dass sich die Fahrgäste auf ihren<br />
Reisen durch ganz Europa lang und breit<br />
mediaservice ulm<br />
www.mediaservice-ulm.de<br />
SÜDWEST PRESSE<br />
45
[bewegen] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Die Serie 200 ist die erfolgreichste Baureihe der Omnisbusmarke Setra. Das Bild rechts zeigt Bus-Entwickler Franz Krieglsteiner mit Designleiter Matthias<br />
Lenz. So nackt sieht der Abschnitt eines Busses aus, bevor es an die Gestaltung des Innenraumes geht.<br />
machen können. Franz Krieglsteiner: „Viel<br />
Bein- und Schulterfreiheit auf einem bequemen<br />
Reisesitz – das ist das, was Busreisende<br />
heute unter anderem erwarten. Alles, was derzeit<br />
in Sachen Komfort und Technik möglich<br />
ist, haben wir in die Setra-Baureihe 500 einfließen<br />
lassen.“<br />
komFoRt aLLein Reicht nicht<br />
Doch Reisebusse müssen nicht nur komfortabel<br />
sein, sondern auch die Aspekte Design,<br />
Praxistauglichkeit und sogar Emotionen in<br />
sich vereinen. Jeder Typ muss sich seinen<br />
Platz in der Branche erobern und Busunternehmer<br />
und Fahrgäste auf Anhieb überzeugen.<br />
Der gelernte Karosserie- und Fahrzeugbau-Techniker,<br />
der 1972 beim Ulmer Busbauer<br />
Kässbohrer als technischer Zeichner angefangen<br />
hat, prägte mit seiner Arbeit maßgeblich<br />
die Entwicklung von Reisebussen in den vergangenen<br />
vier Jahrzehnten. Mit Herz und Verstand.<br />
Er war es, der 1972 den Grundrahmen<br />
des S 200 skizzierte, dem Vorläufer der Baureihe<br />
200, die man heute getrost als legendär bezeichnen<br />
kann. Bis heute ist sie die erfolgreichste<br />
Serie der Omnibusmarke Setra, die<br />
seit 1995 zur Stuttgarter Daimler AG gehört.<br />
Die Fertigung der Baureihe 200 führte in den<br />
70er und 80er Jahren in der Region Ulm/Neu-<br />
Ulm zu einem wahren Einstellungsboom. Mit<br />
insgesamt 27.680 Einheiten, von 1976 bis<br />
1991 gebaut, übertraf sie die Verkaufszahlen<br />
der Vorgängerreihe um 150 Prozent. Sie trug<br />
zu großen Teilen zu dem bis heute ungebremsten<br />
Erfolg der selbsttragenden Busse<br />
bei, die in den 50er Jahren von dem Ulmer Ingenieur<br />
Otto Kässbohrer zur Serienreife entwickelt<br />
worden sind.<br />
Franz Krieglsteiner war es auch, der bei<br />
Linien bussen die Fahrtzielanzeige erstmals<br />
hinter der Windschutzscheibe integrierte.<br />
Wer kann sich heute noch etwas anderes vorstellen?<br />
So sah das auch RDA-Präsident Richard<br />
Eberhardt,<br />
der bei der Preisverleihung<br />
in Köln<br />
sagte: „Seit der legendären<br />
Baureihe<br />
200 aus dem Hause<br />
Kässbohrer sind<br />
zahlreiche Innovationen<br />
aus dem<br />
Zuständigkeitsbereich<br />
von Franz<br />
Krieglsteiner in RDA-Präsident Richard<br />
den Bau moderner Eberhardt<br />
Busse eingeflossen.<br />
Diese zeichnen nicht nur die aktuellen<br />
Produkte von Daimler aus, einige davon haben<br />
in der Busindustrie insgesamt Verwendung<br />
und Anerkennung gefunden.“<br />
oFFen FÜR anRegungen<br />
Ehre, wem Ehre gebührt. Der 60-Jährige ist<br />
nicht nur erfolgreich, sondern vor allem bei<br />
vielen Busunternehmern von Italien bis nach<br />
Norwegen äußerst beliebt, da er stets ein offenes<br />
Ohr für deren Wünsche und Anforderungen<br />
hat. Franz Krieglsteiner ließ sich immer<br />
ganz bewusst in die Karten blicken, neben den<br />
Kunden auch von Lieferanten, Forschern und<br />
Fahrgästen. „Nur wenn man mit Kunden frühzeitig<br />
zu neuen Themen ins Gespräch kommt<br />
und herausfindet, wo der Schuh drückt, erreicht<br />
man sein Ziel auf die beste Art“, lautet<br />
die Philosophie des Preisträgers, der sich in<br />
ein formidables Netzwerk aufgebaut hat: „Ohne<br />
eine gute Mannschaft im Hintergrund, die<br />
die Ideen in die Realität umsetzt, nutzt jedoch<br />
die ganze Kreativität nichts. Und am Schluss<br />
muss man neben der entsprechenden Position<br />
im Unternehmen auch das Durchsetzungsvermögen<br />
besitzen, die angestoßenen Projekte<br />
im Haus umzusetzen.“<br />
Dies werden nun bald andere tun, denn im<br />
<strong>Oktober</strong> geht Franz Krieglsteiner in den Ruhestand.<br />
Einen Blick in die Zukunft der Omnibusse<br />
wagt er schon heute: „Das Ambiente eines<br />
Busses wird sich in den kommenden<br />
Jahren noch mehr den modernen Kommunikationsansprüchen<br />
der Fahrgäste anpassen<br />
müssen.“ Vielleicht, so der Entwickler, wird es<br />
in ein paar Jahren gar keine Seitenverglasung<br />
mehr geben, da die Scheiben lieber als Projektionsfläche<br />
für Filme genutzt werden und die<br />
Reisenden sowieso kein Interesse mehr haben,<br />
vorbeiziehende Landschaften zu betrachten.<br />
Reine Utopie? Nicht für Franz Krieglsteiner:<br />
„Man muss die eigenen Visionen immer<br />
wieder mit dem Zeitgeist abgleichen.“<br />
Vorstellen konnte sich Franz Krieglsteiner<br />
schon viel. Wenn auch vielleicht nicht, dass<br />
er als Entwickler einmal mit einem Marketingpreis<br />
für sein Lebenswerk ausgezeichnet<br />
wird. [!]<br />
stefan loeffler<br />
46
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[namen & nachrichten]<br />
Zu-präsident Jansen geht vorzeitig<br />
Hat sein Amt vorzeitig<br />
aufgegeben:<br />
Stephan Jansen.<br />
Die Zeppelin-Universität (ZU)<br />
hat ihren Gründungs-Präsidenten<br />
früher als geplant verloren.<br />
Stephan Jansen, der sein Ausscheiden<br />
für<br />
das nächste<br />
Jahr angekündigt<br />
hatte,<br />
legte sein<br />
Amt als Präsident<br />
nach elf<br />
Jahren nieder.<br />
Der 43-Jährige<br />
hatte die<br />
ZU mitgegründet.<br />
Bereits<br />
die Kündigung des Kanzlers<br />
Niels Helle-Meyer im August<br />
nach nur anderthalb Jahren hatte<br />
in Kreisen von Mitarbeitern, Professoren<br />
und der 1200 Studenten<br />
Unmut und Protest ausgelöst.<br />
Der Vorstandsvorsitzende der<br />
ZU-Stiftung, Werner Allgöwer,<br />
im Hauptberuf Vorstandschef der<br />
Sparkasse Bodensee, rechtfertigte<br />
die Entscheidung mit den Worten,<br />
Mitarbeiter und Studenten<br />
könnten die Arbeit Helle-Meyers<br />
gegenüber den Gesellschaftern<br />
nicht beurteilen.<br />
Nach Helle-Meyers Kündigung<br />
folgte der nächste Paukenschlag:<br />
Ein Schreiben aus Kreisen der ZF<br />
Friedrichshafen, einem der wichtigsten<br />
Geldgeber der ZU, gelangte<br />
an die Öffentlichkeit. Darin<br />
wird die Ausgabenpolitik der ZU<br />
scharf kritisiert. Zudem werfen<br />
Insider der ZU vor, Provisionen<br />
fürs Einwerben von Forschungsund<br />
Fördergeldern bezahlt zu haben<br />
– ohne Kenntnis der jeweiligen<br />
Förderer. Die Uni bestätigt<br />
das: Seit der Gründung 2003 bestehe<br />
ein leistungsbezogenes Vergütungssystem.<br />
Das sei in Zusätzen<br />
der Arbeitsverträge von<br />
Professoren und „einnahmeorientierten“<br />
Mitarbeitern geregelt.<br />
Die Zulagen betrügen in der Regel<br />
fünf Prozent auf private Spenden<br />
und Förderungen. Zuletzt<br />
hätten 25 Kollegen solche Bezüge<br />
erzielt, darunter auch Jansen. Das<br />
Vergütungsmodell berücksichtige<br />
nur eingeworbene private<br />
Drittmittel, zum Beispiel Stiftungslehrstühle.<br />
Ausgenommen<br />
seien Groß-Förderungen an die<br />
Stiftung. Der Umgang mit Drittmitteln<br />
an Privathochschulen ist<br />
gesetzlich nicht geregelt. [!] HaM<br />
weishaupt<br />
investiert<br />
Der Hersteller von Brennern,<br />
Wärmepumpen und Solartechnik,<br />
Weishaupt, hat an seinem<br />
Hauptsitz in Schwendi (Kreis Biberach)<br />
rund 15 Millionen Euro<br />
in sein Forschungs- und Entwicklungszentrum<br />
investiert. Auf<br />
dem Werksgelände entstanden<br />
zwei neue, moderne Gebäudekomplexe.<br />
Hintergrund ist der<br />
Ausbau der Produktpalette. Das<br />
Familien<strong>unternehmen</strong> beschäftigt<br />
in dem Forschungszentrum<br />
rund 100 Mitarbeiter. Insgesamt<br />
sind es am Hauptsitz rund 1000,<br />
weltweit mehr als 3000. Die<br />
Weishaupt-Gruppe erzielte im<br />
vergangenen Jahr einen Umsatz<br />
von 540 Millionen Euro. [!] ref<br />
Privatpraxis<br />
Beate Trautmann<br />
Fachärztin für Frauenheilkunde und<br />
Geburtshilfe<br />
Diplom-Psychologin<br />
Naturheilverfahren, Akupunktur<br />
. . . auch für Männer.<br />
Magirus-Deutz-Str. 7, 89077 Ulm<br />
Tel. 0731 / 6 027 027 7<br />
sprechzeiten:<br />
Mo Di Mi Fr<br />
9-12 9-12 9-12 12 –<br />
16-19 16-19 16-19 17:30<br />
Donnerstag und Samstag<br />
nach individueller<br />
Vereinbarung<br />
Wir bieten Ihnen:<br />
• Schnelle Terminvergabe<br />
• Geringe Wartezeiten<br />
• Eine ruhige, zugewandte Atmosphäre<br />
• Genügend Zeit, um Sie und Ihre<br />
Anliegen kennenzulernen, um aus<br />
langjähriger Erfahrung eine individuelles<br />
Therapiekonzept für Sie zu entwickeln.<br />
Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch einen<br />
Flyer mit Informationen über unser Leistungsspektrum<br />
zu.<br />
47
Früher war alles schöner – zumindest die ein oder andere Werbung.<br />
Tante Emma atmet auf<br />
Der kleine Laden ums Eck ist tot. Das hört man immer wieder. Es muss aber nicht so sein. Mit ausgefeilten Konzepten<br />
verhilft die Utz Lebensmittel-Großhandel GmbH & Co. KG Dorfläden zu neuen Chancen.<br />
Das Herz des Lebensmittelgroßhändlers<br />
Utz schlägt am Rande des Gewerbegebiets<br />
Ochsenhausen-Längenmoos:<br />
Hier erstreckt sich eine 2005 neu gebaute Halle<br />
– gleichzeitig der Firmensitz. Genau hier<br />
legen alle angelieferten, für die spätere Verteilung<br />
benötigten Waren einen Zwischenstopp<br />
ein. Auf insgesamt 7500 Quadratmetern<br />
schnurren die Lageristen auf ihren Elektro-<br />
Fahrzeugen und ihren Gabelstaplern hin und<br />
her, schaffen das perfekte System zum Anund<br />
Abtransport von Lebensmitteln, Süß-und<br />
Tabakwaren und Getränken für mehr als 1000<br />
Kunden. Die Mitarbeiter organisieren 6500<br />
verschiedene Produkte, kennzeichnen sie,<br />
sortieren Mangelware aus, behalten das Haltbarkeitsdatum<br />
im Auge, trennen Pfand- von<br />
Einwegflaschen – und nutzen dabei die 7000<br />
48
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[machen]<br />
Stellplätze für Europaletten optimal.<br />
Was unterscheidet Geschäftsführer Rainer<br />
Utz und sein Unternehmen von anderen Lebensmittel-Großhändlern?<br />
Vor allem die<br />
Dienstleistungen, die dafür sorgen, dass es mit<br />
den kleinen Lebensmittelgeschäften auf dem<br />
Land wieder bergauf geht: Das Unternehmen<br />
berät bei Rentabilitätsberechnungen und<br />
Kaufkraftanalysen, hilft bei der Suche nach<br />
passenden Standorten, bei der Ladenplanung,<br />
übernimmt bei Bedarf die Produktion von<br />
Handzetteln oder Plakaten für Sonderangebote<br />
oder hilft bei der Einrichtung.<br />
DiE BayErn warEn schnELLEr<br />
Rainer Utz: „Immer mehr alte oder geschlossene<br />
Standorte werden als Dorfladen wiedereröffnet.<br />
Uns gelingt es auch, bei Generationsoder<br />
Inhaberwechsel jüngere Leute für die<br />
Selbstständigkeit zu begeistern.“ Überdies sei<br />
die Nahversorgung als Ausdruck für eine bestimmte<br />
Lebensqualität vor allem im ländlichen<br />
Raum auf politischer Ebene angekommen.<br />
Der Begriff „Tante Emma“ sei wieder<br />
positiv besetzt, zumal die Menschen ihn mit<br />
„Nähe, Regionalität, persönlicher Ansprache<br />
und Kommunikation“ verbinden.<br />
Den Strukturwandel mit Discountern hat Utz<br />
frühzeitig erkannt und ihm eigene regionale<br />
Nahversorgungskonzepte entgegengestellt:<br />
ganzheitliche Vertriebskonzepte wie „Um’s<br />
Eck“ oder „Dorfladen“, auf genossenschaftlicher<br />
Basis oder als Unternehmergesellschaft<br />
organisiert. Oft stoßen mittlerweile Bürgerinitiativen<br />
oder auch Gemeinden ein Dorfladen-Konzept<br />
an. Etwa ein Drittel befindet sich<br />
in Baden-Württemberg, zwei Drittel liegen in<br />
Bayern – vielleicht auch, weil die Politik dort<br />
Chef Rainer Utz an seinem Lieblingsplatz im Unternehmen: dem gewaltigen Lager.<br />
das Thema früher aufgegriffen hat. Utz selbst<br />
hat das Dorfladen-Prinzip übrigens vor rund<br />
zehn Jahren entwickelt.<br />
„Dorfläden funktionieren anders“, erklärt der<br />
studierte Betriebswirt, der in seiner Freizeit<br />
gerne aufs Rennrad oder Mountainbike steigt<br />
und hin und wieder einen Marathon bestreitet:<br />
„Die Geschäfte werden oftmals sehr emotional<br />
gesehen.“ Was gerade der Vorteil ist.<br />
Dennoch muss es auch wirtschaftlich funktionieren.<br />
Utz‘ Konzept dafür geht weit über das<br />
Beliefern mit Waren hinaus: Betreiber erhalten<br />
eine Standortanalyse, die wirtschaftliche<br />
Fakten und regionale Vorlieben auflistet. Die<br />
klassische Ladenausstattung kann auch ergänzt<br />
werden, etwa mit Backshop, Fotoservice,<br />
Postagentur, Kopier-Shop, Bistro-Ecke …<br />
GUTE rEGaLE von schLEckEr<br />
Des einen Leid, des anderen Freud: „Nachdem<br />
Schlecker in die Insolvenz gegangen ist, kamen<br />
wir beispielsweise günstig an Verkaufsregale,<br />
die ich bei Bedarf an unsere Dorfläden<br />
weitergeben kann.“ Denn einen Laden neu<br />
einzurichten, geht ins Geld. Und wenn Regale<br />
voll funktionstüchtig sind, nehme kaum ein<br />
Kunde wahr, ob sie nagelneu sind oder nicht<br />
– ihn interessiert, was draufsteht. „Eine kos-<br />
Details sind keine Kleinigkeiten.<br />
Nething Generalplaner Architekten und Ingenieure<br />
Wegenerstraße 7 . 89231 Neu-Ulm . Weitere Büros in Berlin und Leipzig<br />
Ein Unternehmen der Nething Gruppe<br />
nething.com
[machen] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Auch das Betriebsklima ist<br />
Rainer Utz sehr wichtig.<br />
tengünstige gebrauchte Einrichtung ist in vielen<br />
Fällen völlig ausreichend“, sagt Utz. Bisher<br />
stehen acht Außendienstmitarbeiter den<br />
Kunden vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Den<br />
Beratungsansatz will er ausbauen und weitere<br />
Fachleute einstellen.<br />
Sei es ein Berater, sei es ein Lagerist. Rainer Utz<br />
weiß um den Wert guter Mitarbeiter und bindet<br />
sie am liebsten langfristig ans Unternehmen:<br />
„Mir ist das<br />
Betriebsklima wie<br />
auch die Zuverlässigkeit<br />
unserer Arbeit<br />
gleichermaßen<br />
wichtig.“ Der<br />
hohe Grad an Beschäftigung<br />
in der<br />
Region erschwert<br />
ihm allerdings die<br />
Rekrutierung: „Haben<br />
sich früher bis<br />
zu 100 Interessenten<br />
für eine ausgeschriebene<br />
Stelle beworben, sind es inzwischen<br />
manchmal kaum mehr als 30.“<br />
Besonders schwierig sei die Suche nach Lehrlingen.<br />
Zurzeit seien sechs Auszubildende in<br />
der Firma. Auch deshalb ist das inhabergeführte<br />
Unternehmen glücklich darüber, dass<br />
die Fluktuation „äußerst gering“ ist.<br />
wEniGE schnäppchEnjäGEr<br />
Die Dorfläden sind für Utz nur eines von mehreren<br />
Standbeinen. 1997 entstand das deutschlandweite<br />
Netzwerk MCS (Marketing und<br />
Convenience Shop System): Utz war von Anfang<br />
an als regionaler Partner für die Belieferung<br />
von Tankstellen- und Kiosk-Ketten in<br />
Baden-Württemberg und Bayern dabei. Etwa<br />
die Hälfte seines Jahresumsatzes von rund 60<br />
Millionen Euro erwirtschaftet Utz inzwischen<br />
mit den Convenience-Shops wie Tankstellen,<br />
Bäckereien, Getränkemärkten und<br />
Kiosken.<br />
2013 führte Utz die Marke „Jeden Tag“ für<br />
preissensible Kunden ein. Je nach Laden bewege<br />
sich die Angebotsbreite zwischen 50<br />
und 100 Artikeln bei einer Gesamtzahl von<br />
2000 bis 2500 Artikeln, berichtet Utz: „Bei<br />
den Dorfladen-Kunden überwiegen dennoch<br />
die Marken- und Qualitätsbewussten, nicht<br />
die Schnäppchenjäger.“ Produkte aus der Region<br />
werden immer beliebter: Besonders bei<br />
Frischeprodukten sei der regionale Bezug zunehmend<br />
wichtig. „Der Dorfladen bietet<br />
gerade hier die passende Vertrauensbasis,<br />
100 jahre Lebensmittel Utz<br />
Hier fing alles an, in einem kleinen Kolonialwarenladen. Auf dem Foto hält Paula Utz, die älteste<br />
Tochter des Firmengründers, die Tante des heutigen Chefs auf dem Arm.<br />
vor 100 jahren, am 1. August 1914,<br />
schrieb Martin Utz die ersten Zeilen der<br />
Erfolgsgeschichte – mit einem kleinen<br />
Kolonialwaren- und Tabakgeschäft in<br />
Ochsenhausen. Fünf Jahre später begann<br />
er mit der Belieferung kleinerer Läden im<br />
Umland. 1959 übernahm sein Sohn Karl<br />
Utz den elterlichen Betrieb und zog mit<br />
der Großhandelsfirma 1963 an den<br />
Stadtrand von Ochsenhausen. Im Laufe<br />
der Jahre vergrößerte er den Standort<br />
mehrmals, auch weil das Lagern gekühlter<br />
Waren an Bedeutung gewann.<br />
Als Karl Utz überraschend starb, trat<br />
1977 sein Sohn Rainer direkt nach dem<br />
Abitur ins Familien<strong>unternehmen</strong> ein: als<br />
Lehrling zum Außenhandelskaufmann.<br />
Nach dem Wehrdienst und einem Jahr<br />
mit Praktika in Großhandelsbetrieben in<br />
Norddeutschland übernahm Rainer Utz<br />
1982 – mit Unterstützung seiner Mutter<br />
– die Geschäftsleitung.<br />
Mit dem Aufbau des Convenience-Vertriebes<br />
1997 wuchs Utz als Großhandels<strong>unternehmen</strong><br />
so schnell, dass im Jahr<br />
2005 der Bau eines völlig neuen Firmensitzes<br />
im Ochsenhausener Gewerbegebiet<br />
Längenmoos notwendig wurde.<br />
Heute arbeiten 100 Mitarbeiter für das<br />
führende privatwirtschaftliche Großhandels<strong>unternehmen</strong><br />
Süddeutschlands.<br />
Sie beliefern Dorfläden, Tankstellen und<br />
Kioske vom Schwarzwald über Stuttgart,<br />
die Ostalb, das Allgäu bis nach München<br />
und Garmisch-Partenkirchen. 2013 erwirtschaftete<br />
das Unternehmen einen<br />
Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Im<br />
Sommer <strong>2014</strong> feierte Utz mit Mitarbeitern<br />
und Kunden auf dem Firmengelände<br />
den 100. Geburtstag.<br />
abE<br />
denn er ist ja mit der Region verwurzelt“, erklärt<br />
Utz.<br />
In die Zukunft blickt das Unternehmen optimistisch:<br />
„Wir gehen davon aus, dass wir dank<br />
unserer zukunftsträchtigen Geschäftsfelder<br />
weiteres Wachstum erzielen können.“ Natürlich<br />
müsse man immer am Ball bleiben. Alle<br />
Schritte vom Einkauf der Ware bis zur Auslieferung<br />
an den Kunden würden ständig durchleuchtet.<br />
Ein großes aktuelles Projekt ist die<br />
Erneuerung der IT-Systeme. „Wir planen, die<br />
alte und aufwendige Lagerführung und Kommissionierung<br />
auf ein modernes, papierloses<br />
Lagerverwaltungssystem umzustellen“, sagt<br />
Utz. Das erhöhe die Bestandssicherheit und<br />
Kommissionierqualität weiter, sagt der Kaufmann:<br />
„Restlaufzeiten sowie Mindesthaltbarkeitsdatum<br />
können dann besser überwacht<br />
werden.“ Das Projekt wurde Anfang <strong>2014</strong> mit<br />
der Dortmunder Firma Pro Logistik gestartet,<br />
Anfang 2015 soll dann alles papierlos laufen<br />
– und die Kommissionierer erhalten ihre<br />
Aufträge über ein Sprachsystem (Pick by<br />
Voice). [!]<br />
EbErhard abElEin<br />
50
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[leben]<br />
AchduliebeZeit!<br />
Sie tickt, wenn wir ins Büro gehen und sie tickt, wenn wir es wieder verlassen. Die Uhr bestimmt unseren<br />
Arbeitsalltag von früh bis spät. Doch wie sieht es in der Freizeit aus? Fünf Führungskräfte haben sich für Stefan<br />
Loeffler und unsere Umfrage ein bisschen Zeit genommen.<br />
Gabriele Wulz<br />
leitet seit 2001 die<br />
Ulmer Prälatur der Evangelischen<br />
Landeskirche in<br />
Württemberg. Hätte die<br />
1959 geborene Darmstädterin<br />
mehr Zeit, würde sie<br />
lesen, lesen, lesen.<br />
1) Ich weiß es nicht mehr genau. Ich vermute jedoch, dass ich meine<br />
erste Uhr in der ersten Schulklasse bekommen habe.<br />
2) Beim Schwimmen.<br />
3) Sehr schwer zu organisieren.<br />
4) Ewigkeit, Augenblick, Vergänglichkeit.<br />
5) Mit netten Menschen.<br />
6) Ich würde alles lesen, was ich schon immer mal lesen wollte oder<br />
sollte oder müsste.<br />
7) Ich halte es in diesem Punkt mit Psalm 90: Unser Leben währet siebzig Jahre und<br />
wenn‘s hoch kommt, so sind`s achtzig Jahre … und dann vor allem: Herr, lehre uns<br />
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.<br />
1) Können Sie sich erinnern, wann Sie Ihre erste Uhr bekommen<br />
haben?<br />
2) Legen Sie Ihre Uhr manchmal ab?<br />
3) Wie stellen Sie sich eine Welt ohne Zeitmesser vor?<br />
4) Nennen Sie bitte drei Begriffe, die Ihnen zum Thema<br />
Zeit einfallen.<br />
5) Mit wem verbringen Sie Ihre Zeit am liebsten?<br />
6) Was würden Sie tun (oder eben auch nicht), wenn Sie<br />
plötzlich ganz viel Zeit hätten?<br />
7) Wie alt möchten Sie werden?<br />
Foto: © abf / Fotolia.com<br />
Foto: © Rob Stark / Fotolia.com<br />
»Kochen isT eine KUnsT Und<br />
Keineswegs die UnbedeUTendsTe.«<br />
Luciano Pavarotti<br />
Miele | gaggenau | liebherr | Selektion D | Val<br />
CuCine<br />
www.kueche-und-raum.de | Frauenstraße 65 | 89073 Ulm | T 0731 61288<br />
51
[leben] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Fotos Uhren: © GoldPix / Fotolia.com<br />
1) Können Sie sich erinnern, wann Sie Ihre erste Uhr bekommen<br />
haben?<br />
2) Legen Sie Ihre Uhr manchmal ab?<br />
3) Wie stellen Sie sich eine Welt ohne Zeitmesser vor?<br />
4) Nennen Sie bitte drei Begriffe, die Ihnen zum Thema<br />
Zeit einfallen.<br />
5) Mit wem verbringen Sie Ihre Zeit am liebsten?<br />
6) Was würden Sie tun (oder eben auch nicht), wenn Sie<br />
plötzlich ganz viel Zeit hätten?<br />
7) Wie alt möchten Sie werden?<br />
Ernst Haible ist seit 36 Jahren<br />
selbstständiger Finanzberater<br />
im Bereich Versicherungen, Immobilien<br />
und Kapitalanlagen.<br />
Der Geschäftsführer der Ernst<br />
Haible GmbH beschäftigt drei<br />
Mitarbeiter. Hätte er mehr Freizeit,<br />
würde er viel öfter am<br />
Steuer eines Oldtimers sitzen.<br />
Wolfram Schneider ist seit<br />
über 30 Jahren geschäftsführender<br />
Gesellschafter der Firma<br />
WolframS Lifestyle GmbH<br />
in Ulm. Der 56-jährige Vater<br />
zweier erwachsener Kinder<br />
verzichtet im Urlaub oftmals<br />
auf seine Uhr.<br />
1) Nein, aber ich habe 1975 in Bangkok meine erste Quarzuhr gekauft.<br />
Das war damals eine Weltneuheit und bei uns noch richtig teuer.<br />
2) Ja, immer in der Nacht.<br />
3) Für die Gesellschaft chaotisch – privat eine völlig neue entspannte<br />
Lebenssituation.<br />
4) Schicke Uhren, Zeit nehmen für alles, was mich interessiert, Unendlichkeit.<br />
5) Mit meiner Frau.<br />
6) Reisen, um ferne Länder und fremde Menschen kennenzulernen.<br />
Und ich würde an mehr Oldtimerrallyes teilnehmen.<br />
7) Bei bester Gesundheit möchte ich sehr alt werden.<br />
1) Ja, meine erste Uhr hat mir mein Großvater geschenkt, kurz nachdem<br />
ich eingeschult wurde, weil ich häufig zu spät kam.<br />
2) Im Urlaub, außer auf Ausflügen, lege ich oft keine Uhr an – und<br />
genieße es sehr, einfach einmal zeitlos zu sein.<br />
3) Eine Welt ohne Zeit kann ich mir nur im Jenseits vorstellen.<br />
4) Planung und Organisation, Arbeitszeit, Freizeit und Urlaub.<br />
5) Mit meinen Kindern und Freunden.<br />
6) Ich würde gerne neue Länder und Menschen kennenlernen, reisen<br />
und viel Sport in der Natur machen.<br />
7) So lange ich gesund und rüstig bin, macht mir das Leben große<br />
Freude.<br />
52
<strong>unternehmen</strong> [!] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
[leben]<br />
Die 33-jährige<br />
Sandra Bohnaker, seit April<br />
<strong>2014</strong> Leiterin des Bereichs<br />
Unternehmensmarketing der<br />
IT-Firma Fritz & Macziol, hat<br />
noch viel Zeit vor sich.<br />
Carlheinz Gern (62) startete<br />
sein Berufsleben als Verlagskaufmann<br />
bei der Südwest<br />
Presse, war 14 Jahre Marketingleiter<br />
bei Radio 7 und ist<br />
seit Sendestart 2003 Geschäftsführer<br />
beim Lokalradio Donau3FM.<br />
Der selbstständige<br />
Veranstalter von Konzerten,<br />
Partys und Events legt seine<br />
Uhr nur ab, wenn er eine<br />
andere tragen möchte.<br />
1) Zum Schulanfang?!<br />
2) Vice versa: Ich lege nur ab und zu eine Uhr an – dann aus modischem<br />
Aspekt. Inzwischen findet sich die Uhrzeit doch überall.<br />
3) Entschleunigt. Ein Leben nach der Sonne und mit der Natur – wie<br />
im Urlaub.<br />
4) Schwäbische Ordnung, Kalenderplanung, Sommerzeit.<br />
5) Mit tollen Menschen, mit Sport und mit der Natur.<br />
6) Für all diese Ideen reicht der Platz hier leider nicht aus.<br />
7) Ich werde mindestens 100 Jahre alt!<br />
1) Das war eine wertvolle Tissot, die ich zur Kommunion bekam.<br />
2) Nur zum Wechseln.<br />
3) Entspannt!<br />
4) Augenblicke, Vergangenheit und Zukunft.<br />
5) Mit Menschen, die mir wichtig sind, mir am Herzen liegen und zeitlos<br />
interessant sind.<br />
6) Die Welt bereisen.<br />
7) Man kann gar nicht alt genug werden, um all die Überraschungen<br />
auszuschöpfen, die das Leben so mit sich bringt.<br />
Nur mit einem gehen sie verschwenderisch um:<br />
Fahrspaß.<br />
Die neuen Cayenne Modelle.<br />
Enthusiasmus. Gesteigert.<br />
Ab sofort bestellbarbei uns im Porsche Zentrum.<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.<br />
Porsche Zentrum Ulm/Neu-Ulm<br />
Sportwagen GmbH Donautal<br />
Steinbeisstraße 26 · 89079 Ulm<br />
Tel.: +49 731 94694-0 · Fax: -34<br />
www.porsche-ulm.de<br />
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): kombiniert: 11,5–6,6; CO 2<br />
-Emissionen: 267–173 g/km<br />
Cayenne S E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) kombiniert: 3,4; CO 2<br />
-Emissionen: 79 g/km; Stromverbrauch: kombiniert 20,8 kWh/100 km<br />
53
[namen & nachrichten] Ausgabe 41 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> <strong>unternehmen</strong> [!]<br />
Ulm wird Teil des<br />
weltweiten<br />
Metall-Clusters<br />
Die Stadt Ulm kann sich über<br />
die Stärkung ihrer Wirtschaftsstruktur<br />
freuen: Sie ist Teil des<br />
weltgrößten Konsortiums für<br />
Metallforschung und -fertigung.<br />
Dazu wird das Stuttgarter<br />
Fraunhofer-Institut dort eine<br />
Niederlassung für Produktionstechnik<br />
und Automatisierung<br />
einrichten. Dafür hat sich die<br />
High-Tech-Allianz Ulm unter<br />
Führung von Prof. Hans-Jörg<br />
Fecht vom Uni-Institut für neue<br />
Materialien eingesetzt. In dem<br />
Cluster arbeiten Konzerne wie<br />
Airbus und Arcelor Mittal mit.<br />
Zum Auftakt dürfte eine Projektgruppe<br />
des Stuttgarter Instituts<br />
mögliche Vorhaben mit der<br />
Ulmer Industrie ausloten, sagte<br />
der geschäftsführende Vorstand<br />
der Hightech-Allianz, Michael<br />
Drechsler.<br />
Druckindustrie<br />
vergibt an NPG<br />
Innovationspreis<br />
Abschalten in Natur und Sonne<br />
Acht von zehn Baden-Württembergern schreiben<br />
ihre Urlaubserholung der Sonne und der<br />
Natur zu. 17 Prozent der für den DAK-Urlaubsreport<br />
Befragten gaben jedoch an, sich kaum<br />
oder nicht im Urlaub erholt zu haben. Im Vergleich<br />
mit anderen Bundesländern ist das der<br />
Die Neue Pressegesellschaft<br />
mbH & Co. KG (NPG/Ulm), die<br />
Herausgeberin der SÜDWEST<br />
PRESSE, hat den Innovationspreis<br />
der Deutschen Druckindustrie<br />
in Silber erhalten. Bei einem<br />
Galabend des Verbands der<br />
Druckindustrie in der Liederhalle<br />
in Stuttgart wurden Gestaltung<br />
und Druck der ausklappbaren<br />
Sonderbeilage „Das<br />
Wallis erleben“ ausgezeichnet.<br />
Ein Allgäuer ist<br />
neuer Präsident<br />
des Handwerks<br />
Joachim Krimmer (58) aus Leutkirch<br />
ist neuer Präsident der<br />
Handwerkskammer Ulm. Die<br />
Vollversammlung, die 117 ehrenamtliche<br />
Mitglieder umfasst<br />
und 18.000 Betriebe vertritt,<br />
wählte ihn zum Nachfolger von<br />
Anton Gindele (65). Der Schreiermeister<br />
aus Horgenzell (Kreis<br />
Ravensburg) hatte zuvor zufrieden<br />
Bilanz<br />
gezogen. Es<br />
sei gelungen,<br />
die<br />
Kammer<br />
stärker als<br />
Dienstleister<br />
für die Betriebe<br />
aufzustellen.<br />
Unter<br />
Gindeles<br />
schlechteste Wert, wie beim Stressabbau. Nur<br />
57 Prozent der Befragten meinten, ihren<br />
Stress reduziert zu haben. DAK-Landeschef<br />
Markus Saur sieht das mit Sorge: „Wer nicht<br />
loslassen kann, kann sich auch nicht erholen.<br />
Damit ist am Ende niemandem gedient.“<br />
Hat Anton Gindele<br />
abgelöst:<br />
Joachim Krimmer.<br />
Foto: © Fotofreundin / Fotolia.com<br />
Führung hat die Kammer die<br />
Ausbildungsberatung für türkische<br />
Jugendliche und hunderte<br />
neuer Bildungspartnerschaften<br />
ins Leben gerufen. Dennoch<br />
wird das Thema Fachkräftesicherung<br />
eine der großen Aufgaben<br />
Krimmers sein. In seinem<br />
1913 gegründeten Heizungs-,<br />
Lüftungs- und Sanitärbetrieb<br />
beschäftigt er 23 Mitarbeiter,<br />
darunter zwei Auszubildende.<br />
Krimmer engagiert sich seit<br />
Jahren in der Kammer, unter<br />
anderem als Obermeister und<br />
Kreishandwerksmeister in Ravensburg.<br />
Er ist verheiratet und<br />
hat drei Kinder. [!]<br />
[impressum]<br />
Verlag/Herausgeber<br />
Neue Pressegesellschaft<br />
mbH & Co. KG<br />
Frauenstraße 77, 89073 Ulm<br />
Geschäftsführer:<br />
Thomas Brackvogel<br />
Redaktion<br />
Alexander Bögelein (verantw.),<br />
Irmgard Städele,<br />
Anschrift wie Verlag<br />
Anzeigen<br />
Dr. Thomas Baumann<br />
(verantwortlich)<br />
Anschrift wie Verlag<br />
Gestaltung<br />
Alen Pahic (Art Director)<br />
Bozena Demski (Bild)<br />
Fotos<br />
Oliver Schulz (Titel + Interview),<br />
Matthias Kessler, Eberhard Abelein,<br />
Lars Schwerdtfeger, Getty<br />
Images, Firmenfotos, PR<br />
Druck<br />
Druck- und Verlagsgesellschaft<br />
Bietigheim mbH<br />
Kronenbergstraße 10<br />
74321 Bietigheim-Bissingen<br />
Auflage: 15 000 Exemplare<br />
Objektleitung & Kontakt<br />
Tobias Lehmann<br />
Telefon 0731 156-515<br />
Fax 0731 156-481<br />
<strong>unternehmen</strong>@swp.de<br />
Mediaberatung<br />
Stefan Kulbe<br />
Telefon 0731 156-137<br />
E-Mail s.kulbe@swp.de<br />
Nächste Ausgabe<br />
29. November <strong>2014</strong><br />
Die Themen<br />
Der Notfallkoffer für<br />
Unternehmer<br />
Messebau + Messen 2015<br />
Energie<br />
u.v.m.<br />
Anzeigenschluss<br />
5. November <strong>2014</strong><br />
www.swp.de/<strong>unternehmen</strong><br />
54
Überzeugt leicht. Beeindruckt schwer.<br />
Das neue C-Klasse T-Modell. Das Beste kennt keine Alternative.<br />
• Sportlich-dynamisches Design trifft auf ein flexibles Raumkonzept.<br />
• Vielseitiges Lifestyle-Fahrzeug mit herausragenden Alltagseigenschaften.<br />
Jetzt Probe fahren.<br />
Telefon: 0731 700-1800.<br />
Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (09/<strong>2014</strong>) verfügbaren Motoren (C<br />
180/C 200/C 250/C 220 BlueTEC und C 250 BlueTEC). Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,0–4,3<br />
l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 140–108 g/km.<br />
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart<br />
Partner vor Ort: Niederlassung Ulm/Neu-Ulm<br />
Von-Liebig-Straße 10, 89231 Neu-Ulm, Telefon: 0731 700-0, www.mercedes-benz-ulm.de