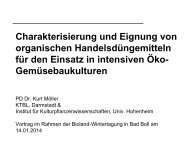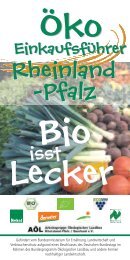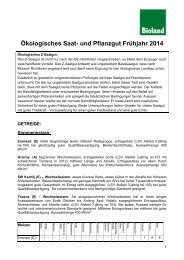Bestellen Sie Ihr Probeabo! - FiBL
Bestellen Sie Ihr Probeabo! - FiBL
Bestellen Sie Ihr Probeabo! - FiBL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die systematische und nachvollziehbare<br />
Herleitung der<br />
empfohlenen Maßnahmen<br />
trägt zur Sensibilisierung der<br />
MilchviehhalterInnen bei und<br />
ermöglicht so einen offenen<br />
Umgang mit den Empfehlungen.<br />
Betriebsindividuelles Gesundheitsmanagement<br />
Ein erfolgversprechender Ansatz zur Verbesserung<br />
der Tiergesundheitssituation bildet ein betriebsindividuelles<br />
Gesundheitsmanagement, das auf<br />
der Erfassung der einzelbetrieblichen Ausgangssituation<br />
sowie der Erarbeitung betriebsindividueller<br />
Handlungsempfehlungen beruht. Die<br />
Erfassung der Ausgangssituation erfolgt mit Hilfe<br />
einer detaillierten Schwachstellenanalyse auf<br />
Basis zentraler Indikatoren für die Euter- und<br />
Stoffwechselgesundheit sowie zugehöriger Zielgrößen<br />
bzw. Grenzwerte. Die im Projekt gewählte<br />
Vorgehensweise, deren Effektivität bestätigt werden<br />
konnte, wird im Folgenden vorgestellt.<br />
1. Erfassung des Status quo auf dem Betrieb<br />
Zur Erfassung des Status quo werden neben<br />
den zentralen Indikatoren der Euter- und Stoffwechselgesundheit<br />
alle diesbezüglich wichtigen<br />
Einflussfaktoren aus Haltungsumwelt, Herdenführung,<br />
Fütterung und Futterbau erhoben. Dazu<br />
gehören tierbezogene Parameter, wie z.B. Anteile<br />
lahmer Kühe, Tierverschmutzung, Körperkondition<br />
oder akute und chronische Zitzenkondition.<br />
Für Probleme im Bereich der Stoffwechselgesundheit<br />
werden u. a. die Körperkonditionsbeurteilungen<br />
der Kühe, Behandlungsraten von hypocalcämischen<br />
Gebärparesen und klinischen Ketosen<br />
sowie Fett-Eiweiß-Quotienten aus den monatlichen<br />
Milchprüfungsergebnissen (als Indikator für Abweichungen<br />
in der Energie- und Strukturversorgung)<br />
herangezogen.<br />
2. Ableitung von Handlungsempfehlungen<br />
und Erstellung eines Maßnahmenkatalogs<br />
Zur Identifikation von (Tiergesundheits-)Problemen<br />
und der Formulierung betriebsindividueller Ziele<br />
erfolgt ein Abgleich der Ausgangssituation des<br />
Betriebs mit den definierten Zielgrößen. Die<br />
Auswertung schließt u.a. Daten zur Tiergesundheit,<br />
z.B. aus der monatlichen Milchleistungskontrolle<br />
(Gehalt an somatischen Zellen und Stoffwechselprofile),<br />
dem Stallbuch/den Abgabebelegen<br />
(Behandlungsinzidenzen) sowie den Befunden<br />
der von den LandwirtInnen zur bakteriologischen<br />
Untersuchung eingesandten Milchproben ein.<br />
Anhand dieser Daten wird durch Fachpersonen<br />
eine Schwachstellenanalyse gemacht. Es wird eine<br />
Indikatorenliste für die oben genannten Bereiche<br />
mit ergänzenden Anmerkungen bezüglich der<br />
Interpretation erstellt.<br />
Die Handlungsempfehlungen für die wesentlichen,<br />
zu verbessernden Tiergesundheitsbereiche<br />
sowie die dazugehörigen Maßnahmen werden<br />
in einem «Vorschlags-Katalog» zusammengefasst.<br />
Gegebenenfalls werden weiterführende Informationen,<br />
z.B. zur systematischen Staphylococcus<br />
aureus-Bekämpfung, beigelegt.<br />
3. Implementierung des Maßnahmenkatalogs<br />
Die Implementierung der Maßnahmenkataloge<br />
findet im Gespräch mit den BetriebsleiterInnen<br />
sowie ggfs. weiteren, mit dem Milchvieh betrauten<br />
MitarbeiterInnen (z.B. Melkpersonal) statt.<br />
Im Implementierungsgespräch erfolgt eine Beschreibung<br />
der Ausgangssituation zur Identifikation<br />
von Tiergesundheitsproblemen, eine betriebsindividuelle<br />
Zielformulierung anhand der Handlungsempfehlungen<br />
sowie die Diskussion und Festlegung<br />
von Maßnahmen(-katalogen) auf Basis<br />
dieser einzelbetrieblichen Ausgangssituation. Die<br />
betriebsindividuellen Vereinbarungen werden in<br />
einem ‘Umsetzungs-Katalog‘ festgehalten.<br />
4. Zweite Erhebung der Parameter im Betrieb<br />
Zur Betrachtung der Entwicklung der Situation<br />
sowie der Anpassung bzw. Bestärkung in Bezug<br />
auf die implementierten Maßnahmenpakete<br />
werden die Parameter ein zweites Mal erhoben<br />
(Effektivitätskontrolle). Abgleich mit den Zielen des<br />
Betriebs und Festlegung weiterer Maßnahmen.<br />
Empfehlungen zur Eutergesundheit beziehen<br />
sich erfahrungsgemäß mehrheitlich auf Probleme<br />
mit tierassoziierten Mastitiserregern (v.a. S.<br />
aureus), auf Optimierungspotenziale bzgl. der<br />
umwelthygienischen Bedingungen, insbesondere<br />
im geburtsnahen Zeitraum, sowie eine systematische<br />
Behandlungsstrategie inklusive des gezielten<br />
metaphylaktischen Einsatzes von antibiotischen<br />
Trockenstellpräparaten.<br />
Im Bereich der Stoffwechselgesundheit liegt<br />
der Schwerpunkt in der Regel bei der Energieversorgung<br />
der Milchkühe in den ersten 100 Tagen<br />
post partum. In diesem Zusammenhang sollten<br />
in der Beratung insbesondere die Fütterung der<br />
trockenstehenden Kühe, die Vorbereitungsfütterung<br />
und die Anfütterung thematisiert werden.<br />
24 Euter- und Stoffwechselgesundheit bei Milchkühen 2012 vTI / Bioland / Demeter / KÖN / IBLA / <strong>FiBL</strong>