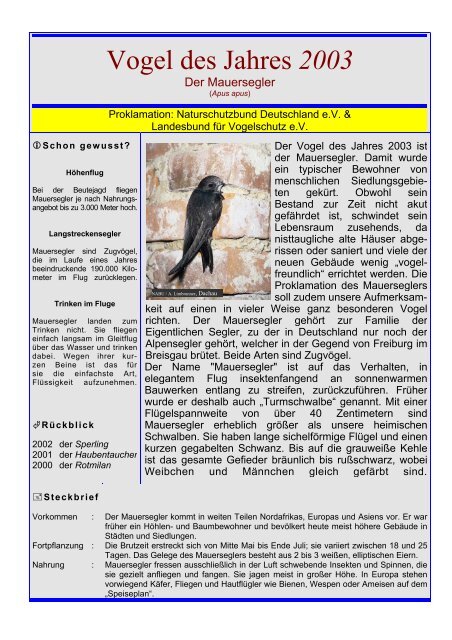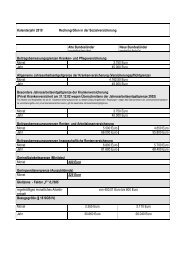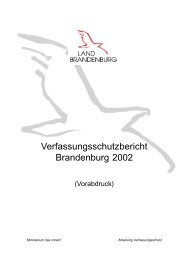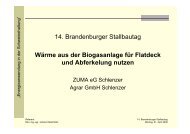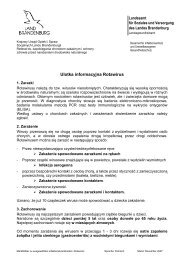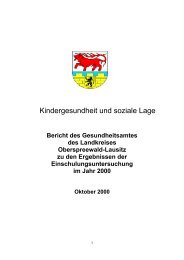Natur des Jahres 2003 - Brandenburg.de
Natur des Jahres 2003 - Brandenburg.de
Natur des Jahres 2003 - Brandenburg.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
� Schon gewusst?<br />
Höhenflug<br />
Bei <strong>de</strong>r Beutejagd fliegen<br />
Mauersegler je nach Nahrungsangebot<br />
bis zu 3.000 Meter hoch.<br />
Langstreckensegler<br />
Mauersegler sind Zugvögel,<br />
die im Laufe eines <strong>Jahres</strong><br />
beeindrucken<strong>de</strong> 190.000 Kilometer<br />
im Flug zurücklegen.<br />
Trinken im Fluge<br />
Mauersegler lan<strong>de</strong>n zum<br />
Trinken nicht. Sie fliegen<br />
einfach langsam im Gleitflug<br />
über das Wasser und trinken<br />
dabei. Wegen ihrer kurzen<br />
Beine ist das für<br />
sie die einfachste Art,<br />
Flüssigkeit aufzunehmen.<br />
� Rückblick<br />
2002 <strong>de</strong>r Sperling<br />
2001 <strong>de</strong>r Haubentaucher<br />
2000 <strong>de</strong>r Rotmilan<br />
� Steckbrief<br />
Vorkommen :<br />
Fortpflanzung :<br />
Nahrung :<br />
Vogel <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Der Mauersegler<br />
(Apus apus)<br />
Proklamation: <strong>Natur</strong>schutzbund Deutschland e.V. &<br />
Lan<strong><strong>de</strong>s</strong>bund für Vogelschutz e.V.<br />
Der Vogel <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong> ist<br />
<strong>de</strong>r Mauersegler. Damit wur<strong>de</strong><br />
ein typischer Bewohner von<br />
menschlichen Siedlungsgebieten<br />
gekürt. Obwohl sein<br />
Bestand zur Zeit nicht akut<br />
gefähr<strong>de</strong>t ist, schwin<strong>de</strong>t sein<br />
Lebensraum zusehends, da<br />
NABU / A. Limbrunner, Dachau<br />
nisttaugliche alte Häuser abgerissen<br />
o<strong>de</strong>r saniert und viele <strong>de</strong>r<br />
neuen Gebäu<strong>de</strong> wenig „vogelfreundlich“<br />
errichtet wer<strong>de</strong>n. Die<br />
Proklamation <strong><strong>de</strong>s</strong> Mauerseglers<br />
soll zu<strong>de</strong>m unsere Aufmerksamkeit<br />
auf einen in vieler Weise ganz beson<strong>de</strong>ren Vogel<br />
richten. Der Mauersegler gehört zur Familie <strong>de</strong>r<br />
Eigentlichen Segler, zu <strong>de</strong>r in Deutschland nur noch <strong>de</strong>r<br />
Alpensegler gehört, welcher in <strong>de</strong>r Gegend von Freiburg im<br />
Breisgau brütet. Bei<strong>de</strong> Arten sind Zugvögel.<br />
Der Name "Mauersegler" ist auf das Verhalten, in<br />
elegantem Flug insektenfangend an sonnenwarmen<br />
Bauwerken entlang zu streifen, zurückzuführen. Früher<br />
wur<strong>de</strong> er <strong><strong>de</strong>s</strong>halb auch „Turmschwalbe“ genannt. Mit einer<br />
Flügelspannweite von über 40 Zentimetern sind<br />
Mauersegler erheblich größer als unsere heimischen<br />
Schwalben. Sie haben lange sichelförmige Flügel und einen<br />
kurzen gegabelten Schwanz. Bis auf die grauweiße Kehle<br />
ist das gesamte Gefie<strong>de</strong>r bräunlich bis rußschwarz, wobei<br />
Weibchen und Männchen gleich gefärbt sind.<br />
Der Mauersegler kommt in weiten Teilen Nordafrikas, Europas und Asiens vor. Er war<br />
früher ein Höhlen- und Baumbewohner und bevölkert heute meist höhere Gebäu<strong>de</strong> in<br />
Städten und Siedlungen.<br />
Die Brutzeit erstreckt sich von Mitte Mai bis En<strong>de</strong> Juli; sie variiert zwischen 18 und 25<br />
Tagen. Das Gelege <strong><strong>de</strong>s</strong> Mauerseglers besteht aus 2 bis 3 weißen, elliptischen Eiern.<br />
Mauersegler fressen ausschließlich in <strong>de</strong>r Luft schweben<strong>de</strong> Insekten und Spinnen, die<br />
sie gezielt anfliegen und fangen. Sie jagen meist in großer Höhe. In Europa stehen<br />
vorwiegend Käfer, Fliegen und Hautflügler wie Bienen, Wespen o<strong>de</strong>r Ameisen auf <strong>de</strong>m<br />
„Speiseplan“.
� Schon gewusst?<br />
Giftige Schönheit<br />
Die Samen <strong>de</strong>r Kornra<strong>de</strong><br />
enthalten einen giftigen<br />
Inhaltsstoff (Saponin). Daher<br />
galt sie früher als gefürchtetes<br />
Unkraut, das <strong>de</strong>m Bauern<br />
seine Wintergetrei<strong>de</strong>ernte<br />
vergiften konnte. Eine Handvoll<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> 3 bis 4 mm großen Samens<br />
kann einen Menschen töten.<br />
Bild : Internet<br />
Tiefe Wurzeln<br />
Die langen Wurzeln <strong>de</strong>r<br />
Kornra<strong>de</strong> können bis zu 90<br />
cm in <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n ragen.<br />
� Rückblick<br />
2002 das Hain-Veilchen<br />
2001 <strong>de</strong>r Blutrote Storchschnabel<br />
2000 <strong>de</strong>r Purpurblaue<br />
Steinsame<br />
� Steckbrief<br />
Vorkommen :<br />
Blüte :<br />
Aussehen :<br />
Vermehrung :<br />
Blume <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Die Kornra<strong>de</strong><br />
(Agrostemma Githago)<br />
Proklamation: Stiftung <strong>Natur</strong>schutz Hamburg e.V. &<br />
Stiftung zum Schutz gefähr<strong>de</strong>ter Pflanzen e.V.<br />
Für <strong>2003</strong> wur<strong>de</strong> die Kornra<strong>de</strong><br />
zur Blume <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> erwählt.<br />
Das Nelkengewächs gehört zur<br />
sogenannten Ackerbegleitflora<br />
und war bis in die 60er Jahre<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> vorigen Jahrhun<strong>de</strong>rts neben<br />
vielen an<strong>de</strong>ren Wildkräutern<br />
eine sehr häufige Pflanze im<br />
Wintergetrei<strong>de</strong>. Heute ist ihr<br />
Bestand infolge mo<strong>de</strong>rner<br />
Anbaumetho<strong>de</strong>n und gründlicher<br />
Saatgutreinigung mehr<br />
und mehr im Rückgang und vielerorts<br />
sogar stark gefähr<strong>de</strong>t<br />
o<strong>de</strong>r ausgestorben – die frühere<br />
„Allerweltspflanze“ ist eine „Rote-<br />
Bild : Internet (Stiftung <strong>Natur</strong>schutz)<br />
Liste-Art“ gewor<strong>de</strong>n. Mit <strong>de</strong>r Proklamation soll - stellvertretend<br />
für alle selten gewor<strong>de</strong>nen Ackerwildkräuter - für<br />
<strong>de</strong>n Erhalt <strong>de</strong>r Kornra<strong>de</strong> geworben wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Pflanze stammt wahrscheinlich aus <strong>de</strong>m Vor<strong>de</strong>ren<br />
Orient und konnte mit <strong>de</strong>r Einführung <strong><strong>de</strong>s</strong> Ackerbaus auch<br />
in Zentraleuropa Fuß fassen. Seit <strong>de</strong>m frühen Mittelalter<br />
wird sie als eine <strong>de</strong>r häufigsten Unkräuter überhaupt<br />
erwähnt. Die lichtlieben<strong>de</strong> Art ist anspruchslos gegenüber<br />
<strong>de</strong>m Basenhaushalt o<strong>de</strong>r Feuchtigkeitsgrad <strong>de</strong>r Bö<strong>de</strong>n. Sie<br />
benötigt jedoch nährstoffreiche und gepflügte Standorte, um<br />
vegetationsfreie Stellen zum Aufkeimen <strong>de</strong>r Saat zu fin<strong>de</strong>n.<br />
Die Kornra<strong>de</strong> kommt wie alle Ackerwildkräuter vornehmlich auf Fel<strong>de</strong>rn und an<strong>de</strong>ren<br />
Rän<strong>de</strong>rn vor.<br />
Die Blüte dieser Pflanze ist bis zu 2 cm groß und hat 5 purpurfarbene Kronblätter, die<br />
eine weißliche Zeichnung aufweisen.<br />
Die Kornra<strong>de</strong> kann bis zu 1 m hoch wer<strong>de</strong>n. An ihrem aufrechten Stengel gibt es nur<br />
wenige Seitentriebe.<br />
Die Blüte wird insbeson<strong>de</strong>re von Faltern - seltener von Bienen - bestäubt; oft fin<strong>de</strong>t<br />
auch Selbstbestäubung statt. Der Samen ist mit 3 bis 4 mm verhältnismäßig groß,<br />
nierenförmig, warzig und schwarz. Als Kaltkeimer muss die Pflanze ihre Früchte<br />
spätestens im zeitigen Frühjahr ausgebracht haben, da die Samenkörner zum<br />
Ge<strong>de</strong>ihen Minustemperaturen ausgesetzt sein müssen.
� Schon gewusst?<br />
Rekord<br />
Zu <strong>de</strong>n ältesten noch heute<br />
bestehen<strong>de</strong>n botanischen Gärten<br />
<strong>de</strong>r Welt gehören die<br />
Gärten von Leipzig (1542),<br />
Pisa (1543, nach an<strong>de</strong>ren Angaben<br />
1545) und Padau (1545).<br />
Weltwun<strong>de</strong>r<br />
Eines <strong>de</strong>r sieben Weltwun<strong>de</strong>r<br />
sind die hängen<strong>de</strong>n Gärten<br />
<strong>de</strong>r Semiramis.<br />
� Rückblick<br />
2002 <strong>de</strong>r Garten<br />
2001 <strong>de</strong>r Fluss<br />
2000 <strong>de</strong>r Fluss<br />
� Steckbrief<br />
Vielfalt :<br />
Statistik :<br />
Entwicklung :<br />
Biotop <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Der Garten<br />
Proklamation: <strong>Natur</strong>schutzzentrum Hessen e.V.<br />
Biogarten in Prieros<br />
Der Begriff "Garten" kommt<br />
aus <strong>de</strong>m Althoch<strong>de</strong>utschen<br />
und be<strong>de</strong>utet "das Umzäunte".<br />
Unsere Altvor<strong>de</strong>ren<br />
verban<strong>de</strong>n mit diesem Wort<br />
die Vorstellung eines festumgrenzten<br />
Gelän<strong><strong>de</strong>s</strong> zum<br />
Anbau "feinerer" Nutzpflanzen. Auch große Parkanlagen<br />
wur<strong>de</strong>n von jeher als Gärten verstan<strong>de</strong>n - schon die alten<br />
Römer verwen<strong>de</strong>ten für Garten und Park dasselbe Wort.<br />
Das Garten-Verständnis war von Anbeginn durch die<br />
jeweiligen gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnisse,<br />
Sitten und Gebräuche sowie vom <strong>Natur</strong>verständnis <strong>de</strong>r<br />
Leute geprägt. Deshalb fin<strong>de</strong>n wir in je<strong>de</strong>r Epoche diesen<br />
Gegebenheiten entsprechen<strong>de</strong> Gartenform. Ab <strong>de</strong>m 7.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> das Beet das eigentlich Charakteristische<br />
für <strong>de</strong>n mitteleuropäischen Garten. Es hob die<br />
Kostbarkeit <strong>de</strong>r Gartenpflanzen hervor und gestattete ihre<br />
sorgfältige Behandlung. Seine Zweckmäßigkeit ist bis heute<br />
unumstritten. Der <strong>de</strong>utsche Bauerngarten stellt eine<br />
direkte Weiterentwicklung <strong><strong>de</strong>s</strong> ger-<br />
manischen Hauslan<strong><strong>de</strong>s</strong> unter <strong>de</strong>m<br />
Einfluss und Vorbild <strong>de</strong>r Klostergärten<br />
dar. Kennzeichnend waren<br />
dabei die nüchterne Regelmäßig-<br />
keit <strong>de</strong>r Anlage und ein ebenso<br />
beschei<strong>de</strong>ner Pflanzenbestand.<br />
Biogarten in Prieros<br />
Es gibt viele verschie<strong>de</strong>ne Gartentypen - Hausgarten, Gemüsegarten, Obstgarten,<br />
Blumengarten ... Neuere „Spezialisierungen“ sind z.B. Schulgarten, <strong>Natur</strong>- o<strong>de</strong>r<br />
Waldlehrgarten.<br />
Mit Stand 1994 gab es in Deutschland 17 Millionen Zier- und Nutzgärten. Jährlich<br />
kommen 150.000 hinzu. Nach Angaben <strong>de</strong>r Deutschen Gartenbau-Gesellschaft<br />
geben Hobbygärtner pro Jahr rund 3 Milliar<strong>de</strong>n Euro für Pflanzen und Gartenzubehör<br />
aus.<br />
Früher dienten die Gärten fast ausschließlich <strong>de</strong>m Anbau von Nutzpflanzen. Mit <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r mittelalterlichen Städte entwickelten sich auch die Ziergärten. Sie<br />
dienten <strong>de</strong>r Repräsentation und <strong>de</strong>r Freizeitgestaltung. Heute sind Gärten<br />
multifunktionale Anlagen, die Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze bieten.
� Schon gewusst?<br />
Natürlicher Dünger<br />
Da die Schwarzerle in Symbiose<br />
mit Bakterien in <strong>de</strong>r<br />
Lage ist, Stickstoff aus <strong>de</strong>r<br />
Luft zu bin<strong>de</strong>n und in<br />
Wurzelknollen anzureichern,<br />
wur<strong>de</strong> sie früher auch<br />
gerne in landwirtschaftlichen<br />
Mischkulturen gepflanzt.<br />
"Wasserfestes" Holz<br />
In Wasser verbaut zeigt<br />
Erlenholz beson<strong>de</strong>rs große<br />
Dauerhaftigkeit und wird<br />
daher gerne für Wasserbauten<br />
verwen<strong>de</strong>t. Halb<br />
Venedig ist auf Schwarzerlen-Pfählen<br />
gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Keine Herbstfärbung!<br />
Da die Schwarzerle wegen<br />
ihrer Wurzelknollen keine<br />
Nährstoffe sparen muss,<br />
wirft sie ihre Blätter grün ab.<br />
� Rückblick<br />
2002 <strong>de</strong>r Wachol<strong>de</strong>r<br />
2001 die Esche<br />
2000 die Sandbirke<br />
� Steckbrief<br />
Vorkommen :<br />
Alter :<br />
Größe :<br />
Früchte :<br />
Baum <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Die Schwarzerle<br />
(Alnus glutinosa L.)<br />
Proklamation: „Kuratorium Baum <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong>“ e.V.<br />
Das Kuratorium „Baum <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
<strong>Jahres</strong>“ hat die Schwarzerle zum<br />
Baum <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong> erwählt.<br />
Obwohl diese Baumart zur Zeit<br />
noch recht verbreitet ist, wird ihr<br />
Bestand durch einen erst 1993<br />
ent<strong>de</strong>ckten Scha<strong>de</strong>rreger bedroht.<br />
Dieser pilzförmige Organismus<br />
kann sich aktiv im<br />
Wasser ausbreiten und führt bei<br />
<strong>de</strong>r Schwarzerle - zunächst am<br />
Bil<strong>de</strong>r (3) : Kuratorium Baum <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong><br />
Stammfuß - zum Absterben <strong>de</strong>r<br />
Rin<strong>de</strong>n. Da <strong>de</strong>r Baum bevorzugt an feuchten Standorten<br />
vorkommt, be<strong>de</strong>utet dies eine ernste Bedrohung <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
gesamten Erlenbestan<strong><strong>de</strong>s</strong>.<br />
Bei <strong>de</strong>r Schwarzerle gibt es männliche und<br />
weibliche Blüten, die aber am gleichen Baum<br />
vorkommen (Einhäusigkeit). Sie beginnt im<br />
Frühjahr schon sehr zeitig zu blühen; die<br />
unscheinbaren Blüten wer<strong>de</strong>n windbestäubt.<br />
Während <strong><strong>de</strong>s</strong> Heranreifens <strong>de</strong>r<br />
Früchte verholzt <strong>de</strong>r Fruchtstand<br />
und platzt schließlich wie ein Zapfen<br />
auf. Die winzigen Samen haben<br />
Auswüchse, die luftgefüllt sind und als<br />
Schwimmpolster dienen. Daher kann sich<br />
die Schwarzerle sehr gut als Pionierpflanze<br />
an feuchten Standorten verbreiten.<br />
Die Schwarzerle ist in fast ganz Europa heimisch. Sie stockt vornehmlich in <strong>de</strong>n<br />
tieferen Lagen. In Deutschland gibt es nur in <strong>de</strong>r nordost<strong>de</strong>utschen Tiefebene noch<br />
ausge<strong>de</strong>hnte Schwarzerlenvorkommen. Eines <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten ist das im<br />
Spreewald (südlich von Berlin).<br />
Im Vergleich zu an<strong>de</strong>ren Laubbaumarten wird <strong>de</strong>r Baum mit 100 bis 200 Jahren nicht<br />
beson<strong>de</strong>rs alt.<br />
Die Schwarzerle erreicht einen Stammdurchmesser von über 1 m und eine Höhe von<br />
mehr als 35 m. Dabei fällt ihr gera<strong>de</strong>r Wuchs auf.<br />
Die Früchte <strong><strong>de</strong>s</strong> Baumes gleichen Zapfen. Nach ihrer Entwicklung brechen sie auf<br />
und geben die Samen frei.
� Schon gewusst?<br />
Orchi<strong>de</strong>e <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Die Fliegen-Ragwurz<br />
(Ophrys insectifera L.)<br />
Optische Täuschung<br />
Mit <strong>de</strong>n braunen Petalen (das<br />
sind die bei<strong>de</strong>n schmalen<br />
Blütenblätter) und <strong>de</strong>m Pelz<br />
gleicht die Fliegen-Ragwurz<br />
einem Insekt, welches <strong>de</strong>n Kopf in<br />
eine grüne Blüte hineingesteckt<br />
hat.<br />
Duften<strong>de</strong> Verführung<br />
Die Blüten <strong>de</strong>r Fliegen-Ragwurz<br />
versprühen <strong>de</strong>n Sexuallockstoff<br />
eines paarungsbereiten Weibchens<br />
<strong>de</strong>r Familie <strong>de</strong>r Graswespen<br />
(Familie Hymenoptera).<br />
Damit sollen <strong>de</strong>ren Männchen<br />
angelockt wer<strong>de</strong>n, um die Bestäubung<br />
zu sichern. Dieser Effekt<br />
wird durch das Aussehen <strong>de</strong>r<br />
Blüte verstärkt und führt bei <strong>de</strong>n<br />
Graswespen zur Pseudokopulation.<br />
� Rückblick<br />
2002 die Vogelnestwurz<br />
2001 die Herbst-Wen<strong>de</strong>l-<br />
orchis<br />
2000 das Rote Waldvögelein<br />
� Steckbrief<br />
Vorkommen :<br />
Blütenform :<br />
Färbung :<br />
Vermehrung :<br />
Proklamation: Arbeitskreis heimischer Orchi<strong>de</strong>en<br />
Die Fliegen-Ragwurz wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n<br />
Vorstän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Arbeitskreise<br />
Heimischer Orchi<strong>de</strong>en zur Orchi<strong>de</strong>e <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
<strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong> gewählt.<br />
Die schöne Pflanze ist <strong>de</strong>rzeit noch von <strong>de</strong>r<br />
nördlichen Mitte Deutschlands bis in <strong>de</strong>n<br />
Bil<strong>de</strong>r (2) : AHO<br />
Sü<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>s</strong> Lan<strong><strong>de</strong>s</strong> beheimatet. Ihr Lebensraum<br />
schwin<strong>de</strong>t jedoch und somit ist auch die Pflanze<br />
bedroht, was mit ein Grund für ihre Proklamation ist.<br />
Die Fliegen-Ragwurz kommt hauptsächlich auf Kalk-<br />
Magerrasen vor. Da diese Standorte<br />
für die Landwirtschaft immer<br />
unattraktiver wer<strong>de</strong>n, pflegt man sie<br />
häufig nicht mehr und sie<br />
„verbuschen“. In <strong>de</strong>n dann von<br />
Gehölzen beschatteten Bereichen<br />
fühlt sich die lichtlieben<strong>de</strong> Pflanze<br />
nicht mehr wohl; sie stellt ihr<br />
Blühen und schließlich das Wachstum<br />
ein. Beson<strong>de</strong>rs die nachlassen<strong>de</strong><br />
Schafhaltung und damit ungenügen<strong>de</strong><br />
Beweidung dieser Wiesen führt zum Rückgang <strong>de</strong>r<br />
Fliegen-Ragwurz. Ein an<strong>de</strong>res Problem ist die<br />
zunehmen<strong>de</strong> Bebauung solcher Flächen, die dadurch für<br />
immer verloren gehen.<br />
Die EU hat die Erhaltungswürdigkeit <strong>de</strong>r Kalk-<br />
Magerrasen erkannt und <strong><strong>de</strong>s</strong>halb die Schutzgebietsausweisung<br />
dieser Lebensräume als prioritär eingestuft.<br />
Die Fliegen-Ragwurz ist von <strong>de</strong>r nördlichen Mitte Deutschlands bis in <strong>de</strong>n Sü<strong>de</strong>n<br />
unseres Lan<strong><strong>de</strong>s</strong> beheimatet. Sie wächst bevorzugt auf Kalk-Magerrasen.<br />
Diese Orchi<strong>de</strong>e verfügt über einen typischen sechsblättrigen Orchi<strong>de</strong>enblütenaufbau.<br />
Die sogenannte Blütenlippe mit ihrem blauen Fleck ist mit einem Pelz überzogen.<br />
Drei <strong>de</strong>r sechs Blütenblätter sind grün, die an<strong>de</strong>ren weisen eine bräunliche Färbung auf.<br />
Die Blüte ahmt durch ihr Aussehen, ihre pelzige Oberfläche und ihren Geruch ein<br />
weibliches Insekt nach. Dadurch lockt die Fliegen-Ragwurz beson<strong>de</strong>rs<br />
Graswespenmännchen an, welche die Blüte dann unfreiwillig bestäuben.
� Schon gewusst?<br />
Geselliger Wolf<br />
Der Wolf ist ein geselliges Tier,<br />
welches in Ru<strong>de</strong>ln lebt. Diese<br />
wer<strong>de</strong>n vom Leitwolf angeführt.<br />
Wolfsgeheul<br />
Das berühmte schauerliche<br />
Wolfsgeheul dient <strong>de</strong>r<br />
Reviermarkierung und <strong>de</strong>r<br />
Verständigung im Ru<strong>de</strong>l.<br />
Weltbürger<br />
Der Wolf kann zurecht als<br />
Weltbürger bezeichnet wer<strong>de</strong>n,<br />
da er früher auf fast <strong>de</strong>r<br />
gesamten Nordhalbkugel heimisch<br />
war. Daher gibt es auch<br />
über 40 Unterarten, die sich in<br />
Größe, Aussehen, aber auch<br />
im Verhalten unterschei<strong>de</strong>n.<br />
� Rückblick<br />
2002 das Rotwild<br />
2001 <strong>de</strong>r Feldhase<br />
2000 die Äskulapnatter<br />
� Steckbrief<br />
Verbreitung :<br />
Größe/Alter :<br />
Nahrung :<br />
Fortpflanzung :<br />
Wildtier <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Der Wolf<br />
(Canis lupus)<br />
Proklamation: Schutzgemeinschaft Deutsches Wild e.V.<br />
Die Schutzgemeinschaft Deutsches<br />
Wild e.V. hat <strong>de</strong>n Wolf<br />
zum Wildtier <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
proklamiert. Durch intensive<br />
Bejagung ist „Isegrim“ in<br />
Deutschland bekanntlich seit<br />
langem ausgerottet. In letzter<br />
Zeit dringen jedoch von Osten<br />
her immer wie<strong>de</strong>r Ru<strong>de</strong>l o<strong>de</strong>r<br />
Einzelgänger zu uns vor. So<br />
Wolf (Foto: G. Ganter)<br />
hatten sich bereits im Herbst<br />
2000 in <strong>de</strong>r Muskauer Hei<strong>de</strong> (Sachsen, nahe <strong>de</strong>r Grenze zu<br />
Polen) sechs Tiere angesie<strong>de</strong>lt. Das Ru<strong>de</strong>l lebt auf einem<br />
14.500 Hektar großen Truppenübungsplatz und hat bereits<br />
zweimal Nachwuchs bekommen.<br />
Da die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r<br />
Schafs- o<strong>de</strong>r Ziegenhaltung<br />
in Deutschland<br />
immer weiter zurückgeht,<br />
scheint gegenwärtig die<br />
Akzeptanz <strong>de</strong>r Wölfe in <strong>de</strong>r<br />
Bevölkerung zu steigen,<br />
zumal wolfsbedingte Ver-<br />
luste an Wei<strong>de</strong>tieren durch<br />
Wolf mit Jungen (Foto: dpa)<br />
die Behör<strong>de</strong>n ersetzt wer<strong>de</strong>n. Die Hauptnahrungsquelle<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Wölfe ist übrigens zur Zeit das Rotwild.<br />
Der Wolf war ursprünglich fast auf <strong>de</strong>r gesamten Nordhalbkugel heimisch - es gibt<br />
sogar eine arabische Unterart. In Deutschland wur<strong>de</strong> er ausgerottet, wan<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>rzeit<br />
von Osten her aber wie<strong>de</strong>r ein.<br />
Erwachsene Wölfe erreichen 12 bis 80 kg. Sie sind dann 1 bis 1,6 m groß und<br />
wer<strong>de</strong>n 10 bis 20 Jahre alt.<br />
Wölfe jagen vorwiegend schwache und junge Huf- o<strong>de</strong>r Nagetiere, ernähren sich aber<br />
auch von Haustieren und fressen sogar Obst und allerlei Abfälle.<br />
Die Paarung fin<strong>de</strong>t im Januar und Februar statt. Nach einer Tragezeit von 61 bis 63<br />
Tagen kommen 3 bis 8 Junge zur Welt. Wölfe sind mit 1 bis 3 Jahren geschlechtsreif.
� Schon gewusst?<br />
Giftige Eier<br />
Der Rogen (die Fischeier)<br />
von Barben ist giftig und verursacht<br />
Durchfall, Erbrechen<br />
und teilweise sogar Herzanfälle.<br />
Falscher Bart<br />
Die vier Barteln <strong>de</strong>r Barben<br />
sind sensible Tastorgane, die<br />
<strong>de</strong>r Barbe - als Grundfisch -<br />
helfen, Nahrung aufzustöbern.<br />
Schmackhaftes Fleisch<br />
Unter <strong>de</strong>n Cyprini<strong>de</strong>n (karpfenartige<br />
Fische) haben die<br />
Barben ein sehr schmackhaftes<br />
Fleisch. Früher war die<br />
Barbe jedoch nur gering<br />
geschätzt - ihr Fleisch wur<strong>de</strong><br />
sogar als Dünger missbraucht.<br />
� Rückblick<br />
2002 die Quappe<br />
2001 <strong>de</strong>r Stör<br />
2000 <strong>de</strong>r Lachs<br />
� Steckbrief<br />
Vorkommen :<br />
Körperform :<br />
Färbung :<br />
Maulform :<br />
Fortpflanzung :<br />
Nahrung :<br />
Fisch <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Die Barbe<br />
(barbus barbus)<br />
Proklamation: Verband <strong>de</strong>utscher Sportfischer (VdSF) e.V.<br />
Die Barbe ist -<br />
wie schon einige<br />
Fisch-<strong><strong>de</strong>s</strong>-<br />
<strong>Jahres</strong>-Favoriten<br />
vor ihr -<br />
eine wan<strong>de</strong>rn<strong>de</strong><br />
Fischart.<br />
Auch sie ist<br />
Bild : VdSF<br />
infolge von Verän<strong>de</strong>rungen<br />
ihres Lebensraumes durch Stauwerke und<br />
Wasserkraftanlagen, welche die Durchgängigkeit <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Flusslaufs min<strong>de</strong>rn, bedroht.<br />
Außer<strong>de</strong>m sind durch die abnehmen<strong>de</strong> Fließgeschwindigkeit<br />
<strong>de</strong>r Wasserläufe in <strong>de</strong>n letzten Jahrzehnten viele<br />
Laichgebiete dieses Süßwasserbewohners verschlammt.<br />
Die Barbe ist <strong>de</strong>r Leitfisch <strong><strong>de</strong>s</strong> Mittellaufs unserer Flüsse<br />
(Barbenregion), <strong>de</strong>r sich von <strong>Natur</strong> aus durch klares, rasch<br />
fließen<strong><strong>de</strong>s</strong> und gut belüftetes Wasser auszeichnet. Der<br />
gesellig leben<strong>de</strong> Schuppenträger zieht hier zur Laichzeit in<br />
großen Schwärmen zu seinen weiter flussaufwärts<br />
liegen<strong>de</strong>n Laichgebieten, wo er Geröll und Kies als<br />
Laichunterlage antrifft. Wird ihm jedoch <strong>de</strong>r Weg durch<br />
Wasserbauwerke verwehrt, so ist seine Fortpflanzung in<br />
<strong>de</strong>n gestauten Flussabschnitten wegen <strong><strong>de</strong>s</strong> fehlen<strong>de</strong>m<br />
Laichsubstrat gefähr<strong>de</strong>t und das Vorkommen vom<br />
Untergang bedroht.<br />
Heute muss <strong>de</strong>r Bestand dieses einst sehr verbreiteten<br />
Fisches in vielen Fließgewässern durch Besatz gestützt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Barbe kommt natürlich in fast ganz West- und Mitteleuropa vor und bevorzugt<br />
klare Flüsse mit kiesigem bzw. sandigem Grund.<br />
Der Körper dieses Süßwasserbewohners ist langgestreckt und walzenförmig. Der<br />
Bauch wirkt leicht abgeflacht.<br />
Die Barbe erscheint insgesamt bräunlich; ihr Rücken schimmert grün, <strong>de</strong>r Bauch<br />
leicht weißlich.<br />
Der Fisch hat ein stark unterständiges Maul mit vier Barteln, von <strong>de</strong>nen jeweils zwei<br />
an <strong>de</strong>r Oberlippe und in <strong>de</strong>r Maulspalte sitzen.<br />
Zur Laichzeit ziehen die Barben die Flüsse herauf, um auf kiesigem Grund im flachen<br />
Wasser zu laichen. Dabei trägt die männliche Barbe „Laichausschlag“. Das Weibchen<br />
legt ca. 3.000 - 9.000 Eier ab. Nach ca. 10 - 15 Tagen schlüpfen die Jungfische.<br />
Algen, Pflanzenreste, Insektenlarven, Kleinkrebse, Würmer, Muscheln, Schnecken,<br />
Krebse ...
Pilz <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Der Papageigrüne Saftling<br />
(Hygrocybe psittacina)<br />
Proklamation: Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) e.V.<br />
� Schon gewusst?<br />
Glasiges Fleisch<br />
Wegen <strong>de</strong>m gera<strong>de</strong> im Alter<br />
zumeist glasigem Fleisch<br />
wer<strong>de</strong>n Saftlinge auch manchmal<br />
"Glasköpfe" genannt.<br />
Gefährlichster Pilz<br />
Der gefährlichste Pilz ist <strong>de</strong>r<br />
grüne Knollenblätterpilz. 2 bis<br />
12 Stun<strong>de</strong>n nach Verzehr<br />
treten Erbrechen, Delirium,<br />
Kollaps und schließlich in über<br />
50 % <strong>de</strong>r Fälle <strong>de</strong>r Tod ein.<br />
Leuchten<strong>de</strong> Pilze<br />
Ein gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Nacht<br />
beson<strong>de</strong>rs interessanter Pilz<br />
ist <strong>de</strong>r Hallimasch. Holz,<br />
welches vom Myzel <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Hallimasch durchsetzt ist, kann<br />
nachts leuchten. Von nordischen<br />
Völkern wur<strong>de</strong> das<br />
sogar teilweise zur Wegmarkierung<br />
in <strong>de</strong>r Nacht ausgenutzt.<br />
�R ückblick<br />
2002 <strong>de</strong>r Orangefuchsige<br />
Rauhkopf<br />
2001 die Mäan<strong>de</strong>rtrüffel<br />
2000 <strong>de</strong>r Königs-Fliegen-<br />
pilz<br />
� Steckbrief<br />
Giftigkeit :<br />
Vorkommen :<br />
Aussehen :<br />
Papageigrüner Saftling<br />
Der Papageigrüne<br />
Saftling wur<strong>de</strong> von<br />
<strong>de</strong>r Deutschen Gesellschaft<br />
für Mykologie<br />
zum Pilz <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
<strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong> gekürt.<br />
Er ist durch <strong>de</strong>n<br />
Rückgang seines<br />
Lebensraums (magere<br />
Wiesen) stark<br />
gefähr<strong>de</strong>t. Der auf-<br />
fällige Hutträger lebt auf diesen Offenbiotopen in<br />
Symbiose mit verschie<strong>de</strong>nen Wiesenkräutern und<br />
-gräsern. Weitere Pilzarten dieses Lebensraums sind<br />
Rötlinge, Erdzungen, Boviste, verschie<strong>de</strong>ne Korallen- und<br />
Keulenpilze. Der Papageigrüne Saftling zählt zu <strong>de</strong>n wohl<br />
schönsten Pilzen und wird daher auch als „Orchi<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r<br />
Pilze“ bezeichnet.<br />
Die glänzend-grünen Geschöpfe, <strong>de</strong>ren Hüte Durchmesser<br />
von bis zu 5 cm<br />
erreichen, sind für <strong>de</strong>n<br />
Verzehr nicht geeignet.<br />
Bis heute ist noch<br />
unbekannt, warum die<br />
meisten Saftlinge bei<br />
uns auf Wiesen wachsen,<br />
während man sie in<br />
an<strong>de</strong>ren Kontinenten oft<br />
in Wäl<strong>de</strong>rn fin<strong>de</strong>t. Es wird<br />
Bild : dt. Gesellschaft für Mykologie<br />
jedoch davon ausgegangen, dass Saftlinge in unserer<br />
Region Symbiosen mit <strong>de</strong>n Gräsern <strong>de</strong>r Wiesen bil<strong>de</strong>n.<br />
Der Papageigrüne Saftling steht wie viele an<strong>de</strong>re Saftlinge im Verdacht, leichte<br />
Vergiftungserscheinungen hervorzurufen.<br />
Der Papageigrüne Saftling kommt beson<strong>de</strong>rs auf Wiesen und in grasigen Wäl<strong>de</strong>rn,<br />
auf Sand und Silikatbö<strong>de</strong>n im Zeitraum von August bis Oktober vor.<br />
Der Hut ist meist grün, obwohl auch gelbe, orange und violette Farbnuancen<br />
möglich sind. Die grüne Färbung verblasst im Alter zu einem fahlen Gelborange.
� Schon gewusst?<br />
Krachmacher<br />
Das Grillen-Männchen bewegt<br />
zum Zirpen die schräg angestellten<br />
Flügel rasch gegeneinan<strong>de</strong>r.<br />
Das Zirpen ist in einem Umkreis<br />
von bis zu 50 m zu hören.<br />
Ohren-Beine<br />
Das Grillen-Weibchen benutzt<br />
zur Ortung seines Männchens<br />
die Vor<strong>de</strong>rbeine. Mit einem<br />
großen und einem kleinen<br />
Trommelfell in je<strong>de</strong>r<br />
Vor<strong>de</strong>rschiene kann das<br />
paarungsbereite Tier das<br />
Männchen auf 10 m orten.<br />
Schlechte Mutter<br />
Das Feldgrillenweibchen ist eine<br />
schlechte Mutter. Nach <strong>de</strong>r Eiablage<br />
in <strong>de</strong>r Wohnröhre sind die Larven<br />
völlig auf sich allein gestellt<br />
und wer<strong>de</strong>n nicht weiter versorgt.<br />
� Rückblick<br />
2002 <strong>de</strong>r Zitronenfalter<br />
2001 die Plattbauch-Libelle<br />
2000 <strong>de</strong>r Goldglänzen<strong>de</strong><br />
Rosenkäfer<br />
� Steckbrief<br />
Vorkommen :<br />
Aussehen :<br />
Fortpflanzung :<br />
Insekt <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Die Feldgrille<br />
(Gryllus campestris L.)<br />
Proklamation: Kuratorium „Insekt <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong>“ e.V.<br />
Bild : Kuratorium Insekt <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong><br />
Das Kuratorium „Insekt<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong>“ hat die<br />
Feldgrille als <strong>de</strong>n wohl<br />
populärsten Vertreter <strong>de</strong>r<br />
rund 80 heimischen<br />
Heuschreckenarten zum<br />
Insekt <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
ausgerufen. Das Wort<br />
„Grille“ ist mit PLINIUS d.Ä.<br />
aus <strong>de</strong>m Griechischen<br />
„gryllos“ über das lateinische „gryllus“ zu uns gekommen<br />
und bezeichnete damit auch Heuschrecken schlechthin.<br />
Später kann es im Althoch<strong>de</strong>utschen mit „grillo“ und im<br />
Mittelhoch<strong>de</strong>utschen mit „grille“ belegt wer<strong>de</strong>n. Mit<br />
Charles von Linné wird „Gryllus“ im Jahr 1758 zum ersten<br />
Gattungsnamen für Heuschrecken überhaupt.<br />
Die Feldgrille ist von<br />
<strong>de</strong>r nordwestafrikanischen<br />
Küste bis zur<br />
Nord- und Ostsee,<br />
und von Zentralspa-<br />
nien bis in <strong>de</strong>n<br />
Kaukasus verbreitet.<br />
Bild : Kuratorium Insekt <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong><br />
Obwohl dieses Insekt in Deutschland zur Zeit noch sehr<br />
häufig vorkommt, dürfte es seltener wer<strong>de</strong>n und allmählich<br />
verschwin<strong>de</strong>n, wenn unsere Wiesen infolge zurückgehen<strong>de</strong>r<br />
Bewirtschaftung und Beweidung weiter verbuschen.<br />
Die Feldgrille ist von Nordwestafrika bis zur Ostsee sowie von Mittelspanien bis in<br />
<strong>de</strong>n Kaukasus verbreitet.<br />
Das fertig entwickelte Insekt ist über 2 cm lang, hat kräftige hintere Sprungbeine und<br />
einen mit „Goldsamt“ geschmückten schwarzen Körper. Die Weibchen erkennt man<br />
an <strong>de</strong>r Legeröhre und <strong>de</strong>n braunen Deckflügeln.<br />
Das Weibchen ortet ein zirpen<strong><strong>de</strong>s</strong> Männchen auf bis zu 10 m Entfernung. Nach <strong>de</strong>r<br />
Paarung folgt eine bis zu 2 Stun<strong>de</strong>n dauern<strong>de</strong> Nachbalz. Die weibliche Grille legt im<br />
Laufe ihres etwa zweimonatigen Lebens einige hun<strong>de</strong>rt Eier in Haufen von jeweils 20<br />
bis 40 in eine Wohnröhre ab. Die Jungen schlüpfen im Juni/Juli nach 2 bis 3 Wochen.<br />
In <strong>de</strong>r weiteren Entwicklung häuten sie sich noch bis zu zehn mal. Die elfte und letzte<br />
Häutung fin<strong>de</strong>t an sonnigen Apriltagen <strong><strong>de</strong>s</strong> Folgejahres statt.
� Schon gewusst?<br />
Lebenserwartung<br />
Die große Zitterspinne kann<br />
bis zu 3 Jahre alt wer<strong>de</strong>n.<br />
Trockene Netze<br />
Im Gegensatz zu vielen<br />
an<strong>de</strong>ren heimischen Spinnenarten,<br />
wie z.B. <strong>de</strong>r<br />
Kreuzspinne, haben die<br />
Netze <strong>de</strong>r Großen Zitterspinne<br />
keine Leimtröpfchen.<br />
Dafür verfügen sie über<br />
beson<strong>de</strong>re Schraubfä<strong>de</strong>n,<br />
welche auf die Beute wie<br />
Fußfesseln wirken können.<br />
Nützlicher „Untermieter“<br />
Die Große Zitterspinne ist<br />
ein nützlicher Mitbewohner<br />
in fast je<strong>de</strong>m Haus: Sie<br />
fängt viele lästige Insekten<br />
wie Fliegen und Mücken.<br />
� Rückblick<br />
2002 die Listspinne<br />
2001 die Wespenspinne<br />
2000 die Wasserspinne<br />
� Steckbrief<br />
Vorkommen :<br />
Nahrung :<br />
Aussehen :<br />
Fortpflanzung :<br />
Spinne <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Die Große Zitterspinne<br />
(Pholcus Phalangioi<strong><strong>de</strong>s</strong>)<br />
Proklamation: Arachnologische Gesellschaft e.V.<br />
Die Arachnologische Gesellschaft e.V. hat die Große<br />
Zitterspinne zur Spinne <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong> gekürt. Diese<br />
Spinne ist beson<strong>de</strong>rs<br />
im Sü<strong>de</strong>n<br />
Europas<br />
weit verbreitet,<br />
kommt aber<br />
auch in MittelundNor<strong>de</strong>uropa<br />
in fast je<strong>de</strong>m<br />
Haus vor.<br />
Bild : Arachnologische Gesellschaft<br />
Neben <strong>de</strong>r<br />
Großen gibt es<br />
noch weitere Zitterspinnen, die sich aber alle nur anhand<br />
<strong>de</strong>r Geschlechtsorgane unterschei<strong>de</strong>n lassen. Ausgewachsene<br />
Männchen und Weibchen kann man leicht<br />
auseinan<strong>de</strong>rhalten: Die Männchen verfügen an ihren<br />
Tastern über große Geschlechtsorgane. Den Weibchen<br />
hingegen fehlen diese Bildungen; sie weisen lediglich dünne<br />
beinartige Taster auf. Die Weibchen fallen kurz vor <strong>de</strong>r<br />
Eiablage auch noch durch einen großen, prall mit Eiern<br />
gefüllten Hinterleib auf.<br />
Der Name <strong>de</strong>r Zitterspinnen geht auf ein interessantes<br />
Verhalten zurück: Stört man sie in ihrem Netz o<strong>de</strong>r berührt<br />
sie, so schwingen sie heftig - wie zitternd - hin und her.<br />
Dadurch verschwin<strong>de</strong>n ihre Umrisse - potentielle Räuber<br />
können so in <strong>de</strong>r „Beutefanghandlung“ gestört wer<strong>de</strong>n und<br />
lassen irritiert von <strong>de</strong>n zittern<strong>de</strong>n Achtbeinern ab.<br />
Die Große Zitterspinne kommt weltweit vor - in <strong>de</strong>n gemäßigten Zonen jedoch häufiger<br />
als in <strong>de</strong>n Tropen. In Europa ist sie - mit Schwerpunkt Sü<strong>de</strong>n - überall weit verbreitet.<br />
Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten. Manchmal tötet und frisst die Große<br />
Zitterspinne aber auch Bewohner an<strong>de</strong>rer Spinnenetze.<br />
Der grauweiße Körper ist mit 0,7 bis 1,0 cm eher klein. Mit ihren langen Beinen (bis<br />
zu 5 cm) ähnelt das Spinnentier einem Weberknecht, welcher allerdings keine<br />
Spinndrüsen hat.<br />
Die weiblichen Zitterspinnen verpacken ca. 20 Eier in einem dünnen Sei<strong>de</strong>nkokon<br />
und tragen ihn in ihren Fängen mit sich herum. Nach <strong>de</strong>m Schlupf <strong>de</strong>r Jungspinnen<br />
bleiben diese noch einige Zeit im Kokon, bis sie selbstständig wer<strong>de</strong>n.
� Schon gewusst?<br />
Alter Spitz<br />
Der Spitz ist eine <strong>de</strong>r<br />
ältesten <strong>de</strong>utschen Hun<strong>de</strong>rassen,<br />
er wird auf <strong>de</strong>n<br />
steinzeitlichen Torfhund<br />
„Canis familiaris palustris<br />
Rüthimeyer“ zurückgeführt.<br />
Phänomenal<br />
„Chanda-Leah“, ein Zwergpu<strong>de</strong>l<br />
aus Hamilton, ist <strong>de</strong>r<br />
gelehrigste Hund <strong>de</strong>r Welt. Er<br />
kann ein Repertoire aus über<br />
300 Kunststücken - darunter<br />
sind auch Klavierspielen,<br />
Zählen und Buchstabieren.<br />
Retter in <strong>de</strong>r Not<br />
Der Hund Barry, ein Bernhardiner,<br />
hat in seinem Leben<br />
mehr als 40 Menschen in <strong>de</strong>n<br />
Alpen das Leben gerettet.<br />
� Rückblick<br />
2002 das Angler Rind<br />
2001 Bergische Land-<br />
hühner und Baye-<br />
rische Landgänse<br />
2000 das Rottaler<br />
Kalbblut<br />
� Steckbrief<br />
Wi<strong>de</strong>rristhöhe :<br />
Gewicht :<br />
Lebenserwartung :<br />
Nutztier <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Deutsche Haus- und Hofhun<strong>de</strong><br />
Proklamation: Gesellschaft zur Erhaltung alter<br />
und gefähr<strong>de</strong>ter Haustierrassen e.V.<br />
Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefähr<strong>de</strong>ter<br />
Haustierrassen hat die Deutschen Haus- und Hofhun<strong>de</strong> zu<br />
Nutztieren <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong> gewählt. Dabei wird<br />
insbeson<strong>de</strong>re auf <strong>de</strong>n Deutschen Pinscher, <strong>de</strong>n Mittelspitz<br />
und <strong>de</strong>n Großspitz und <strong>de</strong>ren aktuelle Bedrohung dieser<br />
Rassen verwiesen.<br />
Die <strong>de</strong>rzeit extrem gefähr<strong>de</strong>ten<br />
Großspitze gibt es<br />
in <strong>de</strong>n Farben weiß, schwarz<br />
und braun, die stark<br />
gefähr<strong>de</strong>ten Mittelspitze<br />
in schwarz, weiß, braun,<br />
orange und graugewolkt.<br />
Die Zucht <strong><strong>de</strong>s</strong> Deutschen<br />
Mittelspitz<br />
Pinscher und vier übergroßen<br />
Zwergpinschern wie<strong>de</strong>r aufgenommen.<br />
Heute beläuft sich die<br />
Vermehrung <strong><strong>de</strong>s</strong> Deutschen Pinschers<br />
auf 150 Welpen pro Jahr. Damit ist er<br />
ebenfalls eine gefähr<strong>de</strong>te Hun<strong>de</strong>rasse.<br />
Die Gemeinsamkeit bei allen diesen<br />
Hun<strong>de</strong>n ist ihr ausgeprägter<br />
Wachinstinkt, ihre Robustheit gegenüber<br />
Krankheiten sowie Überzüchtung<br />
und ihre Gelehrigkeit und Intelligenz.<br />
Pinschers wur<strong>de</strong> 1958 mit<br />
lediglich einem Deutschen<br />
Deutscher Pinscher<br />
Die Wi<strong>de</strong>rristhöhe <strong>de</strong>r Großspitze beträgt etwa 46 cm ±4 cm, die <strong>de</strong>r Mittelspitze 34<br />
cm ±4 cm, die <strong><strong>de</strong>s</strong> Deutschen Pinscher beträt 45 bis 50 cm.<br />
Der Großspitz wiegt ausgewachsen maximal bis zu 20 kg, <strong>de</strong>r Mittelspitz bis zu 13 kg.<br />
Der Deutsche Pinscher erreicht ausgewachsen bis zu 18 kg.<br />
Mit 10 - 12 Jahren hat <strong>de</strong>r Deutsche Pinscher eine durchschnittliche Lebenserwartung.<br />
Mit 12 bis 13 Jahren (Großspitz) beziehungsweise 13 bis 15 Jahren<br />
(Kleinspitz) liegt die Lebenserwartung <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>utlich höher.
Nutzpflanze <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Jahres</strong> <strong>2003</strong><br />
Die Kartoffel<br />
(Solanum tuberosum L. ssp. tuberosum)<br />
Proklamation: Verein zur Erhaltung <strong>de</strong>r Nutzpflanzenvielfalt e.V.<br />
� Schon gewusst?<br />
Göttliche Kartoffel<br />
Die Inkas hatten einst sogar<br />
eine eigene Kartoffel-Göttin.<br />
Sie hieß Aro-Mamma.<br />
Schöne Kartoffel<br />
Die ersten Kartoffeln in<br />
Europa wur<strong>de</strong>n nur als<br />
Zierpflanzen angebaut (beson<strong>de</strong>rs<br />
die lila blühen<strong>de</strong>n) -<br />
das Bild zeigt, warum...<br />
Kartoffelblüte<br />
� Rückblick<br />
2002 <strong>de</strong>r Flaschenkürbis<br />
2001 die Tomate<br />
2000 die Gartenmel<strong>de</strong><br />
� Steckbrief<br />
Form :<br />
Farbe :<br />
Vermehrung :<br />
Die Kartoffel ist eine in Europa noch recht junge<br />
Kulturpflanze - sie kam bekanntlich erst nach <strong>de</strong>r<br />
Ent<strong>de</strong>ckung Amerikas zu uns. Hier entwickelte sie sich von<br />
einer seltenen Zierpflanze zu <strong>de</strong>m Grundnahrungsmittel. In<br />
ihrer Heimat, <strong>de</strong>n südamerikanischen An<strong>de</strong>n, geht die Kultur<br />
<strong>de</strong>r Kartoffel jedoch bis 2000<br />
vor Christus zurück. Dort<br />
wur<strong>de</strong> sie zuerst von <strong>de</strong>n<br />
Indianern kultiviert - bei <strong>de</strong>n<br />
Inkas zählte sie zu <strong>de</strong>n<br />
Grundnahrungsmitteln.<br />
Die ersten Europäer, welche<br />
Speisekartoffel<br />
die Kartoffel kennenlernten,<br />
waren die Spanier, die bei<br />
ihren Eroberungszügen durch Peru und Chile (1525-1543)<br />
auf die Pflanze trafen. Um 1555 wur<strong>de</strong>n die ersten dieser<br />
rotschaligen, violett-blühen<strong>de</strong>n Gewächse nach Spanien<br />
gebracht. Zehn Jahre später gelangten dann auch die<br />
ersten gelbschaligen Kartoffeln aus Venezuela nach<br />
England. Bei<strong>de</strong> Sorten wur<strong>de</strong>n bei ihrer Ausbreitung über<br />
Europa mehrmals gekreuzt und vermischt. Die große<br />
wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Kartoffel wur<strong>de</strong> dann aber<br />
erst 200 Jahre später erkannt, als Krieg und Not zum<br />
Nach<strong>de</strong>nken über Nahrungsreserven führte. So gab<br />
Preußenkönig Friedrich II. 1756 zu Beginn <strong><strong>de</strong>s</strong> siebenjährigen<br />
Krieges seinen berühmten "Kartoffelbefehl“, <strong>de</strong>r die Bauern<br />
zum „Knollenanbau“ zwang. Der preußische Pro-Kopf-<br />
Verbrauch an Kartoffeln soll 1875 bereits 120 Kilogramm<br />
betragen haben! Die diesjährige Proklamation <strong>de</strong>r Kartoffel soll<br />
u.a. darauf aufmerksam machen, dass die Sortenvielfalt dieser<br />
wichtigen Pflanze (und vor allem ihrer Wildarten) heutzutage<br />
durch die Vermarktung von mo<strong>de</strong>rnen Arten stark gefähr<strong>de</strong>t ist.<br />
Kartoffeln sind meist rund bis ellipsoid, können aber auch unregelmäßig geformt sein.<br />
Die Kartoffelknollen erscheinen gelblich; es gibt aber auch violette Arten. Die Blüte<br />
<strong>de</strong>r Kartoffelpflanze ist weiß o<strong>de</strong>r rosa bis violett.<br />
Die Kartoffel vermag sich auf zwei Wegen verbreiten: Die Knollen können (wie bei<br />
Saatkartoffeln) austreiben und eine neue Pflanze bil<strong>de</strong>n. Wer<strong>de</strong>n die Blüten bestäubt,<br />
bil<strong>de</strong>n sich Samen an <strong>de</strong>n Blütenstän<strong>de</strong>n. Dabei kommt es oft zur Selbstbefruchtung.