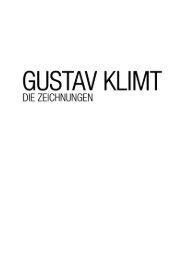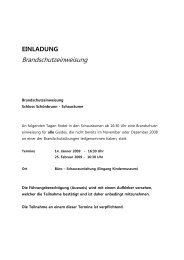Kutschen, Kleider, Kultobjekte - Die Fachgruppe Wien der ...
Kutschen, Kleider, Kultobjekte - Die Fachgruppe Wien der ...
Kutschen, Kleider, Kultobjekte - Die Fachgruppe Wien der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SISI AUF DER SPUR<br />
<strong>Kutschen</strong>, <strong>Klei<strong>der</strong></strong>, <strong>Kultobjekte</strong> <strong>der</strong><br />
Kaiserin Elisabeth von Österreich.<br />
Eine Ausstellung <strong>der</strong> Wagenburg des Kunsthistorischen Museums,<br />
1130 <strong>Wien</strong>, Schloss Schönbrunn<br />
30. Mai 2008 bis Ende 2009<br />
Im Rahmen dieser Ausstellung werden in <strong>der</strong> Wagenburg ab 30. Mai einmalige authentische Erinnerungsstücke an<br />
Kaiserin Elisabeth zu sehen sein. Durch die Schausammlung wird ein „Sisi-Pfad“ führen, <strong>der</strong> den Lebensweg <strong>der</strong><br />
Kaiserin von ihrer Hochzeit bis zu ihrem tragischen Tod anhand ihrer Fahrzeuge nachvollziehbar macht. Präsentiert<br />
werden diese <strong>Kutschen</strong> gemeinsam mit Portraits, Gemälden und weltweit einmaligen Objekten aus Sisis persönlichem<br />
Besitz:<br />
Gleich zu Beginn kann man neben ihrer Hochzeitskutsche die wun<strong>der</strong>bare goldbestickte Schleppe bewun<strong>der</strong>n, die Sisi<br />
1854 zu ihrem Brautkleid trug. Kultstatus hat auch <strong>der</strong> einzig erhaltene Sattel <strong>der</strong> Kaiserin, dem die Portraits ihrer<br />
Lieblingspferde gegenüber gestellt sind. Eine wahre Ikone für Sisi-Fans ist ein prachtvolles schwarzes Kleid mit<br />
meterlanger Schleppe, das ihre eindrucksvolle Erscheinung auf einzigartige Weise wie<strong>der</strong> lebendig macht.
SISI SISI SISI AUF AUF DER DER SPUR<br />
SPUR<br />
<strong>Kutschen</strong>, <strong>Klei<strong>der</strong></strong>, <strong>Kultobjekte</strong> <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth Elisabeth von von Österreich.<br />
Österreich.<br />
<strong>Die</strong> Wagenburg des Kunsthistorischen Museums und das ihr angeschlossene Monturdepot zählen weltweit zu den wenigen<br />
Museen in <strong>Wien</strong>, die eine große Anzahl authentischer Erinnerungsstücke <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth von Österreich besitzen.<br />
Dazu gehören die eindrucksvollen Roben <strong>der</strong> Kaiserin und Objekte ihres persönlichen Gebrauchs wie ihr roter Damensattel.<br />
Aus konservatorischen Gründen können die meisten dieser einzigartigen Stücke doch nur ganz selten <strong>der</strong> Öffentlichkeit<br />
präsentiert werden. Hinzu kommen zahlreiche „Portraits“ von Elisabeths Reitpferden, die sie in ihrer „Reitkapelle“ versammelt<br />
hatte, sowie Darstellungen einiger ihrer Hunde.<br />
Darüber hinaus können die wichtigsten Ereignisse im Leben <strong>der</strong> Kaiserin und Königin von ihrer Hochzeit bis zu ihrem<br />
tragischen Tod anhand <strong>der</strong> von ihr benutzen Fahrzeuge nachvollziehbar gemacht werden. Das betrifft ihren (ursprünglich für<br />
Napoleon gebauten) Einzugswagen als kaiserliche Braut, den goldenen Imperialwagen, in dem sie zu ihrer Krönung in die<br />
Matthiaskirche von Budapest gefahren wurde, ihr zuletzt vor ihrer Ermordung benutztes Leiblandaulett und schließlich den<br />
imposanten schwarzen Leichenwagen, mit dem sie zur Kapuzinergruft geführt wurde. Gezeigt werden außerdem die<br />
bezaubernden Kin<strong>der</strong>kutschen ihrer Tochter Gisela und des Kronprinzen Rudolf.<br />
Insgesamt acht Themenschwerpunkte zu Elisabeths Leben sind anlässlich dieser Ausstellung in die allgemeine, nun neu<br />
angeordnete Schausammlung <strong>der</strong> Wagenburg integriert und führen den Besucher auf Sisis Spur. So wird, ausgehend von<br />
ihren <strong>Kutschen</strong>, ein neuer und ungewöhnlicher Blick auf die Person <strong>der</strong> berühmten Monarchin ermöglicht, in <strong>der</strong>en Leben<br />
bereits vor über 100 Jahren heute aktuelle Themen wie Mobilität, Sport und Schlankheitskult eine bedeutende Rolle gespielt<br />
haben.<br />
2<br />
Kaiserin Elisabeth im Frisiermantel<br />
Gemälde von Eberhard Riegele (1923) nach einem<br />
Original von Franz Xaver Winterhalter (1864)<br />
Regensburg, Fürst Thurn und Taxis Museen,<br />
Inv.-Nr. StE 492<br />
Winterhalter gehörte zu den wenigen Malern, denen<br />
Elisabeth Porträtsitzungen gewährte. Winterhalter,<br />
seinerzeit einer <strong>der</strong> meistgefragten Porträtmaler,<br />
fertigte vom Kaiserpaar die beiden offiziellen<br />
Staatsportraits an. Franz Joseph bestellte bei ihm aber<br />
auch zwei private Bildnisse <strong>der</strong> Kaiserin, die sie beide<br />
mit offenen Haaren zeigen.<br />
Jenes im Frisiermantel war das Lieblingsbild des<br />
Kaisers von seiner Gemahlin. Er hatte es auf einer<br />
Staffelei direkt vor seinem Schreibtisch in <strong>der</strong> Hofburg<br />
stehen.<br />
Der Kaiser war <strong>der</strong> Meinung, dass es überhaupt kein<br />
gutes Bild seiner Gemahlin gegeben habe, doch zu<br />
den Porträts von Winterhalter meinte er: <strong>Die</strong> „Bil<strong>der</strong>,<br />
die er von Sisi machte, sind ganz scharmant geworden<br />
und sind die ersten ähnlichen Porträts von ihr.“
ZEITTAFEL ZEITTAFEL ZUR ZUR KAISERIN KAISERIN ELISABETH<br />
ELISABETH<br />
24. Dezember 1837 Elisabeth Amalia Eugenia wird in München als<br />
viertes Kind von Herzog Maximilian in Bayern<br />
und Herzogin Ludovika geboren<br />
Juni 1848 Fahrt nach Innsbruck: erstes Zusammentreffen<br />
von Sisi und ihren Cousins; Franz Joseph ist<br />
aber nicht anwesend<br />
2. Dezember 1848 Regierungsantritt Kaiser Franz Josephs<br />
18. August 1853 Kaiser Franz Joseph hält in Ischl an seinem 23.<br />
Geburtstag um die Hand <strong>der</strong> fünfzehnjährigen<br />
Elisabeth an<br />
24. April 1854 Trauung des Paares in <strong>der</strong> Augustinerkirche in<br />
<strong>Wien</strong><br />
5. März 1855 Geburt <strong>der</strong> ersten Tochter Sophie in <strong>der</strong> <strong>Wien</strong>er<br />
Hofburg<br />
15. Juli 1856 Geburt <strong>der</strong> zweiten Tochter Gisela in Laxenburg<br />
29. Mai 1857 Tod <strong>der</strong> ersten Tochter Sophie in Buda(pest)<br />
21. August 1858 Geburt des Kronprinzen Rudolf in Laxenburg;<br />
Sisi leidet unter chronischem Husten,<br />
Appetitlosigkeit und Kopfschmerzen<br />
19 November 1860 Abfahrt nach Madeira zur Erholung von einem<br />
Lungenleiden; nachfolgend Aufenthalte in Korfu,<br />
Venedig und Bad Kissingen<br />
14. August 1862 Nach Genesung Rückkehr in die Residenzstadt<br />
<strong>Wien</strong><br />
Februar 1863 Elisabeth beginnt, systematisch Ungarisch zu<br />
lernen<br />
November 1864 Ida von Ferenczy wird „Vorleserin Ihrer Majestät“<br />
und engste Vertraute <strong>der</strong> Kaiserin, die in <strong>der</strong><br />
Ungarnfrage als Vermittlerin fungiert<br />
27. August 1865 Im so genannten Ischler Ultimatum For<strong>der</strong>ung an<br />
den Kaiser nach freier Entscheidung in<br />
Erziehungsfragen und freier Wahl ihres<br />
Aufenthaltsortes; beides wird gewährt<br />
8. Jänner 1866 Erstes Treffen mit dem ungarischen Landtagsabgeordneten Gyula Graf Andrássy; in <strong>der</strong> Folge<br />
immer stärkere Befürwortung <strong>der</strong> ungarischen Interessen<br />
8. Juni 1867 Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich Krönung Franz Josephs und Elisabeths zum<br />
König und zur Königin von Ungarn; dem Königspaar werden Schloss Gödöllö und das dortige<br />
Jagdrevier zur Verfügung gestellt<br />
22. April 1868 Geburt <strong>der</strong> jüngsten Tochter Marie Valérie in<br />
Buda(pest)<br />
Um 1868/1869 Letzte Porträtphotos <strong>der</strong> damals 30/31-jährigen<br />
1. Mai 1873 <strong>Die</strong> <strong>Wien</strong>er Weltausstellung wird eröffnet<br />
Dezember 1873 25-jähriges Regierungsjubiläum des Kaisers; nach<br />
1873 übernimmt Elisabeth kaum noch<br />
Repräsentationspflichten in <strong>Wien</strong><br />
26. Juni 1875 Tod des Ex-Kaisers Ferdinand I., dessen Haupterbe<br />
Kaiser Franz Joseph ist. Erhöhung <strong>der</strong> Apanage<br />
Elisabeths von 100.000 auf 300.000 Gulden pro Jahr<br />
11. September 1875 Schwerer Reitunfall in Sassetôt (Normandie)<br />
März 1876 Erstmalige Teilnahme an Parforcejagden in England<br />
April 1879 Feier <strong>der</strong> Silbernen Hochzeit; letztes Porträt Elisabeths:<br />
die „nach <strong>der</strong> Natur“ geschaffene Büste von Victor<br />
Tilgner<br />
März 1882 Beendigung des letzten Reitaufenthalts in England und<br />
Verkauf ihrer dortigen Pferde; im selben Jahr Beginn<br />
<strong>der</strong> Ausübung des Fechtsportes unter Anleitung <strong>der</strong><br />
Fechtmeister Friedrich und Schulze<br />
Februar 1885 Der Gedichtzyklus Nordsee Lie<strong>der</strong> wird begonnen<br />
Oktober 1885 Große Orientreise; unter Anleitung von Alexan<strong>der</strong> von<br />
Warsberg intensive Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong><br />
griechischen Kultur<br />
April 1886 Beginn <strong>der</strong> systematischen Auseinan<strong>der</strong>setzung mit<br />
Heine, im Gegenzug Einschränkung des Reitsports<br />
13. Juni 1886 Tod König Ludwigs II. von Bayern, <strong>der</strong> bei Elisabeth eine nicht mehr endende Todessehnsucht<br />
auslöst<br />
Dezember 1886 Komplette Auflösung ihres Reitstalles und Entlassung <strong>der</strong> Bereiter<br />
Jänner 1887 Gedichtzyklus Winterlie<strong>der</strong>, <strong>der</strong> 140 Gedichte umfassen sollte; im selben Jahr erste spiritistische<br />
Neigungen und Vorsorge für ein Exil in <strong>der</strong> Schweiz<br />
Februar 1888 Beginn des dritten Gedichtzyklus, Vermischte Gedichte, <strong>der</strong> im November unvollendet<br />
abgebrochen wird<br />
November 1888 Entschluss, auf Korfu eine Villa errichten zu lassen; Beginn des Studiums <strong>der</strong> neugriechischen<br />
Sprache<br />
3<br />
Lithographie nach einem Entwurf von M.<br />
Streicher, 1888.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, Pg II 47.)<br />
Widmungsblatt zum Regierungsjubiläum am<br />
2. Dezember 1888. Tableau mit den Bildnissen<br />
des Kaiserpaares sowie mit denjenigen von<br />
dessen Eltern, Kin<strong>der</strong>n und Schwiegerkin<strong>der</strong>n.<br />
Marie Valérie war damals noch unverheiratet.<br />
Photographie von Ludwig Angerer,<br />
1868/69.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, NB 504.279-B.)
24. Dezember 1888 Verlobung <strong>der</strong> Lieblingstochter Marie Valérie<br />
30. Jänner 1889 Selbstmord des Kronprinzen Rudolf; Elisabeth verfällt<br />
in schwere Depressionen und trägt (fast) nur mehr<br />
schwarze Kleidung; <strong>der</strong> Fechtsport wird aufgegeben,<br />
die Reiseaktivitäten werden hingegen weiter<br />
intensiviert<br />
31. Juli 1890 Anlässlich <strong>der</strong> Trauung Marie Valéries nicht in Schwarz<br />
gekleidet; das Kleid hat eine taubengraue Farbe<br />
Ab 1892 Elisabeth ist kaum noch in <strong>Wien</strong>, Gödöllö o<strong>der</strong> Ischl;<br />
die Wintermonate werden im Süden verbracht; die<br />
Reisen erfolgen zum Teil ungeplant und spontan, so<br />
dass <strong>der</strong> Kaiser oft genug nur aus den Zeitungen<br />
erfährt, wo sich seine Gemahlin gerade aufhält<br />
März und April 1896 Letzter Aufenthalt auf Korfu; das Achilleion wird zum<br />
Verkauf freigegeben<br />
Mai und Juni 1896 Millenniums-Feierlichkeiten in Ungarn; letzte öffentliche<br />
Auftritte<br />
14. Juni 1896 Zweites Testament Elisabeths, ausgestellt in Lainz<br />
1896/1897 Aufgrund anhalten<strong>der</strong> Unterernährung treten<br />
Hungerödeme auf<br />
15. Juli 1898 Abreise von Ischl; <strong>der</strong> Kaiser sollte seine Gemahlin<br />
nicht mehr lebend wie<strong>der</strong>sehen<br />
10. September 1898 Ermordung in Genf durch den Anarchisten Luigi<br />
Lucheni<br />
17. September 1898 Beisetzung in <strong>der</strong> Kapuzinergruft in <strong>Wien</strong><br />
SISI, SISI, SISI, DIE DIE BRAUT BRAUT DES DES KAISERS KAISERS VON VON ÖSTERREICH<br />
ÖSTERREICH<br />
„Als 15-jähriges Kind wird man verkauft […]“<br />
Elisabeth 1889 zu ihrer Tochter Marie Valérie.<br />
Tagebuchnotiz von Marie Valérie, Tochter <strong>der</strong> Kaiserin, 1889:<br />
Mama sagte, „die Ehe sei eine wi<strong>der</strong>sinnige Einrichtung. Als 15-jähriges Kind<br />
wird man verkauft und tut einen Schritt, den man nicht versteht und dann 30<br />
Jahre länger bereut und nicht lösen kann.“<br />
Als Kaiser Franz Joseph im August 1853 zu seinem 23. Geburtstag nach Ischl fuhr,<br />
war seitens seiner Mutter beabsichtigt, ihm seine Cousine Helene als Braut zu<br />
präsentieren. Helene kam daher mit ihrer Mutter Ludovica und in Begleitung ihrer<br />
jüngeren Schwester Sisi nach Ischl. Der Kaiser verliebte sich aber statt in Helene<br />
Hals über Kopf in die damals erst fünfzehnjährige Sisi und hielt an seinem<br />
Geburtstag um ihre Hand an. Sisi willigte verunsichert ein. Sie hatte sich zwar in<br />
den Kaiser verliebt, doch ängstigte sie seine Stellung. „Wenn er nur kein Kaiser<br />
wäre!“, soll Sisi gesagt habe, und gleichzeitig auch: „Ich bin ja so unbedeutend!“<br />
Dem Kaiser gefiel aber gerade ihre schüchterne Mädchenhaftigkeit.<br />
Graf Hans Wilczek, <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Verlobung anwesend war:<br />
„Sie war damals noch sehr jung […] und noch lange nicht so schön, wie sie<br />
später wurde. Damals sah man noch gar nichts davon, dass sie so<br />
wun<strong>der</strong>bar schönes Haar hatte. Sie war eben noch ganz Knospe und ihre<br />
Gestalt eher unansehnlich und doch wurde sie später die schönste Frau in<br />
Österreich.“<br />
Nach <strong>der</strong> Verlobung kehrte <strong>der</strong> Kaiser zu seiner „papierenen Schreibtischexistenz“<br />
zurück, wie er es selbst formulierte. Sisi hingegen musste ihr Mädchendasein<br />
aufgeben und ein immenses Lernprogramm bewältigen, um sich auf ihre zukünftige<br />
Rolle vorzubereiten. Der Kaiser war mit den „Lernfortschritten“ seiner Braut<br />
zufrieden. Ein beson<strong>der</strong>s Anliegen war ihm auch die Beschaffung eines möglichst<br />
authentischen Porträts von Sisi.<br />
Brief Kaiser Franz Josephs an seine Mutter vom 17. Oktober 1853.<br />
„Alle Tage liebe ich Sisi mehr und immer überzeuge ich mich mehr, daß<br />
keine für mich besser passen kann als sie. […] Ich habe hier das erste gut<br />
aufgefaßte und wirklich ähnliche Bild von ihr, von einem gewissen Dürck<br />
gemalt, gesehen […].“<br />
Zur Hochzeit am 24. April 1854 fuhr Sisi am 20. April mit ihrer Familie per Kutsche<br />
bis Straubing und am nächsten Tag per Schiff bis Linz. Dort empfing <strong>der</strong> Kaiser am<br />
22. April seine Braut, die anschließend mit dem Raddampfer Franz Joseph nach<br />
<strong>Wien</strong> fuhr, wo sie nachmittags ankam und die folgende Nacht im Schloss<br />
Schönbrunn verbrachte.<br />
4<br />
Büste von Kaiserin Elisabeth von Victor<br />
Tilgner, 1879<br />
Anonyme Photographie.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, Pf E 115 E.)<br />
Photographie von Alois Löcherer,<br />
1852/53.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, E 22.267-D.)<br />
Elisabeth im Alter von 14 o<strong>der</strong> 15<br />
Jahren.<br />
Galvanographie von Leo Schöninger<br />
(1854) nach einem Gemälde von<br />
Friedrich Dürck von 1853.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, NB 500.825-B.)
Der Einzug <strong>der</strong> Braut in die Stadt <strong>Wien</strong> fand am 23. April über die damit zugleich eingeweihte Elisabeth-Brücke statt. <strong>Die</strong> Braut<br />
saß mit ihrer Mutter im vergoldeten Galawagen, <strong>der</strong> mit acht Schimmeln bespannt war.<br />
Am nächsten Tag, dem 24. April, traute Erzbischof Rauscher das Paar in <strong>der</strong> Augustinerkirche. Zum Weg dorthin wurden<br />
übrigens keine Wägen verwendet. Es gibt also keinen „Hochzeitswagen“.<br />
Objekte<br />
Objekte<br />
Einzugswagen für Sisi als kaiserliche Braut −<br />
ursprünglich „Mailän<strong>der</strong> Krönungswagen“ Napoleons I.<br />
Paris, um 1789/90<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 003<br />
Der ursprünglich ganz vergoldete Wagen wurde um 1790 in<br />
Paris gebaut und 1805 von Napoleon bei seiner Mailän<strong>der</strong><br />
Krönung zum König von Italien verwendet.<br />
Kaiser Franz I. brachte ihn nach seinem endgültigen Sieg<br />
über Napoleon nach <strong>Wien</strong>, wo <strong>der</strong> Wagen − mit<br />
österreichischen Kronen und Wappen versehen − zu einem<br />
<strong>der</strong> wichtigsten Fahrzeuge des Hofes wurde. So entstand die<br />
Tradition, dass kaiserliche und erzherzogliche Bräute im<br />
„Mailän<strong>der</strong> Wagen“ ihren Einzug in <strong>Wien</strong> hielten. Auch Sisi<br />
zog am 23. April 1854 in diesem Wagen in ihre künftige<br />
Heimatstadt ein. Allerdings war sie keine „strahlende“ Braut: Erschöpft und verängstigt saß sie neben ihrer Mutter,<br />
Herzogin Ludovika. Bei <strong>der</strong> Ankunft in <strong>der</strong> Hofburg blieb sie mit ihrem Diamantendiadem an <strong>der</strong> Türfassung des Wagens<br />
hängen und strauchelte. Entsetzt über dieses Missgeschick, kam sie schluchzend in ihrem neuen Heim an.<br />
Sisis Hochzeitsschleppe<br />
<strong>Wien</strong>, 1854<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot, Inv.-Nr. N 207<br />
Bei ihrer Hochzeit am 24. April 1854 trug Sisi ein weißes Seidenkleid mit<br />
reicher Stickerei in Gold und Silber sowie eine lange, goldbestickte<br />
„Courschleppe“, die als selbständiges Element um die Taille über dem Kleid<br />
fixiert wurde. <strong>Die</strong>se Schleppe wurde als beson<strong>der</strong>es Erinnerungsstück von<br />
Sisis Lieblingstocher Erzherzogin Marie Valérie aufbewahrt. 1989 konnte sie<br />
aus dem Besitz <strong>der</strong> Nachfahren <strong>der</strong> Erzherzogin für das Monturdepot<br />
erworben werden.<br />
Ausfahrt von Franz Joseph und Sisi am 19. August 1853, dem Tag<br />
ihrer Verlobung, von Bad Ischl nach Hallstadt. Graf Grünne lenkt<br />
den Landschützer mit Schecken-Sechserzug im Wildgang<br />
Johann Gottlieb Prestel, um 1853/54<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. Z 037<br />
Franz Joseph-Zitat (Brief an seine Mutter, dat. Ischl. 1. Juli<br />
1865):<br />
"Liebe Mama, [...] Vorgestern habe ich allein mit Sisi beim<br />
herrlichsten Wetter eine sehr hübsche Partie gemacht. Wir<br />
sind um 10 Uhr zum Steg gefahren und von dort zu Fuß auf<br />
<strong>der</strong> Solenleitung auf den Rudolphsturm und dann noch nach<br />
Hallstatt gegangen, wo wir schon um 1 Uhr waren und um 2<br />
Uhr auf dem Balkon des Wirtshauses speisten. Nach Tisch<br />
sind wir zum Waldbachstrub gegangen. Das Tal war herrlich<br />
beleuchtet und vom frischesten Grün; nur durch eine Menge<br />
von Trotteln, wie immer, und durch eine neue, in dieser<br />
Gegend höchst unpassende Zivilisation verunstaltet. Es sind<br />
nämlich am ganzen Wege eine Menge Butiken mit Schnitzereien und Steinen aufgestellt und sogar ein Kaffeehaus ist<br />
entstanden, so daß ich schon erwartete, man müsse wie in <strong>der</strong> Schweiz beim Wasserfall Entree zahlen. Allein das ist<br />
denn doch noch nicht <strong>der</strong> Fall. Wir waren beide seit unserem Verlobungstage nicht in dem schönen Tale gewesen und<br />
gedachten recht viel <strong>der</strong> damaligen Zeit. ...“<br />
5
Das Kaiser- und Kronprinzenpaar im Schlosspark von Laxenburg<br />
Karl Schweninger d. Ä., 1887<br />
<strong>Wien</strong>, <strong>Wien</strong> Museum, Inv.-Nr. 16.865<br />
Elisabeth ist auf dem Bild in einer Victoria sitzend dargestellt.<br />
<strong>Die</strong> Kaiserin fuhr aber auch gerne in sogenannten<br />
Selbstkutschierwägen, das heißt, sie kutschierte den Wagen<br />
selbst.<br />
Hinweis:<br />
<strong>Die</strong>ses Bild ist nur bis 26.1.2009 in <strong>der</strong> Ausstellung zu sehen.<br />
DIE DIE JUNGE JUNGE KAISERIN<br />
KAISERIN<br />
„Ich bin erwacht in einem Kerker […]“<br />
Aus einem Gedicht <strong>der</strong> Kaiserin<br />
Gedicht <strong>der</strong> Kaiserin, laut Elisabeth-Biograph Corti nur vierzehn Tage nach ihrer<br />
Hochzeit verfasst, möglicherweise aber erst später entstanden.<br />
„Ich bin erwacht in einem Kerker,<br />
Und Fesseln sind an meiner Hand.<br />
Und meine Sehnsucht immer stärker –<br />
Und Freiheit! du, mir abgewandt!“<br />
Schon bald nach ihrer Trauung wurde Elisabeth bewusst, dass eine Ehe mit dem<br />
österreichischen Kaiser und persönliche Freiheit unvereinbar waren. Den<br />
Hauptgrund dafür bildete das streng reglementierte Hofleben, das kaum Privatheit<br />
erlaubte.<br />
Dennoch erfüllte Elisabeth in den ersten Ehejahren die Pflichten einer Kaiserin und<br />
begleitete ihren Gemahl auf den Reisen, nahm an Festlichkeiten teil, besuchte<br />
Spitäler, und das Wichtigste: Sie gebar − nach zwei Mädchen − am 21. August<br />
1858 einen Thronfolger. Als sie dennoch am <strong>Wien</strong>er Hof weiterhin ständiger Kritik<br />
ausgesetzt war und zu guter Letzt noch Gerüchte über außereheliche Beziehungen<br />
ihres Gemahls hinzukamen, führte dies schließlich im Jahre 1860 zum körperlichen<br />
und seelischen Zusammenbruch.<br />
Ihre Reaktion war eine zweifache: Zum einen floh sie vom <strong>Wien</strong>er Hof, zum<br />
an<strong>der</strong>en schuf sie ein „Gegenzeremoniell“ mit einem Kreis persönlicher Vertrauter<br />
vorzugsweise ungarischer Herkunft.<br />
Bil<strong>der</strong><br />
Bil<strong>der</strong><br />
<strong>Die</strong> Kaiserin vor ihrer „Flucht“ nach Madeira im November 1860. Elisabeth trug<br />
damals noch häufig die weit ausladenden Krinolinen.<br />
Elisabeth mit ihrem Bru<strong>der</strong> Carl Theodor in Kissingen, wo sie sich von Mai bis Juli<br />
1862 zur Kur aufhielt, die nun endlich die lang ersehnte Besserung brachte. Am 14.<br />
August 1862 kehrte Elisabeth nach <strong>Wien</strong> zurück. <strong>Die</strong> fast zweijährige Abwesenheit<br />
vom <strong>Wien</strong>er Hof hatte sie sowohl äußerlich als auch wesensmäßig verän<strong>der</strong>t: Sie<br />
hatte an Schönheit und Selbstbewusstsein gewonnen.<br />
6<br />
Photographie von Ludwig Angerer.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, NB 509.044-B.)<br />
Lithographie von Emil Hartitzsch.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, NB 511.421-B.)
Objekte<br />
Objekte<br />
Leib-Victoria à la Daumont<br />
Laurenzi & Comp. (<strong>Wien</strong>), 1852/53<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 030<br />
<strong>Die</strong> nach <strong>der</strong> englischen Königin benannte Victoria war um<br />
1850 ein eleganter Modewagen. Sie diente als reines<br />
Schönwetterfahrzeug für zwei Personen, die ein Faltdach vor<br />
plötzlich einsetzendem Regen schützte. Da <strong>der</strong> Kasten auf<br />
Türen verzichtete, konnten die Insassen beson<strong>der</strong>s gut<br />
gesehen werden. <strong>Die</strong>s machte die Victoria zu einem beliebten<br />
Damenwagen, mit dem die Besitzerinnen ihre Gar<strong>der</strong>obe bei<br />
<strong>der</strong> Ausfahrt wirkungsvoll zur Geltung bringen konnten.<br />
<strong>Die</strong> hier vorgestellte, 1852 von Ludwig Laurenzi gebaute<br />
Victoria ist für eine Bespannung à la Daumont eingerichtet: Sie hat keinen Bock, da sie von berittenen Kutschern o<strong>der</strong><br />
Jockeys gelenkt wurde. Als Leibwagen war sie ausschließlich<br />
für den Kaiser und seine Gemahlin bestimmt und somit eines<br />
jener Fahrzeuge, die die frisch vermählte Kaiserin Elisabeth<br />
regelmäßig benützte.<br />
Viersitzige Leib-Kalesche à la Daumont<br />
Cesare Sala (Mailand), 1857<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 029<br />
Als „Daumont“-Wagen bezeichnete man <strong>Kutschen</strong> ohne<br />
Bock, die von berittenen Jockeys gelenkt wurden. Offene<br />
Daumont-Wägen galten als beson<strong>der</strong>s elegant, da die<br />
Aussicht <strong>der</strong> Fahrgäste we<strong>der</strong> durch ein Dach noch durch<br />
einen Kutschbock behin<strong>der</strong>t wurde. Das le<strong>der</strong>ne<br />
Klappverdeck, das die Insassen vor plötzlichen<br />
Regenschauern schützen sollte, war normalerweise zurückgeschlagen. In <strong>Wien</strong> wurden Daumont-Wägen bei schönem<br />
Wetter für Ausfahrten in <strong>der</strong> Stadt o<strong>der</strong> im Prater verwendet.<br />
Der Hof besaß naturgemäß zahlreiche Fahrzeuge dieser Art, darunter diese elegante Kalesche, die Franz Joseph und<br />
Elisabeth drei Jahre nach ihrer Hochzeit beim berühmten Mailän<strong>der</strong> Wagenbauer Cesare Sala bestellten. Sie wurde von<br />
sechs weißen Kladruber Hengsten gezogen und diente als sommerlicher Alltagswagen für die kaiserliche Familie.<br />
„Chenillekleid“ <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth<br />
Fanny Scheiner (<strong>Wien</strong>), um 1880, nach 1890 verän<strong>der</strong>t<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot, Inv.-Nr. N 124<br />
<strong>Die</strong>ses Kleid aus hellem Satin und Seidentüll mit Chenille-Applikationen wurde<br />
um 1880 von Sisis Lieblingsschnei<strong>der</strong>in Fanny Scheiner für sie entworfen. Es<br />
wurde im Dezember 1889 wie die meisten hellen <strong>Klei<strong>der</strong></strong> <strong>der</strong> Kaiserin im<br />
Familienkreis verschenkt und nach 1890 für eine neue Trägerin verän<strong>der</strong>t.<br />
1962 gelangte es als Schenkung einer Nachfahrin des Kaiserhauses an das<br />
Kunsthistorische Museum.<br />
Campagne-Uniform eines österreichischen Feldmarschalls in deutscher<br />
Adjustierung, getragen von Kaiser Franz Joseph I.<br />
Anton Uzel (<strong>Wien</strong>), 1889 (Rock), 1916 (Hose)<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot, Inv.-Nrn. N 260, N 261<br />
Der Leibkammerdiener des Kaisers, Eugen Ketterl, berichtet von <strong>der</strong><br />
Bescheidenheit und Sparsamkeit des Kaises bei den täglich in Gebrauch<br />
stehenden Uniformen des Kaisers: Statt einer Erneuerung wünschte <strong>der</strong><br />
Kaiser eher eine "Egalisierung".<br />
"Der Waffenrock ist noch ganz gut, lassen S' ihn neu egalisieren ...“<br />
7
Livree eines Vorreiters vom Daumontzug für Schimmel<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot, Inv.-Nrn. U 321 (Rock), U 242<br />
(Perücke)<br />
Getragen vom Leibkutscher und Leibpostillon Franz Hengge (1837-1904),<br />
<strong>der</strong> von 1885 bis 1898 im <strong>Die</strong>nst <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth stand.<br />
DIE DIE DIE KAISERIN KAISERIN ALS ALS MUTTER<br />
MUTTER<br />
„[…] sie ist ja doch so eine hingebende Gattin und Mutter!“<br />
Der Kaiser über seine Gemahlin im September 1856.<br />
Mit zwanzig Jahren hatte Elisabeth bereits drei Kin<strong>der</strong> geboren und<br />
den Tod ihrer erstgeborenen Tochter erleben müssen. Dabei war sie<br />
selbst noch ein halbes Kind, zumal sie durch ihre frühe<br />
Verehelichung in ihrer eigenen Persönlichkeitsentfaltung behin<strong>der</strong>t<br />
wurde.<br />
<strong>Die</strong> Mutter des Kaisers, Erzherzogin Sophie, entwickelte in ihrer<br />
Zuneigung für Elisabeth und ihre Enkelkin<strong>der</strong> eine zwar gut<br />
gemeinte, aber zugleich bevormundende Fürsorglichkeit. <strong>Die</strong><br />
Kaiserin konnte unter diesen Umständen kaum ein Selbstwertgefühl<br />
als Mutter entwickeln.<br />
Im Jahr 1867, als <strong>der</strong> Ausgleich Österreichs mit Ungarn nicht zuletzt<br />
durch Elisabeths Engagement zustande kam, fühlte sich Elisabeth<br />
offenbar so gestärkt, dass sie nach fast zehn Jahren wie<strong>der</strong> Mutter<br />
werden wollte. <strong>Die</strong>smal traute sie sich zu, die Erziehung ihres vierten<br />
Kindes, Marie Valérie, ganz allein zu übernehmen, mit dem<br />
Ergebnis, dass sie dieses Kind mit ihrer Liebe fast erdrückte.<br />
Kaiser Franz Joseph im September 1856 an seine Mutter:<br />
„Ich bitte Sie jedoch inständigst, Sisi nachsichtig zu beurteilen,<br />
wenn sie vielleicht eine zu eifersüchtige Mutter ist, – sie ist ja<br />
doch so eine hingebende Gattin und Mutter! […] Übrigens fällt<br />
es Sisi gar nicht ein, Ihnen die Kin<strong>der</strong> entziehen zu wollen, und<br />
sie hat mir eigens aufgetragen, Ihnen zu schreiben, daß<br />
dieselben immer ganz zu Ihrer Disposition sein werden, wie es<br />
ja auch immer in Schönbrunn und Laxenburg <strong>der</strong> Fall war.“<br />
Elisabeth über ihre damals vierjährige Tochter Marie Valérie im Juni<br />
1872:<br />
„Jetzt weiß ich es, was für eine Glückseligkeit ein Kind bedeutet<br />
[…].“<br />
8<br />
Photographie von Ludwig Angerer, 1859.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, Pf 332.)<br />
Das Familienphoto von 1859 hat Seltenheitswert. Es<br />
ist das einzig bekannte Photo <strong>der</strong> kaiserlichen Familie,<br />
auf dem auch Elisabeth (hier mit Gisela und Rudolf) zu<br />
sehen ist.<br />
Tuschzeichnung von A. Fischel, Prag um 1875.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, Pg II 44.)<br />
Tableau mit <strong>der</strong> kaiserlichen Familie.
Objekte<br />
Objekte<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kutschen</strong> <strong>der</strong> Kaiserkin<strong>der</strong><br />
<strong>Kutschen</strong> hatten einen festen Platz in allen Bereichen des höfischen Lebens: Es gab Prunkfahrzeuge, die ausschließlich <strong>der</strong><br />
Repräsentation fürstlicher Macht dienten, und Gebrauchsfahrzeuge für Alltag und Reise sowie Lust- und Freizeitwägen, die<br />
<strong>der</strong> Kaiser und die Kaiserin gerne auch selbst kutschierten.<br />
So war es selbstverständlich, dass auch die kaiserlichen Kin<strong>der</strong> schon früh den Umgang mit Pferd und Wagen lernten, wobei<br />
die für sie angefertigten <strong>Kutschen</strong> das ganze Spektrum zeitgenössischer Gefährte vom höchstrangigen<br />
Repräsentationsfahrzeug bis hin zur sportlichen Freizeitkutsche wi<strong>der</strong>spiegeln.<br />
Angefertigt wurden die kaiserlichen Kin<strong>der</strong>wägen von den bedeutendsten <strong>Kutschen</strong>fabrikanten ihrer Zeit, die sie als exakte<br />
Miniaturausgaben <strong>der</strong> Fahrzeuge für Erwachsene konzipierten. So kostbar die kleinen Fahrzeuge auch waren – sie wurden<br />
tatsächlich von den Kin<strong>der</strong>n für Ausfahrten in den kaiserlichen Parks benützt. Gezogen wurden sie je nach Art und Größe von<br />
eigens dafür abgerichteten Schafen, Ziegen o<strong>der</strong> Ponys.<br />
Kin<strong>der</strong>wagen <strong>der</strong> Erzherzogin Gisela<br />
Österreich, um 1858/59<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 070<br />
<strong>Die</strong>se elegante kleine Kalesche wurde für Erzherzogin<br />
Gisela, die 1856 geborene Tochter des Kaiserpaares gebaut.<br />
Wie bei hochrangigen Kin<strong>der</strong>wägen üblich, zeigt sie den<br />
gleichen technischen und gestalterischen Luxus wie<br />
<strong>Kutschen</strong> für Erwachsene: Der modisch schiffförmige Kasten<br />
ist direkt auf die Druckfe<strong>der</strong>n des reich vergoldeten Gestells<br />
montiert. Er trägt eine „hofgrüne“ Lackierung und eine<br />
Bordüre aus goldenen Ranken. Am Wagenschlag ist das<br />
Monogramm <strong>der</strong> kleinen Erzherzogin angebracht.<br />
Briefen <strong>der</strong> Großmutter, Erzherzogin Sophie, zufolge wurde<br />
<strong>der</strong> kleine Wagen bereits 1859 von Gisela und ihrem Bru<strong>der</strong><br />
Rudolf im kaiserlichen Schloss Laxenburg verwendet.<br />
Schil<strong>der</strong>ung eines Besuches bei Sisi am 28. Juni 1859 in Laxenburg von Erzherzogin Sophie, mit Erwähnung von<br />
Giselas Wagen.<br />
„<strong>Die</strong>nstag, wo wir abends nach Laxenburg fuhren, Papa, Onkel Ludwig, Ludwig [Victor] und ich, fanden wir abermals<br />
den Kleinen mit einem großen Stück Semmel, aber in Gisela's Wägelchen, o<strong>der</strong> vielmehr Calesche, sitzend durch den<br />
Esel gezogen. Gisela saß bei ihm, und beide Kin<strong>der</strong> sahen so glücklich aus. Gisela lächelte beständig und küßte ihr<br />
Brü<strong>der</strong>chen, denn beide Kin<strong>der</strong> lieben sich so zärtlich. Sie wurden vor dem Hause auf- und abgefahren.“<br />
Kin<strong>der</strong>wagen des Kronprinzen Rudolf<br />
Cesare Sala (Mailand), um 1860<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 069<br />
<strong>Die</strong>ser bezaubernde kleine Kin<strong>der</strong>wagen wurde vom<br />
berühmten Mailän<strong>der</strong> Wagenfabrikanten Cesare Sala für den<br />
heiß ersehnten Kronprinzen Rudolf, gebaut. Der Wagen für<br />
den kleinen Prinzen ist eine Miniaturausgabe eines<br />
Luxusfahrzeuges für Erwachsene, die verschwen<strong>der</strong>isch mit<br />
allen technischen und künstlerischen Raffinessen <strong>der</strong> Zeit<br />
ausgestattet ist. Den offenen Kasten, in dem zwei Kin<strong>der</strong><br />
einan<strong>der</strong> gegenüber sitzen konnten, ziert gemaltes<br />
Flechtwerk. Elegante längliche Kotflügel schützten die<br />
kleinen Passagiere vor aufspritzendem Staub und Schlamm.<br />
Ein Steckdach mit Seidenvorhängen und kleinen<br />
rudolfinischen Kronen spendete Schatten. All dies betonte ebenso wie das reich skulptierte und vergoldete Fahrgestell<br />
den hohen Rang des noch im Kindesalter befindlichen Eigentümers. Gezogen wurde das elegante Gefährt von zwei<br />
Ponys.<br />
9
IHRE IHRE MAJESTÄT MAJESTÄT DIE KAISERIN VON ÖSTERREICH<br />
„[…] <strong>der</strong> reizendste Gast in <strong>der</strong> <strong>Wien</strong>er Hofburg.“<br />
Neues <strong>Wien</strong>er Tagblatt, 3. März 1870<br />
Kaiserin Elisabeth war seitens des <strong>Wien</strong>er Hofes und <strong>der</strong> Presse häufig heftiger Kritik ausgesetzt, denn sie vernachlässigte<br />
die repräsentativen Pflichten innerhalb des höfischen Zeremoniells und als Landesfürstin. <strong>Die</strong> Kaiserin wollte sich jedoch nicht<br />
einem Reglement unterwerfen, das vor allem <strong>der</strong> Befriedigung von Eitelkeiten und Sicherung ungerechtfertigter Privilegien<br />
diente. Hinzu kommt, dass sie die <strong>Wien</strong>er Hofaristokratie als überheblich empfand und ihr im Laufe <strong>der</strong> Zeit mit immer mehr<br />
Spott und Verachtung begegnete.<br />
Soweit sich dies an den Briefen des Kaisers an seine Gemahlin nachvollziehen lässt, warf ihr <strong>der</strong> Kaiser kaum mangelnden<br />
Eifer in <strong>der</strong> Erfüllung repräsentativer Aufgaben vor, zumal er selbst diesen Pflichten nur ungern nachkam. Er gestattete <strong>der</strong><br />
Kaiserin vielmehr das Privatleben, das er sich teils selbst vorenthielt und das ihm zum Teil auch von <strong>der</strong> Kaiserin aufgrund<br />
ihrer immer häufigeren Abwesenheit vorenthalten wurde.<br />
Bemerkung Elisabeths zu ihrem Griechisch-Lehrer Christomanos (1892):<br />
„Oft komme ich mir vor wie dicht verschleiert, ohne es zu sein, wie in einer innerlichen Maskerade: im Kostüm einer<br />
Kaiserin.“<br />
Erzherzogin Sophie an ihren Sohn Ferdinand Maximilian im Dezember 1856:<br />
„Der liebe Gott hat mit <strong>der</strong> Kaiserin Schönheit und unvergleichlichem Anstand ein Kapital in des Kaisers Hände gelegt,<br />
das die reichsten Zeichen trägt und auf’s Neue den Glücksstern des Hauses Österreich bewährt.“<br />
Objekte<br />
Objekte<br />
Reicher zweisitziger Leib-Stadtwagen (Coupé) <strong>der</strong> Kaiserin<br />
Elisabeth<br />
Cesare Sala (Mailand), 1857<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 026<br />
Der außerordentlich elegante Wagen wurde 1857 beim<br />
Mailän<strong>der</strong> Wagenfabrikanten Cesare Sala angekauft. Mit<br />
dem ungewöhnlich hohen Kaufpreis von 15.000 Gulden war<br />
er – nach <strong>der</strong>zeitigem Wissensstand − bei weitem <strong>der</strong><br />
teuerste Personenwagen, <strong>der</strong> im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t für den<br />
<strong>Wien</strong>er Hof entstand.<br />
Das reich skulptierte Langwiedgestell mit doppelter Fe<strong>der</strong>ung<br />
betont ebenso wie die aufwendige Ausstattung mit 5<br />
Fenstern, 4 prächtig verzierten Laternen, Dachgalerie und<br />
vergoldeten Ornamentleisten an Oberkasten und<br />
Bodenschwellen den beson<strong>der</strong>s hohen zeremoniellen Rang des Fahrzeuges. Seiner Bedeutung entsprechend wurde es<br />
mit acht weißen Kladruber Hengsten bespannt.<br />
Der prunkvolle Wagen wurde bei Staatsangelegenheiten von Kaiserin Elisabeth benützt. Erst nach <strong>der</strong>en Tod<br />
verwendeten ihn auch an<strong>der</strong>e Mitglie<strong>der</strong> des Kaiserhauses.<br />
Reicher viersitziger Leib-Stadtwagen (Berline)<br />
Carl Marius (<strong>Wien</strong>), 1865<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 017<br />
1865 wurde diese prunkvolle Berline als Galawagen für das<br />
Kaiserpaar angekauft.<br />
Franz Joseph und Elisabeth (und in späteren Jahren auch<br />
<strong>der</strong> Kronprinz) verwendeten sie bei wichtigen Anlässen wie<br />
dem alljährlichen Fronleichnamsfest. Den hohen Rang des<br />
Fahrzeuges erkennt man am reich geschnitzten und<br />
vergoldeten Fahrgestell mit acht Fe<strong>der</strong>n, <strong>der</strong> vollständigen<br />
Verglasung des Kastens, <strong>der</strong> Ausstattung mit vier kostbaren<br />
Laternen und <strong>der</strong> bekrönenden Dachgalerie.<br />
Aufgrund ihrer außerordentlichen Qualität wurde die Berline<br />
1873 auf <strong>der</strong> <strong>Wien</strong>er Weltausstellung präsentiert und von<br />
Beobachtern als Glanzpunkt <strong>der</strong> österreichischen Wagenabteilung bezeichnet. Beson<strong>der</strong>s bewun<strong>der</strong>t wurden die feinen<br />
gestalterischen Details, wie die Ausführung von Türschnallen und Hängestützen des Kastens in Form von kaiserlichen<br />
Doppeladlern.<br />
10
Schwarzes Hofkleid <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth<br />
Fanny Scheiner, <strong>Wien</strong>, um 1885<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot, Inv.-Nr. N 123<br />
<strong>Die</strong>ses prachtvolle Kleid aus schwarzer Moireeseide mit Spitzenbesatz und<br />
reicher Jetperlen-Stickerei ist vollkommen unverän<strong>der</strong>t erhalten geblieben.<br />
So dokumentiert es eindrucksvoll die hohe, schlanke Gestalt <strong>der</strong> Kaiserin mit<br />
<strong>der</strong> unglaublich schmalen, längsovalen „<strong>Wien</strong>er Wespentaille“. Als kostbares<br />
Erinnerungsstück wurde es im Kaiserhaus aufbewahrt und schließlich 1962<br />
dem Kunsthistorischen Museum übergeben.<br />
Fächer aus dem Besitz <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth<br />
Franz Krejci (<strong>Wien</strong>), um 1890<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot, Inv.-Nr. N 287<br />
Gala-Uniform eines österreichischen Feldmarschalls in deutscher Adjustierung,<br />
getragen von Kaiser Franz Joseph I.<br />
A. Uzel & Sohn (<strong>Wien</strong>), 1910<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot, Inv.-Nr. N 471<br />
HINWEIS:<br />
ZU DEN GARDEROBEN DER KAISERIN GIBT ES EINEN EIGENEN VIDEOFILM!<br />
Aus dem „Neuen <strong>Wien</strong>er Tagblatt“ erschien kurz nach dem Tod <strong>der</strong> Kaiserin im<br />
September 1898 (gekürzt)<br />
" [...]<strong>Die</strong> herrliche Gestalt <strong>der</strong> Kaiserin war seit Jahrzehnten das Ideal aller<br />
Modekünstler. Schlank, biegsam, fein, graziös; die Taillenmitte umspannte leicht<br />
ein Maß von 48 Centimetern, die Büste hob sich frei und weit, die Hüften waren von vollendetem Ebenmaß.<br />
[...] Ihr künstlerischer Sinn einerseits, und das Bedürfniss, auf ihren grossen, oft mühevollen Spaziergängen bequem und<br />
unbeengt ausschreiten zu können, hielten sie stets von allen Excentricitäten <strong>der</strong> Mode fern. So wurde denn für ihre<br />
Alltagskleidung bald eine Norm geschaffen: <strong>der</strong> Rock musste fußfrei sein, eng um die Hüften schließen und dabei doch ein<br />
freies Gehen gestatten; die Taille war blousonförmig weit, oft auch mit Jäckchenteilen und Figaros versehen und ein -- je nach<br />
laufen<strong>der</strong> Mode -- breiterer o<strong>der</strong> schmälerer Gürtel umspannte knapp die zarte Taille.<br />
Zu kleinen Details wurde dann doch <strong>der</strong> Rath <strong>der</strong> Mode herangezogen, ein Lieblingswort <strong>der</strong> Kaiserin bei Anordnung ihrer<br />
Toilette lautete sogar: 'hochmo<strong>der</strong>n'. [...]<br />
Wie allgemein bekannt, trug sich die hohe Frau seit dem Tode ihres Sohnes, des Kronprinzen Rudolph, stets in tiefstem<br />
Schwarz. Auch die wenigen Hoffestlichkeiten, die sie seitdem besuchte, sahen sie nur in dieser düsteren Trauergewandung.<br />
[...] Doch auch in früheren Zeiten war sie kleine Freundin des Farbenreichthums in <strong>der</strong> Toilette. Schwarz-weiß o<strong>der</strong> weiß mit<br />
schwarzem Aufputz, hellgrau, eventuell auch lila waren ihre Farben, unter denen damals gewählt wurde.<br />
Seit dem Tode des Kronprinzen gab es nur einen Tag im Jahre, an dem die hohe Frau in diesen Farben erschien: am 18.<br />
August, dem Geburtstag des Kaisers. Zum Kirchgang in Ischl, zur Feier des Geburtstages ihres Gemals, umgaben wie<strong>der</strong><br />
lichte Farben die ideale Schönheit Elisabeths von Oesterreich."<br />
11
ERZSÉBET, ERZSÉBET, A A MAGYAROK MAGYAROK KIRÁLYNÉJA KIRÁLYNÉJA -<br />
KRÖNUNG KRÖNUNG IN IN BUDA BUDA 1867<br />
1867<br />
„Alles ist von ihr und ihrer ungarischen Sprache enthusiasmiert.“<br />
Der Kaiser über seine Gemahlin im Februar 1866.<br />
Elisabeth bemühte sich seit Anfang 1866, ihren Ehemann dazu zu bewegen, die seit<br />
<strong>der</strong> gewaltsamen Nie<strong>der</strong>schlagung <strong>der</strong> Revolution in Ungarn 1848/49 offenen<br />
For<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Ungarn zur Wie<strong>der</strong>herstellung ihrer Autonomie zu erfüllen. Über<br />
ihre Vertraute und „Vorleserin“ Ida von Ferenczy kam Elisabeth in Kontakt mit den<br />
ungarischen Liberalen, insbeson<strong>der</strong>e mit Gyula Graf Andrássy.<br />
Elisabeth konnte sich schließlich gegen die Einwände Franz Josephs durchsetzen.<br />
Am 18. Februar 1867 wurde mit geringen Modifikationen die ungarische Verfassung<br />
von 1848 wie<strong>der</strong>hergestellt, nachdem Andrássy tags zuvor zum ungarischen<br />
Ministerpräsidenten gewählt worden war. <strong>Die</strong> Krönung am 8. Juni 1867 besiegelte<br />
die Versöhnung <strong>der</strong> Ungarn mit den Habsburgern.<br />
Bil<strong>der</strong><br />
Bil<strong>der</strong><br />
Das Krönungskleid ist eine Kreation des Pariser Modesalons von Charles Fre<strong>der</strong>ick<br />
Worth und zeigt Elemente <strong>der</strong> ungarischen Nationaltracht mit<br />
Perlenverschnürungen. Nach <strong>der</strong> Krönung schenkte Elisabeth das Kleid und den<br />
Schleier dem Bischof von Veszprém zur Aufbewahrung in <strong>der</strong> dortigen Domkirche.<br />
Elisabeth fuhr am Krönungstag, dem 8. Juni 1867, im Imperialwagen, dem<br />
„Krönungswagen“ des <strong>Wien</strong>er Hofes, von <strong>der</strong> königlichen Burg von Buda(pest) zur<br />
Krönungskirche. Er wurde für diesen Anlass neu<br />
vergoldet, was den enormen Kostenaufwand von<br />
5.000 Gulden verursachte. Außerdem wurde er eigens<br />
für die Krönung mit 100.000 Gulden versichert. Der<br />
Transport des Krönungswagens von <strong>Wien</strong> nach<br />
Budapest erfolgte per Schiff.<br />
<strong>Die</strong> Krönungsfeierlichkeiten begannen um 7 Uhr<br />
morgens, als sich <strong>der</strong> Zug von <strong>der</strong> königlichen Burg<br />
zur Krönungskirche – <strong>der</strong> Matthiaskirche -- in<br />
Bewegung setzte.<br />
Von enthusiastischem Jubel begrüßt erschien Kaiserin<br />
Elisabeth im achtspännigen goldenen Imperialwagen,<br />
<strong>der</strong> zu beiden Seiten von Leiblakaien begleitet wurden.<br />
Dem Wagen <strong>der</strong> Kaiserin folgte <strong>der</strong> sechsspännige<br />
goldene Galawagen mit <strong>der</strong> Obersthofmeisterin Gräfin<br />
Königsegg. Gräfin Königsegg erschien wie die<br />
Kaiserin im ungarischen Kostüm. Im Anschluß daran fuhren die Hofwägen mit den zur <strong>Die</strong>nstleistung in <strong>der</strong> Kirche bestimmten<br />
Palastdamen.<br />
Kaiser Franz Joseph fuhr traditionellerweise nicht im Wagen, son<strong>der</strong>n begab sich zu Pferd zur Matthiaskirche. Franz Joseph<br />
reitet in ungarischer Marschallsuniform hinter dem Bischof und dem<br />
ungarischen Oberststallmeistervertreter, <strong>der</strong> das gezückte<br />
Reichsschwert hält.<br />
Elisabeth wurde unmittelbar nach Franz Joseph am selben Tag<br />
gekrönt, eine große Auszeichnung ihrer Person. Ihre Krönung<br />
erfolgte, indem <strong>der</strong> Fürstprimas die Stephanskone über Elisabeths<br />
Schulter hielt. Während dieser für die ungarischen Königinnen<br />
typischen Form <strong>der</strong> Krönung trug Elisabeth die österreichische<br />
Hauskrone.<br />
Rasterdruck nach einer anonymen Lithographie.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, 420.602-B.)<br />
HINWEIS:<br />
EIN EIGENER VIDEOFILM ZEIGT DEN GESAMTEN ABLAUF DER<br />
KRÖNUNGSFEIERLICHKEIT AM 8. JUNI 1867 IN<br />
HISTORISCHEN DARSTELLUNGEN.<br />
12<br />
Photographie von Emil Rabeding.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, NB 511.080-B.)<br />
Anonyme Xylographie.<br />
(Reproduktion; ÖNB/Bildarchiv, 146.813-B.)
Objekte<br />
Objekte<br />
Imperialwagen – Sisis ungarischer Krönungswagen<br />
<strong>Wien</strong>, um 1735<br />
Paneelmalereien von Franz Xaver Wagenschön, 1763<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 001<br />
Beim „Imperialwagen“ handelt es sich um die vornehmste<br />
Kutsche des <strong>Wien</strong>er Hofes. Als kaiserlicher Paradewagen<br />
war er ein „Thron auf Rä<strong>der</strong>n“, also gleichsam eine Insignie,<br />
die die Macht <strong>der</strong> Dynastie repräsentierte und nur bei<br />
höchstrangigen Ereignissen wie Krönungen, Hochzeiten o<strong>der</strong><br />
Einzügen Verwendung fand.<br />
Auch Kaiserin Elisabeth benützte den (eigens zu diesem<br />
Zweck nach Ungarn transportierten) barocken Prunkwagen,<br />
als sie am 8.6.1867 unter dem Jubel <strong>der</strong> Bevölkerung zu ihrer<br />
Krönung in die Budapester Matthiaskirche fuhr.<br />
Fast fünfzig Jahre später (1916) wurde <strong>der</strong> Imperialwagen im<br />
Zuge <strong>der</strong> ungarischen Krönung Kaiser Karls zum letzten Mal<br />
verwendet, um Kaiserin Zita und Kronprinz Otto zur Kirche zu<br />
fahren.<br />
Ungarisches Krönungsreitzeug<br />
Budapest, um 1867<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nrn. S 006, S<br />
098, G 083<br />
Verwendet von Kaiser Franz Joseph I. bei seiner Krönung zum<br />
König von Ungarn<br />
DIE DIE KAISERIN KAISERIN ALS ALS REITERIN<br />
REITERIN<br />
„Sisi sieht allerliebst zu Pferde aus […]“<br />
Erzherzogin Sophie im Mai 1855.<br />
Kaiserin Elisabeth war eine <strong>der</strong> besten und mutigsten Reiterinnen<br />
ihrer Zeit. <strong>Die</strong> Reitleidenschaft wurde sicherlich durch ihr<br />
Elternhaus geför<strong>der</strong>t. Im Münchner Palais ihres Vaters Herzog Max<br />
in Bayern gab es sogar eine Zirkusmanege, in dem ihre Eltern mit<br />
Reitdarbietungen auftraten. Einen eigentlichen Reitunterricht nahm<br />
Elisabeth aber erst im Alter von fünfzehn Jahren. Als Sisi die Braut<br />
Franz Josephs wurde, konnte sie – wie <strong>der</strong> Kaiser sagte – sehr<br />
„scharmant“ reiten.<br />
<strong>Die</strong> Mutter des Kaisers, Erzherzogin Sophie, im Mai 1855:<br />
„Sisi sieht allerliebst zu Pferde aus und reißt alles zur<br />
freudiger Aufregung und Bewun<strong>der</strong>ung hin. Alles läuft<br />
durcheinan<strong>der</strong> […] es ist <strong>der</strong> Ausdruck des Entzückens. Doch<br />
lange bleiben Franzi und Sisi nicht in <strong>der</strong> Allee, son<strong>der</strong>n<br />
wenden sich bald auf die Wiesen, um ungestört zu sein.“<br />
<strong>Die</strong> Leidenschaft für das Reiten war sicher eine <strong>der</strong> größten<br />
Gemeinsamkeiten des Kaiserpaares, solange Elisabeth diesen<br />
Sport betrieb. <strong>Die</strong> Kaiserin litt jedoch schon in den frühen achtziger<br />
Jahren an Ischiasschmerzen, die ihr fallweise das Reiten<br />
unmöglich machten. Den Auftrag, ihre Stallungen aufzulösen,<br />
erteilte sie schließlich im November 1886. Allerdings gab sie die<br />
Anweisung, in England drei sichere Damenjagdpferde anzukaufen,<br />
die hauptsächlich ihrer Tochter Gisela, bei Gelegenheit aber auch<br />
ihr selbst zur Verfügung stehen sollten.<br />
<strong>Die</strong> Kaiserin nach ihrem Reitunfall in Sassetôt im September 1875.<br />
„Ihr wollt, ich soll nicht mehr reiten. Ob ich’s thu o<strong>der</strong> nicht,<br />
ich werde so sterben, wie es mir bestimmt ist.“<br />
13<br />
Lithographie nach einem Gemälde von Eduard Kaiser,<br />
1854/55. (ÖNB/Bildarchiv, Pk 2.983.)<br />
Kaiserin Elisabeth und Kronprinz Rudolf in einem<br />
Hofschlitten, 1876. Xylographie von Eduard Hallberger<br />
nach einer Zeichnung von Theodor Breidwiser, 1876.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, 213.134-B.)
<strong>Die</strong> Reitkleidung Elisabeths wurde seinerzeit nicht nur von <strong>der</strong> Öffentlichkeit,<br />
son<strong>der</strong>n auch von ihrem Gemahl viel beachtet. Ihm gefielen die etwas weiter<br />
geschnittenen Modelle besser. <strong>Die</strong> von ihr beson<strong>der</strong>s in den späteren Jahren<br />
bevorzugten hautengen Reitkostüme nannte er „gräuliche Hülsen“. <strong>Die</strong>se <strong>Klei<strong>der</strong></strong><br />
waren zumeist aus schwarzem Samt. Als Elisabeth einmal ein Reitdress in<br />
Schwarz und Weiß trug, meinte <strong>der</strong> Kaiser: „Sisi, Du siehst ja aus wie ein Zebra!“<br />
Objekte<br />
Objekte<br />
Auf Auf <strong>der</strong> <strong>der</strong> Empore<br />
Empore<br />
Reiterporträt <strong>der</strong> Prinzessin Elisabeth in Bayern vor Schloss Possenhofen<br />
Franz Adam und Karl Piloty, 1853<br />
Regensburg, Fürst Thurn und Taxis Museen, Inv.-Nr. StE 2720<br />
Gebrauchssattel <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth<br />
Casimir Foltz, <strong>Wien</strong>, um 1855<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. G 297<br />
Kaiserin Elisabeth war eine <strong>der</strong> berühmtesten Reiterinnen ihrer Zeit. Der<br />
<strong>Wien</strong>er Hofsattelmacher Casimir Foltz, <strong>der</strong> schon für Kaiser Franz I.<br />
gearbeitet hatte, fertigte für die junge Monarchin diesen prachtvollen Sattel in<br />
Form einer englischen Pritsche an. Er ist mit drei Halt gebenden Hörnern,<br />
einem Steigriemen und einem Steigbügel in Form eines Pantoffels<br />
ausgestattet. Als einziger erhaltener Gebrauchssattel <strong>der</strong> Kaiserin wurde das<br />
kostbare Stück bereits kurz nach Sisis Tod an die „Reiche Sattelkammer“ des<br />
Kaiserhauses abgegeben, von <strong>der</strong> es schließlich in die Wagenburg gelangte.<br />
Porträts von Pferden aus dem Besitz <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth<br />
Wilhelm Richter, 1865/77<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. Z 051-074<br />
Als leidenschaftliche Reiterin war Sisi auch eine große Pferdeliebhaberin, die lange Zeit einen exquisiten Stall mit rund 30<br />
eigenen Reit- und Zugtieren unterhielt. Viele dieser Pferde wurden von den Malern des Hofes für die Kaiserin porträtiert.<br />
Ein beson<strong>der</strong>es Kuriosum bildete die so genannte „Reitkapelle“ <strong>der</strong> Monarchin, ein Salon, <strong>der</strong> ganz mit Pferdeporträts<br />
ausgekleidet war. Nur beson<strong>der</strong>e Gäste, die auch selbst Pferdeliebhaber waren, wurden von <strong>der</strong> Kaiserin in diese<br />
„Kapelle“ geführt. Einer von ihnen<br />
war Sisis Vorleser Constantin<br />
Christomanos. „Sehen Sie“, erklärte<br />
sie ihm vor den Pferdebil<strong>der</strong>n, „so<br />
viele Freunde habe ich schon<br />
verloren und keinen einzigen<br />
gewonnen. Viele davon sind für mich<br />
in den Tod gegangen, was kein<br />
Mensch je getan haben würde; eher<br />
würden sie mich ermorden.“<br />
14
Herren-Reitpeitsche mit dem Porträt Kaiserin Elisabeths<br />
Österreich, 1891<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. G 401<br />
Damen-Reitpeitsche mit dem Porträt Kaiser Franz Josephs<br />
Österreich, 1891<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. G 402<br />
Wilhelm Richter: "Haltan", "Selma" und "Black", die Schweiß-<br />
Hunde <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth; Öl auf Leinwand, signiert und datiert<br />
1874.<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. Z 067<br />
Objekte<br />
Objekte<br />
Bei Bei den den den Jagd Jagd- Jagd und und und Lustwägen<br />
Lustwägen<br />
Großer gefe<strong>der</strong>ter Leib-Schlitten<br />
Armbruster (<strong>Wien</strong>), 1897<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 086<br />
<strong>Die</strong>ser elegante Leib-Schlitten war für winterliche Lustfahrten<br />
<strong>der</strong> kaiserlichen Familie bestimmt. Zur größeren<br />
Bequemlichkeit ist <strong>der</strong> zweisitzige Kasten für die Herrschaft<br />
mit Hilfe von Le<strong>der</strong>riemen in C-Fe<strong>der</strong>n eingehängt. <strong>Die</strong> an<br />
Vor<strong>der</strong>- und Rückseite angebrachten Sitzbänke für Kutscher<br />
und Lakaien sind hingegen ungefe<strong>der</strong>t. Als Hoffahrzeug ist <strong>der</strong><br />
Schlitten grün lackiert, gold beschnitten und mit rudolfinischen<br />
Kronen verziert. Um auch nachts ausfahren zu können, hat er<br />
zwei Laternen.<br />
Kaiserin Elisabeth liebte es schon als junge Frau, im Winter<br />
mit Schlitten im Schönbrunner Schlosspark auszufahren,<br />
wobei sie gerne auch selbst kutschierte. In späteren Jahren<br />
benützte sie vorwiegend große Schlitten wie diesen, die von<br />
ihrem Leib-Kutscher gelenkt wurden.<br />
Ausseer Jagdanzug Kaiser Franz Josephs I.<br />
Franz Bubácek (<strong>Wien</strong>), um 1900<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot, Inv.-Nr. WS A 2213<br />
Livree („Jagdquäker“) eines k. k.<br />
Büchsenspanners (Leibjägers) für den<br />
Jagddienst<br />
Österreich, um 1900<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum,<br />
Monturdepot, Inv.-Nr. U 171<br />
15
REISEN REISEN UND UND TOD TOD DER DER KAISERIN<br />
KAISERIN<br />
„[…] nur nicht so lang an einem Fleck sitzen.“<br />
Elisabeth an Karl Graf Grünne, 1861.<br />
<strong>Die</strong> Aufenthalte Elisabeths in <strong>Wien</strong> reduzierten sich im Laufe ihres Lebens immer<br />
mehr. Auch in <strong>der</strong> Sommerresidenz Ischl und im Jagdschloss Gödöllö verbrachte<br />
sie ab 1892 nur mehr kurze Perioden. <strong>Die</strong> Kaiserin nahm nun vorwiegend in ihren<br />
verschiedenen Reisedomizilen Quartier, doch hatte Elisabeth schon seit ihrer<br />
Eheschließung am 24. April 1854 kein richtiges Zuhause mehr.<br />
Neben Familienbesuchen in Bayern waren zunächst Kuraufenthalte Anlass für<br />
Elisabeths Reisen. Es galt dabei, Elisabeths eigene Gesundheit wie<strong>der</strong>herzustellen<br />
o<strong>der</strong> die Konstitution von Elisabeths jüngster Tochter Marie Valérie zu stärken.<br />
Zwischen 1876 und 1882 gab es eine Reihe von Aufenthalten in England und Irland<br />
mit waghalsigen Parforcejagden. Da die Kaiserin zunehmend an Rheuma und<br />
Herzbeschwerden litt, standen ab 1883 wie<strong>der</strong> Kur- und Erholungsaufenthalte im<br />
Mittelpunkt. 1885 unternahm sie mit <strong>der</strong> großen Orientfahrt eine Art Bildungsreise.<br />
Ab 1892 wurde das Reisen praktisch zu ihrer Hauptbeschäftigung. Kaum war sie<br />
irgendwo angelangt, zog es sie schon wie<strong>der</strong> weg. Wirkliche Sehnsucht hatte sie<br />
jedoch nur nach dem Meer. Dort fühlte sie sich frei und unbeschwert und kannte<br />
keinerlei Angst, nicht einmal diejenige vor dem Tod.<br />
Elisabeth zu ihrem Griechisch-Lehrer Christomanos, 1892:<br />
„<strong>Die</strong> Reiseziele sind nur deswegen begehrenswert, weil die Reise<br />
dazwischen liegt. Wenn ich irgendwo angekommen wäre und wüßte, daß ich<br />
nie mehr mich davon entfernen könnte, würde mir <strong>der</strong> Aufenthalt selbst in<br />
einem Paradies zur Hölle werden.“<br />
Elisabeth fuhr nicht gerne in <strong>Kutschen</strong>, wie sie zu ihrem Architekten Raffaele Carito sagte, „denn die Wagen machen mich<br />
nervös, man verliert ja seine ganze Individualität dabei“.<br />
Auch das Eisenbahnfahren liebte die Kaiserin nicht, berichtet ihre Hofdame Irma Sztáray, „weil sie <strong>der</strong> Bewegung und <strong>der</strong><br />
reinen frischen Luft entbehren mußte. Sie schritt im Gange des Schlafwagens auf und nie<strong>der</strong> […].“<br />
<strong>Die</strong> Kaiserin liebte hingegen das Reisen auf dem Schiff. Zu ihrem Griechisch-Lehrer Christomanos meinte sie im März 1892:<br />
„Das Leben auf dem Schiff ist doch mehr als bloßes Reisen. Es ist ein verbessertes, wahres Leben […] ohne Wunsch<br />
und Zeitempfindung. Das Gefühl <strong>der</strong> Zeit ist immer schmerzhaft, denn es gibt uns das Gefühl des Lebens.“<br />
Am 10. September 1898 verstarb die Kaiserin in Genf an den Folgen des Attentats von Luigi Lucheni. Elisabeth hatte den<br />
Tathergang nicht in seiner Tragweite realisiert. Sie nahm an, <strong>der</strong> Mann wollte ihr die Uhr entwenden. Sie konnte noch ohne<br />
Hilfe die etwa 150 Meter bis zum Schiff gehen, sank dort aber in Bewusstlosigkeit. Man brachte sie auf einer Bahre wie<strong>der</strong><br />
zurück zum Hotel Beau Rivage, wo sie die Nacht zuvor verbracht hatrte. Dort starb sie knapp nach zwei Uhr nachmittags.<br />
ZUM HERGANG DES ATTENTATS WIRD EIN EIGENER VIDEO-FILM MIT HISTORISCHEM BILDMATERIAL GEZEIGT.<br />
Objekt<br />
Objekt<br />
Leib-Landaulett <strong>der</strong> Kaiserin Elisabeth − <strong>der</strong> letzte von ihr in Genf<br />
benützte Wagen<br />
Carl Marius jun. (<strong>Wien</strong>), 1885<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 040<br />
Während Sisi als junge Frau noch häufig mit <strong>der</strong> Kutsche<br />
reiste, konnte die reife Kaiserin bereits auf ein gut<br />
ausgebautes Eisenbahnnetz zurückgreifen. Auch wenn sie<br />
die großen Distanzen mit <strong>der</strong> Bahn zurücklegte, führte sie<br />
jedoch stets eine bequeme Hof-Kutsche mit sich, um am<br />
Ankunftsort keinen Wagen mieten zu müssen. Das hier<br />
gezeigte Landaulett war eines jener Fahrzeuge, die die<br />
Kaiserin gerne auf Reisen mitnahm. Es ist ein kleines,<br />
ebenso komfortables wie unauffälliges Stadtfahrzeug,<br />
dessen Dach bei schönem Wetter geöffnet und bei<br />
Schlechtwetter geschlossen werden kann. Auch auf Sisis letzter Reise in Genf war dieser Wagen im Einsatz, weshalb er<br />
nach ihrer Ermordung als beson<strong>der</strong>es Erinnerungsstück aufbewahrt wurde.<br />
16<br />
Anonyme Photographie.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, Pf 6.639:E 112/1.)<br />
Am 3. September 1898 in Genf mit ihrer<br />
Hofdame Irma Sztáray. Letzte bekannte<br />
Aufnahme <strong>der</strong> Kaiserin vor ihrer<br />
Ermordung.
BESTATTUNG BESTATTUNG DER DER KAISERIN<br />
KAISERIN<br />
„Nun ist es gekommen, wie sie es immer wünschte […].“<br />
Marie Valérie, Tochter <strong>der</strong> Kaiserin, zum Tod ihrer Mutter im<br />
September 1898.<br />
Tagebuchnotizen von Marie Valérie, Tochter <strong>der</strong> Kaiserin:<br />
Drei Monate nach dem Selbstmord des Kronprinzen Rudolf, am 30.<br />
April 1889.<br />
„Mama wird wohl nie mehr, die sie ehemals war; sie neidet<br />
Rudolf den Tod und ersehnt ihn Tag und Nacht.“<br />
Und nach dem tödlichen Attentat auf ihre Mutter am 10. September<br />
1898:<br />
„Nun ist es gekommen, wie sie es immer wünschte, rasch,<br />
schmerzlos, ohne ärztliche Beratungen, ohne lange, bange<br />
Sorgentage für die Ihren […].“<br />
Nachdem Kaiserin Elisabeth am 10. September 1898 in <strong>der</strong> Suite<br />
des Hotel Beau Rivage verstorben war, wurde <strong>der</strong> neben dem<br />
Sterbezimmer liegende Salon schwarz ausstaffiert. Dort wurde <strong>der</strong><br />
Leichnam aufgebahrt und am 13. September eingesegnet.<br />
Am 14. September 1898 wurde <strong>der</strong> Sarg mit dem Leichnam <strong>der</strong> Kaiserin in einem örtlichen Leichenwagen vom Hotel Beau<br />
Rivage zum Genfer Bahnhof geführt, wo <strong>der</strong> Hofwagenzug zur Überstellung nach <strong>Wien</strong> bereitstand.<br />
Der Hofwagenzug kam am Abend des 15. September um 10 Uhr am <strong>Wien</strong>er Westbahnhof an. Nach <strong>der</strong> Einsegnung wurde<br />
<strong>der</strong> Sarg auf den mit sechs Rappen bespannten schwarzen Leichenwagen gehoben. Der Leichenkondukt zur Burgkapelle<br />
führte über die Mariahilfer Straße und die Ringstraße durch das Äußere Burgtor bis zum Schweizertrakt <strong>der</strong> Hofburg. Dort<br />
wartete <strong>der</strong> Kaiser mit seinen beiden Töchtern Gisela und Marie Valérie. Wie im Tagebuch <strong>der</strong> Marie Valérie beschrieben,<br />
schritt <strong>der</strong> Kaiser in aufrechter Haltung bis zur Burgkapelle hinter dem Sarg her. Dort kniete er am Kopfende des<br />
geschlossenen Sarges nie<strong>der</strong> und küsste ihn.<br />
Nachdem <strong>der</strong> geschlossene Sarg zwei Tage lang in <strong>der</strong> Burgkapelle aufgebahrt worden war, fand am 17. September 1898<br />
dessen Überführung in die die Kapuzinergruft statt. Der schwarze Leichenwagen war nun mit acht Rappen bespannt. Dabei<br />
wurde die für Hofleichen übliche Route von <strong>der</strong> Burgkapelle über den Inneren Burgplatz, den Michaelerplatz und den<br />
Josephsplatz sowie über die Augustinerstraße und Tegetthoffstraße bis zur Kapuzinerkirche genommen. Bei dieser<br />
Zeremonie des Leichenbegängnisses begleitete <strong>der</strong> Kaiser den Sarg selbst bis hinunter in die Gruft, eine Beson<strong>der</strong>heit.<br />
Am 29. Oktober 1898 erfolgte die definitive Beisetzung des Leichnams in einem Sarkophag, <strong>der</strong> ursprünglich direkt neben<br />
dem von Kronprinz Rudolf stand und diesem in <strong>der</strong> Ausführung gleicht.<br />
Mathilde, eine <strong>der</strong> Schwestern Elisabeths, ließ sich am 18. September, also einen Tag nach <strong>der</strong> Beisetzung, den Außensarg<br />
öffnen, um durch das in Kopfhöhe angebrachte Fenster des Innensarges das Gesicht Elisabeths ein letztes Mal zu sehen. Es<br />
soll bereits ziemlich entstellt gewesen sein, wie Marie Valérie in ihrem Tagebuch vermerkt.<br />
Leichenwägen Leichenwägen und und Hofbegräbnisse<br />
Hofbegräbnisse<br />
Dem Spanischen Zeremoniell zufolge gab es am <strong>Wien</strong>er Hof eine „große“ und eine „kleine“ Hoftrauer. Beim Tod eines<br />
ungekrönten Familienmitglieds galt die „kleine“ Trauer: <strong>Die</strong> Trauerfarbe war in diesem Fall Rot, weshalb beim Begräbnis ein<br />
roter Leichenwagen verwendet wurde. Auch die begleitenden Lakaien trugen nicht Schwarz, son<strong>der</strong>n die gewöhnliche<br />
Campagne-Livree des Hofes.<br />
Beim Tod von Kaiser o<strong>der</strong> Kaiserin galt hingegen die „große“ Trauer: Hier war die Trauerfarbe das Schwarz, weshalb <strong>der</strong><br />
1876/77 neu erbaute, schwarze Leichenwagen zum Einsatz kam. Er wurde von acht mit schwarzen Fe<strong>der</strong>buschen<br />
geschmückten Rappen gezogen und von Lakaien und Edelknaben in schwarzer Trauerlivree begleitet. Bei <strong>der</strong> „großen“<br />
Trauer mussten auch alle Trauergäste ganz in Schwarz erscheinen. Selbst die Knöpfe, Hutschlingen und Degengriffe <strong>der</strong><br />
Herren mussten mit schwarzem Stoff überzogen werden. <strong>Die</strong> Damen hingegen trugen bei Kaiserbegräbnissen bodenlange<br />
schwarze Schleier, so genannte „Clochen“, die ihre Gestalt ganz verhüllten.<br />
Unter Kaiser Franz Joseph wurde dieses strenge Trauerzeremoniell dreimal durchbrochen: Seine Eltern, Erzherzog Franz<br />
Karl und Erzherzogin Sophie, und sein Sohn, Kronprinz Rudolf, wurden ausnahmsweise mit dem Schwarzen Leichenwagen<br />
zur kaiserlichen Gruft bei den Kapuzinern gefahren.<br />
17<br />
Photographie.<br />
(ÖNB/Bildarchiv, Pf 6639:E 128 b, Abs. D.)<br />
Leichenbegängnis am 17. September 1898. Im<br />
Hintergrund die Albertina mit <strong>der</strong> damals noch<br />
bestehenden Albertinarampe.
Objek Objekte Objek te<br />
Schwarzer Leichenwagen<br />
Hofsattlerei (<strong>Wien</strong>), 1876/77<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Inv.-Nr. W 005<br />
Der imposante Schwarze Leichenwagen des <strong>Wien</strong>er Hofes<br />
wurde 1876/77 für die gekrönten Mitglie<strong>der</strong> des Kaiserhauses<br />
gebaut. Nur für sie galt nach Spanischem Hofzeremoniell die<br />
„große Trauer“ mit <strong>der</strong> Trauerfarbe Schwarz. Für alle übrigen<br />
Familienmitglie<strong>der</strong> gab es die „kleine Trauer“ mit <strong>der</strong><br />
Trauerfarbe Rot und einem eigenen roten Leichenwagen.<br />
Als Gemahlin des regierenden Kaisers wurde Sisi im am 17.<br />
September 1898 mit dem Schwarzen Leichenwagen zu Grabe<br />
getragen. Bei dieser letzten Fahrt war <strong>der</strong> prachtvolle Wagen<br />
mit acht Rappen bespannt und wurde von Edelknaben und<br />
Laternenträgern in schwarzer Trauerkleidung flankiert.<br />
Achtzehn Jahre später (1916) wurde auch Elisabeths Gemahl<br />
Franz Joseph in diesem Wagen zur Kapuzinergruft gefahren.<br />
1989 fand <strong>der</strong> Schwarze Leichenwagen beim Begräbnis <strong>der</strong> im Exil verstorbenen<br />
Kaiserin Zita zum letzten Mal Verwendung.<br />
Trauer-Uniform für k. k. Edelknaben<br />
<strong>Wien</strong>, 2. Hälfte 19. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
<strong>Wien</strong>, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot, Inv.-Nrn. U 668, 669, 676, 679 (Röcke), U<br />
691, 692, 694, 695 (Hosen)<br />
18
ALLGEMEINE ALLGEMEINE INFORMATIONEN<br />
INFORMATIONEN<br />
ÖFFNUNGSZEITEN ÖFFNUNGSZEITEN WAGENBURG<br />
WAGENBURG<br />
November – März täglich 10 bis 16 Uhr<br />
April - Oktober täglich 9 bis 18 Uhr<br />
EINTRITTSPREISE<br />
EINTRITTSPREISE<br />
Erwachsene € 4,50<br />
Erwachsene ermäßigt € 3,--<br />
Gruppen ab 10 Pers., p. P. € 3,--<br />
Schüler von 6 – 18 Jahren € 2,50<br />
Sc hüler im Klassenverband € 2,--<br />
Familienkarte (2 Erwachsene, bis zu 3 Kin<strong>der</strong>) € 9,--<br />
Audio Guide<br />
Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch € 2,--<br />
Än<strong>der</strong>ungen vorbehalten.<br />
FÜHRUNGEN<br />
FÜHRUNGEN<br />
Jeden Sonntag um 11 Uhr<br />
Führungspreis: € 3,--<br />
Buchung von Son<strong>der</strong>führungen:<br />
Tel. + 43/1/525 24-5202| Fax + 43/1/525 24-5299 | info.mup@khm.at<br />
Führungen Führungen für für Kin<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong><br />
Es finden in <strong>der</strong> Wagenburg regelmäßig Kin<strong>der</strong>führungen statt: “pferdenärrisch, reiselustig und immer top gestylt!”<br />
gestylt!”<br />
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.khm.at o<strong>der</strong> Sie rufen an unter:<br />
Tel. + 43/1/525 24-5202| Fax + 43/1/525 24-5299 | info.mup@khm.at<br />
Kin<strong>der</strong> gratis, Erwachsene ermäßigter Eintritt- € 3,-<br />
Anmeldung nicht erfor<strong>der</strong>lich<br />
TOURISMUS<br />
TOURISMUS-INFORMATION<br />
TOURISMUS INFORMATION<br />
Tel.: + 43 1 525 24– 4031<br />
e-mail: tourist@khm.at<br />
Mag. Maria Gattringer<br />
Tel.: + 43 1 525 24– 4028<br />
Mobil: + 43 664 605 14– 4028<br />
Fax: + 43 1 525 24– 4098<br />
e-mail: maria.gattringer@khm.at<br />
KOMBITICKETS<br />
KOMBITICKETS<br />
„Schätze „Schätze <strong>der</strong> <strong>der</strong> Habsburger“:<br />
Habsburger“: Habsburger“: Kunsthistorisches Museum und Schatzkammer:<br />
€ 18,— pro Person; Gruppen ab 10 p. P. € 12,—<br />
Mag. Markus Kustatscher<br />
Mobil: + 43 664 605 14– 4031<br />
Fax: + 43 1 525 24– 4098<br />
e-mail: markus.kustatscher@khm.at<br />
„Imperiale „Imperiale Sammlungen“ Sammlungen“ Sammlungen“ : : Kunsthistorisches Museum, Schatzkammer und Wagenburg:<br />
€ 21,— pro Person; Gruppen ab 10 p. P. € 15,—<br />
INHALT INHALT / / GLIEDERUNG GLIEDERUNG GLIEDERUNG DER DER AUSSTELLUNG<br />
AUSSTELLUNG<br />
ZEITTAFEL ZUR KAISERIN ELISABETH ..................................................................... 3<br />
SISI, DIE BRAUT DES KAISERS VON ÖSTERREICH ................................................. 4<br />
DIE JUNGE KAISERIN ................................................................................................. 6<br />
DIE KAISERIN ALS MUTTER ....................................................................................... 8<br />
IHRE MAJESTÄT DIE KAISERIN VON ÖSTERREICH ................................................10<br />
ERZSÉBET, A MAGYAROK KIRÁLYNÉJA - KRÖNUNG IN BUDA 1867 ....................12<br />
DIE KAISERIN ALS REITERIN ....................................................................................13<br />
REISEN UND TOD DER KAISERIN.............................................................................16<br />
BESTATTUNG DER KAISERIN ...................................................................................17<br />
Texte zu Kaiserin Elisabeth: Dr. Elisabeth Hassmann<br />
Texte zu den Objekten: Dr. Monica Kurzel-Runtscheiner<br />
Än<strong>der</strong>ungen vorbehalten,<br />
Stand Jänner 2009<br />
kunsthistorisches museum<br />
mit mvk und ötm<br />
wissenschaftliche anstalt<br />
öffentlichen rechts<br />
A-1010 <strong>Wien</strong>, Burgring 5<br />
Phone +43 1 525 24/4031<br />
Fax +43 1 525 24/4098<br />
www.khm.at, tourist@khm.at