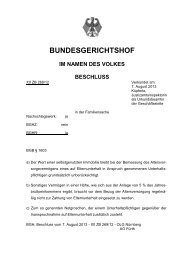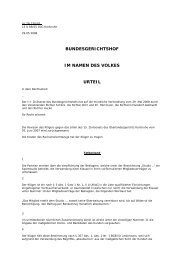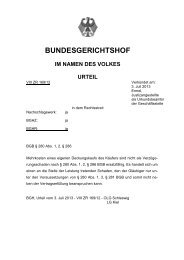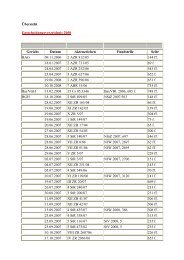Dr. Markus Winkler Entwicklungsschwerpunkte im ... - Ja-Aktuell
Dr. Markus Winkler Entwicklungsschwerpunkte im ... - Ja-Aktuell
Dr. Markus Winkler Entwicklungsschwerpunkte im ... - Ja-Aktuell
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AUFSATZ ZIVILRECHT · DER VERGÜTUNGSANSPRUCH DES RECHTSANWALTS GEGENÜBER SEINEM MANDANTEN<br />
Anspruchs nach § 254 BGB besteht. Der BGH betont dabei, dass<br />
die Kenntnis des Mandanten um ein juristisches Problem den<br />
Rechtsanwalt sogar dann nicht entlasten kann, wenn der Mandant<br />
selbst über eine juristische Vorbildung verfügt. Im rein rechtlichen<br />
Bereich ist der Anwalt <strong>im</strong> Verhältnis zu seinem Mandanten<br />
grundsätzlich allein verantwortlich. 71<br />
Hinsichtlich der Verjährung 72 gelten die allgemeinen Vorschriften<br />
(§§ 195 ff. BGB). Die Sondervorschrift des § 51b BRAO<br />
(= § 51 BRAO a.F.) wurde mit dem Verjährungsanpassungsgesetz<br />
abgeschafft. 73<br />
F. PROZESSUALE DURCHSETZUNG<br />
I. § 29 ZPO<br />
Der Vergütungsanspruch des Rechtsanwalts kann grundsätzlich am<br />
allgemeinen Gerichtsstand des Wohnsitzes bzw. des Sitzes des<br />
Mandanten gem. §§ 12, 13, 17 ZPO geltend gemacht werden.<br />
Für den Anwalt stellt sich die entscheidende Frage: Kann er seine<br />
Gebührenforderung wahlweise auch am Gericht des Kanzleisitzes<br />
nach § 29 ZPO geltend machen? Der X. Zivilsenat verneint dies<br />
grundsätzlich 74 und weicht damit von der früheren höchstrichterlichen<br />
Rechtsprechung ab, die für einen einheitlichen Gerichtsstand<br />
des Erfüllungsortes votierte. 75 Nach § 29 Abs. 1 ZPO ist,<br />
wenn über eine Verpflichtung aus einem Vertragsverhältnis gestritten<br />
wird, das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung<br />
zu erfüllen ist. Dieser Erfüllungsort best<strong>im</strong>mt sich – sofern<br />
keine gesetzlichen Sonderregelungen eingreifen – nach dem<br />
Leistungsort, der aus § 269 Abs. 1 und 2 BGB folgt. Die dispositive<br />
Norm des § 269 Abs. 1 BGB stellt die Regel auf, dass die Leistung<br />
an dem Ort zu erfolgen hat, an welchem der jeweilige Schuldner<br />
zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz<br />
hatte. Dies ist be<strong>im</strong> Vergütungsanspruch des Rechtsanwalts als<br />
Geldschuld der Wohnsitz des Mandanten (§§ 270 Abs. 4, 269<br />
Abs. 1 BGB). Allein aus dem Abschluss eines Vertrags mit einem<br />
Rechtsanwalt ergibt sich nach dem BGH insbesondere keine stillschweigende<br />
Vereinbarung über einen Leistungsort dergestalt, dass<br />
der Mandant am Ort der Kanzlei seinen Zahlungsverpflichtungen<br />
nachkommen soll. 76 Auch weist der Anwaltsvertrag grundsätzlich<br />
keine Besonderheiten auf, die bei der nur hilfsweise einschlägigen<br />
Regel des § 269 Abs. 1 BGB zu beachten wären. Ein einheitlicher<br />
Erfüllungsort am Kanzleisitz wäre nach dem BGH eine vom Gesetz<br />
nicht gedeckte Privilegierung der Rechtsanwälte gegenüber anderen<br />
Gläubigern von Geldforderungen. 77<br />
Besonderheiten gelten <strong>im</strong> Hinblick auf Art. 5 EuGVVO. 78 Während<br />
<strong>im</strong> nationalen Recht eine Abkehr von einem einheitlichen<br />
AUFSATZ ÖFFENTLICHES RECHT · ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE IM KOMMUNALRECHT<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Markus</strong> <strong>Winkler</strong>, Universität Mainz*<br />
<strong>Entwicklungsschwerpunkte</strong> <strong>im</strong> Kommunalrecht<br />
A. ÜBERGREIFENDE IMPULSE<br />
Das Kommunalrecht unterscheidet sich zwar stärker von Land zu<br />
Land als die anderen beiden Kernbereiche des Besonderen Verwaltungsrechts,<br />
das Baurecht und das allgemeine Gefahrenabwehrrecht.<br />
Auf manche Teilgebiete des Kommunalrechts wirken<br />
sich aber europäisches Gemeinschaftsrecht und Bundesrecht vereinheitlichend<br />
aus. Zudem erfassen best<strong>im</strong>mte Reformprojekte<br />
früher oder später alle Länder, und sei es auch zeitversetzt.<br />
Das Europarecht und das einfache Bundesrecht betreffen vor<br />
allem das privatrechtliche Handeln der Kommunen und die Wahl<br />
der Organisationsformen für die Erfüllung ihrer Aufgaben (III 2<br />
Erfüllungsort mit dieser BGH Rechtsprechung erfolgte, besteht <strong>im</strong><br />
europäischen Zuständigkeitsrecht nach Art. 5 Nr. 1b EuGVVO ein<br />
einheitlicher Gerichtsstand am Kanzleisitz des Rechtsanwalts. 79<br />
II. § 11 RVG<br />
Im Zusammenhang mit der prozessualen Durchsetzung des Vergütungsanspruches<br />
ist § 11 RVG zu beachten. Diese Vorschrift<br />
eröffnet dem <strong>im</strong> gerichtlichen Verfahren tätig gewordenen<br />
Rechtsanwalt – wie auch seinem Mandanten – die Möglichkeit,<br />
die vom Rechtsanwalt berechnete Vergütung durch ein einfaches,<br />
kostengünstiges und schnelles Verfahren gerichtlich überprüfen<br />
zu lassen. Hieraus folgt jedoch, dass dem Rechtsanwalt, der seine<br />
Vergütung nach § 11 RVG feststellen lassen kann, für eine Gebührenklage<br />
vor den ordentlichen Gerichten das Rechtsschutzbedürfnis<br />
fehlt, so dass die Klage unzulässig ist. 80<br />
G. FAZIT<br />
Am praxisorientierten Fall des Rechtsanwalts, der seinen Vergütungsanspruch<br />
aus dem Anwaltsvertrag durchsetzen will, lassen<br />
sich die Systematik des Bürgerlichen Gesetzbuches und die Fähigkeit<br />
zum stringenten Anspruchsaufbau <strong>im</strong> Rahmen einer Klausur<br />
hervorragend abprüfen. Die Spezialmaterie des Anwaltsrechts, das<br />
zumindest <strong>im</strong> Hinblick auf die dargestellten vier Grundpflichten<br />
jedem späteren Rechtsanwender bekannt sein sollte, wird dabei<br />
zum Maßstab des einzuhaltenden Pflichtenkatalogs des § 280<br />
Abs. 1 BGB. Zivilprozessuale Besonderheiten können dabei eine<br />
zusätzliche Herausforderung sein, die in einer praxisorientierten<br />
Ausbildung nicht vernachlässigt werden sollten.<br />
71 BGH NJW-RR 2005, 1435 m.w.N.<br />
72 Im Rahmen der Aufrechung sind §§ 390, 215 BGB zu beachten.<br />
73 Gesetz v. 9.12.2004, BGBl. I, 3214, in Kraft seit 15.12.2004, dazu Borgmann NJW<br />
2005, 22 (29). Diese Gesetzesänderung brachte das Ende der Rechtsprechung zum<br />
Sekundäranspruch gegen den Anwalt. Danach war ein Rechtsanwalt verpflichtet, seinen<br />
Mandanten auf mögliche Schadensersatzansprüche gegen sich selbst aufmerksam zu<br />
machen. Unterließ der Anwalt dies, so bestand ein Schadensersatzanspruch des Mandanten<br />
dahingehend, so behandelt zu werden, als sei die Verjährung nicht eingetreten.<br />
Dazu Sonthe<strong>im</strong>er DStR 2005, 834; Bruns NJW 2003, 1498 m.w.N. Zum Übergangsrecht:<br />
Zugehör WM Sonderbeilage Nr. 3/2006, 28 f.<br />
74 BGHZ 157, 20 = NJW 2004, 54. Dazu P. Gottwald FamRZ 2004, 98; Scherf NJW<br />
2004, 722; N. Schneider AnwBl 2004, 121; Neumann/Spangenberg BB 2004, 901.<br />
75 BGHZ 97, 79 (82) = NJW 1986, 79; BGH WM 1981, 411; BGH NJW 1991, 3095.<br />
76 BGHZ 157, 20 = NJW 2004, 54.<br />
77 BGHZ 157, 20 = NJW 2004, 54.<br />
78 BGH NJW 2006, 1806.<br />
79 Dazu Nagel/Gottwald Internationales Zivilprozessrecht, 6. Aufl. 2007, § 3 Rn. 46 einerseits<br />
und Rn. 50 ff. andererseits. Zu den Problemen um die internationale Zuständigkeit<br />
nach § 29 ZPO: H. Roth FS Schlosser, 2005, S. 773 ff.<br />
80 BGH NJW 1981, 875, 876 (allerdings noch zu § 19 BRAGO).<br />
und IV 2). Eine wichtige Rolle spielt daneben das Bundesverfassungsrecht.<br />
Neben Art. 28 I 2 und II GG stehen hier die Grundrechte<br />
<strong>im</strong> Mittelpunkt (II, III 1 und IV 1). Noch nicht absehbar ist,<br />
wie streng das 2006 in Art. 84 I 7 und Art. 85 I 2 GG aufgenommene<br />
Verbot an den Bundesgesetzgeber, den Kommunen neue<br />
Aufgaben zu übertragen, in der Praxis gehandhabt werden wird. 1<br />
* Der Autor ist Akademischer Rat am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie und öffentliches<br />
Recht von Professor Uwe Volkmann an der Universität Mainz.<br />
1 Zu den Auslegungsmöglichkeiten Burgi DVBl 2007, 70 (76 f.); Schoch DVBl. 2007, 261<br />
(262 ff.)<br />
6/2007 405<br />
AUFSATZ
AUFSATZ<br />
AUFSATZ ÖFFENTLICHES RECHT · ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE IM KOMMUNALRECHT<br />
An Vorhaben der Verwaltungsreform ist die Umstellung des<br />
kommunalen Haushaltsrecht auf die doppelte Buchführung <strong>im</strong><br />
vollen Gang. 2 Mit einer Reduzierung der für die Kommunalaufsicht<br />
zuständigen Mittelbehörden in den kleineren Flächenländern<br />
hat <strong>im</strong> <strong>Ja</strong>hr 2000 Rheinland-Pfalz begonnen. 2005 zog Niedersachsen<br />
nach, und bis 2008 wird Sachsen folgen. 3 In Sachsen-<br />
Anhalt und Sachsen ist die Kommunalaufsicht über kreisangehörige<br />
Gemeinden bereits den Landkreisen übertragen. 4 Für dünn<br />
besiedelte Gebiete in Norddeutschland wird zzt über die Bildung<br />
kreisfreier Großgemeinden anstelle bisheriger Landkreise 5 sowie<br />
von Regionalkreisen in der Größe früherer Regierungsbezirke 6<br />
diskutiert.<br />
B. KOMMUNALE DEMOKRATIE<br />
Nur punktuell beeinflusst das Bundesrecht die so genannte Kommunalverfassung,<br />
d.h. das innere Organisationsrecht der Gemeinden<br />
und Gemeindeverbände. Hier steht Art. 28 I 2 GG <strong>im</strong> Vordergrund,<br />
der den Ländern gebietet, in ihrem Recht eine kommunale<br />
Volksvertretung vorzusehen, die nach denselben Grundsätzen<br />
gewählt wird wie der Bundestag. Nur ausnahmsweise kann<br />
gem. Art. 28 I 4 GG eine Gemeindeversammlung an die Stelle des<br />
Repräsentativorgans treten. Die direktdemokratische Mitwirkung<br />
der örtlichen Gemeinschaft an der Kommunalverwaltung in Bürgerentscheiden<br />
ist jedoch nicht bereits deswegen verfassungswidrig.<br />
I. Repräsentation der örtlichen Gemeinschaft<br />
Volksvertretung ist in den Gemeinden der Gemeinderat. In den<br />
Städten heißt er Stadtrat oder Stadtverordnetenversammlung. In<br />
den Landkreisen wird das Volk durch den Kreistag repräsentiert.<br />
1. Entscheidungskompetenz der Kommunalvertretung<br />
Anders als staatliche Parlamente kann eine Kommunalvertretung<br />
grundsätzlich Beschlusskompetenzen auf Ausschüsse, Ortsbeiräte<br />
oder sogar auf den Bürgermeister oder Landrat übertragen. Die<br />
vom Grundgesetz hervorgehobene Position der Kommunalvertretung<br />
verbietet allerdings, dass sie zentrale Kompetenzen abgibt.<br />
Zu ihren nicht delegierbaren Kernkompetenzen gehört der Beschluss<br />
von Satzungen. Dieses Delegationsverbot betrifft indes nur<br />
die verbandsinterne Aufgabenverteilung. Es verhindert schon deshalb<br />
nicht, dass kommunale Satzungen dynamische Verweisungen<br />
auf Normen des Landesrechts enthalten. 7 Das gilt auch dann,<br />
wenn die staatliche Bezugsnorm auf einer ungesicherten Tatsachengrundlage<br />
ergangen ist und der Normgeber daher zur Beobachtung<br />
und u.U. zur Korrektur dieser Norm verpflichtet ist. 8 Unwirksam<br />
sind kommunale Satzungen allerdings, wenn ein anderer<br />
als der beschlossene Text ausgefertigt oder verkündet wurde. 9<br />
2. Beiräte und Ausschüsse der Kommunalvertretung<br />
Ausschüsse oder Ortsbeiräte können nur als Delegationsempfänger<br />
Hoheitsbefugnisse ausüben. Ihre demokratische Legit<strong>im</strong>ation<br />
leiten sie von der Kommunalvertretung als ganzer ab. Dass u.U.<br />
nur die wahlberechtigten Bewohner einzelner Ortsteile in Ortsbeiräten<br />
ein weiteres Mal vertreten sind, diejenigen anderer Ortsteile<br />
aber nicht, weil nicht für das ganze Gemeindegebiet Ortsbezirke<br />
gebildet sind, verletzt deshalb nicht die demokratische<br />
Gleichheit aller Bürger. 10 Ebenso unbedenklich ist, dass EU-Bürger<br />
außer in der kommunalen Volksvertretung auch <strong>im</strong> Ausländerbeirat<br />
vertreten sind; 11 dieser ist ein reines Beratungsgremium<br />
ohne Entscheidungsbefugnisse.<br />
Auch dass »sachkundige Bürger« in Ausschüsse der Kommunalvertretung<br />
berufen werden können, ohne dem Vertretungsorgan<br />
selbst anzugehören, steht grundsätzlich <strong>im</strong> Einklang mit dem<br />
Demokratieprinzip. Bilden sie allerdings die Mehrheit in einem<br />
406 6/2007<br />
beschließenden Ausschuss, so muss die Vertretung dessen Beschlusskompetenzen<br />
eng begrenzen, um seine geminderte personelle<br />
Legit<strong>im</strong>ation durch ein höheres Maß an sachlich-inhaltlicher<br />
Legit<strong>im</strong>ation zu kompensieren. 12 Bei der Besetzung der Ausschüsse<br />
gebietet Art. 28 I 2 GG, sicherzustellen, dass alle politischen<br />
Gruppierungen spiegelbildlich zu ihrem Sitzanteil <strong>im</strong> Gesamtorgan<br />
vertreten sind. Dies wäre jedenfalls be<strong>im</strong> Auszählungsverfahren<br />
nach d’Hondt nicht gewährleistet, wenn bei der Ausschusswahl<br />
mehrere Gruppierungen eine gemeinsame Liste aufstellen<br />
dürften. 13<br />
3. Status der Mitglieder und Fraktionen<br />
Dass die Fraktionen politischer Gruppierungen in einer Kommunalvertretung<br />
gleichmäßig mit Informationen, personellen, sächlichen<br />
und finanziellen Arbeitsmitteln auszustatten sind, 14 beruht<br />
ebenfalls auf Art. 28 I 2 GG, da ihre Arbeit der Repräsentativfunktion<br />
der Kommunalvertretung dient. Die Bildung einer<br />
Fraktion setzt eine grundsätzliche politische Übereinst<strong>im</strong>mung<br />
ihrer Mitglieder voraus, 15 wenn auch nicht deren Zugehörigkeit<br />
zur selben politischen Partei. Aus Art. 28 I 2 GG folgt auch ein<br />
Gebot proportionaler Berücksichtigung der Fraktionen bei der<br />
Ausschussbesetzung. 16 Art. 3 I, 9 I oder 21 I GG schützen die<br />
Fraktionsarbeit indes nicht. Da weder Art. 28 I 2 GG noch seine<br />
landesverfassungsrechtlichen ¾quivalente subjektive Rechte vermitteln,<br />
17 können die Fraktionen Teilnahmerechte mithin nicht<br />
auf verfassungsrechtliche, sondern nur auf einfachgesetzliche Normen<br />
wie z.B. § 30 RhPfGemO, § 36a HGO oder § 56 NRWGO<br />
stützen.<br />
Die kommunalrechtlichen Verbote an Mandatsträger, <strong>Dr</strong>itte<br />
gegenüber der Kommune zu vertreten, gelten auch für Weisungsbzw.<br />
Auftragsangelegenheiten; <strong>im</strong> Fall von Rechtsanwälten allerdings<br />
werden sie verfahrensrechtlich von § 3 II BRAO überlagert.<br />
18 Um Interessenkollisionen auszuschließen, die nicht nur<br />
punktuell aufträten, sondern geradezu vorprogrammiert wären,<br />
ist das Mandat in der Kommunalvertretung unvereinbar mit der<br />
Tätigkeit als Beamter oder Angestellter der Kommune selbst,<br />
eines öffentlich-rechtlichen Verbandes, dem sie angehört, oder<br />
der für die Kommune zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde<br />
sowie mit leitenden Funktionen in Unternehmen, an denen die<br />
Kommune beteiligt ist.<br />
Eine solche Leitungsfunktion haben Personen inne, die das<br />
Unternehmen allein oder zusammen mit anderen nach außen<br />
ständig vertreten. Das trifft z.B. auf den ¾rztlichen Direktor eines<br />
Kreiskrankenhauses zu, nicht aber auf einen Chefarzt, der ihn <strong>im</strong><br />
Verhinderungsfall vertritt. 19 Weder das Verhältnismäßigkeitsprin-<br />
2 Überblick bei Thormann KommJur 2005, 281.<br />
3 Vgl. Hoegner/Groß DÖV 2000, 1040; Reffken NdsVBl 2006, 177; Fügemann SächsVBl<br />
2006, 1; Sponer LKV 2006, 337.<br />
4 Zu § 112 I SächsGemO vgl. SächsVerfGH LKV 2006, 79 (80).<br />
5 Ipsen NdsVBl 2005, 313; Sellmann/Sellmann NdsVBl 2006, 98.<br />
6 Kasper DÖV 2006, 589; Meyer DÖV 2006, 929; Schröder LKV 2006, 540.<br />
7 BVerwG NVwZ 2005, 1325 f.; BayVGH NVwZ-RR 2007, 57 f.<br />
8 Insoweit a.A. OVG NRW NVwZ 2005, 606 f.<br />
9 BVerwGE 120, 82, 86 = JA 2004, 795 (Meister), NRWOVG NWVBl. 1992, 288. Zu<br />
der vom Rechtsstaatsprinzip gebotenen Auflagenstärke des Bekanntmachungsorgans jetzt<br />
BVerwG NVwZ 2007, 216.<br />
10 RhPfOVG DVP 2002, 251 f.<br />
11 A.A. Troidl BayVBl 2004, 321 (326).<br />
12 Vgl. BVerfGE 107, 59 (87 f.) = JA 2004, 22 (Häußermann).<br />
13 BVerwGE 119, 305 (307 f.) = JA 2004, 603 (Schwind).<br />
14 HessVGH NVwZ-RR 1999, 188 und DÖV 2001, 256 f.; BayVGH NVwZ 2000,<br />
811 f.; OVG NRW NVwZ 2003, 376.<br />
15 NRWOVG DVBl 2005, 651 f.<br />
16 BremOVG DVBl 1990, 829; Groh NWVBl 2001, 41 (44); a.A. RhPfOVG NVwZ-RR<br />
1996, 460 f.<br />
17 Vgl. zu Art. 3, 9 und 28 I 2 GG BVerfGE 99, 1, 7.<br />
18 Zu Letzterem a.A. VG Schleswig NVwZ-RR 2001, 596.<br />
19 BWVGH DVBl 2001, 825; BayVGH NVwZ-RR 2004, 442 (443).
AUFSATZ ÖFFENTLICHES RECHT · ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE IM KOMMUNALRECHT<br />
zip noch der gleichheitsrechtliche Gehalt des Art. 137 I GG<br />
gebietet, die Inkompatibilität auch bei Beschäftigten der Kommunen<br />
selbst und öffentlich-rechtlicher Verbände, denen sie angehören,<br />
auf die Inhaber von Leitungsfunktionen zu beschränken. 20<br />
Vertretungsmitglieder können auf ihr Mandat verzichten, ohne<br />
dass dafür ein wichtiger Grund vorliegen müsste. Rechtsmissbräuchlich<br />
und daher unwirksam ist jedoch ein kollektiver Rücktritt<br />
mit dem Ziel, eine Neuwahl herbeizuführen; er liefe auf ein<br />
<strong>im</strong> Gesetz nicht vorgesehenes Selbstauflösungsrecht der Vertretung<br />
hinaus. 21<br />
II. Unmittelbare Mitwirkung der örtlichen Gemeinschaft<br />
Während schlichte Einwohner der Kommunen nur Ansprüche<br />
auf Information durch die und auf Anregung eines Tätigwerdens<br />
der verfassten Organe besitzen, können ihre Bürger als der zur<br />
aktiven Mitwirkung berufene Teil der »örtlichen Gemeinschaft«<br />
mit Hilfe der Instrumente Bürgerbegehren und Bürgerentscheid<br />
auch unmittelbar Entscheidungen treffen.<br />
1. Zulässige Gegenstände<br />
Bürgerbegehren dürfen nur auf Entscheidungen gerichtet sein, die<br />
danach auch Inhalt eines Bürgerentscheids sein können. Die<br />
Kommunalordnungen begrenzen die in Betracht kommenden<br />
Gegenstände auf wichtige Angelegenheiten der Kommune <strong>im</strong><br />
Bereich der Selbstverwaltung. Des weiteren klammern sie Entscheidungen<br />
aus, die die Gestaltungsfreiheit des Repräsentativorgans<br />
beeinträchtigen würden, die innere Organisation der Kommunalverwaltung<br />
oder die Rechtmäßigkeit des kommunalen<br />
Verwaltungshandelns beträfen. 22 Der geschützte Gestaltungsspielraum<br />
der Kommunalvertretung umfasst <strong>im</strong> Kern Haushalts- und<br />
Planungsentscheidungen. 23<br />
Im Einzelnen sind Grundsatz- und Vollzugsentscheidungen oft<br />
unterschiedlich zu behandeln. So kann die Zahl der Beigeordneten<br />
<strong>im</strong> Rahmen der gesetzlichen Vorgaben per Bürgerentscheid<br />
geregelt werden. Ob ein best<strong>im</strong>mter Beigeordneter in sein Amt<br />
eingeführt wird, gehört jedoch zu den »Rechtsverhältnissen« der<br />
Organwalter und Bediensteten i.S. der Negativkataloge. 24 Abgaben,<br />
deren Höhe nicht bürgerentscheidfähig ist, sind neben den in<br />
den Kommunalabgabengesetzen vorgesehenen Gebühren und<br />
Beiträgen z.B. auch Parkgebühren. 25 Ob eine Abgabe überhaupt<br />
erhoben werden soll, kann aber Gegenstand eines Bürgerentscheids<br />
sein, soweit die Kommune zur Erhebung nicht gesetzlich<br />
verpflichtet ist. 26<br />
2. Rechtsstellung der Initiatoren<br />
Umstritten, aber kaum praktisch relevant ist, ob dadurch, dass ein<br />
Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids gestellt wird,<br />
die Antragsteller bzw. das Bürgerbegehren als solches zum Organ<br />
der Kommune werden oder nicht. 27 Wichtiger ist in der Praxis,<br />
auf welchem Weg die Initiatoren die Durchführung erzwingen<br />
oder eine nach ihrer Ansicht unrichtige Feststellung des Abst<strong>im</strong>mungsergebnisses<br />
korrigieren lassen können.<br />
Lehnt die Kommunalvertretung den Antrag als unzulässig ab,<br />
so hält die Rechtsprechung durchweg eine Feststellungsklage gem<br />
§ 43 VwGO für statthaft, die auf Feststellung der Zulässigkeit des<br />
Bürgerentscheids gerichtet ist. Aktiv prozessführungsbefugt sind<br />
dabei je nach Landesrecht entweder die Unterzeichner 28 oder das<br />
Bürgerbegehren selbst, 29 gesetzlich vertreten jeweils durch die benannten<br />
Vertreter. Die Feststellungsklage tritt jedoch gem § 43 II<br />
VwGO zurück, falls eine Verpflichtungsklage auf Durchführung<br />
des Bürgerentscheids oder eine Anfechtungsklage gegen seine<br />
Nichtzulassung 30 statthaft ist. Sofern man <strong>im</strong> Verhältnis zwischen<br />
Kommunalorganen keine Außenwirkung für möglich hält und<br />
damit keinen Verwaltungsakt (VA) in der Entscheidung der<br />
Kommunalvertretung sieht, geht jedenfalls die allgemeine Leistungsklage<br />
auf Durchführung des Bürgerentscheids 31 der Feststellungsklage<br />
vor.<br />
Stellt der Wahlausschuss nach der Abst<strong>im</strong>mung fest, dass das<br />
Bürgerbegehren abgelehnt sei, so ist jedenfalls diese Feststellung<br />
ein VA gegenüber den Unterzeichnern bzw. dem Bürgerbegehren.<br />
Diese können sie daher mit Widerspruch und Anfechtungsklage<br />
angreifen. 32 Die Wahlprüfungsbeschwerde als kommunalwahlrechtlicher<br />
Sonderrechtsbehelf ist ausdrücklich ausgeschlossen<br />
und mangels einer Regelungslücke auch nicht analog anwendbar.<br />
33<br />
3. Verhältnis zu den Kompetenzen der gewählten Organe<br />
In den meisten Ländern entfaltet der positive Bürgerentscheid für<br />
mehrere <strong>Ja</strong>hre eine Sperrwirkung gegen Entscheidungen der<br />
Kommunalvertretung, die ihm widersprächen. Diese Sicherung<br />
seiner Effektivität verstößt nicht gegen ein bundesrechtliches<br />
Prinzip des Vorrangs der repräsentativen vor der direkten Demokratie.<br />
34 Nach bayerischem Verfassungsrecht soll trotz Art. 28<br />
I 1 GG anderes gelten, 35 weshalb in Bayern keine Sperrwirkung<br />
(mehr) eintritt.<br />
Die Mitglieder der gewählten Kommunalorgane und ihrer Teile<br />
können der Sperrwirkung allerdings vor einem Bürgerentscheid<br />
dadurch entgegentreten, dass sie sich in weiterem Maße in amtlicher<br />
Eigenschaft zu seinem Gegenstand äußern, als sie es vor<br />
Wahlentscheidungen der Bürger dürften. Während die Inhaber<br />
kommunaler ¾mter nämlich vor Wahlen zur Neutralität verpflichtet<br />
sind, wenn sie sich als solche äußern – und dies auch<br />
dann, wenn sich ein Amtsinhaber zur Wiederwahl stellt 36 –, können<br />
sie zum Thema eines Bürgerentscheids wertende Aussagen<br />
abgeben. Sie sind hier nur zur Sachlichkeit und Wahrhaftigkeit<br />
verpflichtet. Unzulässig ist allerdings die Auslage amtlicher Entscheidungsempfehlungen<br />
<strong>im</strong> Abst<strong>im</strong>mungslokal. 37<br />
C. ORGANISATIONSFORMEN DER AUFGABENERFÜLLUNG<br />
Längst hat die Privatisierungswelle auch die Kommunalverwaltung<br />
erreicht. Das Kommunalwirtschaftsrecht muss mittlerweile<br />
mit den Folgefragen des Umstands fertig werden, dass die Kommunen<br />
ihre Aufgaben in verschiedensten Organisationsformen<br />
erfüllen.<br />
20 BVerwGE 117, 11, 17 f. = JA 2003, 379 (Schliesky); meine gegenteilige Auffassung in<br />
Ley/Jutzi (Hrsg.) Staats- und Verwaltungsrecht für Rheinland-Pfalz, 4. Aufl 2005, Teil D<br />
Rn. 110 gebe ich auf.<br />
21 VG Osnabrück NVwZ-RR 2006, 278 (281 f.).<br />
22 NRWOVG NVwZ 2002, 766 f.; Ritgen NVwZ 2000, 129 (135).<br />
23 Vgl. zur Bauleitplanung Kautz BayVBl 2005, 193.<br />
24 HessVGH NVwZ 2004, 281 f.; Frotscher/Knecht DÖV 2005, 797 (808).<br />
25 VG Köln NVwZ-RR 2000, 455 f.<br />
26 BayVGH NVwZ 2000, 219 (220 f.); Oebbecke DV 37 (2004), 105 (110 f.).<br />
27 Pro RhPfOVG NVwZ-RR 1997, 241; VG Koblenz NVwZ-RR 2002, 453; Fügemann<br />
DVBl 2004, 343 (349); <strong>Winkler</strong> (Fn. 20) Rn. 214; contra HessVGH DVBl 2000, 928 f.;<br />
NRWOVG NVwZ-RR 2003, 448 f.; He<strong>im</strong>lich DÖV 1999, 1029 (1032); Ritgen Bürgerbegehren<br />
und Bürgerentscheid, 1997, S. 115 ff.<br />
28 BayVGH NVwZ 2000, 219 f.; HessVGH DVBl 2000, 928 (930); NRWOVG NVwZ-<br />
RR 2003, 448 (449); ebenso Fischer DÖV 1996, 181 (183 ff.).<br />
29 RhPfOVG NVwZ-RR 1997, 241 auf Grund der Organstellung »des Bürgerbegehrens«.<br />
30 Hofmann-Hoeppel/Weible BayVBl 2000, 577 (583); Schmidt-Aßmann/Röhl in: Schmidt-<br />
Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 13. Aufl 2005, 1. Kap. Rn. 91 m.w.N.<br />
31 He<strong>im</strong>lich DÖV 1999, 1029.<br />
32 HessVGH DÖV 2004, 966 (967).<br />
33 BWVGH DVBl 2001, 1280 (dort zur Klage eines Bürgers).<br />
34 So aber Huber, P.M. AöR 126 (2001) 165 (180 f.).<br />
35 BayVGH NVwZ-RR 2000, 737 (739); BayVerfGHE 50, 181 (202 ff.).<br />
36 BVerwGE 104, 323 (326 f.); 118, 101 (106 f.); BVerwG DÖV 2001, 1278; RhPfOVG<br />
DÖV 2002, 163 (165); BayVGH NVwZ-RR 2004, 440 f.; HessVGH NVwZ 2006,<br />
610 (611); zusf. Oebbecke NVwZ 2007, 30 ff.<br />
37 NRWOVG NWVBl 2004, 151 (152); HessVGH DÖV 2004, 966 (967); BayVGH<br />
NVwZ-RR 2000, 454.<br />
6/2007 407<br />
AUFSATZ
AUFSATZ<br />
AUFSATZ ÖFFENTLICHES RECHT · ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE IM KOMMUNALRECHT<br />
I. Anforderungen an öffentliche Einrichtungen<br />
Dies betrifft trotz des insoweit missverständlichen Ausdrucks auch<br />
die öffentlichen Einrichtungen der Kommunen. Sie können ebenso<br />
in Formen des Gesellschaftsrechts betrieben werden, wie sie<br />
sich privatrechtlicher Handlungsformen bedienen dürfen. Unter<br />
öffentlichen Einrichtungen sind Sach- und Personalgesamtheiten<br />
zu verstehen, die durch einen besonderen Widmungsakt für einen<br />
Gemeinwohlzweck best<strong>im</strong>mt und tatsächlich in seinen Dienst<br />
gestellt worden sind. In Einzelfällen ist der Einrichtungscharakter<br />
zweifelhaft, so etwa bei kommunalen Internetseiten. 38 Die Kommune<br />
selbst streift die besonderen Bindungen des Kommunalrechts<br />
39 durch eine Wahl privatrechtlicher Organisationsformen<br />
jedenfalls nicht ab.<br />
1. Begrenzung der Einrichtungszwecke und -formen?<br />
Das betrifft zum einen die Zweckbindung der Einrichtung. Sie<br />
muss der Erfüllung kommunaler Aufgaben dienen. Bei der Ausgestaltung<br />
solcher Aufgaben ist dem Landesrecht durch Art. 28 II<br />
GG indes nur eine weite Grenze gezogen, und dies auch nur <strong>im</strong><br />
Hinblick auf Einrichtungen <strong>im</strong> Selbstverwaltungsbereich. So<br />
kann ein Land seinen Kommunen erlauben, den Umweltschutz<br />
als Selbstverwaltungsaufgabe auf den Zweck der Kl<strong>im</strong>avorsorge zu<br />
erstrecken, 40 während ein anderes dies mangels örtlichen Bezugs<br />
des Kl<strong>im</strong>aschutzes ausschließen kann. Art. 20a GG ersetzt<br />
eine landesrechtliche Zuweisung dieser Selbstverwaltungsaufgabe<br />
nicht. 41<br />
Für den spezifischen Bezug zur örtlichen Gemeinschaft unerheblich<br />
ist es jedenfalls, ob die Einrichtung sich über die Gemeinde-,<br />
Landkreis- oder sogar Landesgrenzen hinweg erstreckt, überhaupt<br />
auch nur zum Teil auf dem Gebiet der Kommune liegt oder nicht<br />
und ob sie ganz, zum Teil oder gar nicht <strong>im</strong> Eigentum der Kommune<br />
steht. Entscheidend ist allein, ob die Tätigkeit der Einrichtung<br />
der Gemeindebevölkerung bzw. dem Gemeindegebiet zugute<br />
kommt. 42 Die Trägerkommune ihrerseits ist nicht durch Art. 28 II<br />
GG daran gehindert, ihre Einrichtung außerhalb ihres eigenen Gebiets<br />
tätig werden zu lassen, denn das Selbstverwaltungsrecht begrenzt<br />
die kommunalen Kompetenzen nicht territorial. 43<br />
Auch wenn die Kommune einen Anschluss- und/oder Benutzungszwang<br />
anordnet, muss sie nicht selbst Trägerin der dadurch<br />
begünstigten Einrichtung sein. Damit die mit dem Zwang verbundenen<br />
Grundrechtseingriffe verhältnismäßig sind, muss die<br />
Kommune aber sicherstellen, dass die Benutzer vor dem Ausfall<br />
oder der Beeinträchtigung der Leistung <strong>im</strong> gleichen Umfang gesichert<br />
sind, als wenn sie durch die öffentliche Hand erfolgte. 44<br />
2. Vorgaben für Zugangs- und Benutzungsregelungen<br />
Zum anderen besteht der kommunalrechtliche Zugangsanspruch<br />
der Gemeinde- bzw. Kreiseinwohner und der ihnen gleichgestellten<br />
Personen nach Art. 21 BayGO, §§ 14 RhPfGemO, 22<br />
NdsGO u.s.w. unabhängig von der organisatorischen Verselbstständigung<br />
des Einrichtungsträgers. Stets bleibt die Kommune<br />
verpflichtet, den zur Benutzung berechtigten Einwohnern effektiv<br />
den Zugang zu verschaffen. Die Entscheidung über den Zugang<br />
muss die Kommune durch eigene, demokratisch legit<strong>im</strong>ierte Organe<br />
treffen. 45 Des weiteren muss sie sicherstellen, dass Ansprüche<br />
der Bürger und der Medien auf Zugang zu Informationen nach<br />
dem UIG und den Landespressegesetzen nach einer Privatisierung<br />
der Einrichtung weiterhin erfüllt werden. 46 Nicht durchgesetzt hat<br />
sich bislang die Forderung, den Zugangsanspruch zu den Einrichtungen<br />
zentraler Orte auf die Einwohner von Umlandgemeinden<br />
zu erstrecken. 47<br />
In welcher Form die Art und Weise der Benutzung geregelt<br />
werden kann, best<strong>im</strong>mt sich danach, ob die Einrichtung in Formen<br />
des öffentlichen oder des privaten Rechts betrieben wird.<br />
408 6/2007<br />
Nur wenn die Kommune selbst, eine andere Kommune auf<br />
Grund einer Zweckvereinbarung, ein Zweckverband oder eine<br />
Anstalt des öffentlichen Rechts die Einrichtung betreibt, kann<br />
der jeweilige Träger öffentlich-rechtliche Regelungen über die Benutzung<br />
durch Satzung, Allgemeinverfügung oder durch Verwaltungsakt<br />
<strong>im</strong> Einzelfall erlassen (Zwei-Stufen-Theorie). Unzulässig<br />
ist auch dann eine Benutzungsregelung durch Polizei- bzw.<br />
Gefahrenabwehrverordnung. 48 Hat sich die Kommune für eine<br />
juristische Person des Privatrechts als Einrichtungsträgerin entschieden,<br />
so ist dieser der Erlass eigener benutzungsregelnder Satzungen<br />
versagt. Ihr kann allenfalls die Befugnis zum Erlass von<br />
Verwaltungsakten eingeräumt werden. Ohne solche Beleihung<br />
kann sie die Modalitäten der Benutzung nur vertraglich vereinbaren<br />
oder kraft ihres Hausrechts einseitig festlegen. Ein Beispiel<br />
sind die Allgemeinen Versorgungsbedingungen der Versorgungsunternehmen<br />
in kommunaler Hand. 49 Privatrechtliche Geschäftsbedingungen<br />
zu verwenden, ist andererseits aber auch öffentlichrechtlichen<br />
Einrichtungsträgern freigestellt.<br />
II. Kommunale Kooperation und Vergaberecht<br />
Laut §§ 97 I, 100 I GWB müssen öffentliche Auftraggeber Waren,<br />
Bau- und Dienstleistungen <strong>im</strong> Wege transparenter Vergabeverfahren<br />
<strong>im</strong> Wettbewerb beschaffen, sofern der Auftragswert best<strong>im</strong>mte<br />
in der Vergabeverordnung festgelegte Schwellen überschreitet.<br />
Arbeiten Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
zusammen, so stellt sich nicht erst bei der Durchführung, sondern<br />
auch schon bei der organisatorischen Vorbereitung die Frage, ob<br />
das Vergaberecht auf die Kooperation anwendbar ist.<br />
1. Vergaberechtspflichtigkeit von Aufträgen an kommunale<br />
Trabanten<br />
Da die §§ 97 ff. GWB der Umsetzung der gemeinschaftsrechtlichen<br />
Vergaberichtlinien dienen, hängt die Pflicht zur Durchführung<br />
von Vergabeverfahren maßgeblich von der Auslegung dieser<br />
Richtlinien durch die Gemeinschaftsgerichte ab 50 . Von der Anwendung<br />
der Richtlinien hat der EuGH so genannte In-house-<br />
Geschäfte freigestellt. Sie liegen vor, wenn ein Auftrag zwar an<br />
eine von dem Auftraggeber verschiedene juristische Person erteilt<br />
wird, diese jedoch <strong>im</strong> Wesentlichen nur für ihn oder andere<br />
öffentliche Anteilseigner tätig wird und keine eigene Entscheidungsgewalt<br />
besitzt, sondern vom Auftraggeber allein oder gemeinsam<br />
mit anderen öffentlichen Stellen kontrolliert wird »wie<br />
eine eigene Dienststelle«. 51<br />
38 Bejahend Ott/Ramming BayVBl 2003, 454 (458 ff.); Frey DÖV 2005, 411 (420);<br />
differenzierend Duckstein/Gramlich SächsVBl 2004, 121 (127 f.); Mann, T. NdsVBl<br />
2007, 26 (29).<br />
39 Zur drittschützenden Wirkung der kommunalrechtlichen Subsidiaritätsklauseln zu<br />
Gunsten privater Konkurrenten RhPfVerfGH AS 27, 231; NRWOVG NWVBl 2003,<br />
1520 (1521 f.); BWVGH NVwZ 2006, 714 (715); vgl. aber auch noch BGH DVBl<br />
2006, 116 (117 f.).<br />
40 BVerwGE 125, 68 (72 f.); SHOVG NordÖR 2004, 152 (153).<br />
41 BVerwG NVwZ 2006, 595 (596 f.); BWVGH VBlBW 2004, 337 (340 f.); Schmidt, A.<br />
NVwZ 2006, 1354 (1357).<br />
42 BVerwGE 122, 350 (354 f.).<br />
43 NRWOVG NVwZ 2005, 1211 (1212); RhPfOVG DÖV 2006, 611 (612 f.); grds. a.A.<br />
Gern NJW 2002, 2593 (2595 ff.); Heilshorn VerwArch 96 (2005), 88; Scharpf NVwZ<br />
2005, 148.<br />
44 BVerwGE 123, 159 (164).<br />
45 BayVGH GewArch 1999, 197 (198).<br />
46 BGH DVBl 2005, 980 (981 f.); Köhler NJW 2005, 2337 (2338); Kühne/Czarnecki LKV<br />
2005, 481 (484).<br />
47 Burgi JZ 1999, 873; Seewald in: Steiner (Hrsg.) Besonderes Verwaltungsrecht, 8. Aufl<br />
2006, Rn. 149; für einen Anspruch de lege lata Schmidt, T.I. DÖV 2002, 696.<br />
48 BWVGH NVwZ 2000, 457.<br />
49 NdsOVG NVwZ 1999, 566; Brüning LKV 2000, 54.<br />
50 Zur Bereichsausnahme <strong>im</strong> ÖPNV EuGH Slg. 2003, 7747 – Altmark Trans; BVerwG<br />
DVBl. 2007, 307 (308 f.).<br />
51 EuGH Slg 1999, 8121 – Teckal; EuGH NZBau 2006, 452 (454) – Carbotermo.
AUFSATZ ÖFFENTLICHES RECHT · ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE IM KOMMUNALRECHT<br />
Letzteres ist aber nur der Fall, wenn der Auftragnehmer keine<br />
anderen Interessen verfolgt als die staatlichen oder kommunalen<br />
Auftraggeber. Halten an der beauftragten Organisation neben öffentlichen<br />
Trägern auch natürliche oder juristische Personen des<br />
Privatrechts Anteile, so schließt schon deren Interesse an der Gewinnerzielung<br />
ein In-house-Geschäft aus. 52 Gleiches dürfte für<br />
solche kommunalen Zweckverbände gelten, zu deren Mitgliedern<br />
neben Gebietskörperschaften auch Privatpersonen zählen.<br />
Da verschiedene Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht<br />
<strong>im</strong>mer gleichgerichtete öffentliche Interessen vertreten, kommt es<br />
für die Anwendbarkeit des Vergaberechts auf die Interessenlage<br />
<strong>im</strong> Einzelfall an, wenn eine Kommune eine andere Kommune<br />
oder deren Eigengesellschaft mit Leistungen beauftragt. 53 Unbedeutend<br />
ist hingegen, ob die beauftragte Körperschaft selbst mit<br />
der Annahme und Ausführung des Auftrags wirtschaftliche Interessen<br />
verfolgt. 54<br />
2. Vergaberechtspflichtigkeit organisatorischer<br />
Grundgeschäfte?<br />
Der Bereichsausnahme für In-house-Geschäfte vorgelagert ist die<br />
Frage, ob es sich bei organisationsrechtlichen Vereinbarungen zwischen<br />
Kommunen um Aufträge i.S.d. § 99 GWB handelt. Dabei<br />
ist zweitrangig, ob ein entgeltliches Moment in dem Umstand<br />
gesehen werden kann, dass zusammen mit der Aufgabe die Befugnis<br />
zur Erhebung öffentlicher Abgaben oder Umlagen übergeht. 55<br />
Verpflichtet sich eine Kommune nicht zur Erfüllung best<strong>im</strong>mter<br />
Aufgaben <strong>im</strong> fremden Namen, sei es <strong>im</strong> Einzelfall oder allgemein,<br />
sondern überträgt ihr der bisher zuständige Verwaltungsträger die<br />
Aufgabe als eigene, so ist Inhalt des Rechtsgeschäfts bereits kein<br />
Leistungsauftrag. Vielmehr verfügen die Beteiligten damit über hoheitliche<br />
Kompetenzen. Die Übernahme einer Kompetenz ist jedoch<br />
keine marktgängige Leistung. Das Vergaberecht greift daher<br />
nicht ein. 56 Dass der Übergang konsensual geregelt wird, tut<br />
dem keinen Abbruch. Nichts anderes gilt, wenn die ausführende<br />
Körperschaft nicht allein zuständig wird, sondern kraft Gesetzes<br />
oder Vertrags Mitentscheidungsrechte und u.U. auch Einwirkungs-<br />
und Einstandspflichten gegenüber <strong>Dr</strong>itten <strong>im</strong> Hinblick<br />
auf die Aufgabenerfüllung bei dem bisher zuständigen Verwaltungsträger<br />
verbleiben. Die »mandatierende« Zweckvereinbarung<br />
darf deshalb ebenso ohne vorheriges Vergabeverfahren geschlossen<br />
werden wie die »delegierende«. 57 Aus denselben Gründen erfasst<br />
der Anwendungsbereich des Vergaberechts auch die Übertragung<br />
kommunaler Aufgaben auf einen Zweckverband nicht. 58<br />
D. FINANZIELLE MITTEL UND BELASTUNGEN<br />
Um ihre Aufgaben zu erfüllen, benötigen alle Träger öffentlicher<br />
Verwaltung Geld. Den Kommunen gewährleistet Art. 28 II 3 GG<br />
zwar eine aufgabenadäquate Finanzausstattung. Allerdings können<br />
sie nur zu einem geringen Teil selber entscheiden, welcher<br />
Aufgaben sie sich annehmen. Weist der Landesgesetzgeber den<br />
Kommunen neue Aufgaben zu, so muss er nach mittlerweile allen<br />
Landesverfassungen regeln, wie die davon verursachten Mehrkosten<br />
gedeckt werden sollen. 59 Über weite Strecken nach Bundesrecht<br />
richtet sich die Haftung für kommunale und aufsichtliche<br />
Fehler.<br />
I. Hoheitliche Einnahmequellen<br />
Über die Sicherung best<strong>im</strong>mter Steuerquellen in Art. 28 II 4 und<br />
106 V bis VIII GG hinaus verpflichtet das Selbstverwaltungsrecht<br />
den Staat zur Regelung eines ergänzenden Finanzausgleichs,<br />
schützt die Befugnis der Kommunen, privatrechtliche Einnahmen<br />
und Kapitalerträge zu erzielen, sowie diejenige, sonstige Abgaben<br />
zu erheben. Insbesondere die kommunale Abgabenerhebung begrenzt<br />
das Grundgesetz aber auch.<br />
1. Kreation neuer Abgaben<br />
Dabei schlägt als Erstes die Kompetenzverteilung zwischen Bund<br />
und Ländern auf die kommunale Ebene durch, da die Kommunen<br />
nur <strong>im</strong> Kompetenzbereich der Länder tätig werden und auch<br />
nur in diesem Rahmen eigene Abgaben »erfinden« können. Kommunale<br />
Sonderabgaben mit Ausgleichszweck unterliegen weniger<br />
strengen Beschränkungen als solche mit Finanzierungszweck, da<br />
sie in geringerem Maße als diese die Ordnungsfunktion der Finanzverfassung<br />
gefährden. 60 Um sie einzuführen, bedürfen die<br />
Kommunen auch keiner ausdrücklichen Ermächtigung.<br />
Was Steuern betrifft, ist hingegen der Katalog der Art. 105 und<br />
106 GG abschließend. Den Kommunen haben die Länder insoweit<br />
nur die Regelung der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern<br />
überlassen, für die nach Art. 105 IIa GG sie zuständig<br />
sind, deren Aufkommen nach Art. 106 VI 1 GG aber ohnehin<br />
den Kommunen zufließt. Andersartige Steuern dürfen die Kommunen<br />
nicht kreieren. Zu den örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern<br />
zählen <strong>im</strong> Wesentlichen die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer<br />
und die Zweitwohnungssteuer.<br />
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern erfassen einen besonderen<br />
Aufwand für die persönliche Lebensführung. 61 Deshalb<br />
ist eine Zweitwohnungssteuer nicht auf Wohnungen anwendbar,<br />
die nur als Geld- oder Vermögensanlage gehalten werden. 62 Sie<br />
darf für Erwerbszweitwohnungen erhoben werden, nicht aber von<br />
Ehegatten, die die Wohnung allein aus beruflichen Gründen unterhalten<br />
und nicht dauernd getrennt leben. 63 Zulässig ist damit<br />
insoweit nur die Besteuerung von Zweitwohnungen am Urlaubsort.<br />
Von Studierenden kann bereits aus kompetenzrechtlichen<br />
Gründen keine Zweitwohnungssteuer erhoben werden, da die<br />
Zweitwohnung am Studienort kein Ausdruck besonderer wirtschaftlicher<br />
Leistungsfähigkeit ist. 64 Örtliche Verbrauch- und<br />
Aufwandsteuern dürfen schließlich nicht auf einen Lenkungseffekt<br />
gerichtet sein, der dem Regelungskonzept eines Bundesoder<br />
eines Landesgesetzes widerspricht. 65<br />
2. Staffelung der Höhe von Abgaben<br />
Ein zusätzlicher Konflikt tritt <strong>im</strong> Fall der Hunde- und der Vergnügungssteuer<br />
dann auf, wenn sie aus anderen Gründen als nach<br />
der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen abgestuft werden.<br />
¾hnliche Fragen wirft die soziale Staffelung von Gebühren und<br />
Beiträgen auf, etwa für Kindergärten und Musikschulen. 66 Maßstab<br />
ist hierfür jeweils Art. 3 I GG in seiner Ausprägung als<br />
Grundsatz der Abgabengerechtigkeit. Eine unterschiedliche Höhe<br />
der Abgaben bedarf danach eines legit<strong>im</strong>en Differenzierungsgrundes,<br />
der seinem Gewicht nach auch dazu geeignet ist, das<br />
Maß der Abstufung zu rechtfertigen. Ein geeigneter Rechtfertigungsgrund<br />
ist die Gefährlichkeit des besteuerten Gegenstandes,<br />
52 EuGH Slg 2005, 1 – Stadt Halle = JA 2005, 692 (Oberrath).<br />
53 OLG Düsseldorf NVwZ 2004, 1022; Hausmann/Bultmann NVwZ 2005, 377 (380).<br />
54 Bultmann NZBau 2006, 222 (223 f.).<br />
55 Vgl. dazu Schröder NVwZ 2005, 25 (29).<br />
56 OLG Düsseldorf NZBau 2006, 662 (664); Burgi NZBau 2005, 208 (210 f.).<br />
57 Burgi NZBau 2005, 208 (211 f.); a.A. OLG Düsseldorf NVwZ 2004, 1022 f.; Bergmann/Vetter<br />
NVwZ 2006, 497 (500); Storr SächsVBl 2006, 234 (239).<br />
58 OLG Düsseldorf NZBau 2006, 662 (664); Schröder NVwZ 2005, 25 (28); a.A. Hattig/<br />
Ruhland NWVBl 2006, 405 (408 f.).<br />
59 Zur Auslegung dieses »Konnexitätsprinzips« Dombert DVBl 2006, 1136 m.w.N.<br />
60 BVerwGE 122, 1 (5).<br />
61 Zur Vergnügungssteuer BVerwGE 120, 175 (182 f.).<br />
62 BVerwGE 99, 303 (304 f.).<br />
63 BVerfGE 114, 316 (335 ff.); a.A. noch BVerwGE 111, 122 (128).<br />
64 RhPfOVG, Beschl. v. 29. 1. 2007 – 6 B 11579/06, juris; MVOVG, Beschl. v.<br />
27. 2. 2007 – 1 M 103/06, juris; a.A. Meier, N./Juhre, KStZ 2005, 46 f.<br />
65 BVerfGE 98, 106 (119) = JA 1999, 635 (Heselhaus); BVerwGE 110, 248 (250).<br />
66 BVerfGE 97, 332 (344 ff.); BVerwGE 104, 60 (67); krit. Behr LKV 2005, 104 (107).<br />
6/2007 409<br />
AUFSATZ
AUFSATZ<br />
AUFSATZ ÖFFENTLICHES RECHT · ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE IM KOMMUNALRECHT<br />
z.B. eines Spielautomaten oder eines Hundes; ihr Grad kann bei<br />
Hunden anhand der Rassezugehörigkeit typisiert werden. 67<br />
Einen Gestaltungsspielraum nicht dem Grunde nach, aber über<br />
die Höhe besitzen die Gemeinden bei der Gewerbesteuer mit<br />
ihrem Recht zur Festlegung des Hebesatzes. Ob der Gesetzgeber<br />
dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht eine zulässige Schranke<br />
gesetzt hat, indem er seit 2004 einen Mindesthebesatz von 200 %<br />
vorschreibt, ist noch offen. Das BVerfG hat über eine dagegen gerichtete<br />
Kommunalverfassungsbeschwerde bislang nicht entschieden.<br />
68 Als Eingriff in die kommunale Finanzhoheit, der aber nicht<br />
deren Kernbereich berührt, beurteilt der SächsVerfGH die gesetzliche<br />
Anordnung von Mindestgebühren in Selbstverwaltungsangelegenheiten.<br />
69<br />
II. Haftung der und gegenüber den Kommunen<br />
Finanzielle Verluste drohen den Kommunen infolge von Schädigungen<br />
<strong>Dr</strong>itter durch kommunale Amts- und Organwalter. Ob<br />
der Ersatz hierfür die kommunalen Kassen belastet, hängt davon<br />
ab, inwieweit die Kommune für ihre Funktionsträger haftet und<br />
ob sie ihrerseits Ersatz vom Träger der Kommunalaufsicht erlangen<br />
kann, falls dessen Bedienstete die Aufsicht fehlerhaft geführt<br />
haben.<br />
1. Haftung der Kommunen für Verschulden ihrer Vertreter<br />
Im Rechtsverkehr werden die Kommunen regelmäßig durch ihre<br />
Hauptverwaltungsbeamten, d.h. die Bürgermeister und Landräte,<br />
gesetzlich vertreten. Neben ihnen sind meist auch Beigeordnete,<br />
die einen Geschäftsbereich leiten, 70 in dessen Grenzen vertretungsbefugt.<br />
Die Mitglieder der Verwaltungsspitze ermächtigen<br />
in der Regel nachgeordnete Bedienstete zur Ausübung ihrer<br />
Vertretungsmacht, soweit sie Geschäfte der laufenden Verwaltung<br />
betrifft. Zudem sind die Gemeinden nicht gehindert, sich rechtsgeschäftlich<br />
bestellter Vertreter i.S. der §§ 164 ff. BGB zu bedienen.<br />
Das in der Kommunalverwaltung vorhandene Wissen wird<br />
diesen zu Gunsten der Geschäftspartner der Kommune nach dem<br />
Rechtsgedanken des § 166 II BGB zugerechnet, soweit nicht die<br />
spezifisch öffentlich-rechtlichen Schranken des Datenschutzes<br />
auch einer behördeninternen Informationsübermittlung entgegenständen.<br />
71<br />
Beide Konstellationen unterscheiden sich <strong>im</strong> Hinblick auf die<br />
Vertreterhaftung nach § 179 BGB. Während sie die rechtsgeschäftlichen<br />
Vertreter zumindest hinsichtlich des Schadenersatzes<br />
uneingeschränkt trifft, sind Amts- und Organwalter, die ihre<br />
Vertretungsbefugnis überschreiten, <strong>Dr</strong>itten nur nach §§ 823 ff.<br />
BGB zum Schadenersatz verpflichtet, insbesondere bei hoheitlichem<br />
Tätigwerden nach § 839 BGB. Praktisch bedeutet dies vor<br />
allem, dass ihre Ersatzpflicht nicht ohne Verschulden eintritt. Die<br />
Kommune, für die sie handeln, haftet dem Geschäftspartner dann<br />
folglich auch nur nach § 831 oder §§ 89, 31 BGB bzw. nach<br />
Art. 34 GG. Sie kann sich auf die Nichtigkeit der von ihrem<br />
Organ ultra vires abgegebenen Willenserklärung allerdings nach<br />
Treu und Glauben nicht berufen, wenn dies dem Erklärungsempfänger<br />
unzumutbar wäre. 72<br />
2. Begrenzungen der rechtsgeschäftlichen Handlungsfähigkeit<br />
der Kommunen und der Schutz ihrer Geschäftspartner<br />
Besondere kommunalrechtliche Schutzvorschriften, die über die <strong>im</strong><br />
Verkehr unter Privatpersonen bestehenden Anforderungen hinausgehen,<br />
können die Wirksamkeit kommunaler Rechtsgeschäfte beeinträchtigen.<br />
Gerade in dieser Situation stellt sich die Frage nach<br />
einer Haftung gegenüber Geschäftspartnern, die auf den Bestand<br />
einer kommunalen Willenserklärung vertraut haben.<br />
Der klassische Fall solcher Schutzvorschriften ist die Form, die<br />
die Kommunalgesetze für Verpflichtungserklärungen vorsehen,<br />
410 6/2007<br />
d.h. für Willenserklärungen, die darauf abzielen, eine neue Verbindlichkeit<br />
der Kommune zu begründen. 73 Bei öffentlich-rechtlichen<br />
Willenserklärungen führt die Verletzung der Formvorschriften<br />
analog § 125 BGB, ggf. i.V.m. § 59 I VwVfG, zur<br />
Nichtigkeit. 74 Da dem Landesgesetzgeber die Kompetenz fehlt,<br />
Formvorschriften des bürgerlichen Rechts zu erlassen, versteht die<br />
Rechtsprechung die Best<strong>im</strong>mungen über Verpflichtungserklärungen<br />
geltungserhaltend als Regelungen der Vertretungsmacht, soweit<br />
sie zivilrechtliche Erklärungen betreffen. 75 Hier greifen die<br />
unter 1. referierten Grundsätze ein. Ein erst vor einigen <strong>Ja</strong>hren<br />
entdeckter weiterer Anwendungsfall ist der Vorbehalt einer aufsichtlichen<br />
Genehmigung für Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte,<br />
durch die eine Kommune sich dazu verpflichtet, für<br />
Verbindlichkeiten <strong>Dr</strong>itter zu haften. Verweigert die Aufsichtsbehörde<br />
unanfechtbar die Genehmigung, so ist die Willenserklärung<br />
der Kommune unwirksam; bis zu diesem Zeitpunkt ist sie<br />
schwebend unwirksam. 76<br />
Klärt die Kommune ihren Geschäftspartner nicht darüber auf,<br />
dass ihre eigene Willenserklärung genehmigungsbedürftig ist, so<br />
kann diese Unterlassung sie zum Schadenersatz aus Verschulden<br />
be<strong>im</strong> Vertragsschluss verpflichten, wenn das Geschäft scheitert. 77<br />
Gleiches dürfte für eine schuldhafte Nichtbeachtung der erwähnten<br />
Formvorschriften gelten. 78 Wenn allerdings auch die Aufsichtsbehörde<br />
falsch entschieden und ein Sicherungsgeschäft für<br />
Verbindlichkeiten <strong>Dr</strong>itter rechtswidrig genehmigt hat, wird die<br />
Kommune versuchen, den Träger der Aufsichtsbehörde in Regress<br />
zu nehmen, um die finanziellen Mehrbelastungen infolge<br />
der Übernahme einer Bürgschaft bzw. einer dinglichen Sicherheit<br />
abzuwälzen. Eine Anspruchsgrundlage könnte sich dafür wiederum<br />
in § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG finden. 79<br />
Dies setzt zunächst voraus, dass die Genehmigung schuldhaft<br />
zu Unrecht erteilt oder versagt wurde. Zur gewissenhaften Prüfung<br />
kommunaler Sicherungsgeschäfte sind die Bediensteten der<br />
Kommunalaufsichtsbehörde verpflichtet. Kommunalaufsicht und<br />
Kommune wirken be<strong>im</strong> Abschluss der Sicherungsgeschäfte auch<br />
nicht zur Erfüllung einer gemeinsamen Aufgabe »gleichsinnig«<br />
zusammen, was die Eigenschaft der Kommune als »<strong>Dr</strong>itte« <strong>im</strong><br />
Sinne des Amtshaftungsrechts ausschlösse. 80 Zweifelhaft ist allerdings,<br />
ob die aufsichtliche Amtspflicht zumindest auch auf den<br />
Schutz des Vermögens und der Zahlungsfähigkeit der beaufsichtigten<br />
Kommune gerichtet ist oder ausschließlich auf das öffentliche<br />
Interesse an einer sparsamen Haushaltsführung. 81 Im letztgenannten<br />
Fall scheitert ein Amtshaftungsanspruch der Kommune<br />
daran, dass die Amtspflicht nicht gerade ihrem Schutz dient.<br />
67 BVerwGE 110, 265 (272 ff.); BVerwG NVwZ 2005, 598 (599 f.).<br />
68 Vgl. BVerfGE 112, 216 (222 f.).<br />
69 SächsVerfGH SächsVBl 2006, 138 (139).<br />
70 Zu ihrem Schutz vor willkürlichem Entzug oder Neuzuschnitt des Geschäftsbereichs<br />
NRWOVG NWVBl. 2004, 348; MVOVG DÖV 2005, 214 f.<br />
71 KG NVwZ-RR 2000, 765 (768 f.); OLG Düsseldorf NJW 2004, 783 (784 f.).<br />
72 BGHZ 147, 381 (387 ff.) = JA 2002, 89 (Krauss); Sensburg NVwZ 2002, 179 f.<br />
73 BGHZ 97, 224 (227).<br />
74 RhPfOVG NVwZ 1998, 655; NdsOVG NdsVBl 2005, 264 (265); a.A. HessVGH<br />
NVwZ-RR 2005, 650 (651).<br />
75 BGHZ 92, 164 (174); 147, 381 (382); ausführlich Stelkens VerwArch 94 (2003) 48.<br />
76 BGHZ 142, 51 (53); BGH DVBl 2004, 577 (580).<br />
77 BGHZ 142, 51 (60 f.); BGH DVBl 2004, 577 (579 f.).<br />
78 Angedeutet in BGHZ 147, 381.<br />
79 Mit positivem Ergebnis BGHZ 153, 198 (203); ebenso Oebbecke DÖV 2001, 406<br />
(411); Komorowski VerwArch 93 (2002) 62 (95).<br />
80 Vgl. BGHZ 116, 312 (315); 148, 139 (147).<br />
81 Ablehnend daher v. Mutius/Groh NJW 2003, 1278 (1280 f.); Pegatzky LKV 2003, 451<br />
(452 ff.); Stelkens DVBl 2003, 22 (31).