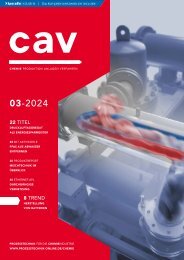Quality Guide 01.2019
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.qe-online.de<br />
01.19<br />
Messen und Events | Software | Mess- und Prüftechnik |<br />
Bildverarbeitung | Dienstleistungen<br />
<strong>Quality</strong> Engineering <strong>01.2019</strong> 1
Industrie<br />
Das Kompetenznetzwerk der Industrie<br />
<br />
<br />
24. Oktober 2019<br />
Parkhotel Stuttgart<br />
Messe-Airport<br />
Oberflächenmesstechnik 4.0<br />
für die Metallverarbeitung –<br />
neue Ansätze und Technologien<br />
Die Verlagerung von Messtechnik an oder in die<br />
Produktionslinie erfordert zunehmend optische<br />
Messtechnik und Automatisierung.<br />
Das 6. QUALITY ENGINEERING InnovationsForum 2019<br />
beleuchtet die verschiedenen Entwicklungen in der<br />
Oberflächenmesstechnik – vom Messraum bis hin zur<br />
Inline-Lösung.<br />
Jetzt Partner<br />
werden!<br />
<br />
an die Oberflächenmesstechnik – und welche sind neu?<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
2 <strong>Quality</strong> Engineering <strong>01.2019</strong>
Ansichten ::<br />
Überblick über einen<br />
Markt in Bewegung<br />
Das Angebot an Technologien und Dienstleistungen für Qualitätssicherung<br />
und -management ist umfangreich. Anwendern fällt es nicht immer leicht zu<br />
erkennen, welcher Hersteller und Dienstleister für welche Aufgaben die passende<br />
Lösung parat hat.<br />
Mit dem <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> möchten wir Ihnen daher einen Überblick über den aktuellen<br />
Markt geben. Relevante Player stellen sich auf den folgenden Seiten vor<br />
– mit ihren Stärken und dem dazugehörigen Angebot. Dazu zählen zum Beispiel<br />
Software-Anbieter und Hersteller von Mess- und Prüftechnik.<br />
Jede dieser Rubriken wird eingeleitet mit einem Artikel über die Trends, welche<br />
die Branche gerade umtreiben. Im Software-Bereich etwa geht es gerade darum,<br />
der veränderten Rolle des Qualitätsmanagements Rechnung zu tragen.<br />
Die Software-Lösungen werden so entwickelt, dass sie auch von Mitarbeitern<br />
aus anderen Abteilungen genutzt werden können.<br />
Mit dem <strong>Quality</strong><br />
<strong>Guide</strong> möchten wir<br />
einen Überblick über<br />
den aktuellen Markt<br />
geben<br />
Sabine Koll und Markus Strehlitz<br />
Redaktion<br />
qe.redaktion@konradin.de<br />
Eine große Bedeutung für den QS- und QM-Markt haben natürlich auch Messen<br />
und Veranstaltungen. Über sie wird im <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> ebenfalls berichtet –<br />
sei es im Vorfeld oder im Nachgang.<br />
So wirft die Control bereits jetzt ihre Schatten voraus. Für die Branche ist die<br />
Messe in Stuttgart die wichtigste Veranstaltung des Jahres. Auch für die Redaktion<br />
der <strong>Quality</strong> Engineering ist die Control ein Highlight.<br />
Ein ebenfalls wichtiges Ereignis ist die Messe Vision im Herbst. Auch sie ist in<br />
der Rubrik Messen/Events zu finden. Hinzukommen Informationen zu den QE-<br />
Events wie etwa dem Forum „Qualitätssicherung in der additiven Fertigung“.<br />
Der <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> ist auch deshalb ein spannendes Produkt, weil <strong>Quality</strong> Engineering<br />
mit ihm neue Wege beschreitet. Er erscheint im E-Paper-Format auf<br />
der Online-Plattform Yumpu und somit als reine Digitalausgabe. Das gibt die<br />
nötige Flexibilität, neue Inhalte zu ergänzen und bereits bestehende Beiträge<br />
zu behalten.<br />
So wird der <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> im Laufe des Jahres wachsen und in sechs Ausgaben<br />
stets den aktuellen Überblick über die Branche liefern. Schließlich ist der Markt<br />
rund um die Qualitätstechnologien und -dienstleistungen ständig in Bewegung.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 3
:: Messen/Events<br />
Rund 80 Teilnehmer zählte das Forum<br />
„Qualitätssicherung in der additven<br />
Fertigung“ im vergangenen Jahr<br />
Bild: Jochen Hempler<br />
Zweites Fachforum von <strong>Quality</strong> Engineering und Fraunhofer IPA<br />
3D-Druck auf dem Prüfstand<br />
Am 21. Februar laden <strong>Quality</strong> Engineering und das Fraunhofer IPA wieder zum Fachforum<br />
„Qualitätssicherung in der additiven Fertigung“ nach Stuttgart. Experten aus Wissenschaft und<br />
Industrie sprechen über Herausforderungen und Chancen bei dem Thema. Einer der<br />
Schwerpunkte: Konkrete Lösungen für die Qualitätskontrolle.<br />
„Wir erleben gerade eine spannende Phase<br />
in der additiven Fertigung“, so Gregor Reischle,<br />
Program Manager Additive Manufacturing<br />
bei TÜV Süd Product Service. „Sie<br />
entkommt immer mehr dem Prototypen-<br />
Stadium und wird interessant für die Serienproduktion.“<br />
Daher werde es für die Unternehmen,<br />
die additive Fertigung betreiben,<br />
nun Zeit, die Themen rund um die Qualitätssicherung<br />
auf den Tisch zu bringen<br />
Vorabend-Event<br />
Eingeläutet wird das Forum am 20. Februar 2019 ab 17 Uhr mit einem Vorabend-Event bei Renishaw<br />
in Pliezhausen. Kernkompetenz von Renishaw ist die industrielle Messtechnik, doch baut das<br />
Unternehmen sein Geschäftsfeld für generative Fertigung stark aus: Dazu gehören Laser-Fertigungssysteme<br />
und Dienstleistungen im Solution Center für generative Fertigung, in dem die<br />
Abendveranstaltung stattfindet.<br />
Geplant sind Vorträge zu den beiden Themen „Additive Manufacturing bei Renishaw“ (Ralph<br />
Mayer, Sales and Business Manager Additive Manufacturing) und „Optimale Prozessketten in der<br />
Additiven Fertigung“ (Dr. Jan Linnenbürger, Leiter Messtechnik und Qualitätssicherung). Anschließend<br />
bieten wir eine Führung in Kleingruppen durch das Solution Center an, geführt von Experten<br />
der Abteilung Additive Manufacturing. Der Abend klingt mit Networking und einem entspannten<br />
schwäbischen Abendessen aus.<br />
und sich darum zu kümmern. Reischle ist einer<br />
der Sprecher auf dem Forum „Qualitätssicherung<br />
in der additiven Fertigung“, das<br />
<strong>Quality</strong> Engineering und das Fraunhofer-Institut<br />
für Produktionstechnik und Automatisierung<br />
IPA gemeinsam veranstalten. Das<br />
Forum adressiert alle Qualitätsprobleme<br />
entlang des Produktionsprozesses. Experten<br />
aus Industrie und Wissenschaft, aus Praxis<br />
und Forschung berichten über ihre Erfahrungen<br />
und Projekte. Nach dem großen Erfolg<br />
im vergangenen Jahr mit rund 80 Teilnehmern<br />
findet die Veranstaltung dieses<br />
Jahr zum zweiten Mal statt – wieder in den<br />
Räumlichkeiten des Fraunhofer IPA.<br />
Prozesse und Pulver im Fokus<br />
Nach den beiden Keynotes von Steffen<br />
Hachtel, Geschäftsführer des gleichnamigen<br />
Werkzeugbauers und Spritzgießers, und<br />
Simina Fulga-Beising vom Fraunhofer IPA ist<br />
das Forum in drei Blöcke eingeteilt.<br />
Der erste Teil steht unter der Überschrift<br />
„Prozesswissen für die Qualitätssicherung“.<br />
Dabei sprechen die Referenten unter anderem<br />
darüber, welchen Beitrag auto -<br />
matisierte Prozessketten sowie Konzeption<br />
und Konstruktion für eine Qualitätssicherung<br />
leisten können. Thematisiert wird<br />
auch, wie sich Pulverwerkstoffe analysieren<br />
und qualifizieren lassen.<br />
Qualitätsmanagement und Recht stehen<br />
im zweiten Block im Mittelpunkt. Hier beleuchtet<br />
Anwalt Daniel Wuhrmann die additive<br />
Fertigung aus haftungsrechtlicher<br />
Sicht. Außerdem erläutern Reischle vom<br />
4 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
TÜV SÜD sowie Sven Gaede von der Deutschen<br />
Bahn den aktuellen Stand der DIN<br />
SPEC 17071. Im Rahmen der Norm arbeiten<br />
Partner aus unterschiedlichen Industrien<br />
gemeinsam daran, alle qualitätsrelevanten<br />
Faktoren in der Wertschöpfungskette zu definieren.<br />
CT blickt auf innenliegende Strukturen<br />
Konkrete Lösungen, um eine Qualitätskontrolle<br />
in der additiven Fertigung zuverlässig<br />
umzusetzen, präsentieren die Referenten<br />
des dritten Themenblocks. Eine besondere<br />
Rolle nimmt dabei die Computertomographie<br />
(CT) ein. Nach Meinung von Lennart<br />
Schulenberg, Vertriebs- und Marketing-Chef<br />
bei Visiconsult, ist die Technik derzeit alternativlos<br />
bei der Prüfung von additiv gefertigten<br />
Bauteilen. So könnten zum Beispiel<br />
innenliegende Strukturen, die mit additiven<br />
Verfahren hergestellt werden, ausschließlich<br />
mithilfe von CT vermessen werden. Die<br />
Technologie habe allerdings auch ihre Grenzen.<br />
Mit einem relativ neuen Verfahren befasst<br />
sich Anian Gögelein von MTU Aero Engines.<br />
Er wird über die Optische Tomographie<br />
für das Prozessmonitoring sprechen.<br />
Die Themenblöcke werden jeweils durch<br />
eine Diskussion und eine Fragerunde abgeschlossen.<br />
Dort haben die Besucher des Forums<br />
Gelegenheit, ihre Fragen an die<br />
jeweiligen Referenten zu richten oder in die<br />
Diskussion zum Thema einzusteigen. Daneben<br />
bieten die Pausen zwischen den Beiträgen<br />
Möglichkeiten für das ausgiebige Networking.<br />
In der ersten Kaffeepause am Vormittag<br />
werden sich außerdem Partner aus der Industrie<br />
vorstellen. Diese zeigen in einer begleitenden<br />
Ausstellung ihre Technologien<br />
und Dienstleistungen für die Qualitätssicherung<br />
in der additiven Fertigung. ■<br />
Anmeldung zum Event<br />
Anmelden zum Event:<br />
Internet: http://hier.pro/MdTcV<br />
Per Mail: Beate.Guenther-Huehn@konradin.de<br />
Die Teilnahme ist nur nach vor -<br />
heriger An meldung möglich.<br />
Die Teilnahmegebühr<br />
beträgt 495 € zzgl. MwSt.<br />
Programm<br />
09:00 Uhr<br />
09:10 Uhr<br />
09:40 Uhr<br />
10.00 Uhr<br />
10.15 Uhr<br />
11.00 Uhr<br />
11.20 Uhr<br />
12.00 Uhr<br />
12.15 Uhr<br />
13:30 Uhr<br />
13.50 Uhr<br />
14.10 Uhr<br />
14.30 Uhr<br />
15.00 Uhr<br />
15.20 Uhr<br />
15.40 Uhr<br />
16.00 Uhr<br />
16:20 Uhr<br />
16.40 Uhr<br />
Begrüßung<br />
Sabine Koll und Markus Strehlitz, Redaktion <strong>Quality</strong> Engineering<br />
Dr. Simina Fulga-Beising, Fraunhofer IPA<br />
Keynote<br />
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der additiven Fertigung in<br />
der Praxis – Erfahrungen, Ansätze, Herausforderungen<br />
Steffen Hachtel, Geschäftsführender Gesellschafter, F. & G. Hachtel<br />
Was macht die Qualität additiv gefertigter Bauteile aus? Qualitätsbeeinflussende<br />
Faktoren in der additiven Fertigung. Ein Überblick<br />
Dr. Simina Fulga-Beising, Senior Scientist, Abteilung Bild- und Signalverarbeitung,<br />
Fraunhofer IPA<br />
Diskussion und Fragerunde zum Themenblock<br />
Kaffeepause und <strong>Guide</strong>d Tour durch die Ausstellung<br />
Prozesswissen für die Qualitätssicherung<br />
Qualität durch Produktgestaltung. Wie fertigungsgerechte Konzeption und<br />
Konstruktion hilft, die Hürden bei der Implementierung von Additiver Fertigung<br />
zu überwinden<br />
Volker Junior, Geschäftsführung, phoenix<br />
Automatisierte additive Gesamtprozessketten als Baustein in der Qualitätssicherung<br />
Patrick Springer, Gruppenleiter, Abteilung Additive Fertigung, Fraunhofer IPA<br />
Diskussion und Fragerunde zum Themenblock<br />
Mittagessen, Besuch der Ausstellung und Networking<br />
Qualitätsmanagement und Recht<br />
Product Compliance – additive Fertigung aus haftungsrechtlicher Sicht<br />
Daniel Wuhrmann, Rechtsanwalt, Reusch Rechtsanwaltsgesellschaft<br />
Normen und Standardisierung: DIN SPEC 17071 „Anforderungen an die<br />
Herstellung von Bauteilen mittels additiver Fertigung – Leitfaden für qualitätsgesicherte<br />
Prozesse bei additiven Fertigungszentren“<br />
Gregor Reischle, Head of Additive Manufacturing, TÜV SÜD Product Service +<br />
Sven Gaede, DB Engineering & Consulting, Deutsche Bahn<br />
Diskussion und Fragerunde zum Themenblock<br />
Kaffee, Besuch der Ausstellung und Networking<br />
Lösungen für die Qualitätskontrolle<br />
Ganzheitliche und integrierte Qualitätsprüfung für die additive Fertigung von<br />
der Mikroskopie über CT bis zum Koordinatenmessgerät<br />
Dr. Robert Zarnetta, Senior Director, Business Sector Manufacturing & Assembly,<br />
Carl Zeiss Microscopy<br />
Prüfung von AM-Bauteilen aus Kunststoff mit Computertomographie (CT)<br />
Prof. Dr. Heiko Wenzel-Schinzer, Geschäftsführer/Chief Digital Officer, Wenzel<br />
Group<br />
Prüfung von AM-Bauteilen aus Metall mit CT<br />
Lennart Schulenburg, Head of Sales and Marketing, VisiConsult<br />
Optische Tomographie für das Prozessmonitoring<br />
Anian Gögelein, MTU Aero Engines<br />
Diskussion und Fragerunde zum Themenblock<br />
Verabschiedung und Ende der Veranstaltung<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 5
:: Messen / Events<br />
In den Räumlichkeiten des Parkhotels<br />
Stuttgart Messe-Airport ging es einen<br />
Tag lang um die Oberflächenmesstechnik<br />
4.0. Das Interesse der Besucher war<br />
groß Bilder: Steffen Schmid<br />
QE-Innovationsforum zum Thema Oberflächenmesstechnik<br />
Taktile und optische Verfahren<br />
schließen sich nicht aus<br />
Mit rund 70 Besuchern war das Innovationsforum von <strong>Quality</strong> Engineering ein voller Erfolg.<br />
Thema des Events, das bereits zum fünften Mal stattfand, war in diesem Jahr<br />
„Oberflächenmesstechnik 4.0 für die Metallverarbeitung“. Optische Messtechnik<br />
spielt dabei zunehmend die Hauptrolle.<br />
Die Autoren<br />
Sabine Koll<br />
Markus Strehlitz<br />
Redaktion<br />
<strong>Quality</strong> Engineering<br />
„Oberflächenmessungen taktil oder optisch? Das sind<br />
zwei unterschiedliche Verfahren, die man eigentlich<br />
nicht miteinander vergleichen sollte. Und dennoch<br />
macht man es“, sagte Thorsten Höring, Global Product<br />
Manager Surface Technology 3D bei Mahr, zu Beginn<br />
seines Vortrags. Mit taktiler Messtechnik erfasse man<br />
Oberflächen linienhaft und damit genauer. Mit optischen<br />
Technologien sei eine flächenhafte, schnellere Erfassung<br />
möglich. Vergleichbare Kennwerte seien nur<br />
unter Berücksichtigung mehrerer Punkt zu erzielen: Dazu<br />
gehören der Tastspitzenradius versus die laterale<br />
Auflösung, die Filterparameter der Auswertung sowie<br />
die Lage des Profilschnitts. Selbstverständlich sollten<br />
die Messparameter identisch sein und bei optischen<br />
Verfahren deren jeweilige spezifischen Vor- und Nachteile<br />
berücksichtigt werden.<br />
Für die taktile Messtechnik stehen mit der ISO 4287<br />
und der ISO 13565 etablierte Normen für die Oberflächenrauheit<br />
zur Verfügung. Die ISO 25178 für die flächenhafte<br />
Rauheitsmessung hingegen sei noch relativ<br />
neu und unbekannt – auch bei Entwicklern und Konstrukteuren,<br />
sodass nach Einschätzung von Höring „alle<br />
Beteiligten noch viel miteinander sprechen müssen“.<br />
Zum Beispiel entspreche der Sz-Wert in der ISO 25178<br />
eher dem Rt-Wert der ISO 4287 und nicht – wie man<br />
vermuten könnte – dem Rz-Wert.<br />
Auch Felix Ströer, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Messtechnik<br />
& Sensorik an der TU Kaiserslautern, verwies in<br />
seiner Keynote zur ISO 25178 darauf, dass Amplitudenkenngrößen<br />
wie Ra oder Rz in der Messtechnik bekannt<br />
und etabliert seien. „Für flächenhafte Rauheitsmessungen<br />
nach der ISO 25178 muss es daher entsprechende<br />
Use Cases geben“, so Ströer.<br />
Um die Effizienz im Messraum zu steigern, lassen<br />
sich Rauheitsmessungen auch auf einem Koordinatenmessgerät<br />
statt auf einem Tastschnittgerät durchführen<br />
– beispielsweise mit dem Tastschnittsensor Rotos<br />
von Zeiss. Darüber berichtete Dr. Dietrich Imkamp, Leiter<br />
6 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
Video<br />
Eindrücke vom QE Innovationsforum 2018 sehen Sie<br />
in diesem Video<br />
Interaktiv: Per Smart -<br />
phone konnten die Be -<br />
sucher an Live-Umfragen<br />
zu den Vorträgen teilnehmen<br />
und ihr Feedback<br />
zur Veranstaltung<br />
abgeben<br />
Visual Systems & Partner von Carl Zeiss Industrielle<br />
Messtechnik. „Das spart Zeit beim Messen sowie<br />
menschliche Ressourcen, da alles CNC-gesteuert läuft<br />
und kein manueller Einsatz notwendig ist“, so Imkamp.<br />
„Außerdem hat der Anwender den Vorteil, dass er ein<br />
gemeinsames Protokoll für dimensionelle und Oberflächenrauheits-Messwerte<br />
hat.“ Doch Imkamp gab zu:<br />
„Tastschnittgeräte sind auch mit dieser Lösung nicht<br />
vollkommen zu ersetzen, weil sie wesentlich genauer<br />
sind.“<br />
Oberflächenrauheitswerte lassen sich<br />
auch am Koordinatenmessgerät erheben<br />
Eine Lösung für die Messung der Oberflächenrauheit<br />
am Koordinatenmessgerät stellte auch Dr. René Pleul<br />
vor, Technical Product Manager Surface Metrology bei<br />
Hexagon. „Der große Vorteil aus metrologischer Sicht ist<br />
die Oberflächenbeschaffenheit als 2D-Profil oder flächenhaft<br />
3D im Werkstückkoordinatensystem. Dadurch<br />
ist es möglich, die Messung in Bezug auf die Makrogeometrie<br />
des Werkstücks zu lokalisieren und zu orientieren“,<br />
so Pleul.<br />
Man benötige für ein solch gewissermaßen traditionelles,<br />
aber miniaturisiertes Mini-Rauheitsmessgerät<br />
auf einem Koordinatenmessgerät allerdings eine Vorschubeinheit<br />
mit Linearführung. Die erhobenen Rauheitskenngrößen<br />
lassen sich nach seiner Darstellung<br />
auch intelligent für die klassische Qualitätsregelung im<br />
Sinne eines geschlossenen Regelkreises nutzen, indem<br />
man sie in einer Datenbank abspeichert und intelligent<br />
mit Statistik-Software oder Künstlicher Intelligenz auswertet.<br />
„Erkennungsalgorithmen zeigen dann Änderungen<br />
in der Fertigung an, sodass man Prozesseinstellungen<br />
gegebenenfalls frühzeitig verändern kann“, so Pleul.<br />
Die Mehrzahl der Vorträge des Innovationsforums fokussierte<br />
sich voll und ganz auf die optische Messtechnik.<br />
So stellte Dr. Daniel Carl, stellvertretender Instituts-<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 7
:: Messen / Events<br />
leiter und Abteilungsleiter Produktionskontrolle am<br />
Fraunhofer IPM, eine neue Lösung vor, mit der man<br />
selbst mit unscharfen Bildern in der Linie Oberflächen<br />
präzise in 3D messen kann – „und zwar mit Bits statt<br />
mit Linsen. Man braucht kein Objektiv dafür“, so Carl.<br />
Die digitale Mehrwellenlängenholographie, die das<br />
Institut entwickelt hat, ist beim Präzisionsdrehteilhersteller<br />
Werner Gießler im Einsatz, um Dichtflächen bei<br />
Dieseleinspritzungen in der Fertigung zu prüfen. Diese<br />
Aufgabe wurde vorher mit Mikroskopie gelöst – ein sehr<br />
aufwändiger Prozess, der nun deutlich schneller geht:<br />
Gerade einmal 1 s benötigt das System, um ein Messfeld<br />
von 20 mm x 20 mm zu messen. „Taktil würde dies<br />
für ein kleineres Messfeld neun Stunden dauern“, so<br />
Carl.<br />
Um Vertrauen in die Messwerte mit der optischen<br />
3D-Oberflächenmessung zu schaffen, haben sich mehrere<br />
Hersteller zusammengetan, um das sogenannte<br />
faire Datenblatt zu schaffen. „Die Vielzahl an Methoden<br />
und Instrumenten können heute anhand von Datenblättern<br />
häufig nicht beurteilt werden“, sagte Dr. Özgür<br />
Tan, Produktmanager bei Polytec. „Datenblätter für optische<br />
Messinstrumente sind einfach nicht vergleichbar.<br />
Das betrifft zum Beispiel, was spezifiziert wird, wie spezifiziert<br />
wird und unter welchen Bedingungen die Spezifikation<br />
ermittelt wurden.“<br />
Ein direkter Vergleich der Messgeräte werde dem Anwender<br />
durch die Verwendung unterschiedlicher Begriffe<br />
erschwert: So meine ein Hersteller zum Beispiel mit<br />
„Bildfeld“ das gleiche wie ein anderer mit „lateraler<br />
Messbereich“. Tan: „Mit dem fairen Datenblatt wollen<br />
wir Transparenz in den Markt bringen. Unser Ziel ist es,<br />
dies auch als ISO-Standard zu etablieren.“<br />
■<br />
Dr. Özgür Tan von Polytec<br />
will mit dem fairen<br />
Datenblatt Transparenz<br />
in den Markt bringen.<br />
Auf dem Innovationsforum<br />
stellte er das Konzept<br />
vor<br />
Bei Thorsten Höring von Mahr ging es<br />
um die Frage, ob und wie sich taktile<br />
und optische Verfahren miteinander<br />
vergleichen lassen<br />
Dr. Daniel Carl vom Fraunhofer IPM<br />
stellte eine Lösung vor, mit der man<br />
selbst mit unscharfen Bildern in der<br />
Linie Oberflächen präzise in 3D<br />
messen kann<br />
8 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
Die Organisation im Blick: Malte Fiegler von der DGQ sprach über die Auswirkungen<br />
der Digitalisierung auf das Qualitätsmanagement<br />
Mit einer Lösung für die Messung der Oberflächenrauheit<br />
an einem Koordinatenmessgerät beschäftigte<br />
sich Dr. René Pleul von Hexagon<br />
Über die automatisierte 3D-Bohrflächeninspektion für kleine Durchmesser diskutierte<br />
Dr. Eric Rüland von Jenoptik auch in den Pausen mit interessierten Teilnehmern<br />
Felix Ströer von der TU Kaiserslautern<br />
stellte in seiner Keynote die ISO 25178<br />
in den Mittelpunkt<br />
In den Kaffeepausen wurden<br />
die Diskussionen aus dem<br />
Plenum fortgeführt und die<br />
Möglichkeiten zum Networking<br />
eifrig genutzt<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 9
:: Messen / Events<br />
Rund 900 Hersteller und<br />
Anbieter aus mehr als 30<br />
Ländern demonstrieren<br />
ihre Technologien sowie<br />
Dienstleistungen<br />
Bild: Schall<br />
Messe Control<br />
Die QS-Branche gibt sich die Ehre<br />
Von 7. bis 10. Mai treffen sich die Aussteller wieder auf dem Messegelände in Stuttgart, um ihre<br />
aktuellen Lösungen rund um die Qualitätssicherung zu zeigen. Erstmals ist auch Halle 8 Teil der<br />
Messe Control. Dort werden Systeme, Software und Services präsentiert. Zum Programm zählen<br />
außerdem wieder die Sonderschauen der Fraunhofer-Institute.<br />
Wer sich über den aktuellen Stand von Technologien<br />
und Dienstleistungen in Sachen Qualitätssicherung<br />
(QS) kundig machen möchte, für den gibt es im Frühling<br />
nur den Weg nach Stuttgart. Vom 7. bis 10. Mai 2019<br />
präsentieren rund 900 Hersteller und Anbieter aus<br />
mehr als 30 Ländern auf der Control ihre Lösungen zu<br />
diesen Themenfeldern.<br />
Die Messe wird in diesem Jahr um die Halle 8 erweitert,<br />
was Veranstalter Schall laut eigener Aussage die<br />
Möglichkeit gibt, die Control für Aussteller und Fachbesucher<br />
thematisch in Kompetenz-Blöcke zu strukturieren.<br />
Die Halle 8 soll künftig die zentrale Plattform für<br />
QS-Systeme, QS-Software und QS-Services sein. Mit dieser<br />
Strukturierung folgt die Control laut Schall den<br />
wachsenden Anforderungen an den QS-Markt, der sich<br />
unter anderem durch die Digitalisierung und den<br />
Zwang zur durchgängigen Vernetzung dramatisch im<br />
Wandel befinde.<br />
Machine Learning im Fokus<br />
In Halle 8 wird auch das Event-Forum des Fraunhofer Instituts<br />
für Produktionstechnik und Automatisierung<br />
(IPA) zu finden sein. Im Mittelpunkt der Sonderschau<br />
mit Live-Demonstrationen steht 2019 das Thema „Maschinelles<br />
Lernen und Sehen – eine technologische Revolution<br />
dank künstlicher Intelligenz und moderner<br />
Bildverarbeitung“.<br />
Der Fokus des Forums liegt auf den Fähigkeiten und<br />
Einsatzmöglichkeiten von maschinellen Lernverfahren<br />
und kameragestützter Bildverarbeitungen für die Qualitätssicherung.<br />
Hierzu zählen zum Beispiel selbstlernende<br />
Fehlerdetektion nach dem Vorbild des menschlichen<br />
Sehens, Nutzung von Deep-Learning-Algorithmen oder<br />
Embedded-Vision-Systeme. Laut Veranstalter ist die<br />
Sonderschau mehr als nur eine Orientierungshilfe bei<br />
der Auswahl einer geeigneten Technologie zur Lösung<br />
verschiedenster Prüfaufgaben in unterschiedlichen Anwendungsfeldern.<br />
Zusätzlich präsentieren die Aussteller<br />
im Rahmen der Sonderschau auch komplette berührungslose<br />
Mess- und Prüfsysteme zur Lösung konkreter<br />
Aufgabenstellungen.<br />
Vorgestellt werden zum Beispiel Lichtschnitt, Streifenprojektion,<br />
Weißlichtinterferometrie, Holographie,<br />
konfokale Messverfahren und Time of Flight. Außerdem<br />
werden Mess- und Prüftechniken für Materialstrukturen<br />
wie Computer-Thermographie oder Röntgensysteme<br />
gezeigt.<br />
Ein weiterer Anziehungspunkt für Besucher und Aussteller<br />
der Control sei das Aussteller-Forum, heißt es bei<br />
Schall. Auch 2019 soll es wieder die Möglichkeit bieten,<br />
durch Fachvorträge und Best-Practice-Referate einen<br />
optimalen Transfer von der Theorie in die industrielle<br />
QS-Praxis zu schaffen.<br />
■<br />
Webhinweis<br />
Auch in diesem Jahr werden sich die Branchenexperten wieder auf<br />
dem Control Stand der QE einfinden, um in Videointerviews über<br />
Trends und Produkte zu sprechen. Hier geht es zu den Videos vom<br />
vergangenen Jahr:<br />
https://quality-engineering.industrie.de/videos/<br />
10 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
Industrie<br />
Unsere Highlights für Ihre Marketingkommunikation<br />
Control 2019: Machen Sie das Beste draus<br />
– mit dem Medienangebot von QUALITY ENGINEERING!<br />
Von der Messevorbereitung über Vor-Ort-Infos zu Ausstellern,<br />
Schwerpunkten und Highlights bis zur Nachlese<br />
Unsere Medien helfen, den Messebesuch optimal zu planen, den Überblick<br />
zu behalten, das Gesehene einzuordnen und nachhaltig zu wirken – auch bei<br />
denen, die die Messe vor Ort nicht besuchen können.<br />
Wir machen die Messe zum crossmedialen Erlebnis für alle!<br />
Sie sind<br />
Aussteller?<br />
Wir beraten<br />
Sie gerne über<br />
Ihre Media-<br />
Optionen!<br />
Fokussiert oder crossmedial – nutzen Sie unsere Medien zur Information und Kommunikation<br />
Offizielle Messezeitung<br />
CONTROL EXPRESS<br />
Messeausgaben QUALITY ENGINEERING / QUALITY ENGINEERING PLUS<br />
Gesamtauflage<br />
40.000<br />
qe-online.de tägl. Sondernewsletter Video-Statement<br />
Verteilung an allen<br />
Messeeingängen und in<br />
den Messehallen<br />
+ Versand vorab an alle<br />
Leser der QUALITY<br />
ENGINEERING<br />
Auf der<br />
Messe<br />
<strong>Quality</strong> Engineering <strong>01.2019</strong> 11<br />
Wir beraten Sie gerne: media.industrie.de | media.industrie@konradin.de | +49 711 7594-552
:: Messen / Events<br />
Roundtable zur Bildverarbeitung in der Food-&-Beverage-Branche<br />
Hightech für komplexe Aufgaben<br />
Die Anforderungen an die Bildverarbeitung sind in der Lebensmittelindustrie besonders hoch,<br />
erklären Experten von JAI, EVT und dem Fraunhofer IPA. Für neue Technologien wie<br />
Hyperspektral, Deep Learning und Polarisation bieten sich große Anwendungsmöglichkeiten.<br />
Doch nicht immer ist der Einsatz wirtschaftlich.<br />
:: Was sind die besonderen Herausforderungen<br />
im Bereich Food & Beverage für die Bildverarbeitung?<br />
Björn Milsch: Gerade in der Food-&-Beverage-Industrie<br />
herrschen teilweise sehr extreme<br />
Umgebungsbedingungen – zum Beispiel<br />
starke Kälte und Hitze. Daher müssen<br />
die Kameras und Bildverarbeitungssysteme,<br />
die eingesetzt werden, extrem robust sein.<br />
Der andere Punkt ist: Die Aufgabenbereiche<br />
sind extrem vielfältig. Das heißt, man sollte<br />
schon ein Bildverarbeitungssystem haben,<br />
das viele verschiedene Prüfalgorithmen bietet,<br />
um alle Aufgaben abdecken zu können.<br />
:: Welche Aufgaben sind das?<br />
Milsch: Das fängt an bei der Vermessung<br />
und Klassifizierung im Wareneingang und<br />
geht dann über die Aussortierung von<br />
Fremdkörpern weiter in die Prozesskette. Bis<br />
hin zu Anwendungen, in denen Backwaren<br />
in 3D vermessen werden.<br />
Markus Hüttel: Es gibt einen entscheidenden<br />
Unterschied zur industriellen Bildverarbeitung.<br />
Dort geht es in der Regel um Produkte,<br />
die von Maschinen mit hoher Wiederholgenauigkeit<br />
hergestellt werden. Das<br />
heißt: Die Aufgabenstellung, wenn es um<br />
das Prüfen oder Messen geht, ist ziemlich<br />
klar beschrieben. Das ist im Bereich natürlicher<br />
Produkte anders. Hier gibt es keine<br />
exakten Vorgaben. Äpfel beispielsweise vari-<br />
Der Roundtable der QE zu Vision-Technologien in der<br />
Lebensmittelbranche – von links nach rechts:<br />
Markus Strehlitz, Björn Milsch, Michal Beising, Markus<br />
Hüttel und Sabine Koll Bilder: Harald Frater
ieren in ihrem Aussehen. Dadurch sind die<br />
Aufgabenstellungen für den Bildverarbeiter<br />
komplexer und komplizierter. Häufig geht<br />
es auch gar nicht um klassische Qualitätsmerkmale,<br />
sondern um die Ästhetik – also<br />
ob die Kartoffel jetzt rund oder länglich ist.<br />
Und diese ästhetischen Qualitätsmerkmale<br />
zu beschreiben, ist relativ schwierig.<br />
Michael Beising: Eigentlich produziert man<br />
im Food-&-Beverage-Bereich keine gleichen<br />
Teile, sondern nur ähnliche. Und dann muss<br />
man abwägen, ob die Ähnlichkeit eines Teils<br />
noch in Ordnung ist. Das ist das, was man in<br />
der klassischen Bildverarbeitung eigentlich<br />
eher nicht haben möchte.<br />
Hüttel: Bei Produkten aus dem Lebensmittelbereich<br />
interessiert auch die chemische<br />
Zusammensetzung. Also zum Beispiel die<br />
Frage: Ist das Produkt noch in dem Zustand,<br />
dass es verkauft werden kann? Und dabei<br />
spielt dann die multispektrale beziehungsweise<br />
hyperspektrale Bildverarbeitung eine<br />
zunehmend wichtige Rolle.<br />
:: Hyperspektral-Bildverarbeitung ist zur<br />
Zeit eines der großen Trendthemen. Wie verbreitet<br />
ist denn der Einsatz der Technologie<br />
überhaupt?<br />
Beising: Die Technologie wird eingesetzt.<br />
Aber das Problem bei der Hyperspektraltechnik<br />
ist, dass es zu wenige Hersteller von<br />
Sensoren gibt. Jeder Kamerahersteller setzt<br />
praktisch die gleichen Sensoren ein. Und deren<br />
Preis ist relativ hoch. So können die Kameras<br />
insgesamt nicht günstiger werden.<br />
Hüttel: Die Technologie ist noch relativ neu<br />
und recht teuer.<br />
Beising: Wir brauchen mehr Wettbewerb,<br />
damit die Preise für Hyperspektralkameras<br />
runter gehen. Dann hätte die Bildverarbeitung<br />
Möglichkeiten ohne Ende.<br />
Die Diskussionsteilnehmer<br />
:: Markus Hüttel, Abteilungsleiter Bild- und Signalverarbeitung,<br />
Fraunhofer IPA<br />
:: Björn Milsch, Regional Sales Manager, JAI<br />
:: Michael Beising, Geschäftsführer, EVT<br />
Hüttel: Die Hersteller von Hyperspektralkameras<br />
gibt es vielleicht seit 15 oder 20 Jahren.<br />
Zunächst hatte man zu wenige Anwendungsfälle.<br />
Jetzt zeigt sich aber, dass die<br />
chemische Charakterisierung von Objekten<br />
zunehmend interessanter wird.<br />
:: Das heißt, es gibt also zunehmend mehr<br />
Anwendungsmöglichkeiten?<br />
Hüttel: Es gibt tatsächlich relativ viele Anwendungen<br />
– speziell im Bereich, wenn Objekte<br />
sortiert werden sollen. Wenn zum Beispiel<br />
eine Packung Linsen danach untersucht<br />
wird, ob in ihr Steine enthalten sind.<br />
Milsch: Da muss ich einhaken. Um Steine<br />
von Obst oder Gemüse zu trennen, brauche<br />
ich keine Hyperspektralkamera. Dafür reicht<br />
eine Infrarotkamera oder eine Prismakamera<br />
mit zwei Sensoren. Mit dieser kann man<br />
sowohl die Qualitäten farbanalysieren als<br />
auch die Fremdkörper detektieren.<br />
Beising: Klar, es muss nicht immer Hyperspektral<br />
sein. Aber wenn ich mit Hyperspektral<br />
arbeite, muss ich mir nicht überlegen,<br />
ob das Merkmal, um das es geht, noch in<br />
mein Spektrum fällt. Dann habe ich eine<br />
Technologie, die alles kann.<br />
Milsch: Aber man muss es natürlich auch<br />
wirtschaftlich sehen. Häufig sagen Unternehmen:<br />
„Wir brauchen eine Hyperspektralkamera,<br />
um dieses oder jenes zu detektieren.“<br />
Aber häufig benötigen sie für ihre Anwendung<br />
nur ein paar Wellenlängen. Wenn<br />
ich dem Kunden dann eine Kamera anbiete,<br />
mit der er zwei, drei oder vier Wellenlängen<br />
ermitteln kann, und die nur 20 % oder 25 %<br />
einer Hyperspektralkamera kostet, dann<br />
wird er sich für diese entscheiden.<br />
Beising: Meistens weiß der Kunde gar nicht,<br />
was man mit der jeweiligen Technologie alles<br />
machen kann. Und wenn er sieht, was<br />
möglich ist, möchte er noch mehr Merkmale<br />
prüfen.<br />
Milsch: Deswegen ist es wirklich essenziell,<br />
am Anfang die Anforderungen zu definieren.<br />
:: Erhöht sich der Aufwand durch den Einsatz<br />
neuer Technologien wie der Hyperspektralbildverarbeitung.<br />
Sind vom Anwender<br />
neue Kompetenzen gefordert?<br />
Beising: Man musste sich auch früher<br />
schon viele Gedanken machen, wenn man<br />
Bildverarbeitung eingesetzt hat. Bei der Hyperspektral-Technik<br />
kommen aber noch<br />
mehr Dimensionen hinzu. Der Nutzer ist<br />
mit Dingen konfrontiert, die er zunächst gar<br />
nicht verstehen kann. Ein Mensch hat ja<br />
kein Gefühl für mehrere Spektren. Da benötigt<br />
man einen Mitarbeiter, der sich zumindest<br />
eine Zeit lang in das Thema einarbeitet.<br />
Das ist schon sehr anspruchsvoll.<br />
Hüttel: In der Bildverarbeitung haben wir es<br />
ja mit mehreren Disziplinen zu tun: Physik,<br />
Optik, Elektronik, Softwareherstellung, Algorithmen,<br />
Computertechnik. Bei der Multispektralen-<br />
oder Hyperspektral-Technik bedarf<br />
es nun auch chemischer Kenntnisse. Also<br />
zum Beispiel: Wie verhalten sich Moleküle<br />
bei Lichteinfall? Letztendlich geht es um<br />
die chemische Materialcharakteristik.<br />
:: Auch die Fülle an Daten, die durch moderne<br />
Bildverarbeitung generiert wird, macht<br />
die Anwendungen komplexer. Kann Machine<br />
Learning dabei helfen, dieser Komplexität<br />
Herr zu werden?<br />
Hüttel: Die Menge der Daten als solche ist<br />
es eigentlich nicht einmal. Maschine Learning<br />
ergibt dann Sinn, wenn Ursachen-<br />
Wirkzusammenhänge nicht mehr analytisch<br />
oder nur ganz schwer beschrieben<br />
werden können. Wenn ich zum Beispiel den<br />
Wirkzusammenhang von einem Spektrum<br />
und dem Alter einer Banane betrachte und<br />
dies nicht mehr analytisch abbilden kann.<br />
Dann verwende ich maschinelles Lernen.<br />
Das System erzeugt dabei ein Modell, das<br />
am Ende die Eingangsdaten – also die Fragestellung<br />
– und dazu die Ausgangsdaten<br />
abbildet.<br />
:: In der Lebensmittelbranche gibt es ja<br />
häufig solche komplexen Zusammenhänge.<br />
Hüttel: Ja – zum Beispiel die Beurteilung, ob<br />
Äpfel schön oder nicht schön aussehen.<br />
:: Wie geht man dabei genau vor?<br />
Hüttel: Man nimmt eine Menge von Äpfeln<br />
und sortiert diese in solche, die schön aussehen,<br />
und jene, die nicht schön aussehen.<br />
Dann nimmt man von jedem Apfel ein oder<br />
mehrere Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven<br />
auf und merkt sich zu jedem<br />
Bild das Attribut „schön“ beziehungs -<br />
weise „nicht schön“. Mit diesen Bildern<br />
wird dann von einem Computer mit Hilfe<br />
eines Lernalgorithmus ein künstliches Neu -<br />
ronales Netz so modifiziert, dass dieses<br />
am Ende des Trainings zum Bild eines<br />
schönen Apfels das Attribut „schön“ und<br />
zum Bild eines nicht schönen Apfels das<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 13
:: Messen / Events<br />
Attribut „nicht schön“ ausgibt. Dabei ist<br />
bemerkenswert, dass dies auch für Bilder<br />
von Äpfeln funktioniert, die dem Computer<br />
zuvor noch nie vorgelegt wurden.<br />
:: Aber Machine-Learning-Systeme müssen<br />
mit möglichst vielen Daten gefüttert werden,<br />
um verlässliche Ergebnisse zu erhalten.<br />
Reicht die Menge an Bildern, die in der Qualitätskontrolle<br />
zur Verfügung stehen, dafür<br />
aus?<br />
Beising: Unternehmen, die zum Beispiel Äpfel<br />
produzieren, müssen natürlich zunächst<br />
einen Mitarbeiter zwei Wochen abstellen,<br />
der die Äpfel qualifiziert. Aber anschließend<br />
haben sie eine Datenbank, in der die Äpfel<br />
Björn Milsch von JAI<br />
empfiehlt Bildverarbeitungssysteme,<br />
die viele<br />
verschiedene Prüfalgorithmen<br />
bieten, um die<br />
vielfältigen Aufgaben<br />
abdecken zu können<br />
mit ihren Merkmalen enthalten sind. Meistens<br />
fängt man ja auch nicht mit einem leeren<br />
Netz an, sondern mit einem vorqualifiziertem<br />
Netz. Und diesem fügt man dann<br />
zusätzliche Daten hinzu. Dann konvergiert<br />
es auch schneller. Das hängt auch von der<br />
Anwendung ab. Wenn die Merkmale zur<br />
Unterscheidung sehr eindeutig sind, werden<br />
weniger Bilder benötigt.<br />
Milsch: Grundsätzlich gilt das Prinzip: Je<br />
trennschärfer ich gut und schlecht voneinander<br />
unterscheiden kann, desto weniger<br />
Bilder brauche ich. Je näher die Merkmale<br />
beieinander liegen, desto mehr Bilder<br />
muss ich teachen.<br />
Maschine Learning ergebe<br />
dann Sinn, wenn Zusammenhänge<br />
zwischen<br />
Ursache und Wirkung<br />
nicht mehr analytisch<br />
oder nur ganz schwer beschrieben<br />
werden könnten,<br />
so Markus Hüttel<br />
vom Fraunhofer IPA<br />
„Wir brauchen mehr Wettbewerb,<br />
damit die Preise für Hyperspek -<br />
tralkameras runter gehen“, sagt<br />
Michael Beising von EVT<br />
Video<br />
Video<br />
Video<br />
Alle drei Roundtable-Teilnehmer werfen einen Blick<br />
auf die BV-Trends – hier als erstes Björn Milsch<br />
Auch Markus Hüttel vom Fraunhofer IPA spricht über<br />
die Entwicklungen in der Bildverarbeitung<br />
Thema ist bei allen Experten – hier Michael Beising,<br />
EVT – auch die Bedeutung der Messe Vision<br />
14 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
Vision mit Rekordergebnis<br />
11.100 Fachbesucher zählte die Vision 2018 – und damit 14 % mehr im Vergleich zur<br />
Vorveranstaltung. Dies ist ein Besucherrekord. Der Anteil an Besuchern, die aus dem<br />
Ausland zur Welt leitmesse der Bildverarbeitung nach Stuttgart anreisten, stieg auf einen<br />
Rekordwert von 47 %. „Die Vision ist die Weltleitmesse der Branche und war drei<br />
Tage der Puls für die Bildverarbeitung. Insbesondere die Qualität der Gespräche und<br />
das große Besucherinteresse an konkreten<br />
Lösungen sind beeindruckend“,<br />
sagt Dr. Klaus-Henning Noffz,<br />
CEO von Silicon Software und Vorsitzender<br />
des Vorstands der VDMA-Fachabteilung<br />
Industrielle Bildverarbeitung.<br />
„Die Bildverarbeitungstechnologie<br />
hat sich längst als ‚das Auge‘ und<br />
Datenlieferant von Industrie 4.0 sowie<br />
in unzähligen nichtindustriellen<br />
Anwendungsbereichen etabliert. Die<br />
Innovationskraft und die Dynamik der<br />
Branche sind vielversprechend, sodass<br />
wir gespannt sind, was die Vision<br />
2020 bereithält“, so Noffz. ■<br />
Hüttel: Ein großer Vorteil dieser neuronalen<br />
Netze oder der lernenden Systeme ist, dass<br />
diese nicht jedes Exemplar, das sie richtig<br />
einsortieren sollen, gesehen haben müssen.<br />
Die Systeme lernen an einer Menge von Beispielen<br />
und können dann anhand dieser<br />
Beispiele interpolieren beziehungsweise<br />
abstrahieren. Es ist sogar eine relativ wichtige<br />
Voraussetzung, dass man diese Netze so<br />
trainiert und sie die Beispiele nicht nur auswendig<br />
lernen. Denn dann reagieren sie nur<br />
noch auf die auswendig gelernten Objekte<br />
und erkennen den Rest nicht mehr verlässlich.<br />
:: Ist das Thema schon in der Praxis angekommen?<br />
Milsch: Wenn es um Deep Learning geht,<br />
muss man sagen: Im Moment sind diese<br />
Technologien noch sehr stark ein Forschungsthema.<br />
Meines Wissens lässt der<br />
Übergang in die Industrie noch ein bisschen<br />
auf sich warten. Er wird aber zweifellos<br />
kommen.<br />
Beising: Der Knackpunkt ist häufig, die Auswertung<br />
in Echtzeit – also im Produktionstakt<br />
– wirtschaftlich umzusetzen. Man kann<br />
zwar heute für 100.000 Euro oder mehr einen<br />
schnellen Rechner kaufen, aber das ist<br />
für die meisten Betriebe nicht tragbar. Einige<br />
der großen Hersteller haben jetzt aber<br />
Chips auf den Markt gebracht, mit denen<br />
sich auch kleinere Netze in Echtzeit rechnen<br />
lassen. Allerdings fallen mir jetzt für solche<br />
kleinen Netze spontan keine Anwendungen<br />
im Lebensmittelbereich ein.<br />
:: Gibt es weitere Technologen, die in der<br />
Food&Beverage-Branche von Bedeutung<br />
sind?<br />
Milsch: Speziell in der Getränke-Industrie<br />
spielen auch Polarisationskameras eine<br />
wichtige Rolle. So weit ich weiß, werden auf<br />
der Vision mindestens drei Firmen – unter<br />
anderem auch meine – neue Polarisationskameras<br />
präsentieren. Diese eignen sich optimal,<br />
um zum Beispiel in der Getränkeabfüllung<br />
Glasspannung oder Einschlüsse im<br />
Glas durch Luftblasen zu erkennen.<br />
Beising: Wir wissen, dass sich die Polarisationstechnik<br />
für Glas eignet. Aber wahr-<br />
scheinlich lässt sie sich auch für andere Materialien<br />
nutzen, die ähnliche Eigenschaften<br />
haben. Daneben wäre es auch schön für die<br />
Nahrungsmittelindustrie, wenn es gelingen<br />
würde, Terahertz-Sensoren günstiger anzubieten.<br />
Dann könnte man zum Beispiel auch<br />
mal unter die Verpackung eines Schokoriegels<br />
schauen. Das ist zwar teilweise auch<br />
mit Thermografie möglich. Aber mit einem<br />
Terahertz-Sensor kann man das noch ein<br />
Tick besser machen.<br />
Hüttel: Mit Terahertz-Technologie lassen<br />
sich insbesondere Körper, die Wasser enthalten,<br />
detektieren und charakterisieren.<br />
Und Lebensmittel bestehen ja auch zu einem<br />
großen Teil aus Wasser. Aber die Technologie<br />
ist noch sehr teuer.<br />
Beising: Das Problem ist: Man braucht erst<br />
mal eine Kamera, um dann herauszufinden,<br />
was man mit ihr alles machen kann. Erst<br />
wenn man es ausprobiert, wird ersichtlich,<br />
für welche Anwendungen sich die jeweilige<br />
Technik eignet. Das ist grundsätzlich so in<br />
der Bildverarbeitung.<br />
■<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 15
:: Software<br />
Qualitätsmanagement<br />
ist keine Einzeldisziplin<br />
mehr, sondern auch für<br />
Entwicklung, Planung<br />
und Produktion, Instandhaltung<br />
und Service ein<br />
Thema<br />
Bild: Zorandim/Fotolia<br />
Qualitätsmanagement-Software für das ganze Unternehmen<br />
Für die Mitarbeiter A bis Z<br />
Der Anwenderkreis von Qualitätsmanagement-Systemen vergrößert sich. Das hat auch<br />
Auswirkungen auf die Software. Diese muss nun auf Mitarbeiter ausgelegt sein, die aus unterschiedlichen<br />
Fachabteilungen kommen. Daneben arbeiten die Anbieter daran, ihre Produkte für<br />
die Folgen der Digitalisierung fit zu machen– wie etwa die wachsenden Datenmengen.<br />
Die Rolle des Qualitätsmanagements hat sich gewandelt.<br />
Es stellt keine Einzeldisziplin dar, sondern zieht sich<br />
durch eine Vielzahl von Fachbereichen im Unternehmen.<br />
Auch für Mitarbeiter aus der Entwicklung, der Planung<br />
und Produktion, der Instandhaltung und dem Service<br />
ist Qualitätsmanagement ein Thema.<br />
Das hat auch Auswirkungen auf die entsprechenden<br />
Systeme. Die Anbieter der Software-Lösungen richten<br />
ihre Produkte nun zunehmend auf einen größeren Anwenderkreis<br />
aus.<br />
„Für uns ist es sehr wichtig, alle Mitarbeitergruppen<br />
in einem Unternehmen zu erreichen. Das heißt: Qualitätsmanagement<br />
nicht nur für die Qualitätsmanager<br />
oder die Führungskräfte und Abteilungsleiter, sondern<br />
für alle Mitarbeiter von A bis Z“, sagt zum Beispiel Iris<br />
Bruns aus der Geschäftsführung des Software-Herstellers<br />
Consense.<br />
„Alle Prozesse sollen so abgebildet werden, wie sie<br />
tatsächlich ablaufen“, so Bruns weiter. „Und jeder Mitarbeiter<br />
– egal, ob er irgendwo in der Produktion arbeitet<br />
oder im Büro – soll die Möglichkeit haben, sich aktiv daran<br />
zu beteiligen und sein Feedback zu geben.“ Das erhöht<br />
ihrer Meinung nach auch die Akzeptanz des Managementsystems.<br />
Denn jeder Mitarbeiter könne sich<br />
so wiederfinden.<br />
CAQ-Spezialist Babtec zieht den Anwenderkreis<br />
ebenfalls größer und denkt dabei auch über Unternehmensgrenzen<br />
hinweg. Mit der Digitalisierung der Lieferkette<br />
hätten sich die Anforderungen an das Qualitätsmanagement<br />
verändert, heißt es bei Babtec. Mit seiner<br />
Software unterstützt der Hersteller die Unternehmen<br />
etwa dabei, Warenprüfungen an die Lieferanten zu delegieren.<br />
Die Anwender des Systems können Prüfaufträge generieren<br />
und diese dem Lieferanten dann direkt über die<br />
Cloud zu Verfügung stellen. Der Lieferant arbeitet mit<br />
einer browserbasierten Software, mit der er die vom<br />
Kunden gesteuerte Prüfung seiner Ware durchführen<br />
kann – und zwar direkt in seinem Warenausgang.<br />
Lieferant übernimmt Wareneingangsprüfung<br />
„Das System führt dabei Schritt für Schritt durch die<br />
Prüfung, sodass eine genaue und detaillierte Erfassung<br />
möglich ist“, erklärt Lutz Krämer, Bereichsleiter Produkte<br />
bei Babtec. Das Ergebnis der Prüfung wird digital an<br />
den Kunden übermittelt und steht beiden Parteien<br />
langfristig in der Cloud zur Verfügung. Auf Grundlage<br />
der empfangenen Daten entscheidet der Kunde, wie mit<br />
der Bestellung weiter verfahren werden soll.<br />
„Die aufwändige Wareneingangsprüfung verschiebt<br />
sich so vom Wareneingang des Kunden in den Warenausgang<br />
des Lieferanten“, so Krämer. „Die Vorteile liegen<br />
auf der Hand: Mängel werden bereits entdeckt, bevor<br />
die Ware das Haus des Lieferanten verlässt. So können<br />
unnötige Logistikkosten für den Versand fehlerhafter<br />
Ware und Zeitverlust für Ersatzlieferungen vermieden<br />
werden.“<br />
Voraussetzung für die Nutzung der Software durch<br />
einen erweiterten Anwenderkreis ist, dass diese nicht<br />
16 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
nur auf Qualitätsexperten zugeschnitten ist. Will heißen:<br />
Die einfache Bedienbarkeit ist elementar für ein<br />
System, mit dem viele verschiedene Fachbereiche arbeiten<br />
sollen.<br />
Auch diese Anforderung steht derzeit bei den Software-Herstellern<br />
ganz oben auf der Agenda. CAQ-Anbieter<br />
iqs zum Beispiel hat es sich zum Ziel gesetzt, seine<br />
Module so transparent, schlank und effektiv wie<br />
möglich zu gestalten.<br />
Auch für Böhme & Weihs ist die Usability ein wichtiges<br />
Thema. Die Mitarbeiter in den verschiedenen Fachabteilungen<br />
würden gezielt nur auf die für sie relevanten<br />
Informationen zugreifen, so Geschäftsführer Professor<br />
Norbert Böhme. „Teils sogar als eine Art App auf<br />
dem Tablet. Der Informationsgewinn erfolgt so einfach<br />
und intuitiv, dass der Mitarbeiter gar nicht merkt, dass<br />
er Mitglied in einem großen CAQ-Netzwerk ist.“<br />
Grundsätzlich gilt: Der Anwender soll das System<br />
einfach bedienen können. Die komplexen Prozesse, die<br />
eventuell im Hintergrund laufen, sollen verborgen bleiben.<br />
Big-Data-Analysen, die unabhängig von einem CAQ-<br />
System erfolgen können, bieten vor dem Hintergrund<br />
der zunehmenden Datenmengen laut Böhme zwar<br />
enormes Informationspotenzial. Das Unberechenbare<br />
sei aber, dass man nicht wisse, ob man Erkenntnisse gewinnen<br />
wird und welcher Art diese sein sollen. „Das ist<br />
der Unterschied zu uns als CAQ- und MES-Anbieter“,<br />
meint Böhme. „Wir arbeiten zielgerichtet: Die Software<br />
benötigt ganz konkrete Daten und setzt jetzt ein bestimmtes<br />
Verfahren ein, um aus diesen Daten die Informationen<br />
und Kennzahlen zu gewinnen.“<br />
Daten aus noch mehr unterschiedlichen Quellen<br />
Die Digitalisierung verändert die Anforderungen an das<br />
Qualitätsmanagement aber noch auf eine andere Weise.<br />
Sie sorgt auch dafür, dass die Datenmengen extrem<br />
wachsen. Darauf müssen die Systeme ebenfalls ausgelegt<br />
werden.<br />
Consense etwa hat aus diesem Grund sein Kennzahlenmanagement<br />
umgestellt. Damit sei man in Zukunft<br />
noch flexibler und könne sich die Daten aus noch mehr<br />
unterschiedlichen Quellen holen, erklärt Stephan Killich,<br />
der neben Iris Bruns in der Geschäftsführung von<br />
Consense sitzt.<br />
„Das betrifft sogar die Informationen, die noch gar<br />
nicht in elektronischer Form vorliegen“, ergänzt Killich.<br />
„Unsere Software fragt dann nach einem definierten<br />
Zeitplan bei der jeweiligen Person nach den entsprechenden<br />
Daten.“<br />
Video<br />
Auf der Control 2018 sprach Professor Norbert Böhme<br />
über das neue hauseigene CAQ-System<br />
Vorteile für die Spezialisten<br />
Software wird zunehmend bedienerfreundlicher und ist somit nicht<br />
nur für Experten nutzbar<br />
Bild: Consense<br />
Auch im Vergleich zu großen ERP-Plattformen, die ein eigenes Qualitätsmanagement-Modul<br />
bieten, sieht er spezialisierte Software im<br />
Vorteil. „Gerade der CAQ-Bereich ist ja ein Spezialgebiet, in dem sich<br />
Lösungspartner vor allem durch ein tiefes Fach-, Prozess- und<br />
Normwissen abgrenzen“, so Böhme. „Da kommt ein Qualitätsmanagement-Modul<br />
als kleiner Bestandteil einer ERP-Lösung fachlich<br />
und inhaltlich womöglich schnell an seine Grenzen.“<br />
In Verhandlungen mit Kunden aus Branchen wie der Medizintechnik,<br />
der Automobilindustrie oder der Luft- und Raumfahrttechnik,<br />
spreche man sofort die gleiche Sprache. „Wir kennen die Anforderungen<br />
im Detail und werfen uns Fachausdrücke an den Kopf, ohne<br />
zu merken, dass das ganz spezielle Fachausdrücke sind.“<br />
Auch Iris Bruns von Consense betont die eigenen Stärken. „Wir<br />
bieten unglaublich viele Unterstützungsmechanismen, Berichte,<br />
Abläufe, die das Qualitätsmanagement optimal unterstützen. Und<br />
dies hat mittlerweile einen Umfang im Kontext des Qualitätsmanagements<br />
erreicht, der sehr schwer in anderen Tools abzubilden ist. ■<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 17
:: Promotion<br />
Die FMEA als zentrales Element der iqs CAQ-Software<br />
Die rote Karte für Wiederholfehler<br />
Die Gewährleistung von Sicherheit und technischer Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger<br />
wirtschaftlicher Produktion stellt Hersteller vor eine große Herausforderung. Produkte werden<br />
komplexer, die Innovationszeiten kürzer. Die Qualität der Produkte darf jedoch nicht leiden. Mit<br />
der richtigen CAQ-Software ist beides möglich: eine Steigerung der Qualität bei gleichzeitiger<br />
Reduzierung der Kosten und Fehler.<br />
Das Ziel von iqs ist<br />
die nachhaltige Vermeidung<br />
von Fehlern<br />
Bild: iqs<br />
Eigentlich ist es ganz einfach: Weniger Fehler verursachen weniger<br />
Kosten, weniger Reklamationen führen zu einer höheren Kundenzufriedenheit.<br />
Den Schlüssel zu mehr Qualität und damit zu mehr<br />
Wertschöpfung bilden konsequente Fehlervermeidung und ein dynamisches,<br />
durchgängiges Qualitätsmanagement. Und trotzdem:<br />
Viele Betriebe arbeiten im Qualitätsmanagement noch mit MS-Office-Anwendungen<br />
wie Word und Excel oder haben verschiedene<br />
Software-Systeme als Insellösungen im Einsatz, welche die relevanten<br />
Prozesse nur unzureichend unterstützen.<br />
Seit der Gründung 1995 arbeitet iqs Software konsequent daran,<br />
mit seinen CAQ-Lösungen Qualitätsmanagementprozesse logisch<br />
und durchgängig abzubilden sowie deren Erkenntnisse nachvollziehbar<br />
und verständlich darzustellen. Dabei hat iqs aktuelle Trends<br />
und die wachsenden Qualitätsanforderungen der Industrie stets im<br />
Blick.<br />
Das Ziel von iqs ist die nachhaltige Vermeidung von Fehlern. Deshalb<br />
setzt das iqs CAQ-System viel früher und tiefer an. Das heißt:<br />
Bereits vor Serienstart müssen möglichst alle potenziellen Produktund<br />
Prozessfehler erkannt und benannt sowie zu jedem potenziellen<br />
Fehler geeignete Maßnahmen definiert werden, die entweder<br />
das Auftreten dieses Fehlers vermeiden oder fehlerhafte Teile effizient<br />
entdecken. Hierfür ist eine gründliche Analyse von Fehlerursache<br />
und -wirkung erforderlich. Im iqs CAQ-System nimmt die FMEA<br />
(Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) eine zentrale Stellung ein<br />
und ist Dreh- und Angelpunkt zur effektiven Fehlervermeidung.<br />
Effizientes Fehlermanagement<br />
Aber iqs geht noch einen Schritt weiter: Alle Reklamationen und Abweichungen,<br />
die im Laufe eines Produktlebenszyklus auftreten, sowie<br />
deren Analyse führen automatisch auch zu einer Anpassung<br />
der entsprechenden FMEA. Es entsteht ein sofortiger Rückfluss in<br />
die Planung und damit ein Regelkreis zwischen Reklamationsmanagement<br />
und FMEA.<br />
Auf diese Weise werden sämtliche Erfahrungen aus der Produktion<br />
in der FMEA gesammelt und zum Wissensspeicher des Unternehmens.<br />
Jede neu zu erstellende FMEA kann auf das ganze Qualitäts-Know-how<br />
der Firma zugreifen. Auf diese Weise erreichen Un-<br />
18 <strong>Quality</strong> <strong>Quality</strong> Engineering <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
Promotion ::<br />
ternehmen einen konsequenten Regelkreis, der zu einer deutlichen<br />
Kostensenkung und Qualitätssteigerung führt.<br />
Nur eine aktuelle und gut gepflegte FMEA über die gesamte Lebensdauer<br />
eines Produktes ist wirklich effizient. Mit der iqs FMEA<br />
können unternehmensweit alle Produkt- und Prozess-FMEAs auf<br />
komfortable Weise erstellt und aktualisiert werden. Eine große Zeitersparnis<br />
bei der Erstellung ergibt sich aus der iqs Vererbungstechnik<br />
und die Wiederverwendung von Bausteinen.<br />
Ähnlichkeiten von Produkten oder Prozessen können für die einfache<br />
Erstellung weiterer FMEAs genutzt werden. Denn auch wenn<br />
sich zwei Gesamtprozesse voneinander unterscheiden, sind viele ihrer<br />
Teilprozesse identisch. Wird nun die FMEA eines solchen Teilprozesses<br />
als Baustein betrachtet, kann sie in verschiedenen Gesamtprozessen<br />
eingesetzt werden, ohne neu erstellt werden zu müssen.<br />
Wird ein Teilprozess geändert, der in verschiedenen Gesamtprozessen<br />
relevant ist, müssen die betroffenen FMEAs nicht mehr von<br />
Hand nachgepflegt werden, sondern werden automatisch angepasst.<br />
Dadurch wird die Komplexität der FMEA beherrschbar.<br />
Immer aktuelle Planungsdokumente<br />
Ein großes Plus der Software: iqs Prüf- und Control-Plan (iqs PP/CP)<br />
und die iqs FMEA sind eins. Dies ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung<br />
der Fertigungsdokumente. Informationsfelder werden nur<br />
einmal bearbeitet – dadurch ist die Dokumentenpflege bei notwendigen<br />
Änderungen oder Anpassungen der Prüfpläne deutlich<br />
schneller. Ein Abgleich von Prüf- und Control-Plan und FMEA ist<br />
überflüssig. Abweichungen in Audits, aufgrund von nicht konsistenten<br />
und veralteten Dokumenten, gehören der Vergangenheit an.<br />
Reklamationsmanagement – Abgleich mit der Realität<br />
Reklamationen müssen schnell und reibungslos abgearbeitet werden.<br />
Mit dem iqs Reklamationsmanagement (iqs RKM) lassen sich<br />
alle Schritte und Abläufe der Reklamationsbearbeitung entsprechend<br />
betriebsindividueller Vorgaben abarbeiten. Aber auch Vorlagen<br />
wie zum Beispiel der 8D-Report oder das in der Medizintechnik<br />
etablierte CAPA-Management zur Qualitätsverbesserung ist vollständig<br />
in das Modul iqs RKM integriert.<br />
Während der Bearbeitung greift das iqs RKM auf die zentrale Datenbank<br />
zurück. Es wird auf ähnliche Fehler oder Wiederholfehler<br />
hingewiesen und liefert so wertvolle Hinweise zur Optimierung der<br />
Maßnahmen. Fehler mit dazugehörigen Maßnahmen können unmittelbar<br />
aus der iqs FMEA übernommen werden. Das Erstellen und<br />
Pflegen von separaten Fehlerkatalogen ist somit überflüssig. Neue<br />
Fehler übergibt iqs RKM an die iqs FMEA, die sofort aktualisiert werden<br />
kann.<br />
Normenkonforme Risikobewertung<br />
Eine Funktion der iqs FMEA ist die Risikobewertung. Weil die FMEA<br />
ständig mit der Realität abgeglichen wird, sind die Risikobewertungen<br />
bei iqs keine Spekulation, sondern durch empirische Daten früherer<br />
Produktionszyklen belegt. Das ist insofern wichtig, als in der<br />
bevorstehenden Revision der ISO 9001:2015 ein sehr viel höheres<br />
Augenmerk auf die Risikobewertung gelegt wird. Die iqs FMEA erfüllt<br />
diese Anforderungen automatisch.<br />
Außerdem ist der Vergleich zwischen tatsächlicher Fehlerhäufigkeit<br />
aus den Reklamationen und Auftretenswahrscheinlichkeit mit<br />
der Software ohne Aufwand möglich. Prüfschwerpunkte werden erkannt<br />
und unnötige Prüfungen können eliminiert werden. Dies<br />
spart Kosten und Zeit.<br />
Aus Reklamationen, FMEAs oder Prüfplänen können Maßnahmen<br />
abgeleitet, per E-Mail an die verantwortlichen Stellen versendet<br />
und zentral überwacht werden. Mit dem Webportal können<br />
Mitarbeiter ihre Maßnahmen über den Browser einsehen und bearbeiten.<br />
Perfekt in Sachen Qualität<br />
Von Anfang an ist die iqs Software ein sicherer und zuverlässiger<br />
Partner für innovative und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich<br />
Qualitätssicherung. Viele namhafte Kunden vertrauen seit Jahren<br />
auf die Erfahrungen des CAQ-Anbieters und sind überzeugt von<br />
dessen Lösungen. Für den gemeinsamen Erfolg erarbeitet iqs alle<br />
Produkte und Entwicklungen, Konzepte und Optimierungen in enger<br />
Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Das macht die Software<br />
praxisnah und intuitiv bedienbar.<br />
Der modulare Aufbau ermöglicht Unternehmen einen individuellen<br />
Einstieg. Durch die gemeinsame Datenbasis kann das iqs CAQ-<br />
System jederzeit schnell und einfach um weitere Module erweitert<br />
werden. Außerdem lässt sich das CAQ-System in alle gängigen Systeme<br />
wie z.B. ERP und MES integrieren. Praxisgerechnete Schnittstellen<br />
bieten eine einfache Anbindung und einen sicheren und zuverlässigen<br />
Austausch von Daten.<br />
■<br />
Adresse:<br />
iqs Software GmbH<br />
Erlenstraße 13c<br />
77815 Bühl (Baden)<br />
www.iqs.de<br />
Kontakt:<br />
info@iqs.de<br />
Produkte: CAQ-Software<br />
iqs Software<br />
<strong>Quality</strong> Engineering <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> <strong>01.2019</strong> 19
:: Mess- und Prüftechnik<br />
Dank der Supatouch-Technologie von<br />
Renishaw gehört die manuelle Optimierung<br />
von Positioniervorschüben,<br />
Messvorschüben und -strategien auf<br />
der CNC-Werkzeugmaschine der Vergangenheit<br />
an Bild: Renishaw<br />
Messtechnik-Trends für die Metallverarbeitung<br />
Immer näher an die Werkzeugmaschine<br />
Die Mess- und Prüftechnik ist bei Metallverarbeitern längst in der Fertigung angekommen ist. Sie<br />
sorgt für schnelle und geschlossene Regelkreise – und damit letztlich für weniger Ausschuss. Wir<br />
geben einen Überblick über Lösungen – von der Inprozess-Messung bis zum mobilen Messarm.<br />
Die Autorin<br />
Sabine Koll<br />
Redaktion<br />
<strong>Quality</strong> Engineering<br />
Das Messen im Prozess ist in der Metallbearbeitung bereits<br />
weit verbreitet. Viele Maschinen sind entsprechend<br />
ausgerüstet. Die Messtechnologien werden robuster,<br />
um mit den zum Teil rauen Bedingungen im Produktionsprozess<br />
fertig zu werden. Und die Preise der integrierten<br />
Messtechnik fallen. Auf der anderen Seite<br />
steigen die Anforderungen an die Genauigkeit. Dies alles<br />
trägt dazu bei, dass Messtechnik zunehmend in die<br />
Fertigung eingebunden wird. Diese deckt dabei ein großes<br />
Spektrum an Messungen ab: von der Einrichtung<br />
von Werkzeugen und Werkstücken in der Werkzeugmaschine<br />
über das Erkennen von Verschleiß und Bruch von<br />
Werkzeugen bis hin zur finalen Kontrolle des Werkstücks<br />
vor dem Abspannen.<br />
So hat Blum-Novotest vor Kurzem das neue Lasermesssystem<br />
LC52-Digilog zur Werkzeugmessung und<br />
-überwachung in Dreh-Fräszentren vorgestellt, das die<br />
Vorteile der berührungslosen Messung mit denen der<br />
taktilen per Messtaster in einem kompakten Gerät vereint.<br />
„Seit Jahren geht der Trend in vielen Unternehmen<br />
in Richtung Kombinationsmaschinen Drehen/Fräsen.<br />
Dem tragen wir mit der Messtechnik Rechnung“, sagt<br />
Marketingleiter Winfried Weiland. Maschinenkonzepte,<br />
in denen mehrere Fertigungsverfahren vereint sind, erfordern<br />
für die Werkzeugeinstellung und -überwachung<br />
eine andere Konfiguration als reine Fräszentren. Während<br />
rotierende Werkzeuge hier immer schnell und sicher<br />
per Laser gemessen werden, empfiehlt es sich,<br />
nicht-rotierende Werkzeuge taktil zu überwachen.<br />
Der Grund hierfür liegt darin, dass bei stehenden<br />
Werkzeugen wie etwa Ausdrehwerkzeugen für eine<br />
hochpräzise Messung eine zeitaufwändige Hochpunktsuche<br />
an der Werkzeugschneide erforderlich ist. Außerdem<br />
beeinflusst Kühlmittel die Prozessfähigkeit in diesem<br />
Fall stärker als es bei der Messung von rotierenden<br />
Werkzeugen der Fall ist. Eine schnelle berührende Messung<br />
von Drehwerkzeugen ist daher von Vorteil. Die taktile<br />
Messung wird mit dem adaptierten Blum-Messtas-<br />
20 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
ter mit planverzahntem Shark360-Messwerk durchgeführt.<br />
Der TC76 verfügt über ein präzises, richtungsunabhängige<br />
Antastverhalten und die verschleißfreie, optoelektronische<br />
Signalgenerierung. Die Shark360-Technologie<br />
ergänzt dabei das multidirektionale Messwerk<br />
um eine Planverzahnung mit 72 Zähnen, wodurch eine<br />
sehr hohe Genauigkeit auch bei außermittiger Antastung,<br />
wie sie bei der Vermessung von Drehwerkzeugen<br />
vorkommen kann, garantiert ist. Bei Auslenkung des Tasteinsatzes<br />
bewegt sich ein Präzisionsstift in eine Lichtschranke,<br />
wodurch das Schaltsignal zur Messwerterfassung<br />
erzeugt wird.<br />
Optimierte Messzyklen in der Werkzeugmaschine<br />
Renishaw hat eine neue Technologie auf den Markt gebracht,<br />
mit der sich Messzyklen in der Werkzeugmaschine<br />
ohne Genauigkeitsverlust optimieren und damit die<br />
Zykluszeiten auf CNC-Maschinen um bis zu 60 % reduzieren<br />
lassen. Die Messzykluszeit an einer Werkzeugmaschine<br />
zu verkürzen, ist keine triviale Aufgabe: Wird einfach<br />
nur der Vorschub erhöht, ist die geforderte Wiederholgenauigkeit<br />
nicht mehr gegeben. Supatouch ist eine<br />
eingebettete Optimierungsroutine innerhalb der Makrosoftware<br />
Inspection Plus von Renishaw nach Industriestandard,<br />
die genau für diesen Zweck nun verbessert<br />
wurde. Die Supatouch-Technologie erkennt automatisch<br />
die schnellstmöglichen Vorschübe, die eine<br />
Werkzeugmaschine bei gleichzeitiger Wahrung der Wiederholgenauigkeit<br />
beim Messen erzielen kann. Ein intelligenter<br />
Entscheidungsprozess sorgt dafür, dass für jede<br />
Messroutine automatisch die schnellstmögliche Messstrategie<br />
(entweder mit Einfach- oder Zweifachantastung)<br />
angewendet wird.<br />
Dieser Entscheidungsprozess wird auch während der<br />
Werkstückmessung fortgeführt. Der Messtaster kann<br />
während einer Maschinenbeschleunigung oder -verzögerung<br />
ausgelenkt werden. Dies kann aufgrund von Lageänderungen<br />
eines Werkstücks ausgelöst werden und<br />
machen Messergebnisse ungenau. Nachdem die Supatouch-Technologie<br />
diese Ungenauigkeit festgestellt hat,<br />
gibt sie dem Messtaster automatisch den Befehl, die<br />
Oberfläche in einer Geschwindigkeit zu messen, die geeigneter<br />
ist, die Genauigkeit beizubehalten, ohne dass<br />
die Werkzeugmaschine einen Alarm ausgibt.<br />
Die Messtechnik in oder sehr nahe an der Werkzeugmaschine<br />
sorgt für kurze, schnelle Regelkreise. Damit<br />
legt sie auch die Basis für eine smarte Produktion. Denn<br />
die Digitalisierung ist auch in der Zerpanung und der<br />
dabei verwendeten Messtechnik angekommen. Der<br />
Grundgedanke ist dabei, dass alle Systeme miteinander<br />
vernetzt sind und Daten austauschen – von der Produktion<br />
über die Konstruktion bis zur ERP-Software. Die<br />
Messtechnik ist dabei ein integraler Bestandteil der Fertigung.<br />
Sie soll proaktiv schon während der Fertigung<br />
eingreifen und die Produktion korrigieren , wenn ein<br />
Bauteil nicht den richtigen Toleranzen entspricht.<br />
Das ist der sogenannte Closed-Loop-Ansatz. Produktionssysteme,<br />
Maschinen und Messtechnik bilden einen<br />
geschlossenen und miteinander kommunizierenden<br />
Kreislauf, der es ermöglicht, das Erstteil bereits als<br />
Gutteil zu produzieren. Die eingebundene Messtechnik<br />
verifiziert bereits in einem sehr frühen Fertigungsstadium<br />
Dimensionen, Toleranzen und Oberflächengüte. Erkennt<br />
der Messsensor, dass ein Bauteil fehlerhaft ist,<br />
wird diese Information im Produktionskreislauf eingespeist.<br />
Closed-Loop-Ansatz für Gutteile vom ersten Teil an<br />
Die Kombination aus optischer Wellenmesstechnik und<br />
automatisierter Roboterbeladung ermöglicht eine<br />
sekundenschnelle Inspektion zahlreicher Prüfmerkmale<br />
Bild: Jenoptik<br />
Alicona verfolgt den Closed-Loop-Ansatz : Geräte wie etwa<br />
das Infinitefocus, das optische 3D-Mikrokoordinatenmesstechnik<br />
und Rauheitsmessung in einem System<br />
bietet, fügen sich in dieses Konzept ein. „Wir stellen<br />
die Schnittstellen und das Know-how für die Einbindung<br />
in die Unternehmensarchitektur bereit“, erklärt<br />
Geschäftsführer Stefan Scherer. Seiner Meinung nach<br />
ist Closed Loop vor allem dann sinnvoll, wenn bei einem<br />
Fertigungsschritt viele Parameter einzustellen sind. Die<br />
Voraussetzung zur Umsetzung des Konzepts seien vollständig<br />
automatisierte Messsysteme, die jeder Werker<br />
ohne Vorkenntnisse bedienen kann.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 21
:: Mess- und Prüftechnik<br />
Inline, atline und offline einsetzten lässt sich der<br />
neue 3D-Sensor X-Gage3D von Isra Vision für die exakte<br />
3D-Formerfassung sämtlicher Merkmale eines Objekts<br />
wie Bohrlöcher oder Spaltmaße in nur einem Messdurchlauf.<br />
Die ermittelten Ergebnisse stehen per CAD-<br />
Abgleich sofort zur Verfügung. Ausgestattet mit vier<br />
hochauflösenden Kameras und einer Hochleistungs-<br />
LED erfasst der Quad-Kamera-Sensor alle Objektformen<br />
innerhalb kürzester Zeit und auch unter herausfordernden<br />
Bedingungen. Seine Multi-Stereo-Technologie gestattet<br />
eine besonders vollständige, ultrafeine Punktewolke,<br />
da stereometrische Aufnahmen mit sechs verschiedenen<br />
Kamerapaaren möglich werden. Durch die<br />
verschiedenen Kameraperspektiven werden zum Beispiel<br />
reflektierende Bereiche nicht unscharf, da sie aus<br />
einem anderen Blickwinkel optimal bestimmt werden<br />
können.<br />
Produktion und Messtechnik ohne Bruch automatisiert<br />
Der Bruch in der Prozesskette der Automatisierung zwischen<br />
Produktion und Messtechnik hat Jenoptik mit<br />
zwei Partnerunternehmen veranlasst, eine automatisierte<br />
Lösung zu entwickeln: Ein optisches Wellenmessgerät<br />
der Opticline C305 wurde mit einem neuen Handlingsroboter<br />
mit Werkstückspeicher kombiniert. Diese<br />
kompakte Einheit wurde von Jenoptik in Zusammenarbeit<br />
mit den Firmen Erler, Dormettingen, und Viktor Hegedüs,<br />
Wehingen, geplant und realisiert. Die Kombination<br />
optischer Wellenmesstechnik und automatisierter<br />
Roboterbeladung ermöglicht eine sekundenschnelle Inspektion<br />
zahlreicher Prüfmerkmale. Das Spannmittel Fixator<br />
von Hegedüs lieferte die Grundlage für eine zuverlässige<br />
Aufnahme von Teilen aller Geometrien.<br />
Wenn Wälzlager, Prüfstifte und Grenzlehrdorne mit<br />
hoher Genauigkeit gemessen werden müssen, bieten<br />
sich Laser Scan Mikrometer von Mitutoyo an. Das neue<br />
Modell LSM-6902H bietet einen Messbereich von 0,1 bis<br />
25 mm. Im Verbund mit den optionalen verstellbaren<br />
Haltersätzen ermöglicht es das hochgenaue Messen der<br />
Außendurchmesser von Prüfstiften und Grenzlehrdornen.<br />
Es bietet eine Linearität über den gesamten Messbereich<br />
von ±0,5 μm sowie ±(0,3+0,1∆) μm in der Teilmessstrecke.<br />
Die Wiederholpräzision beträgt 0,045 μm<br />
über den vollen Messbereich (25 mm Durchmesser) und<br />
0,03 μm für die Teilmessstrecke (10 mm Durchmesser).<br />
Mit 1.600/s wurde die Scanrate des neuen Geräts gegenüber<br />
der des Vorgängers verdoppelt.<br />
Werth hat die 3D-Mess-Software Winwerth um eine<br />
Funktion zur Integration von Produktfertigungsinformationen<br />
(PMI) ergänzt: Mit 3D-PMI lassen sich nun<br />
Messablaufpläne erstellen. Viele CAD-Systeme bieten<br />
mittlerweile die Möglichkeit, PMI-Daten zu integrieren.<br />
Die hieraus resultierenden CAD-Datensätze enthalten<br />
dann zusätzlich zur Geometriebeschreibung der CAD-<br />
Elemente auch die vom Konstrukteur festgelegten Bemaßungen<br />
inklusive Toleranzen und Bezugselementen.<br />
Diese Informationen bilden nun das Grundgerüst zur<br />
Erstellung des Messablaufplans mit der neuen Funktion<br />
3D-PMI der Mess-Software Winwerth.<br />
■<br />
Flexibel durch mobile Messarme<br />
Mobile Messarme sind ein bewährtes Mittel, um in der Produktion flexibel zu messen. So hat Hexagon seine Romer Absoule<br />
Arm Produktreihe modernisiert. Dabei fällt das modulare Handgelenk-Design auf: Sowohl der RS5–Laserscanner als auch der<br />
Pistolengriff sind nun vollständig abnehmbar und erleichtern dadurch das Tasten auf engstem Raum. Bei Laserscanner-Anwendungen<br />
mit Pistolengriff gewährleisten die drei verschiedenen Griffgrößen eine optimale Handhabung für jeden Nutzer.<br />
Das Display am neuen Armgelenk bietet Übersicht über die Messergebnisse. Durch<br />
das Umschalten zwischen Profilen wie auch die Kalibrierung im laufenden Messbetrieb<br />
kann sich der der Anwender völlig auf die Messung konzentrieren. Die neuen<br />
Modelle des Absolute Arm sind auch als Ausführung mit sechs Achsen er hältlich,<br />
die für spezielle Tastanwendungen entwickelt wurde.<br />
Neu bei Faro ist ein 8-Achsen-System. Die achte Achse ermöglicht dabei die Drehung<br />
des Messobjekts in Echtzeit. Das System kombiniert den portablen Quantum<br />
Faroarm oder den Quantum Scanarm mit einer funk tional integrierten, aber physisch<br />
getrennten achten Achse. Bei der achten Achse handelt es sich um eine vollständige<br />
Drehachse. Sie lässt sich direkt mit dem Faroarm verbinden und wird so<br />
zu einer nahtlos integrierten, hoch genauen Zusatzachse, die keinerlei weitere Einrichtungszeit<br />
oder Installationsarbeiten bedarf.<br />
Das 8-Achsen-System von Faro kombiniert einen portablen<br />
Messarm mit einer funktional integrierten,<br />
aber physisch getrennten achten Achse Bild: Faro<br />
22 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
Industrie<br />
Das Kompetenznetzwerk der Industrie<br />
Hier könnte Ihr<br />
Firmenprofil stehen.<br />
Fordern Sie Ihr<br />
Angebot an!<br />
Im digitalen QUALITY GUIDE 2018 geben wir einen umfassenden Überblick über die aktuellen<br />
Management- und Technologietrends, welche die Qualitätssicherung aktuell bestimmen – und<br />
die wichtigsten Partner dahinter. Präsentieren Sie sich umfassend und ganzjährig mit Ihrem<br />
individuellen Technologieprofil im Markt. Einstieg jederzeit möglich!<br />
+ Verbreitung über qe-online.de und keosk.de + Verbreitung über Newsletter<br />
Der QUALITY GUIDE 2018 wird während des gesamten<br />
Jahres 2018 aktualisiert und auf den Websites<br />
qe-online.de wie auch keosk.de präsentiert.<br />
Der QUALITY GUIDE 2018 wird mit regelmäßigen<br />
Newslettern im Markt verbreitet.<br />
<strong>Quality</strong> Engineering <strong>01.2019</strong> 23<br />
Wir beraten Sie gerne: media.industrie.de | media.industrie@konradin.de | +49 711 7594-552
:: Promotion<br />
Renishaw bietet Messtechnik für effizientere Fertigungsprozesse<br />
Der Schlüssel zu<br />
höherer Produktivität<br />
Präzisionsteile für Smartphones, Hochleistungs-Motorenaggregate und Turbinenschaufeln<br />
haben alle eines gemeinsam: Sie kamen im Laufe ihrer Produktion irgendwann mit Messtechnik<br />
von Renishaw in Berührung.<br />
Der Revo 5-Achsen-Messkopf<br />
besitzt die Fähigkeit,<br />
die Scanbewegung<br />
selbständig auszuführen.<br />
Dadurch verbessert sich<br />
der Messdurchsatz bei<br />
Koordinatenmessgeräten,<br />
die bisher mit 3-Achsen-Messtastersysteme<br />
arbeiteten, um bis zu<br />
900 %. Außerdem spart<br />
der Anwender damit im<br />
Vergleich zu herkömmlichen<br />
Dreh-/Schwenkköpfe,<br />
mehrere Stunden der<br />
Kalibrierzeit ein<br />
Bilder: Renishaw<br />
Toleranzen im Mikrometer-Bereich werden heute für diese<br />
Hightech-Bauteile gefordert. Damit eine Werkzeugmaschine Bauteile<br />
mit dieser Genauigkeit prozesssicher produzieren kann, benötigt<br />
diese allerdings zusätzliche Intelligenz. Dies leisten die Messtaster-<br />
und Prüfsysteme des Weltmarktführers für industrielle<br />
Messtechnik, Renishaw. Damit werden Nacharbeiten, Umarbeiten,<br />
Sonderfreigaben und Ausschuss reduziert. Zusätzlich wird der<br />
Durchsatz erhöht und die Produktionskosten nachhaltig gesenkt.<br />
Der systematische Ansatz von Renishaw bietet die Rahmenbedingungen<br />
zur Identifizierung und Eliminierung von Abweichungen<br />
innerhalb des Produktionsprozesses. Innovative Messtechnologien,<br />
bewährte Verfahren und eine weltweite Unterstützung durch die<br />
Experten von Renishaw machen dieses Konzept so erfolgreich.<br />
Die Prüf- und Messtechnik greift noch vor dem eigentlichen Bearbeitungsbeginn<br />
ein und über- prüft im Vorfeld die Leistungsfähigkeit<br />
der Maschine, um gegebenenfalls korrigierend ein- zugreifen.<br />
Damit werden ungeplante Standzeiten von vornherein eliminiert.<br />
Ein schnelles, automatisches und wiederholgenaues Einrichten des<br />
zu bearbeitenden Werkstücks und der Werkzeuge wird durch die<br />
vorbereitenden Kontrollen gewährleistet. Das automatisierte Einrichten<br />
kann bis zu zehn Mal schneller sein als herkömmliche manuelle<br />
Einrichtverfahren.<br />
Während der Zerspanung passen die regelnden Kontrollen die<br />
Routinen mittels automatischer Ergebnisrückführung an die tatsächlichen<br />
Material- und Umweltbedingungen an. Eine effektive Ergebnisüberwachung<br />
sorgt am Ende für eine schnelle, rückführbare<br />
Protokollierung der Zerspanungsoperationen und -ergebnisse.<br />
Die Kernkompetenzen von Renishaw liegen in den Bereichen<br />
Messtechnik, Motion Control, Spektroskopie, Präzisionsbearbeitung<br />
und der additiven Fertigung. Renishaw bietet seinen Kunden allerdings<br />
mehr als nur die reine Technik. Das Ziel ist die Entwicklung einer<br />
individuellen Komplettlösung, um die Leistungsfähigkeit zu ver-<br />
24 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
Promotion ::<br />
In weltweit verfügbaren<br />
Solutions Centern wie in<br />
Pliezhausen stellt Renishaw<br />
den Anwendern der<br />
additiven Fertigung sein<br />
Know-how zur<br />
Verfügung<br />
bessern – angefangen bei der verbesserten Produktionsleistung<br />
und erhöhten Produktqualität bis hin zur Maximierung der Forschungskapazitäten.<br />
Der taktile Messtaster löste eine Revolution im Maschinenbau aus<br />
Gegründet wurde Renishaw im Jahre 1973 von Sir David McMurtry<br />
und John Deer in der Grafschaft Gloucestershire in England. Mit der<br />
Erfindung des ersten taktilen Messtasters revolutionierte McMurtry<br />
die dreidimensionale Koordinatenmessung und ermöglichte eine<br />
äußerst präzise und wiederholgenaue Messung von Werkstücken.<br />
Der präzise Schaltvorgang direkt am Werkstück lässt keinen<br />
Spielraum mehr für Ablesefehler. Noch heute liegen die Vorteile der<br />
taktilen Messtechnik gegenüber optischen Methoden in der sehr<br />
hohen Genauigkeit, der guten Zugänglichkeit der von außen schwer<br />
sichtbaren Merkmale sowie in der Unabhängigkeit von den Oberflächen-<br />
und Materialeigenschaften des Werkstücks. Die taktile Messtechnik<br />
ist daher noch immer ein unverzichtbares Instrument in der<br />
Fertigung und Qualitätssicherung.<br />
Renishaw sieht sich seit seiner Gründung der Forschung und Entwicklung<br />
stark verpflichtet und investiert rund 18 % des Jahresumsatzes<br />
in diesem Bereich. Dies ermöglichte es, das Produktportfolio<br />
stetig zu erweitern: Messtaster für die Automatisierung von CNC-<br />
Werkzeugmaschinen und zur Werkstückmessung, berührungslose<br />
Weg- und Winkelmesssysteme für hochgenaues Motion Control,<br />
Laserinterferometer zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit von<br />
Maschinen und additive Fertigungssysteme, um nur einige Beispiel<br />
zu nennen, gehören heute zu den umfangreichen Produkten von Renishaw.<br />
Mit ausgereifter Prozesskette für additive Fertigung zum Erfolg<br />
Der 3D-Metalldruck eröffnet neue Chancen, innovative Bauteilkonzepte<br />
wirtschaftlich und kurzfristig zu realisieren. Renishaw bietet<br />
hier mit den weltweit verfügbaren Solutions Centern eine einzigartige<br />
Einstiegs-Chance für Nutzer der additiven Technologie. Das betrifft<br />
speziell das Laserschmelzverfahren auf Metallpulverbasis, wie<br />
es Renishaw in seinen Fertigungssystemen verwendet. In einem<br />
kontinuierlichen Schichtaufbauprozess entstehen aus feinem Metallpulver<br />
nahezu beliebige Geometrien sowie topologisch oder bio-<br />
nisch optimierte Formen. Dies gelingt inzwischen prozesssicher mit<br />
einer Vielzahl an Metallen, zum Beispiel mit Titan, Stahl-, Nickelund<br />
Leichtmetalllegierungen. Um jedoch von den Vorteilen zu profitieren,<br />
erfordert es im Vergleich zu bisherigen Produktionsprozessen<br />
grundlegend andere Vorgehensweisen als mit der substraktiven<br />
zerspanenden Fertigung. Deshalb müssen Fertigungstechniker in<br />
der gesamten Prozesskette umdenken.<br />
Das betrifft das Bauteilkonzept, die Detailkonstruktion, die Programmierung<br />
der Fertigungsabläufe, das additive Verfahren auf der<br />
Maschine und die Nachbearbeitung der gefertigten Bauteile. In seinem<br />
aktuell fertiggestellten Solutions Center Nähe Stuttgart stellt<br />
Renishaw Anwendern nunmehr ein ganzheitliches Konzept zur Verfügung.<br />
Interessenten können sogenannte Mietzellen nach einer<br />
ausführlichen Unterweisung in die Systemtechnik und die Grundlagen<br />
der Additiven Fertigung eigenständig nutzen, um selbst die gesamte<br />
Prozesskette vom Design und der Konstruktion bis hin zur<br />
Nacharbeit zu verwirklichen. Die Spezialisten von Renishaw stehen<br />
jederzeit mit unterstützenden Leistungen, Beratung und Service zur<br />
Verfügung.<br />
■<br />
Renishaw<br />
Adresse:<br />
Renishaw GmbH<br />
Karl-Benz-Straße 12<br />
72124 Pliezhausen<br />
www.renishaw.com<br />
Mitarbeiterzahl: 4000<br />
Jahresumsatz: 536,6 Millionen Pfund<br />
Kontakt:<br />
verkauf@renishaw.com<br />
Produkte: industrielle Messtechnik, Motion Control,<br />
Spektroskopie<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 25
:: Promotion<br />
Umweltsimulationsanlagen für Forschung, Entwicklung und QS von Weiss Umwelttechnik<br />
Test it, heat it, cool it<br />
Extreme Hitze oder große Kälte – während Herstellung, Transport, Lagerung und Gebrauch<br />
müssen Produkte unterschiedlichsten Umweltbedingungen standhalten. Mit ihren Umwelt -<br />
simulationsanlagen bietet Weiss Umwelttechnik Industrie und Forschung innovative, erprobte<br />
und zuverlässige Technologien, um Produkte noch besser, langlebiger und sicherer zu machen.<br />
Maßgeschneiderte<br />
Emissions- und<br />
Leistungsprüfkammer<br />
mit Rollenprüfstand<br />
Bilder: Weiss Umwelttechnik<br />
Als ein Hersteller von Umweltsimulationsanlagen entwickelt<br />
und produziert Weiss Umwelttechnik Prüfsy -<br />
steme für unterschiedlichste Anforderungen. Das Leistungsspektrum<br />
reicht von Temperatur- und Klimatests<br />
über Vibrations-, Korrosions-, Emissions-, Höhen- und<br />
Druckprüfungen bis hin zu kombinierten Stressprü -<br />
fungen.<br />
Mit den Prüfsystemen können unterschiedlichste<br />
Umwelteinflüsse rund um den Erdball im Zeitraffer<br />
simuliert werden. Das zu prüfende Produkt wird dabei<br />
unter realer Belastung auf seine Funktionalität, Qua -<br />
lität, Zuverlässigkeit, Materialbeständigkeit und Lebensdauer<br />
untersucht.<br />
Neben Prüfschränken und -kammern in Serienausführung<br />
entwickelt und produziert Weiss Umwelttechnik<br />
kundenspezifische und prozessintegrierte Anlagen.<br />
Im Fokus stehen auch dabei immer präzise Prüfergebnisse<br />
mit höchster Reproduzierbarkeit, einfache Bedie-<br />
nung und eine hohe Energieeffizienz. Typische Anwendungsfelder<br />
finden sich zum Beispiel in der Elektronikund<br />
Automobilindustrie.<br />
Elektronik: Überall und überall sicher<br />
Elektronische Geräte dringen in sämtliche Lebensbereiche<br />
vor. Vom Smartphone über intelligente Waschmaschinen<br />
bis zu Wearables, ganzheitlich vernetzten Fahrzeugen<br />
und Satellitensteuerungen – überall sind Sensoren,<br />
Chips, Konnektoren und andere Elektronikkomponenten<br />
verbaut. Diese müssen perfekt zusammenspielen<br />
und in jeder Situation absolut zuverlässig funktionieren.<br />
Um dies jederzeit zuverlässig sicherzustellen, bietet<br />
Weiss Umwelttechnik eine breite Auswahl an Prüfschränken<br />
und -kammern, die Umwelteinflüsse aller Art<br />
im Zeitraffer simulieren.<br />
26 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
Promotion ::<br />
Batterien sicher testen<br />
Dadurch lassen sich mögliche Risiken und Schwachstellen<br />
bereits während der Produktentwicklung erkennen<br />
und für die spätere Serienfertigung ausschließen.<br />
Aber auch bei Produktion und Qualitätssicherung kommen<br />
diese Prüfsysteme zum Einsatz, damit nur einwandfreie<br />
Produkte das Werk verlassen.<br />
Automotive: Innovationen nehmen Fahrt auf<br />
Klimaprüfschrank<br />
Clime Event für<br />
Batterieprüfungen<br />
Die Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen.<br />
Mit innovativen Antriebskonzepten wie batteriebetriebenen<br />
Elektromotoren, Hybridsystemen,<br />
Brennstoffzellen und Wasserstoffantrieben muss sie die<br />
Emissionen reduzieren. Gleichzeitig eröffnet die Vernetzung<br />
von Fahrzeugen neue Fahr- und Entertainmentmöglichkeiten<br />
und ebnet den Weg für teil- oder vollautomatisierte<br />
Mobilität.<br />
Damit diese neuen Systeme und Materialien serienreif<br />
werden und sicher im Auto der Zukunft eingesetzt<br />
werden können, müssen die Automobilindustrie und ihre<br />
Zulieferer neue Wege gehen. Dabei müssen auch die<br />
Entwicklungs- und Produktionsprozesse sowie die damit<br />
verbunden Prüfprozesse umgestellt werden.<br />
Als langjähriger Partner der Automobilindustrie<br />
kennt Weiss Umwelttechnik die Herausforderungen<br />
durch steigende Anforderungen und verkürzte Entwicklungszeiten<br />
und unterstützt die Branche mit maßgeschneiderten<br />
Prüfständen. Unter anderem mit der Simulation<br />
von Luftströmungen, extremen Höhen oder<br />
großen Temperaturschwankungen sorgen diese dafür,<br />
dass je nach Anforderung einzelne Komponenten und<br />
Komplettfahrzeuge von der Arktis über die Tropen bis in<br />
die Wüste sicher funktionieren.<br />
Mit dem Megatrend E-Mobilität wächst die Bedeutung<br />
von besonders leistungsstarken elektrischen Speichersystemen<br />
wie Lithium-Ionen-Batterien. Damit steigen<br />
auch die Anforderungen an deren Sicherheit und Zuverlässigkeit.<br />
Um das einwandfreie Funktionieren der Speicher sicher<br />
zu gewährleisten, werden diese unter unterschiedlichsten<br />
Bedingungen getestet. Zu den üblichen Prüfungen<br />
gehören beispielsweise standardmäßige State-of-<br />
Charge (SoC) Temperatur- und Klimatests sowie weitere<br />
Tests unter extremen thermischen, klimatischen und<br />
mechanischen Bedingungen. Weiss Umwelttechnik bietet<br />
hier Prüfkammern von der erprobten Standardlösung<br />
bis zur maßgeschneiderten Großanlage inklusive<br />
Rollenprüfstand.<br />
Mit steigender Energiedichte nimmt bei Batterietests<br />
auch das Risiko von Überlastungen und Fehlfunktionen<br />
bis hin zur Zerstörung der Batterien zu. Damit<br />
Mitarbeiter, das Labor und alle darin befindlichen Gegenstände<br />
optimal geschützt sind, stattet Weiss Umwelttechnik<br />
die Prüfsysteme bedarfsgerecht mit umfangreichen<br />
Sicherheitseinrichtungen aus.<br />
Diese Einrichtungen sollen unkontrolliertes Verhalten<br />
verhindern und die Auswirkungen eines Störfalls<br />
von vorne herein so klein wie möglich halten. Dazu gehören<br />
beispielsweise Messeinheiten zur Überwachung<br />
der Gaskonzentration und -zusammensetzung, Branddetektoren<br />
sowie Warn- und Druckentlastungseinrichtungen.<br />
Für den Fall einer Explosion wird bei der Konstruktion<br />
des Prüfraums auf eine druckresistente Ausführung<br />
und verstärkte Verschlüsse geachtet.<br />
■<br />
Adresse:<br />
Weiss Umwelttechnik<br />
Weiss Umwelttechnik GmbH<br />
Greizer Straße 41–49<br />
35447 Reiskirchen<br />
www.weiss-technik.com<br />
Kontakt:<br />
info@weiss-technik.com<br />
Produkte: Umweltsimulationsanlagen, Industrie -<br />
öfen, Reinräume, Klimatisierung, Luftentfeuchtung,<br />
Reinluft- und Containment-Anlagen<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> 27
:: Promotion<br />
Hochgenaue Zahnräder und Verzahnungsmessgeräte von Frenco<br />
Auf den Zahn gefühlt<br />
Messtechnik für Lauf- und Passverzahnungen wie zum Beispiel Wälzscannen,<br />
Zweiflankenwälzprüfgeräte oder die universelle Rotationsmessung von Wellen – Frenco ist<br />
spezialisiert auf hochgenaue Zahnräder und Verzahnungsmessgeräte.<br />
Das Verzahnungsmessgerät Wälzscanner<br />
ist für große Serien ausgelegt. Frenco<br />
ist weltweit der einzige Anbieter eines<br />
Messgeräts dieser Art Bild: Frenco<br />
Video<br />
Wie der Walzscanner funktioniert,<br />
zeigt Frenco in diesem Video<br />
Frenco ist ein weltweit anerkannter Spezialist für Verzahnungsmesstechnik.<br />
Das Unternehmen wurde 1978<br />
in Nürnberg/Fischbach von Rudolf Och gegründet. Nach<br />
zehn Jahren des Aufbaus siedelte es in das damals noch<br />
wesentlich kleinere Gebäude der Rummelsberger Anstalten<br />
in der Jakob-Baier-Straße in Altdorf um.<br />
Seit seiner Gründung hat sich Frenco von einem Hersteller<br />
von einfachen Prüfmitteln für Zahnräder zu einem<br />
Systemanbieter und Spezialisten auf dem komplexen<br />
Gebiet der prozessintegrierten Qualitätssicherung<br />
von Verzahnungen entwickelt . Neben Verzahnungslehren<br />
und Lehrzahnrädern entstehen hier komplette<br />
Messgeräte für Verzahnungen, zum Beispiel für Getriebehersteller<br />
wie ZF, Getrag oder Daimler. Aber auch Hersteller<br />
von Fahrwerken und Lenkungen wie GKN, Harmonic<br />
Drive oder Robert Bosch Automotive Steering<br />
zählen zu den weltweiten Kunden der Firma.<br />
Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden,<br />
beschäftigt Frenco derzeit 70 Mitarbeiter, die sich in den<br />
Bereichen Konstruktion, Feinbearbeitung, Montage,<br />
Softwareentwicklung und Qualitätssicherung auf ihre<br />
Aufgaben spezialisiert haben.<br />
Frenco ist mittelständisch, unabhängig und legt<br />
Wert auf eine gute Beziehung zu Mitarbeitern, Lieferanten<br />
und Kunden. So kommen immer wieder nationale<br />
und internationale Kunden nach Altdorf, um an Schulungen<br />
und Seminaren teilzunehmen oder um an Richtlinien<br />
und Normen zu arbeiten, für die sich Frenco sehr<br />
stark engagiert.<br />
Das Unternehmen setzt auf Flexibilität und ist offen<br />
für Diskussionen, Anregungen und neue Wege. Grundlagenforschung,<br />
die Zusammenarbeit mit Instituten<br />
und kooperierenden Partnerfirmen sowie das Spezialistenwissen<br />
sind die Basis für eine innovative und zukunftsorientierte<br />
Technik.<br />
■<br />
Adresse:<br />
Frenco GmbH<br />
Jakob-Baier-Straße 3<br />
90518 Altdorf<br />
www.frenco.de<br />
Kontakt:<br />
frenco@frenco.de<br />
Frenco<br />
Produkte: Messtechnik für Lauf- und Passverzahnungen, Wälz -<br />
scannen, verzahnte Höchstpräzision, Zweiflankenwälzprüfgeräte,<br />
Messlehren und Zweikugelmaßerfassung, universelle Rotations -<br />
messung von Wellen, Dakks-akkreditiertes Prüflaboratorium<br />
28 <strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
API versteht sich als Hersteller, Solution Partner und Dienstleister<br />
Alles aus einer Hand<br />
Nur wenige Messdienstleister können behaupten, auch Hersteller<br />
der mobilen laserbasierten 3D-Messsysteme zu sein, mit denen sie die<br />
Messdienst leistung durchführen. API hat die Erfahrung und liefert<br />
Erge bnisse, denen man vertrauen kann.<br />
Video<br />
Mobil und flexibel – die Vorteile des Lasertrackers OT2<br />
Core im Video<br />
XD Laser – ein multidimensionales<br />
Messsystem zum gleichzeitigen Er -<br />
fassen aller 6 Freiheitsgrade (6DoF)<br />
einer Linearachse Bild: API<br />
Die Produktpalette der 1987 gegründeten<br />
Automated Precision Inc. umfasst u. a. moderne<br />
Mess- und Sensorsysteme wie Lasertracker,<br />
berührungslose 3D Scanner sowie<br />
Messsysteme zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit<br />
von Bearbeitungsmaschinen.<br />
Die Kompetenz von API belegt die Erfindung<br />
des selbstverfolgenden Laserinterferometers,<br />
auf dem die Lasertracker-Technologie<br />
basiert. Die Produkte von API sind<br />
bei allen Global Playern der Fertigungsindustrie<br />
installiert und werden im Automotive-Bereich,<br />
in der Luft- und Raumfahrttechnik,<br />
im Maschinenbau sowie von Herstellern<br />
von Koordinaten-Messmaschinen eingesetzt.<br />
Wenn es eine Kategorie gibt, in der die<br />
Vorzüge mobiler 3D-Messsysteme sofort ins<br />
Auge springen, so sind es die Serviceeinsätze,<br />
zu denen Lasertracker vermehrt herangezogen<br />
werden. Ein kompakter API Lasertracker<br />
mit Zubehör kann im Kofferraum eines<br />
PKWs transportiert werden, jedoch sind<br />
es meist die Verhältnisse beim Kunden vor<br />
Ort, die aufgrund des beschränkten Platzangebots<br />
ein möglichst mobiles und kompaktes<br />
System erfordern. Dabei sind es nicht<br />
nur Inspektionen, Inbetriebnahmen, Revisionen<br />
und Reparaturen, die ausgeführt<br />
werden. Beispielsweise müssen große Maschinen<br />
auf 0,1 mm genau auf ihr Fundament<br />
zurückgestellt werden. Insbesondere<br />
beim Ausrichten von Maschinen mit einer<br />
vorgegebenen Genauigkeit von wenigen<br />
hundertstel Millimetern erreicht man durch<br />
den Einsatz eines Lasertrackers ganz erhebliche<br />
Zeiteinsparungen.<br />
API ist in der Lage, sowohl taktile als auch<br />
berührungslose messtechnische Anforderungen<br />
mit den eigenen Systemen schnell<br />
zu lösen.<br />
Schulungs- und Beratungsangebote –<br />
Lernen von den Profis<br />
Die API Academy bietet themenübergreifende<br />
Grund- und Aufbauschulungen sowie<br />
kundenspezifische Schulungen – auch vor<br />
Ort. Besonders durch das Beratungsangebot<br />
und die Unterstützung bei der Implementierung<br />
von Messprozessen profitieren Kunden<br />
von APIs langjähriger Erfahrung.<br />
Der XD Laser von API ist ein mehrdimensionales<br />
Lasermesssystem zur schnellen<br />
Fehlerauswertung von Bearbeitungsmaschinen.<br />
Schnelle und genaue Messungen<br />
der Maschinenposition und -rotation ermöglichen<br />
eine vollständige Begutachtung<br />
des Maschinenzustands.<br />
Der am häufigsten zu ersetzende Teil einer<br />
Maschine ist die Spindel. Dies ist keine<br />
Überraschung, wenn man bedenkt, dass sie<br />
auch der Teil der Maschine ist, welcher oftmals<br />
den größten Belastungen ausgesetzt<br />
ist. API bietet mit dem Spindle Analyzer ein<br />
System zur Diagnose und Wartung von<br />
Werkzeugmaschinen mit einer Spindel -<br />
achse an.<br />
Zu allen Systemen liefert API die Software<br />
zur Kontrolle, Datenerfassung und<br />
Berichterstattung mit. Systemengpässe<br />
können regional mit Mietsystemen von<br />
API überbrückt werden. Wartungsverträge<br />
und die verlängerte Herstellergarantie<br />
runden das Rundum-Sorglos-Paket ab. Im<br />
Zuge von Wartungen und Instandhaltung<br />
stellt API die Systemperformance sicher und<br />
gewährleistet somit Prozesssicherheit für<br />
den Kunden.<br />
■<br />
Adresse:<br />
API<br />
Automated Precision Europe GmbH<br />
Im Breistpiel 17<br />
69126 Heidelberg<br />
www.apisensor.com<br />
Mitarbeiterzahl: 350<br />
Kontakt:<br />
info.eu@apisensor.com<br />
Produkte: Lasertracker, berührungslose 3D Scanner,<br />
Messsysteme zur Verifizierung/Kalibrierung von Bearbeitungsmaschinen,<br />
Zubehör und Rundum-Service<br />
<strong>Quality</strong> Engineering <strong>01.2019</strong> 29
Industrie<br />
ISSN 1436-2457<br />
Das<br />
Kompetenz-<br />
Netzwerk<br />
der Industrie<br />
18 Medienmarken für alle wichtigen<br />
Branchen der Industrie<br />
Information, Inspiration und Vernetzung<br />
für Fach- und Führungskräfte in der Industrie<br />
Praxiswissen über alle Kanäle:<br />
Fachzeitschriften, Websites, Events,<br />
Newsletter, Whitepaper, Webinare<br />
Herausgeberin:<br />
Katja Kohlhammer<br />
Verlag<br />
Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH<br />
Ernst-Mey-Straße 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen,<br />
Germany<br />
Geschäftsführer:<br />
Peter Dilger<br />
Verlagsleiter:<br />
Peter Dilger<br />
Chefredakteur:<br />
Dipl.-Ing. (FH) Werner Götz, Phone +49 711 7594-451<br />
Redaktion:<br />
Sabine Koll, Markus Strehlitz<br />
Redaktionsassistenz:<br />
Daniela Engel, Phone +49 711 7594-452<br />
E-Mail: qe.redaktion@konradin.de<br />
Layout:<br />
Vera Müller, Phone +49 711 7594-422<br />
Gesamtanzeigenleiter:<br />
Joachim Linckh, Phone +49 711 7594-565<br />
E-Mail: joachim.linckh@konradin.de<br />
Auftragsmanagement:<br />
Annemarie Olender, Phone +49 711 7594-319<br />
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 37 vom 1.10.2018<br />
Leserservice<br />
Ute Krämer, Phone +49 711 7594-5850,<br />
Fax +49 711 7594-15850<br />
E-Mail: ute.kraemer@konradin.de<br />
<strong>Quality</strong> Engineering erscheint 4 x jährlich. Bezugs preise:<br />
Inland 68,40 € inkl. Versand kosten und MwSt.; Ausland:<br />
68,40,- € inkl. Versandkosten. Einzelverkaufspreis: 17,20 €<br />
inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten.<br />
Sofern die Lieferung nicht für einen bestimmten Zeitraum<br />
bestellt war, läuft das Abonnement bis auf Widerruf.<br />
Bezugszeit: Das Abonnement kann erstmals vier Wochen<br />
zum Ende des ersten Bezugsjahres gekündigt werden.<br />
Nach Ablauf des ersten Jahres gilt eine Kündigungsfrist von<br />
jeweils vier Wochen zum Quartalsende.<br />
Bei Nichterscheinen aus technischen Gründen oder höherer<br />
Gewalt entsteht kein Anspruch auf Ersatz.<br />
Auslandsvertretungen:<br />
Großbritannien: Jens Smith Partnership, The Court, Long<br />
Sutton, GB-Hook, Hampshire RG29 1TA, Phone 01256<br />
862589, Fax 01256 862182, E-Mail: media@jens.demon.<br />
co.uk; Switzerland IFF media ag, Frank Stoll, Technoparkstrasse<br />
3, CH-8406 Winterthur, Tel: +41 52 633 08 88, Fax:<br />
+41 52 633 08 99, e-mail: f.stoll@iff-media.ch; Japan:<br />
Media house Inc., Teiko Homma, Kudankita 2-Chome Building,<br />
2-3-6, Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102, Phone<br />
03 3234–2161, Fax 03 3234–1140, E-Mail: homma@me<br />
diahs.com; USA: D.A. Fox Advertising Sales, Inc. Detlef Fox,<br />
5 Penn Plaza, 19th Floor, New York, NY 10001, Phone<br />
+1 212 8963881, Fax +1 212 6293988, detleffox@com cast.<br />
net<br />
Gekennzeichnete Artikel stellen die Meinung des Autors,<br />
nicht unbedingt die der Redaktion dar. Für unverlangt eingesandte<br />
Berichte keine Gewähr.<br />
Eingesandte Manuskripte unterliegen der evtl. redak -<br />
tionellen Kürzung oder Erweiterung. Korrekturabzüge<br />
können leider nicht zur Verfügung gestellt werden.<br />
Alle in <strong>Quality</strong> Engineering erscheinenden Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen,<br />
vorbehalten. Reproduktionen, gleich welcher Art, nur<br />
mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.<br />
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.<br />
Druck:<br />
Konradin Druck GmbH, Leinfelden-Echterdingen<br />
Printed in Germany<br />
© 2019 by Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Leinfelden-Echterdingen<br />
Die passenden Medien für Sie<br />
und Ihre Branche:<br />
konradin.de/industrie<br />
media.industrie.de<br />
Kooperationspartner:<br />
AFQ Akademie für<br />
Qualitätsmanagement<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong>
C A M S y s t e m<br />
TECHNIK FÜR GEWINDE<br />
Industrie<br />
Das Kompetenznetzwerk der Industrie<br />
Einladung zum<br />
50 Technologieführer<br />
präsentieren ihre<br />
Innovationen 2019<br />
21. März 2019<br />
09:00 bis 17:00 Uhr<br />
Kongresshalle | Böblingen<br />
Es erwarten Sie<br />
5 parallel stattfindende Vortragssessions:<br />
Werkzeugmaschinen & Industrie 4.0<br />
Werkzeuge<br />
Robotik & Automation<br />
Maschinenelemente & Automation<br />
Additive Manufacturing<br />
Informative Begleitausstellung<br />
Networking auf Augenhöhe<br />
Jetzt<br />
anmelden!<br />
Jetzt anmelden auf: www.mav-online.de<br />
oder per E-Mail an: innovationsforum@konradin.de<br />
Bitte beachten Sie, dass bei der Anmeldung per E-Mail weitere Bestätigungsschritte notwendig sind.<br />
Bild: Hahn + Kolb<br />
Unsere<br />
Partner<br />
2019<br />
SOFLEX<br />
<strong>Quality</strong> Engineering <strong>Guide</strong> <strong>01.2019</strong> <strong>01.2019</strong> 31