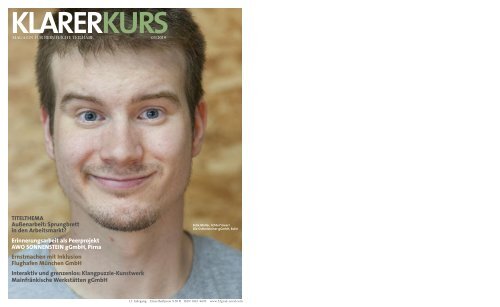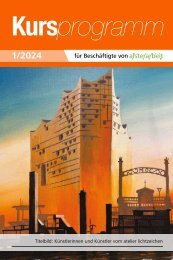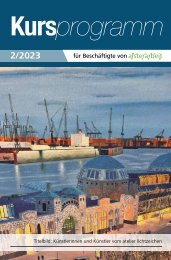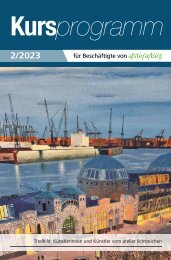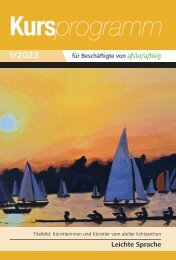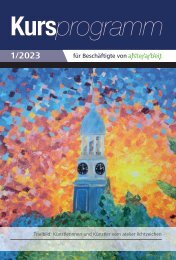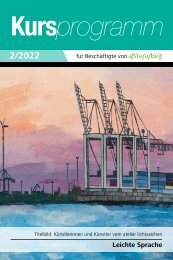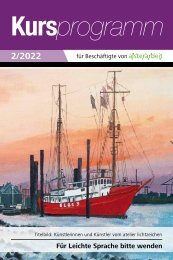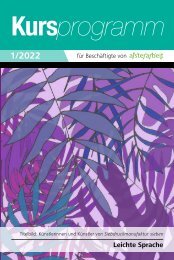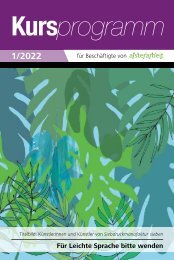Klarer Kurs 0319
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KLARERKURS<br />
MAGAZIN FÜR BERUFLICHE TEILHABE 03/2019<br />
TITELTHEMA<br />
Außenarbeit: Sprungbrett<br />
in den Arbeitsmarkt?<br />
Erinnerungsarbeit als Peerprojekt<br />
AWO SONNENSTEIN gGmbH, Pirna<br />
Ernstmachen mit Inklusion<br />
Flughafen München GmbH<br />
Interaktiv und grenzenlos: Klangpuzzle-Kunstwerk<br />
Mainfränkische Werkstätten gGmbH<br />
Felix Müller, lichter°meer/<br />
Die Ostholsteiner gGmbH, Eutin<br />
12. Jahrgang Einzelheftpreis 9,50 € ISSN 1867-6693 www.53grad-nord.com
FRAGEN/<br />
Was macht Sie stark?<br />
/INHALT/<br />
/EDITORIAL/<br />
24<br />
Tischlampe<br />
Boje: lichter°meer/<br />
Die Ostholsteiner,<br />
Eutin<br />
20<br />
Gelebte Vielfalt: Flughafen München GmbH<br />
▲ „Mein Ehrenamt, weil ich dadurch Anerkennung und<br />
Wertschätzung erfahre. Und mein Kampf mit meiner psychischen<br />
Erkrankung macht mich auch stark“<br />
ERIK VOGEL, EU-RENTNER, DRESDEN<br />
▲ „Wenn ich bei der Diakonie Neustadt behinderte Menschen<br />
bei Urlaubsfahrten unterstütze oder wenn ich mit ihnen koche<br />
und bastle und sie dabei Spaß haben, das macht mich stark“<br />
▲ „Positive Begegnungen machen mich stark. Meine Familie<br />
und das Gefühl von Zugehörigkeit“<br />
IRIS HELBIG, BERUFSBILDUNGSBEREICH DER AWO PIRNAER WERKSTÄTTEN<br />
▲ „Wenn ich weiß, dass ich meine sieben Sinne zusammen<br />
hab’, dass ich weiß, was ich mache und wie ich es mache“<br />
MICHAEL SKALDA, WERKSTATT EISFELD/AUSSENARBEITSPLATZ<br />
▲ „Mein Umfeld macht mich stark – meine Freunde, Bekannten<br />
und professionellen Begleiter. Und mein Selbstbewusstsein, das<br />
ich durch meine Beraterarbeit gewonnen habe“<br />
02<br />
04<br />
06<br />
12<br />
16<br />
20<br />
24<br />
28<br />
32<br />
36<br />
37<br />
38<br />
42<br />
43<br />
Was macht Sie stark?<br />
Aktuelles<br />
TITELTHEMA<br />
Der Außenarbeitsplatz: Sprung in den Arbeitsmarkt?<br />
Wie kann Vermittlung aus der WfbM in eine dauerhafte<br />
Festanstellung gelingen?<br />
BILDUNG<br />
Sprechen über den Massenmord<br />
AWO SONNENSTEIN gemeinnützige GmbH, Pirna<br />
„Die App bereichert einfach den Bildungsalltag“<br />
OWB Oberschwäbische Werkstätten gem. GmbH, Mengen<br />
ARBEIT<br />
„Wenn die Firma es wirklich will, kann das klappen<br />
mit der Inklusion“<br />
Flughafen München GmbH<br />
Ein eigenes Lichtermeer<br />
Die Ostholsteiner gGmbH, Eutin<br />
ENTWICKLUNG<br />
Gelebte Inklusion<br />
Osnabrücker Werkstätten der Heilpädagogischen Hilfe<br />
Die entscheidende Herausforderung<br />
Strategisches Personalmanagement und der Anpassungsdruck<br />
von Werkstätten<br />
Interview mit Martin Ossenberg, Iserlohner Werkstätten gGmbH<br />
Was und wie viel verdienen Werkstattbeschäftigte?<br />
Gastkommentar: Dr. Jochen Walter<br />
„Man muss immer das Beste daraus machen!“<br />
Mein Arbeitsplatz: Michael Skalda<br />
Die verbindende Kraft des Klangs<br />
Mainfränkische Werkstätten gGmbH, Würzburg<br />
Comic: Workman<br />
Impressum<br />
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, das Titelthema dieser<br />
Ausgabe schaut darauf, wie Vermittlungen aus der<br />
Werkstatt in dauerhafte Festanstellung gelingen können.<br />
Sind Außenarbeitsplätze dabei hilfreich? Ein Blick<br />
in die Statistik ist ernüchternd: Trotz 20 000 bis 25 000<br />
Einzel- und Gruppenaußenarbeitsplätzen liegen die<br />
Übergangszahlen in feste Beschäftigung immer noch bei<br />
unter 0,2 Prozent. Was hindert also an der Vermittlung<br />
und was bedeutet das für Außenarbeitsplätze? Ab Seite 6<br />
Unter dem Titel „Sprechen über den verdrängten<br />
Massenmord“ berichten wir über ein außerordentliches<br />
Projekt der AWO Sonnenstein in Pirna: Dort werden<br />
Menschen mit Beeinträchtigungen zu Peer-Referenten<br />
ausgebildet, die in Leichter Sprache an die „Euthanasie“-<br />
Morde in Pirna erinnern und durch die Gedenkstätte<br />
Sonnenstein führen. Ab Seite 12<br />
Inklusion in der Arbeitswelt − nur eine Wunschvorstellung<br />
von „Gutmenschen“? Nein, meint die Flughafen<br />
München GmbH und setzt auf gelebte Vielfalt im<br />
Unternehmen selbst. Wie ihr besonderes Konzept aussieht,<br />
erfahren Sie ab Seite 20.<br />
Außerdem schauen wir bei den Oberschwäbischen<br />
Werkstätten in Mengen zu, die die Leichter-Lesen-App<br />
von Capito im Berufsbildungsbereich einsetzen. Mit der<br />
App entscheiden Leser selbst, auf welchem von vier<br />
Sprachniveaus sie Texte lesen möchten. Und wir besuchen<br />
„Die Ostholsteiner“: Die Werkstatt ist jetzt mit<br />
einer neuen Produktlinie unter dem Namen lichter°meer<br />
− fein designte, besondere Leuchten − am Markt.<br />
Wir berichten über „gemischte Gruppen“ bei den<br />
Osnabrücker Werkstätten, in denen Menschen mit Behinderung<br />
aus Tagesförderstätte und Werkstatt gemeinsam<br />
arbeiten. Wir sprechen mit Martin Ossenberg,<br />
Geschäftsführer der Iserlohner Werkstätten, über das<br />
wichtige Zukunftsthema Personalmanagement.<br />
Und eine<br />
besondere Klangreise führt<br />
uns nach Würzburg. Aber<br />
lesen Sie selbst!<br />
Wir wünschen entspannte<br />
wie interessante Lektüre!<br />
PETRA KIEHLE, EU-RENTNERIN, PIRNA<br />
BIRGER HOHN, BERATER BEI DER ERGÄNZENDEN UNABHÄNGIGEN<br />
TEILHABEBERATUNG (EUTB) DRESDEN<br />
GRID GROTEMEYER<br />
02 M E I N U N G E N<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
I N H A L T / E D I T O R I A L<br />
03
AKTUELLES<br />
Grenzenlos Kultur: Rimini Protokoll/Helgard Haug mit „Chincilla Arschloch, waswas“<br />
Grenzenlos Kultur vol. 21 − Theaterfestival in Mainz<br />
Rudolf-Freudenberg-<br />
Preis 2020<br />
DER RUDOLF-FREUDENBERG-PREIS steht 2020 unter<br />
dem Motto „Konzepte zur Beschäftigung von Menschen<br />
mit seelischer Behinderung in Inklusionsunternehmen“.<br />
Mit diesem Schwerpunkt richten sich<br />
die bag if und die Freudenberg Stiftung an Inklusionsunternehmen,<br />
die erfolgreich einen hohen Anteil<br />
von Menschen mit seelischer Behinderung<br />
beschäftigen und bereit sind, ihre Erfahrungen an<br />
Dritte weiterzugeben. Unternehmenskonzepte, die<br />
Inklusionsfirmen bis zum 15. Dezember 2019 einreichen<br />
können, sollten Rahmenbedingungen und<br />
Faktoren darstellen, die zur erfolgreichen Beschäftigung<br />
dieser Zielgruppe beitragen. Der Preis ist mit<br />
5 000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am<br />
18. März 2020 in Dortmund im Rahmen der LWL-<br />
Messe der Inklusionsunternehmen und der CEFEC-<br />
Konferenz der bag if statt. Weitere Informationen:<br />
www.bag-if.de/rudolf-freudenberg-preis/ ❚<br />
Kämpfer für die Interessen der<br />
Werkstattbeschäftigten.<br />
Zum Tod von Martin Kisseberth<br />
WAS IST HEIMAT? Ein Land, eine Region? Das<br />
Vertraute, das Überschaubare? Die 21. Ausgabe<br />
von Grenzenlos Kultur steht unter der<br />
Frage, was „Heimat(en)“ für uns heute bedeuten<br />
– auch und gerade für Menschen mit<br />
Behinderung. Mit dabei unter anderem: Rimini<br />
Protokoll, RambaZamba, Theater<br />
Thikwa und das Künstlerinnenkollektiv<br />
CONNECT 2018 – 2020<br />
04 A K T U E L L E S<br />
hannsjana, Stephanie van Batum und Stacyian<br />
Jackson. Ebenso i can be your translator<br />
und Dennis Seidel. Und weil an den<br />
Theatern in Bezug auf Barrierefreiheit oft<br />
viel Luft nach oben ist, berichten im Festival-<br />
Symposium Theater barrierefrei gestalten<br />
Expertinnen und Experten mit und ohne Behinderung<br />
von ihrer gelebten Erfahrung mit<br />
KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER mit Behinderungen<br />
sind auch in Deutschland seit Jahrzehnten<br />
eine feste Größe. Bislang allerdings<br />
haben sich hauptsächlich die sozialen Träger<br />
dafür stark gemacht, die Kunst behinderter<br />
Menschen in allen Sparten zu fördern. Berührungspunkte<br />
mit Kulturinstitutionen gibt es<br />
nur vereinzelt und zum größten Teil projektbezogen.<br />
Damit Künstlerinnen und Künstler mit<br />
einer Behinderung verstärkt im Kulturbetrieb<br />
präsent sind, müssen Begegnungen stattfinden,<br />
von denen beide Seiten profitieren können.<br />
Genau das will CONNECT, ein von eucrea<br />
gestartetes Projekt: In Hamburg, Niedersachsen<br />
und Sachsen kooperieren Künstlergruppen<br />
aus Einrichtungen für Menschen mit<br />
Behinderungen in allen Sparten der Kunst<br />
mit Museen, Kunstvereinen, Schauspielhäusern,<br />
freien Spielstätten und anderen Kulturhäusern<br />
und erproben Formen der Zusammenarbeit.<br />
Ihre Künstlerische Prozesse<br />
dokumentieren sie in Werkpräsentationen,<br />
Ausstellungen und anderen öffentlichen Formaten.<br />
Angestrebt wird dabei eine langfristige<br />
Zusammenarbeit zwischen Künstlergruppen<br />
und Kulturinstitutionen. Im Juni<br />
2020 steht ein bundesweiter Summit auf der<br />
Agenda. Informationen:<br />
www.eucrea.de/connect-2018-2020 ❚<br />
der barrierefreien Gestaltung von Theater.<br />
Sie diskutieren über Audiodeskription, Gebärdensprachdolmetschen,<br />
Leichte Sprache,<br />
Rollstuhlzugänglichkeit und Relaxed Performances.<br />
Das Theaterfestival findet vom 12.<br />
bis 22. September 2019 im Staatstheater<br />
Mainz statt. Informationen:<br />
www.grenzenlos-kultur.de/ ❚<br />
Neue REHADAT-Publikationen<br />
zur Teilhabe<br />
REHADAT hat zwei neue Wissensreihen veröffentlicht:<br />
„Ich sehe das einfach anders“ thematisiert<br />
die berufliche Teilhabe von<br />
Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit.<br />
„Klare Sprache statt Klischees“ informiert<br />
über die Situation von Menschen mit<br />
Autismus im Berufsleben. REHADAT hat im<br />
Vorfeld Befragungen von betroffenen Menschen<br />
durchgeführt, deren Ergebnisse in die<br />
Broschüren eingeflossen sind. Die Wissensreihen<br />
beantworten Fragen wie: Welche Grundinformationen<br />
über die Behinderung sind im<br />
Arbeitsleben von Bedeutung? Wie können Arbeitsplätze<br />
gestaltet werden? Welche Maßnahmen<br />
sind sinnvoll? Was für Hilfsmittel<br />
können eingesetzt werden? Welche Tipps<br />
geben Fachleute und Betroffene? Wer kann<br />
Betriebe und Beschäftigte unterstützen? Die<br />
REHADAT-Wissensreihen und die Ergebnisse<br />
der Umfragen finden sich unter:<br />
http://rehadat.link/publikationen ❚<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
LWL informiert online und<br />
am Telefon zum BTHG<br />
WEIL SICH MIT DEM BTHG wichtige Zuständigkeiten<br />
ändern, bietet der Landschaftsverband Westfalen-<br />
Lippe (LWL) auf zwei Wegen Unterstützung für<br />
Menschen mit Behinderung an: Eine Internetseite<br />
bietet Antworten auf Fragen rund um das BTHG in<br />
leicht verständlicher Sprache. Ein weiterer Bereich<br />
der Seite richtet sich mit Informationen insbesondere<br />
an gesetzliche Betreuer. Für Leistungserbringer<br />
und andere Experten stehen darüber hinaus umfangreiches<br />
Hintergrundwissen und weitergehende<br />
Erläuterungen zur Verfügung. Das zweite Angebot<br />
des LWL ist eine Telefon-Hotline. Dort kann jeder anrufen,<br />
der Fragen zum BTHG hat, egal ob persönlich<br />
Betroffener, Angehöriger oder Inklusionsexperte.<br />
Das geschulte Personal wird Fragen im Vorfeld klären<br />
und so auch die Hilfeplaner des LWL entlasten.<br />
Das LWL-Wissensportal zum BTHG ist abrufbar<br />
unter www.bthg2020.lwl.org. Die Telefon-Hotline<br />
ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr unter<br />
0251 5915115 erreichbar. ❚<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
LIEBER MARTIN KISSEBERTH, ich spreche dich heute mit „du“ an, obwohl<br />
wir das zeitlebens nie taten. Irgendwie hatten wir den richtigen Zeitpunkt<br />
dazu verpasst.<br />
Du hast Mitte Juni dieses Jahres nach einer sich schnell entwickelnden<br />
Krankheit den Planeten verlassen. Zu schnell und zu plötzlich, um das<br />
wirklich begreifen zu können. Als gelernter Rettungssanitäter hast du vielen<br />
Menschen helfen können, nur dir selbst nicht so recht. Seit Jahren<br />
konnten wir beobachten, wie du dich manchmal leicht, doch meist mit<br />
großer Anstrengung durch die Bundesrepublik bewegtest, um dich für die<br />
in Werkstätten beschäftigten Menschen einzusetzen. Du fehlst.<br />
In deine Klugheit, deine Ausdrucksfähigkeit und deine Zielstrebigkeit<br />
haben viele Menschen mit Behinderung ihre Hoffnungen gesetzt und<br />
dich in wichtige Vertretungspositionen gewählt. Als Vorsitzender Gesamtwerkstattrat<br />
ELBE und LAG Werkstatträte Hamburg sowie als Vorstand<br />
Werkstatträte Deutschland hast du beste Interessenvertretung<br />
gemacht, verhandelt, gestritten, referiert. Auf all diesen Ebenen sind wir<br />
uns in unseren jeweiligen Funktionen auf Augenhöhe begegnet, fast<br />
immer miteinander, ja und auch mal gegeneinander. Wir haben uns respektiert<br />
und gemocht, so wie es dir mit deinen GesprächspartnerInnen<br />
meist auch erging. Dein Wort zählte. Du fehlst.<br />
Die Stärkung der Stellung der Werkstatträte im neuen Bundesteilhabegesetz<br />
und die Finanzierung der Werkstatträte Deutschland zählen zu<br />
deinen großen Engagements und Erfolgen. Den geplanten gemeinsamen<br />
Vortrag zu den neuen Vermittlungsstellen können wir nun nicht mehr<br />
halten. Du fehlst.<br />
Als gebürtige Hessen teilten wir die Liebe zum Regional-/Ex-Bundesligaverein<br />
Kickers Offenbach, du fanatischer als ich. Vor allem bewahre ich<br />
deinen wunderbaren Humor, dein verschmitztes Lächeln und deine klare<br />
Sicht der Dinge als Bild von dir in mir. Das bleibt. ANTON SENNER ❚<br />
A K T U E L L E S<br />
05
TITELTHEMA/VERMITTLUNG<br />
Wie kann Vermittlung<br />
aus<br />
der WfbM in<br />
eine dauerhafte<br />
Festanstellung<br />
gelingen?<br />
Der Außenarbeitsplatz:<br />
Sprungbrett in den<br />
ersten Arbeitsmarkt?<br />
AUSSENARBEITSPLÄTZE, Betriebsintegrierte Arbeitsplätze, Betriebsintegrierte<br />
Beschäftigung − viele Bezeichnungen und alle meinen<br />
dasselbe: ausgelagerte Werkstattplätze in Betrieben des ersten<br />
Arbeitsmarkts. Sie gibt es schon sehr lange, ihre Funktion: Wahlmöglichkeiten<br />
zu eröffnen und Werkstattbeschäftigten den Weg zu<br />
erleichtern, von der Werkstatt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung<br />
zu wechseln. Außenarbeit im Portfolio einer Werkstatt<br />
erhöht die Attraktivität bei ihren Kunden, den Menschen mit Behinderung,<br />
und gilt als unverzichtbar für den Erhalt der Konkurrenzfähigkeit<br />
spätestens dann, wenn sich Andere Anbieter in der<br />
Nachbarschaft niederlassen. Viele, aber nicht alle Werkstätten haben<br />
inzwischen einen „virtuellen“ Bereich aufgebaut, manche sogar mit<br />
einem Anteil von bis zu 30 oder 35 Prozent. Die Zahl ist allerdings<br />
mit Vorsicht zu genießen, nicht immer geben Werkstätten an, was sie<br />
als Außenarbeitsplatz werten: auch eine Stelle im werkstatteigenen<br />
Café oder in einer in der ganzen Stadt eingesetzten Gartengruppe?<br />
Die BAG WfbM erhebt zurzeit die Anzahl von Außenarbeitsplätzen,<br />
endgültige Ergebnisse liegen noch nicht vor. Es zeichnet sich aber ab,<br />
dass sich die Anzahl zwischen 20 000 und 25 000 Gruppen- und Einzelaußenarbeitsplätzen<br />
bewegt. Das sind ca. 8 Prozent der etwa<br />
280.000 Beschäftigten im Arbeitsbereich. In vielen Bundesländern<br />
regeln die Leistungsträger mit Zielvereinbarungen, wie viele Außenarbeitsplätze<br />
und/oder Übergänge Werkstätten schaffen müssen.<br />
Doch trotz Positivtrend in der Außenarbeit steigen die Zahlen der<br />
Übergänge bundesweit kaum an, liegen sie immer noch bei unter 0,2<br />
Prozent. Was ist also dran an den Außenarbeitsplätzen?<br />
06 T I T E L T H E M A<br />
ERSTES KONZEPT<br />
DER AUSSENARBEITSPLÄTZE<br />
Hessen war das erste Bundesland, das sie bereits 1986 einführte.<br />
Anders als heute waren sie auf maximal zwei Jahre befristet, spätestens<br />
dann sollte eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung<br />
folgen. Sie waren ebenso wie Werkstätten nicht als<br />
Dauereinrichtungen geplant. Parallel dazu finanzierte der Landeswohlfahrtsverband<br />
(LWV) zusätzliche Stellen für ‚Fachkräfte für<br />
Außenarbeitsplätze‘ neben dem regulären Personalschlüssel der<br />
Werkstätten, die solche Außenarbeitsplätze akquirierten und dort<br />
die Werkstattbeschäftigten auch begleiteten. Magnus Schneider,<br />
ehemaliger Geschäftsführer der Lebenshilfe Gießen und damals<br />
im Vorstand der hessischen LAG WfbM, erinnert sich: „Schon damals<br />
wurde klar, dass das Modell nicht so funktioniert, wie wir<br />
uns das gedacht hatten. Es gab zwar jede Menge Außenarbeitsplätze,<br />
aber nur wenig Übergänge in reguläre Verhältnisse. Die<br />
Beschäftigten auf Außenarbeitsplätzen hatten sich allerdings gut<br />
integriert. Bei strenger Auslegung des Konzepts hätten die Beschäftigten<br />
nach zwei Jahren wieder zurückgemusst in die Werkstatt,<br />
weil die Betriebe sie nicht übernahmen.“ Das wollte<br />
niemand und so schaffte man die zeitliche Befristung ab und<br />
führte das Modell unter dem Namen ‚Arbeiten im Verbund‘ weiter.<br />
Seit einer Gesetzesänderung 2008 gelten Außenarbeitsplätze<br />
als dauerhaft ausgelagerte Werkstattplätze. Doch trotz grundsätzlicher<br />
Entfristung verfehlte dieses Modell sein Ziel: Außenarbeitsplätze<br />
blieben bis auf wenige Ausnahmen Dauerzustand, die i<br />
i Übergänge kaum beförderten. Die Gründe dafür liegen vor allem<br />
in der Struktur der Werkstätten.<br />
DIE ZIELKONFLIKTE<br />
DER WERKSTATT<br />
Werkstätten müssen drei Ziele verfolgen, die sich gegenseitig stören:<br />
u Sie sollen als rehabilitative „Durchgangseinrichtung“ Menschen<br />
mit Behinderung qualifizieren, fördern und befähigen, im ersten<br />
Arbeitsmarkt zu arbeiten.<br />
u Sie sollen betriebswirtschaftlich organisiert sein, wie Wirtschaftsbetriebe<br />
arbeiten und 70 Prozent des Gewinns als Arbeitsentgelt<br />
an die Beschäftigten ausschütten.<br />
u Und sie haben die Aufgabe der Vermittlung: Sie sollen Beschäftigte<br />
aus der Werkstatt möglichst in sozialversicherungspflichtige<br />
Beschäftigung bringen.<br />
Nimmt man den Vermittlungsauftrag ernst, leidet darunter der<br />
„Wirtschaftsbetrieb Werkstatt“: Wenn viele leistungsfähige Menschen<br />
mit Behinderung die Werkstatt in Richtung Arbeitsmarkt<br />
verlassen, läuft die Werkstatt Gefahr, nicht mehr konkurrenzfähig<br />
zu sein. Denn Leistungsträger sichern die Produktivität der Werkstatt,<br />
die die immer anspruchsvolleren Aufträge immer schneller<br />
„in time“ erledigen müssen. Die Leistungsträger sorgen zugleich<br />
mit ihrer Arbeit dafür, dass auch Leistungsschwächere ein Arbeitsentgelt<br />
über dem Grundbetrag erhalten. Würden die Beschäftigtenzahlen<br />
wegen der Übergänge zurückgehen, so die Befürchtung<br />
vieler Werkstätten, drohe obendrein Personalabbau, weil die Fachkraftstellen<br />
nicht mehr refinanziert seien. Werkstätten haben also<br />
ein ökonomisches Eigeninteresse am „Behalten“ ihrer Beschäftigten<br />
und allen voran ihrer Leistungsträger, bilanziert Manfred Gehrmann*<br />
1 . Auf Außenarbeitsplätzen bleibt den Werkstätten zumindest<br />
der meist nur geringfügig gekürzte Kostensatz erhalten.<br />
Das widersprüchliche Tripelmandat der Werkstätten hindert sie<br />
daran, sich als Übergangseinrichtung zu begreifen, die Menschen<br />
mit Behinderung, die noch nicht oder noch nicht wieder regulärer<br />
Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt nachgehen können, genau<br />
dazu durch Rehabilitation befähigt. Ein Verbleib in WfbM, ein auf<br />
Dauer angelegter Werkstattplatz war vom Gesetzgeber nur für die,<br />
die nicht im ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, vorgesehen. Dieser<br />
differenzierte Personenkreis wurde, schreibt Detlef Springmann,<br />
Geschäftsführer der Lebenshilfe Braunschweig, 2013 in seinem Artikel<br />
Die Zukunft der Werkstatt: Werkstätten als Übergangseinrichtung*<br />
2 , „in vielen Werkstätten (…) auf ein einziges Merkmal<br />
reduziert: auf die unterstellte Unmöglichkeit, jemals erwerbsfähig<br />
zu sein. Das ist eine Bankrotterklärung für Qualität und Wirkung<br />
ihrer Eingliederungsleistungen.“ Die Antizipation der Unmöglichkeit<br />
scheint den dauerhaften Verbleib in der Werkstatt zu legitimieren<br />
ebenso wie die Behauptung, Menschen mit Behinderung und<br />
Werkstattfähigkeit könnten allenfalls auf Außenarbeitsplätzen in<br />
Betrieben des ersten Arbeitsmarkts arbeiten. Für die „Dauerhaftigkeit“<br />
macht Springmann drei andere Gründe aus: Die Organisation<br />
Werkstatt habe Vorrang vor dem Individuum, die Veränderungsbereitschaft<br />
bei Werkstattträgern und Leitungen sei ungenügend und i<br />
07<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9 K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9 T I T E L T H E M A
i<br />
das unbekannte Neue führe zur Furcht vor dem Abbruch einer<br />
langjährigen realen oder vermeintlichen Stabilität, alles dazu angetan,<br />
„um Werkstatt als Dauereinrichtung zu konservieren und abzusichern“.<br />
Der Fehler liege darin, dass Werkstätten wie Wirtschaftsbetriebe<br />
geführt würden. Um ökonomisch „überlebensfähig“<br />
zu sein, darf sich Werkstatt also nicht als rehabilitative Übergangseinrichtung<br />
begreifen, müssen Werkstattbeschäftigte als dauerhaft<br />
voll erwerbsgemindert gelten und auch Außenarbeitsplätze als dauerhafte<br />
angelegt sein.<br />
FORDERUNGEN<br />
AN DIE POLITIK<br />
Um die Werkstätten aus ihrem Zielkonflikt zu befreien, ist politischer<br />
Veränderungswille gefragt. Das BTHG stellt zwar das<br />
Belange von Menschen mit Behinderung, auf die Fahnen geschrieben.<br />
Neben einer Reform der Werkstättenverordnung lassen sich indes<br />
konkrete Schritte seitens der Werkstätten unternehmen, ihrem „Ur-<br />
Auftrag“ beizukommen. Wie Organisationsstruktur der Werkstatt<br />
und Vermittlungserfolge zusammenhängen, beschreibt Malte Teismann<br />
unter anderem in einem Gastkommentar für KLARER KURS<br />
2/2019: Es brauche grundsätzlich eine „Geschäftsführung, die den<br />
(Re)Habilitationsauftrag fordert und fördert. Um die bestehenden<br />
Zielkonflikte zu minimieren und die Zahl der Übergänge zu erhöhen,<br />
empfiehlt sich eine klare Trennung der Organisationsformen.“<br />
Das bedeutet, die Werkstatt braucht einen eigenständigen Fachdienst,<br />
dessen Aufgabe die Vermittlung ist und zwar unabhängig<br />
von den Zwängen, unter denen das Werkstattpersonal, Sozialarbeiter<br />
i<br />
kennenlernen. Den Arbeitgebern machen die Jobcoachs gleich zu<br />
Anfang klar: Ziel ist immer die Übernahme in sozialversicherungspflichtige<br />
Arbeit. „Nach vier Wochen kann ein Handwerksmeister<br />
sagen, ob es klappt oder nicht. Wenn ja, folgt ein Langzeitpraktikum“,<br />
berichtet Carsten Raters, Jobcoach beim Caritas-Verein, „und<br />
dann das Gespräch übers Budget für Arbeit.“ Entscheidend ist,<br />
meint Sinnigen, dass im BBB bereits Veränderung als Zustand und<br />
nicht Dauerhaftigkeit wie in der WfbM gelebt werde, das entwickle<br />
eine Eigendynamik: „Der Teilnehmer weiß, nach 27 Monaten ist<br />
hier Schluss. Dann geht sein Nachbar ins Praktikum, auch der<br />
nächste und ein anderer ist im Langzeitpraktikum. Und dann will er<br />
auch in einem Betrieb arbeiten.“<br />
Außenarbeitsplätze sind das Mittel der Wahl im Arbeitsbereich:<br />
Erst Praktikum, dann Außenarbeitsplatz und spätestens nach einem<br />
sere Nachhaltigkeit liegt bei 91 Prozent!“<br />
Das Besondere: Wedel nutzt von Beginn an<br />
für alle Vermittlungen den Eingliederungszuschuss<br />
nach SGB III. „Damit sind die Beschäftigten<br />
wirklich im Arbeitsmarkt und<br />
gelten als erwerbsfähig.“ Am Budget für<br />
Arbeit kritisiert er, dass Übergänger im<br />
SGB IX und damit in der vollen Erwerbsminderung verblieben. „Aus<br />
einem Budget heraus wird der Schritt in echte Erwerbsfähigkeit<br />
schwierig. Vor allem schwerstbehinderte Menschen sollten doch ins<br />
Budget kommen, und jetzt sind es in der Praxis wohl die, die man eigentlich<br />
anders vermitteln kann.“ Weil für Wedel grundsätzlich die<br />
Vermittlung das Ziel ist, sieht er die gängige Praxis skeptisch: „Ich<br />
warne immer vor unbefristeten Außenarbeitsplätzen, die sind schnell<br />
„Um Zielkonflikte zu minimieren und die Zahl der Übergänge zu erhöhen, empfiehlt sich eine klare Trennung der Organisationsformen“<br />
Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinderung in den<br />
Mittelpunkt, setzt auf Personenzentrierung statt auf eine Ausrichtung<br />
an den Interessen der Institution. Durch die Zulassung von<br />
Konkurrenz durch Andere Anbieter will man das Monopol der<br />
Werkstätten aufbrechen und mit dem Budget für Arbeit Übergänge<br />
in den ersten Arbeitsmarkt schaffen. Bislang aber ist die Umsetzung<br />
des neuen Gesetzes eher schleppend angelaufen, Nachbesserungen<br />
seitens Politik und Gesetzgebung stehen in vielen Punkten aus.<br />
Als Grund für die schlechte Vermittlungsquote wird oft die<br />
„fehlende Aufnahmebereitschaft des Arbeitsmarkts“ angeführt:<br />
Er gebe die Beschäftigung von voll erwerbsgeminderten Menschen<br />
nicht her, es gebe überdies kaum Arbeitsplätze mit einfachen<br />
Tätigkeiten, die Menschen mit Behinderung ausführen<br />
könnten. Dabei ließe sich die „Aufnahmebereitschaft“ beispielsweise<br />
durch drastische Erhöhung der Ausgleichsabgabe − eine<br />
politische Entscheidung − anstoßen: Noch können sich Wirtschaftsbetriebe<br />
von der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung<br />
durch ein „Taschengeld“ freikaufen. Die Anhebung der<br />
Ausgleichsabgabe haben sich viele Politiker von den Grünen bis<br />
zu Jürgen Dusel, dem Beauftragten der Bundesregierung für die<br />
und Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung, stehen: „Sobald<br />
man in seiner Arbeit Ziele und Umstände von anderen Kollegen, Arbeitsbereichen<br />
etc. mitdenken muss, wird Arbeit ineffizient und<br />
schwierig. Diejenigen, die dann darunter leiden, sind diejenigen, die<br />
von vornherein die geringste Macht im Prozess haben, nämlich die<br />
Beschäftigten.“ Organisatorisch „entkoppeltes“ Personal für die unterschiedlichen<br />
Ziele und geeignete Übergangsstrategien sind also<br />
für Werkstätten, die Beschäftigte in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln<br />
wollen, unabdingbar.<br />
VERMITTLUNG GEHT DOCH:<br />
ALTENOYTHE<br />
„Allein 18 Übergänge aus dem Berufsbildungs- und dem Arbeitsbereich<br />
ins Budget für Arbeit sind uns 2018 gelungen“, erzählt Ralf<br />
Sinnigen, Leiter des Berufsbildungsbereichs des Caritas-Vereins Altenoythe<br />
in Niedersachsen. In der Werkstatt arbeiten rund 800 Beschäftigte,<br />
etwa 100 Teilnehmer besuchen den BBB. Was macht den<br />
Erfolg aus? Der BBB verfügt über einen werkstattexternen Standort,<br />
pro Jahr absolvieren die Teilnehmer mindestens ein mehrwöchiges<br />
Praktikum und das, bevor sie die Produktionsbereiche der WfbM<br />
Jahr wird mit dem Arbeitgeber über das Budget gesprochen. Oberstes<br />
Ziel ihrer Arbeit ist die Vermittlung. Carsten Raters: „Das ist<br />
manchmal schwierig, denn wir brauchen auch gute Arbeit für die<br />
Menschen, für die es keine Alternative zur Werkstatt gibt. Intern<br />
haben wir die Unterstützung der Leitung, das wird mehr und mehr<br />
in der Werkstatt gelebt.“ Der Außenarbeitsplatz kann ein Sprungbrett<br />
in den ersten Arbeitsmarkt sein, wenn „man das Ziel der Vermittlung<br />
verfolgt. Wir schließen aber auch einen dauerhaften<br />
Außenarbeitsplatz nicht aus für den Personenkreis, dessen Leistungsfähigkeit<br />
dort erreicht ist. Denn unsere Ziele sind allein personenbezogen,<br />
nicht institutionell begründet.“<br />
VERMITTLUNG OHNE<br />
AUSSENARBEITSPLATZ<br />
Jemand, der es anders macht, ist Thomas Wedel, Geschäftsführer der<br />
Boxdorfer Werkstatt mit ca. 190 Beschäftigten in Berufsbildungsund<br />
Arbeitsbereich in Nürnberg und zuständig für das Thema Rehabilitation<br />
und Integration. Seit 20 Jahren vermittelt er Beschäftigte in<br />
sozialversicherungspflichtige Arbeit, ohne Außenarbeitsplätze oder<br />
Budget für Arbeit: „Mittlerweile sind es über 50 Personen und un-<br />
dauerhaft. Deshalb bieten wir gar keine an. Wenn man aber Außenarbeit<br />
macht, sollte man zumindest nach einem halben Jahr darüber<br />
reden, wie es weitergehen kann.“ Auch bei den Boxdorfern ist Veränderung<br />
Normalitätsprinzip: Jeder Beschäftigte kann jederzeit im<br />
Haus wechseln, drei Monate einen anderen Bereich ausprobieren<br />
und, wenn es passt, bleiben. „Der Wechsel, ob drinnen oder nach<br />
draußen, wird bei uns gelebt, da muss ich niemanden werben.“<br />
UNABHÄNGIGE<br />
FACHDIENSTE<br />
Unabhängige Fachdienste, die Menschen mit Behinderung in den<br />
ersten Arbeitsmarkt vermitteln, gibt es noch nicht viele in Deutschland.<br />
Aber dort, wo es sie gibt, schaffen sie sehr erfolgreich Wahlmöglichkeiten<br />
und Zugänge zum ersten Arbeitsmarkt und zeigen,<br />
dass auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf vermittelbar<br />
sind. Wie die Hamburger Arbeitsassistenz, die seit 27 Jahren Menschen<br />
mit Lernschwierigkeiten in feste Arbeitsverhältnisse vermittelt,<br />
wie ISA Initiative Sinnvolle Arbeit in Venne/Bramsche oder<br />
ACCESS in Nürnberg und Erlangen. Andrea Seeger, ACCESS-Geschäftsführerin,<br />
nutzt für die Vermittlung viele Instrumente wie das<br />
i<br />
i<br />
08 T I T E L T H E M A K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9 K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
T I T E L T H E M A 09
i<br />
Persönliche Budget, Unterstützte Beschäftigung<br />
und auch das Budget für Arbeit. Auch<br />
Beschäftigte aus Werkstätten begleiten die<br />
Fachdienstmitarbeiter in Betrieben über<br />
mehrere Monate in eng unterstützten<br />
Langzeit-Praktika. Ziel ist immer der Übergang,<br />
und anders als in Werkstätten ist der<br />
Außenarbeitsplatz „für uns nur das letzte Mittel“, sagt sie und fügt<br />
kritisch an: „Wenn für Werkstatt-Außenarbeitsplätze bei Arbeitgebern<br />
Stundensätze bis zum Mindestlohn in Rechnung gestellt werden,<br />
muss man sich fragen, was eigentlich davon abhält, einen<br />
regulären Arbeitsvertrag abzuschließen.“ Fachdienste vermitteln<br />
Menschen mit Lernschwierigkeiten sehr viel erfolgreicher als Werkstätten.<br />
Das mag vor allem daran liegen, dass sie auf keinen Werkstatt-Arbeitsbereich<br />
zurückgreifen können und sich deshalb viel<br />
inklusiver zu arbeiten, als ihnen das in einer Werkstatt möglich ist.<br />
Wir fragen uns manchmal aber schon, warum dann kein Übergang<br />
stattfindet, Menschen also zu lange auf einem Außenarbeitsplatz verweilen.“<br />
Wenn man den Zeitpunkt verpasst habe, zu dem ein Übergang<br />
vollzogen werden muss, setze ein Gewöhnungseffekt bei allen<br />
Beteiligten ein. Außerdem sei dann eine Übernahme für Arbeitgeber<br />
oftmals nicht mehr lukrativ: „Aus der finanziellen Perspektive eines<br />
Arbeitgebers erscheint der ausgelagerte Arbeitsplatz manchmal lukrativer<br />
als eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das<br />
kann dann ein Vermittlungshemmnis sein.“ Auch dass Menschen,<br />
die das Potenzial hätten, in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu<br />
wechseln, auf dauerhaften Außenarbeitsplätzen nur arbeitnehmerähnliche<br />
Rechte und damit deutlich weniger Rechte als die regulären<br />
Mitarbeiter haben, kritisiert Baar. Schlecht, wenn Außenarbeitsplätze<br />
in Konkurrenz zu sozialversicherungspflichtiger Arbeit stehen.<br />
i<br />
DIE BUDGETDECKELUNG<br />
IN HAMBURG<br />
Auch in Hamburg arbeitet der zuständige Leistungsträger, die Behörde<br />
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), mit<br />
Zielvereinbarungen. 2015 beschloss die Behörde mit den Elbe-<br />
Werkstätten eine Deckelung des Trägerbudgets und einen Abbau der<br />
Belegungszahlen. Anton Senner, damaliger Geschäftsführer der<br />
Elbe-Werkstätten erinnert sich: „Unser Gesamtbudget für alle Plätze<br />
wurde eingefroren. Die jährlich durch Kostensteigerung, Inflationsrate<br />
und Personalkostensteigerung entstehenden Mehrausgaben<br />
haben wir kompensiert durch einen Abbau von Plätzen. Bei im<br />
Schnitt angenommenen zwei Prozent Mehrkosten im Jahr mussten<br />
wir also zwei Prozent Plätze abbauen. Im ersten Jahr haben wir im<br />
Arbeitsbereich von 2 400 Plätzen 30 abgebaut. Und wir haben auch<br />
abgebaut, weil wir zunehmend Menschen ins Budget gebracht<br />
nur dann den Weg in Festanstellung, wenn die Werkstatt sie als Anfang<br />
einer Entwicklung und nicht als deren Ziel begreift: Voraussetzung<br />
ist der ernste Wille, zielstrebig und konsequent Übergänge zu<br />
schaffen. Die Einsicht beruht auch auf Erfahrungen aus einer zumeist<br />
als belebend empfundenen Konkurrenz: Denn dass die Elbe-<br />
Werkstätten schon lange im Thema Außenarbeit und Übergänge<br />
unterwegs sind, verdanken sie auch ihrem „Mitbewerber“ um die<br />
Gunst der Kunden: der Hamburger Arbeitsassistenz.<br />
FAZIT<br />
Um erfolgreich zu vermitteln, braucht es Macher, die sich auch persönlich<br />
engagieren, die Wünsche der Menschen mit Behinderung als<br />
Auftrag betrachten und sie mit Nachdruck verfolgen. Aufgrund ihrer<br />
Zielkonflikte aber tun sich Werkstätten schwer, Beschäftigte über Außenarbeit<br />
hinaus in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Das wird<br />
„Es müssen Strategien entwickelt werden, wie man Werkstattplätze sukzessive abbauen kann“<br />
klarer und entschiedener auf die Qualifizierung in Betrieben mit<br />
dem Ziel einer Festeinstellung ausrichten. In Städten wie Köln,<br />
Nürnberg oder Hamburg kooperieren die Fachdienste mit Werkstätten.<br />
Dort sind die Vermittlungszahlen deutlich höher als in anderen<br />
Regionen der Republik.<br />
STEUERUNG DURCH<br />
DEN LEISTUNGSTRÄGER<br />
Im Einzugsgebiet des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL),<br />
dem zuständigen Leistungsträger der Eingliederungshilfe, gibt es<br />
rund 2 500 Außenarbeitsplätze, eine Quote von 6,5 Prozent. Grundsätzlich<br />
legt der LWL mit jeder Werkstatt in einer Zielvereinbarung<br />
fest, wie viele Außenarbeitsplätze sie neu schaffen und wie viele<br />
Übergänge sie pro Jahr anbahnen muss. Außenarbeitsplätze können<br />
Sprungbretter in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sein,<br />
wenn sie zielgerichtet auf Übergänge angelegt und entsprechend begleitet<br />
würden, meint Hartmut Baar vom LWL-Inklusionsamt in<br />
Münster. „Natürlich werden Außenarbeitsplätze auch genutzt, um<br />
Menschen mit schweren Behinderungen die Möglichkeit zu geben,<br />
10<br />
Um dennoch möglichst viele Menschen mit Behinderung aus<br />
Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, setzt der LWL<br />
auf Integrationsfachdienste und unabhängige, qualifizierte Jobcoachs,<br />
die er auch selbst ausbildet. Der IFD ist von der Anbahnung<br />
bis zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz eingebunden,<br />
unterstützt den gesamten Prozess gemeinsam mit der Werkstatt und<br />
bleibt danach Ansprechpartner für die Betriebe. Die Begleitung und<br />
Unterstützung vor Ort übernehmen bei Bedarf Jobcoachs, beauftragt<br />
von den IFDs. Baar: „Wir machen auch entsprechende Zielvereinbarungen<br />
mit den Integrationsfachdiensten.“<br />
In Westfalen-Lippe setzt man also auf sanften Druck durch Zielvereinbarungen,<br />
mit denen man die Werkstätten in Bewegung bringen<br />
will, auf eine neue ganzheitliche Teilhabeplanung, die den<br />
Menschen in den Mittelpunkt rückt, und stärkt die Kooperation von<br />
Werkstätten und Integrationsfachdiensten. Ein Netz von freiberuflichen<br />
Jobcoachs, die vom IFD in den Übergangsprozess einbezogen<br />
werden, macht Sinn, Baar: „Mit unserem Konzept in Westfalen-<br />
Lippe sind wir erfolgreich, das werden wir nun gemeinsam mit den<br />
Werkstätten und den Integrationsfachdiensten weiter steigern.“ i<br />
haben.“ Ein Stellenabbau bei den Fachkräften ließ sich verhindern,<br />
weil die Werkstatt zugleich anerkannte Trägerin im Budget für Arbeit<br />
ist und die Menschen, die aus der Werkstatt ins Budget gehen,<br />
weiterhin betreut. Budget- und Platzzahl-Deckelung hatten zur<br />
Folge, dass die Werkstatt sich enorm bewegen musste und tatsächlich<br />
mehr und mehr Beschäftigte vermittelte. „Das hat bei uns in<br />
Hamburg gut funktioniert.“ Dass auf Dauer angelegte Außenarbeitsplätze<br />
nicht zu Übergängen führten, müsse man allerdings<br />
nicht nur den WfbM anlasten: Firmen, sagt Senner, hielten auch oft<br />
an Außenarbeit fest, weil ihnen dabei alles abgenommen würde, und<br />
auch die Eltern fänden sie gut, weil die Werkstatt als Option offen<br />
bliebe. Solchermaßen aufgestellte Außenarbeitsplaẗze zementierten<br />
aber das System. „Auch wenn der neue Staatenbericht der UN für<br />
Deutschland das harsche Urteil über die WfbM von 2017 zumindest<br />
abgemildert hat, müssen dennoch verbindliche Ausstiegsszenarien,<br />
zumindest Strategien entwickelt werden, wie man Werkstattplätze<br />
sukzessive abbauen kann.“<br />
Außenarbeitsplaẗze, konstatiert Sven Neumann, Koordinator Außenarbeit<br />
und Budget für Arbeit bei den Elbe-Werkstätten, eröffnen<br />
sich nicht ändern, solange das Prinzip der Dauerhaftigkeit für Werkstätten<br />
und Außenarbeit nicht infrage gestellt wird. Vermittlung wird<br />
mit der Werkstatt − von wenigen Leuchttürmen einmal abgesehen −<br />
nur unter spezifischen Bedingungen funktionieren: Es braucht den<br />
Druck der Leistungsträger, vor allem eine Platzzahlbegrenzung, wie<br />
das Beispiel Hamburg zeigt, damit sich Werkstätten bewegen und Beschäftigte<br />
in Betriebe des ersten Arbeitsmarkts vermitteln, auch um<br />
Platz zu schaffen für Nachrücker. Gleichzeitig braucht es ein flächendeckendes<br />
Netz unabhängiger Fachdienste, die Vermittlung zielstrebig<br />
verfolgen und damit endlich Wahlmöglichkeiten in der<br />
beruflichen Teilhabe und Alternativen zur Werkstatt für Menschen<br />
mit Behinderung schaffen. Und ja, eine nachhaltige Reform der<br />
Werkstättenverordnung ist längst überfällig. GG ❚<br />
ANMERKUNGEN<br />
*1 Manfred Gehrmann: Betriebe auf der Grenze. Integrationsfirmen und Behindertenwerkstätten<br />
zwischen Markt- und Sozialorientierung. Campus Verlag,<br />
Frankfurt/New York 2015<br />
*2 Detlef Springmann: Die Zukunft der Werkstatt: Werkstätten als Übergangseinrichtung.<br />
In: Teilhabe durch Arbeit. Ergänzbares Handbuch zur beruflichen Teilhabe von<br />
Menschen mit Behinderung. Lebenshilfe-Verlag, Marburg 2015<br />
T I T E L T H E M A K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9 K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9 T I T E L T H E M A<br />
11
BILDUNG/PEER-REFERENTEN<br />
Sprechen über<br />
den verdrängten<br />
Massenmord<br />
Verkohlte Mundharmonika als letztes Zeugnis eines Nazi-Opfers<br />
Iris Helbig, Erik Vogel, Birger Hohn und Melanie Wahl (v.l.) bei einer Probeführung<br />
➜ Thema: Menschen mit Beeinträchtigungen werden zu<br />
Peer-Referenten ausgebildet, die in Leichter Sprache<br />
an die „Euthanasie“-Morde in Pirna erinnern und durch<br />
die Gedenkstätte Sonnenstein führen<br />
➜ Einrichtung: AWO SONNENSTEIN gemeinnützige GmbH<br />
➜ Ort: Pirna<br />
12<br />
B I L D U N G : A W O S O N N E N S T E I N , P I R N A<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
GANZ UNTEN, hinter den dicken Mauern des kühlen Kellerlabyrinths<br />
im Haus C 16, endet die Spur der kleinen farbigen Kreuze<br />
am Boden. Kreuz neben Kreuz auf Straßenasphalt und Kopfsteinpflaster<br />
gesprüht, führt sie von der Elbe durch die Pirnaer Innenstadt<br />
kilometerweit hoch zur einstigen Heil- und Pflegeanstalt<br />
Sonnenstein und zielstrebig die Steinstufen hinab bis in den zweiten<br />
der hell gekalkten Kellerräume des ehemaligen Männerkrankengebäudes.<br />
„Hier war die Gaskammer, getarnt als Dusche.“ Iris<br />
Helbig umreißt mit beiden Händen eine imaginäre „Wand mit<br />
Fenster“, die in den 1940er Jahren den gut 20 Quadratmeter gro-<br />
i<br />
ßen Raum geteilt hatte. „Vor dem Fenster haben die Tötungsärzte<br />
zugeschaut, wie die Menschen im Gas gestorben sind.“ 13 720 psychisch<br />
kranke, geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen ließ<br />
Hitlers „Euthanasie“-Zentrale 1940/41 im Zuge der „Aktion T 4“<br />
als „lebensunwerte Esser“ an diesem Ort ermorden. Und in der<br />
Folge mehr als 1 000 KZ-Häftlinge. Die junge Frau aus dem Berufsbildungsbereich<br />
der Pirnaer Werkstätten auf dem Sonnenstein<br />
ist am düstersten Ort ihrer Führung angekommen. Dort, wo der zynische<br />
Nazi-Begriff „Tötungsanstalt“ schlagartig zur beklemmenden<br />
Realität wird.<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
Iris Helbig erklärt, wie das Gas eingeleitet und nach den Morden<br />
abgesaugt wurde. Zeigt, wo die Leichenverbrenner den Opfern Goldzähne<br />
herausbrachen, ehe sie sie in die beiden Verbrennungsöfen im<br />
Raum nebenan schoben, von denen die freigelegten Fundamente im<br />
Boden zeugen. Führt weiter zu den Vitrinen mit alten Knöpfen, verkohlten<br />
Prothesen, kleinen Taschenkämmen, einer verschmorten<br />
Mundharmonika – letzte persönliche Zeugnisse, die von den ermordeten<br />
Menschen geblieben sind. Es ist Iris Helbigs vierter „Probelauf“<br />
als angehende Peer-Referentin, die in Leichter Sprache durch die<br />
Dauerausstellung der Gedenkstätte führt und an die perfide Mord- i<br />
B I L D U N G : A W O S O N N E N S T E I N , P I R N A 13
i maschinerie in der zur Tötungsanstalt umgebauten ehemaligen Heilund<br />
Pflegeeinrichtung erinnert.<br />
Nazi-Vergangenheit in Leichter Sprache Gemeinsam mit der Historikerin<br />
und Projektkoordinatorin Melanie Wahl und drei weiteren angehenden<br />
Peer-Referenten führt Iris Helbig heute zehn ihrer<br />
Werkstattkollegen durch die Ausstellungsräume der Gedenkstätte, die<br />
unmittelbar neben den Pirnaer Werkstätten steht. Vor knapp einem<br />
Jahr hat ihre Trägerin, die AWO SONNENSTEIN gemeinnützige<br />
GmbH, in Kooperation mit der Stiftung Sächsische Gedenkstätten/Gedenkstätte<br />
Pirna Sonnenstein und gefördert von der Aktion Mensch<br />
das Peer-Ausbildungsprojekt aufgelegt. Menschen mit Behinderungen<br />
können sich innerhalb von drei Jahren zu Peer-Referenten ausbilden<br />
lassen, um anschließend als Honorarkraft die dunkle Geschichte des<br />
Orts in Leichter Sprache zu vermitteln.<br />
Es war ein Start bei Null, sagt die Projektkoordinatorin der AWO<br />
SONNENSTEIN, Melanie Wahl. Auch das Konzept sollte mit den Peers<br />
in spe gemeinsam erarbeitet werden. Melanie Wahl verfasste einen<br />
Infoflyer in Leichter Sprache, schrieb Werkstattträger, Sozialverbände<br />
und Förderschulen in der Region an, um interessierte Gedenkstättenführer<br />
zu gewinnen. Iris Helbig war als Erste dabei. Seit 2017 arbeitet<br />
sie im Berufsbildungsbereich Holz der Pirnaer Werkstätten der AWO:<br />
„Es ist mir wichtig, neben meinem Werkstattarbeitsplatz noch weitere<br />
Aufgaben zu haben. Es ist schön, wenn ich etwas für die Bildung tun<br />
und Geschichtswissen an meine Kolleginnen und Kollegen weitergeben<br />
kann.“ Viele, die seit Jahren in der Werkstatt unmittelbar neben der<br />
Gedenkstätte arbeiten, wüssten nichts von den Gräueln, die das Nazi-<br />
Regime und ihre willigen Helfer vor gerade mal knapp 80 Jahren an<br />
diesem Ort verübten, sagt sie. Wüssten nichts vom geheimen Umbau<br />
der einstigen Heil- und Pflegeanstalt zur Tötungsanstalt von Menschen<br />
mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. Für die AWO<br />
SONNENSTEIN ein wichtiges Motiv, das Peerprojekt zur Bildungsund<br />
Erinnerungsarbeit für Menschen mit Beeinträchtigungen anzustoßen.<br />
„In DDR-Zeiten haben wir in der Schule davon nichts gehört. Ich<br />
wollte mehr wissen“, sagt auch Petra Kiehle. So war die gehbehinderte<br />
EU-Rentnerin, die sich seit Jahren vielfältig bei Freizeitangeboten für<br />
behinderte Menschen engagiert, sofort dabei, als ihre Sozialarbeiterin<br />
von dem Ausbildungsprojekt erzählte. Erst nach 1989 wurde der fast<br />
vergessene Massenmord in Pirna zum Thema der öffentlichen Aufarbeitung,<br />
im Juni 2000 wurde die Gedenkstätte eröffnet. Sein Interesse<br />
an Geschichte und ein Besuch in der Gedenkstätte hat Erik Vogel zum<br />
Projekt stoßen lassen. Auch er ist EU-Rentner, engagiert sich unter anderem<br />
als Inklusionsbeauftragter der SPD in Dresden und als stellvertretender<br />
Landesvorsitzender der AG Selbst Aktiv. „Gerade jetzt, wo<br />
die Rechten wieder lautstark auf die Straße gehen, muss man alles tun,<br />
damit so etwas nicht wieder geschieht.“ Ähnlich formuliert es Birger<br />
Höhn, der als Berater bei der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung<br />
(EUTB) in Dresden arbeitet. Er hat „Bezugspunkte zur eigenen<br />
Familiengeschichte“, die ihn für das Peer-Projekt motiviert haben:<br />
„Mich bewegt das emotional alles sehr.“<br />
Geschichtsunterricht zur Vorbereitung Sieben ganz unterschiedliche<br />
Menschen – vom Förderschüler über die Werkstattbeschäftigte bis zum<br />
EU-Rentner – hat Melanie Wahl inzwischen in ihrer Projektgruppe<br />
versammelt. Im Dezember vorigen Jahres haben sie sich zum ersten<br />
Mal getroffen und im 14-Tages-Rhythmus die ganze Geschichte des<br />
Sonnensteins und der Nazi-Ideologie aufgerollt: angefangen bei der i<br />
14<br />
Iris Helbig ist das Bildungsangebot für ihre Kollegen wichtig<br />
Blick in die Kellerräume, wo früher die Verbrennungsöfen standen<br />
Peer-Referentin Petra Kiehle erzählt von den berüchtigten grauen Bussen<br />
i Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein, die 1811 eröffnet wurde und bis<br />
zur Machtergreifung Hitlers als reformpsychiatrische, moderne Vorzeige-Einrichtung<br />
galt. Sie befassten sich eingehend mit Sozialdarwinismus,<br />
der Hitlers Ideologie von „Rassenhygiene“ den Nährboden<br />
bereitete, mit Propagandamethoden der NSDAP und Begrifflichkeiten<br />
wie „Gnadentod“ oder „erbkrank“. In ihren „Geschichtsstunden“<br />
setzten sie sich damit auseinander, wie behinderte Menschen als „nutzlose<br />
Esser“ diffamiert, aus dem ganzen Land in grauen Bussen mit abgeklebten<br />
Scheiben in die vermeintlichen Heil- und Pflegeanstalten<br />
verfrachtet und von Ärzten begutachtet wurden, deren einzige Aufgabe<br />
es war, plausible Todesursachen zu definieren. Lernten, wie Helfer in<br />
Serie vorformulierte „Trostbriefe“ an Angehörige verfassten und vorgetäuschte<br />
Todesumstände erklärten.<br />
Viele der geschichtlichen Details hat die Gruppe in ihre ganz eigene<br />
Konzeption der Führungen in Leichter Sprache aufgenommen. Kein<br />
einfacher Stoff. Einige der propagandistischen, hetzerischen Begriffe<br />
sind auf den ersten Blick nicht leicht zu vermitteln. Alle Besucher bekommen<br />
vorsorglich zu Beginn der Führung einen kleinen roten Zettel<br />
mit der Aufschrift „Halt! Leichte Sprache“ in die Hand gedrückt.<br />
„Wer etwas nicht versteht, kann einfach den Zettel hochhalten.“ Iris<br />
Helbig und Melanie Wahl heften zu Beginn der Tour Papierschilder<br />
mit gegensätzlichen Wortpaaren an die Wand und fragen ihre Besucher<br />
nach Beispielen: Was ist nützlich, was nutzlos? Was minderwertig,<br />
„Was wäre geschehen, wenn ich<br />
einige Jahre früher geboren wäre?“<br />
ERIK VOGEL, ANGEHENDER PEER-REFERENT<br />
was höherwertig? Was lebenswert und lebensunwert? Klingt „Gnadentod“<br />
gut oder schlecht? Kurz darauf, im Dachgeschoss der Gedenkstätte,<br />
sind es nicht mehr die harmlosen Beispiele wie „Eimer<br />
ohne Boden“ oder „Strümpfe mit Löchern“, die die Besucher als „nutzlos“<br />
aufgezählt haben. Es sind reale Menschen mit Beeinträchtigungen,<br />
die mit ihrem Namen, in Bildern und Biografien lebendig werden<br />
und von den Nazis in die Kategorie „nutzlos“, „minderwertig“, „lebensunwert“<br />
sortiert wurden. Hier wird auch der harmlos klingende<br />
„Gnadentod“ zum gnadenlosen Mord.<br />
Iris Helbig und Melanie Wahl erzählen von den Menschen, von ihren<br />
Familienangehörigen, die sich sorgten, lesen aus den Trostbriefen vor,<br />
die sie erhielten, antworten auf entsetzte Fragen und betroffene Kommentare<br />
ihrer Gäste. Kurz darauf, unten im Keller, hält es Erik Vogel<br />
nicht mehr aus und muss ins Freie. „Was wäre geschehen, wenn ich einige<br />
Jahre früher geboren wäre?“ Eine Frage, die er sich immer wieder<br />
stellt, wenn er in der Gedenkstätte die Schicksale der Ermordeten anschaut,<br />
sagt er. „Vor allem die der Kinder, die ihr Leben noch vor sich<br />
hatten.“ Dass sich gerade auch Menschen mit Behinderungen mit der<br />
Nazi-Vergangenheit auseinandersetzen, hält er für wichtig, vor den<br />
Führungen, die er absehbar selbst halten wird, hat er allerdings „ganz<br />
schön Muffe“, gibt er zu.<br />
Drei Jahre Ausbildung Bis März 2021 läuft das Ausbildungsprojekt. Bis<br />
dahin sollen die Peers mit Faktenwissen und didaktischen Ansätzen so<br />
weit sein, dass sie immer zu zweit durch die Gedenkstätte führen und<br />
sich auch selbst organisieren, sagt Melanie Wahl. Noch feilen die angehenden<br />
Peer-Referenten an den Abläufen, setzen sich nach jeder Probeführung<br />
zusammen und besprechen mit Melanie Wahl, was gut oder<br />
weniger gut gelaufen, was noch verbessert werden könnte.<br />
Am Elbhang-Wald hinter der Gedenkstätte ist die Resonanz der Besuchergruppe<br />
aus den Pirnaer Werkstätten der AWO durchweg positiv.<br />
„Sehr traurig“, aber auch „sehr interessant“ lauten die Kommentare.<br />
Die Gäste spüren auch nichts von der Nervosität ihrer Guides. Dort, wo<br />
Hitlers Helfer unbeobachtet die Asche der verbrannten Opfer achtlos<br />
den Hang hinunter, zwischen die Bäume kippten, sind alle angehenden<br />
Referenten spontan mit Redebeiträgen an der Reihe. Jeder von ihnen<br />
hält die Kopie eines Ausstellungsdokuments hoch und fasst wesentliche<br />
Informationen zusammen oder stößt ein Gespräch darüber an.<br />
Am Ende der Tour setzen sich Besucher und Peers zusammen, Melanie<br />
Wahl und Iris Helbig legen Bilder zum Gehörten und Gesehenen<br />
auf den Tisch. Jeder kann einen Stein auf das Bild legen, dessen<br />
Geschichte ihn am meisten bewegt hat. „Behaltet das, was euch aufgewühlt<br />
hat und belastet, nicht für euch“, gibt Iris Helbig ihren Kollegen<br />
mit auf den Weg. „Darüber sprechen hilft.“ AS ❚<br />
Bildet die Peer-Guides aus: Projektkoordinatorin Melanie Wahl<br />
KONTAKT<br />
AWO SONNENSTEIN, PIRNA, gemeinnützige GmbH<br />
Melanie Wahl, Projektkoordinatorin<br />
Schlosspark 9-12, 01796 Pirna<br />
Melanie.Wahl@awo-sonnenstein.de<br />
Tel.: 03501 797230<br />
www.awo-sonnenstein.de<br />
B I L D U N G : A W O S O N N E N S T E I N , P I R N A K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
B I L D U N G : A W O S O N N E N S T E I N , P I R N A 15
BILDUNG/DIGITALE MEDIEN<br />
„Die App bereichert einfach<br />
den Bildungsalltag“<br />
➜ Thema: Mit der Capito-App werden Texte am Arbeitsplatz und in der Schulung leichter verständlich<br />
➜ Einrichtung: OWB Oberschwäbische Werkstätten gem. GmbH ➜ Ort: Mengen<br />
Rollenwechsel: Als Experten erklären BBB-Teilnehmer<br />
den Besuchern vom Rudolf-Sophien-Stift die App<br />
ES IST HEISS im Schulungsraum am OWB-<br />
Standort in Mengen. Das einstöckige Fabrikgebäude<br />
liegt in einem weitgehend baumlosen<br />
Gewerbegebiet im Donautal und hat sich in der<br />
Sommersonne kräftig aufgeheizt. Die Plätze in<br />
Reichweite des Standventilators sind deshalb besonders<br />
begehrt. Vier junge Männer und eine<br />
Frau sitzen gemeinsam mit Bildungsbegleiter<br />
Christian Bader um weiße Bürotische herum, die<br />
dicken Aktenordner mit Schulungsunterlagen an<br />
den Plätzen. Daneben hat jeder ein DIN-A4-großes<br />
Tablet liegen. „Persönliche Hygiene“ heißt das<br />
Kapitel, das heute dran ist. Und während Christian<br />
Bader zu erläutern beginnt, worum es dabei<br />
alles gehen wird, schnappt sich Lara Rautenberg<br />
ihr Tablet. Ein paar Mal Wischen und Klicken,<br />
und schon hat sie über die Capito-App den entsprechenden<br />
Code im Ordner abfotografiert.<br />
Über solche QR-Codes werden ganze Kapitel und<br />
einzelne Schulungsunterlagen auf das Gerät<br />
hochgeladen. „Dann kann ich hier auf ‚leichter<br />
lesen’ klicken, damit ich es besser verstehe“, demonstriert<br />
die 19-Jährige. Und schon hat sie eine<br />
einfachere Version des Schulungsstoffes auf dem<br />
Display. Aber nicht nur eine: Über die App werden<br />
sowohl der Originaltext als auch drei leichtere<br />
Versionen in abgestuften Sprachniveaus zur Verfügung<br />
gestellt. „Ich nehm’ immer das ‚leichter zu<br />
lesen’“, sagt Lara Rautenberg, „das ist Stufe A2“.<br />
Informationen aufs Handy laden Die junge Frau<br />
mit dem blonden Pagenschnitt beherrscht den<br />
Umgang mit Tablet und App perfekt und ist doch<br />
erst seit Mai dabei. Sie steckt noch im Eingangsverfahren,<br />
einer dreimonatigen Orientierungsphase.<br />
„Da geht es in erster Linie darum, Stärken<br />
und Schwächen herauszufinden und auch Vorlieben<br />
zu ermitteln“, erklärt Bildungsbegleiter Bader.<br />
Danach entscheidet sich dann, in welchem Berufsfeld<br />
sie die folgenden zwei Jahre verbringen<br />
will. Im Berufsbildungsbereich der Oberschwäbischen<br />
Werkstätten stehen die Bereiche „Lager und<br />
Logistik“, „Hauswirtschaft“ oder „Metall“ zur<br />
Auswahl.<br />
Entschieden hat sich Lara Rautenberg noch<br />
nicht. Im Metall-Bereich hat sie gesehen, wie man<br />
Teile stanzt. Das hat ihr gefallen. „Oder der Reinraum<br />
wär’ spannend, wo man die Sachen fürs<br />
Krankenhaus macht.“ Dort werden unter besonderen<br />
hygienischen Bedingungen Medizinprodukte<br />
verpackt. Arbeiten darf man hier nur in<br />
Schutzkleidung, und rein kommt man nur durch<br />
eine spezielle Schleuse. Fürs Ein- und Ausschleusen<br />
gibt es genaue Regeln, die verhindern<br />
sollen, dass unzulässig viele Schmutzpartikel in<br />
den fusselfreien Arbeitsbereich gelangen. Das<br />
entsprechende Kapitel dazu hat sich Lara Rautenberg<br />
auch schon in ihre App geladen. „Ich<br />
hab’ das dann auch auf dem Handy und kann<br />
das mit nach Hause nehmen“, erklärt sie. So<br />
kann sie sich die Vorschriften immer wieder<br />
durchlesen, die entsprechenden Bilder dazu hat<br />
sie bereits im Kopf.<br />
„Vor einem guten Jahr haben wir damit begonnen,<br />
die Capito-App in unseren Werkstätten zu<br />
nutzen“, berichtet Bernd Heggenberger, Leiter des<br />
Bereichs Bildung und Arbeitsförderung. Damit<br />
sind die OWB einer von zwei Werkstattträgern in i<br />
bilal mechkit:<br />
„Ohne App<br />
wär’s für mich<br />
schwieriger“<br />
Lernen klappt gut mit der Capito-App: Bilal Mechkit<br />
16 B I L D U N G : O W B O B E R S C H W Ä B I S C H E W E R K S T Ä T T E N G E M . G M B H , R A V E N S B U R G K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9 K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
B I L D U N G : O W B O B E R S C H W Ä B I S C H E W E R K S T Ä T T E N G E M . G M B H , R A V E N S B U R G 17
maurice heinrich:<br />
„Ich probier’ auch<br />
mal den schwierigeren<br />
Text, aber leichter ist<br />
besser“<br />
marco stark:<br />
„Manchmal lese ist das<br />
selbst, aber lieber lass<br />
ich es mir vorlesen“<br />
lara rautenberg:<br />
„Es gibt ja echt viele<br />
Fremdworte, die wir<br />
nicht verstehen. Das<br />
wird uns dann alles<br />
erklärt“<br />
i<br />
Deutschland, die bereits dieses digitale Hilfsmittel<br />
des österreichischen Dienstleistungsunternehmens<br />
Capito aus Graz nutzen. Capito („ich habe<br />
verstanden“) stand bislang für eine zertifizierte<br />
Übersetzungsmethode von komplizierten Texten<br />
in Leichte Sprache. Auf Franchise-Basis gehören<br />
in Deutschland inzwischen zehn Unternehmen<br />
zum Capito-Netzwerk und bieten barrierefreie<br />
Informationsvermittlung als Dienstleistung an –<br />
in erster Linie Übersetzungen bereits vorhandender<br />
Texte, die nun eben auch per App genutzt<br />
werden können. Eines davon, Capito Bodensee,<br />
gehört zur OWB und sitzt am benachbarten<br />
Standort in Sigmaringen.<br />
Alle nutzen dieselben Unterlagen „Die App ist ein<br />
gigantisches Mittel, wenn man sieht, wie die<br />
Leute das aufnehmen und ernst nehmen. Das ist<br />
einfach schön.“ Wenn Bernd Heggenberger so ins<br />
Schwärmen gerät, leuchten seine Augen. Die<br />
Leute – damit meint er die Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer des OWB-Berufsbildungsbereichs. 48<br />
Menschen durchlaufen darin derzeit Teilqualifizierungsmaßnahmen.<br />
Menschen mit Behinderung,<br />
aber auch Geflüchtete, EU-Ausländer und<br />
Langzeitarbeitslose aus bildungsfernen Milieus.<br />
„Wir machen die Maßnahmen gemischt, alle<br />
nutzen dieselben Unterlagen“, berichtet Heggenberger.<br />
Auch die Capito-App gehört, neben zwei<br />
weiteren Apps, zu den Standard-Arbeitsmitteln.<br />
Wer kein eigenes Smartphone besitzt, kann ein<br />
Tablet des Betriebs nutzen.<br />
Zu den Unterlagen, die das Team von Capito<br />
Bodensee bereits für die App übersetzt und geprüft<br />
hat, zählen Schulungsunterlagen und die<br />
persönlichen Arbeitsverträge des Berufsbildungsbereichs.<br />
„Die sind erst mal sehr komplex<br />
zu lesen, weil sie natürlich Agentur-für-Arbeitkonform<br />
sein müssen“, sagt Heggenberger. Auch<br />
hier erleichtert die App Zugang und Verständnis.<br />
„Sie müssen halt verstehen: Wenn ich krank bin,<br />
muss ich mich melden.“<br />
18 B I L D U N G : O W B O B E R S C H W Ä B I S C H E W E R K S T Ä T T E N G E M . G M B H , R A V E N S B U R G<br />
Viele beginnen wieder zu lesen Den Einsatz der<br />
App will Heggenberger nach und nach auf<br />
sämtliche Arbeitsfelder der OWB ausweiten. 650<br />
Menschen sind derzeit an sechs Standorten zwischen<br />
Donau und Allgäu beschäftigt. Arbeitsplatzbeschreibungen,<br />
Info-Schreiben, Arbeitsanweisungen<br />
– in der Capito-App soll sich künftig<br />
alles nachlesen lassen. Am unternehmensweiten<br />
Intranet wird bereits gebastelt. „Das<br />
Schöne an der App ist ja: Jeder Mensch kann<br />
sich selbst aussuchen, wie er etwas lesen will und<br />
versteht“, betont Heggenberger. „Und niemanden<br />
von uns geht es etwas an, wie der das liest.“<br />
Einen Nebeneffekt hat er im Berufsbildungsbereich<br />
bereits bemerkt: Gerade Menschen mit<br />
Lernschwierigkeiten würden die Themen Lesen<br />
und Schreiben häufig umgehen, vermutlich<br />
wegen früherer Misserfolge. „Inzwischen haben<br />
aber viele wieder begonnen zu lesen.“<br />
Der aufgeheizte Schulungsraum hat sich inzwischen<br />
gefüllt, die Lerngruppe hat Besuch<br />
bekommen. Eine Delegation vom Rudolf-Sophien-Stift<br />
aus Stuttgart tauscht sich mit der<br />
OWB über Digitalisierung im Arbeitsbereich aus<br />
und lässt sich auch den Umgang mit der Capito-<br />
App zeigen. „A2 ist gut“, sagt Marco Stark spontan.<br />
Eine andere Schwierigkeitsstufe wähle er<br />
selten, am liebsten lasse er sich die Texte vorlesen<br />
– und startet gleich die Sprachausgabe. „Auf Android<br />
funktioniert die Vorlesefunktion schöner als<br />
auf Apple“, wirft Bildungsbegleiter Christian<br />
Bader ein.<br />
„Ich probier’ auch mal den schwierigeren Text“,<br />
erklärt Maurice Heinrich den Besuchern, „aber<br />
leichter ist besser.“ Und Bilal Mechkit ergänzt:<br />
„Jeder Mensch kann sich selbst aussuchen,<br />
„Ohne App wär’s für mich schwieriger.“ Die jungen<br />
Männer sind alle zwischen 19 und 22 und im<br />
ersten BBB-Jahr. Samed Mehinovic berichtet stolz,<br />
dass er in der Nudelverpackung arbeitet, bereits<br />
den Hubwagen-Führerschein gemacht hat und<br />
auch schon an die Verpackungsmaschine durfte,<br />
mit der man eine ganze Palette Nudelkartons<br />
ringsherum in Folie einwickeln kann. Dann zeigt<br />
er den Besuchern noch seine eigenen Notizen:<br />
Viele Stellen aus der App hat er sich auf Papier abgeschrieben<br />
und auch die dazugehörigen Warnschilder<br />
abgemalt. „Gigantisch, wie die sich<br />
Gedanken machen und dazulernen“, schwärmt<br />
Bernd Heggenberger ein weiteres Mal. „Die App<br />
bereichert einfach den Bildungsalltag.“ Auch dass<br />
die Teilnehmer jetzt als Experten für die Anwendung<br />
anderen die App erklären, findet er großartig<br />
– ein Rollenwechsel, der Mut macht und<br />
Selbstbewusstsein gibt.<br />
Spannende Möglichkeiten Yvonne Frick leitet<br />
beim Rudolf-Sophien-Stift in Stuttgart den Bereich<br />
Berufliche Bildung. Beim Besuch in Mengen<br />
entdeckt sie durchaus spannende i<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
wie er etwas lesen will und versteht“ BERND HEGGENBERGER, BBB-LEITER<br />
i<br />
Möglichkeiten, wie sich die Capito-App in<br />
ihrem eigenen Hause anwenden ließe. „Die verschiedenen<br />
Textstufen klingen ja zunächst reizvoll<br />
für diejenigen, die kognitiv nicht so fit sind“,<br />
meint Frick. „Dafür haben wir eher nicht so das<br />
typische Klientel.“ Das Rudolf-Sophien-Stift ist<br />
auf psychische Erkrankungen spezialisiert, ein<br />
Großteil der rund 500 Mitarbeiter in den Werkstätten<br />
hat einen Hochschulabschluss oder eine<br />
umfassende Ausbildung. „Allerdings gehen mit<br />
manchen Erkrankungen auch Lernschwächen<br />
einher“, sagt Frick, „und da könnte der Gebrauch<br />
der App vermutlich die Autonomie erhöhen.“<br />
Dabei denkt sie speziell an einen<br />
Mitarbeiter, der nicht mehr in der Lage ist, sich<br />
die Einstellungen der Waschmaschine zu merken.<br />
Eine Anleitung auf Papier habe wenig geholfen,<br />
mit einem Film dagegen käme er jetzt<br />
zurecht.<br />
Wie vielfältig die Anwendungsmöglichkeiten<br />
der App sein könnten, entdeckt auch Heggenberger<br />
immer mehr – und auch, wo Grenzen liegen.<br />
Bei der Nachbarfirma im Mengener<br />
Gewerbegebiet, einem Automobilzulieferer, sei<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
Ist begeistert von den vielen Möglichkeiten der App: Bernd<br />
Heggenberger (m.) mit Marco Stark (l.) und Maurice Heinrich<br />
das Interesse an Anleitungen auf verschiedenen<br />
Sprachstufen groß: Mitarbeiter stünden oft vor<br />
Sprachbarrieren oder Verständnisschwierigkeiten,<br />
die damit überwunden werden könnten.<br />
„Was bei uns nicht funktioniert, ist der Speiseplan“,<br />
erinnert sich Heggenberger an seine ersten<br />
Versuche, die Capito-App einzusetzen.<br />
Schnell wurde klar: Bei vier verschiedenen Lieferanten,<br />
die täglich jeweils mindestens zwei unterschiedliche<br />
Menüs an verschiedene OWB-<br />
Standorte liefern, kommen die beiden Mitarbeiterinnen<br />
von Capito Bodensee mit dem<br />
Übersetzen nicht hinterher. „Da müsste ich eine<br />
Kraft allein dafür einstellen.“ Deshalb will Heggenberger<br />
den Einsatz der App jetzt erst einmal<br />
im Werkstattbereich ausweiten. GS ❚<br />
KONTAKT<br />
OWB Oberschwäbische Werkstätten gem. GmbH<br />
Bernd Heggenberger<br />
Leiter Bildung und Arbeitsförderung<br />
Jahnstraße 98, 88214 Ravensburg<br />
Tel.: 0751 36338-525<br />
bernd.heggenberger@owb.de<br />
www.owb.de<br />
Bildungsbegleiter Christian Bader<br />
LEICHTER LESEN AM SMARTPHONE<br />
Über die LL-App von Capito können<br />
Texte in vier verschiedenen Sprachniveaus<br />
abgerufen werden – je<br />
nach dem, wie diese zuvor hinterlegt<br />
wurden. Dazu öffnet man die<br />
App auf einem Smartphone oder<br />
Tablet und fotografiert dann mit<br />
der Kamera einen zum Text gehörigen<br />
QR-Code ab. Nach einer kurzen<br />
Ladezeit steht das Dokument bereit:<br />
zum einen im Original, zum<br />
anderen in drei vereinfachten Versionen.<br />
„Leicht zu lesen“ entspricht<br />
dabei der Stufe B1 nach dem vom<br />
Europarat festgelegten „Gemeinsamen<br />
europäischen Referenzrahmen<br />
für Sprachen“ (GeRS). Mit<br />
„Leichter zu lesen“ gelangt man zu<br />
einem Text der Stufe A2, mit „Sehr<br />
leicht zu lesen“ zu A1. Möglich ist<br />
sogar, auch eine englische Version<br />
zu hinterlegen. Daneben gibt es<br />
die Funktion, sich den Text über die<br />
Sprachausgabe des Betriebssystems<br />
vorlesen zu lassen. Es kann<br />
sogar ein Video in Gebärdensprache<br />
aufgerufen werden, sofern der<br />
Anbieter eines hinterlegt hat.<br />
Sämtliche Dokumente, die man<br />
einmal per QR-Code hochgeladen<br />
hat, bleiben gespeichert und lassen<br />
sich auch mit nach Hause nehmen.<br />
Dort kann man sie noch<br />
einmal nachlesen oder auch mit<br />
anderen Sprachstufen experimentieren.<br />
Daneben bietet der Hersteller<br />
der App, die Firma Capito aus<br />
dem österreichischen Graz, auch<br />
einen kostenlosen Themenkanal<br />
Nachrichten an. Darin werden<br />
jeden Nachmittag die wichtigsten<br />
Nachrichten des Tages veröffentlicht<br />
– ebenfalls in vier verschiedenen<br />
Sprachstufen.<br />
B I L D U N G : O W B O B E R S C H W Ä B I S C H E W E R K S T Ä T T E N G E M . G M B H , R A V E N S B U R G<br />
19
ARBEIT/INKLUSION<br />
„Wenn die Firma es wirklich<br />
will, kann das klappen<br />
mit der Inklusion“<br />
➜ Thema: Ein Betrieb realisiert das „Projekt<br />
Inklusion“<br />
➜ Unternehmen: Flughafen München GmbH<br />
„INKLUSION IN DER ARBEITSWELT? Das ist doch<br />
eine Wunschvorstellung von Gutmenschen. Die Realität<br />
sieht anders aus. Betriebe sind auf Gewinnmaximierung<br />
aus, das Thema Behinderung hat da keinen<br />
Platz.“ So lautet eine gängige Meinung. Die hohen<br />
Ausgleichszahlungen für nicht besetzte Schwerbehindertenplätze<br />
scheinen den Skeptikern recht zu geben.<br />
Einige Firmen wollen jedoch den Gegenbeweis antreten<br />
und schreiben das Thema Inklusion bewusst auf<br />
ihre Fahnen. Zu ihnen gehört die Flughafen München<br />
GmbH, die FMG.<br />
Barrierefreier Flughafen Flughäfen müssen schon aus<br />
wirtschaftlichen Gründen dem Thema Behinderung<br />
Beachtung schenken. Schließlich gehören behinderte<br />
Fluggäste zu ihren Kunden. Deshalb bemüht sich der<br />
Münchener Flughafenkonzern seit Jahren um Barrierefreiheit,<br />
hat u.a. ein taktiles Leitsystem für Sehbehinderte<br />
eingebaut und sensibilisiert seine Mitarbeiter<br />
in Schulungen für die besonderen Bedürfnisse<br />
behinderter Menschen. Dafür bekam er das Signet<br />
„Bayern barrierefrei – wir sind dabei“ verliehen.<br />
Zudem ist er als einer von drei Flughäfen in Deutschland<br />
mit dem Qualitätssiegel „Reisen für Alle“ zertifiziert.<br />
Das Thema Inklusion will der Flughafen jetzt auch<br />
in Bezug auf seine Mitarbeiterschaft in Angriff nehmen.<br />
Dazu beigetragen hat sicher die hohe Schwerbehindertenquote<br />
von elf Prozent, überwiegend<br />
langjährige Mitarbeiter, die im aufreibenden Flughafengeschäft<br />
erkrankt sind. Dass die Quote so hoch ist,<br />
ist ein Beleg dafür, dass die FMG das Ziel verfolgt,<br />
diese Beschäftigten im Unternehmen zu halten und<br />
ihre Arbeitsbedingungen anzupassen. Seit Jahren<br />
wurde Inklusion im FMG-Konzern von der Geschäfts-<br />
und Personalleitung gefördert: Der Begriff<br />
soll in Abläufen und Vorgaben beschrieben werden,<br />
die einen Standard definieren. Dabei geht es nicht nur<br />
um Personalthemen, sondern auch ums Bauen, um<br />
Büroausstattung oder Auftragsvergaben.<br />
20 A R B E I T : F L U G H A F E N M Ü N C H E N G M B H<br />
Der Motor des Inklusionsgedankens Der Kopf hinter<br />
den vielfältigen Aktivitäten heißt Willy Graßl. Der Arbeitswissenschaftler<br />
ist schon 31 Jahre bei der FMG<br />
beschäftigt und eine Institution: Bodenständig, kommunikativ,<br />
ein Teamplayer mit Überzeugungskraft. Jemand,<br />
der für seine Themen brennt. Schon früh war<br />
er Mitglied des Betriebsrats, wurde dessen Vorsitzender.<br />
2010 erhielt er von der Geschäftsleitung den Auftrag,<br />
das Gesundheitsmanagement neu zu strukturieren.<br />
Eine Aufgabe, der er sich mit Erfolg widmete.<br />
Aufgrund einer schweren Erkrankung musste Willy<br />
Graßl 2015 für ein halbes Jahr pausieren und erhielt<br />
den Schwerbehindertenstatus. 2018 wurde er Verantwortlicher<br />
für das Inklusionsthema. Er treibt es gemeinsam<br />
mit seiner Kollegin Petra Bauer voran, die<br />
bereits die Vorarbeiten geleistet hatte.<br />
Die Motive des Betriebs erläutert er so: „Es geht um<br />
die eigenen Schwerbehinderten, aber auch um die<br />
Neueinstellungen behinderter Kollegen. Wir brauchen<br />
gelebte Vielfalt. Die Botschaft lautet: Dieses Unternehmen<br />
stellt sich auf seine Mitarbeiter ein, ist flexibel<br />
und anpassungsfähig. Das macht uns zu einem attraktiven<br />
Arbeitgeber. In Zeiten des Fachkräftemangels<br />
ist das ein Mehrwert.“<br />
Die Weltoffenheit des Flughafens spiegelt sich in seinen<br />
Beschäftigten wider. Menschen aus 70 Nationen<br />
arbeiten hier. Willy Graßl: „Es gibt Busfahrer, Feuerwehrleute,<br />
Verkäufer, Tätigkeiten in der Gastronomie<br />
und im Hotel, eine eigene Klinik, eine Tischlerei und<br />
sogar eine eigene Brauerei. Drei Imker betreuen auf<br />
dem Flughafenareal 16 Bienenvölker.“ Alle Bemühungen<br />
drehen sich um das Wohl und die Sicherheit<br />
der Fluggäste und um pünktliche Starts und Landungen.<br />
Keine einfache Aufgabe bei über 400 000 Flugbewegungen<br />
im Jahr und 46 Millionen Passagieren.<br />
Willy Graßl: „Wir sind eine große Flughafenfamilie,<br />
die an 365 Tagen im Jahr ihr Bestes geben muss und<br />
aufeinander angewiesen ist.“<br />
Besuch vor Ort Wie das Thema Inklusion in diese spezielle<br />
Arbeitswelt passt und wie es in der Praxis gelebt<br />
wird, zeigt Willy Graßl dem KLARER-KURS-Reporter<br />
auf einer Rundtour durch das Flughafengelände.<br />
In einem der Funktionsgebäude ist die Poststelle un- i<br />
Vom Praktikum in die Festanstellung: Patrick Kühnel<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9 K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
A R B E I T : F L U G H A F E N M Ü N C H E N G M B H 21
Willy Graßl, verantwortlich für das Thema Inklusion<br />
Vorgaben beziehen sich auch auf ergonomische IT-<br />
Geräte, die Beleuchtung und das Raumklima. Ergänzt<br />
wird die neue Ausstattung durch eine Ergonomieberatung,<br />
die die optimale Einstellung garantiert.<br />
Szenenwechsel in eines der Mitarbeitercasinos im<br />
Terminal 2. Hier hat Willy Graßl das Thema Inklusion<br />
auf andere Weise realisiert. „Wir kooperieren mit der<br />
Künstlergemeinschaft Groupe Smirage der Stiftung<br />
Pfennigparade und bieten den Künstlern die Möglichkeit<br />
zu einer Dauerausstellung. Wir leasen ihre Bilder<br />
für ein Jahr, dann wechseln sie. Die Bilder stehen<br />
auch zum Verkauf.“ Zur Vernissage der Dauerausstellung<br />
„KUNST Flüge“ waren alle 26 Künstler eingeladen,<br />
überwiegend Rollstuhlfahrer. Ein Großereignis<br />
im sicherheitsrelevanten Teil des Flughafengebäudes.<br />
Flughafen- statt Werkstattarbeitsplatz In einer<br />
Waschhalle im Bereich Fahrzeugwartung steht Johann<br />
Pletschacher mit zwei seiner Schülerinnen. Er ist<br />
Werklehrer an der Fröbelschule der Lebenshilfe Frei-<br />
„Wir<br />
brauchen<br />
gelebte<br />
Vielfalt“<br />
WILLY GRASSL<br />
Lehrer Johann Pletschacher im Gespräch mit Willy Graßl, Carina Lindner und Adrienne Fihr (v.l.)<br />
i tergebracht. Hier sind Tätigkeiten zusammengefasst,<br />
die der Betrieb aus den üblichen Abläufen verlagert<br />
hat. Die Absicht: Arbeitsplätze für Mitarbeiter zu<br />
schaffen, die aufgrund der körperlichen oder psychischen<br />
Belastung erkrankt sind. Christian Ostermaier<br />
ist der Teamleiter. Er zählt die Aufgaben seiner<br />
Abteilung auf: „Neben der Postverteilung verwalten<br />
wir das Büromaterial, kaufen ein, übernehmen die Getränkeversorgung,<br />
Kurier- und Botenfahrten.“ Christian<br />
Ostermaier war in der Bodenabfertigung tätig<br />
und ist selber vor einigen Jahren erkrankt. „Woanders<br />
hätte ich wahrscheinlich das Unternehmen verlassen<br />
müssen. Hier konnte ich in diese Abteilung wechseln<br />
und mein Chef hat mich nach einiger Zeit zum Leiter<br />
gemacht. Das hat mir neues Selbstvertrauen gegeben<br />
und mich gesundheitlich stabilisiert.“<br />
In der Verwaltung treffen wir Michael Berger. Er ist<br />
Sportwissenschaftler, kümmert sich um das Thema<br />
Ergonomie am Arbeitsplatz und gehört schon seit<br />
2012 zum Team von Willy Graßl. Die Arbeitsplatzausstattung<br />
war schon eines der Themen im Projekt<br />
Gesundheitsmanagement und ist bei der Erstellung<br />
des Inklusionskonzeptes wieder von Bedeutung. Es<br />
geht um Gesundheitsprophylaxe, aber auch darum,<br />
die Büromöbel auf jeden Bedarf anzupassen. Dazu hat<br />
Michael Berger einen Standard für den Konzern entwickelt.<br />
Beispiel: Jeder neu angeschaffte Schreibtisch<br />
ist elektrisch höhenverstellbar, sodass Menschen unabhängig<br />
von ihrer Größe oder auch Rollstuhlfahrer<br />
ihn nutzen können. Michael Berger: „Durch feste Rahmenverträge<br />
mit ergonomiebewussten Herstellern<br />
konnten wir den Standard sogar kostengünstiger umsetzen.<br />
Den Bestellvorgang haben wir zentralisiert und<br />
beschleunigt, es gibt keinen Wildwuchs mehr.“ Die<br />
22 A R B E I T : F L U G H A F E N M Ü N C H E N G M B H<br />
sing und leitet hier an jedem Dienstag ein Betriebspraktikum<br />
an. Heute reinigen die jungen Damen mit<br />
Hingabe einen Smart, der zum Fuhrpark der FMG gehört.<br />
Sie waschen die Scheiben, saugen Staub, putzen<br />
die Armaturen. „Wir öffnen unseren Schülern den Zugang<br />
zum Arbeitsmarkt,“ erläutert der Lehrer. „In der<br />
Werkstufe absolvieren sie jeden Dienstag ihren Praxistag<br />
in einem Betrieb und zwei Wochen im Jahr zusätzlich<br />
ein Blockpraktikum.“ Der Flughafen ist unter<br />
den Praktikumsmöglichkeiten der Schule erste Wahl.<br />
Nicht nur wegen seines guten Images, sondern auch<br />
wegen des guten Kantinenessens, wie Praktikantin<br />
Adrienne Fihr verschmitzt eingesteht: „Mittags gibt es<br />
hier auch immer eine Pizza zur Auswahl. Da freu ich<br />
mich die ganze Woche drauf.“ Für die Zeit nach der<br />
Schule haben die Schülerinnen klare Berufsvorstellungen.<br />
„Ich will Verkäuferin werden“, gibt sich<br />
Adrienne Fihr entschlossen und die etwas zurückhaltendere<br />
Carina Lindner will in den Kindergarten: „Ich<br />
möchte auf jeden Fall mit Kindern arbeiten.“ Die Aussichten,<br />
dass sich ihre Berufswünsche erfüllen, stehen<br />
gut, sagt ihr Lehrer: „25 Prozent der Schulabgänger<br />
finden einen Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt.“<br />
In der Nebenhalle spritzt Patrick Kühnel mit dem<br />
Hochdruckreiniger den Unterboden eines schweren<br />
Transportfahrzeuges ab. Er gehört zu denjenigen, die<br />
den Sprung aus den Praktika in eine Festanstellung<br />
geschafft haben. „Ich wollte diesen Arbeitsplatz unbedingt<br />
haben und hab’ mich mächtig reingehängt“, erinnert<br />
sich der heute 25-Jährige. Sein Chef und<br />
Anleiter ist Thomas Philippi. Der weiß, was er an dem<br />
jungen Mann hat: „Patrick arbeitet selbstständig und<br />
ist zuverlässig. Er liebt seine Arbeit und ist so gut wie<br />
nie krank.“ Thomas Philippi ist mit seiner zupacken-<br />
i<br />
Michael Berger kümmert sich<br />
als Sportwissenschaftler um<br />
das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz.<br />
Alle neu angeschafften<br />
Schreibtische sind<br />
höhenverstellbar<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
i den Art eine Vaterfigur für die jungen Leute. „Als ich<br />
Praktikanten von der Förderschule nehmen sollte, war<br />
ich anfangs skeptisch“, gibt er zu. „Ich wusste nicht,<br />
um welche Behinderungen es sich handelt. Heute bin<br />
ich froh, mich dafür entschieden zu haben.“ Besonders<br />
eine Praktikantin mit Downsyndrom hat er in bester<br />
Erinnerung. „Sie war so fröhlich und offen, da ging<br />
jedem das Herz auf.“ Auch mit den Festangestellten<br />
habe er nur gute Erfahrungen gemacht. Er ist sich sicher:<br />
„Wenn die Firma es wirklich will, dann geht viel,<br />
dann kann das klappen mit der Inklusion. Jeder hat<br />
seine Fähigkeiten und wenn man die Leute richtig einsetzt,<br />
profitiert auch das Unternehmen davon.“<br />
Willy Graßl schmunzelt bei diesen Sätzen, denn<br />
genau das ist die Botschaft, die er und seine Kollegin<br />
mit dem Inklusionsprojekt vermitteln wollen:<br />
„Schauen wir beim Thema Behinderung nicht immer<br />
auf die Einschränkung, sondern auf den Nutzen für<br />
den Betrieb.“ Bei der Personalgewinnung hat er nicht<br />
nur Behinderteneinrichtungen wie die Freisinger Lebenshilfe<br />
oder die Pfennigparade im Blick, er initiiert<br />
auch die Kontakte mit der Firma Auticon, einer Firma,<br />
die Menschen im Autismus-Spektrum als IT-Consultants<br />
vermittelt. Oder mit dem österreichischen Unternehmen<br />
MyAbility, das Studierenden mit Behinderung<br />
die Chance zum betrieblichen Einstieg gibt. Und<br />
Petra Bauer hat dafür gesorgt, dass die Flughafen<br />
München GmbH Mitglied im Unternehmensforum<br />
wurde, einem Zusammenschluss namhafter Firmen,<br />
die behinderten Menschen eine Anstellung ermöglichen<br />
und Aktionspläne für ihren Betrieb entwickeln.<br />
Inklusion muss Alltag werden Die Verschriftlichung<br />
von Standards und Vorgehensweisen ist der Weg, den<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
Willy Graßl schon bei seinem Erfolg im Gesundheitsmanagement<br />
gegangen ist. In wenigen Jahren baute er<br />
eine eigene Abteilung, in der 14 Themen zusammengefasst<br />
waren, die vorher im Konzern eher stiefmütterlich<br />
behandelt wurden: Arbeitsmedizin und die<br />
psychosoziale Beratungsstelle gehörten dazu, Gesundheitskurse<br />
und Betriebssport, die Personalverpflegung<br />
mit den fünf Betriebskantinen, aber auch die<br />
Kinderkrippe, die Sozialberatung oder die Dienstkleidung.<br />
Bei kostenintensiven Entscheidungen wusste<br />
Willy Graßl die Geschäftsleitung auf seiner Seite und<br />
so wurde der Flughafen in Sachen Gesundheitsmanagement<br />
zu einem Vorzeigeunternehmen, das 2017 den<br />
renommierten Corporate Health Award gewann.<br />
Mit dem offiziellen Auftrag seines Chefs, dem Personalleiter<br />
Dr. Robert Scharpf, und mit der erforderlichen<br />
finanziellen Ausstattung für das Thema Inklusion<br />
definiert er nun wieder die zugehörigen Themenfelder,<br />
sucht Experten, die mit ihm gemeinsam<br />
die Entwicklung vorantreiben, und schafft Strukturen,<br />
die in schriftlichen Standards und in einem Konzernrahmenvertrag<br />
festgeschrieben werden. Standards und<br />
Vertrag sind für ihn aber nur Hilfen: „Entscheidend<br />
ist, dass sich Inklusion in den Köpfen festsetzt, dass sie<br />
an jedem Arbeitsplatz gelebt wird. Das Thema darf<br />
nicht an meiner Person oder der meiner Kollegin hängen,<br />
sonst habe ich mein Ziel nicht erreicht.“ Wie der<br />
Betrieb heute Gesundheitsmanagement lebt, so soll<br />
das Thema Inklusion ebenfalls selbstverständlich werden.<br />
Ein solcher Prozess erfordert einen langen Atem,<br />
wie Willy Graßl weiß: „Die Casino-Sanierung hat<br />
Jahre gedauert.“ Die Zeit gibt er sich. Spätestens wenn<br />
er in Rente geht, soll die Flughafen München GmbH<br />
ein Leuchtturmbetrieb für Inklusion sein. DB ❚<br />
Für jeweils ein Jahr<br />
geleast: Kunstwerke der<br />
Groupe Smirage der Stiftung<br />
Pfennigparade<br />
KONTAKT<br />
Flughafen München GmbH<br />
Willy Graßl<br />
Postfach 231755<br />
85326 München-Flughafen<br />
Tel.: 089 97564210,<br />
willy.grassl@munich-airport.de<br />
A R B E I T : F L U G H A F E N M Ü N C H E N G M B H<br />
23
ARBEIT/EIGENPRODUKT<br />
Ein eigenes<br />
Lichtermeer<br />
Handgefertigt: Tischlampe Boje<br />
➜ Thema: Gute Arbeit für Werkstattbeschäftigte<br />
durch Eigenprodukte<br />
➜ Einrichtung: Die Ostholsteiner gGmbH<br />
➜ Ort: Eutin, Heiligenhafen<br />
STEVEN, PLANKE, POLLER UND BOJE heißen<br />
sie und der maritime Bezug ihrer Namen macht<br />
schnell klar, woher sie kommen: von der Küste,<br />
genauer: aus Schleswig-Holstein. Sie sind fein designte,<br />
besondere Leuchten, die in verschiedenen<br />
Werkstätten von Die Ostholsteiner produziert<br />
werden. Unter dem klangvollen Namen „lichter°meer“<br />
vermarktet die Werkstatt aus Ostholstein<br />
ihre neue Eigenproduktserie, die in einer<br />
frisch gegründeten Arbeitsgruppe in der Heiligenhafener<br />
Werkstatt der Ostholsteiner endmontiert<br />
wird.<br />
Zur Arbeitsgruppe gehört Sascha Kranz, der<br />
sich in der Heiligenhafener Montagehalle gerade<br />
über Steven beugt: „lichter°meer gefällt mir richtig<br />
gut“, findet der 35-Jährige. Er sei stolz auf seine<br />
Arbeit und das Projekt. „Vor diesem Job habe ich<br />
15 Jahre in der Aktenvernichtung gearbeitet.“ Er<br />
schraubt die Leuchte routiniert auf das fertig angelieferte<br />
Holzelement, dann montiert er Kabel<br />
und Wandhalterung. „In der Gruppe fühle ich<br />
mich wohl“, strahlt er, „hier möchte ich lange bleiben.“<br />
Spricht’s und konzentriert sich auf die<br />
nächste Leuchte.<br />
Treibholz-Optik. Wer sich das aktuell günstigste<br />
Modell Boje auf den Tisch stellen will, muss dafür<br />
knapp 100 Euro bezahlen. „Qualität hat seinen<br />
Preis“, kommentiert Projektleiter Hansjörg Fischenbeck.<br />
Bernd Meyer (Name v. d. Red. geändert) hat für<br />
lichter°meer sogar die Werkstatt gewechselt. Vorher<br />
war er bei Die Ostholsteiner in Oldenburg,<br />
gute zehn Kilometer von Heiligenhafen entfernt.<br />
„Die Arbeit hier ist sehr vielseitig, was mir besonders<br />
gefällt: Wir können unser Produkt von Anfang<br />
bis Ende begleiten, wenn wir das wollen.“<br />
Nach einem Praktikum in Heiligenhafen habe er<br />
sich „um die Stelle bei lichter°meer gerissen“. Und<br />
bekommen. Nun ist der 61-Jährige zunächst für<br />
die Montage der Planke zuständig: So wie sein<br />
Kollege Sascha Kranz den Steven montiert, montiert<br />
er die Hängelampe. Fachlich hochqualifiziert<br />
− unter anderem ist er Schlossermeister, hat Vermessung<br />
gelernt, in der E-Technik und der Tischlerei<br />
gearbeitet und war auch schon Mediengestalter<br />
− hat Bernd Meyer mit dieser Stelle seinen<br />
Traumjob gefunden. Und auch privat hat er dazugewonnen,<br />
wie er mit einem Augenzwinkern<br />
sagt: „Ich sitze eine Stunde pro Tag weniger im<br />
Werkstattbus.“ Warum er dann nicht früher gewechselt<br />
habe? Wegen der Arbeit, die sei in Oldenburg<br />
für ihn zuerst deutlich interessanter und<br />
passender gewesen. Aber mit lichter°meer in Heiligenhafen<br />
ist ihm die Entscheidung leicht gefallen.<br />
Montiert die komplette Lampe: Henrik Schönherr<br />
Produktion im Verbund Jeder der vier Standorte<br />
arbeitet mit seinem Gewerk an den Leuchten mit.<br />
In Eutin etwa wird der Eisenfuß für das Modell<br />
Poller geschweißt und pulverbeschichtet. Oldenburg<br />
kümmert sich um Boje: Die Werkstatt verbindet<br />
Sichtbeton, LED-Leuchte und Holzelement.<br />
In Heiligenhafen wird endmontiert, verpackt<br />
und versandt, Schwentinental unterstützt<br />
mit seinem Bürobereich beim Marketing. Komponenten,<br />
die im eigenen Haus nicht gefertigt<br />
werden können, werden in enger Partnerschaft<br />
von den Preetzer Werkstätten gefertigt.<br />
Das Design der Leuchten liegt im aktuellen<br />
Treibholz-Trend. Boje ist eine Tischleuchte, Steven<br />
ist eine Wandleuchte, Planke eine Hänge- und<br />
Poller eine Stehleuchte. Allen gemein ist die Beleuchtungstechnik,<br />
also energieoptimierte Niedervolt<br />
LED, und das Thema gealtertes Holz in<br />
Neue Arbeitsinhalte Viele Werkstätten ziehen sich<br />
aus der Eigenproduktion zurück, anders Die Ostholsteiner,<br />
die sich vor rund zwei Jahren entschlossen<br />
haben, den Bereich Eigenprodukte als<br />
zusätzliche Säule der Produktion aufzubauen und<br />
damit weniger von Aufträgen Dritter abhängig zu<br />
sein. Zwar übernehmen sie auch weiterhin Aktenvernichtung,<br />
führen klassische Montage- und Verpackungsarbeiten<br />
durch, kochen, waschen, bearbeiten<br />
Metall und pulverbeschichten, aber mit den<br />
Eigenprodukten entstehen zusätzliche „unterschiedliche,<br />
neue und interessante Arbeiten für<br />
Menschen mit Beeinträchtigungen“, meint Hansjörg<br />
Fischenbeck, bei Die Ostholsteiner für Controlling<br />
und Projektmanagement zuständig, „für<br />
verschiedene Gewerke und an unterschiedlichen<br />
Standorten.“ Dennoch, Eigenprodukte sind kein<br />
einfaches Geschäft, der Projektleiter ist überzeugt:<br />
24 A R B E I T : D I E O S T H O L S T E I N E R G G M B H , E U T I N<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
A R B E I T : D I E O S T H O L S T E I N E R G G M B H , E U T I N<br />
i<br />
120 cm hoch: Stehlampe Poller<br />
25
„Mit unseren Eigenprodukten<br />
entstehen interessante Arbeiten<br />
für die Beschäftigten“<br />
HANSJÖRG FISCHENBECK<br />
i „Wenn nicht alle im Haus an einem Strang ziehen,<br />
kann das nichts werden.“ Man müsse sowohl<br />
die Geschäftsführung mit guten Konzepten überzeugen<br />
als auch die einzelnen Werkstattleitungen<br />
und Arbeitsbegleiter mit ins Boot holen.<br />
Prototypen aus der Garage Wenn Hansjörg Fischenbeck<br />
über lichter°meer spricht, strahlt er mit<br />
seinen Leuchten um die Wette. „Anfangs war es<br />
nicht leicht, die Skeptiker im Unternehmen von<br />
meinen Ideen zu überzeugen“, sagt er, „aber ich<br />
bin aufgrund meiner Erfahrung in anderen Häusern<br />
davon überzeugt, dass Eigenprodukte der<br />
richtige Weg sind.“ Bis zur Endfertigung in Heiligenhafen<br />
dauerte es aber noch rund eineinhalb<br />
Jahre. Als begeistertem Radler, der auch schon mal<br />
über die Alpen fährt, ging ihm jedoch die Puste<br />
nicht aus: „Die Entwürfe der einzelnen Leuchten<br />
habe ich zu Hause am Wochenende in meiner Garage<br />
gebaut“, lacht Fischenbeck. Montags, wenn<br />
er dann mit seinen Ergebnissen in die Eutiner Geschäftsstelle<br />
gekommen sei, habe er nicht nur positive<br />
Reaktionen geerntet. „Mit den Menschen,<br />
die ich von lichter°meer begeistern konnte, haben<br />
wir dann intensive Überzeugungsarbeit in allen<br />
Werkstätten geleistet.“ Das hat sich gelohnt.<br />
Parallel zur Entwicklung seiner Leuchten setzten<br />
sich Fischenbeck und seine Kollegen mit dem<br />
Thema Marketing und Vertrieb von Eigenprodukten<br />
auseinander. Und er fand die richtigen<br />
Leuchtmittel und gute Verpackungslösungen.<br />
„Viele LED-Teile haben wir anfangs im Internet<br />
bestellt“, doch das habe seine Schattenseiten.<br />
„Manchmal kam eine ganz andere Leuchte als die<br />
bestellte an.“ Die hatte − obwohl identisch beschrieben<br />
− andere Maßen und die gut entwickelten<br />
Arbeitsanleitungen waren Makulatur.<br />
„Wir haben viel gelernt“, meint Fischenbeck mit<br />
einem Lächeln. <strong>Kurs</strong>änderung war auch bei der<br />
Namensgebung angesagt: Hatten die Ostholsteiner<br />
ihre vier Leuchten zuerst und schlicht nach<br />
den Werkstätten benannt, in denen sie entstehen<br />
− Eutin, Oldenburg, Schwentinental und Heiligenhafen<br />
−, gaben sie ihnen alsbald neue Namen:<br />
Den maritimen Bezug hatte der hausinterne Bereich<br />
„Öffentlichkeitsarbeit“ eingebracht.<br />
Produkttest in Nürnberg Im März dieses Jahres<br />
schließlich war es so weit: lichter°meer stellte auf<br />
i<br />
Henrik Schönherr, Christian Lühr bei der Lampenkontrolle; Christian Keitel, Sascha Kranz bei Packarbeiten<br />
26 A R B E I T : D I E O S T H O L S T E I N E R G G M B H , E U T I N<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9 K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
i<br />
der Werkstätten-Messe in Nürnberg aus, eine Premiere<br />
für Die Ostholsteiner: „Dort wollten wir<br />
unsere neuen Produkte präsentieren, wollten<br />
selbst sehen, wie das Publikum das lichter°meer<br />
aufnimmt, ob unsere Leuchten ankommen und<br />
wir den Markt richtig eingeschätzt haben“, erinnert<br />
sich Fischenbeck. Knapp 40 Leuchten hatten<br />
sie dabei − und stellten schon am Aufbautag fest,<br />
dass ihre Produkte das Zeug zum Publikumsliebling<br />
haben: Sie hätten alle direkt verkaufen können.<br />
„Und wir waren deutlich zu günstig“, findet<br />
der Produktentwickler. Die Qualität der Arbeit<br />
und das besondere Design machten andere Preise<br />
möglich.<br />
Mit nach Nürnberg zur Messe fuhren auch Heiligenhafens<br />
Abteilungsleiterin Liane Pitzschel und<br />
Arbeitsbegleiter Christian Lühr. Der 47-Jährige<br />
leitet seit zehn Jahren die Montage- und Kreativgruppe<br />
in Heiligenhafen gemeinsam mit einer<br />
Kollegin. Und als vor zwei Jahren die Geschäftsleitung<br />
alle Werkstatt-Tüftler und Kreativ-Engagierte<br />
dazu aufforderte, Eigenprodukte fürs<br />
Arbeits- und Beschäftigungsportfolio zu entwickeln,<br />
setzten beide das schnell um. „Wir haben<br />
begonnen, Taschen aus Segeltuch und Anziehhilfen<br />
für Neoprenanzüge zu nähen und lokal zu<br />
verkaufen“, erzählt der begeisterte Wassersportler.<br />
Als er nach der Messe gefragt wurde, ob er in Heiligenhafen<br />
eine neue Gruppe für die Endmontage<br />
des lichter°meers aufbauen würde, „habe ich nicht<br />
lange nachgedacht und ‚Ja‘ gesagt“. Innerhalb kurzer<br />
Zeit fand sich das neue, kleine Team zusammen:<br />
Eine tolle Truppe, freut sich der engagierte<br />
Arbeitsbegleiter, „alle sind hochmotiviert und mit<br />
vollem Elan bei der Sache“.<br />
Lieber weniger, aber dafür gut Über Verkauf und<br />
Vertrieb der Leuchten machen sich Die Ostholsteiner<br />
keine Sorgen. Neben dem Verkauf im eigenen<br />
Werkstattladen bewerben sie die edlen<br />
Lichtspender über ihre Website lichterpunktmeer.de<br />
und im Onlineshop von Die Ostholsteiner,<br />
dort können sie auch bestellt werden. „Aktuell<br />
arbeiten wir die vorhandenen Aufträge der Messe<br />
ab“, sagt Fischenbeck. So schaffe die Montagegruppe<br />
zwischen fünf und zehn Leuchten pro Tag.<br />
Qualität braucht eben seine Zeit. Anfragen gab es<br />
aber auch schon für 200 Stück en gros. „Da mussten<br />
wir passen − und zwar leichten Herzens.“ Ein<br />
Holz für die lichter°meer-Produkte<br />
hochwertiges Produkt ist und bleibt das Ziel: „lieber<br />
weniger und dafür gut“.<br />
Und wie geht es nun weiter? „Heiligenhafen<br />
boomt“, sagt Liane Pitzschel, „und das wird lichter°meer<br />
auch tun.“ Das neue Projekt tue der Einrichtung<br />
gut. Angestoßen durch das Projekt<br />
haben Die Ostholsteiner neue Strukturen geschaffen<br />
und das Angebot an interessanten Arbeitsplätzen<br />
deutlich erweitert. So wurden zum<br />
Beispiel die Arbeitsgruppen anders zugeschnitten,<br />
damit lichter°meer gut starten und Christian Lühr<br />
und sein Team sich in die neue Materie einarbeiten<br />
konnten. „Das hat nicht allen Mitarbeitern gefallen“,<br />
konstatiert Liane Pitzschel, „aber jetzt sind<br />
alle mit der Umstellung durchaus zufrieden.“<br />
Auf dem Parkplatz vor der Werkstatt liegen<br />
Holzreste, säuberlich auf einem Haufen, Reste des<br />
alten Heiligenhafener Museumsstegs. Balken und<br />
Bretter, die jahrzehntelang als Seglersteg Wind<br />
und Wellen ausgesetzt waren und im Salzwasser<br />
langsam alterten, Patina und die eine oder andere<br />
Seepocke ansetzten. Und die Fantasie der Ostholsteiner<br />
anregen: „Aus dem Material machen wir<br />
eine neue Produktlinie“, schwärmt Hansjörg Fischenbeck<br />
begeistert. „Das werden absolute Unikate<br />
im lichter°meer.“ Im großen Meer der<br />
kommerziellen Leuchten ist lichter°meer schon<br />
jetzt ein Einzelstück. UW ❚<br />
Hansjörg Fischenbeck und Liane Pitzschel<br />
KONTAKT<br />
Die Ostholsteiner gGmbH<br />
Hansjörg Fischenbeck<br />
Siemensstr. 17, 23701 Eutin<br />
Tel.: 04521 7993-34<br />
fischenbeck@die-ostholsteiner.de<br />
www.lichterpunktmeer.de<br />
A R B E I T : D I E O S T H O L S T E I N E R G G M B H , E U T I N<br />
27
ENTWICKLUNG/GEMISCHTE GRUPPEN<br />
Gelebte Inklusion<br />
➜ Thema: Menschen mit Behinderung aus Tagesförderstätte und Werkstatt<br />
arbeiten gemeinsam in gemischten Gruppen<br />
➜ Einrichtung: Osnabrücker Werkstätten der Heilpädagogischen Hilfe<br />
➜ Ort: Hilter, Sutthausen<br />
„HELMUT, LASS MAL LOS“, sagt Susanne<br />
Kuhn und reicht Dimitri Plutznikov einen<br />
Weidenzweig, den er in ein Weidengebinde<br />
einflechten will. Sie nimmt Helmut Westerwiede<br />
den nächsten Zweig ab und reicht ihn<br />
weiter: „Schau mal, Dimitri, so musst du den<br />
Zweig durchstecken.“ Helmut Westerwiede<br />
kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen<br />
und hält den nächsten Zweig so lange fest, bis<br />
die Gruppenleiterin schließlich kleinere Stücke<br />
davon abschneidet. Dimitri Plutznikov<br />
flechtet sie nach und nach ein, drückt hier<br />
und dort noch ein wenig nach, derweil Susanne<br />
Kuhn sanft Helmuts Hand löst: „Helmut<br />
Westerwiede aus Westerwiede, lass den<br />
Zweig los.“ Der lässt plötzlich locker, sie hat<br />
nicht damit gerechnet, der Zweig fällt runter,<br />
Helmut strahlt. „Schlitzohr“, sagt Susanne<br />
Kuhn. Kurz darauf kommen die Kollegen<br />
Oliver Michel und Simone Petri (beide<br />
Namen v. d. Red. geändert) vorbei, sie haben<br />
in der Mittagspause Fußball gespielt. „Wie<br />
geht es dir, Chef“, fragt Oliver und Simone<br />
herzt Helmut gleich, streicht ihm liebevoll<br />
übers Haar, „du siehst ja aus wie Räuber Hotzenplotz“,<br />
grinst sie. Die drei gehören zur<br />
Garten- und Weideflechtgruppe in Hilter, einem<br />
Standort der Osnabrücker Werkstätten:<br />
21 Beschäftigte, 3 Fachkräfte auf 2,5 Stellen,<br />
eine „durchmischte“ Gruppe: Menschen mit<br />
unterschiedlich hohem Unterstützungsbedarf<br />
aus Tagesförderstätte und Werkstatt arbeiten<br />
hier gemeinsam. Das ist etwas Besonderes.<br />
Menschen, die ein sogenanntes „Mindestmaß<br />
an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“<br />
nicht erbringen können, werden in<br />
besonderen Gruppen betreut, die als Tagesförderstätten<br />
oder Förder- und Betreuungsgruppen<br />
(FuB) teils an WfbM angegliedert,<br />
teils in anderer Trägerschaft separat organisiert<br />
sind: Menschen mit höherem Assistenzbedarf<br />
sind noch einmal besonders<br />
separiert. In der Behindertenhilfe hat sich<br />
deshalb die Auffassung durchgesetzt, eine<br />
unter der WfbM angesiedelte zweite Einrichtungsstruktur<br />
müsse, wegen weiterer<br />
Aussonderung, abgebaut werden. Das<br />
BTHG folgt dieser Auffassung nicht, son- i<br />
28<br />
Flechtarbeiten: Helmut Westerwiede, Susanne Kuhn und Dimitri Plutznikov (v.l.)<br />
E N T W I C K L U N G : H E I L P Ä D A G O G I S C H E H I L F E O S N A B R Ü C K K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
E N T W I C K L U N G : H E I L P Ä D A G O G I S C H E H I L F E O S N A B R Ü C K 29
Wenn Andreas Meyer aus dem Rollstuhl gehoben wird, helfen alle mit<br />
„Um Pflege kommt künftig bei uns niemand mehr herum“ ANNE BENAD, BEREICHSLEITUNG<br />
i dern legt nur eine engere Kooperation nahe,<br />
es bleibt bei der alten Struktur: Trennung<br />
der Bereiche.<br />
Gemischter Aufschlag 2011 Die Osnabrücker<br />
Werkstätten sind eine Werkstatt mit integrierter<br />
Tagesförderstätte. In den Fördergruppen<br />
werden Menschen mit hohem<br />
Unterstützungsbedarf aus der Tagesförderstätte,<br />
aber auch Werkstattbeschäftige mit der<br />
Hilfebedarfsstufe 4 und 5 betreut. 2011 begann<br />
die Werkstatt am Standort Hilter, die<br />
erste dieser Gruppen aufzulösen. „Das war<br />
der erste Schritt, um den Automatismus −<br />
jeder Mensch mit hohem Unterstützungsbedarf<br />
kommt in eine Fördergruppe − abzuschalten“,<br />
sagt Anne Benad, Bereichsleiterin<br />
der Osnabrücker Werkstätten. Inzwischen<br />
ziehen Schritt für Schritt andere Werkstattbetriebe<br />
nach und führen auch durchmischte<br />
Gruppen ein.<br />
Initiatorin des Projekts war Conny Kammann,<br />
die damalige Bereichsleiterin auch für<br />
den Standort in Hilter. Ihr Anliegen war es,<br />
der doppelten Aussonderung zu begegnen<br />
und besonders Menschen mit hohem Assistenzbedarf<br />
in den Mittelpunkt zu rücken,<br />
ihnen in inkludierenden Gruppen die<br />
Chance zu eröffnen, an Arbeitsprozessen,<br />
und sei es nur in winzigen Teilschritten, zu<br />
partizipieren und in seltenen Fällen die<br />
Werkstattberechtigung zu bekommen. Nach<br />
dem Weggang der einstigen Wegbereiterin<br />
übernahm Anne Benad die neu geschaffene<br />
Stelle der Koordinatorin der Intensivförderung<br />
und begleitet seitdem auch die Umsetzung<br />
an anderen Standorten.<br />
„Wir haben uns damals gefragt: Wie soll<br />
Inklusion in der Gesellschaft funktionieren,<br />
wenn wir es als Werkstatt nicht mal hinbekommen,<br />
die Menschen mit Behinderung an<br />
einem Ort gemeinsam zu begleiten und<br />
keine weitere Aussonderung zu betreiben?“,<br />
beschreibt Susanne Kuhn die Initialzündung<br />
für das Projekt. Die nötige Infrastruktur, um<br />
Pflege auch in Werkstattarbeitsgruppen zu<br />
gewährleisten − zusätzliche Pflegeräume und<br />
-bäder, Betten und Lifter − ließ sich rasch<br />
aufbauen, denn „wir hatten bereits weitere<br />
Pflegeräume geplant, sodass durchmischte<br />
Gruppen keinen Mehrbedarf verursachten“,<br />
meint Manuel Eisbrenner, Abteilungsleiter in<br />
der Werkstatt Hilter. Nächster Schritt: Beschäftigte<br />
und Mitarbeiter mussten vorbereitet,<br />
Fachkräfte für die zu übernehmende<br />
Pflege geschult werden.<br />
Die Angst vor der Pflege nehmen Die Schulungen<br />
drehten sich um die Themen Pflege,<br />
Ergotherapie, Logopädie und Kinästhetik. In<br />
der Pflegeberatung begleitete eine Pflege-<br />
Ausbilderin die Fachkräfte vor Ort: „Wir<br />
haben viel Hilfe an die Hand bekommen“,<br />
meint Rita Söger, Gruppenleiterin Raumpflege.<br />
„Wie muss ich bei Pflege mit den<br />
Menschen umgehen, wo stehe ich, wenn ich<br />
das Essen anreiche? Was mache ich bei<br />
Schluckbeschwerden?“ Am Anfang, sagt<br />
Anne Benad, täten sich reine Handwerker<br />
eher schwer mit dem Thema Pflege. Ihre Erfahrung:<br />
Die anfänglich ablehnende Haltung<br />
der Kollegen resultiere aus Unsicherheit, weil<br />
Wissen fehlte und Erfahrung. „Natürlich<br />
muss man auch verstehen, wenn Handwerker<br />
Pflege ablehnen und sagen, ich bin Elek-<br />
KONTAKT<br />
Osnabrücker Werkstätten<br />
Anne Benad, Bereichsleitung<br />
Industriestr. 17, 49082 Osnabrück<br />
Tel.: 0541 76028413<br />
a.benad@os-hho.de www.os-hho.de<br />
i<br />
i triker. So haben sie 20 Jahre gearbeitet. Trotzdem:<br />
Um Pflege kommt künftig bei uns niemand<br />
mehr herum.“ Und um den Spagat<br />
zwischen Wirtschaftlichkeit und angemessener<br />
Begleitung von pflegeintensiveren Gruppen<br />
besser zu gestalten, setzen die<br />
Osnabrücker künftig auf multiprofessionelle<br />
Teams. „Sicherlich sind die durchmischten<br />
Gruppen für die Mitarbeiter eine Herausforderung.<br />
Sie müssen das mittragen, sonst geht<br />
es nicht“, meint Manuel Eisbrenner. Die Erfahrung<br />
in Hilter: Sind die Menschen erst in<br />
der Gruppe „zusammengezogen“, wird es<br />
schnell zum Selbstläufer und zieht alle mit.<br />
Vom Betreuten zum Betreuer In Hilter wurden<br />
die Beschäftigten in den Morgenrunden<br />
auf die neuen Kollegen aus den Fördergruppen<br />
vorbereitet. Weil Tafö- und Werkstattgruppen<br />
ihre Räume im selben Gebäude<br />
haben, kennt man sich oft schon vom Sehen<br />
beim Mittagessen in der Kantine. Susanne<br />
Kuhn begleitete Helmut Westerwiede bei<br />
mehreren Schnupperbesuchen, oft vormittags,<br />
„das klappte auch mit den Beschäftigten<br />
sehr gut“, sagt die gelernte Heilerziehungspflegerin.<br />
Mit vier Teilnehmern der damaligen<br />
Intensivgruppe wechselte sie als Gruppenleiterin<br />
in die Garten- und Weidenflechtgruppe:<br />
„Im Sommer fahren viele der Beschäftigten<br />
mit meinem Kollegen Martin<br />
Ossegge raus. Die Beschäftigten, die es körperlich<br />
nicht mehr gut schaffen, und jene mit<br />
hohem Assistenzbedarf wie Helmut bleiben<br />
hier in der Flechtgruppe.“ Er profitiere sehr<br />
davon, Aufgaben zu haben. „Er übernimmt<br />
viele Teilschritte, macht Botengänge mit dem<br />
Rollstuhl.“ Seine Gruppenkollegen kümmern<br />
sich um ihn. Dieselbe Erfahrung macht<br />
auch Gruppenleiterin Rita Söger: Wenn ihre<br />
Reinigungsgruppe durchs Haus zieht und<br />
sauber macht, ist Andreas Meyer (Name v. d.<br />
Red. geändert) mit auf der Walz, dann streiten<br />
sich seine Kollegen darum, wer ihn wohin<br />
schieben, ihn in den Sitzsack legen darf. „Das<br />
Gruppengefüge hat sich verändert, auch<br />
wenn seine Arbeitsleistung gering ist, hat er<br />
großen Einfluss auf die Gruppe. Beschäftigte<br />
erleben sich selbst oft als Hilfeempfänger,<br />
nun können sie helfen und anderen etwas<br />
beibringen. Das fördert soziale Kompetenz.“<br />
Gemeinsame Arbeit: in Hilter Normalität.<br />
Und die Eltern? In Hilter kennen sie durchmischte<br />
Gruppen seit Jahren, entsprechend<br />
positiv sind sie gestimmt. Am Standort Sutthausen<br />
gab es bei neuen gemischten Gruppen<br />
zunächst Sorgen, was Pflege und auch Lärmpegel<br />
betraf. Die aber sind nach Gesprächen<br />
und der ersten Praxis verschwunden. „Und“,<br />
bemerkt Anne Benad, „seitdem wir die Spezialförder-<br />
und Intensivgruppen in Verpackungsgruppen<br />
umbenannt haben, sind alle<br />
völlig begeistert. Die alten Namen haben alle,<br />
besonders die Angehörigenbeiräte, als stigmatisierend<br />
empfunden.“<br />
Entscheidend: Wunsch und passende Arbeit<br />
„Es gibt Gruppen, in denen zwei Fachkräfte<br />
und zwei Praktikanten 28 Beschäftigte gut<br />
begleiten können, in anderen sind zwei Fachkräfte<br />
und zehn Beschäftigte sehr gefordert.<br />
Wir setzen deshalb auf eine Mischkalkulation:<br />
Die Standortrechnung muss aufgehen,<br />
nicht die einer jeden Gruppe“, erklärt Manuel<br />
Eisbrenner. „Wir schauen grundsätzlich nicht<br />
darauf, welchen refinanzierten Hilfebedarf<br />
jemand hat, sondern darauf, welchen<br />
Wunsch er hat und in welche Gruppenkonstellation<br />
er passt.“<br />
Welche Gruppe zu wem passt, hängt auch<br />
von den Arbeitsanforderungen ab. Seitdem<br />
Physio- und Ergotherapeuten dabei unterstützen,<br />
Arbeitsprozesse in kleinste Teilschritte<br />
runterzubrechen, steigt mit der Erfahrung<br />
auch das Angebotsspektrum. Anne<br />
Benad: „Gute Arbeit für die nicht so Leistungsstarken<br />
zu finden, ist grundsätzlich<br />
schwierig und keine Frage der Durchmischung.“<br />
Das klappt übrigens auch in Produktionsgruppen<br />
mit „wirtschaftlichem Outcome“:<br />
Vereinzelt arbeiten Menschen, die<br />
motorisch sehr eingeschränkt sind, im Rahmen<br />
ihrer Möglichkeiten in der Metallmontage<br />
mit als selbstverständlicher Teil der<br />
Engagieren sich für gemischte Gruppen: Anne Benad und Manuel Eisbrenner<br />
Gruppe. Den Spagat zwischen der Erfüllung<br />
anspruchsvoller Aufträge und Begleitung von<br />
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf<br />
schaffen die Gruppen − weil sie es wollen.<br />
Der Pflegebedarf steigt in den Werkstätten<br />
Das Konzept der durchmischten Gruppen<br />
auch auf andere Standorte zu übertragen, ist<br />
„ein weiter Weg, besonders, was die Umbaumaßnahmen<br />
betrifft. Allerdings müssen wir<br />
grundsätzlich für die Pflege nachrüsten: Auch<br />
für Beschäftigte, die älter werden und deren<br />
Fähigkeiten abnehmen, brauchen wir Pflegebäder.“<br />
Inzwischen ist ein Gebäude in Sutthausen<br />
umgerüstet, ein weiteres wird folgen<br />
und in bestehende Gruppen werden nach<br />
und nach Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf<br />
aufgenommen. Alternativ, aber<br />
nicht automatisch, wird es in Osnabrück weiterhin<br />
kleine, nicht gemischte Gruppen für<br />
Menschen mit hoher Pflegebedürftigkeit<br />
oder Verhaltensauffälligkeiten geben.<br />
Werkstätten müssen sich künftig breiter<br />
aufstellen, denn wenn ihre leistungsfähigeren<br />
Beschäftigten die Werkstatt in Richtung Arbeitsmarkt<br />
verlassen − oder gar nicht mehr<br />
in die Werkstatt kommen −, muss es auch<br />
Arbeit für die, die bleiben, geben, für die, die<br />
einen höheren Assistenz- und Pflegebedarf<br />
haben. Mit ihrem Konzept gemischter Gruppen<br />
sind die Osnabrücker dafür gut gerüstet.<br />
Vor allem aber zeigen sie, dass „alle gemeinsam“<br />
unabhängig von der Leistungsfähigkeit<br />
des Einzelnen funktioniert, weil sie es wollen.<br />
Was die Politik im BTHG nicht schafft, leben<br />
sie seit Jahren in der Praxis. GG ❚<br />
30 E N T W I C K L U N G : H E I L P Ä D A G O G I S C H E H I L F E O S N A B R Ü C K<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
E N T W I C K L U N G : H E I L P Ä D A G O G I S C H E H I L F E O S N A B R Ü C K 31
ENTWICKLUNG/STRATEGISCHES PERSONALMANAGEMENT<br />
Die entscheidende<br />
Herausforderung<br />
Werkstätten stehen zunehmend unter Druck, ihre<br />
Leistungen zu professionalisieren. KLARER KURS hat mit<br />
Martin Ossenberg, Geschäftsführer der Iserlohner<br />
Werkstätten gGmbH, über strategisches Personalmanagement<br />
und den Anpassungsdruck von Werkstätten gesprochen.<br />
32 E N T W I C K L U N G : I S E R L O H N E R W E R K S T Ä T T E N G G M B H<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
KLARER KURS: Ein strategisches Personalmanagement verbindet<br />
man gemeinhin nur mit großen Wirtschaftsunternehmen.<br />
Warum wird dieses Instrument auch für eine Werkstatt für behinderte<br />
Menschen wichtig?<br />
MARTIN OSSENBERG: Ein entscheidender Grund ist die Demografie.<br />
Wir haben bei den Fachkräften eine große Breite<br />
im Alter zwischen 50 und 65. Auf Leitungsebene ist sogar<br />
nur die Dekade zwischen 55 und 65 vertreten. Das zweite<br />
große Thema ist der Fachkräftemangel, insbesondere aus<br />
dem Bereich Elektronik. Es ist sehr schwierig geworden,<br />
Menschen aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt für unsere<br />
Aufgaben zu motivieren.<br />
KK: Weil die Konkurrenz der Privatwirtschaft zu übermächtig<br />
ist?<br />
MO: Zumindest, was das Finanzielle angeht. Elektriker wissen<br />
sehr gut, was sie wert sind. Da wären wir beim nächsten<br />
Punkt: Die finanziellen Ressourcen sind eine Herausforderung<br />
– immer weiter steigende Personalkosten versus gedeckelte<br />
Refinanzierung. Auch das Thema Digitalisierung<br />
spielt eine große Rolle. Sowohl im Kommunikationsbereich<br />
als auch im Bereich der unterstützten Fertigung.<br />
KK: Das heißt, die Kompetenzen, die ein Facharbeiter mitbringen<br />
muss, sind weitreichender, als es seinem klassischen Berufsbild<br />
entspricht?<br />
MO: Genau. Und dies trifft auf den Wandel auf dem Stellenmarkt.<br />
Ich kann mich noch gut erinnern, dass 100 Bewerbungen<br />
auf eine Gruppenleiterstelle vor Jahren keine<br />
Seltenheit waren. Inzwischen müssen wir Bewerbern unsere<br />
Stärken darlegen und nicht umgekehrt. Hinzu kommt, dass<br />
wir gerade hier in Nordrhein-Westfalen ein massives Imageproblem<br />
haben, seit bei RTL der Wallraff-Report über Gewalt<br />
in Werkstätten ausgestrahlt wurde. Wir haben<br />
daraufhin sogar mit RTL einen Fernsehbeitrag über ein positives<br />
Beispiel von Werkstatt gedreht, aber schlechte Nachrichten<br />
halten sich ziemlich hartnäckig.<br />
KK: Wie hilft ein strukturiertes Personalmanagement da<br />
weiter?<br />
MO: Es greift alle Herausforderungen auf. Die fünf zentralen<br />
Module lauten Personalgewinnung, Personalauswahl,<br />
Personalbindung, Personalentwicklung und Personalcontrolling.<br />
Wir sind vor sieben Jahren mit dem Projekt Personalmarketing<br />
gestartet und haben dafür aus unserem Team<br />
eine Mitarbeiterin mit dem Schwerpunkt Personalmanagement<br />
betraut. Ziel ist, uns als attraktiven Arbeitgeber zu<br />
präsentieren, unseren Bedarf an qualifiziertem Personal zu<br />
decken und damit unseren Unternehmenserfolg zu sichern.<br />
KK: Und wie erfüllt man so ein Programm mit Leben?<br />
MO: Es braucht ein strukturiertes Projektmanagement und<br />
man muss möglichst viele aus dem Unternehmen beteiligen<br />
– auch hierarchieübergreifend. Multiplikatoren müssen das<br />
Thema weitertragen und umgekehrt die Wünsche der Kolleginnen<br />
und Kollegen aus dem Haus einbringen. Aber es<br />
reicht nicht, ein Personalmanagement-System einzuführen<br />
und zu denken, dann wird alles besser. Das geht nur im<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
Kontext der gesamten Unternehmensentwicklung. Dazu gehört<br />
zunächst vor allen Dingen eine gelebte Unternehmenskultur.<br />
Man muss sich mit Dingen wie Führungsstil<br />
auseinandersetzen mit der Frage, welches Menschenbild<br />
wollen wir vermitteln? Wollen wir weiterhin sagen, ein<br />
Mensch mit Behinderung ist derjenige, der von uns betreut<br />
wird, oder ist das ein Mensch, der von uns assistiert wird?<br />
Wir haben bei uns sehr viele Begrifflichkeiten umgestellt,<br />
um unseren Ansatz deutlich zu machen. Das Wort Betreuung<br />
spielt bei uns zum Beispiel keine Rolle mehr. Der Gedanke<br />
Assistenz muss im Unternehmen aber lange<br />
diskutiert und verfestigt werden.<br />
KK: Wo stehen Sie heute?<br />
MO: Wir sind noch mitten im Prozess, aber schon ganz gut<br />
aufgestellt. Wir haben den kooperativen Führungsstil etabliert.<br />
Abteilungsleitungen zeigen Personalbedarf an und sie<br />
sind auch dafür verantwortlich, das Personal zu bekommen.<br />
Das heißt, sie stoßen den Bewerbungsprozess an, verantworten<br />
den Auswahlprozess und geben den Impuls, um jemanden<br />
einzustellen.<br />
KK: Wie sieht das in der Praxis aus?<br />
MO: Für die Gewinnung von Fachkräften haben wir eine eigene<br />
Stelle für Recruiting aufgebaut. Man könnte dies<br />
durchaus auch als Vertriebsstelle bezeichnen. Die Mitarbeiterin<br />
hat die Aufgabe, uns bei Bewerbern attraktiv zu machen<br />
und sie für uns zu werben.<br />
„Karriereplanung gleich<br />
bei der Einstellung spielt eine<br />
zunehmend große Rolle“<br />
KK: Wie geht das?<br />
MO: Die Mitarbeiterin nutzt dafür zum Beispiel alle sozialen<br />
Netzwerke. Sucht man einen Produktionshelfer, kann man<br />
durchaus über ebay-Kleinanzeigen gehen, um Führungskräfte<br />
zu gewinnen, nutzt man Stepstone oder spricht jemanden<br />
gezielt über Xing oder Linkedin an. Wir arbeiten<br />
auch immer mal wieder mit einem Beratungsunternehmen<br />
zusammen, das für uns nach Fachkräften sucht. Eine große<br />
Rolle spielt inzwischen Kununu – die Bewertung von Unternehmen<br />
durch Mitarbeitende oder Ehemalige im Netz.<br />
Viele der Generation X und der Generation Millenium machen<br />
sich erst mal über diesen Weg schlau, bei wem sie sich<br />
bewerben.<br />
KK: Was macht Sie zu einem attraktiven Arbeitgeber?<br />
MO: Das beginnt beim Thema Tarif. Wir nutzen die gesamte<br />
Bandbreite des Tarifs, agieren flexibel mit Zulagen und Prämien,<br />
die mit besonderen Aufgaben verknüpft sind. Von den<br />
etablierten Eingruppierungen haben wir uns gelöst und versuchen,<br />
alles gleich in einen Personalentwicklungsprozess<br />
einzubinden. Man kann auch sagen Karriereplanung oder<br />
Talentförderung. Das spielt eine zunehmend große Rolle.<br />
E N T W I C K L U N G : I S E R L O H N E R W E R K S T Ä T T E N G G M B H<br />
33<br />
i
i<br />
KK: Was bedeutet das für die Werkstatt?<br />
MO: Über die Personalentwicklung haben wir mittlerweile in<br />
vielen Teams Experten sitzen. Ein Kollege hat sich zum Beispiel<br />
vor Jahren intensiv mit dem Thema Autismus-Spektrums-Syndrom<br />
befasst, hat Zusatzausbildungen gemacht<br />
und ist heute nicht nur bei uns, sondern in vielen Werkstätten<br />
in der Region als Ansprechpartner unterwegs. Dadurch<br />
haben wir gute Kontakte zum Autismus-Zentrum in Dortmund<br />
entwickelt, was wiederum dazu führte, dass vermehrt<br />
Anfragen für diesen Personenkreis kamen und wir inzwischen<br />
fast ideale Arbeitsbedingungen für diese Menschen<br />
vorhalten. Auf ähnliche Weise haben wir Angebote für Menschen<br />
mit herausforderndem Verhalten im Haus etabliert.<br />
Kollegen haben sich außerdem mit dem Thema Gewaltprävention<br />
auseinandergesetzt, mittlerweile haben wir 15 geschulte<br />
Part-Trainer zur Gewaltprävention, die ihr Wissen an<br />
Kolleginnen und Kollegen weitergeben.<br />
KK: Personalentwicklung erschließt also ganz neue Geschäftsbereiche?<br />
MO: Genau, das erweitert das Angebotsspektrum. Man<br />
könnte sagen, diese Themen gehören nicht zu unserem ursprünglichen<br />
Aufgabengebiet, aber damit ließe man auch die<br />
neue Anbietersituation außer Acht. Wir sagen nicht, wir<br />
brauchen erst Personal, um ein Angebot zu machen, sondern<br />
stellen personelle Ressourcen bereit, ermöglichen Schulungen<br />
und Fortbildungen und versuchen, ein Angebot zu erarbeiten.<br />
Aktuell ist Forensik ein großes Thema, mit dem sich einige<br />
Kollegen befassen, und wir ein Angebot dazu aufbauen<br />
wollen.<br />
KK: Wie durchlässig ist ihr System der Personalentwicklung für<br />
Menschen mit Beeinträchtigungen?<br />
MO: Die Möglichkeit gibt es auch. Wir haben einen jungen<br />
Mann motivieren können, eine Ausbildung als Fachkraft<br />
Lager/Logistik bei uns zu absolvieren. Aber dabei handelt es<br />
sich in der Tat noch um Einzelfälle.<br />
KK: Bleiben wir bei der Personalgewinnung. Womit punkten<br />
Sie noch als attraktiver Arbeitgeber?<br />
MO: Zum Beispiel mit der betrieblichen Altersvorsorge, die<br />
momentan nur vom Arbeitgeber getragen wird. Vergleicht<br />
man das mit Angeboten der normalen Versicherungswirtschaft,<br />
ist das allemal attraktiv. Des Weiteren haben wir Arbeitszeitkonten<br />
mit Gleitzeit. Kernzeit ist, wenn unsere<br />
Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung vor Ort sind. Aber innerhalb<br />
dieser Einheit kann man flexibel arbeiten. Und wenn<br />
eine Fachkraft zum Beispiel die Entwicklungsplanung für Beschäftigte<br />
am PC dokumentieren will, ist das auch mal von zu<br />
Hause aus möglich.<br />
KK: Inwieweit ist Flexibilisierung innerhalb der Kernzeit denn<br />
möglich?<br />
MO: Flexible Arbeitszeiten haben wir zunehmend auch bei<br />
Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung. Insbesondere bei ausgelagerten<br />
Arbeitsplätzen hat sich das etabliert. In unserem<br />
Cafébetrieb arbeiten wir im Schichtdienstbetrieb und bei<br />
Kulturangeboten arbeiten Kollegen auch abends und entscheiden,<br />
ob sie am nächsten Tag später anfangen oder die<br />
Zeit auf ihrem Gleitzeitkonto ansparen. Wir wünschen uns<br />
ein Mehrschichtsystem auch in anderen Bereichen.<br />
KK: Reicht das der Generationen X und Millenium,<br />
denen man nachsagt, besonderen Wert auf Work-Life-<br />
Balance zu legen?<br />
MO: Das nehmen wir auch wahr und reagieren nicht nur mit<br />
flexiblen Arbeitszeiten, sondern auch mit Teilzeitangeboten.<br />
Wir hatten vor einiger Zeit die Bewerbung einer Sozialarbeiterin,<br />
die am Ende sagte, es geht zwar um eine Vollzeitstelle,<br />
aber mir reichen 25 Stunden. Vor fünf Jahren hätten wir noch<br />
gesagt, „es war nett Sie kennenzulernen“. Heute wägen wir ab,<br />
ob uns die Kompetenzen, die jemand mitbringt, wichtiger<br />
sind. Auch bei unseren Mitarbeitern mit Beeinträchtigung<br />
haben wir zunehmend Teilzeitwünsche. Da versuchen wir,<br />
noch deutlich flexibler zu werden.<br />
KK: Wir haben bisher nur davon gesprochen, wie Sie um Fachpersonal<br />
buhlen. Andererseits müssen die Bewerber neben ihren<br />
fachlichen Qualitäten hohe soziale und kommunikative Kompetenzen<br />
oder Empathiefähigkeit mitbringen. Wie loten Sie diese<br />
Fähigkeiten bei der Bewerberauswahl aus?<br />
MO: Das ist ein sehr entscheidender Aspekt und die Herausforderung,<br />
eine Stellenausschreibung so zu formulieren,<br />
dass sie die Anforderungen an die Stelle realistisch wiedergibt<br />
und Bewerber auch anspricht. Tatsächlich haben wir<br />
inzwischen eine sehr appellative Form der Stellenausschreibung.<br />
Die Attraktivitätsfaktoren als Arbeitgeber stehen<br />
dabei mehr im Vordergrund als das, was wir von Bewerberinnen<br />
und Bewerbern erwarten. Um eine möglichst passende<br />
Personalauswahl treffen zu können, haben wir<br />
sogenannte Bewerbertage eingeführt, um unsere Anforderungen<br />
auszuloten. Wir strukturieren solche Tage mit einem<br />
gewissen Programm, das für alle Kandidatinnen und Kandidaten<br />
gleich ist, und am Ende des Tages gibt es eine Bewertung.<br />
Der Vorteil ist, dass sich mehrere Stellen im Unternehmen<br />
einen Eindruck von der Person verschaffen können. i<br />
i<br />
KK: Welche Menschen kommen dann letztlich zu Ihnen, sind<br />
das sozial engagierte Menschen, Idealisten, Leute, die nach<br />
einem Praktikum hängen bleiben?<br />
MO: Das ist gut zusammengefasst. Aber sie bleiben nicht<br />
zufällig hängen. Zum Recruiting gehört, dass wir ganz bewusst<br />
Werbung machen. Wir lassen uns bei jeder Ausbildungsmesse<br />
sehen, wir sind ja seit 15 Jahren Ausbildungsbetrieb<br />
und bilden von der Industriekauffrau bis zur Fachkraft<br />
Lager Logistik querbeet alles aus, was wir im Unternehmen<br />
benötigen. Wir versuchen, unsere eigenen<br />
Fachkräfte über Ausbildung an uns zu binden. Wir gehen<br />
in die Schulklassen, die sich für die Berufswahl vorbereiten,<br />
und bieten gemeinsam mit den Industrie- und Handwerkskammern<br />
an, eine Management-AG mit den Iserlohner<br />
Werkstätten durchzuführen. Wir haben inzwischen<br />
viele Stellen über eigene Azubis besetzt. Aktuell haben wir<br />
23 neue Auszubildende, sie stellen fast zehn Prozent der<br />
Gesamtbelegschaft. Aber auch für diese jungen Leute müssen<br />
wir attraktiv erscheinen, damit sie sich bewerben.<br />
„Wenn sich das Unternehmen<br />
um den Mitarbeiter kümmert,<br />
kümmert sich der Mitarbeiter<br />
auch um das Unternehmen“<br />
KK: Und wie gelingt es, das Personal auch zu halten?<br />
MO: Da sind neben Entwicklungsmöglichkeiten weiche<br />
Faktoren sehr entscheidend. Wenn sich das Unternehmen<br />
um den Mitarbeiter kümmert, kümmert sich der Mitarbeiter<br />
auch um das Unternehmen. Wir haben eine Seelsorgerin<br />
und Gesprächstherapeutin, die als Ansprechpartnerin<br />
für alle möglichen Probleme da ist. Sie hilft auch mit<br />
Kontakten, wenn jemand pflegebedürftige Eltern hat, Probleme<br />
mit Kindern. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass<br />
sich Mitarbeitende über unser Unternehmen Rat holt. Außerdem<br />
machen wir viele Angebote im Bereich Gesundheitsmanagement,<br />
bieten regelmäßig Themenwochen an.<br />
Aktuell geht es um Mobbing. Voriges Jahr ging es um<br />
Sucht, Alkohol, Bewegung, Ernährung. Dazu arbeiten wir<br />
auch mit externen Anbietern. Die Angebote gelten für alle<br />
Mitarbeitenden im Unternehmen, wir kommunizieren sie<br />
über Plakate und PCs, die barrierefrei genutzt werden<br />
können.<br />
KK: Wie kommt das alles bei der Belegschaft an?<br />
MO: Wir befragen regelmäßig unsere Mitarbeitenden<br />
nach ihrer Arbeitszufriedenheit und nach psychischen<br />
Belastungsfaktoren des gesamten Arbeitsumfeldes (JOB-<br />
STRESS ANALYSIS, ITA-Benchmarking). Nach der aktuellen<br />
Befragung von diesem Jahr fällt das Urteil sehr positiv<br />
aus. Insbesondere die Arbeitszufriedenheit und eigene<br />
Arbeitsplatzsituation haben sich seit der vorherigen Befragung<br />
vor drei Jahren deutlich verbessert. Begründet wird<br />
dies zum einen mit dem Flexibilisieren der Arbeitszeit, aber<br />
gerade auch mit diesem „Kümmern“. Inwieweit fühle ich<br />
mich als Mitarbeiter in meinem Arbeitsumfeld wahrgenommen?<br />
Wie kann ich Probleme kommunizieren? Werde<br />
ich abgeholt und verstanden oder werde ich gleich abgestempelt<br />
als jemand, der nur quengelt und meckert. Das<br />
hat sich wesentlich verbessert, viele Mitarbeitende identifizieren<br />
sich sehr mit dem Unternehmen.<br />
KK: Viele Dinge, die Sie genannt haben, sind Standards in privaten<br />
Unternehmen. Kann sich Werkstatt vor diesem Anpassungsdruck<br />
und solchen Entwicklungsthemen verschließen?<br />
MO: Nein, das wird spätestens nach den veränderten Rahmenbedingungen<br />
durch das BTHG deutlich. Die Anforderungen<br />
der Leistungsträger an die Professionalisierung der<br />
Werkstätten werden weiter steigen, und wenn man nicht<br />
nur verlängerte Werkbank des Kunden sein will, muss man<br />
seine Leistung profilieren. Noch gelingt es Werkstätten zu<br />
wenig darzustellen, was sie wirklich können. Und eines<br />
können sie ganz besonders gut: die Entwicklung, Qualifizierung<br />
und Bildung von Menschen durch das Medium<br />
Arbeit. Das gilt für Mitarbeitende mit und ohne Beeinträchtigungen<br />
gleichermaßen.<br />
KK: Welche Rolle spielt dabei ein strukturiertes Personalmanagement?<br />
MO: Aus meiner Sicht stellt dieser Prozess das entscheidende<br />
Handlungsfeld für eine erfolgreiche Entwicklung<br />
auch von Werkstätten dar. Wir sehen es bereits zum Beispiel<br />
in der Pflege. Viele Angebote können wir nicht vorhalten,<br />
weil Personal fehlt. Es geht darum, Kompetenzen<br />
aufrechtzuerhalten und zu entwickeln, Nachfolge zu regeln,<br />
damit wir nicht an Qualität verlieren.<br />
KK: Holen Sie sich dabei auch Hilfe von außen?<br />
MO: Wir nutzen mehrere Beratungsfirmen für Schulungen<br />
und Coachingprozesse, eine für Personal und Organisation,<br />
eine weitere für inhaltliche Fragestellungen rund um<br />
unser Geschäft und eine für weiche Faktoren. Wir beteiligen<br />
uns über Unis und Hochschulen auch an Projekten, die<br />
öffentlich gefördert werden. Und wir haben fünf dual Studierende,<br />
die jeweils im Wechsel drei Monate in Villingen-<br />
Schwenningen Sozialwirtschaft studieren und drei Monate<br />
bei uns arbeiten. Das hat den Vorteil, dass Themen aus der<br />
Wissenschaft schnell Eingang in unser Unternehmen finden.<br />
Die Studierenden kümmern sich um übergreifende<br />
Themen wie Gesundheitsmanagement oder um Sonderprojekte<br />
wie Erklärvideos für Menschen mit Beeinträchtigungen,<br />
für die wir sonst kaum die notwendigen<br />
personellen und fachlichen Ressourcen hätten. ❚<br />
KONTAKT<br />
Iserlohner Werkstätten<br />
gGmbH<br />
Martin Ossenberg<br />
Geschäftsführer<br />
Giesestraße 35<br />
58636 Iserlohn<br />
Tel.: 02371 9766-145<br />
martin.ossenberg@iswe.de<br />
34<br />
E N T W I C K L U N G : I S E R L O H N E R W E R K S T Ä T T E N G G M B H<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
E N T W I C K L U N G : I S E R L O H N E R W E R K S T Ä T T E N G G M B H<br />
35
ENTWICKLUNG/GASTKOMMENTAR<br />
Was und wie viel verdienen<br />
Werkstattbeschäftigte?<br />
DER BUNDESTAG HAT IM JUNI das Gesetz zur Anpassung der<br />
Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes beschlossen.<br />
Damit erhöht sich ab dem 01.08.19/01.08.20 das Ausbildungsgeld für<br />
Teilnehmer im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich anerkannter<br />
Werkstätten für behinderte Menschen von 80 auf 117 Euro/<br />
119 Euro monatlich. Die Erhöhung des Ausbildungsgeldes hat auch<br />
Auswirkungen auf die Höhe des Grundbetrages für Beschäftigte im<br />
Arbeitsbereich einer WfbM. Der Grundbetrag ist gemäß SGB IX an<br />
die Höhe des Ausbildungsgeldes gekoppelt. Eine kurzfristige Steigerung<br />
von 80 auf 117 Euro hätte nicht wenige Werkstätten vor große<br />
finanzielle Herausforderungen gestellt. Daher hat der Bundestag auf<br />
Drängen vieler Akteure die Erhöhung „gestreckt“.<br />
Der Grundbetrag wird nun in vier Stufen angepasst und beträgt<br />
erst ab dem 01.01.23 dann mindestens 119 Euro. Außerdem wird die<br />
Bundesregierung beauftragt, in den nächsten vier Jahren unter Beteiligung<br />
der Werkstatträte, der BAG WfbM, der Wissenschaft und weiterer<br />
maßgeblicher Akteure ein transparentes, nachhaltiges und<br />
zukunftsfähiges Entgeltsystem zu entwickeln – hierfür hatte sich vor<br />
allem die BAG WfbM eingesetzt. Damit öffnet sich ein Zeitfenster für<br />
eine Reform des jahrzehntealten, kaum mehr durchschaubaren Systems<br />
der Vergütung von Werkstattbeschäftigten, das erkennbar an<br />
seine Grenzen gekommen ist: Die „gut gemeinte“ Erhöhung des<br />
Grundbetrags wäre bei sehr vielen Beschäftigten gar nicht angekommen<br />
und entweder über eine Absenkung des sogenannten Steigerungsbetrags<br />
oder über die Anrechnung auf die Grundsicherung<br />
ganz oder teilweise abgefischt worden. Die schätzungsweise 150 000<br />
in einer WfbM arbeitenden Grundsicherungsempfänger können sich<br />
zudem die Frage stellen, warum sie eigentlich jeden Tag arbeiten<br />
gehen, haben sie dadurch doch kaum mehr in der Tasche. Natürlich<br />
ist es unredlich zu behaupten, Werkstattbeschäftigte „verdienten“ nur<br />
durchschnittlich etwa 200 Euro im Monat, und zugleich die beträchtlichen<br />
Transferleistungen des Staates für diesen Personenkreis einfach<br />
zu verschweigen.<br />
Andererseits stellt sich unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten<br />
nicht nur angesichts der UN-BRK die Frage, ob Menschen mit<br />
Behinderung, die tagtäglich im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine Arbeitsleistung<br />
erbringen, wirklich auf Sozialhilfe angewiesen sein<br />
müssen oder nicht besser einen Lohn bzw. ein Gehalt bekommen<br />
sollten, das unter bestimmten Bedingungen sogar zum Leben reicht.<br />
Welche möglichen Varianten sind bisher in der Diskussion aufgetaucht?<br />
Da ist zum einen die kräftige und dann regelmäßige Erhöhung<br />
des Arbeitsförderungsgeldes, also die staatliche Subvention des<br />
Grundbetrags. Da ist zum anderen die Bündelung aller Transferleistungen<br />
zu einem „Gehalt“, das wie aus einer Hand ausgezahlt wird,<br />
entweder pauschal oder mit entsprechender Einzelfallprüfung. Und<br />
da sind Varianten für ein (subventioniertes) auskömmliches Werkstatt-Einkommen,<br />
das sich etwa am Mindestlohn, an einem Rentenwert<br />
oder anteilig am Durchschnittslohn orientiert. Alle Varianten<br />
müssen u.a. hinsichtlich folgender Fragen abgeklopft werden: Wie ist<br />
das Verhältnis zwischen Transferleistungen und „Gehalt“, wie viel<br />
kommt wirklich beim Beschäftigten netto und anrechnungsfrei an,<br />
wie transparent und einfach nachvollziehbar ist das System, können<br />
zukünftig regelmäßige Steigerungen des Entgelts abgebildet werden,<br />
inwieweit fließen die Wirtschaftskraft der Werkstatt und die eigene<br />
Leistung in die Entgelthöhe mit ein? Das alles verspricht eine komplexe<br />
Debatte, die seriös und konstruktiv geführt werden muss,<br />
damit es am Ende auch ein gutes Ergebnis gibt.<br />
Was aus meiner Sicht auf keinen Fall passieren darf: dass die aufgestockte<br />
Erwerbsminderungsrente als Nachteilsausgleich entfällt.<br />
Denn als der liebe Gott bestimmt hat, wer von Geburt an oder später<br />
durch Unfall bzw. Krankheit behindert wird, hat sich wohl keiner<br />
von uns freiwillig gemeldet oder etwa laut „Hier!“ gerufen. Auch deshalb<br />
hat sich unsere Gesellschaft dafür<br />
entschieden, für Menschen mit Behinderung<br />
Nachteile auszugleichen, damit<br />
sie möglichst gleichberechtigt am gesellschaftlichen<br />
Leben teilhaben können.<br />
Vielleicht wäre es sogar klug,<br />
diesen Nachteilsausgleich unter bestimmten<br />
Bedingungen für eine etwaige<br />
Arbeitsmarktkarriere nach der<br />
Zeit in der Werkstatt an die Person zu<br />
„binden“. Dann verliert niemand ein<br />
„Rentenprivileg“, wenn er/sie von der<br />
WfbM in den allgemeinen Arbeitsmarkt<br />
wechselt. ❚<br />
DR. JOCHEN WALTER,<br />
Vorstand Stiftung Pfennigparade<br />
und Stellvertretender<br />
Vorsitzender der BAG<br />
WfbM<br />
SEIT ÜBER EINEM JAHR arbeite ich drei<br />
Tage in der Woche, Mittwoch bis Freitag,<br />
bei der Finanzberatung Mauersberger UG<br />
auf einem Außenarbeitsplatz der Wefa Eisfeld.<br />
Bei uns geht es um Finanzierungen,<br />
staatliche Förderungen, Geldanlagen, Bausparen<br />
und Kompositversicherungen wie<br />
Hausrat, Haftpflicht, Unfall oder auch KFZ.<br />
Mein Aufgabenbereich ist ziemlich groß:<br />
Ich bearbeite die Post, habe viel Kundenkontakt,<br />
erfasse die Verträge von neuen und<br />
von Bestandskunden in Excellisten mit<br />
ihren zugehörigen Maklerverträgen und<br />
sende die Liste regelmäßig an den Maklerpool<br />
in Marburg. Denn wenn jemand über<br />
uns einen Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft<br />
abschließen will, brauchen wir<br />
eine Maklervollmacht, die uns berechtigt,<br />
die Angelegenheiten in seinem Interesse zu<br />
erledigen. Falls derjenige noch andere Versicherungsverträge<br />
hat und es will, können<br />
wir mit der Vollmacht seine anderen Verträge<br />
mitbetreuen. Das wird für uns in Marburg<br />
hinterlegt und mit den einzelnen<br />
Gesellschaften geregelt. Außerdem übernehme<br />
ich im Sachbereich auch Abschlüsse<br />
im PC: zum Beispiel, wenn Kunden ihr<br />
Auto bei uns versichern möchten. Dann<br />
suche ich nach einer preisgünstigen Gesellschaft,<br />
und wenn die dem Kunden gefällt,<br />
erledige ich alle weiteren Vertragsgeschäfte.<br />
Unterschrieben wird heute gar nichts mehr:<br />
Der Kunde bekommt eine Police zugeschickt,<br />
fertig.<br />
Ich arbeite von acht bis halb drei und<br />
schmeiße das Büro oft ganz allein, weil Herr<br />
Mauersberger viele Außentermine hat. Also,<br />
Zeit für Langeweile habe ich nicht. Manchmal,<br />
wenn ich morgens komme, frühstücken<br />
wir erst zusammen. Auf meinem<br />
Schreibtisch liegen dann schon die Unterlagen,<br />
die ich bearbeiten soll, und Herr Mauersberger<br />
erklärt mir, was ich bei welchem<br />
Kunden erledigen muss. Am meisten gefällt<br />
mir der Umgang mit Menschen. Ich freue<br />
mich immer, wenn sich Menschen für einen<br />
guten Rat bedanken oder sich glücklich<br />
schätzen, wenn alles funktioniert. Beratungen<br />
übernehme ich nicht, aber ich unterhalte<br />
mich mit den Kunden, wenn ich<br />
Verträge vorbereitet habe. Oft kommen sie<br />
vorbei und fragen nach dem Stand der<br />
Dinge, dann rufe ich bei den jeweiligen Versicherungsgesellschaften<br />
an und fasse nach.<br />
Die Arbeit macht mir Spaß: Ich komme<br />
aus diesem Bereich, bin gelernter Industriekaufmann,<br />
war selber viele Jahre bei einer<br />
Vermögensberatungsgesellschaft und habe<br />
/MEIN ARBEITSPLATZ/<br />
Michael Skalda: Man muss immer<br />
das Beste daraus machen!<br />
viel Erfahrung. Ich besitze den Ausbilderschein<br />
und habe mich immer weitergebildet:<br />
Bildung ist der Baustein für die<br />
Zukunft! Nur kann ich heute gesundheitlich<br />
nicht mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt<br />
die volle Leistung bringen. Seit<br />
sieben Jahren bin ich in der Werkstatt, seitdem<br />
ich auf dem Außenarbeitsplatz bin,<br />
aber nur noch montags und dienstags in<br />
der Industriemontage: Weil ich Werkstattrat<br />
bin, will ich für die Beschäftigten ansprechbar<br />
bleiben. Trotzdem wollte ich auch<br />
Veränderung, ein bisschen Abwechslung.<br />
Wenn man selber merkt, dass man gern<br />
noch mal was anderes probieren will, und<br />
wenn das dann auch noch funktioniert,<br />
dann ist es einfach schön. Mein Motto lautet:<br />
Das Leben genießen. Und, sag ich mal:<br />
Man muss immer das Beste daraus machen!<br />
Ich bin froh, dass Herr Mauersberger mir<br />
die Chance gegeben hat zu zeigen, was ich<br />
kann. Dass er zufrieden mit mir ist, ist mir<br />
sehr wichtig, und auch, dass wir uns gegenseitig<br />
mit Respekt behandeln. ❚<br />
KONTAKT<br />
Doreen Dietmann, Wefa Eisfeld<br />
Hintere Bahnhofstraße 1, 98673 Eisfeld<br />
Tel.: 03686 3937-15<br />
d.dietmann@diakoniewerk-son-hbn.de<br />
36 E N T W I C K L U N G : G A S T K O M M E N T A R K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9 E N T W I C K L U N G : M E I N A R B E I T S P L A T Z 37
KULTUR/INKLUSIVES KLANGPUZZLE<br />
SPHÄRISCHE MUSIK schallt leise aus dem Chorraum, erfüllt das<br />
hohe, schlicht weiße Kirchenschiff der einst barock gestalteten Augustinerkirche<br />
mitten in der Würzburger Fußgängerzone. Klangkulisse<br />
für magische Theatermasken, großformatige Gemälde und Tonskulpturen,<br />
die behinderte Künstlerinnen und Künstler aus dem Würzburger<br />
Raum geschaffen haben und im Halbrund des Altarraums<br />
ausgestellt sind. „Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol<br />
ich der Königin ihr Kind ...“ Beim Nähertreten tönt die Stimme deutlich<br />
aus dem Klangteppich, lässt aufzucken und auf die dämonische<br />
Maske „Myros“ schauen, die der Künstler Georg Brand in der Theaterwerkstatt<br />
Eisingen einst für das Stück Labyrinth geschaffen hat. Aus<br />
dem Hintergrund singt eine Stimme leise „Stille Nacht“, gefolgt von<br />
der Frage „Hast du heute Zeit?“. Besucher bleiben stehen, treten vor<br />
und zurück, heben die Arme und bemerken, dass jede ihrer Bewegungen<br />
neue Sätze, Gesänge, Geräusche auslöst. Im Nu sind alle ins<br />
Geschehen involviert, bewegen sich im spontanen Schreittanz umeinander<br />
und um die Ausstellungspodeste mit Masken und Tonskulpturen,<br />
in denen Lautsprecher und Bewegungsmelder montiert sind.<br />
„Klangpuzzle“ heißt die ungewöhnliche interaktive Kunst- und Klanginstallation,<br />
die der Würzburger Komponist und Klangkünstler Bur-<br />
kard Schmidl gemeinsam mit der Pädagogin und Musikerin Antje Arlt<br />
und Michael Wenzel, dem langjährigen Prokuristen der Mainfränkischen<br />
Werkstätten in Würzburg, auf die Beine gestellt hat.<br />
„Die erste Idee entstand aus dem Gedanken, dass ständig um Spenden<br />
und Unterstützung für Hilfsprojekte gebeten wird. Ich wollte den<br />
Spieß umdrehen und Menschen mit Behinderungen um eine Spende<br />
bitten – einen Klang.“ Aus der „schrägen Idee“ montierter Klangbeiträge,<br />
mit der Schmidl vor Jahren bei Michael Wenzel vorsprach, wurde<br />
2016 eine erste interaktive Kunst- und Klangausstellung bei den Mainfränkischen<br />
Werkstätten. „Die kam so gut an, dass wir das in größe- i<br />
In der Mitte hört man alles: Marcel Erbacher<br />
1 Enrico Illhardt<br />
und seine Masken<br />
(2+4)<br />
3 Valentina Sudweg<br />
5 Klangspender<br />
Marcel Erbacher<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Meister des Klangs: Burkard Schmidl<br />
Die verbindende Kraft<br />
des Klangs<br />
➜ Thema: Menschen mit und ohne Behinderungen werden durch persönliche Klangspenden<br />
Teil eines großen, grenzenlosen Klang-Kunstwerkes<br />
➜ Einrichtung: Klangkünstler Burkard Schmidl und Mainfränkische Werkstätten<br />
gGmbH<br />
➜ Ort: Würzburg<br />
38 E N T W I C K L U N G : M A I N F R Ä N K I S C H E W E R K S T Ä T T E N G G M B H W Ü R Z B U R G<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
E N T W I C K L U N G : M A I N F R Ä N K I S C H E W E R K S T Ä T T E N G G M B H W Ü R Z B U R G<br />
39
„Alle konnten mitmachen<br />
und mit ihrer Klangspende<br />
Teil des Projekts werden“<br />
ANTJE ARLT<br />
Michael Wenzel (m.) spricht mit Besuchern über die Klang- und Kunstinstallation, bei der niemand ausgeschlossen bleibt<br />
strang ablesen, welche Spende gerade zu hören ist. „Wann bin ich zu<br />
hören?“ Die Frage hat Schmidl während der knapp sechswöchigen<br />
Ausstellungsdauer immer wieder beantworten müssen. An allen Ausstellungstagen<br />
hat er Besuchergruppen und seine Klangspender durch<br />
die Ausstellung begleitet, die fast alle gekommen sind, um ihr großes<br />
Gemeinschaftswerk zu erleben, freudig den eigenen Beitrag zu hören<br />
oder den von Kollegen und Bekannten zu erkennen.<br />
Nicht alle Spender finden sich wieder. „Es waren einfach zu viele“,<br />
sagt Schmidl. Wie ein Lauffeuer hatte es die Runde gemacht, wie toll es<br />
sei, mitzumachen und eine Klangspende beizusteuern. „Ende Januar<br />
mussten wir die Sammlung abbrechen, weil wir sonst nie fertig geworden<br />
wären“, sagt Antje Arlt. Doch auch wer sich nicht im Klangpuzzle<br />
wiederfindet, gelohnt hat es sich für alle, ist sie überzeugt. Für<br />
sie waren die Aufnahmen das eindrücklichste Erlebnis: „zu sehen, was<br />
fünf bis zehn Minuten komplette Aufmerksamkeit bei Menschen bewirken<br />
können“. Am Ende seien alle stolz und glücklich gegangen.<br />
Währenddessen ist Enrico Illhardt im Kirchenraum eingetroffen. Als<br />
Schauspieler und Künstler engagiert er sich bei der Theaterwerkstatt<br />
Eisingen St. Josefs-Stift. Mehrere seiner Masken, die er für eigene Rollen<br />
gefertigt hat, sind in der Ausstellung zu sehen. Fast liebevoll betrachtet<br />
er jede einzelne, zigmal stand er mit ihnen auf der Bühne. Jetzt<br />
stehen sie auf dem Podest – auch für ihn ein Erlebnis, wie überhaupt<br />
das gesamte Projekt. Mit seinem Ensemble trat er zur Vernissage und<br />
beim „Zwischenspiel“ zur Halbzeit der Schau in der Kirche auf, ging<br />
auf die Zuschauer zu, schaute sie an, bis er auch ihnen ein Lächeln, eine<br />
Reaktion „entlockte“.<br />
Ausstellungsorte gesucht Auf den Weg für das ungewöhnliche Projekt<br />
haben sich auch Valentina Sudweg und Mechthild Strobel gemacht.<br />
Die beiden haben „extra für die Ausstellung“ einen <strong>Kurs</strong> in der Töpferwerkstatt<br />
der Mainfränkischen Werkstätten besucht, um neben<br />
den Künstlergruppen „Alte Waschküch“ des St. Josefs-Stifts, der Gemeinschaft<br />
Sant’Egidio oder des Fördervereins der Stiftung Menschen<br />
und Autismus eigene Arbeiten für das Großprojekt beizusteuern.<br />
Stolz stellen sie sich neben eine Figurengruppe, die im Team<br />
entstanden ist. „Auf dem Weg“ lautet der Titel. Immer wieder laufen<br />
die beiden nun an den Podesten mit Objekten vorbei, betrachten die<br />
Werke und hören auf die Klangkulisse aus den Lautsprechern. „Es ist<br />
sehr schön. Das macht stolz“, sagt Valentina Sudweg, während aus<br />
dem Off Würzburgs Dritte Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake<br />
mit eindringlich-hauchender Stimme „Alle Bürger sind gleich“ in<br />
den Kirchenraum tönt.<br />
„Total schön.“ Gabi Dauerer, Bereichsleiterin der Mainfränkischen<br />
Werkstätten, schaut sich um und strahlt. Sie ist mit Marcel Erbacher<br />
gekommen, der mit seinem Rollstuhl in die Mitte des Chors fährt, während<br />
sie immer wieder an den Objekten vorbeiläuft, bis alle Spenden<br />
1 Maske aus der<br />
Theaterwerkstatt<br />
Eislingen 2<br />
Antje Arlt 3, 4<br />
Beigesteuerte<br />
Werke: „Gespalten“<br />
und „Mummies“<br />
5 Michael<br />
Wenzel<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
i rem Umfang wiederholen und künstlerisch komplexer weiterentwickeln<br />
wollten.“ Aktion Mensch bewilligte die Finanzierung und mit<br />
der Würzburger Ordensgemeinschaft der Augustiner, bekannt für innovative<br />
Projekte und ihr Engagement für inklusive Themen, war<br />
schnell auch der Partner mit dem idealen Ausstellungsort mitten in der<br />
Stadt gefunden.<br />
Gigantisches Gemeinschaftsprojekt Die neue Spendensammlung des<br />
bewährten Teams konnte beginnen. Diesmal sollte sie ohne Grenzen<br />
sein. Ein gigantisches Gemeinschaftsprojekt, für alle offen, im Wortsinn<br />
inklusiv. „Wir haben hier im Würzburger Raum eine große Landschaft<br />
an Werkstätten, Inklusionsprojekten und Einrichtungen für<br />
Menschen mit Behinderungen“, sagt Antje Arlt, die von den Mainfränkischen<br />
Werkstätten inzwischen zur Wohnberatungsstelle der Lebenshilfe<br />
Mainfranken gewechselt ist. „Die Idee war, wirklich alle<br />
einzuladen, eine Klangspende abzugeben.“ Sie entwickelten einen Infoflyer<br />
zu Projektidee und Ablauf, verteilten das Faltblatt großflächig in<br />
der Region und Antje Arlt managte die Flut an organisatorischen<br />
Rück- und Absprachen, die darauf folgten: Wie spendet man einen<br />
40<br />
E N T W I C K L U N G : M A I N F R Ä N K I S C H E W E R K S T Ä T T E N G G M B H W Ü R Z B U R G<br />
Klang? Wo soll das stattfinden? Wie lange dauert das? Lässt sich das in<br />
den Arbeitsalltag integrieren?<br />
Fast ein Jahr lang ist Burkard Schmidl schließlich mit Mikro und<br />
Aufnahmegerät durch Werkstätten, Wohn- und Seniorenheime, Tagesförderstätten,<br />
Kindergärten oder Schulen gezogen, klapperte alle Inklusionsprojekte<br />
in der Region ab, fragte Vertreter der Lokalpolitik und<br />
des öffentlichen Lebens und bat um einen klingenden Beitrag. Von A<br />
wie die Theatergruppe „Augenblick“ über K wie Kulturreferat der Stadt<br />
Würzburg bis Z wie das Zentrum für Körperbehinderte in Würzburg<br />
hat Schmidl besucht.<br />
Eine aufregende, berührende Reise für alle Beteiligten, sagen Arlt und<br />
Schmidl, bei der sich der Untertitel des Ausstellungsprojekts „entlockt“,<br />
den die Augustiner Ordensbrüder mitentwickelt haben, teilweise als<br />
reale Beschreibung der akustischen Sammelaktion erwies. „Manche<br />
waren vor dem Mikro so aufgeregt, dass sie erst ganz blockiert waren.“<br />
Andere wieder wollten nur in der Gruppe Klänge produzieren, im Beisein<br />
ihres Gruppenleiters oder nur an ihrem Arbeitsplatz, wieder andere<br />
hatten sich mit Liedern, Geschichten oder Musikstücken so gut<br />
vorbereitet, als hätten sie nur darauf gewartet, vor ein Mikro zu treten. i<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
i 30 Stunden Klangmaterial Schmidl erwies sich als Entlockungskünstler<br />
und geduldiger Zuhörer. 350 Klangspenden hat er in seiner monatelangen<br />
Tour eingesammelt, 30 Stunden „Material“ aufgenommen. Zu<br />
jeder Spende kann er eine Geschichte erzählen, sagt er und sprudelt los.<br />
Erzählt vom Mann mit Downsyndrom, der ihm auf der Flöte einen Ton<br />
gespendet hat – den einzigen, den er generell spielt. Von der Frau, die nie<br />
auch nur ein Wort spricht und ihm leise „Heidi, Heidi, deine Welt sind<br />
die Berge“ ins Mikro gesungen hat, dass ihrer Gruppenleiterin Tränen<br />
in die Augen schossen. Vom Spender, der ihm eine Stunde lang eine<br />
umfangreiche, alte Version des Rumpelstilzchens vortrug und im Anschluss<br />
noch den Froschkönig. Vom Auftritt des Chors und der Veeh-<br />
Harfen-Gruppe der Mainfränkischen Werkstätten. Vom jungen Mann,<br />
der als Spende seinen Verlobungsring auf der Tischplatte kreiseln ließ.<br />
Oder vom „Herrn der Papiere“, dem erst mal nichts einfiel, und auf<br />
Schmidls Vorschlag hin, doch etwas zu singen: zehn Minuten in schönsten<br />
Betonungsvarianten „Au ja, das wär schön“ ins Mikro sagte.<br />
Der Satz tönt neben einigen anderen „Feature-Sätzen“ in wiederkehrender<br />
Sequenz aus verschiedenen Lautsprechern durch die Kirche<br />
und sticht aus der Endlosschleife von sechs unterschiedlichen Melodiefolgen<br />
heraus, die Schmidl als Klangteppich komponiert hat und<br />
damit die Kunstwerke samt Klangspenden in wechselnden emotionalen<br />
Atmosphären erleben lässt. Ein aufwendiges Klangpuzzle, das<br />
Schmidl in ungezählten Stunden im Studio in kurze Sequenzen geschnitten<br />
und zusammengefügt hat. „Ich habe sicher viele Spenden bis<br />
zu 500-mal angehört, um sie in eine passende Folge zu bringen.“ Er<br />
zückt ein Bündel DIN-A4-Blätter – die Partitur seiner Klangkomposition.<br />
Für jedes der acht Ausstellungspodeste kann er nach einem Zeit-<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
erklungen sind. Gemeinsam haben sie ihre Klangspenden abgegeben<br />
und wollten nun auch gemeinsam das Ergebnis sehen.<br />
Niemand soll ausgeschlossen bleiben. Den Ansatz der Ausstellung<br />
haben auch die Ordensbrüder ins Zentrum ihrer seelsorgerischen Arbeit<br />
gerückt, die Ausstellung in ihre Predigten einbezogen, aus der Gemeinde<br />
Begleitdienste organisiert, die Besucher und Klangspender<br />
über barrierefreie Zugänge in die Kirche lotsen. „Sie haben die Ausstellung<br />
auch zu ihrem Projekt gemacht und mitgeholfen“, sagt Michael<br />
Wenzel. Er sucht nun gemeinsam mit Antje Arlt und Burkard<br />
Schmidl weitere Ausstellungspartner in Deutschland, die die ungewöhnliche<br />
Kunst-Klanginstallation zeigen wollen. Am liebsten würde<br />
Wenzel mit dem Klangpuzzle auf Tournee gehen, um den inklusiven<br />
Ansatz ins Bewusstsein zu rücken: „Es ist so ein tolles Projekt, in dem<br />
so viel Arbeit steckt. Es wäre zu schade, es einfach einzumotten.“ AS ❚<br />
KONTAKT<br />
Burkard Schmidl, Komposition und Klangkunst<br />
97246 Eibelstadt, Tel.: 09303-990524<br />
klanggarten@t-online.de www.klanggarten.de<br />
Michael Wenzel michaelwenzel08@yahoo.de<br />
E N T W I C K L U N G : M A I N F R Ä N K I S C H E W E R K S T Ä T T E N G G M B H W Ü R Z B U R G<br />
41
COMIC/<br />
Der Comic stammt von Katja Wilhelmi, VIA Blumenfisch gGmbH, Berlin<br />
IMPRESSUM<br />
KLARER KURS – Magazin für berufliche Teilhabe<br />
Herausgeber: 53° NORD Agentur und Verlag<br />
Ein Geschäftsbereich der gdw mitte eG<br />
GmbH; 24-31: Axel Nordmeier; 37: Wefa Eisfeld; 38-41:<br />
Alex Kraus; 5, 6-11, 20-21, 28, 30, 32, 34, 36: istock<br />
Grafik-Design: Dietmar Meyer<br />
Bildbearbeitung: Ronald Fromme<br />
Druck: reha GmbH DruckCenter, Saarbrücken<br />
Redaktion KLARER KURS<br />
Magazin für berufliche Teilhabe<br />
Frankfurter Str. 227b, 34134 Kassel<br />
Tel.: 0561 475966-0; 0160 98343487<br />
info@53grad-nord.com www.53grad-nord.com<br />
Abonnement: KLARER KURS – Magazin für berufliche<br />
Teilhabe erscheint vierteljährlich.<br />
Das Jahresabonnement kostet 38 Euro.<br />
Abo-Service/Anzeigen: Tel.: 0561 475966-53<br />
Grid Grotemeyer (Chefredakteurin, GG, V.i.S.d.P.),<br />
Dieter Basener (DB), Gerhard Schindler (GS),<br />
Anita Strecker (AS), Uli Winter (UW)<br />
Fotos: 1: Axel Nordmeier; 4: Robert Schittko; 5: Werkstatträte<br />
Deutschland; 12-15: Michael Höhle; 16-19:<br />
Julia Klebitz; 20-23: Alex Friedel, Flughafen München<br />
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt<br />
eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Kein<br />
Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung<br />
des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden.<br />
Die nächste Ausgabe von KLARER KURS<br />
erscheint im November 2019<br />
42<br />
E N T W I C K L U N G : C O M I C<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
K L A R E R K U R S 0 3 / 1 9<br />
E N T W I C K L U N G : C O M I C<br />
43