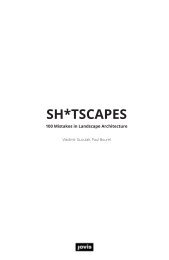Typisch Posener
978-3-86859-593-2
978-3-86859-593-2
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KATRIN VOERMANEK<br />
<strong>Typisch</strong> <strong>Posener</strong>
<br />
<strong>Typisch</strong> <strong>Posener</strong> 7<br />
Häusergeschichten 19<br />
Haus Cramer 29<br />
„Ich verliebte mich, als ich<br />
auf das Haus zuging …“<br />
Haus Mohrbutter 35<br />
„Kann man hier noch<br />
Schaden verhindern?“<br />
Liebermann-Villa 43<br />
„Einspruch im Namen<br />
der Kultur“<br />
Diakonissenkrankenhaus / 47<br />
Kunstquartier Bethanien<br />
„Baukritik muss sein!“<br />
Rudolf-Virchow-Krankenhaus 57<br />
„… dann werden wir uns<br />
eben weiter streiten.“<br />
Universum-Kino / 71<br />
Schaubühne am Lehniner Platz<br />
„… denn es ist am Ende<br />
nicht alles gut.“<br />
Kino Babylon 81<br />
„Da is Musike drin.“
West und Ost, Alt und Neu 92<br />
Neue Nationalgalerie 99<br />
„… um es einmal hart zu sagen,<br />
eine Krambude.“<br />
ICC 111<br />
„Einen Staubsauger haben wir bisher<br />
nicht für Architektur gehalten.“<br />
Wie Julius <strong>Posener</strong> 121<br />
Architekturkritiker wurde<br />
Epilog – Architekturkritik als Instrument 140<br />
Anhang 142
6 <br />
Julius <strong>Posener</strong> an seinem Schreibtisch, circa 1985
7<br />
<strong>Typisch</strong> <strong>Posener</strong><br />
Julius <strong>Posener</strong> hat Häuser gerettet, Preise bekommen, und an<br />
der Berliner Rehwiese ist ein kleiner Platz nach ihm benannt.<br />
In seinem Arbeitszimmer saßen Leguane, sein Großneffe ist der<br />
renommierte Koch Yotam Ottolenghi. Er hat ein ganzes Leben lang<br />
publiziert, gelehrt und sich engagiert. Menschen, die Julius <strong>Posener</strong><br />
persönlich erlebt haben, bekommen einen verklärten Gesichtsausdruck,<br />
wenn sie von ihm sprechen. Seine Texte lesen sich anders<br />
als andere. Braucht es mehr Gründe, um sich an diesen besonderen<br />
Menschen zu erinnern oder ihn kennenlernen zu wollen?<br />
Heimliche Erinnerungen heißen die vermutlich 1957 in Malaysia verfassten<br />
Memoiren Julius <strong>Posener</strong>s, in denen er die ersten knapp 50<br />
Jahre seines Lebens Revue passieren lässt. Sie erschienen 2004,<br />
acht Jahre nach dem Tod des Doyens der deutschen Architekturkritik,<br />
wie er allenthalben genannt wird. Herausgegeben hat sie sein<br />
Sohn, der Publizist Alan <strong>Posener</strong>. Das Manuskript war lange unentdeckt<br />
geblieben, gelagert in einer Orangenkiste. So hatte Julius<br />
<strong>Posener</strong> es seinem Sohn erst kurz vor seinem Tod zu lesen gegeben.<br />
Im Kapitel „Wie man keine Doktorarbeit schreibt“ berichtete er, ein<br />
Promotionsvorhaben begonnen, aber nie wirklich ernsthaft betrieben<br />
und schließlich aufgegeben zu haben. Auch dieses Buch basiert<br />
auf den Recherchen für eine Dissertation. Nun ist es ein Lesebuch<br />
geworden – und das macht Sinn: Julius <strong>Posener</strong>s wohl schönste<br />
Hinterlassenschaft ist seine Sprache. Er ist immer viel mehr ein<br />
Erzähler als ein Wissenschaftler gewesen, und so ist sein Schaffen<br />
in einer Textsammlung gut aufgehoben. Zu vieles tat „J. P.“, wie<br />
er seine Briefe zu unterschreiben pflegte, aus dem Bauch heraus.<br />
Zu wenig lag ihm an einem stringenten theoretischen Überbau, an<br />
validierbaren Thesen, an der Konsistenz seiner Bewertungen, was<br />
ihm selbst bewusst war und was ihm manche seiner Zeitgenossen<br />
durchaus vorwarfen. Vieles, was er als Architekturkritiker, Lehrer
14<br />
Publikum, einem im Sich-Entziehen geübten Justizsenator oder<br />
wem sonst entgegenstellt.“ 8<br />
Wenn J. P. Architektur beschrieb, dann erzählte er von sich und<br />
seinen Begegnungen mit Häusern, von seinen Erinnerungen und<br />
Assoziationen. Er drückte mit klaren und verständlichen Worten aus,<br />
wie die Architektur auf ihn wirkte, was ihm gefiel und was nicht.<br />
<strong>Posener</strong> richtete direkte Fragen an seine Leser und trat in seinen<br />
Texten unter Verwendung eines Autoren-Ichs, das er auch in einen<br />
Pluralis Majestatis verpackte, in Erscheinung. Dabei schrieb er aber<br />
nicht hoheitlich-abgehoben, sondern so, dass man sich als Leser in<br />
das Wir aufgenommen fühlt und der Eindruck entsteht, man schaue<br />
sich das Beschriebene gerade gemeinsam mit ihm an.<br />
Analogien und Verweise<br />
Im biografischen Teil am Ende dieses Buches ist nachzulesen, wie<br />
Julius <strong>Posener</strong> und seine beiden Brüder in ihrem großbürgerlichen<br />
und musischen Elternhaus eine umfassende Bildung erfuhren. Dies<br />
schimmert unaufdringlich durch all seine Texte hindurch, sei es im<br />
beiläufig eingestreuten Goethe-Zitat, in einer Analogie, die er zwischen<br />
einem Gebäude und einer musikalischen Komposition herstellte,<br />
oder wenn er Mendelsohn mit dem jungen Beethoven verglich.<br />
Bildung ist die wesentliche Quelle, aus der sich seine Artikel<br />
und Vorlesungen speisen. Sie hat es ihm ermöglicht, Architektur<br />
stets in einem breiteren Kontext zu betrachten und ihren Stellenwert<br />
in Kategorien außerhalb der Welt des Bauens einzuordnen. <strong>Posener</strong><br />
hat ein Gebäude nie als singuläres Ereignis irgendwo am Straßenrand<br />
wahrgenommen. Für ihn gehörten immer die Nachbarschaft<br />
und die Stadt einschließlich (lokal-)politischer oder wirtschaftlicher<br />
Rahmenbedingungen als Bezugsgrößen dazu – wenn nötig auch die<br />
gesamte Baugeschichte und die anderen schönen Künste. Nikolaus<br />
Kuhnert und Anh-Linh Ngo, die Herausgeber der Zeitschrift Arch+,<br />
hoben seine Fähigkeit hervor, Architektur in politische und kulturelle<br />
Zusammenhänge einzuordnen, was seine „Architekturgeschichte<br />
zu Gesellschaftsgeschichte“ mache. 9<br />
Emotionalität<br />
Was <strong>Posener</strong>s Texte ebenfalls von anderen unterscheidet, ist Emotionalität.<br />
Um Gebäude zu beschreiben, pflegte er keinen harten und<br />
kantigen Stil. Es war schon früh ein sanfter Klang, der seine Sprache
<strong>Typisch</strong> <strong>Posener</strong><br />
15<br />
auszeichnete. Als J. P. den Text „Stuhl oder Sitzmaschine“ schrieb,<br />
war er gerade einmal 28 Jahre alt, hier ein kurzer Auszug:<br />
„Wenn man sich nicht scheut, die Freude einmal zu analysieren,<br />
die man in einer guten, menschlichen Umgebung empfindet,<br />
so wird man schnell merken, dass es nicht das Komplizierte<br />
ist, das befriedigt, nicht das Raffinierte, auch nicht das restlos<br />
Durchkonstruierte. Was man begrüßt, was einen warm werden<br />
lässt, ist vielmehr das Zwanglose im Umgang von Mensch und<br />
Ding, das Zutrauliche, Ruhige dieses Umganges. Es ist die<br />
Sicherheit mit der die Sachen an ihrem Platz stehen, die Klarheit,<br />
mit der sie ihren einfachen Zweck erfüllen und aus drücken,<br />
die Würde und Heiterkeit, die ihnen eigen ist, weil sie am<br />
engsten zu uns gehören, die helle, menschliche Gegenwart.“ 10<br />
Dieser Mut zu emotionaler Wortwahl setzt auch den Ton in späteren<br />
Texten, in denen Häuser mal „liebenswert“, „großmütig“ und<br />
„gelassen“ sind, aber auch „schrecklich“ oder „glitschig“. Sie „erregen“<br />
J. P., er „liebt“ sie, ist von ihnen „begeistert“ oder gar „verzaubert“.<br />
Humor<br />
Architekturkritik ist oft eine humorlose Angelegenheit. Nicht so bei<br />
Julius <strong>Posener</strong>. Mit seiner Art zu sprechen und zu schreiben hat er<br />
auch deswegen viele Menschen erreicht, weil er seinen Sinn für<br />
Humor einzusetzen wusste – von leiser Ironie bis zum krachenden<br />
Scherz. So nahm er in einem Gespräch mit Manfred Sack den Architekten<br />
Hugo Häring auf den Arm:<br />
„Julius <strong>Posener</strong>: Das ist nicht genau das, was Hugo Häring<br />
gemeint hatte, der ja der entschiedenste Funktionalist gewesen<br />
ist.<br />
Manfred Sack: Der ja eine der eigenwilligsten Koryphäen des<br />
Neuen Bauens, mehr wohl: des ‚organhaften‘ Bauens in den<br />
Zwanziger Jahren war.<br />
Julius <strong>Posener</strong>: Häring hat gesagt, dass sich, wenn man die<br />
rein praktische Aufgabe genau genug durchdenke, die Form von<br />
selbst ergebe. Dass er nie so gearbeitet hat, ist etwas anderes.<br />
Wenn man das berühmte Gut Garkau am Pönitzer See, nördlich
18<br />
Auszug aus einem Original-Manuskript von Julius <strong>Posener</strong>, 1987
19<br />
Häusergeschichten<br />
Die Häusergeschichten speisen sich aus verschiedenen Quellen:<br />
den Büchern von und über Julius <strong>Posener</strong>, den Archiven<br />
der Medien, in denen er publizierte, vor allem aber aus seinem<br />
im Baukunstarchiv der Akademie der Künste in Berlin verwalteten<br />
Nachlass. Die Arbeit mit diesem Material öffnet den Blick in eine<br />
Welt des Schreibens und Publizierens, die es heute nicht mehr gibt.<br />
Es war eine Zeit ohne Laptop und Drucker, Scanner und Kopierer,<br />
Smartphone und soziale Medien. Ein Großteil des Archivbestands<br />
sind auf einer mechanischen Schreibmaschine getippte Manuskripte,<br />
oftmals im Durchschlag. Wer das nicht mehr kennt: Wenn<br />
man früher einen Brief verfasste und diesen wegschickte, war dies<br />
das Original. Man hatte auf keiner Festplatte und in keiner Cloud<br />
eine Kopie dessen, was man geschrieben hatte. Deswegen stellte<br />
man vor der Erfindung von Kopierern und Scannern einen Durchschlag<br />
zum Verbleib in den eigenen Unterlagen her, in der Regel<br />
mithilfe von sogenanntem Durchschlag- oder Kohlepapier. Dieses<br />
legte man zwischen das Original und ein zweites, oftmals dünneres<br />
Papier, und durch eine spezielle Beschichtung wurde der von Hand<br />
geschriebene oder der getippte Inhalt auf das zweite Blatt übertragen.<br />
In <strong>Posener</strong>s Nachlass finden sich zehntausende Manuskripte und<br />
Briefe, die über ihren Inhalt hinaus auch etwas über die Umstände<br />
vermitteln, unter denen sie entstanden sind. Manche sind auf<br />
Schreibmaschinen mit englischer Tastatur getippt, was an den fehlenden<br />
Umlauten und dem doppelten S zu erkennen ist, das unser<br />
Schriftzeichen ß ersetzte. (Für dieses Buch wurde die Schreibweise<br />
in allen Zitaten allerdings an die neue deutsche Rechtschreibung<br />
angepasst.) Manche Manuskriptseiten weisen die typischen Löcher<br />
auf, die mechanische Schreibmaschinen ins Papier schlugen,<br />
zum Beispiel beim i-Punkt, wenn man sie in Eile, mit zu großem
28<br />
Haus Cramer im wiederhergestellten Zustand, 1979<br />
Das Haus mit abgestützten Giebelwänden, 1967
29<br />
Haus Cramer<br />
„Ich verliebte mich, als ich<br />
auf das Haus zuging …“<br />
Es gibt ein Haus in Berlin, das in seiner persönlichen Bedeutung<br />
für Julius <strong>Posener</strong> alle anderen überragt. Es war im architektonischen<br />
Sinne seine erste große Liebe und Sinnbild einer Idylle, die<br />
er selbst verloren hatte. Die Rede ist vom Haus Cramer von Hermann<br />
Muthesius, fertiggestellt 1913 in Dahlem an der Ecke der Straßen<br />
Pacelliallee und Im Dol. Muthesius hatte es für den jüdischen<br />
Kaufmann Hans Cramer und dessen Familie auf einem über 4000<br />
Quadratmeter großen Grundstück gebaut. Ein imposantes Haus mit<br />
Bruchstein-Fassaden und hoch aufragenden, sanft gewellten Giebeln.<br />
Mehrere Pergolen verweben es mit dem weitläufigen Garten.<br />
Es gilt als beispielhafte Umsetzung der Muthesius’schen Ideale vom<br />
Wohnen, die der Architekt aus der Analyse englischer Landhäuser<br />
abgeleitet hatte. Julius <strong>Posener</strong> sah dieses Haus als junger Student,<br />
und es war eine eindrückliche Begegnung, die er in seinen Heimlichen<br />
Erinnerungen beschrieb:<br />
„Eines Tages nahm ich an einer Exkursion teil, die einer unserer<br />
Dozenten an der TH organisiert hatte. Wir fuhren hinaus nach<br />
Dahlem und besichtigten dort nur zwei Häuser. Das erste der<br />
beiden war von Hermann Muthesius entworfen worden, dem<br />
Mann, der im Jahr meiner Geburt den englischen Landhausstil<br />
in Deutschland eingeführt hatte. Ich hatte noch nie eine Arbeit<br />
von ihm gesehen, und das Haus Cramer, auf das wir jetzt<br />
zugingen, zählte nicht zu seinen besten. Doch in dem Augenblick,<br />
in als wir uns dem Eingang in der Bruchsteinmauer aus<br />
grobem, grauem Kalkstein näherten, stand für mich bereits<br />
fest, dass ich es ‚himmlisch’ fand. Die Erfahrung entsprach etwa<br />
der plötzlichen Verliebtheit eines Heranwachsenden und war<br />
ebenso wenig eindeutig fassbar. Am nächsten Tag ist der junge<br />
Mensch häufig nicht mehr in der Lage, die Augenfarbe seiner
34<br />
Haus Mohrbutter, 1968
35<br />
Haus Mohrbutter<br />
„Kann man hier noch<br />
Schaden verhindern?“<br />
„3.11.1983<br />
Lieber Herr Engel,<br />
vor dem Haus Mohrbutter, Schlickweg 6 in Zehlendorf, Architekt<br />
Hermann Muthesius (1912) lagern niedersächsische Dachpfannen<br />
für eine Neueindeckung. Sie sind graubraun im Ton und<br />
in der Form von den grauen Pfannen, welche ursprünglich auf<br />
dem Dach lagen – und noch liegen – stark unterschieden. Das<br />
Haus ist durch seine Lage auf dem spitzwinkligen Eckgrundstück<br />
an der Klopstockstraße eine Landmarke in der Schlachtenseegegend,<br />
und es wird nach der Eindeckung mit den niedersächsischen<br />
Pfannen ziemlich anders aussehen als bisher.<br />
Steht das Haus unter Schutz?<br />
Kann man hier noch Schaden verhindern?<br />
Mit bestem Gruß,<br />
Ihr Julius <strong>Posener</strong>“ 1<br />
Beim Lesen dieses Briefes tauchen sofort Bilder vor dem inneren<br />
Auge auf: Wie Julius <strong>Posener</strong> bei einem Spaziergang durch<br />
die Nachbarschaft am Schlachtensee im Vorgarten von Haus Mohrbutter<br />
zufällig die aufgestapelten Dachziegel entdeckt, wie er die<br />
Gefahr für das Muthesius-Haus erkennt, nach Hause eilt, um sich<br />
an die Schreibmaschine zu setzen und sogleich dem damaligen Landeskonservator<br />
Helmut Engel zu schreiben. Wie schnell wäre das<br />
heutzutage mit einem Smartphone und einem Instagram- Account<br />
erledigt?<br />
Schon auf den ersten Blick unterscheidet sich das Haus Mohrbutter<br />
von früheren Muthesius-Landhäusern. Der Architekt baute<br />
es 1912/13 für den Künstler Alfred Mohrbutter als Wohnhaus mit<br />
Ateliergebäude. Der Entwurf des Hauses fällt in eine interessante<br />
Umbruchphase in Muthesius’ Schaffen, nachdem dieser vom
42<br />
Die verlassene Liebermann-Villa, 1971
43<br />
Liebermann-Villa<br />
„Einspruch im Namen<br />
der Kultur“<br />
Die Villa des Malers Max Liebermann am Ufer des Wannsees ist<br />
seit 2006 ein Museum. Bereits zwei Jahre zuvor konnte sie zeitweise<br />
besichtigt werden. Die Zeitung Die Welt schrieb damals: „30<br />
Jahre mussten vergehen, bis aus einer Idee des Architekturkritikers<br />
Julius <strong>Posener</strong> Wirklichkeit wurde.“ 1 Auch um dieses Haus hat sich<br />
<strong>Posener</strong> also verdient gemacht, wenn auch mit viel Zeitverzug.<br />
Der jüdische Maler Max Liebermann, 1847 in Berlin geboren und<br />
1935 auch dort verstorben, hatte sich 1910 in der heutigen Colomierstraße<br />
3 vom Architekten Paul O. A. Baumgarten einen Landsitz<br />
bauen lassen. Dort verbrachte er mit der Familie den Sommer,<br />
während er im Winter meist in seinem Palais am Pariser Platz lebte.<br />
Der Garten der Villa ist in vielen Bildern des Malers verewigt – die<br />
Max-Liebermann-Gesellschaft zählt mehr als 200 Gemälde, die<br />
unterschiedlichste Stimmungen und wechselnde Bepflanzungen<br />
auf dem 7000 Quadratmeter großen Seegrundstück zeigen.<br />
Über die bewegte Geschichte des Hauses nach dem Tod des Malers<br />
ist auf der Webseite des Trägervereins des heutigen Museums zu<br />
lesen: „1940 wurde Martha Liebermann von den Nationalsozialisten<br />
gezwungen, das Grundstück an die Deutsche Reichspost zu verkaufen,<br />
die in der Villa ein Schulungslager für ihre weibliche Gefolgschaft<br />
einrichtete. Gegen Ende des Krieges diente das Haus als Lazarett.<br />
Nach 1945 wurde die Liebermann-Villa gemeinsam mit der benachbarten<br />
Villa Hamspohn zur chirurgischen Abteilung des Städtischen<br />
Krankenhauses Wannsee. Das ehemalige Atelier Max Liebermanns<br />
fungierte als Operationssaal.“ 2 1951 erhielt die Familie das Haus<br />
zurück und verkaufte es einige Jahre später an das Land Berlin.<br />
1971 kommt Julius <strong>Posener</strong> ins Spiel. Unter der launigen Überschrift<br />
„Liebermann und die Froschmänner“ veröffentlichte er einen Text<br />
im Tagesspiegel. 3 Der Garten des Sommerhauses, das zwischenzeitlich<br />
leer gestanden hatte, war zu jenem Zeitpunkt nach seinem
46<br />
Kunstquartier Bethanien, 1989<br />
Entwurf für eine Wohnbebauung hinter dem<br />
Bethanien von Sigrid Kressmann-Zschach,<br />
DIE WELT, 19.3.1969, S. 18
47<br />
Diakonissenkrankenhaus /<br />
Kunstquartier Bethanien<br />
„Baukritik muss sein !“<br />
Rund um das heutige Kunstquartier Bethanien in Berlin-Kreuzberg<br />
rankt sich eine <strong>Posener</strong>-Legende, die bei den Recherchen<br />
für diese Häusergeschichte eine Entzauberung erfahren hat. Auf<br />
einer Gedenkveranstaltung des Berliner Werkbunds für J. P. in der<br />
Akademie der Künste am Hanseatenweg hatte Ulrich Conrads von<br />
einer <strong>Posener</strong>’schen Heldentat im Jahr 1967 berichtet. Damals war<br />
gerade bekannt geworden, dass dem Diakonissenkrankenhaus am<br />
Mariannenplatz Gefahr durch Abriss drohte:<br />
„Julius <strong>Posener</strong> und ich haben uns verschworen und gesagt, das<br />
kann nicht passieren, dass dieses Gebäude hier verschwindet. Wir<br />
haben uns im Werkbund Verstärkung geholt und versucht, diese<br />
Sache zu retten. Wir haben mit Scharf [dem damaligen Berliner Landesbischof]<br />
und mit vielen Menschen gesprochen. Ich weiß nicht<br />
mehr, wer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, dann müssen wir<br />
nach Bonn gehen ins Parlament. Und das haben wir auch gemacht.<br />
Wir haben dem Parlament geschrieben, und – oh Wunder – die<br />
gesamtdeutsche Kommission des Bundestags hat sich der Sache<br />
angenommen und ist unserer Einladung gefolgt. […] Sie reisten an<br />
und wurden von keinem anderen als Julius <strong>Posener</strong> durch dieses<br />
Gebäude geführt. Und diese Führung kann man sich eigentlich nur<br />
so vorstellen, wie man Warzen bespricht. Ganz ungeheuer überzeugend,<br />
mit dieser unaufgeregten und dennoch akzentuierten, kräftigen<br />
Betonung dessen, worauf es ankam. Die Kommission fuhr<br />
nach Bonn zurück und hat dem Senat auferlegt, der Architektin,<br />
die inzwischen den Abbruch der Seitenflügel bereits beim Landesdenkmalpfleger<br />
durchgebracht hatte und die hier geplant hatte, das<br />
Gelände mit bis zu 16-geschossigen Wohntürmen zu bebauen, das<br />
Projekt wieder zu entreißen, den Schwestern die fünf Millionen<br />
Altersgeld zu geben und dieses Gebäude zu übernehmen. So kann<br />
man sagen, dass es Julius <strong>Posener</strong> war, der dieses Haus gerettet
56<br />
Rudolf-Virchow-Krankenhaus, 1988, im Vordergrund noch erhaltene Pavillons von Ludwig Hoffmann
57<br />
Rudolf-Virchow-Krankenhaus<br />
„… dann werden wir uns<br />
eben weiter streiten.“<br />
Der Kampf gegen die Zerstörung von Bauten des Rudolf-<br />
Virchow-Krankenhauses (RVK), zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
von Ludwig Hoffmann erbaut, hielt Julius <strong>Posener</strong> über mehrere<br />
Jahre hin weg in Atem. In der Debatte, die in der Stadt ab 1986<br />
hohe Wellen schlug, zog er alle Register, nutzte strategisch die ihm<br />
zur Verfügung stehenden Medien und Foren, von der Tageszeitung<br />
bis zum Rundfunk, vom Denkmalbeirat bis zum Werkbund, sowie<br />
mehrere öffentliche Auftritte, darunter eine Ausstellungseröffnung,<br />
das Schinkelfest und eine Preisverleihung, um zur Rettung aufzurufen.<br />
Er korrespondierte intensiv mit Kollegen der Presse, die er zu<br />
einem gemeinschaftlichen Vorgehen gegen den Abriss animierte.<br />
Gerade diese Kommunikation hinter den Kulissen ist wegen ihrer<br />
Unverblümtheit interessant – obwohl alle Mühe am Ende vergebens<br />
war.<br />
Ludwig Hoffmann war von 1896 bis 1924 Stadtbaurat von Berlin.<br />
Zu jener Zeit galt man in diesem Amt noch als „der erste Architekt<br />
seiner Stadt“, wie es der Journalist Günther Kühne in der Radiosendung<br />
„Kunst auf Eins“ im RIAS treffend umschrieb. 1 Anders als<br />
wir es heute kennen, verwaltete man das Bauen nicht, man baute<br />
vor allem selbst. Hoffmann war es in seinem Amt persönlich vorbehalten,<br />
gemeinsam mit dem berühmten Arzt Rudolf Virchow die<br />
Pläne für ein großes Krankenhausareal im Bezirk Wedding zu entwickeln<br />
und diese dann ab 1899 auch umzusetzen. Virchow verstarb<br />
kurz vor der Fertigstellung der Anlage. Seine Witwe schrieb nach<br />
der Eröffnung im Jahr 1906 einen Brief an Hoffmann, aus dem Günther<br />
Kühne zitierte. Sie sei von der Besichtigung „tief bewegten und<br />
dankerfüllten Herzens“ zurückgekehrt, in dem Bewusstsein, dass<br />
dieses Krankenhaus „das herrlichste Denkmal“ bleiben werde,<br />
das dem Verstorbenen jemals habe gesetzt werden können. Kaiser<br />
Wilhelm II. soll sogar gegenüber Hoffmann bekannt haben: „Was
70<br />
Schaubühne am Lehniner Platz, 1982<br />
Der zu großen Teilen zerstörte Mendelsohn-Bau, 1979,<br />
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.2.1979, S. 21
71<br />
Universum-Kino /<br />
Schaubühne am Lehniner Platz<br />
„… denn es ist am Ende<br />
nicht alles gut.“<br />
Berlin gehörte im Europäischen Jahr des Denkmalschutzes 1975<br />
mit mehreren Sanierungsgebieten zu den fünf Beispiel städten<br />
der BRD. Umso wütender machte es Julius <strong>Posener</strong>, als ihm just in<br />
jenem Jahr ein Dokument in die Hände fiel, auf dem ein Grundstück<br />
am Kurfürstendamm zum Verkauf angeboten wurde. Dem Tagesspiegel<br />
sandte er daraufhin folgendes Manuskript zu:<br />
„Vor mir liegt ein interessantes Angebot. Die Firma Prox<br />
Immobilie bietet ein Grundstück ‚in exklusiver Citylage‘ zum<br />
Verkauf an. ‚Das unbelastete Grundstück ist mit einem abrissreifen<br />
Althaus bebaut. Kaufpreis 5 Millionen.‘ Das abrissreife<br />
Althaus ist das Kino am Lehniner Platz, Erich Mendelsohns<br />
‚Universum‘.<br />
In der Liste Berliner Baudenkmäler ist Mendelsohns Kino nicht<br />
enthalten. Ein paar recht fragwürdige Gebäude stehen drin.<br />
Mendelsohns Kino nicht. Die Liste bedarf der Überholung. Das<br />
weiß auch der Landeskonservator. Anfrage: Kann man den<br />
Mendelsohn-Bau unter Denkmalschutz stellen? ‚Theoretisch<br />
ja‘, ist die Antwort: Die Stadt kann jedes Gebäude in ihre Obhut<br />
nehmen, welches sie für ‚denkmalswert‘ erachtet. Aber da<br />
ist der Kaufpreis von 5 Millionen. Macht der Besitzer Schwierigkeiten<br />
– und das wird er: er will ja abreißen –, so müsste<br />
die Stadt bereit sein, ihm das Haus abzukaufen. Ob sie dazu<br />
imstande ist, kann ich nicht beurteilen. Ebenso wenig maße ich<br />
mir an zu beurteilen, ob gewisse, sehr kostspielige Bauunternehmen<br />
der jüngsten Zeit – Flughafen, Kongresszentrum – das<br />
sind, was man gesunde Investitionen nennt. Nur dies: Für<br />
Bauvorhaben, von denen sich die Stadt etwas verspricht, steht<br />
Geld zur Verfügung (weit über eine Milliarde Mark). Aber fünf<br />
Millionen lediglich dafür auszugeben, ein Meisterwerk der
80<br />
Kino Babylon, 1991<br />
Originalzustand des großen Saals nach Poelzig, 1929
81<br />
Kino Babylon<br />
„Da is Musike drin.“<br />
Alle bisherigen Häusergeschichten haben sich in Julius <strong>Posener</strong>s<br />
Heimat Westberlin zugetragen. Doch gibt es ein Projekt, das<br />
ihn gleich nach der Maueröffnung in den Ostteil der Stadt führte.<br />
Dort engagierte er sich ab 1990 für einen Bau von Hans Poelzig, seinem<br />
hochgeschätzten Lehrer an der Technischen Hochschule Berlin.<br />
Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten war J. P. bemüht, den<br />
Rück-Umbau des 1928/29 errichteten Babylon-Kinos am heutigen<br />
Rosa-Luxemburg-Platz in seinen Originalzustand zu erwirken. Einer<br />
Versuchsanordnung gleich, ging es in diesem Fall um die Frage,<br />
was im Denkmalschutz als richtig oder falsch zu bewerten sei, ob<br />
im Konfliktfall die Zeitgeschichte Vorrang vor der Ästhetik haben<br />
solle oder umgekehrt, die Ästhetik vor der Zeitgeschichte. Auch<br />
beim Babylon bildeten sich zwei Lager: Die einen wollten authentische<br />
historische Schichten bewahren, die sich in dem mehrfach<br />
umgebauten Haus ablesen ließen. Die anderen, unter ihnen Julius<br />
<strong>Posener</strong>, wollten einen verlorenen „originalen“ Bauzustand wiederherstellen,<br />
dem sie einen höheren Wert beimaßen als allen späteren<br />
Überformungen. Der letztlich gefundene Kompromiss – vorne<br />
Poelzig, hinten Ostmoderne mit Goldrand – hätte <strong>Posener</strong> garantiert<br />
nicht gefallen.<br />
Das Kino ist in eine fünfgeschossige Blockrandbebauung integriert<br />
und war Teil eines städtebaulichen Plans von Hans Poelzig<br />
für dieses Areal, das früher Bülow-Platz hieß und damals wie heute<br />
von Oskar Kaufmanns 1915 erbauter Volksbühne beherrscht wird.<br />
Deren bauliche Rahmung war 1925 Gegenstand eines Wettbewerbs.<br />
Der Jury gehörte unter anderen auch Hermann Muthesius<br />
an, es gewann der Architekt Johann Emil Schaudt. Aber noch bevor<br />
es zur Umsetzung des Siegerentwurfs hätte kommen können,<br />
trat Martin Wagner das Amt des Berliner Stadtbaurats an, der die<br />
Ergebnisse des alten Verfahrens überholt fand und sich nicht an sie
92<br />
West und Ost,<br />
Alt und Neu<br />
West und Ost<br />
Außer den Plänen für das Kino Babylon erregten im Osten<br />
Berlins auch der geplante Umbau der Neuen Wache unter<br />
den Linden und der bereits zu Beginn der 1990er Jahre diskutierte<br />
Wiederaufbau des Stadtschlosses das Interesse <strong>Posener</strong>s,<br />
genauer gesagt, provozierten seine Kritik. Auch der Prozess des<br />
Zusammenwachsens der Stadt ließ ihn nicht kalt, unter anderem<br />
äußerte er sich kritisch zu den großen Bauvorhaben am Potsdamer<br />
Platz:<br />
„Ich weiß nur, wer nicht entscheiden soll: Daimler-Benz und<br />
Sony. Man stelle sich das vor: Man kommt an eines der drei<br />
wich tigsten Eingangstore des historischen Berlin, und wem<br />
begegnet man? Einem Auto- und einem Videorekorderkonzern.“ 1<br />
In einem Leserbrief an den Tagesspiegel nannte er den Potsdamer<br />
Platz einmal „Daimler-Sony-Platz“ und fragte: „Wie lange wird es<br />
noch dauern, bis Berlin Benzin heißen wird?“ 2<br />
Zu jener Zeit war J. P. schon fast 90 und zunehmend gesundheitlich<br />
beeinträchtigt, das muss man sich klar machen. Die allgemeine<br />
Euphorie und Goldgräberstimmung, die über Berlin und den so<br />
unverhofft anstehenden Bauaufgaben lagen, passten nicht zu seiner<br />
Bedächtigkeit. Oder er passte nicht mehr in diese Zeit. Er publizierte<br />
immer weniger, seine Themen, die Vororte und ihre Landhäuser,<br />
gerieten aus dem Blickfeld, weil es plötzlich darum ging, die Mitte<br />
der Stadt neu zu erfinden. Das Insel-Dasein Westberlins gehörte der<br />
Vergangenheit an, <strong>Posener</strong>s Alleinstellung als mahnende Stimme<br />
für das bauliche Erbe auch.<br />
Als es um die Neue Wache ging, bezeichnete <strong>Posener</strong> das Vorgehen<br />
des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, als anmaßend.
93<br />
Der Pavillon Unter den Linden, 1818 von Karl Friedrich Schinkel als<br />
Wachgebäude errichtet, 1931 von Heinrich Tessenow zum Ehrenmal<br />
umgestaltet, war nach den Zerstörungen durch den Krieg zu DRR-<br />
Zeiten wieder aufgebaut worden, allerdings im Innenraum verändert.<br />
Für <strong>Posener</strong> wäre jetzt, nach dem Fall der Mauer, nur eine Wiederherstellung<br />
des Tessenow-Entwurfs in Frage gekommen, mit zwei<br />
Leuchtern und einem auf einem Sockel liegenden Metallkranz. Dass<br />
für die neue zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland<br />
stattdessen eine im Maßstab deutlich veränderte Pieta von Käthe<br />
Kollwitz aufgestellt wurde, fand er der Aufgabe des Ortes thematisch<br />
nicht angemessen. Außerdem tue man der „innigen Skulptur“<br />
der Künstlerin durch die vielfache Vergrößerung Gewalt an. 3<br />
Ein wiederaufgebautes Stadtschloss, leicht schräg in die Achse der<br />
„Linden“ gestellt, hielt er städtebaulich für einen Gewinn. Aber<br />
inhaltlich hatte er große Bedenken, wie er in einem Brief gegenüber<br />
einem Mitarbeiter der Akademie der Künste bekannte:<br />
„Ich meine, der Neubau des Schlosses an der alten Stelle<br />
werde peinlich wirken – und peinlich bleiben: Es wird nicht<br />
so altern, wie das ursprüngliche Schloss gealtert ist. […]<br />
Bedeutend scheint mir zu sein, dass das Schloss seit 1918 leer<br />
wirkte. Es war zu nichts mehr da, und das spürte man, sobald<br />
man eintrat. Das wird bei dem Neubau schlimmer sein. […]<br />
Für jede geplante Nutzung wird das Schloss zu groß sein, zu<br />
anspruchsvoll. Es ist, fürchte ich, in seiner endgültigen Form,<br />
die auch ich erst nach der Abdankung des letzten Herrschers<br />
gesehen habe, – und da wirkte es leer, – nicht wieder zum<br />
Leben zu bringen.“ 4<br />
Wie es aussieht, könnte er auch hier recht behalten.<br />
Alt und Neu<br />
Julius <strong>Posener</strong>s Herz schlug für das Alte. Nicht erst nach dem Mauerfall,<br />
schon früher betrachtete er viele Neubauten eher skeptisch.<br />
Als er in jungen Jahren begann, für die L’Architecture d’Aujourd’hui<br />
zu schreiben, habe die Avantgarde in ihm keinen Propagandisten<br />
gehabt, schrieb Manfred Sack 1983 in der ZEIT. 5 <strong>Posener</strong> habe ihm<br />
gegenüber bekannt: „Ich war schon sehr reaktionär“. Auch in Berlin<br />
fiel er nicht als Fürsprecher des Neuen auf. Kaum zu glauben,
98<br />
Neue Nationalgalerie, 1970
99<br />
Neue Nationalgalerie<br />
„… um es einmal hart zu sagen,<br />
eine Krambude.“<br />
Im September 1968 eröffnete an der Potsdamer Straße die Neue<br />
Nationalgalerie und die Architekturwelt feierte die Heimkehr Ludwig<br />
Mies van der Rohes nach Berlin. 1962 hatte der 1938 in die USA<br />
ausgewanderte Architekt den Direktauftrag der Stiftung Preußischer<br />
Kulturbesitz für das Museum erhalten, der Baubeginn erfolgte 1965.<br />
Für 2020 ist die Wiedereröffnung des Hauses nach denkmalgerechter<br />
Sanierung durch das Büro David Chipperfield Architects angekündigt.<br />
Das Gebäude hat längst den Status einer Ikone, es gilt als Meilenstein<br />
des Museumbaus. Wer kennt und schätzt sie nicht, die „heilige<br />
Halle“, ihre wunderbaren Raumerlebnisse, ihr schwebendes<br />
Dach? Zahllose Ausstellungen haben hier stattgefunden, von Piet<br />
Mondrian bis Otto Piene, von Alberto Giacometti bis Jeff Koons,<br />
von Oswald Mathias Ungers bis Rem Koolhaas. Unvergessen die<br />
Besucherschlangen, die sich 2004 anlässlich des MoMA-Gastspiels<br />
um das Gebäude wickelten. 2015 verabschiedete die Gruppe Kraftwerk<br />
den Bau mit einer Serie von Konzerten in die Sanierungspause.<br />
Aus heutiger Sicht sakrosankt und über fast jede Kritik erhaben,<br />
brachte der Bau in seiner Entstehungszeit manchen Kritiker heftig<br />
ins Schlingern. Wie sollte man sich positionieren? Nun hatte man<br />
endlich einen Mies in Berlin, noch dazu einen so beeindruckenden.<br />
Die Besucher strömten in Scharen. Wer wollte da gleich wieder in<br />
die Suppe spucken? Gleichzeitig war es nie ein Geheimnis, dass<br />
Mies den Entwurf in wesentlichen Merkmalen nicht eigens für Berlin<br />
entwickelt hatte. Er griff auf einen ungebauten Vorschlag für den<br />
Rum-Hersteller Bacardi in Santiago de Cuba zurück, den er zuvor<br />
schon für das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt abgewandelt<br />
hatte. Und es war klar, dass der Bau für seinen eigentlichen Zweck,<br />
das Ausstellen von Kunst, keine allzu guten Bedingungen bot.
110<br />
ICC, 1980
111<br />
ICC<br />
„Einen Staubsauger<br />
haben wir bisher nicht für<br />
Architektur gehalten.“<br />
„‚Was halten Sie‘, fragt ich den Fahrer<br />
– Er steuert verschlossenen Gesichts –<br />
‚Vom Kongresszentrum dort, dem neuen?‘<br />
Er sagt lakonisch: ‚Nichts‘.<br />
O Fahrer, Du magst einst bereuen<br />
Dein karges verneinendes Wort.<br />
Am Kongresszentrum dort, dem neuen<br />
Da bauen sie munter fort.<br />
Sie bauen, so sagt man, die Zukunft.<br />
Man sagt das vielleicht etwas schnell.<br />
Denn unfertig wie’s ist, ist’s Vergangenheit schon:<br />
Es ist nicht einmal sensationell.“ 1<br />
Wen wird jetzt noch wundern, dass Julius <strong>Posener</strong> mit dem<br />
zwischen 1975 und 1979 erbauten Internationalen Con -<br />
gress Centrum (ICC) von Ralf Schüler und Ursulina Schüler- Witte<br />
nichts anfangen konnte. Für ihn war es keine Sensation. Mehr<br />
noch, an anderer Stelle schrieb er, er habe es gefürchtet und sogar<br />
gehasst. Es sei keine besondere Architektur, so sein hartes Urteil,<br />
allenfalls ein Designobjekt, ein aufwendiger Apparat ohne Sinn. In<br />
diesem Bau sei alles Räumliche durch Organisation ersetzt worden,<br />
was Jaques-Tati- Fantasien in ihm auslöste. Als Besucher<br />
bewege man sich nicht durch das Haus, sondern werde „prozessiert“.<br />
Vor allem aber hielt <strong>Posener</strong> das ICC für den Ausdruck eines<br />
politischen Willens – und zwar eines aus seiner Sicht völlig verfehlten<br />
Willens.<br />
„Das ICC ist eine genau und gut konstruierte Maschine für<br />
einen Zweck, den ich nur als politischen Zweck begreifen kann:<br />
Symbol einer Berlin-Politik, welche sich, dessen bin ich sicher,
120<br />
Familie <strong>Posener</strong> und Bedienstete vor dem Haus in der Karlstraße (heute Baseler Straße), circa 1908
121<br />
Wie Julius <strong>Posener</strong><br />
Architekturkritiker wurde<br />
arum Julius <strong>Posener</strong> nach seiner Rückkehr nach Berlin im<br />
W Jahr 1961 seinen Kampf für das bauliche Erbe aufnahm und<br />
warum er schrieb, wie er schrieb, lässt sich zu großen Teilen aus seiner<br />
Biografie ableiten, vor allem aus den prägenden ersten Berliner<br />
Jahren bis 1933.<br />
Eine glückliche Kindheit im Berliner Südwesten<br />
Julius <strong>Posener</strong> wurde am 4. November 1904 in Berlin geboren. In<br />
seinen Lebenserinnerungen Fast so alt wie das Jahrhundert 1 gab<br />
er als Adresse seines Geburtshauses „Potsdamer Straße 118 b“ an.<br />
Das Haus existiert heute nicht mehr, es gehörte damals der Familie<br />
mütterlicherseits. Großvater Julius Oppenheim, nach dem der<br />
Enkel auch benannt ist, hatte ein größeres Vermögen durch Immobiliengeschäfte<br />
erworben. <strong>Posener</strong> konnte das Haus und dessen<br />
Umbau durch den Architekten Bruno Schmitz aus späterer Anschauung<br />
zwar recht detailliert beschreiben, doch geprägt hat ihn diese<br />
innerstädtische Berliner Umgebung kaum. Er war nur ein Jahr alt,<br />
als die Familie nach Lichterfelde-West umzog. Schon 1905 begann<br />
also, wenn auch noch unbewusst, die enge Bindung <strong>Posener</strong>s an<br />
den Vorort als lebenslange Heimat.<br />
Sein 1862 geborener Vater Moritz <strong>Posener</strong> war Maler, seine 1872<br />
geborene Mutter Gertrud <strong>Posener</strong> brachte ein ererbtes Familienvermögen<br />
mit in die Ehe, was der Familie ein großbürgerliches<br />
und unbeschwertes Leben im grünen Südwesten Berlins ermöglichte.<br />
J. P. hatte zwei Brüder, Karl und Ludwig, der eine war zwei,<br />
der andere sechs Jahre älter als er. Zunächst wohnte die Familie<br />
in der Holbeinstraße in Lichterfelde in einem Haus, mit dem Julius<br />
<strong>Posener</strong> wenig positive Erinnerungen verband: „düster und weitläufig“<br />
sei es gewesen. Missbilligende Erwähnung fanden in seiner<br />
Beschreibung unter anderem ein großer modriger Garten, riesige
140<br />
Epilog – Architekturkritik<br />
als Instrument<br />
Julius <strong>Posener</strong>s Begriff von Architekturkritik war weit gefasst. Nie<br />
zielte sie darauf ab, geneigte Zeitungsleser zum Frühstück oder<br />
am Sonntagnachmittag auf dem Sofa mit schönen Formulierungen<br />
zu erbauen. Seine Architekturkritik war für den Alltag gemacht. Sie<br />
fand nicht nur im Feuilleton, sondern auch im Lokalteil und der Leserbriefspalte<br />
statt. Und nicht nur in der Zeitung und in Büchern, sondern<br />
auch im Rundfunk und im Fernsehen, im Hörsaal, auf Podien<br />
und bei Stadtspaziergängen. Sie war informativ und beschreibend,<br />
aber selten ohne Appell. <strong>Posener</strong> benutzte Architekturkritik, um<br />
etwas zu erreichen, als Publizist und zugleich als Hochschullehrer<br />
und Vertreter wichtiger Institutionen in seinen zweiten Berliner Jahren.<br />
In <strong>Posener</strong>s Nachlass finden sich Stellen, in denen er einen<br />
Brief als „Instrument“ bezeichnet oder von einem Buch, zu dem<br />
er beigetragen hat, explizit als positiv gemeintes „Werk der Propaganda“<br />
spricht. Er wusste stets, was er durch das Geschriebene<br />
erreichen wollte, auch wenn am Ende nicht alle seine Initiativen und<br />
Kampagnen zum gewünschten Erfolg führten.<br />
„Ach, so einen wie ihn bräuchten wir heute wieder!“, sagten viele<br />
meiner Gesprächspartner bei der Recherche zu diesem Buch.<br />
Warum? Was hatte <strong>Posener</strong>, was unsere gegenwärtige Architekturkritik<br />
vermissen lässt?<br />
Da ist zum einen die Vielfalt der „Werkzeuge“, die er benutzte.<br />
Es sind die zahlreichen Bühnen, auf denen er gleichzeitig spielte:<br />
Lehre, Journalismus, öffentliche Ämter. Es ist die Tatsache, dass er<br />
sich als Autor nicht im Verborgenen hielt, sondern als Person sichtbar<br />
machte und sich mutig aus der Deckung seiner Schreibstube<br />
herausbegab. Dann ist da dieses niemals demonstrativ zur Schau<br />
gestellte Bildungsfundament, auf dem seine Argumente standen.<br />
Und es ist nicht zuletzt die Schönheit seiner Sprache. Der Blick<br />
zurück auf so viele, aus unterschiedlichen Zeiten stammende und
141<br />
für verschiedene Zielgruppen verfasste Beiträge belegt, was Julius<br />
<strong>Posener</strong> auszeichnete – seine erzählerische und „bekennende“<br />
Art der Architekturkritik, seine weniger auf Details als vielmehr die<br />
Wirkung eines Baus bezogene Betrachtungsweise, seine bewusst<br />
nicht abgeklärt formulierten, auch Veränderungen unterlegenen,<br />
ganz persönlichen Urteile, die er immer wieder wagte. Er zeigte in<br />
seinen Texten und Vorträgen Mut zur Begeisterung, zu subjektiver<br />
Bewertung und einfachen, klaren Worten. Er gab seinen Lesern und<br />
Zuhörern Hinweise, worauf sie achten sollten, versuchte ihnen die<br />
Augen zu öffnen und ihren Blick auf das Wesentliche zu lenken. Eine<br />
mäkelige Grundhaltung, verschwurbelte Formulierungen oder abgehobene<br />
Verweise sind in seinen Texten nicht zu finden.<br />
Wenn es etwas gibt, was wir heute von <strong>Posener</strong> lernen können,<br />
dann dies: Architektur ist immer ein Politikum. Architekturkritik ist<br />
keine Randsportart im vielleicht ohnehin aussterbenden gedruckten<br />
Zeitungsfeuilleton. Sie gehört in viel mehr Medien, zurück ins Radio,<br />
in Podcasts und andere schnelle Social-Media-Kanäle. Sie ist nichts,<br />
was nur für einen kleinen, elitären Leserkreis gemacht sein darf,<br />
oder, noch größere Verschwendung, nur die schreibende Kollegenschaft<br />
beeindrucken will. Im Geiste Julius <strong>Posener</strong>s ist sie öffentliches<br />
Engagement und Aktivismus – ein kraftvolles Instrument, das<br />
den Lauf der Dinge verändern kann. Architekturkritik wirkt!