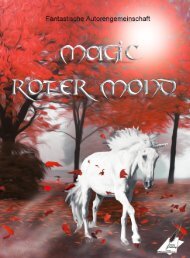Leseprobenheft BuchBerlin 2019
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Leseproben<br />
Erstellt für die <strong>2019</strong><br />
aus<br />
Werken von<br />
Rosa ANANITSCHEV<br />
In der sibirischen Kälte<br />
Andersrum<br />
Renate ZAWREL<br />
Schattenglück<br />
Zuckerwatte und Christbaumherz<br />
Il Vesuvio<br />
Barbara SIWIK<br />
Aqua Tofana<br />
Der Schatz aus der Truhe<br />
Wohin du gehen wirst<br />
Der unwegsame Pfad der Zeit<br />
1
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher<br />
Genehmigung der Autorinnen.<br />
Copyright - <strong>2019</strong>, Rosa Ananitschev, Renate Zawrel,<br />
Barbara Siwik<br />
2
Rosa Ananitschev<br />
4<br />
In der sibirischen Kälte – Auszug<br />
9<br />
Andersrum– Auszug<br />
19<br />
Renate Zawrel<br />
24<br />
Schattenglück - Bijela kuća<br />
29<br />
Zuckerwatte und Christbaumherz<br />
37<br />
Il Vesuvio - Die Ehrenwerte Gesellschaft<br />
45<br />
Barbara Siwik<br />
52<br />
Aqua Tofana<br />
57<br />
Der Schatz aus der Truhe<br />
65<br />
Der unwegsame Pfad der Zeit<br />
75<br />
Wohin du gehen wirst 87<br />
3
Rosa Ananitschev<br />
4
Rosa Ananitschev (geb. Schütz) erblickte das Licht der Welt im<br />
März 1954 in einem deutschen Dorf in Westsibirien (Gebiet<br />
Omsk). Ende 1992 kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland.<br />
Sie arbeitet als Bibliotheksassistentin in der Stadtbücherei<br />
Lüdenscheid, den Beruf Bibliothekarin hat sie noch in Russland<br />
erlernt und viele Jahre ausgeübt.<br />
Seit 2010 veröffentlicht Rosa Ananitschev Kurzgeschichten und<br />
Autobiografisches in digitaler Form.<br />
2014 erschien ihr erstes gedrucktes Buch (Novelle ›Andersrum‹),<br />
das sich mit dem Thema ›Kindesmissbrauch‹ befasst.<br />
Neuausgabe: ePubli 2018, ISBN: 978-3-746741-13-0<br />
In autobiografischen Texten setzt sich die Autorin intensiv mit<br />
ihrer Kindheit und Vergangenheit auseinander.<br />
Diese Texte beinhaltet auch ihr zweites Buch ›In der sibirischen<br />
Kälte‹, das im Mai 2016 im Karina-Verlag erschienen ist.<br />
ISBN: 978-3-903056-85-5.<br />
Außerdem ist Rosa Ananitschev in mehreren Anthologien mit<br />
ihren Texten und Kurzgeschichten vertreten.<br />
Homepage: www.rosa-andersrum.de<br />
Blog: www.rosasblog54.wordpress.com<br />
5
Text hier eingeben<br />
6
Das kleine Mädchen, …<br />
… das auf dem Coverbild scheinbar so unbeschwert einen Wintertag<br />
genießt, hat auf seinem Weg zum Erwachsenwerden viel erlebt. Es ist ein<br />
Werdegang mit vielen Hindernissen und Unbillen. Teilweise finden diese<br />
ihren Ursprung in der Zeit, der Herkunft und politischen Lage, in der diese<br />
Biografie ihren Anfang nimmt: 1954 in einem Dorf in Westsibirien.<br />
Rosa Ananitschev erzählt von Erlebnissen, die ihr besonders gut in<br />
Erinnerung geblieben sind: schöne und glückliche, traurige und tragische<br />
oder auch solche, die erst im reifen Alter aus der Tiefe aufstiegen und die<br />
Geschehnisse ihres Lebens in ganz anderem Licht erscheinen ließen. Die<br />
Erkenntnis, was den Depressionen zugrunde liegt, die sie seit ihren<br />
Kindheitstagen begleiten, löst zwiespältige Gefühle aus. Es braucht Zeit, bis<br />
die Autorin zu der Einsicht kommt, dass die kleine Rosa von damals ein<br />
Verschweigen nicht verdient hat, sondern vielmehr die Wahrheit und<br />
uneingeschränkte Anerkennung dafür, dass sie trotz allem, was ihr<br />
widerfahren war, die Willenskraft besaß, ihren Weg zu gehen.<br />
Vielleicht stellt das Mädchen auf dem Cover die kleine Rosa dar? Gewiss –<br />
sie hätte von so herrlicher Winterkleidung nicht einmal zu träumen gewagt<br />
… und doch – ihrem Wesen nach ist sie es. Hin und wieder vergaß sie<br />
nämlich alles Schwere um sich und in sich, tobte und wirbelte im Schnee<br />
umher und fühlte sich leicht und frei – ganz in ihrem Element, ganz in ihrem<br />
Universum.<br />
ISBN: 978-3-903056-85-5 – EUR 13,90<br />
7
8
In der sibirischen Kälte – Auszug<br />
Aus Sibirien ins Sauerland<br />
An einem bitterkalten Tag, am 4. Dezember 1992, saß ich endlich<br />
mit meiner Familie im Flugzeug, das den Kurs nach Deutschland<br />
hielt. Darüber schrieb ich bereits. Nicht nur mein sehnlichster<br />
Wunsch ging in Erfüllung, sondern auch der meines Mannes und<br />
unserer Kinder. Fast zwei Jahre hatten wir auf diesen Moment<br />
gewartet – eine lange Odyssee, die mit viel Formalitäten, aber<br />
auch Kampf und Bangen verbunden war.<br />
Nostalgie. Nostalgija – russisch ausgesprochen – ein Wort, das in<br />
dem Land, aus dem ich komme, viel thematisiert wird und für das<br />
Volk von großer Bedeutung ist. Es drückt am besten das Gefühl<br />
der Sehnsucht nach der Heimat aus, der verlorenen Heimat. Viele<br />
russische Schriftsteller, sowohl bekannte als auch unbekannte,<br />
beschrieben es in ihren Romanen und Gedichten, besonders<br />
diejenigen, die gezwungen waren, fernab von Russland zu leben.<br />
Vermutlich ist dies in der heutigen Zeit etwas anders geworden,<br />
denn fast jeder Ausgewanderte hat die Wahl, in der Fremde zu<br />
bleiben oder, wenn die Sehnsucht überhandnimmt, sich für eine<br />
Rückkehr zu entscheiden. Zumindest aber darf er das Land<br />
immer wieder besuchen.<br />
Ich habe nie den Wunsch verspürt, nach Russland zurückzukehren;<br />
nicht einmal den Urlaub wollte ich dort verbringen.<br />
Und doch habe ich es vor elf Jahren getan. („Die Reise zurück“)<br />
Es war wie das Eintauchen in meine frühen Albträume,<br />
faszinierend und quälend zugleich.<br />
Auch mein Heimatdorf besuchte ich. Auf dem Boden der<br />
Vergangenheit zu stehen, das Haus zu sehen, in dem ich<br />
aufgewachsen war, das Grab meiner Mutter auf dem völlig<br />
überwucherten Teil des Friedhofs zu suchen und zu finden und<br />
9
den kleinen Blumenstrauß auf die Granitplatte zu legen – das<br />
waren Emotionen ohnegleichen. Auch jetzt, während ich<br />
schreibe, muss ich mit den Tränen kämpfen, weil ich diese Bilder<br />
so klar vor Augen habe, weil plötzlich so viele Gefühle da sind …<br />
Keiner kann sich seinen Geburtsort aussuchen. Wir werden in die<br />
Welt hineingeboren und müssen uns in ihr zurechtfinden. War es<br />
mein Glück oder Unglück, als Deutsche in Russland geboren zu<br />
werden?<br />
Wahrscheinlich beides.<br />
Als Kind habe ich mich oft gefragt, warum gerade ich?<br />
Warum meine Eltern? Warum deren Vorfahren?<br />
Und manchmal wünschte ich mir dann, jemand anderer zu sein.<br />
Ich war nicht nur ‚fremd‘ in diesem Land, sondern fühlte mich<br />
auch im Dorf als Außenseiter (was allerdings ebenso auf meine<br />
Geschwister zutraf).<br />
Es lag vor allem daran, dass unsere Mutter nicht zu den<br />
Einheimischen zählte und daher nie so richtig dazugehörte. Sie<br />
war – ich schrieb es schon – 1933 aus der Ukraine nach Sibirien<br />
deportiert worden und hatte unseren Vater erst im Dorf<br />
kennengelernt.<br />
Die Familie unserer Mutter sprach einen Dialekt, der sehr dem<br />
Schwäbischen glich. Wir Kinder benutzten zu Hause ihre<br />
Sprache. Der Dialekt unseres Vaters war ein anderer. Die<br />
Dorfbewohner bezeichneten sich selbst als Belomeser.<br />
Im Spiel mit den anderen Dorfkindern verwendete ich anfangs<br />
die Muttersprache (im wahrsten Sinne des Wortes), wurde aber<br />
oft genug deswegen ausgelacht. Vaters Dialekt wollte ich nicht<br />
sprechen und so habe ich mich ziemlich früh der russischen<br />
Sprache bedient. Da gab es dann nichts mehr zu lachen und bald<br />
sprach ich auch daheim fast ausschließlich Russisch.<br />
10
Das Leben im Dorf in den 50er und 60er Jahren verlief einfach,<br />
besser ausgedrückt – ärmlich und voller Entbehrungen. Unsere<br />
Familie besaß nicht viel und die Kinder mussten sich mit ihren<br />
Wünschen ganz hinten anstellen. Natürlich sorgten die Eltern<br />
dafür, dass wir genug zu essen hatten, aber alles andere …<br />
Als Kind konnte ich meine Spielzeuge an den Fingern abzählen<br />
und als Jugendliche hatte ich kaum Kleidung zum Wechseln,<br />
obwohl das Geld dafür ganz sicher ausgereicht hätte. Fürwahr –<br />
es gab wichtigere Sachen als eine Puppe oder später ein neues<br />
Kleid.<br />
Als erwachsene Frau hätte ich mir in der Stadt, in der ich mit<br />
meiner Familie lebte und als Bibliothekarin arbeitete, finanziell<br />
einiges leisten können, wäre da nicht ein weiterer Engpass<br />
aufgetreten – das ’Defizit‘, ein allseits bekanntes Phänomen der<br />
sowjetischen Wirtschaft, der Mangel an allem in sämtlichen<br />
Branchen.<br />
Noch heute denke ich beim Einkaufen unwillkürlich daran, wie<br />
deprimierend leer die Läden in Omsk waren und was für eine<br />
Fülle hier überall herrscht. Und wenn ich unseren Kleiderschrank<br />
öffne, vergleiche ich dessen Inhalt oft mit dem des Schrankes von<br />
damals, der nicht einmal halb so groß war, in den aber die<br />
Kleidung für vier Familienmitglieder bequem hineinpasste und<br />
auch noch Platz übrigblieb.<br />
Ich kann sagen, dass ich mich in Russland wegen meiner<br />
Nationalität nie besonders diskriminiert fühlte. Bei der älteren<br />
Generation war das natürlich ganz anders. die Deutschen mussten<br />
zu Stalins Zeit viel erleiden, wurden mit den Faschisten ’in einen<br />
Topf ’ geworfen, zumindest aber als ’Beilage‘ angesehen und<br />
dementsprechend behandelt. Alle im europäischen Teil des<br />
Landes wohnenden Deutschen wurden 1941 nach Sibirien<br />
verbannt und die auf diese Art Deportierten durften nur im<br />
11
ihnen zugewiesenen Ort leben; ihn zu verlassen – egal wohin,<br />
egal warum – war im besten Fall allein mit einer Sondergenehmigung<br />
erlaubt.<br />
Ich entdeckte neulich ein Dokument in russischer Sprache im<br />
Internet, eine sogenannte Einverständniserklärung. Darin stand –<br />
sinngemäß übersetzt:<br />
Ich … bestätige hiermit, dass ich in diesen Ort … für alle<br />
Ewigkeit verbannt bin; mir ist auch bewusst – falls ich meinen<br />
Wohnsitz ohne Erlaubnis verlasse, werde ich mit zwanzig Jahren<br />
Lagerarbeit bestraft.<br />
Unterschrift …<br />
Freiwillig wurde diese Erklärung ganz bestimmt nicht abgegeben.<br />
Wer sollte damit wohl einverstanden sein? Mir fehlten die Worte,<br />
als ich den Inhalt dieser wenigen Zeilen richtig begriff …<br />
Übrigens wurden die in Russland lebenden Deutschen erst 1956<br />
– nach Stalins Tod – von ihrer kollektiven Mitschuld am Zweiten<br />
Weltkrieg freigesprochen und durften sich wieder frei im Land<br />
bewegen. In den Ort, in dem sie einmal ihr Zuhause hatten,<br />
kehrte jedoch kaum einer von ihnen zurück. Zu tief saß die<br />
Angst vor neuen Verfolgungen und außerdem waren sie dort<br />
nicht willkommen, denn die Häuser, die sie einst bewohnt oder<br />
besessen hatten, waren längst im Besitz von Fremden, mitunter<br />
sogar von ihren früheren Nachbarn, die das Glück hatten, keine<br />
Deutschen zu sein.<br />
Was mir in dieser oben erwähnten Einverständniserklärung sofort<br />
ins Auge fiel – sie war von einem Mann mit dem Nachnamen<br />
Hetterle unterzeichnet worden – das war auch der Mädchenname<br />
meiner Mutter. Leider ist es mir nicht gelungen, herauszufinden,<br />
ob es wirklich um einen Verwandten handelte. Jedoch habe ich<br />
mir vorgenommen, mich demnächst eingehender mit der<br />
Ahnenforschung zu befassen …<br />
12
Ja, für die Russland-Deutschen hatte das Wort Heimat mehrere<br />
›Gesichter‹, darunter ziemlich hässliche, wie ich versucht habe zu<br />
schildern.<br />
Auch mir fehlte die feste Bindung an dieses Land, das sich stolz<br />
mit dem Namen Vaterland brüstete.<br />
Zuweilen überkam mich in Russland das seltsame Gefühl, als<br />
gäbe es in meinem tiefsten Inneren eine angeborene Erinnerung;<br />
ich bildete mir sogar ein, etwas Schemenhaftes ausmachen zu<br />
können …<br />
Eine fremde Straße? … Fremdartige Häuser? … Dunkles Grün<br />
in der Abenddämmerung? …<br />
Im Verlauf einer Unterhaltung mit meiner Arbeitskollegin zum<br />
Thema Heimat – es war vielleicht um 1982 – gestand ich, dass ich<br />
mir insgeheim wünschte, ich könne wenigstens einmal durch eine<br />
Stadt gehen und die Menschen ringsum nur Deutsch reden hören.<br />
Die Kollegin war ob dieses seltsamen Wunsches sehr verwundert.<br />
Vermutlich dachte sie: ‚Die spinnt doch!‘<br />
Nun, gesponnen oder nicht: Zehn Jahre später wurde mein<br />
Traum wahr. Das hätte auch ich damals nicht für möglich<br />
gehalten.<br />
Nein, ich sehne mich nicht zurück, würde nie mehr in Russland<br />
leben wollen, denn mein Herz sagt mir: Dort wärst du tief<br />
unglücklich, dort hättest du dein Leben nie so leben können, wie<br />
du es für richtig hältst, dort hättest du dich verstecken, deine dir<br />
eigene Natur verleugnen müssen. Und vor allem wärst du dort nie<br />
den Ursachen deiner Depressionen und Panikanfälle auf den<br />
Grund gegangen, hättest nie gelernt, sie zu bewältigen. Du wärst<br />
in deinem schlimmsten Albtraum gefangen geblieben.<br />
Mein Herz sagt mir: Deine Heimat ist hier – in dem<br />
sauerländischen Städtchen Hemer, wo du dich wohl und zuhause<br />
fühlst.<br />
13
Aber wenn ich meiner inneren Stimme aufmerksam lausche, höre<br />
ich, dass sie mir dennoch etwas zuflüstert, das ich nicht vergessen<br />
sollte: Es gibt in deinem Herzen auch einen Ort, der in weiter,<br />
weiter Ferne liegt – ein winziges Fleckchen Erde in einem riesigen<br />
Land, wo du geboren wurdest und die Welt kennenlerntest.<br />
Und dann denke ich an die schönen Momente meiner Kindheit –<br />
die Dorfstraßen und Wiesen mit ihren Abenteuern, die Streifzüge<br />
durch die Wälder auf der Suche nach Erdbeeren, Brombeeren<br />
und Pilzen, ich denke an meine beste Freundin und daran, wie<br />
viel mir die Freundschaft mit ihr bedeutete. Ich sehe die<br />
Menschen, die trotz harter Schicksalsschläge nicht zerbrachen, die<br />
Kraft fanden, weiterzuleben. Und dann sage ich mir selbst – ja,<br />
auch das kleine Dorf in Sibirien wird immer seine besondere<br />
Bedeutung behalten. Vor vielen Jahren habe ich es verlassen, ging<br />
fort, um auf den Spuren meiner Vorfahren in meine Ur-Heimat<br />
zurückzukehren, das Land, in dem der Beginn dieser Spuren<br />
leider nicht mehr auszumachen ist.<br />
Fragte mich jemand, wo meine Heimat nun wirklich ist, so weiß<br />
ich im ersten Moment keine Antwort darauf.<br />
Vielleicht ist dies ein Ansatz: Heimat ist überall dort, wo ich von<br />
Liebe und Frieden umgeben bin.<br />
14
Das Buch enthält 50 ergreifende Geschichten, die von verschiedensten<br />
Heldenmomenten des Lebens erzählen. Opfer sein<br />
─ das hat viele Facetten: Mobbing, häusliche Gewalt, Missbrauch,<br />
aber auch Krieg, Krankheiten, Sucht, Comingout, oder aber auch<br />
das Opfer seiner selbst zu sein. Die Anthologie zeigt mit ihren<br />
Geschichten auch die Heldenmomente, die Überwindung der<br />
Opferrolle. Sie beinhaltet ein breites Spektrum von Lebensereignissen<br />
und möchte Betroffene ins Gespräch bringen. <br />
Das Buch dient zudem einem guten Zweck. 60 % vom Erlös<br />
gehen an die folgenden drei gemeinnützigen Vereine:<br />
re-empowerment, Quarteera und Anuas. <br />
Herausgeberin: Petra Schaberger, Q5 Verlag. <br />
Im Buch enthalten: „Offener Brief“ von Rosa Ananitschev.<br />
<br />
ISBN: 978-3-981985-71-9<br />
15
16
Eine Geschichte, die sich irgendwann vor vielen Jahren<br />
zugetragen hat … wenn sie der Realität entspringt. Ob dem so ist,<br />
mag der Leser für sich entscheiden. Doch das Thema, das dem<br />
Inhalt des Buches zugrunde liegt, ist brandaktuell.<br />
Auf ganz besondere Weise wird in „Andersrum“ die Problematik<br />
des sexuellen Missbrauchs – insbesondere im Familienkreis –<br />
behandelt. Was sich beinahe wie ein Märchen liest, hat mit dem<br />
genannten Genre wenig zu tun und lässt den Blick in die Seele<br />
eines Kindes zu, das vorerst vergeblich versucht, Erlebtes zu<br />
verdrängen und zu vergessen.<br />
Erst ein rätselhafter Fremder kann Lisa aus der Reserve locken<br />
und verhilft ihr mit Verständnis und dem vermittelten Gefühl,<br />
immer für das Kind da zu sein, das Trauma aufzuarbeiten und<br />
sich zu wehren.<br />
„Andersrum“ hat seinen Ursprung 1958, irgendwo in einem<br />
deutsch-russischen Dorf, doch ereignen sich gleichgeartete Fälle<br />
viel zu oft auch in heutiger Zeit und nicht selten in unmittelbarer<br />
Umgebung.<br />
Das Buch soll uns feinfühliger machen im Bezug darauf,<br />
Anzeichen für sexuelle Übergriffe besser zu erkennen. Nicht<br />
wegsehen und reagieren kann vielleicht helfen, Dinge zu<br />
verhindern, die einem Kind nie angetan werden sollten.<br />
ISBN: 978-3-746741-13-0 EUR 6,99<br />
<br />
17
18
Andersrum– Auszug<br />
Das Licht<br />
Die folgende Geschichte spielt sich in einem kleinen Dorf ab, das<br />
in einem weiten Land zwischen vielen Birkenwäldern liegt.<br />
Die Menschen in der Siedlung arbeiten hart und müssen viel Leid<br />
und Ungerechtigkeiten ertragen.<br />
Auch die kleine Lisa kämpft sich tapfer durch das Leben. Sie hat<br />
ihr ganz persönliches, schweres Päckchen zu tragen.<br />
Wir schreiben das Jahr 1958.<br />
Wie so oft wird Lisa mitten in der Nacht wach. Sie hat etwas<br />
geträumt, kann sich allerdings nicht mehr erinnern, was es war.<br />
Sie weiß nur – es war schlimm; der Albtraum nahm ihr Herz in<br />
den eisernen Griff und jetzt, wieder befreit, schlägt es schnell<br />
und hämmernd in ihrer Brust.<br />
Lisa hat im Schlaf geweint und spürt noch die Nässe im Gesicht.<br />
Ein Schluchzen entfährt ihr, als sie tief ein- und ausatmet. Ihr<br />
Herz beginnt sich allmählich zu beruhigen.<br />
Da hört sie eine Stimme, die nicht von außen zu kommen<br />
scheint, sondern direkt in ihrem Kopf sitzt: „Hallo, Lisa!“<br />
Das Mädchen hält den Atem an und lauscht angestrengt in sich<br />
hinein. Aber sie hört nur das gewohnte leise Schnaufen und<br />
Schnarchen ihrer Geschwister. Dann dreht sie sich auf den Rücken.<br />
Es ist nicht ganz düster im Zimmer. Der Mondschein von draußen<br />
hinterlässt einen hellen Streifen auf dem Holzfußboden und erfasst<br />
auch die dunkle Gestalt, die auf dem Rand des Bettes sitzt.<br />
„Hab keine Angst“, sagt erneut die Stimme in Lisas Kopf. Ohne<br />
es begründen zu können, weiß das Mädchen sofort, dass sie zu<br />
dieser Erscheinung gehört.<br />
19
Das Kind hat gar keine Angst – der Fremde ist zwar vollständig<br />
in Schwarz gehüllt, aber überhaupt nicht furchterregend.<br />
„Wer bist du? Was machst du hier?“, flüstert Lisa erstaunt.<br />
„Ich bin gekommen, um dir deinen größten Wunsch zu erfüllen“,<br />
antwortet die wohlklingende Stimme. „Du hast doch einen?“<br />
Lisa setzt sich langsam auf und schaut die Gestalt an. Dann<br />
schüttelt sie den Kopf und raunt: „Das kannst du nicht. Das<br />
kann nicht mal der liebe Gott.“<br />
Ein plötzlicher Verdacht kommt in ihr auf und sie fragt<br />
vorsichtig: „Du bist doch nicht Gott?“<br />
Sie hätte schwören können, dass der Fremde schmunzelt, obwohl<br />
sie sein Gesicht nicht sieht.<br />
Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. „Nein, der bin ich<br />
nicht. Betest du denn oft zu Gott?“<br />
„Mama sagt, ich muss jeden Abend vor dem Schlafengehen<br />
beten, dann wird der liebe Gott mich gernhaben und über mich<br />
wachen.“ Ein tiefer Seufzer entringt sich dem Mädchen. „Aber<br />
das will ich gar nicht. Dass er über mich wacht, meine ich. Ich<br />
bitte ihn nur …“ Lisa verstummt.<br />
„Worum ersuchst du Gott? Erzähl mir doch mal von deinem<br />
Wunsch“, bittet die einfühlsame Stimme.<br />
Erneutes tiefes Luftholen, das aus tiefster Seele kommt. Lisas<br />
Stimme wird immer leiser und ist kaum hörbar. „Das ist ein ganz<br />
ernster Wunsch.“ Sie sucht eine Weile nach dem passenden Wort.<br />
„Ein ganz anderer Wunsch, weil … weil es kein Ding ist.“<br />
Plötzlich stehen Tränen in ihren Augen. „Ich wünsche mir, froh<br />
zu sein“, flüstert sie, und ein unterdrücktes Weinen lässt ihre<br />
Schultern zucken.<br />
Der Fremde streichelt dem Mädchen beruhigend über die<br />
weichen Locken. „Weine nicht, Kleines. Das kriegen wir hin.<br />
Versprochen.“<br />
20
Lisa hebt den Kopf, in ihren Augen glänzen Tränen. Ungläubig<br />
blickt sie in das schwarze Gesicht. „Das kannst du? Echt? Dann<br />
bist du ja noch allmächtiger als Gott!“ Das Wort „Allmächtig“<br />
hat sie von den Erwachsenen oft gehört und weiß, was es<br />
bedeutet.<br />
Wieder spürt Lisa auf seltsame Weise das Lächeln des Fremden,<br />
als er antwortet: „Allmächtiger vielleicht nicht, aber ich kann<br />
Einiges. Am besten, wir fangen gleich an, an deinem Wunsch zu<br />
arbeiten. Komm, wir gehen nach draußen.“<br />
Die dunkle Gestalt erhebt sich vom Bett des Kindes. Selbst das<br />
Licht des Mondes vermag ihr kein Gesicht zu geben.<br />
„Jetzt? Im Dunkeln?“, argwöhnt Lisa, rutscht aber schon<br />
bereitwillig aus dem Bett.<br />
Der Fremde nimmt sie an die Hand. „Wo sind denn deine<br />
Schuhe?“, will er wissen.<br />
„Die sind im Schrank. Ich laufe im Sommer immer barfuß“,<br />
erklärt das Kind.<br />
„Dann muss ich dich aber auf den Arm nehmen, draußen ist es<br />
jetzt ganz schön feucht.“ Er hebt Lisa hoch und sie erstarrt, von<br />
plötzlicher Scheu erfasst. Behutsam drückt der Fremde das Kind<br />
an sich. „Ich tue dir nichts. Vertrau mir.“<br />
Lisa schmiegt sich vorsichtig an seine Brust. Das tut gut und sie<br />
fühlt sich auf einmal sehr wohl und sicher.<br />
Ohne ein Geräusch zu verursachen, huschen der Mann und das<br />
Mädchen aus dem Haus. Niemand hört oder bemerkt etwas.<br />
Im Garten bleibt der Fremde stehen und schaut zum Himmel<br />
empor. Auch Lisa hebt den Kopf.<br />
„Siehst du da oben die vielen Sterne?“, fragt die dunkle Gestalt.<br />
„Ja! Ich weiß auch, dass es Sonnen und Planeten sind“, antwortet<br />
das Mädchen mit hörbarem Stolz in der Stimme. „Das hat mir<br />
meine Schwester erzählt.“<br />
21
„Genau so ist es. Und sieh mal, der helle Stern da!“ Er deutet<br />
nach oben. „Auf dem wohnt auch so ein Mädchen wie du.“<br />
Lisa wird neugierig. „Ist es auch sechs Jahre alt? Heißt es auch<br />
Lisa?“<br />
Obwohl die Kleine sein Gesicht durch den schwarzen Stoff nicht<br />
sieht, ahnt sie, dass der Fremde lächelt, als er antwortet: „Nicht<br />
unbedingt Lisa – aber vielleicht … Asil?“<br />
„Oh ja – das ist mein Name, nur andersrum!“ Lisa lacht, der<br />
Name Asil gefällt ihr ausgesprochen gut.<br />
„Du bist ein kluges Mädchen!“, sagt der Fremde anerkennend.<br />
„Ist Asil auch manchmal traurig?“, will das Kind wissen.<br />
„Manchmal ja“, erwidert die Gestalt in Schwarz. „Besonders aber<br />
dann, wenn du traurig bist.“<br />
Lisa zupft leicht an dem Gewand des Mannes. „Woher weiß sie das?“<br />
„Nun, sie spürt es. Asil und du, ihr seid zwei Seelenverwandte.“<br />
„Was bedeutet das?“<br />
„Das ist wie bei Freunden. Zwei gute Freunde verstehen sich oft<br />
auch ohne Worte und fühlen, was der andere fühlt“, erklärt der<br />
Fremde.<br />
„Ich habe keine Freundin“, gesteht Lisa betrübt und senkt den Blick.<br />
„Die kommt noch – eines Tages“, verspricht der Dunkelgekleidete.<br />
„Du wirst es sofort wissen, wenn du sie siehst.“<br />
Schnell wechselt Lisa das Thema. „Sag mal, warum versteckst du<br />
dein Gesicht?“<br />
Der Fremde zögert ein wenig. „Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich<br />
darf mein Gesicht den Erdlingen nicht zeigen. So sind die<br />
Regeln.“<br />
Beim Wort „Erdlinge“ blickt Lisa nach oben zu den Sternen,<br />
dann wieder in das schwarze Gesicht. Eine Erkenntnis leuchtet in<br />
ihren Augen auf, aber sie behält sie für sich, fragt stattdessen:<br />
„Kannst du denn gut sehen, wenn deine Augen verdeckt sind?“<br />
22
Ein Kichern ist zu hören und anschließend: „Oh doch, ich sehe<br />
alles sehr gut.“<br />
Lisa bemerkt etwas auf der Brust des Fremden und setzt an:<br />
„Was ist …?“ Dann stoppt sie die Frage und ihre nächsten Worte<br />
klingen ein wenig vorwurfsvoll: „Du hast mir noch gar nicht<br />
gesagt, wie du heißt.“<br />
„Stimmt. Entschuldige“, antwortet die schwarze Gestalt. „Du<br />
kannst mich einfach Duh nennen.“<br />
Lisa macht große Augen. „Duh … so wie ich und du?“<br />
„Ja, so ungefähr.“<br />
„Dein Name gefällt mir“, sagt Lisa zufrieden. „Also Duh, was ist<br />
das hier, das so grün leuchtet?“ Sie berührt die Stelle auf dem<br />
Umhang. „Es ist hart. Ist das ein Kästchen?“<br />
Bereitwillig erklärt Duh: „Das ist ein kleines Gerät, das meine<br />
Sprache für dich übersetzt und deine für mich.“<br />
Das Mädchen wundert sich. „Verstehst du denn kein Deutsch? Auch<br />
kein Russisch? Ich kann schon gut Russisch sprechen“, fügt sie stolz<br />
hinzu. „Kann das Kästchen auch andere Sprachen übersetzen?“<br />
„Ja, alle Sprachen der Welt.“<br />
Lisa schüttelt beeindruckt den Kopf und lehnt sich an Duhs<br />
Schulter: „Du riechst gut“, murmelt sie.<br />
„Ich habe mich extra für dich fein gemacht.“<br />
Lisa ist zwar erst sechs Jahre alt, aber versteht den Scherz und<br />
antwortet gespielt ernst: „Für Mädchen müssen die Jungs sich<br />
eben fein machen.“<br />
„Gut erkannt, Kleine“, murmelt Duh.<br />
Lisa wird müde und der Fremde trägt sie wieder ins Haus, in ihr<br />
Bett. Sie löst sich nur ungern aus seinen Armen. Bevor der Schlaf<br />
sie endgültig überwältigt, flüstert sie: „Danke, Duh …“<br />
„Wofür denn, Kleines?“<br />
„Dafür, dass du so lieb bist.“<br />
23
Renate Zawrel<br />
24
Renate Zawrel<br />
wurde 1959 in Wien geboren und übersiedelte 1993 mit ihrer<br />
Familie nach Oberösterreich in das wunderschöne Ennstal.<br />
Die Erstausgabe von ›Il Vesuvio‹ präsentierte sie im April 2011.<br />
Es folgten im Verlag Sarturia Veröffentlichungen von mehreren<br />
Kurzgeschichten, sowie die Krimi-Trilogie ›Damendoppel‹.<br />
Ebendort war Renate Zawrel Herausgeberin der Kinderbuchreihe<br />
›Märchen unterm Regenbogen‹ und der Sarturia-<br />
Märchenbibliothek.<br />
Seit 2016 Mitarbeiterin im Karina-Verlag, Vienna.<br />
Kurzgeschichten in den Büchern der Reihe ›Respekt für dich‹,<br />
sowie Mitautorin der Flügel-Trilogie (Thriller), Teamleiterin des<br />
Fantasyprojekts ›Magic‹, Herausgeberin der Märchenbücher<br />
›Sternenreihe‹<br />
›Schattenglück – Bijela kuća‹ erlebte 2016 im Karina-Verlag,<br />
Vienna, eine Neuauflage.<br />
2018 wurde der Thriller ›Zuckerwatte und Christbaumherz‹ im<br />
Karina-Verlag veröffentlicht.<br />
Im Selfpublishing wird die Kinderbuchreihe ›Paulinchens und<br />
Onkel Paulchens Märchenwelt‹ herausgegeben - innerhalb dieser<br />
Reihe die Serie der Umweltbücher.<br />
https://www.renate-zawrel.at<br />
www.facebook.com/Renate.Zawrel<br />
<br />
25
26
Amely lebt in einer von Gewalt dominierten Beziehung. Die<br />
daraus resultierenden Selbstzweifel münden in Resignation …<br />
Die junge Frau und Mutter eines Sohnes gibt sich selbst die<br />
Schuld für alles, was ihr Dasein zur Hölle macht.<br />
Es bedarf eines einschneidenden Erlebnisses und einer gehörigen<br />
Portion Mut, sich aus diesem Kapitel ihres Lebens zu befreien<br />
und einen Neustart zu wagen.<br />
ISBN 978-3-903161-00-9 EUR 14,90<br />
27
28
Schattenglück - Bijela kuća<br />
Andjela, die Urenkelin Amelys, wird deren Aufzeichnungen aus ihrem<br />
Leben, das lange unter einem dunklen Schatten stand, zu einem Roman<br />
verarbeiten, der in der Gegenwart spielt …<br />
Die Einlösung einer ›Wettschuld‹, wenn man es so bezeichnen will, führt die<br />
Österreicherin Amely nach München. Dort trifft sie auf einen Mann, der<br />
ihr Herz berührt. Aber sie weiß, dass sie die Gefühle zu ihm in ihrem<br />
Herzen begraben muss. Amely ist verheiratet … wenngleich die Ehe auch<br />
die Hölle ist. Und … Amely entschließt sich zu einem folgenschweren<br />
Schritt.<br />
„Es gibt nicht mehr viel ‚weiter‘. Er ist in dieser Nacht bei mir<br />
geblieben und hat mich am Vormittag zum Zug gebracht. Das<br />
war es dann!“ Amelys Stimme schwankte als sie beteuerte: „Aber<br />
ich bereue nichts. Gar nichts. Nicht eine Sekunde.“<br />
Und dann folgte etwas, das Marianne, Amelys Freundin, ihres<br />
Zeichens Anwältin, zu allerletzt erwartet hätte!<br />
Amely erklärte: „Ich möchte die Scheidung. Und ich will, dass du<br />
mich vertrittst. ER soll mein Leben nicht mehr bestimmen<br />
dürfen.“ Sie missverstand das Erstaunen der Freundin. „Schau<br />
mich nicht so an“, verteidigte sie sich. „Von Marko habe ich<br />
weder Telefonnummer noch Adresse. Wir werden uns nie mehr<br />
sehen. Er ist nicht der Grund für die Scheidung, aber er hat den<br />
Ausschlag für meinen Entschluss gegeben. Er hat mir gezeigt,<br />
was es heißt, geliebt zu werden, wenn er es vielleicht auch nicht<br />
so empfunden hat. Mir ist klar geworden, dass ich nicht mehr<br />
dulden werde, dass ER mich und das Kind seelisch und<br />
körperlich zerstört.“ Amelys flehender Blick traf Marianne.<br />
29
„Wirst du mir helfen? Wirst du einen Weg finden, dass ich, dass<br />
wir, endlich in Ruhe leben können?“<br />
Wie lange schon hatte sie auf die Freundin eingeredet? Und<br />
dieser Marko Urbanić schaffte es an einem Wochenende. Respekt!<br />
Marianne fragte dennoch: „Bist du dir hundertprozentig sicher?<br />
Nicht, dass du nach der ersten Verhandlung wieder einen<br />
Rückzieher machst. Dein künftiger EX“, formulierte sie mit<br />
Genugtuung, „wird alle Register ziehen. Doch sei unbesorgt,<br />
meine Argumente werden besser und stichhaltiger sein. Wir<br />
werden auf allen Ebenen siegen und du wirst ein Leben führen<br />
können, wie du es dir schon so lange wünschst.“<br />
Sie hielt Amely die Hand entgegen und die schlug ein.<br />
„Ja, ich steh es durch!“, versprach sie. „Es muss nun genug sein.“<br />
Während sie erzählte, war Amely so aufgewühlt gewesen, dass sie<br />
sogar darauf vergaß, Tränen zu vergießen. Nun war die<br />
Anspannung gewichen und Marianne hielt eine bitterlich<br />
Weinende im Arm. Die Freundin schluchzte und bebte, denn sie<br />
hatte soeben eine Entscheidung getroffen, die ihr weiteres Leben<br />
bestimmen würde.<br />
Marianne aber erkannte, dass Amely in ihrem Leben zum ersten<br />
Mal wirklich geliebt hatte und geliebt worden war.<br />
Mariannes Brief löst eine Flut an Katastrophen aus:<br />
Neugierig, warum ausgerechnet Marianne ihm einen eingeschriebenen<br />
Brief schickte, beeilte sich Roman, ihn vom Postamt<br />
abzuholen. Vielleicht hatte die Mutter ihm ja irgendetwas schon<br />
zu Lebzeiten vererbt. Keinen Gedanken verschwendete der Mann<br />
daran, dass dieses Schreiben in irgendeinem Zusammenhang mit<br />
seiner Frau stehen könnte. Die hatte er schließlich fest im Griff.<br />
30
Er führte ein bequemes Leben. Die Mutter unterstützte ihn,<br />
wenn er sich wieder einmal ein neues Prestige-Auto zulegen<br />
wollte, eine luxuriöse Armbanduhr oder welche Annehmlichkeit<br />
auch immer. Er selbst war froh, dass er sich nicht um sie<br />
kümmern musste. Gegenüber seinen Kumpanen bezeichnete er<br />
sie als ›alten Drachen‹ und in dieser Eigenschaft informierte sie<br />
ihn über jeden Schritt, den Amely tat.<br />
Seine weiblichen Begleiterinnen wechselte Roman wie die<br />
Hemden. Sie mussten gut im Bett sein, mehr interessierte ihn an<br />
diesen Frauen nicht. Was die eigene betraf, so freute er sich<br />
darauf, es ihr wieder einmal so richtig ‚zu besorgen’, sobald die<br />
Schwiegereltern abgereist waren. Er wusste, dass er Amelys Seele<br />
traf, wenn er sie mit brutaler Gewalt nahm oder seine perversen<br />
Spiele mit ihr trieb; ebenso, dass sie wegen Michael nicht zu<br />
schreien wagte. Auch für diesmal hatte er sich gewisse Bosheiten<br />
ausgedacht, da ihm die Mutter ausführlich über Amelys Verhalten<br />
seit ihrer Rückkehr aus Deutschland berichtet hatte. Diesmal<br />
würde ihre Beherrschung zusammenbrechen, ob das Kind in der<br />
Nähe war oder nicht. Es würde eine Weile dauern, ehe sie sich<br />
‚danach‘ wieder auf die Straße wagen konnte. Sie sollte erfahren,<br />
nein, erspüren, was geschah, wenn man ihm Widerstand leistete.<br />
Er unterschrieb den Reco-Brief. Mit zweideutigem Lächeln<br />
machte er der Frau am Schalter ein Kompliment, das sie zum<br />
Erröten brachte, und verließ in bester Laune das Postamt.<br />
Sein Grinsen gefror, als er den Inhalt des Briefes überflog.<br />
In rechtsfreundlicher Vertretung von Frau Amalie Berg, wohnhaft in …<br />
Roman übersprang persönliche Daten … teile ich Ihnen mit, dass meine<br />
Mandantin eine sofortige Lösung des ehelichen Verhältnisses anstrebt.<br />
Gemäß der §§83,84,105,201 StGB liegt Ihrerseits eine schwere<br />
Eheverfehlung vor, insbesondere durch die Tatsache der Anwendung<br />
körperlicher Gewalt und Zufügen von schwerem seelischen Leid. Sie werden<br />
31
daher eingeladen, zwecks Besprechung der notwendigen Schritte, gemeinsam<br />
mit Ihrem Rechtsvertreter am Mittwoch, dem 13.Jänner diesen Jahres in<br />
meiner Kanzlei vorzusprechen.<br />
Hochachtungsvoll<br />
Dr. Marianne Bräuer<br />
Erstes Opfer seiner Aggression wurde eine am Boden liegende<br />
Getränkedose. Wütend trat er auf sie ein, bis sie nur mehr ein<br />
flaches Stück Blech war. Roman riss das Handy aus der<br />
Hosentasche und wählte, zitternd vor Zorn, Amelys Nummer …<br />
dreimal, viermal, fünfmal vergeblich: ‚Der gewünschte Teilnehmer ist<br />
im Moment nicht erreichbar. Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen ...’<br />
Ungeduldig wartete er den Signalton ab und hinterließ eine<br />
Tirade wüster Beschimpfungen und Drohungen, die er mit ‚Du<br />
bist tot!’ beendete. In seiner unbezähmbaren Wut bedachte er<br />
nicht, dass ihm gerade diese Worte zum Verhängnis werden<br />
konnten. Seine Frau über das Festnetz zu erreichen, wagte er<br />
nicht, er fürchtete ihre Eltern.<br />
In seiner Wohnung angekommen, warf er die Tür ins Schloss,<br />
dass die Wand bebte. Die ›Entschädigungszahlung‹ für diesen<br />
herausfordernden Fetzen Papier würde Amely nicht unbeschadet<br />
überstehen.<br />
Anwalt … Anwalt …<br />
Roman überlegte krampfhaft: Er hatte keinen Freund, der Anwalt<br />
war. Eigentlich hatte er gar keine Freunde, höchstens Kumpel, die<br />
ihm kaum helfen würden, wenn es hart auf hart kam. Er blätterte<br />
das Telefonbuch mehr mals nach einem geeigneten<br />
Rechtsbeistand durch, doch die Wut ließ ihn keinen klaren<br />
Gedanken fassen. Morgen würde er sein Glück aufs Neue<br />
versuchen. Amely und ihre bescheuerte Anwältin hatten die<br />
Rechnung ohne ihn gemacht.<br />
32
33
34
Weihnachtliche Düfte locken Kinder wie Erwachsene auf den<br />
Wiener Christkindlmarkt.<br />
An einem der Verkaufsstände arbeitet Hannah. Hinter ihrem<br />
schrillen Äußeren verbirgt sich eine junge Frau, deren Kindheit<br />
kein Honiglecken war. Aufgewachsen in einem Waisenhaus,<br />
musste sie erfahren, dass Liebe und Zuneigung unerfüllte<br />
Herzenswünsche bleiben.<br />
Dem Waisenhaus steht Georgine Häusler vor. Ihr ist Hannah ein<br />
Dorn im Auge – und das nicht nur aufgrund der provokativen<br />
Art, die diese an den Tag legt.<br />
Ein Kind des Waisenhauses verschwindet auf unerklärliche Weise<br />
im Tiergarten Schönbrunn, ein Verbrechen kann nicht<br />
ausgeschlossen werden. Mit allen Mitteln versucht Georgine<br />
Häusler, Hannah dafür verantwortlich zu machen. Ein weiteres<br />
Kind wird als vermisst gemeldet … und bald darauf fehlt auch<br />
von Hannah jede Spur.<br />
Von Weihnachtsfrieden ist keine Rede mehr, als sich der wahre<br />
Charakter der Heimleiterin herauskristallisiert, der ein Tierpfleger<br />
und ein korrupter Polizist zur Seite stehen.<br />
Über all dem schwebt der Wunsch eines Jungen im<br />
›Herzerlbaum‹, der den weihnachtlichen Rathauspark schmückt.<br />
ISBN: 978-3-96443-113-4 EUR 13,90<br />
35
36
Zuckerwatte und Christbaumherz<br />
Im Tiergarten Schönbrunn.<br />
Die Uhr des Tierpflegers Heinz Pfader zeigte noch nicht einmal<br />
achtzehn Uhr.<br />
Die spezielle Nachtführung, für die sich die ›Arbeitsgemeinschaft<br />
Biologie‹ der Schüler der Neuen Mittelschule aus dem achten<br />
Gemeindebezirk angemeldet hatte, würde um neunzehn Uhr<br />
starten. Stefan Lindner und Georg Hanaus sollten die Mädchen<br />
und Buben sowie die beiden Lehrbeauftragten zu den<br />
nachtaktiven Tieren begleiten.<br />
»Heute bekommt’s wieder Besuch, meine Schönen«, rief Pfader über<br />
den Zaun des Wolfsgeheges. Ein Paar bernsteinfarbener Punkte<br />
tauchten aus dem Dunkel auf, begleitet von einem leisen Knurren.<br />
»Schon gut, Amio«, brummte der Pfleger beruhigend. »Es dauert<br />
nicht lange, dann habt ihr wieder Ruhe vor den neugierigen<br />
Fratzen.«<br />
Für Heinz Pfader waren Kinder unliebsame Störenfriede und<br />
heute war es soweit, ein Exempel zu statuieren. Das erwies sich<br />
aus seiner Sicht als durchaus notwendig, abgesehen davon, dass er<br />
ja im Auftrag handelte …<br />
Die Schüler samt den Lehrern näherten sich mit ihren Führern<br />
dem Wolfsgehege.<br />
Jasmina aus der Sonnenherberge trödelte ein wenig hinter der<br />
Gruppe her.<br />
»Mädchen!«, rief Professor Schütze ungeduldig. »Komm endlich,<br />
wir wollen nicht immer auf dich warten.«<br />
»Ich komme schon, muss mir nur den Schnürriemen neu binden«,<br />
antwortete Jasmina.<br />
37
»Dann beeile dich.« Die Umrisse des Biologie-Lehrers verschmolzen<br />
mit der Dunkelheit.<br />
Jasmina war allein und das beunruhigte sie nun doch, denn es<br />
waren Geräusche zu hören … Sie versuchte angestrengt, das<br />
Dunkel mit ihren Blicken zu durchdringen.<br />
Kiesel knirschten unter harten Sohlen.<br />
Erleichtert atmete Jasmina auf. Sicher kam der Professor sie<br />
holen. Unerwartet blendete sie das Licht einer Taschenlampe.<br />
»Bitte nicht, Professor!«, bat sie und hielt abwehrend die Hand<br />
vor die Augen.<br />
»Nix Professor«, knurrte eine böse Stimme …<br />
Die Professoren Schütze und Hofer reihten ihre Schüler<br />
inzwischen ahnungslos vor dem Wolfsgehege auf, wie die<br />
Tierpfleger Lindner und Hanaus es angewiesen hatten. Die<br />
Schülerinnen und Schüler erhielten Nachtsichtgeräte und<br />
benutzten sie gemäß den Anweisungen der Angestellten des<br />
Tierparks.<br />
Bald hörte man verhaltene Ausrufe wie ›Boah!‹ ›Cool!‹ und all jene<br />
Wörter, die eben gerade ›in‹ waren, wenn man seiner<br />
Begeisterung Ausdruck verleihen wollte.<br />
»Scheiße!«, rief eine Jungenstimme plötzlich laut.<br />
»Martin, mäßige dich!«, zischte Professor Hofer.<br />
»Geht nicht, Professor!«, gab der Bursche mit rauer Stimme<br />
zurück. »Ich hab’ grad beobachtet, wie eins der Viecher was<br />
hinter den Busch zog, das wie ein Mensch aussah …«<br />
»So ein Quatsch«, knurrte Hofer. »Wo willst du das gesehen<br />
haben?«<br />
Martin drückte das Nachtsichtgerät des Lehrers so weit nach<br />
links, dass dieser ungefähr den Busch im Visier haben musste,<br />
den er meinte.<br />
38
Gerold Hofers Hand begann zu zittern. »Schütze«, krächzte er.<br />
»Schau mal oder schau lieber nicht. Ich weiß nicht, was besser<br />
ist.«<br />
Schütze schaute. Bei anderen Lichtverhältnissen hätte man wohl<br />
gesehen, wie er blass wurde. So verwunderte höchstens, dass der<br />
Mann sich haltsuchend an das Gatter lehnte. Er keuchte und<br />
stammelte, nur für den Lehrerkollegen hörbar: »Von Verfütterung<br />
eines … Menschen … war aber in der Nachtführung … nicht die<br />
Rede. Das ist ja wie … in einem … Horrorfilm.«<br />
Die Schüler hatten mitbekommen, dass etwas geschehen sein<br />
musste und schwenkten ihre Geräte in die Richtung, in welche die<br />
Professoren und mittlerweile auch die beiden Zoo-Führer<br />
starrten.<br />
»Herr Professor«, stotterte ein Mädchen verunsichert, »ist … ist<br />
das … wirklich ein … Mensch, den die Wölfe …?«<br />
Die Frage wurde unterbrochen … Unerwartet erhob sich<br />
schauriges Heulen. Ein einzelner Wolf hatte es angestimmt, aber<br />
nach und nach fielen andere ein.<br />
Georg Hanaus verständigte über Handy eilig das Sicherheitspersonal<br />
des Tierparks. Zehn Minuten später flammten<br />
Suchscheinwerfer auf. Der blattlose Strauch im Gehege stand nun<br />
grau im gleißenden Licht. Schleifspuren, abgebrochene Zweige<br />
und unter dem dürren Geäst wurden deutlich Teile eines roten<br />
Schnürstiefels sichtbar.<br />
»Jasmina!«, schrie Schütze in plötzlicher Erkenntnis, wem der<br />
Stiefel zuzuordnen war.<br />
Totenstille. Keiner wagte zu reden. Alle horchten gespannt,<br />
hofften auf Antwort.<br />
Das Geheul der Wölfe verstummte. Die Tiere verschwanden<br />
lautlos im dichten Gehölz.<br />
39
»Ein abschreckendes Beispiel ist immer gut«, murmelte Heinz<br />
Pfader in den dicken Schal hinein, den er um den Hals trug.<br />
»Immer! Nicht wahr, Amio?« Er klopfte an den stabilen Zaun des<br />
Wolfsgeheges und schlurfte davon. Ein starrer Blick aus<br />
bernsteinfarbenen Augen folgte ihm. Der Leitwolf kehrte zu<br />
seinem Rudel zurück. Die Sonderration Fleisch würde die Tiere<br />
noch eine Weile beschäftigen.<br />
Schneeflocken sanken lautlos zur Erde und bedeckten alle<br />
Spuren, falls welche vorhanden gewesen waren …<br />
*<br />
Als Hannah durch das Portal in die Eingangshalle des Heims trat,<br />
warteten dort schon ›Georgie‹ und der dümmlich-arrogante<br />
Polizist Lampert auf sie. Triumphierend verkündete der<br />
›Hausdrachen‹: »Du bist verhaftet. Sigi nimmt …« Erschrocken<br />
hielt die Häusler inne und beeilte sich, ihren Fehler zu<br />
korrigieren. »Inspektor Lampert wird dich gleich mitnehmen.«<br />
Der Versprecher hatte ausgereicht, um bei Hannah alle<br />
Alarmglocken läuten zu lassen: Daher wehte der Wind! ›Georgie‹<br />
und der Polizist steckten unter einer Decke.<br />
Lampert gab sich keine Mühe, höflich zu sein. Jetzt konnte er es<br />
diesem blöden Weib heimzahlen. »Entführung eines Minderjährigen.<br />
Und halte gefälligst die Klappe! Du hast nichts zu<br />
vermelden. Mitkommen!« Er packte Hannah am Unterarm und<br />
wollte sie mit sich ziehen. Nur so einfach lief das nicht. Hannah<br />
befreite sich mit einem Ruck und versuchte, durch das Portal zu<br />
entkommen. Aber davor hatte sich die Heimleiterin aufgebaut.<br />
40
Als Hannah an ihr vorbeieilen wollte, packte sie zu, erwischte die<br />
Fliehende und rammte ihr durch Anorak und Pullover hindurch<br />
eine Spritze in den Oberarm.<br />
Ehe Hannah recht begriff, was ihr geschah, sackte sie zusammen<br />
und fiel wie ein Stein zu Boden. »Verschwinde mit ihr! Aber<br />
schnell!«, zischte Georgina Lampert zu. »Es darf dich keiner<br />
sehen!« Sie drückte ihm ein Kuvert in die Hand. »Die Anzahlung;<br />
Rest wie vereinbart.«<br />
Lampert steckte das Päckchen ein, schulterte die bewusstlose<br />
Hannah und verschwand durch den Hintereingang … Dort hatte<br />
er den Lieferwagen abgestellt und den Motor laufen lassen.<br />
41
42
Der Regisseur Ronald Graham plant sein Filmprojekt vor der<br />
Kulisse des schlummernden Vulkans. Ein Film, der das<br />
verschwommene Bild der Camorra, der Mafia in Neapel<br />
beleuchten soll. Wie steht Don Carlos, der Pate, jedoch dazu?<br />
Er stellt Bedingungen – eine davon ist tödlich.<br />
Nebst Filmkulisse birgt das Haus von Sir Lindsay, dem<br />
englischen Lord, zudem ein Geheimnis: Maria! Wie glühend<br />
roter Lavastrom begleitet der Name durch die Geschichte.<br />
Doch welche Rolle ist Marie zugedacht in diesem blutigen Spiel<br />
um Macht, Korruption und … Liebe?<br />
ISBN 978-3-745022-72-8 EUR 21,99<br />
43
44
Il Vesuvio - Die Ehrenwerte Gesellschaft<br />
Auf dem Kai tummelten sich neben streunenden Katzen, die<br />
gierig nach jedem Happen schnappten, auch Kinder, die sich<br />
verstohlen hier und da einen Fisch schnappten und mit ihm<br />
davonrannten, nicht einholbar für die schimpfenden Fischer, die<br />
ja letztendlich bei ihrer Ware bleiben mussten. Die Kisten, deren<br />
Deckel oft nur einen Spaltbreit offenstanden, enthielten Fische,<br />
Langusten und Muscheln.<br />
Frauen mit großen Körben wählten aus dem reichen Angebot.<br />
Das Geräusch der vielen Stimmen hörte sich an wie das<br />
Rauschen der Meeresbrandung, zumal weder Karl noch Ronald<br />
ein Wort verstanden. Über allem lag der intensive Geruch von<br />
Fisch.<br />
Unversehens stieß Landmann Graham an und wies nach vorn.<br />
»Sieh mal, wer da ist!« Nur er bemerkte, dass sich sein Puls<br />
beschleunigte, dennoch befürchtete er, man könne es geradezu<br />
sehen.<br />
Wenige Meter von ihnen entfernt stand Marie, die junge Frau, der<br />
sie gestern bei Sir Edward begegnet waren.<br />
Lachend und ungezwungen unterhielt sie sich mit dem Fischer,<br />
scheute sich nicht, die Fische selbst aus den großen Behältern<br />
herauszuholen und besiegelte deren Kauf mit Handschlag. Die<br />
fangfrischen Tiere wurden in Nylonsäckchen verpackt und in<br />
einen großen Korb gelegt.<br />
Mit dem Handrücken strich Marie sich eine widerspenstige<br />
Strähne aus dem Gesicht und packte dann den Korb, um ihn<br />
aufzuheben. Karl war mit wenigen Schritten bei ihr.<br />
Marie erschrak, als so plötzlich jemand neben ihr auftauchte und<br />
nach dem Henkel griff. Sie reagierte automatisch und schlug mit<br />
45
der Faust zu … Erst danach erkannte sie die Situation und fuhr in<br />
tödlicher Verlegenheit zurück. »Oh, es tut mir ja so leid«, rief sie.<br />
»Wie hätte ich ahnen sollen, dass Sie es sind. Ich dachte, es sei<br />
einer dieser flinkfingrigen Burschen. Mister Landmann, bitte<br />
entschuldigen Sie.« Marie wusste nicht, was sie noch sagen oder<br />
tun sollte.<br />
Der Schlag hatte gesessen. Karl – in gebückter Haltung –<br />
bemühte sich, eine regelmäßige Atmung zustande zu bringen.<br />
Ronald stand einige Meter entfernt und schnappte ebenfalls nach<br />
Luft, jedoch vor Lachen. Es hatte aber auch zu komisch<br />
ausgesehen, als die kleine Lady dem großen Mann eine Breitseite<br />
verpasste, dorthin, wo es Mann am schmerzhaftesten trifft!<br />
Auch Giuseppe der Fischer hatte seine Kappe nach hinten<br />
geschoben, kratzte sich das Kinn und grinste unverschämt. Er<br />
mochte Marie, die schon seit langer Zeit bei ihm die Fische<br />
kaufte. Sie wusste genau, was sie wollte und zahlte gern einen<br />
vernünftigen Preis. Er hatte es inzwischen aufgegeben, ihr mehr<br />
Euros zu berechnen. Das funktionierte nicht bei dieser Frau.<br />
Außerdem gefiel es ihm, dass sie italienisch sprach, sich nie zu<br />
fein war, selbst mit anzupacken, obwohl man bei ihrer grazilen<br />
Erscheinung eher dazu neigte, gleich hilfsbereit zur Stelle zu sein,<br />
wie soeben dieser junge Mann. Aus seiner Jackentasche holte<br />
Guiseppe eine kleine Flasche und hielt sie dem noch immer mit<br />
dem Schmerz Kämpfenden hin, der wohl das erste Mal in seinem<br />
Leben von einer Frau geschlagen worden war und dann noch …<br />
na ja …<br />
»Bere!«, forderte er Karl freundlich auf und hielt ihm die Flasche<br />
unter die Nase.<br />
»Sie sollen trinken, das hilft«, übersetzte Marie. »Giuseppes<br />
Grappa ist gut, fast schon Medizin.«<br />
46
Karl nahm dankbar einen kräftigen Schluck. Zu kräftig! Statt<br />
sofortiger Besserung fehlte ihm urplötzlich wiederum die Luft<br />
und er erlitt einen Hustenanfall.<br />
Ronald, der inzwischen neben der Gruppe stand, traten Tränen<br />
der Heiterkeit in die Augen. Einer seiner Filmhelden sah hier<br />
gerade gar nicht wie ein verwegener Mafioso aus, eher wie eine<br />
ausgepresste Zitrone.<br />
Dankend nahm auch er die Flasche entgegen, die ihm der Fischer<br />
reichte, der nun ebenfalls herzlich lachte. Puh, das war vielleicht<br />
ein Zeug! »Himmel! Was trinkt ihr da? Das brennt ja wie Feuer.«<br />
Giuseppe verstand nicht, was der Fremde sagte, konnte sich aber<br />
denken, was die Worte bedeuteten und lachte erneut.<br />
Der Grappa brannte Ronald bis in den Magen hinunter, von dort<br />
jedoch breitete sich eine wohltuende Wärme in seinem Körper<br />
aus.<br />
Marie war inzwischen zu ihrem Auto gelaufen, das nur wenige<br />
Meter entfernt stand und kam mit einer Flasche Mineralwasser<br />
zurück. Schuldbewusst beugte sie sich zu dem hustenden und<br />
prustenden Karl hinunter, der noch immer nach Luft schnappte,<br />
und reichte ihm die Plastikflasche. Als er abwinkte, sprach sie ihm<br />
gut zu: »Das ist nur Mineralwasser, ehrlich. Bitte, trinken Sie in<br />
kleinen Schlucken.«<br />
Endlich griff er zu und nippte sehr vorsichtig an dem klaren<br />
Nass. Er hatte ehrlich gezweifelt, dass es sich wirklich um Wasser<br />
handelte. Langsam fühlte er eine Besserung und vermochte sich<br />
aufrichten. Doppeltes k.o. war der richtige Ausdruck dafür, was<br />
ihm soeben widerfahren war. Als er endlich wieder aufrecht zu<br />
stehen vermochte, traf sein Blick auf den besorgten<br />
Gesichtsausdruck von Marie. In ihren Augen flackerte noch<br />
immer Erschrecken und etwas wie Angst.<br />
47
Sie war heute ungeschminkt und auf ihrem Gesicht zeigten sich<br />
hektische rote Flecke. Der üppige Rollkragen des Pullis schien<br />
ihren Kopf verschlucken zu wollen und eine Windböe zerrte an<br />
ihrem aufgesteckten Zopf.<br />
Karl drängte es, die Hand zu heben und Marie über die Wange zu<br />
streichen, sie zu trösten, wie man es bei einem Kind tut, das<br />
ungewollt eine Dummheit begangen hat. Im letzten Moment<br />
besann er sich und verlangte nur den Verschluss der Wasserflasche.<br />
Als Marie ihm die Kappe reichte, berührten sich ihre Hände und<br />
es war, als spränge ein elektrischer Funke über. Gedankenschnell<br />
fuhren beider Hände auseinander und der Plastikverschluss fiel zu<br />
Boden. Beide bückten sich, gleichzeitig, und – stießen nun auch<br />
noch mit den Köpfen zusammen.<br />
Giuseppe und Ronald – abwechselnd am Grappa nippend –<br />
beobachteten die beiden interessiert, grinsten einvernehmlich und<br />
gaben jeweils ihre Meinung kund – für den einen so<br />
unverständlich wie für den anderen. Aber sie waren sich<br />
vollkommen einig: Wer den Schaden hatte, brauchte für den Spott<br />
nicht sorgen …<br />
Marie hatte inzwischen ein krebsrotes Gesicht und das Karls<br />
näherte sich der gleichen Farbe. Er murmelte fast nicht<br />
Verständliches, das gleichzeitig wie eine Entschuldigung und wie<br />
›das gibt’s doch nicht‹ klang. Immerhin hatte er es geschafft, die<br />
Flasche wieder zu verschließen und Marie zu reichen.<br />
Wie kam es nur, dass er so unvermittelt auf eine Frau reagierte?<br />
Er wusste nichts von ihr, außer, dass sie hervorragende Petit<br />
Fours machte, ihre Finger – wenn auch unbeabsichtigt – seinen<br />
Nacken berührt hatten, dass sie einen treffsicheren Schlag auf<br />
edle Körperteile ausführen konnte, ihr Kopf eine richtig harte<br />
Nuss war und – dass sie ausdrucksvolle Augen besaß, Haar, das<br />
48
zum Streicheln einlud, Hände, die man in die seinen nehmen<br />
wollte, einen Körper, den man augenblicklich zu umarmen<br />
wünschte und … Karls Magen zog sich warnend zusammen.<br />
Wann hatte er das letzte Mal solche Gefühle für eine Frau<br />
gehabt?<br />
Marie hatte sich gefangen; sie griff nach dem Korb mit den<br />
Fischen und eilte – in der anderen Hand die Wasserflasche – auf<br />
den Kombi zu. In ihrem Hals saß ein Kloß. Wahrscheinlich hätte<br />
sie den Rest Grappa in der Flasche leeren müssen, um ihn<br />
fortzuschwemmen. Distanz war das Einzige, das helfen würde.<br />
Daher wollte sie so schnell wie möglich von diesem Mann fort,<br />
der sie so aus dem Konzept brachte. Sie hatte sich geschworen,<br />
nie mehr solche Gefühle zuzulassen, wie sie sich ihr nun<br />
aufdrängten. Zornig über sich selbst warf sie die Fische in die<br />
große Kühlbox, die sich im Kofferraum des Kombis befand. Und<br />
ihr seelischer Zustand besserte sich erst recht nicht, als Karl<br />
schweigend neben sie trat und ihr beim Beladen half.<br />
Zum Glück ahnte sie nichts von den Bildern in seinem Kopf …<br />
Er sah sich Marie in die Arme nehmen, sah, wie er sie entkleidete<br />
und auf die freie Ladefläche des Kombis bettete … Einen<br />
Augenblick schloss er die Augen, meinte zu spüren wie ihr Mund<br />
den seinen berührte, seine Finger durch ihr Haar glitten, das sich<br />
anfühlte wie …<br />
»Mister Landmann, ist Ihnen nicht gut? Ich würde gern den<br />
Kofferraumdeckel zumachen.« Jetzt erst registrierte er, dass Marie<br />
auf ihn einredete. Sie musste ihn schon einige Male angesprochen<br />
haben, denn ein besorgtes Lächeln lag auf ihrem Gesicht, das die<br />
normale Farbe zurückgewonnen hatte.<br />
»Natürlich, ja. Ich war nur etwas … abwesend. Soll ich helfen?«,<br />
bot er höflich an.<br />
49
»Lieber nicht.« Marie wehrte in komischem Entsetzen ab. »So gut,<br />
wie wir beide das heute können, schlage ich Ihnen letztendlich<br />
noch die Klappe auf den Kopf. Schadensersatzforderungen kann<br />
ich mir nicht leisten.« Sie hatte sich wieder im Griff und das war<br />
das Wichtigste.<br />
Der Wind trieb dunkle Wolken heran und einzelne Regentropfen<br />
fielen vom grauen Himmel.<br />
Giuseppe rief Marie etwas zu und deutete auf das Meer hinaus.<br />
Die Frau nickte und wandte sich an Karl, der noch immer wie ein<br />
Schatten neben ihr stand.<br />
»Ich bringe Sie beide ins Hotel. Es wird gleich regnen. Sehen Sie,<br />
Giuseppe schafft alles an Bord. Ich muss zwar noch einige<br />
Besorgungen machen, doch solange können Sie im Wagen<br />
warten.«<br />
Der Wellengang verstärkte sich, die Gischt spritzte über die<br />
Kaimauer.<br />
Auch die anderen Fischer brachten ihre Waren in Sicherheit und<br />
der zuvor dicht belaufene Kai lag bald wie leergefegt da. Man<br />
kannte hier die Vorzeichen des Wetters nur zu gut. Sobald der<br />
Wind über das Meer hereinpeitschte, war es besser, Schutz zu<br />
suchen.<br />
Ronald überlegte gar nicht erst, schob Karl zur Beifahrertür und<br />
ließ sich selbst auf die Rückbank fallen, was in Anbetracht<br />
dessen, dass die Parkplätze neben Maries Wagen bereits leer<br />
waren, nicht mehr so schwierig war. Fischgeruch wölkte im<br />
Lieferwagen.<br />
Ronald gingen bereits wieder sehr praktische Gedanken durch<br />
den Kopf: Diese Frau sprach perfekt italienisch, schien gut mit<br />
den Menschen hier auszukommen und Karl hatte ganz<br />
offensichtlich eine Schwäche für sie. Marie würde sich also<br />
wunderbar als Sprachmittlerin zwischen ihm und den<br />
50
Neapolitanern und vielleicht sogar als heimliche Geliebte Angelo<br />
Cortesas eignen, der rechten Hand des Padrone. Es hieß nur<br />
abwarten, bis sich die geeignete Gelegenheit ergab, ihr dies<br />
schmackhaft zu machen.<br />
Der Regen prasselte auf die Windschutzscheibe; die Scheibenwischer<br />
waren schon auf die schnellste Geschwindigkeit gestellt,<br />
um einigermaßen freie Sicht zu gewähren.<br />
Marie konzentrierte sich auf den Straßenverkehr und achtete<br />
nicht auf ihren Beifahrer. Sie hatte Francine angerufen, die<br />
sowohl die Bluse für sie, als auch für sich selbst einige Dinge<br />
erstanden hatte. Die Anzüge des Lords aus der gleich neben der<br />
Galleria liegenden Reinigung hatte sie bereits abgeholt. Der Gang<br />
zum mercato musste verschoben werden. Bei diesem Wetter<br />
waren die Markstände mit Sicherheit bereits geschlossen. Fehlten<br />
nur noch die Zigarillos für Frederic.<br />
Die Französin staunte nicht schlecht, als sie bemerkte, wen Marie<br />
aufgelesen hatte. Sie schlüpfte hochbeglückt rasch auf den Platz<br />
hinter Marie, neben Ronald Graham.<br />
»Wir bringen die Herren ins Hotel«, erklärte Marie. »Ehe der Bus<br />
kommt, sind die beiden bis auf die Knochen durchgeweicht.«<br />
»Ischt gut, ischt gar keine Problem.« Francine blinzelte Ronald zu.<br />
Vielleicht wurde der Regisseur auf sie aufmerksam und entdeckte<br />
sie! Eine Rolle beim Film – das klang wie Himmel auf Erden. »In<br />
welsche 'otel wohnen Sie?«, fragte sie neugierig.<br />
»Im Rex schönes Kind«, Ronald lächelte galant. Wenn er wollte,<br />
konnte er!<br />
51
Barbara Siwik<br />
52
Barbara Siwik<br />
Jahrgang 1939, geboren in Liegnitz, arbeitete nach dem Abitur zwecks<br />
›politischer Umerziehung‹, ein Jahr in einem volkseigenen Bau-Betrieb<br />
der ehemaligen DDR. Sie wollte Germanistik studieren, erhielt jedoch<br />
aus politischen Gründen keinen Studienplatz, deshalb absolvierte sie<br />
illegal ein sozialpädagogisches Fachschulstudium in West-Berlin.<br />
Drei Jahre war sie als Erzieherin nacheinander in einem Kinderheim in<br />
Calbe/Saale, einem Kindergarten in Halle/Saale und zuletzt in der freien<br />
religiösen Kinderbetreuung im Dekanat Torgau tätig.<br />
Nach der Heirat und der Geburt ihrer drei Töchter nahm sie ein<br />
vierjähriges Fernstudium an der Fachschule für Bibliothekare in Leipzig<br />
auf. Es folgte eine langjährige Tätigkeit als Dipl. Bibliothekarin in der<br />
Stadtbibliothek Merseburg, die sie von 1991 bis zu ihrem Ruhestand<br />
auch leitete.<br />
Die Autorin ist in zahlreichen Anthologien mit Gedichten, Märchen<br />
und Erzählungen vertreten.<br />
2008 gab der Schmöker-Verlag Garbsen das Lyrikbändchen »Highmatt-Land<br />
– satirische Gedichte« heraus, das auf Initiative des<br />
Schriftstellerkollegen Wolfgang Reuter entstand.<br />
2010 erschien im Fhl-Verlag Leipzig der Fantasy-Roman »Das Erbe des<br />
Casparius«, der 2015 im Sarturia-Verlag Unterensingen neu verlegt<br />
wurde. Noch im selben Jahr gab der Verlag die Roman-Fortsetzung<br />
»Das Buch der magischen Sprüche« heraus.<br />
Bunte Märchenbilder zaubert die Autorin in ihrem Buch »Die<br />
Märchenweberin«, das 2016 im Karina-Verlag Wien erschien. Im<br />
Oktober 2017 folgten das Fantasy-Jugendbuch »Der Schatz aus der<br />
Truhe« und im Februar 2018 die paranormalen Geschichten für<br />
Jugendliche und Erwachsene »Das nicht Greifbare«.<br />
Barbara Siwik lebt in Braunsbedra bei Merseburg. Sie ist Mitglied des<br />
Verbandes deutscher Schriftsteller Sachsen-Anhalt.<br />
Webseite: https://barbarasiwik.wixsite.com/wortkunst<br />
53
54
Der Mord an einer jungen Schauspielerin lässt weder ein Motiv<br />
noch einen Täter erkennen. Mit Sicherheit steht nur fest, dass die<br />
›Mordwaffe‹ sich ›Aqua Tofana‹ nennt – das bevorzugte Gift der<br />
Mörderinnen früher Jahrhunderte.<br />
Ein seit Jahren Verschollener scheint in diesem Fall eine wichtige<br />
Rolle zu spielen und so weiten sich die Ermittlungen bis in die<br />
USA aus.<br />
Als der Fall bereits ›kalt‹ zu werden beginnt, ergibt sich<br />
unerwartet eine Aufklärung des Verbrechens, die dem leitenden<br />
Ermittler buchstäblich auf den Schreibtisch flattert: Eine<br />
Anwaltskanzlei in Bologna schickt ihm im Auftrag eines<br />
Detektivs Notizen, die den Mord in völlig unvermutetem Licht<br />
erscheinen lassen …<br />
ISBN 978-3-966618-45-8 EUR 12,90<br />
<br />
55
56
Aqua Tofana<br />
Schlüsselszene<br />
Der Zuschauerraum des ›Frankfurter Schauspielhauses‹ war bis auf<br />
den letzten Platz gefüllt. Man gab Goethes ›Faust‹. Die Kerker-<br />
Szene näherte sich dem Höhepunkt und das Spiel damit auch<br />
dem Ende der Tragödie.<br />
Die Gretchendarstellerin Eliza Burger war eine bemerkenswerte<br />
Schauspielerin und die Vorstellung nicht zuletzt deshalb<br />
ausverkauft. Gleiches Interesse brachte das Publikum auch dem<br />
Faust-Darsteller entgegen, der sie soeben beschwor: »Besinne dich!<br />
Nur einen Schritt, so bist du frei!«<br />
Mephisto drohte ungeduldig, Faust zu verlassen, sofern dieser<br />
ihm nicht endlich folge. Dessen Blick aber war auf Gretchen<br />
gerichtet, die ihn wie einen Geist anstarrte. In ihren Augen lag<br />
blankes Entsetzen, als sie in höchster Not aufschrie: »Dein bin ich<br />
Vater … rette mich … ihr Engel … ihr heiligen Scharen ... lagert euch<br />
umher ... mich zu bewahren.«<br />
Röchelnd presste die Darstellerin mit letzter Kraft aus sich<br />
heraus: »Heinrich, mir graut’s vor dir!«<br />
Manchem Zuschauer lief bei diesem Szenario ein Schauer über<br />
den Rücken.<br />
Im grauen Büßerhemd, das Haar aufgelöst, sank Gretchen aufs<br />
Strohlager. Es schien, als wolle Faust zu ihr hineilen, aber<br />
Mephisto zerrte ihn mit sich.<br />
Langsam senkte sich der Vorhang, doch vergeblich wartete das<br />
textkundige Publikum auf den letzten, verzweifelten Ruf<br />
Gretchens: ›Heinrich … Heinrich …‹<br />
Nach einem Augenblick atemloser Stille brandete Beifall auf. Die<br />
Schauspieler erschienen jedoch nicht vor dem Vorhang, um den<br />
57
Applaus dankend entgegenzunehmen. Ungeduldig skandierte das<br />
Publikum schließlich: »Gret-chen, Gret-chen, Gret-chen ...«<br />
Endlich ließen sich Mephisto und Faust mit Frau Marthe sehen.<br />
Sie verbeugten sich mit einstudiertem Lächeln. Das Publikum<br />
applaudierte, wurde unruhig und skandierte erneut: »Gret-chen,<br />
Gret-chen ...«<br />
»Wir müssen's ihnen sagen«, zischte der Faustdarsteller Gert<br />
Becker, während er sich automatisch verbeugte. Sein Kollege Rolf<br />
Tender bejahte dies und schickte zugleich ein arrogantes<br />
Mephisto-Lächeln in die tobende Menge. Entschlossen trat<br />
Becker zwei Schritte vor und hob die Hand. Der Tumult<br />
verebbte. Seine Stimme klang angestrengt, als er informierte:<br />
»Verehrtes Publikum! Diese Begeisterung ehrt Eliza Burger sehr.<br />
Leider kann sie den Beifall nicht persönlich entgegennehmen. Sie<br />
erlitt einen Schwächeanfall.«<br />
Ausrufe des Bedauerns wurden laut, Blumen für die Schauspielerin<br />
auf die Bühne gereicht. Eliza Burger würde sie nie in<br />
Empfang nehmen – sie war tot.<br />
*<br />
Die Zeiger der Uhr standen auf Mitternacht. Erregt schritt der<br />
Direktor des ›Frankfurter Schauspielhauses‹ im Büro auf und ab. Auf<br />
seiner Stirn standen Schweißperlen. Er sprach mit sich selbst. Das<br />
tat er stets, wenn ihn etwas überforderte. Und was heute Abend<br />
geschehen war, reichte weit über seine Vorstellungskraft hinaus.<br />
»So ein Unglück«, murmelte er zum wiederholten Mal. »Eine<br />
Katastrophe. Nicht zu fassen.« Schließlich sank er doch in den<br />
Schreibtischsessel und starrte auf die leere Tischplatte.<br />
Wie ein Film liefen die Ereignisse des Abends vor seinem inneren<br />
Auge ab : Gegen zweiundzwanzig Uhr näherte sich die<br />
Vorstellung dem Ende. Wie üblich war er zur letzten Szene hinter<br />
den Kulissen erschienen. Dort standen zwei Techniker und die<br />
58
Nebendarsteller. Wenige Meter vor ihnen gebärdete sich die<br />
Burger auf der Bühne, als werde sie wirklich von Furien gejagt.<br />
Auch ihn hatte ein Schauer erfasst, als sie die Himmelsgeister<br />
anrief, als sie ganz zuletzt … nein, da spielte ihm die Textkenntnis<br />
einen Streich, wie man ihm versichert hatte. Im Unterschied zu<br />
den anderen glaubte er nämlich, den Nachruf ›Heinrich! Heinrich!‹<br />
gehört zu haben. Tatsächlich aber war dies nicht geschehen.<br />
Jedenfalls – nach Beckers und Tenders Abgang und dem Fallen<br />
des Vorhangs hätte auch Eliza auftauchen müssen, aber sie kam<br />
nicht. Becker war deshalb noch einmal auf die Bühne<br />
zurückgekehrt und bald darauf mit entsetztem Gesichtsausdruck<br />
erschienen, die offenbar Ohnmächtige auf den Armen. ›Ich weiß<br />
nicht, was passiert ist‹, hatte er gesagt und die schlaffe Last in die<br />
helfend ausgestreckten Arme der beiden Techniker gleiten lassen.<br />
Dann war er mit Tender und den anderen Darstellern vor den<br />
Vorhang geeilt, um den Applaus des Publikums entgegenzunehmen.<br />
So war es nun mal im Theater – die show musste<br />
laufen, selbst wenn die Welt einstürzte, was ja der Wahrheit in<br />
diesem Fall ziemlich nahe gekommen war, wie sich herausstellte.<br />
Während Becker das Publikum informierte, hatten die Techniker<br />
die Schauspielerin in den Aufenthaltsraum getragen und er hatte<br />
per Handy seinen Hausarzt angerufen, der in der Nähe wohnte.<br />
Der war auch in kürzester Zeit erschienen und stellte fest, was<br />
alle inzwischen ahnten – Eliza lebte nicht mehr.<br />
›Die Polizei muss her‹ hatte der Arzt gesagt und jemand – ja, wer<br />
eigentlich? – hatte im Präsidium angerufen. Zu diesem Zeitpunkt<br />
war ihm bereits alles über den Kopf gewachsen.<br />
Das Publikum ahnte von den Vorgängen hinter der Bühne zum<br />
Glück nichts und verließ das Theater wie stets in Gelassenheit.<br />
Die Polizei dagegen befand sich immer noch im Gebäude.<br />
Warum zum Teufel? Weil die Burger zu jung war, um ›einfach so‹<br />
59
zu sterben? Es traf doch oft noch jüngere Leute, ohne dass<br />
deshalb eine Untersuchung von Amts wegen stattfand ...<br />
Und an dieser Stelle fiel dem Direktor ein, dass es auch noch ein<br />
›morgen‹ und ›übermorgen‹ für das Schauspielhaus gab, an dem<br />
›Faust‹ aufgeführt werden musste – und zwar in veränderter<br />
Gretchenbesetzung. Das bedurfte einiger Arrangements und war<br />
etwas, woran er sich festhalten konnte, etwas, worauf er sich<br />
verstand. Trotz später Stunde griff der Direktor zum Telefon ...<br />
Am anderen Ende der Leitung meldete sich niemand.<br />
»Auch das noch!«, stöhnte er. Aber man konnte der Larivière<br />
schließlich nicht vorschreiben, wo sie sich nachts aufzuhalten<br />
hatte. Dabei war sie ihm doch vor zwei Stunden geradezu in die<br />
Arme gelaufen.<br />
60
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich in jener<br />
Grauzone bewegen, von der sich kaum ein Zeitgenosse sicher ist,<br />
ob er sie akzeptieren oder ignorieren soll – Heimsuchungen<br />
durch das personifizierte Böse, Kontakte mit Geistern, die<br />
lebensecht wirken, Zeit- und Raumveränderungen, in die er<br />
hineingerät, magische Kräfte, die sein Tun beeinflussen.<br />
Vordergründig ist er stolz auf seinen nüchternen Verstand.<br />
Warum wünscht er sich dann insgeheim, einen Blick hinter all<br />
jene Dinge werfen zu können, die es eigentlich gar nicht gibt?<br />
Die vorliegenden Geschichten – mögen sie nun möglich oder<br />
unmöglich, ernst oder heiter sein – sind aus dem Bestreben<br />
heraus entstanden, der Vorstellung von einem magischphantastischen<br />
Weltbild, die so manchen Menschen im<br />
Verborgenen begleitet, Nahrung zu geben.<br />
ISBN 978-3-961116-72-0 EUR 13,90<br />
61
62
Grüne Kreide ist nicht immer das, wonach sie aussieht, vor allem<br />
dann nicht, wenn sie sich unversehens in Nebel auflöst.<br />
Vier Jugendliche erleben durch sie wundersame Dinge. Sie stellen<br />
fest, dass auch Märchen ihren normalen Alltag besitzen, reisen<br />
rückwärts in die Zeit und machen die Erfahrung, dass so manche<br />
Überlieferung fragwürdig ist.<br />
Eins allerdings bleibt wahr – in jeder Legende steckt ein<br />
Körnchen Wahrheit. Langweilig sind dagegen Reisen in die<br />
Zukunft, denn worauf sollte man noch gespannt sein, wenn man<br />
schon alles weiß?<br />
Gelegentlich jedoch sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft<br />
so dicht ineinander verwoben, dass selbst ein wacher Verstand<br />
den Durchblick verliert.<br />
ISBN 978-3-961116-59-1 EUR 13,90 <br />
63
64
Der Schatz aus der Truhe<br />
Jugendliteratur Fantasy<br />
An diesem Nachmittag betrat Janus zum ersten Mal den<br />
Dachboden.<br />
„Du lieber Himmel, der ist ja voller Gerümpel“, staunte er und<br />
deutete dann auf die kleine Tür an der Wand. „Ist sie das?<br />
Dahinter fällt man doch direkt nach draußen.“<br />
„Falsch! Dahinter liegt eine unbekannte, magische Welt“,<br />
berichtigte Ulla. „Es kommt nur darauf an, das Richtige auf die<br />
Tür zu schreiben.“<br />
Tori drückte vorsichtig die Klinke nieder.<br />
Ulla griente. „So einfach geht’s nicht.“ Sie holte die Kreide und<br />
den Schlüssel aus der Truhe und blickte den Bruder auffordernd<br />
an.<br />
Janus rief: „Worauf wartest du? Ich will den mittelalterlichen<br />
Markt in Hamburg auch sehen, von dem du mir erzählt hast.“<br />
Ben schüttelte den Kopf. „Kein Markt. Wie wär’s mit der<br />
Wackerburg? Ich meine, in einer Zeit, als dort die Raubritter ihr<br />
Unwesen trieben. Wisst ihr noch, wie enttäuscht wir waren, weil<br />
die im Dorf nicht mal etwas über die Wacker-Brüder wussten?“<br />
Janus war mit diesem Ziel sofort einverstanden, nur Tori<br />
erkundigte sich beklommen: „Können die uns sehen?“<br />
Ulla nickte. „Ja. Es ist, als seien wir Menschen aus dieser Zeit.“<br />
Das gefiel Tori nicht sehr; unsichtbar bleiben wäre ihr lieber<br />
gewesen.<br />
„Wann haben die Wacker-Brüder denn gelebt?“, wollte Janus<br />
wissen.<br />
65
„Die Burg ist im Jahr 1590 abgebrannt“, sagte Ulla. „Ich hab’s<br />
neulich erst in einem Sagenbuch nachgelesen. Darin ist auch von<br />
dem Schatz die Rede, der dort noch liegen soll.“<br />
Sie setzte die Kreide an und schrieb WACKERBURG VOR<br />
DEM BRAND 1590. Während sie die Jahreszahl auf das<br />
Türchen setzte, murmelte sie das Sprüchlein. Es waberte grün<br />
und dann war die Schrift verschwunden. Ulla steckte den<br />
Schlüssel ins Schloss und ließ Tori öffnen. Mit vor Aufregung<br />
zitternder Hand kam die Freundin der Aufforderung nach. Aus<br />
der Öffnung gähnte ihnen Dunkelheit entgegen.<br />
„Wir sind im Verlies gelandet“, vermutete Janus. „Was machen<br />
wir ohne Licht?“<br />
„Ich hole Kerzen.“ Ben sauste die Bodentreppe hinunter in die<br />
Küche. Er hatte Glück – Lisa war nicht da, also musste er sich<br />
keine Ausrede einfallen lassen. Er wusste, wo Kerzen und<br />
Streichhölzer aufbewahrt wurden. Null Komma nichts war er<br />
wieder bei den anderen.<br />
Während seiner Abwesenheit hatte Ulla einige Rollen Schnur aus<br />
dem alten Schrank gekramt, die ihr schon beim ersten<br />
Bodenbesuch ins Auge gefallen<br />
waren. „Kellergänge sind ja was Ähnliches wie ein Labyrinth“,<br />
erklärte sie. „Nicht, dass wir uns auf dem Rückweg verirren.“<br />
Ben zündete drei Kerzen an und drückte je eine Tori und Janus in<br />
die Hand. „Ich gehe mit Ulla voraus“, bestimmte er.<br />
Ulla band die Schnur an der Innenklinke des Türchens fest und<br />
Ben leuchtete ihr beim Laufen. Janus und Tori folgten. Selbst bei<br />
Kerzenlicht war es in dem engen, muffig riechenden Gang<br />
ziemlich duster. Die erste Rolle war bald aufgebraucht und Ulla<br />
knüpfte eine weitere Schnur an. Einige Male gelangten sie an<br />
Abzweigungen, entschieden sich jedoch, im Hauptgang zu<br />
66
leiben. Auch die dritte Schnurrolle kam noch zum Einsatz, denn<br />
die finstere Röhre führte um einige Ecken.<br />
Endlich wurde es vor ihnen ein wenig heller und dann standen<br />
die vier am Fuß einer schmalen, ausgetretenen steinernen Treppe.<br />
Oberhalb erkannten sie Fackelschein.<br />
„Vorsicht!“, warnte Ulla leise. „Wo Licht ist, sind Menschen.“<br />
Über die Treppe gelangten sie in die Eingangshalle der Burg.<br />
Dort roch es nach verbranntem Pech, Braten und Klosett.<br />
„Igitt!“, flüsterte Tori und hielt sich die Nase zu.<br />
Laute Stimmen drangen an ihr Ohr, obgleich in der Halle kein<br />
Mensch zu sehen war. Also kamen sie wohl aus der Etage<br />
darüber. Ulla band das Schnurende an einen der rostigen Haken,<br />
die massenweise aus der Wand ragten. Die anderen löschten die<br />
Kerzen und legten sie auf<br />
den Stufen ab. Mit Herzklopfen schlichen alle im Gänsemarsch<br />
erst durch die Halle und dann über eine schmale Treppe ohne<br />
Geländer, die an der Wand entlang führte, nach oben. Dort tat<br />
sich eine ähnliche Halle auf wie unten, ebenfalls von Fackeln<br />
erhellt, die schrecklich qualmten und den<br />
Raum mit grauem, stinkenden Nebel füllten. An einem klobigen<br />
Tisch in der Mitte des Raumes hockten auf klobigen Schemeln<br />
drei vor Schmutz starrende, wüste Gesellen. Einer davon schien<br />
besonders groß und stark zu sein.<br />
„Die Wacker-Brüder“, flüsterte Ben Janus zu.<br />
Entlang der Wand, nahe der Treppe, zog sich eine breite,<br />
hochbeinige massive Holzbank hin. Sie lag in tiefem Schatten und<br />
bot den vier Eindringlingen<br />
genügend Platz, um darunterzukriechen. Die Männer am Tisch<br />
achteten nicht auf ihre Umgebung. Sie waren ziemlich betrunken<br />
und stritten heftig. Was sie sich an den Kopf warfen, war nicht zu<br />
verstehen, aber es klang drohend. Zwei ebenso schmutzige,<br />
67
heruntergekommene Gestalten stolperten von der anderen Seite<br />
des Saales herein und brachten zwei Weinkrüge. Einer schenkte<br />
dem Riesen ein, der andere dessen Brüdern, die johlend tranken<br />
und sich nachschenken ließen.<br />
Auf der Tischplatte blinkte und funkelte Gold und Silberzeug.<br />
„Beute! Und sie streiten darum“, wisperte Ulla.<br />
Der Riese erhob sich taumelnd – Himmel war das ein Ungetüm!<br />
Krachend fiel der Schemel um. Auch seine Brüder versuchten, in<br />
die Höhe zu kommen, aber stattdessen fielen sie wie nasse Säcke<br />
von ihren Sitzen herunter. Die Knechte luden sich die Säufer<br />
schweigend auf die Schultern und schleppten sie weg. Der Riese<br />
aber lachte dröhnend und schadenfroh, griff einen Ledersack von<br />
den Dielen auf und schob das funkelnde Zeug hinein, das auf<br />
dem Tisch lag. Es klimperte und klirrte. Dann schulterte er den<br />
Sack und trampelte mit unsicherem Schritt an der Bank vorüber<br />
die Treppe hinunter in die Halle.<br />
„Ein Wunder, dass der die Stufen findet“, flüsterte Janus.<br />
„Der ist ans Saufen und an die Treppe gewöhnt“, vermutete Ben.<br />
„Was ist?“, wisperte Ulla. „Schleichen wir ihm hinterher?“<br />
Doch Tori wollte das Versteck unter der Bank auf keinen Fall<br />
verlassen und Janus entschied: „Entweder alle oder keiner.“<br />
Die Entscheidung erwies sich als richtig, denn der Unhold – ganz<br />
gewiss der Gero der Legende – kam zurück. Er grölte etwas<br />
Unverständliches und wiederum erschienen die Knechte. Gero<br />
öffnete eine Truhe an der gegenüberliegenden Wand und<br />
entnahm ihr drei weitere prall gefüllte Ledersäcke. Er und die<br />
beiden zwielichtigen Gestalten luden sie sich auf die Schultern<br />
und stapften die Treppe hinunter.<br />
„Himmel!“, flüsterte Ulla. „Das ist der Schatz. Gero bringt ihn in<br />
Sicherheit. Ich will sehen, wohin.“ Die vier krochen nun doch<br />
unter der Bank hervor und schlichen in die Halle hinunter. Sie<br />
68
war leer, aber das Portal zum Burghof stand offen. Draußen war<br />
Nacht, doch im Schein der Fackeln, die auch dort brannten,<br />
erkannten sie einen Karren und zwei eingespannte Pferde. Ein<br />
drittes Pferd<br />
stand aufgezäumt bereit. Gero von der Wacker gestikulierte mit<br />
den Knechten und kam dann allein auf das Portal zu. Eilig<br />
wichen die vier zurück und drückten sich in eine dunkle Nische<br />
zwischen der Wand und einem großen Schrank.<br />
Der Riese verteilte an vielen Stellen der Halle Pech, das er mit<br />
einer Holzkelle aus einem Bottich schöpfte. Auch der Schrank<br />
bekam davon eine Ladung ab, doch in die Nische schaute der<br />
Raubritter nicht. Aus bereitstehenden Säcken verstreute er<br />
gehäckseltes Stroh und stapfte dann in den Saal hinauf. Die vier<br />
folgten in sicherem Abstand und – auf den Stufen hockend –<br />
sahen sie ihn den Raum in gleicher Weise für einen Brand<br />
vorbereiten. Schemel, Tisch, Truhe und Bank wurden reichlich<br />
mit Pech bekleckst.<br />
„Gut, dass wir dort weg sind!“, hauchte Tori.<br />
Schließlich verließ Gero den Saal in der Richtung, aus der anfangs<br />
die Knechte gekommen waren. Auch Janus und Ben setzten sich<br />
in Bewegung, in der Absicht, den Riesen weiter zu beobachten.<br />
„Ich geh da nicht mit“, flüsterte Tori. „Ist mir zu gefährlich.<br />
Wenn wir uns in der Burg verlaufen …“<br />
Ulla gab ihr recht, aber die Jungen winkten ab. „Wir packen das!<br />
Verzieht euch in den Keller!“ Schon liefen sie quer durch den<br />
Saal. Die Mädchen schlichen wieder treppab, dicht an die Wand<br />
gedrückt, und quer durch die Halle zur Kellertreppe. Dort<br />
hockten sie sich auf die kalten, schmutzigen Stufen.<br />
„Nach der Legende setzt Gero von der Wacker jetzt die Kammer<br />
seiner Brüder in Brand. Nur passiert es nicht aus Unachtsamkeit,<br />
69
wie die Legende berichtet, er hat’s von vorn herein geplant“,<br />
flüsterte Tori.<br />
„Von wegen Dämon!“, pflichtete Ulla bei. „Mit so viel Pech<br />
bekleckert, brennt alles im Nu. Und mit dem Schatz haut der Kerl<br />
ab. Hast du ja gesehen.“<br />
„Aber es heißt, die drei Brüder seien gemeinsam …“<br />
„Mensch, Tori! Drei Männer sind den Flammen entkommen. Die<br />
Leute dachten, es seien die drei Brüder. Aber zwei von ihnen<br />
waren ja abgefüllt bis oben hin. Wie sollten die sich aufrappeln?<br />
Nee, nee! Der Kerl lässt sie brutzeln und murkst sicher später<br />
auch die Knechte noch ab. Deshalb hat nie wieder jemand was<br />
von den Wacker-Brüdern gehört.“<br />
Nach einer Zeit, die den Mädchen wie einen Ewigkeit vorkam,<br />
hörten sie es im oberen Saal rumoren und zischen, dann<br />
polterten schwere Tritte die Treppe herunter. Vorsichtig reckten<br />
Ulla und Tori die Hälse …<br />
Der Riese stürzte den Pechkübel in der Halle um, rannte von<br />
Fackel zu Fackel, riss sie aus den Halterungen und warf sie auf<br />
Stroh und Pech. Im Handumdrehen fing alles Feuer und der<br />
Brandstifter preschte aus der Halle. Sie hörten ihn etwas schreien,<br />
das wie ein Befehl klang, ein Pferd wieherte und dann knarrten<br />
Räder …<br />
Nun war nur noch das Knistern der Flammen zu vernehmen.<br />
„Der ist weg“, murmelte Ulla. „Die Burg gehört uns.“<br />
„Mir ist nicht nach Lachen“, jammerte Tori. „Wo bleiben die<br />
Kerle?“ Gerade da sprangen zwei Gestalten durchs Feuer und<br />
fielen mehr als dass sie rannten die Kellertreppe hinunter.<br />
„Weg von hier“, keuchte Janus.<br />
„Immer schön langsam“, bremste Ulla. „Wenn überhaupt, brennt<br />
es hier unten zuletzt.“<br />
70
„Aber wenn sich der Rauch hier sammelt, ersticken wir“, keuchte<br />
Ben und<br />
versuchte mit zitternder Hand, ein Streichholz zu entzünden. Es<br />
flackerte und erlosch. Mit einem zweiten und dritten erging es<br />
ihm ebenso.<br />
„Geht schon los“, knurrte er. „Die Kerzen können wir uns<br />
knicken.“<br />
Über ihnen rauschte hörbar das Feuer. Eilig hangelten sich die<br />
vier in der Finsternis an der Schnur zurück, erreichten glücklich<br />
das Türchen und Ben – als Letzter in der Reihe – drückte es<br />
aufatmend hinter sich zu.<br />
„Bin ich froh, wieder auf dem Dachboden zu sein“, gestand Tori<br />
und ließ sich auf einen alten Sessel fallen.<br />
71
72
Der Lebensweg eines Menschen ist nicht vorhersehbar, denn<br />
nicht er selbst ist seines Glückes Schmied ─ die Zeit schwingt<br />
blind den Hammer. Sie fügt auch in diesem Roman zwei Familien<br />
zusammen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Die<br />
Wurzeln der einen Familie reichen bis ins 13. Jahrhundert zu<br />
einer Burg zurück, die der anderen krallen sich um Bedeutungslosigkeit.<br />
Doch auf dem unwegsamen Pfad der Zeit schlägt der<br />
Hammer des Schicksals auf die eine wie die andere emotionslos<br />
ein. Er formt und er zertrümmert Schlag um Schlag familiäres<br />
Glück auf dem Amboss der Weltgeschichte durch Krieg, Tod<br />
und Vertreibung. Nie wieder wird die Zeit Teile eines ehemals<br />
Ganzen in alter Weise zusammenfügen, nie wird sie letzte<br />
Klarheiten schaffen über den Verbleib eines Verschollenen.<br />
Tatsache ist am Ende nur, dass sie bereits neue Eisen im Feuer<br />
liegen hat, um sie zu bearbeiten, dass nichts endet, sich vieles nur<br />
ändert …<br />
ISBN 978-3-961119-25-7 EUR 29,90<br />
73
74
Der unwegsame Pfad der Zeit<br />
Zeitgeschichtlicher Familienroman<br />
(Juni 1945 in Niederschlesien))<br />
Das Liegnitz, das sie verlassen hatten, gab es nicht mehr. Auf<br />
dem Ring lag so viel Papier wie im Winter Schnee auf den<br />
Uferwiesen der Katzbach. Wer auch immer so gewütet hatte – er<br />
schien alle Akten, die im Rathaus aufzufinden waren, auf dem<br />
Platz verstreut zu haben. Viele Gebäude in der Frauenstraße<br />
waren ausgebrannt. Es sah aber nicht nach einem Bombenangriff<br />
aus, eher nach Brandstiftung. Die Inneneinrichtung der Häuser<br />
lag zumeist zertrümmert als Müll auf der Straße. Der Geruch<br />
nach Brand und Verwesung schlug ihnen überall entgegen. Nur<br />
vereinzelt waren Menschen zu sehen, die auftauchten wie<br />
Gespenster und eilig wieder verschwanden.<br />
Endlich standen sie auf der Nepomukbrücke und spähten mit<br />
bangem Blick voraus: Ja, das Häuschen von Weigts stand noch.<br />
Unter dem Glockengeläut der Dreifaltigkeitskirche zogen die<br />
Heimkehrer durch die Gerichtstraße. Die Haustür des kleinen<br />
Gebäudes stand offen. Im Treppenhaus lag das Eigentum der<br />
Weigts und der Pohls umher. Es stank bestialisch, als befänden sie<br />
sich in einer Kloake. Letztendlich sollte sich das bewahrheiten.<br />
Die alte Frau Weigt hatte ihre Wohnung wohl doch verlassen, ehe<br />
die Russen einrückten. Wo mochte sie untergekommen sein? In<br />
dem verwüsteten Haus schien sich dennoch jemand aufzuhalten,<br />
denn die Treppe war freigeräumt. Die Wohnungstüren im<br />
Obergeschoss standen sperrangelweit offen, die Tür des<br />
separaten Mittelzimmers dagegen war abgeschlossen.<br />
Beklommen nahm Trudl ihre Wohnung in Augenschein: Überall<br />
lagen Wäsche, Kleidung, Bücher, zerbrochenes Geschirr und<br />
75
Mobiliar herum. Sämtliche Federbetten waren aufgeschlitzt<br />
worden. Die Federn bedeckten den Fußboden, vielfach vermischt<br />
mit Urin und Scheiße. Der bestialische Gestank machte das<br />
Atmen schwer. Es gab kaum eine größere Fläche, auf der sich<br />
kein Haufen befand. Was, um Himmels willen, waren das für<br />
Menschen, die sich hier ausgetobt hatten?<br />
Sie setzte Monika auf dem Wohnzimmertisch ab – eine von<br />
Fäkalien freie Fläche – stieg in ungläubigem Entsetzen zwischen<br />
dem Unrat umher und entdeckte, dass da auch Dinge<br />
herumlagen, die nicht ihr gehörten.<br />
Bei ihnen sähe es nicht besser aus, erfuhr sie von Käthe, die die<br />
Schaukel der Kinder ablieferte, Fremdgut gewissermaßen. Trudls<br />
Vater hatte am letzten Weihnachtsfest als Geschenk für die Enkel<br />
zwei Haken in das obere Futter der Schlafzimmertür eingedreht<br />
und eine Gitterschaukel daran aufgehängt. Bei geöffneter Tür ließ<br />
es sich zwischen Wohn- und Schlafraum nun so gut schaukeln<br />
wie im Sonnenland neben der Laube. Die Kinder hatten sich<br />
jedoch nur kurze Zeit an dem Geschenk erfreuen können, denn<br />
im Februar waren sie ja aus Liegnitz geflohen.<br />
Aus der Wasserleitung im Hausflur lief nur ein dünner Strahl. Ein<br />
Wunder, dass es überhaupt Wasser gab. Trudl schrubbte die<br />
Schaukel sauber, so gut es möglich war, hängte sie auf und setzte<br />
Moni hinein. Die Kleine war nun erst einmal beschäftigt. Eins der<br />
beiden Kinderstühlchen befand sich in noch brauchbarem<br />
Zustand. Darin saß Bärbel in der Nähe der Schlafzimmertür und<br />
schaute Moni beim Schaukeln zu.<br />
Trudl reinigte die Couch. Offenbar hatte die als Gelegenheit für<br />
gewisse Dienste gedient. Sie war mit typischen Flecken übersät,<br />
aber wenigstens nicht beschissen! Vorerst würden die Kinder<br />
leider auf dieser Couch schlafen müssen, denn für die<br />
Kinderbetten gab es weder Kissen noch Zudecken. Wenn sie es<br />
76
geschickt anstellte, rettete sie vielleicht noch Federn für ein<br />
dünnes Deckbett. Nähzeug war vorhanden, dafür hatte sich<br />
keiner interessiert.<br />
Bärbel hielt es nicht mehr auf dem Stühlchen, sie wollte<br />
unbedingt das Märchenbuch suchen. Trudl warnte: „Pass auf,<br />
wohin du trittst!”<br />
Das Kind balancierte um die Haufen und die schaukelnde Moni<br />
herum bis zum Kachelofen im Schlafzimmer. Dort schrie es<br />
wütend auf ...<br />
So schnell wie möglich versuchte Trudl ins Schlafzimmer zu<br />
gelangen, rutschte auf einem Haufen aus und bekam glücklicherweise<br />
die Schaukel zu fassen. Die Seile hielten! Moni lachte<br />
fröhlich, weil sie glaubte, das sei ein Spiel.<br />
Dann stand Trudl im Schlafzimmer und erkannte die Ursache für<br />
Bärbels Wutgeschrei: Das Märchenbuch lag in fast aufgelöstem<br />
Zustand auf dem Boden. Die Blätter waren herausgerissen und<br />
als Klopapier benutzt worden. Auf dem abgetrennten Buchdeckel<br />
machte sich ein eingetrockneter Scheißhaufen breit und ringsherum<br />
war es einmal sehr nass gewesen.<br />
„Ich hasse sie! Ich hasse sie!”, schluchzte Bärbel. Sie hatte Helmut<br />
Pohl nicht verstanden, als er ihr erklärte, was Hass sei. Jetzt<br />
wusste sie, wie sich das anfühlte. Diese Gemeinheit hatten<br />
Ungeheuer wie das in Komotau begangen!<br />
„Mäusl! Hör auf zu weinen”, tröstete Trudl. „Du bekommst ein<br />
neues Buch. Es wird genauso aussehen wie das alte, denn davon<br />
gibt es nicht nur eins.” Ihr Blick irrte umher, fiel auf die<br />
Spiegeltoilette und da erkannte sie das Bambi-Buch,<br />
offensichtlich unbeschädigt. Sie stieg über einen Haufen Federn,<br />
griff danach und hielt es hoch. „Sieh mal! Bambi ist noch da!”<br />
Bärbel ließ sich beruhigen. Trudl half ihr zum Stühlchen zurück<br />
und machte sich wieder ans Aufräumen. Sie kam nur langsam<br />
77
voran. Bis zum Abend schaffte sie es jedoch noch, ein dünnes<br />
Federbett für die Kinder zurechtzustopfen. Die heil gebliebenen<br />
Sofakissen steckte sie in Bezüge, die sie noch im Schrank<br />
vorgefunden hatte. Für das Federbett fand sich nichts Passendes.<br />
Die Kinder hatten Hunger. Woher sollte Trudl etwas Essbares<br />
nehmen? Als habe sie etwas geahnt, brachte Käthe zwei Gläser<br />
Pflaumenkompott herüber. Martha Vogt war bald nach der<br />
Ankunft mit den Töchtern im Keller verschwunden und sie<br />
hatten nach oben getragen, was an eingeweckten Vorräten noch<br />
zu finden war.<br />
„Da unten ist es sauberer als hier oben”, berichtete Käthe. „Es<br />
sind schon welche vor uns im Keller gewesen, aber die kannten<br />
Frau Weigts Lager für schlechte Zeiten nicht. Die Vorräte sind<br />
jetzt drüben bei uns. Sie werden ein Weilchen reichen, wenn wir<br />
sparsam sind.” Und dann erzählte sie, dass sich im Mittelzimmer<br />
ganz eindeutig jemand aufhalte. „Vater vermutet, dass es Trieblich<br />
ist. Offenbar will er von uns nicht gesehen werden.”<br />
Die Kinder schliefen, eins zu Häupten eins zu Füßen, auf der<br />
Couch. Trudl verbrachte die Nacht in einem heil gebliebenen<br />
Sessel, bedeckt mit ihrem Wintermantel, den sie unter einem<br />
Haufen Federn gefunden hatte. Sobald es draußen hell wurde,<br />
war sie wieder auf den Beinen, räumte und säuberte weiter. In der<br />
Waschküche im Hof lief das Wasser besser als oben im Hausflur.<br />
Sie füllte eine Wanne und walkte die Wolldecken durch.<br />
Nach einigem Suchen fand sie eine Wäscheleine und Klammern.<br />
Der Tag versprach warm zu werden, also würden die Decken gut<br />
trocknen. Während sie aufhängte, läuteten auch an diesem<br />
zweiten Pfingstfeiertag die Glocken. Waren Pfarrer Smaczny und<br />
die Grauen Schwestern in Liegnitz geblieben? Gern wäre Trudl bis<br />
zur Kirche gelaufen, aber sie wagte sich nicht auf die Straße. Die<br />
Angst, noch einmal vergewaltigt zu werden, war zu groß. Bärbel<br />
78
und Moni spielten derweil auf der Couch mit den wiedergefundenen<br />
Puppen und einer Riesenmuschel. Trudl hatte sie<br />
beim Aufräumen unter den fremden Dingen entdeckt, sie Moni<br />
ans Ohr gehalten und ihr weisgemacht, darin sei das Rauschen<br />
des großen Wassers zu hören, das man Meer nannte.<br />
Moni hatte gelauscht und behauptet: „Nein, die Englein singen.”<br />
Bärbel begutachtet die Muschelgeräusche ebenfalls und erklärte<br />
altklug: „Dummchen! Das ist Rauschen, kein Singen.” In gewisser<br />
Hinsicht spürte man schon, dass die Große reif für die Schule<br />
war. Eigentlich hätte sie Ostern eingeschult werden sollen,<br />
stattdessen war sie im Februar in Dresden knapp dem Tod<br />
entgangen. Nun würde Bärbel wohl noch ein weiteres Jahr auf<br />
den herbeigesehnten ersten Schultag warten müssen.<br />
In der zweiten Nacht nach der Rückkehr schlief Trudl mit den<br />
Kindern im Ehebett. Die Wolldecken waren rechtzeitig trocken<br />
geworden.<br />
Einer der folgenden Tage bescherte Vogts und Trudl eine<br />
unangenehme Überraschung – das Haus erhielt Einquartierung.<br />
In den späten Morgenstunden ratterten zwei russische Armee-<br />
Autos auf den Hof. Die rauen Zurufe in fremder Sprache, die<br />
schlagenden Türen verhießen nichts Gutes. Trudl schlug das Herz<br />
bis zum Hals, als jemand an ihre Wohnungstür pochte. Noch ehe<br />
sie sich gefasst hatte, lief Bärbel in den Korridor und schob den<br />
Riegel zurück, den Vogt an der Tür anstelle des defekten<br />
Schlosses angebracht hatte. Draußen stand ein russischer Offizier.<br />
Er trat nicht ein, musterte das Kind nur freundlich und fragte<br />
Trudl in Deutsch, ob sie hier wohne. Als sie dies bejahte, erklärte<br />
er: „Wir besetzen Räume unten. Kommandantur! Dürfen bleiben,<br />
wenn wollen. Ich verspreche, keine Gefahr für Frau. Charaschò?”<br />
79
Trudl nickte beklommen. Der Offizier zeigte auf die Tür<br />
gegenüber. „Auch Leute?” Und als sie dies bejahte, klopfte er bei<br />
Vogts. Sie sah gerade noch, dass Martha Vogt öffnete, ehe sie die<br />
eigene Tür aufatmend schloss und den Riegel vorschob.<br />
Es wurde nun ziemlich laut im Haus. Zwei Soldaten räumten die<br />
Weigt-Wohnung leer und kehrten alles, was im Hausflur lag,<br />
durch die Hintertür in den Hof. Dort verbrannten sie den Unrat.<br />
Am Abend klopfte es erneut an der Tür. Diesmal war es eine<br />
Russin in Uniform, die ihnen Schwarzbrot und Tee brachte, den<br />
sie tschai nannte. „Fier Kindärr!”, erklärte sie.<br />
Trudl bedankte sich überrascht. Moni zupfte die fremde Frau an<br />
der Uniformbluse und die beugte sich zu ihr hinunter. Die Kleine<br />
hielt der Russin die Muschel ans Ohr und sagte: „Horch! Die<br />
Engelein singen!”<br />
Vermutlich verstand die Frau kein Wort, aber sie lächelte und<br />
lauschte.<br />
Vogt wagte es schließlich, sich in der näheren Umgebung<br />
umzusehen. Mit Spannung und Besorgnis erwarteten die Frauen<br />
seine Rückkehr. „Mit wem hast du gesprochen?”, fragte Martha<br />
Vogt, als sie alle um den Tisch saßen.<br />
„Ich hab' im Pfarrhaus geklopft. Die Glocken läuteten an<br />
Pfingsten schließlich nicht von selbst”, erklärte er und erzählte:<br />
„Pfarrer Smaczny ist in Liegnitz geblieben. Die Glocken hat er<br />
selber geläutet. Die Grauen Schwestern und ihre Zöglinge wurden<br />
Ende Januar in einem eigenen Transport aus der Gefahrenzone<br />
nach Hessen gebracht. Das hat das Mutterhaus in Breslau noch<br />
organisiert, obwohl die Russen dort schon vor der Stadt standen.<br />
Der alte Tierarzt aus der Zimmerstraße sollte auch mit, aber er<br />
wollte nicht. Inzwischen behandelt er Zweibeiner nach Vierbeinerdiagnose,<br />
meint Smaczny. Er soll gesagt haben, ob Tier, ob<br />
Mensch, innen läuft's gleich ab. Liegnitz ist am neunten Februar<br />
80
von der Roten Armee eingenommen worden. Die Soldaten haben<br />
unter der Zivilbevölkerung viel Unheil angerichtet. Obgleich die<br />
Stadt menschenleer wirkt, sind viele Leute nicht geflohen oder<br />
jedenfalls nicht rechtzeitig, meint Smaczny. Die Russen haben in<br />
der Innenstadt überall Siegesfeuer gelegt. Tragisch ist, sagt er,<br />
dass sie meist ehemals jüdische Geschäftshäuser erwischt haben,<br />
also eigentlich das Eigentum von denen vernichteten, die durch<br />
die Nazis in den Lagern umkamen.”<br />
„Ich wüsste gern, was aus der Großmutter von Franz geworden<br />
ist”, sagte Trudl. „Sie wohnt in der Breslauer Straße.”<br />
„Da würd' ich an Ihrer Stelle jetzt nicht hingehen Viel zu<br />
gefährlich für Frauen”, beurteilte Vogt die Lage. „Aber ich war in<br />
der Karthausstraße in der Wohnung Ihrer Eltern. Dort sieht's so<br />
wüst aus wie überall. Jedenfalls sind sie offenbar rechtzeitig aus<br />
Liegnitz 'raus.”<br />
Der sechste Juni '45 war ein warmer Vorsommertag. Bärbel hatte<br />
inzwischen begriffen, dass die Lachel-Oma und der Lachel-Opa<br />
nicht nach Liegnitz zurückgekommen waren, dass sie mit Mutti<br />
und Moni in diesem Jahr nicht ins Sonnenland laufen würde und<br />
auch nicht nach 'Afrika', weil der schlimme Krieg zwar zu Ende<br />
war, aber auf den Straßen noch immer böse Soldaten<br />
herumliefen, die Menschen töteten oder verschleppten. Die<br />
Soldaten in ihrem Haus gehörten nicht dazu, die brachten ihnen<br />
etwas zu essen. Es gab also auch gute! Nach langer Zeit tanzte sie<br />
mit Moni heute wieder das ausgedachte Spiel Alle Tage ist kein<br />
Sonntag. Das Spitzenhäubchen der Gocke-Oma war heil<br />
geblieben. Moni durfte als erste aufs Stühlchen hinaufsteigen und<br />
sich mit dem Häubchen drehen. Sie tat's ein bisschen wacklig, ließ<br />
sich am Ende schwer in die Arme der großen Schwester fallen<br />
und blieb kraftlos darin hängen. Ängstlich rief Bärbel um Hilfe.<br />
81
Als Mutti aus der Küche herbeieilte und Schwesterchen in den<br />
Arm nahm murmelte Moni: „Mickl is so kaputt.”<br />
Mutti legte Schwesterchen die Hand auf die Stirn und stellte fest:<br />
„Du hast Fieber.” Darauf befühlte sie Bärbel und sagte: „Du<br />
auch.”<br />
Was Fieber bedeutete, wusste Bärbel: Man war krank. Schließlich<br />
hatte sie schon eine Krankheit hinter sich gebracht, die Scharlach<br />
hieß. Aber jetzt tat ihr doch vom um den Stuhl Herumtanzen nur<br />
ein bisschen der Kopf weh. Es half nichts, sie wurde wie Moni<br />
unter die Decken gepackt und unversehens wurden Arme und<br />
Beine wirklich immer schwerer.<br />
Sobald die Kinder schliefen, lief Trudl zu Vogts hinüber. „Die<br />
Mädchen haben Fieber”, sagte sie bekümmert. „Es wird doch<br />
nichts Ernstes sein?”<br />
„Lassen Sie eine Nacht verstreichen”, riet Martha Vogt. „Ist ja<br />
kein Wunder, dass die Kinder bei der miesen Ernährung und den<br />
Strapazen, die sie hinter sich haben, schlapp machen. Das nimmt<br />
uns Erwachsene ja schon mit.”<br />
In dieser Nacht tat Trudl kein Auge zu und am Morgen zeigte<br />
sich, dass es nicht allein um Entkräftung ging: Beide Kinder<br />
hatten hohes Fieber und kamen gar nicht zu sich.<br />
„Geh zum Viehdoktor, Georg”, bat Martha Vogt ihren Mann.<br />
„Er soll sich die beiden ansehen. Was kann er schon falsch<br />
machen!”<br />
Der Tierarzt war nicht daheim, sondern bei anderen zweibeinigen<br />
Patienten. „Ich sag's ihm, wenn er zurück ist”, versprach die<br />
Haushälterin und schrieb sich die Adresse auf.<br />
Am Nachmittag dieses Tages kam Bärbel zu sich. Sie wand sich<br />
vor Bauchschmerzen. Trudl setzte sie aufs Töpfchen. Was das<br />
Kind stöhnend und weinend aus sich herauspresste, bestand<br />
indes nur aus Blut und Schleim. So furchtbar dies war, Trudl hätte<br />
82
viel darum gegeben, wenn Moni aus dem gleichen Grund wach<br />
geworden wäre. Aber die Kleine lag still und flach atmend unter<br />
dem dürftigen Federbett. Bärbels Bauchkrämpfe wiederholten<br />
sich. Käthe und Trudl legten ihr ein Gummilaken aus<br />
Kleinkinderzeiten unter, ein mehrfach gefaltetes Leinentuch<br />
darauf und ließen den Dingen ihren Lauf. Das Kind kam nicht<br />
einmal mehr beim qualvollen Pressen zu sich. Das Thermometer<br />
zeigte 40° Fieber an. Gegen sieben Uhr abends erschien endlich<br />
der Tierarzt. Er war einer russischen Streife in die Hände gefallen,<br />
die unbedingt einen Faschisten festnehmen wollte. Schließlich<br />
hatte man ihn gehen lassen.<br />
Der alte Mann setzte sich zu Moni ans Bett, nahm die kleine,<br />
noch warme Hand in die seine und strich ihr über das Köpfchen.<br />
„Sie ist tot”, sagte er leise.<br />
„Nein”, widersprach Trudl. „Sie hat eben noch geatmet.”<br />
„Das glaube ich gern”, versicherte der Arzt. „Kinder in diesem<br />
Alter wehren sich nicht gegen den Tod und sterben daher<br />
friedlich und fast unbemerkt.”<br />
Schluchzend nahm Trudl die Kleine in den Arm. Auch Käthe<br />
weinte, aber jemand musste jetzt handeln. Sie schlug die Decke<br />
über Bärbel zurück und der Doktor nahm das fiebernde Kind in<br />
Augenschein, betrachtete den blutigen Schleim. Dann winkte er<br />
Käthe ins Wohnzimmer und schloss die Tür.„Ich dachte es mir<br />
schon”, sagte er leise. „Es ist bei beiden Kindern Typhus. Sie<br />
haben sich vermutlich erst hier infiziert. Ich weiß, dass die<br />
Wohnungen als Abtritte missbraucht wurden. Auch in der<br />
russischen Armee grassieren Ruhr und Typhus. Exkremente sind<br />
tückische Krankheitsherde. Die Kleine ist so schnell gestorben,<br />
weil ihr Kreislauf überfordert war. Die Größere könnte es bei<br />
richtiger Medikation schaffen, am Leben zu bleiben. Ich kann<br />
aber nur eine Pferdekur anbieten und das meine ich wörtlich.”<br />
83
Der Doktor öffnete seine Tasche und holte einen Beutel von der<br />
Größe einer Teepackung heraus. „Das ist medizinische Kohle,<br />
wie sie Pferden bei Durchfall verabreicht wird”, erklärte er. „Es<br />
sollte wirken, wenn das Durchhaltevermögen des Kindes<br />
ausreicht.” Er setzte die Größe der Dosis und die Häufigkeit der<br />
Einnahme fest, versprach auch, in zwei Tagen wiederzukommen.<br />
Käthe brachte den Doktor zur Tür und kehrte ins Schlafzimmer<br />
zurück. Dort versuchte sie, Trudl gut zuzusprechen. „Du musst<br />
stark bleiben. Bärbel braucht dich, damit sie es schafft, gesund zu<br />
werden.” Leere Worte, doch was hätte sie sagen sollen? Sie<br />
wickelte Monika schließlich in ein Betttuch und Vogt trug den<br />
kleinen Leichnam hinunter in den Keller, weil es dort kühl war.<br />
84
Wenn man das Leben mit einem Wettlauf gleichsetzt, dann<br />
erreicht Else Stehauf als Letzte das Ziel. Sie hat einen schlechten<br />
Start, ihre Bahn ist voller Stolpersteine und auf ihren Schultern<br />
lastet ein Gewicht, das sie abwerfen müsste, um voranzukommen.<br />
Das Gewicht heißt Alfred – von der Natur mit Einfalt gestraft<br />
oder gesegnet, wer will das entscheiden? Else jedenfalls stellt<br />
solche Überlegungen nicht an. Sie weiß: Das Leben ist eben keine<br />
Rennbahn mit Platz und Sieg, sondern eher ein aufhaltsamer<br />
Dauerlauf. Und auf manchem Stolperstein des Weges wächst<br />
auch ein bisschen Moos, auf dem sie rasten kann – trotz oder mit<br />
Alfred.<br />
ISBN 978-3-748585-14-5 EUR 22,90<br />
85
86
Wohin du gehen wirst<br />
Zeitgeschichtlicher Familienroman<br />
Im Mai 1915 wurden auf dem Weg zur Grube ’Kamerad’ zwei<br />
lange Baracken gebaut und mit einem hohen Stacheldrahtzaun<br />
umgeben. Eines Nachmittags rannte der dürre Klaus durchs<br />
Dorf, als seien die Hunde hinter ihm her, und schrie: „De<br />
Franzen komm’! De Franzen komm’!“<br />
Tatsächlich folgte ihm ein Zug Kriegsgefangener, mindestens<br />
hundert Männer. Sie trotteten durch Naundorf hindurch und<br />
verschwanden in den Baracken hinter dem Stacheldraht.<br />
Die Franzosen arbeiteten in der Grube ’Kamerad’ und wurden<br />
von Merseburg aus mit Nahrungsmitteln versorgt.<br />
„Die kriegn mehr, als unsereener uff ’n Tisch bring’ kann“,<br />
ärgerten sich die Bergarbeiter.<br />
In den ersten Tagen pilgerten die Schulkinder nachmittags zu den<br />
Baracken und bestaunten die Fremden wie Zootiere. „Die hahm<br />
ja jarkeene Jewehre“, wunderte sich Alfred.<br />
„Du kommst uff Ideen!“, spottete Else. „Die hahm unsre den’<br />
doch abgenomm’. Was denkst’n, was die machen würd’n, wenn<br />
sie eens inne Hand kriegt’n? Die ballern damit inner Gegend rum<br />
und schießen dich ohne Gnade in’ Arsch.“<br />
Das leuchtete Alfred ein. Die Franzosen blieben besser ohne<br />
Gewehre! Wenigstens musste er dann nicht auf seinen Hintern<br />
achtgeben. Das Begucken wurde schnell langweilig, denn die<br />
Männer sahen aus wie alle anderen Leute. Wenn der Stacheldraht<br />
und die Gerüchte über die bessere Verpflegung nicht gewesen<br />
wären, hätten vermutlich sogar die Erwachsenen die Gefangenen<br />
vergessen.<br />
87
Im Juni des Jahres 1915 stand Alfred wieder einmal quäkend –<br />
wie Else es nannte – unter der Wilhelms-Eiche, diesmal im Kreis<br />
der Großfamilie Kluge. Die jüngeren Brüder seines Vaters waren<br />
gefallen. Friedrich Georg war unverheiratet gewesen, Ernst<br />
Eduard jedoch hinterließ eine Frau und vier Kinder. Alfred<br />
schluchzte hinreichend für alle, die keine Tränen hatten oder sie<br />
zurückhielten. Er erhielt deshalb fast mehr Zuspruch als die<br />
Witwe.<br />
Der Krieg machte sich inzwischen im täglichen Leben<br />
empfindlich bemerkbar, vor allem bei den Ärmeren. Zu Beginn<br />
des Jahres waren Brotkarten eingeführt worden und solche ’zur<br />
Empfangnahme von Butter, Margarine – Pflanzenfett’. 5 Rose markierte<br />
das Brot auf der Rückseite. Dennoch fehlte immer wieder ein<br />
Stück und keins der Kinder wollte es gewesen sein. Zuletzt<br />
schloss sie das Brot in der Truhe ein und nahm den Schlüssel<br />
überallhin mit.<br />
Auch Seife wurde rationiert. Almas duftendes Weihnachtsgeschenk<br />
lag noch unberührt zwischen der Bettwäsche im<br />
Schrank – jedenfalls dachte Rose das. Als sie sich eines Tages<br />
entschloss, die kostbare Reserve für das Einreiben stark<br />
verschmutzter Wäsche zu verwenden, suchte sie jedoch<br />
vergeblich danach. „Wer von euch war an der Seefe?“, fragte sie,<br />
als die Mädchen aus der Schule kamen. Else und Lydia blickten<br />
verständnislos, Hilde dagegen rief, sie habe etwas vergessen und<br />
müsse noch mal …<br />
Rose erwischte und schüttelte sie. „Wo is die Seefe?“<br />
Hilde schwieg verstockt, aber Lydia ging plötzlich ein Licht auf.<br />
Sie verschwand in der Schlafkammer und kam mit einem Kamm<br />
und einem Handspiegel zurück. „Ich hab mich gewundert, woher<br />
Hilde das Zeug hat“, rief sie empört und hielt beides empor. „Nu<br />
weeß ich’s.“<br />
88
Es stellte sich heraus, dass Hilde die Seife bei der Weidauer-<br />
Tochter gegen Kamm und Spiegel eingetauscht hatte. Anna<br />
versohlte Hilde den Hintern, sperrte sie in die Kammer ein und<br />
strich ihr das Abendbrot. Aber das brachte den kostbaren Besitz<br />
nicht zurück und der Trödelkram – denn etwas anderes war es<br />
nicht – ließ sich nicht versetzen.<br />
Die vierjährige Frida war während des Strafgerichts unter den<br />
Tisch geflohen, dessen Schutz sie nun ganz allein genoss, denn<br />
auch Otto ging inzwischen zur Schule. Sie verstand nicht, was<br />
geschah, aber die zornige Mutter erschreckte sie. Dass Hilde<br />
nichts zu essen kriegen sollte, begriff sie allerdings schon. Von<br />
diesem Teil der Strafe nahm Rose jedoch am Abend Abstand.<br />
Mehr als eine Brotschnitte mit ungesüßtem Apfelmus kriegten die<br />
Kinder ja nicht und mit leerem Magen fiel schon Erwachsenen<br />
das Einschlafen schwer, um wie viel mehr erst Kindern.<br />
Zur Zeit der Kartoffelernte ereignete sich auf einem Feld hinter<br />
Naundorf Furchtbares. Alfred hatte es von Ewald erfahren, der<br />
die Nachricht aus der Nachtschicht mitbrachte, und posaunte nun<br />
stolz in der Schule herum: „Die hahm Beckern abjemurkst!“<br />
Keiner glaubte ihm, aber bis Mittag wurde es traurige Gewissheit.<br />
Um die noch nicht abgeernteten Felder vor Dieben zu schützen,<br />
waren die alten Männer des Dorfes vom Gemeindevorsteher<br />
beauftragt worden, nachts zu wachen. Dem alten Becker war ein<br />
Kartoffelfeld zugeteilt worden. Weil die von der Grube<br />
Heimkehrenden stets den kürzeren Weg quer über die Felder<br />
nahmen, hatten sie den Alten gefunden – erschlagen. Vielleicht<br />
wären die Schuldigen nie entdeckt worden, wenn nicht der dürre<br />
Klaus in eben jener Nacht auf eigene Faust Wachmann gespielt<br />
hätte.<br />
89
„Hawwes jeseh’n! Hawwes jeseh’n! ”, trompetete er in aller Frühe<br />
vor Kassaus Haus. Der Gendarm – in Hemd und Unterhose –<br />
wurde aus Klausis verworrener Geschichte nicht klug, begriff<br />
nur, dass irgendwo irgendjemand tot herumlag. Erst Ernst Kluges<br />
Meldung brachte Licht ins Dunkel. Der dürre Klaus führte<br />
Kassau und den Ortsvorsteher nun aufs Feld, wo einer der<br />
Kumpel bei Beckers Leiche Wache hielt. „Na und, Klaus?“,<br />
bohrte Kassau. „Wen hast du gesehen?“<br />
Klausi griente, machte kehrt und stampfte auf das<br />
Gefangenenlager zu.<br />
Letztendlich kam heraus: Zwei Franzosen aus der ’Stacheldraht-<br />
Kolonie’, wie die Naundorfer das Lager nannten, hatten einen<br />
Weg durch den Zaun gefunden und waren von Becker beim<br />
Kartoffelbuddeln erwischt worden. Einer gegen zwei, das konnte<br />
natürlich nicht gut ausgehen. Die kampferprobten Soldaten<br />
hatten ihn nicht umbringen wollen, aber zu kräftig zugeschlagen<br />
und dem alten Mann das Lebenslicht ausgelöscht.<br />
Plötzlich befand sich der Krieg mitten im Dorf. Hier deutsch, da<br />
französisch – und zumeist gnadenloser Hass auf deutscher Seite!<br />
„Gleich abmurksen!“, verlangten die einen. „Vors Kriegsgericht!“,<br />
rieten die Besonnenen.<br />
Nur die alten Frauen murmelten: „Ach, die Ärmsten! Die<br />
hungern eben ooch. Nischt is mit Sonderverpflegung. Hätt’<br />
Becker se doch klauen lassen, dann wär’ er ooch noch am<br />
Leben.“<br />
Pastor Redlich nahm die Tat zum Anlass, im Religionsunterricht<br />
der Großen über das fünfte Gebot zu sprechen: ’Du sollst nicht<br />
töten’. Natürlich klammerte er das länderübergreifende Morden<br />
aus – das war ja etwas ganz anderes: Da kämpfte Gott mit,<br />
selbstverständlich auf Seiten der Deutschen!<br />
90
„Siehste, ich hatte recht“, sagte Else zu Alfred. „Wenn die<br />
Franzosn Gewehre gehabt hätt’n, hätt’n se Beckern in Arsch<br />
geschossen. Und nu wern’se selber ooch ä Kopp kürzer<br />
gemacht.“<br />
In der Grube ’Kamerad’ weigerten sich die Kumpel, mit den<br />
Gefangenen gemeinsam zu arbeiten. Erst eine energische<br />
Verlautbarung der Grubenverwaltung unter Androhung des<br />
Kriegsgerichtes brachte die Männer zur Vernunft. Die Wachen<br />
um das Gefangenenlager wurden verstärkt, weil zu befürchten<br />
stand, dass die Naundorfer die Baracken stürmen könnten. Doch<br />
die Aufregung legte sich schnell, nicht zuletzt deshalb, weil die<br />
Sorge um die eigene Lebenslage ständig zunahm.<br />
Rose hob viel häufiger Gräber aus als zuvor, denn vornehmlich<br />
die Alten verloren Lebensmut und Kraft und starben in aller<br />
Stille. Weihnachten ging sang- und klanglos vorüber.<br />
Im Januar 1916 wurde Lehrer Richter wiederum zum<br />
militärischen Lehrgang eingezogen. Hauptlehrer Neuhaus<br />
verzichtete diesmal auf eine Eingabe und schickte die verwaisten<br />
unteren Schulgruppen zum staatlich verordneten Sammeln von<br />
Buntmetall, denn vier Gruppen zur gleichen Zeit konnte er nicht<br />
unter einen Hut bringen. Die Kinder sammelten mit Eifer und<br />
Einfallsreichtum: Sie stahlen den Großeltern die Nachttöpfe<br />
unterm Bett weg und den Müttern die Blechtöpfe aus dem Regal.<br />
Natürlich wurden auch die oberen Klassen zum Sammeln<br />
angehalten. Alfred schleppte den löchrigen Eisentopf an, aus<br />
dem der Hund gefressen hatte, ehe er – von ihm reichlich<br />
beweint – an Altersschwäche gestorben war.<br />
„Wir hahm nischt“, erklärte Else lauthals in der Schule und damit<br />
war die Sache für sie erledigt. Lydia entdeckte jedoch in Althoffs<br />
Scheune einen Topfdeckel und war glücklich, dass die Kinder des<br />
91
Bauern ihr nicht zuvorgekommen waren. Dreizehn Zentner<br />
Alteisen türmten sich zuletzt in der Schule.<br />
Als Rose am letzten Tag der Aktion vom Wäschewaschen bei<br />
Kunzes nach Hause kam, empfing sie bedrückte Stille. „Is was<br />
passiert?“, fragte sie und setzte beunruhigt hinzu: „Is was mit<br />
Hilde?“ Die war nämlich wieder mal nicht daheim.<br />
„Nee!“, sagte Else schnell, „der geht's gut, aber …“<br />
„Ich war’s nich!“, beteuerte Erich vorsorglich.<br />
„Hilde hat den Regulator abgeliefert“, platzte Lydia heraus. Roses<br />
Blick fiel auf die Wand, an der sonst die Uhr hing und sie<br />
schimpfte: „Um Himmels willen! Hat se den Verstand verlor’n?<br />
Wenn der Vater heemkommt und das Ding nich …“<br />
„Da passiert gar nischt“, fiel Else der Mutter ins Wort. „Uns tät<br />
er verkloppen, Hilde nich. Die is sein Liebling.“<br />
„Quatsch“, widersprach Rose. „Die Uhr hat er selber gekooft! Da<br />
wird er wilde, wenn die weg is.“<br />
„Und was mach’mer nu?“, rief Lydia. „Hilde hat sich<br />
verkrümelt.“<br />
„Kümmert euch um die Kleene“, befahl Rose. „Ich geh’ zu Berta<br />
Gehre. Die hat den Schulschlüssel. Die Uhr muss wieder her! Es<br />
weeß ja sonst keener mehr, wie spät’s is.“<br />
Die Frau des Postboten schlug die Hände zusammen, als Rose<br />
bei ihr auftauchte und sie den Grund für den Besuch erfuhr.<br />
„Hilde is aber ooch ein verrücktes Huhn. Mein Willy geht mit ihr<br />
in eene Klasse. Was der manchmal so erzählt.“<br />
Rose sagte, sie wolle es lieber nicht wissen. Was das Mädchen zu<br />
Hause losließe, reiche ihr. Die beiden Frauen hasteten in der<br />
Dunkelheit zum Schulhaus, das zum Glück bereits elektrisches<br />
Licht besaß. Wegen der Diebe standen die Säcke in einem der<br />
Unterrichtsräume, nicht in der Scheune.<br />
„Na, dann mal los“, seufzte die Frau des Postboten.<br />
92
„Warten Sie“, sagte Rose. „Vielleicht is was zu hör’n.“<br />
Berta Gehre hatte nicht viel Hoffnung. „Wenn da was Schweres<br />
druffliegt, könn’ die Zeiger nich weiter.“ Beide lauschten in die<br />
Stille … nichts! Nun legte Rose das Ohr auf jeden Sack und bei<br />
Nummer zehn rief sie: „Hier isse drin!“ Ein Schnarren war zu<br />
hören …<br />
Die Uhr lag mit dem Zifferblatt nach unten auf der Öffnung<br />
eines alten Topfes. Das hatte es den Zeigern ermöglicht, sich zu<br />
bewegen. Die Ketten waren auch noch dran, allerdings fehlten die<br />
Gewichte und deshalb mussten die Frauen das sperrige Eisenund<br />
Blechzeug Stück für Stück aus dem Sack holen, ehe sie die<br />
Zapfen fanden. Erleichtert trug Rose die von ihr so oft<br />
verwünschte Uhr heim, wo Hilde sich inzwischen eingefunden<br />
hatte. „Du Dussel, was haste dir denn dabei gedacht?“, schimpfte<br />
Rose und hängte den Regulator an den alten Platz zurück.<br />
„Na, du hast immer gesagt, die is kaputt“, maulte Hilde.<br />
„Und wenn! Die Uhr gehört’m Vater. Du kannst nich<br />
verschenk’n, was nich deins is. Und noch eens!“ Rose hob den<br />
Zeigefinger und schnitt damit energisch die Luft in zwei Teile.<br />
„Mit der Uhr wird keener totgeschoss’n! Was denkt ihr denn, was<br />
die aus’m Zeug machen, das ihr sammelt? Gewehr- und<br />
Kanonenkugeln! Und damit schießen se nich uff Spatzen,<br />
sondern uff Menschen!“<br />
Lydia hätte nun gern den Topfdeckel zurückgehabt und Else war<br />
froh, dass sie sich gar nicht erst die Mühe gemacht hatte, nach<br />
Eisen zu suchen. Erich aber dachte: „Drei Nägel und ’ne<br />
Schraube, das reecht nich für ’ne Kugel“, und fühlte sich deshalb<br />
frei von jeder Tötungsschuld.<br />
93
Die Autorinnen<br />
bedanken sich für Ihr<br />
Interesse!<br />
94