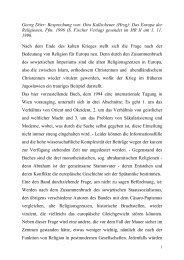Dr. Georg Doerr -- Kurzbesprechung von Mirella Carbone: Joseph Roth e il cinema. Artemide: Roma 2004.
Erschienen in: GERMANISTIK -- Internationales Referatorgan mit bibliographischen Hinweisen. Bd. 47 (2006) Heft 1/2. S. 418-419. In drei Kapiteln zeigt Mirella Carbone in der für die italienische Germanistik typischen minuziösen philologischen Arbeitsweise Joseph Roths sich wandelnde Einstellung zum Film seit seiner Ankunft in Berlin im Jahre 1920: sieht Roth in seiner politisch engagierten Phase im Dokumentarfilm, der als echte Kunst den Zuschauer zu seinem eigenen Regisseur mache und ethisch-soziales Eingreifen ermögliche, pädagogische Möglichkeiten, so schwinden diese Hoffnungen zu Beginn der 30er Jahre zuneh-mend. Bald lehnt Roth dann den Film -- mit Berufung auf Oswald Spengler -- als ein „diabolisches Mittel zur Verfälschung der Wirklichkeit“ kategorisch ab. ...
Erschienen in: GERMANISTIK -- Internationales Referatorgan mit bibliographischen Hinweisen. Bd. 47 (2006) Heft 1/2. S. 418-419.
In drei Kapiteln zeigt Mirella Carbone in der für die italienische Germanistik typischen minuziösen philologischen Arbeitsweise Joseph Roths sich wandelnde Einstellung zum Film seit seiner Ankunft in Berlin im Jahre 1920: sieht Roth in seiner politisch engagierten Phase im Dokumentarfilm, der als echte Kunst den Zuschauer zu seinem eigenen Regisseur mache und ethisch-soziales Eingreifen ermögliche, pädagogische Möglichkeiten, so schwinden diese Hoffnungen zu Beginn der 30er Jahre zuneh-mend. Bald lehnt Roth dann den Film -- mit Berufung auf Oswald Spengler -- als ein „diabolisches Mittel zur Verfälschung der Wirklichkeit“ kategorisch ab. ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Georg</strong> <strong>Doerr</strong>: <strong>Kurzbesprechung</strong> <strong>von</strong> <strong>Mirella</strong> <strong>Carbone</strong>: <strong>Joseph</strong> <strong>Roth</strong> e <strong>il</strong> <strong>cinema</strong>.<br />
<strong>Roma</strong>: <strong>Artemide</strong> <strong>2004.</strong> 142 S. Erschienen in: Germanistik - Internationales<br />
Referatorgan mit bibliographischen Hinweisen, Bd. 47 (2006) Heft 1/2. S. 418-<br />
419.<br />
In drei Kapiteln zeigt M. <strong>Carbone</strong> in der für die italienische Germanistik<br />
typischen minuziösen ph<strong>il</strong>ologischen Arbeitsweise J. <strong>Roth</strong>s sich wandelnde<br />
Einstellung zum F<strong>il</strong>m seit seiner Ankunft in Berlin 1920: sieht <strong>Roth</strong> in seiner<br />
politisch engagierten Phase im Dokumentarf<strong>il</strong>m, der als echte Kunst den<br />
Zuschauer zu seinem eigenen Regisseur mache und ethisch-soziales Eingreifen<br />
ermögliche, pädagogische Möglichkeiten - den expressionistischen<br />
„Kammerspielf<strong>il</strong>m“ (Kracauer, 38) nimmt er erstaunlicherweise nicht wahr - so<br />
schwinden diese Hoffnungen seit Anfang der 30er Jahre. Schon am Anfang<br />
seiner Rezensionstätigkeit zeige sich bei <strong>Roth</strong> auch Kulturpessimismus<br />
(Amerikanisierung, Vermassung). Auffällig an <strong>Roth</strong> Rezensionen ist nach<br />
<strong>Carbone</strong> die Dominanz des Erzählers über den Kritiker (23). Die in den 20er<br />
Jahren geführte Diskussion über die „Wahlverwandtschaft“ (57) <strong>von</strong> F<strong>il</strong>m und<br />
<strong>Roma</strong>n („romanzo mosaico“, 70), die beide die unerfindlichen Zufälligkeiten<br />
des modernen Lebens darstellen wollen, führt in <strong>Roth</strong>s Zeit- bzw. Zeitungsromanen<br />
der 20er Jahre, wie bei Döblin, zur Annäherung der Prosa an den<br />
‚f<strong>il</strong>mischen’ F<strong>il</strong>m („f<strong>il</strong>m ‚f<strong>il</strong>mico’“, 71), die f<strong>il</strong>mische Darstellungsweise wird<br />
zum Modell des <strong>Roma</strong>ns. Seit Anfang der 30er Jahre kehrt <strong>Roth</strong> nicht nur zur<br />
traditionellen geschlossenen Form des <strong>Roma</strong>ns zurück, sondern lehnt den F<strong>il</strong>m<br />
als ein „diabolisches Mittel zur Verfälschung der Wirklichkeit“ (96, aus: Der<br />
Antichrist) kategorisch ab.<br />
<strong>Georg</strong> Dörr, Tübingen







![Dr. Georg Doerr -- Kurzbesprechung von B. Röllin: Nietzsches Werkpläne vom Sommer 1885: eine Nachlass-Lektüre. Philologisch-chronologische Erschließung der Manuskripte. Fink: München [u.a.] 2012. Universität Basel, Diss., 2011.](https://img.yumpu.com/63036560/1/184x260/dr-georg-doerr-kurzbesprechung-von-b-rollin-nietzsches-werkplane-vom-sommer-1885-eine-nachlass-lekture-philologisch-chronologische-erschliessung-der-manuskripte-fink-munchen-ua-2012-universitat-basel-diss-2011.jpg?quality=85)