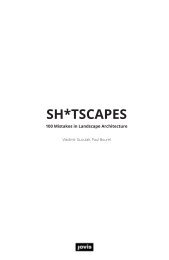Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SURFING<br />
BAUHAUS<br />
HESSEN +<br />
TYPOGRAPHY<br />
LINKS<br />
QUOTES<br />
REFERENCES<br />
DATA<br />
TEXTS<br />
AND MORE<br />
Tobias<br />
Becker<br />
Sandra<br />
Hoffmann<br />
Robbiani<br />
jovis
Inhaltsverzeichnis Table of Contents<br />
21 Vorwort Foreword Tine Melzer<br />
24 Index Index<br />
25 Fragmente Fragments<br />
182 <strong>Bauhaus</strong>paare Kai Buchholz<br />
185 Die digitale Bildersuche als kreativer Prozess Michael Mischler, Christoph Stähli Weisbrod<br />
187 Faces of Internationalism: G and the New Typography Sabrina Rahman<br />
190 Hessen Typefaces and <strong>Bauhaus</strong> Lettering: Typo graphic Equals or Worlds Apart? Dan Reynolds<br />
196 <strong>Bauhaus</strong>, please return the call. Eine Polemik Florian Walzel<br />
201 Literaturverzeichnis Bibliography<br />
207 Bildnachweise Picture Credits<br />
209 Biografien Biographies<br />
211 Danksagung Acknowledgements
Index Index<br />
A<br />
25 Georg Adams-Teltscher<br />
26 Bruno Adler<br />
27 August Agatz<br />
28 Josef Albers<br />
29 Mordecai Ardon<br />
29 Alfred Arndt<br />
31 Gertrud [Grete/Trudel] Arndt<br />
33 Johannes Ilmari Auerbach<br />
B<br />
34 Rudolf Baschant<br />
35 Eugen Batz<br />
36 Willi Baumeister<br />
39 Herbert Bayer<br />
41 Peter Behrens<br />
43 Ella Bergmann-Michel<br />
45 Max Bill<br />
47 Theodor Bogler<br />
50 Katt Both<br />
51 Marianne Brandt<br />
54 Erich Brendel<br />
55 Max Burchartz<br />
C<br />
56 Roman Clemens<br />
57 Edmund Collein<br />
D<br />
58 Margarete Dambeck-Keller<br />
58 Christian Dell<br />
58 Friedl Dicker<br />
60 Theo van Doesburg<br />
61 Otto Dorfner<br />
61 Werner Drewes<br />
62 Lydia Driesch-Foucar<br />
62 Hedwig Dülberg-Arnheim<br />
E<br />
62 Alfred Ehrhardt<br />
63 Franz Ehrlich<br />
F<br />
66 Werner David Feist<br />
67 Beate Feith<br />
67 Carl Fieger<br />
70 Albert Flocon<br />
G<br />
72 Max [Gebs] Gebhard(t)<br />
74 Jacques Germain<br />
74 Werner Graeff<br />
81 Ise Gropius<br />
81 Walter Gropius<br />
84 Carl Grossberg<br />
H<br />
85 Hans Haffenrichter<br />
86 Josef Hartwig<br />
88 Dörte Helm<br />
89 Florence Henri<br />
90 Walter Herzger<br />
90 Ludwig Hirschfeld-Mack<br />
92 Hanns Hoffmann-Lederer<br />
94 Mila Hoffmann-Lederer<br />
95 Fritz Christoph Hüffner<br />
J<br />
96 Martin Jahn<br />
K<br />
97 Grit Kallin-Fischer<br />
97 Benita Koch-Otte<br />
98 Ferdinand Kramer<br />
103 Lore Kramer<br />
103 Kurt Kranz<br />
L<br />
109 Margaret [Mark] Leiteritz<br />
111 Otto Lindig<br />
109 El Lissitzky<br />
111 Heinz Loew<br />
M<br />
112 Thilo Maatsch<br />
112 Lotte Mentzel-Flocon<br />
113 Adolf Meyer<br />
114 Hannes Meyer<br />
115 Lena Meyer-Bergner<br />
117 Robert Michel<br />
120 Ludwig Mies van der Rohe<br />
121 Immeke Mitscherlich<br />
121 László Moholy-Nagy<br />
123 Farkas Molnár<br />
124 Johannes Molzahn<br />
126 Georg Muche<br />
N<br />
127 Hannes Neuner<br />
129 Hein [Henny] Neuner<br />
129 Helene [Lene] Nonné-Schmidt<br />
P<br />
132 Max Peiffer-Watenphul<br />
133 Walter Peterhans<br />
134 Erich Pfeiffer-Belli<br />
134 Söre Popitz<br />
R<br />
137 Lilly Reich<br />
137 Margaretha [Grete] Reichardt<br />
138 Hans Richter<br />
141 Otto Rittweger<br />
142 Reinhold Roether<br />
142 Agnes Roghé<br />
142 Elsa [Ella] Rogler<br />
143 Karl Peter Röhl<br />
147 Naftaly [Naf] Rubinstein<br />
S<br />
148 Hinnerk Scheper<br />
149 Lou Scheper-Berkenkamp<br />
149 Fritz Schleifer<br />
150 Oskar Schlemmer<br />
152 Valentin Schmetzer<br />
152 Arthur Schmidt<br />
152 Joost [Schmittchen] Schmidt<br />
154 Kurt Schmidt<br />
155 Lothar Schreyer<br />
155 Herbert Schürmann<br />
156 Heinz Schwerin<br />
157 Ricarda Schwerin<br />
158 Alma Siedhoff-Buscher<br />
159 Franz Singer<br />
160 Ré Soupault<br />
162 Mart Stam<br />
163 Lotte Stam-Beese<br />
165 Kate/Käte Steinitz<br />
165 Grete [Ringl] Stern<br />
167 Gunta Stölzl<br />
T<br />
168 Margit Téry-Adler<br />
U<br />
169 Otto [Umbo] Umbehr<br />
W<br />
169 Wilhelm Wagenfeld<br />
172 Dora Wibiral<br />
174 Fritz Winter<br />
Y<br />
175 Iwao Yamawaki<br />
<strong>Bauhaus</strong> +<br />
176 Hessen Hessia Hesse<br />
177 Archiv Archive Darmstadt<br />
178 DIN-Norm-Papierformate<br />
DIN Paper sizes<br />
178 Ring »neue werbegestalter«<br />
Circle of Modern Advertising<br />
Designers<br />
178 Studio Dorland<br />
179 Neue Typografie<br />
New Typography<br />
179 Schriften Typefaces<br />
180 Venus-Grotesk<br />
180 Alfarn<br />
181 Dessau-Schriftzug Signage<br />
24 INDEX
G NO ID www.pressreader.com/germany/maerkische-oderzeitung-<br />
fuerstenwalde/20190615/283077005763625 (Abgerufen 17.07.2019).<br />
Georg Adams-Teltscher<br />
Schüler Student<br />
Adams-Teltscher, Georg Anthony / Adams, George<br />
* 01.07.1904, Purkersdorf (at) † 03.1983, London (gb)<br />
»Artist (Printmaker)«<br />
Text: [n/a], Design & Art Australia Online, 10.05.2019<br />
»Teltscher attended the School of Arts and Crafts, Vienna, later studying<br />
at the <strong>Bauhaus</strong> 1921–23.«<br />
G ID 196-1 www.daao.org.au/bio/georg-teltscher (Retrieved 16.06.2019).<br />
»De Stijl-Kurs«<br />
Text: Gerda Breuer, Werner Graeff 1901–1978, 2010<br />
»Namen-Liste für den ersten Stijl-Kursus in Weimar durch Theo van<br />
Doesburg, Kursuszeit März – Juli. Mittwochabends von 7 bis 9 Uhr.«<br />
[Georg Teltscher ist u. a. aufgelistet]<br />
G In: Werner Graeff 1901–1978. Der Künstleringenieur (Breuer 2010, 39).<br />
»Die ›<strong>Bauhaus</strong>‹ Down Under«<br />
Text: Sonja Neef, An Bord der <strong>Bauhaus</strong>, 2009<br />
»Am 27. August 1940 erreichte der zum Truppentransporter umgebaute<br />
und als ›Hell-Ship‹ berühmt-berüchtigte Frachter ›Dunera‹ aus Großbritannien<br />
die Stadt Freemantle in Westaustralien. An Bord befand sich<br />
ein nicht unwesentlicher Teil kontinentaleuropäischer Intelligenz: Wissen<br />
schaftler, Künstler, Geistliche, Wirtschaftstreibende, Rechtsgelehrte,<br />
Ärzte, alle vorwiegend jüdische Flüchtlinge, die ab Mitte der 30er Jahre<br />
in England Asyl gesucht hatten, dort jedoch im Zuge der Kriegsereignisse<br />
als feindliche Ausländer interniert worden waren. […] Am 7. September<br />
schließlich endete eine – ungeachtet des Kriegs – für England peinliche,<br />
von Konfiskation, Schikanen und Misshandlung begleitete Deportation in<br />
Sydneys Darling Harbour, wo der große Rest von insgesamt 2732 Kriegsgefangenen<br />
von Bord gebracht und, auf Züge verladen, in das Internierungslager<br />
Hay im Bundesstaat New South Wales überstellt wurde. Unter<br />
ihnen befanden sich auch die Bauhäusler Georg Adams-Teltscher und<br />
Ludwig Hirschfeld-Mack.«<br />
G ID 700-402 www.transcript-verlag.de/media/pdf/87/31/af/oa9783<br />
839411049.pdf (Abgerufen 18.09.2019). In: An Bord der <strong>Bauhaus</strong>. Zur<br />
Heimatlosigkeit der Moderne (Neef 2009, 131).<br />
»Australische Legende. Zwei Bauhäusler verschlug es ans andere Ende<br />
der Welt – unfreiwillig. Mit ihren Schicksalen verbindet sich ein Ereig nis,<br />
das in der Erinnerungskultur des Landes eine große Rolle spielt«<br />
Text: Beate Hagen, Oranienburger Generalanzeiger, 15.06.2019<br />
Ȇber George Teltscher ist nur wenig bekannt. Er wurde 1904 in Wien<br />
geboren und hatte in den Jahren 1921 bis 1923 am <strong>Bauhaus</strong> studiert. Dort<br />
entwarf er zusammen mit seinem Kommilitonen Kurt Schmidt das ›Mechanische<br />
Ballett‹, in dem flächige, stark grundfarbige und geometrisch<br />
geschnittene Figurinen in tänzerische Interaktionen gebracht werden.<br />
1938 emigrierte er nach England, von wo aus er ebenfalls auf der ›Dunera‹<br />
nach Australien deportiert wurde.«<br />
»Als die ›Dunera‹ nach vielen Wochen die australische Küste erreichte,<br />
schien für die Deportierten das Schlimmste überstanden zu sein. Doch als<br />
sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten, standen schon Eisenbahnzüge<br />
bereit, die sie in das ›Out-back‹, in das weite, unbesiedelte,<br />
heiße und trockene australische Inland, brachten. Dort wurden sie in<br />
ehemaligen Strafgefangenen-Lagern interniert, Hirschfeld-Mack und<br />
George Teltscher in Hay und Orange, New South Wales, und in Tatura,<br />
Victoria.«<br />
»Ende 1941 waren die meisten aus der Haft entlassen. Von den ehemals<br />
Deportierten gingen viele nach Großbritannien zurück, so auch der<br />
Bauhäusler George Teltscher, der sich später als Grafikdesigner und<br />
lang jähriger Lehrer am London College of Printing, heute die London<br />
College of Communication, einen Namen machte. Er starb 1983 in London.<br />
Etwa 900 frühere Internierte blieben nach ihrer Freilassung in Australien.«<br />
»Hay Money«. Georg Adams-Teltscher, 1941. Photos: courtesy of the Australian War<br />
Memorial, 2019.<br />
»Toy Currency, Australia«<br />
G NO ID www.awm.gov.au/advanced-search?query=teltscher&<br />
collection=true&facet_type=Technology + NO ID www.designweek.co.uk/<br />
issues/25-february-3-march-2019/george-adams-exhibition-shines-<br />
light-on-prolific-but-undocumented-bauhaus-designer/ + NO ID https://<br />
unsorted.co/george-adams-exhibition-shines-light-on-prolific-but-un<br />
documented-bauhaus-designer/ (Retrieved 17.07.2019).<br />
»Hay Money«<br />
Text: [n/a], Sydney Jewish Museum, [n.d.]<br />
»As the internees were not allowed to possess money, they resorted to<br />
bartering for commodities. Eventually, the artist and engraver Georg A<br />
Teltscher designed camp money that was used by the internees at Camp<br />
number seven. The serial numbers of the notes corresponded to the registration<br />
numbers of the internees. The notes contain some hidden messages,<br />
such as the text written in the barbed wire at the border of the<br />
notes: ›We are here because we are here because we are here…‹ The wording<br />
hidden in the barbed wire entanglement at the foot of the fencing in<br />
the centre of the front contains ›HMT Dunera Liverpool to Hay.‹<br />
The camp notes were recognised as official money by the Commonwealth<br />
Bank. The short-lived circulation began in March 1941. Today,<br />
there are only few notes left. They were withdrawn from circulation by<br />
the Department of the Treasury in May 1941.«<br />
G NO ID https://sydneyjewishmuseum.com.au/collection/hay-money<br />
(Retrieved 17.07.2019).<br />
»Australia under attack«<br />
Text: [n/a], The Australian War Memorial, 20.03.2017<br />
»Designed by German internee and artist George Teltscher, these notes<br />
were made and used at No. 7 Internment Camp at Hay in central New<br />
South Wales. The 25 sheep represent the camp’s 25 huts. Camp leader W.<br />
Eppenstein’s name is written within the fleece of the sheep on the shield,<br />
and the names of the hut leaders on the other sheep. The barbed wire<br />
design around the edge reads, ›we are here because we are here because<br />
we are here‹.«<br />
G NO ID www.awm.gov.au/visit/exhibitions/underattack/exhibitions<br />
(Retrieved 16.06.2019).<br />
GEORG ADAMS-TELTSCHER A 25
historischen Mission der Arbeiterklasse in Deutschland führten, den<br />
Kampf für die Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den<br />
Menschen und für eine sozialistische Zukunft. Folgerichtig wurden sie<br />
auch zu aktiven Kämpfern gegen die faschistische Diktatur in Deutschland<br />
und deren Kriegspolitik. Willi Jungmittag und August Agatz haben<br />
die Befreiung vom Faschismus nicht mehr erlebt. In ihrem Sinne zu handeln<br />
bedeutet für uns, aktiv an der Gestaltung der ent wickel ten sozialistischen<br />
Gesellschaft mitzuarbeiten.«<br />
G NO ID https://studylibde.com/doc/10585579/zwei-bauh%C3%B6uslerim-kampl-gegen-faschismus-und-krieg<br />
(Abgerufen 19.06.2019).<br />
In: Zwei Bauhäusler im Kampf gegen Faschismus und Krieg (Franke<br />
1979, 315f).<br />
»Futura Black. ›(1926, a great stencil face---Paul Renner and the Bauer<br />
design office made it into a typeface in 1929, and included it in the Futura<br />
series, even though Futura is quite different in concept), Kombinationsschrift<br />
auf Glas (1928–1931; combine a few elements). This was revived<br />
as P22 Albers by Richard Kegler from 1995 until 2004. […] Kombinationsschrift<br />
is inherently modular, the principle at the basis of FontStruct<br />
and other font creation tools. On my pages, I sometimes call the blatantly<br />
modular typefaces in the style of Kombinationsschrift piano key fonts‹.«<br />
G NO ID http://luc.devroye.org/fonts-32493.html (Retrieved 12.09.2019).<br />
Josef Albers<br />
Schüler Student, Jungmeister Young Master<br />
* 19.03.1888, Bottrop (de) † 25.03.1976, New Haven/Connecticut (us)<br />
»Font Designer – Josef Albers«<br />
Text: [n/a], Linotype, [n.d.]<br />
»The artist, theorist and designer Josef Albers was born on March 19,<br />
1888 in Bottrop, Germany and died on March 25, 1976 in New Haven in<br />
the United States. He first worked as a teacher and subsequently studied<br />
at the Royal Art School, Berlin, as well as the School of Applied Arts in<br />
Essen and the Academy of Art in Munich. From 1923 he worked at the<br />
<strong>Bauhaus</strong>, where he was appointed Deputy Director in 1930. Three years<br />
later, he emigrated with his wife Anni to the USA. There he worked at Black<br />
Mountain College, North Carolina, and at Yale University School of Art.«<br />
G NO ID www.linotype.com/8211/josef-albers.html (Retrieved 19.06.<br />
2019).<br />
»Josef Albers —›documenta IV‹ Kassel«<br />
Text: [n/a], Wikipedia, [n.d.]<br />
»He [ Josef Albers] participated in documenta I (1955) and documenta IV<br />
(1968) in Kassel.«<br />
G NO ID https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Albers#cite_note-guggen<br />
heim.org-25 (Retrieved 12.09.2019).<br />
»Josef-Albers-Straße in Fulda (Hessen)«<br />
Text: [o. A.], Straßen in DE, [o. J.]<br />
»Straßenname: Josef-Albers-Straße<br />
Straßenart: Straße<br />
Ort: Fulda<br />
Bundesland: Hessen<br />
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h<br />
Breitengrad (Latitude): 50.5406828<br />
Längengrad (Longitude): 9.6521978«.<br />
G NO ID www.strassen-in-deutschland.de/23799347-josef-albersstrasse-in-fulda.html<br />
(Abgerufen 13.11.2019).<br />
»lokal: goldener pfau, vilbelerstr. 26«<br />
Text: Gerd Fleischmann, <strong>Bauhaus</strong>, 1995<br />
»Einladung zu einem Vortrag von Josef Albers vor der Ortsgruppe<br />
Frankfurt am Main des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker<br />
am 15. März 1929, zusammen mit der Einladung zum darauffolgenden<br />
Vortrag von Wilhelm Lesemann, Fachlehrer an der Kunstgewerbeschule<br />
Bielefeld und unermüdlicher Propagandist der Neuen Typografie […].«<br />
[Der Vortrag fand in dem Lokal »Goldener Pfau« in der Vilbelerstr. 26,<br />
Frankfurt am Main, statt.]<br />
G In: <strong>Bauhaus</strong>. Drucksachen, Typografie, Reklame (Fleischmann 1995,<br />
238).<br />
»His typefaces«<br />
Text: [n/a], luc.devroye.org, [n.d.]<br />
»Schablonenschrift (1923–1926). ›This is one of a series of stencil typefaces<br />
Albers designed while teaching at the Dessau <strong>Bauhaus</strong>‹.«<br />
Typeface »Kombinationsschrift ›3‹«. Josef Albers, um 1928. Photo: monoskop.org,<br />
bauhaus. zeitschrift für gestaltung, 1931.<br />
»Kombinationsschrift«<br />
Text: (NO 2018), bauhaus100.de, [o. J.]<br />
»Um 1928 entwirft Josef Albers am <strong>Bauhaus</strong> Dessau eine neue Schrift,<br />
die aus nur drei kombinierbaren Typen abgeleitet ist und damit ›bei der<br />
reichlich komplizierten herstellung von typografischen schriften eine<br />
außerordentliche arbeits- und materialersparnis verspricht‹.<br />
Bereits ab 1923 arbeitet Josef Albers an einer Schablonenschrift, deren<br />
Lettern sich aus den geometrischen Grundformen Quadrat, Dreieck und<br />
Viertelkreis ableiten. 1928 entwickelt er diese Versuche weiter zu seiner<br />
Kombinationsschrift. Auch diese basiert auf der Kombination von Grundformen<br />
– nun sind es Kreis, Viertelkreis und Quadrat. Aus ihnen entwickelt<br />
Albers eine Serie von zehn Standard-Elementen (hier in der obers<br />
28 A AUGUST AGATZ
ten Zeile abgebildet), aus denen Buchstaben, Ziffern, Umlaute, Akzente<br />
und Interpunktionen variabel zusammensetzbar sind. Die Kombinationsschrift<br />
wurde später durch die Metallglas-Aktiengesellschaft Offenburg<br />
Baden ausgeführt und sollte hauptsächlich für Schriftfelder außergewöhnlicher<br />
Höhe und Breite Anwendung finden. Werbewirksam preist ein Prospekt<br />
der Firma um 1931 die Schrift als ›Entworfen von J. Albers, <strong>Bauhaus</strong><br />
Dessau‹ an – lieferbar in allen Größen und Farben.«<br />
G NO ID www.bauhaus100.de/das-bauhaus/werke/druck-undreklame/kombinationsschrift<br />
(Abgerufen 19.06.2019).<br />
Wandmalereiabteilung bei Wassily Kandinsky. Am 17.4.1924 legte er die<br />
Gesellenprüfung vor der Handwerkskammer Weimar ab. Von 1925 bis<br />
1926 war er am <strong>Bauhaus</strong> Dessau in der Wandmalereiabteilung bei Hinnerk<br />
Scheper, von 1926–1927 bis 1927–1928 in der Tischlereiwerkstatt<br />
bei Marcel Breuer. 1927 heiratete Arndt die <strong>Bauhaus</strong>-Studentin Gertrud<br />
Hantschk. Er legte 1928 die Meisterprüfung ab und verließ das <strong>Bauhaus</strong><br />
am 31.5.1928.«<br />
G NO ID www.grandtourdermoderne.de/facetten-des-bauhauses/<br />
personen-am-bauhaus/meister-und-lehrende/alfred-arndt (Abge rufen<br />
17.07.2019).<br />
Mordecai Ardon<br />
Schüler Student<br />
geb. né Bronstein, Max / Bronstein, Mordechai Eliezer /<br />
Ardon, Mordechai<br />
* 13.07.1896, Tuchów (pl) † 18.06.1992, Jerusalem (il)<br />
»II. documenta — Retrospective«<br />
Text: [n/a], documenta und Museum Fridericianum, [n.d.]<br />
»II. documenta / 11 July – 11 October 1959 / Art after 1945. International<br />
Exhibition«.<br />
»Participating Artists: [i. a.] Ardon, Mordechai (Ardon, Mordecai &<br />
Bron stein, Marek)«.<br />
G NO ID www.documenta.de/en/retrospective/ii_documenta<br />
(Retrieved 12.09.2019).<br />
»Bezalel und <strong>Bauhaus</strong>1«<br />
Text: Ita Heinze-Greenberg, DAVID – Jüdische Kulturzeitschrift, 04.2017<br />
»1935 konnte unter neuer Leitung und mit neuem Lehrerkollegium die<br />
›New Bezalel School of Arts and Crafts‹ eröffnet werden. Der aus Polen<br />
stammende Maler Mordechai Ardon (1896–1992) war von Anbeginn dabei<br />
und übernahm 1940 bis 1952 die Direktion. Er war stark vom frühen<br />
<strong>Bauhaus</strong> in Weimar geprägt, wo er zwischen 1920 und 1925 als Max Bronstein<br />
immatrikuliert war. Er brachte die <strong>Bauhaus</strong>pädagogik ans Bezalel,<br />
insbesondere den berühmten Vorkurs des Schweizers Johannes Itten<br />
(1888–1967), an dessen 1926 eröffneten eigenen Schule in Berlin Ardon<br />
bereits Erfahrungen als Lehrer sammeln konnte. 15«<br />
15 »Vgl. hierzu Gideon Ofrat, Ein zionistisches <strong>Bauhaus</strong>, in: Zeitschrift<br />
<strong>Bauhaus</strong> 2, November 2011, S. 48–55.«<br />
»1935 Neujahrsgruss Mordechai Ardon an Georg Muche, 27.12.1976.«<br />
G NO ID http://davidkultur.at/artikel/bezalel-und-bauhaus1 (Abgerufen<br />
19.06.2019).<br />
»BONNE ANNÉE«<br />
Text: Ita Heinze-Greenberg, DAVID – Jüdische Kulturzeitschrift, 04.2017<br />
»Neujahrsgruss Mordechai Ardon an Georg Muche, 27.12.1976. Quelle:<br />
<strong>Bauhaus</strong>-Archiv, Berlin.«<br />
G NO ID http://davidkultur.at/artikel/bezalel-und-bauhaus1 (Abgerufen<br />
17.07.2019).<br />
Alfred Arndt<br />
Schüler Student, Meister Master, Leiter Head, Lehrkraft Teacher<br />
* 26.11.1898, Elbląg (pl) [Elbing/Westpreußen (de)] † 07.07.1976,<br />
Darmstadt (de)<br />
»Facetten des <strong>Bauhaus</strong>es / Personen am <strong>Bauhaus</strong> / Meister und Lehrende«<br />
Text: [o. A.], Grand Tour der Moderne, [o. J.]<br />
»Am Staatlichen <strong>Bauhaus</strong> in Weimar und am <strong>Bauhaus</strong> in Dessau studierte<br />
er von 1921 bis 1927. 1921 belegte er in Weimar den Vorkurs bei<br />
Johannes Itten und den Unterricht bei Paul Klee, Dora Wibiral [Schriftkurs]<br />
und Dorothea Seeligmüller. Von 1922 bis 1924–1925 war er in der<br />
»Dem <strong>Bauhaus</strong> und seinen Ideen stets treu geblieben. Erinnerung an<br />
den Elbinger Maler und Architekten Alfred Arndt – Ein begeisterter<br />
Wandervogel«<br />
Text: Bernhard Heister, Das Ostpreußenblatt, 05.10.1991<br />
»Im Jahre 1921 machte Alfred Arndt eine große Wanderung – zu Fuß<br />
ver steht sich für einen Wandervogel jener Zeit – von Hamburg durch die<br />
Lüneburger Heide und den Thüringer Wald. Er kam nach Weimar, wo sich<br />
damals das berühmte <strong>Bauhaus</strong> befand.<br />
Bei einem Essen in der <strong>Bauhaus</strong>-Kantine kam ihm der Gedanke, sich<br />
bei dem Direktor des Hauses – es war Gropius – melden zu lassen. Er wurde<br />
auch eingelassen und schrieb später einmal selbst darüber in der bei<br />
ihm üblichen Kleinschrift: ›mit einer verbeugung nannte ich meinen namen<br />
und erklärte, daß ich in der kantine gegessen und mich ein bekannter<br />
aufgefordert hätte, hier zu bleiben. ›Na ja‹, meinte er und drückte mich<br />
in einen mordspolstersessel, eckig und gelb, ›so ohne weiteres können sie<br />
nicht hierbleiben, da müssen sie erst mal zeigen, was sie bis jetzt gelernt<br />
haben, also zeichnungen einschicken oder fotos mit lebenslauf. Das wird<br />
der meisterrat prüfen, und dann wird er entscheiden, ob ihr talent ausreicht.‹<br />
was ist ›meisterrat‹, dachte ich im stillen, erzählte dann, daß ich<br />
auf wanderfahrt wäre und keine arbeiten – außer den skizzen, die ich<br />
unterwegs machte – bei mir hätte, ich würde aber meiner mutter schreiben<br />
und sie bitten, eine mappe mit köpf- und aktzeichnungen, linol schnitten<br />
und urkunden usw. an das bauhaus zu schicken, ich selber gedächte<br />
nach dem bayrischen wald bzw. dem böhmerwald zu wandern (angeregt<br />
durch schriften von adalbert stifter) und würde in etwa zwei monaten,<br />
post lagernd passau, den entscheid des meisterrats erwarten, ob ich kommen<br />
dürfte oder nicht, gropius war einverstanden, drückte mir die hand<br />
und wünschte mir gute fahrt.‹«<br />
»In der NS-Zeit entwickelte er für die AEG die erste Normküche. 1948<br />
übersiedelte er nach Darmstadt.«<br />
»Woher er kam, hat Alfred Arndt niemals vergessen. Er schrieb mir einmal,<br />
was er aus seiner Heimat hatte: ›In Skizzenbüchern 170 lose Zeichnungen,<br />
157 Aquarelle, 31 Pastelle, 26 Lithos, 4 Linolschnitte, 14 Porträts<br />
von Wandervögeln, 14 Tagebücher von 1914–1921, 1 Buch Heimatsprüche<br />
und Kinderreime usw. selbst gesammelt, Geschichten aus der Heimat in<br />
der Elbinger Stadtbücherei aus alten Schwarten abgeschrieben.‹«<br />
G NO ID http://archiv.preussische-allgemeine.de/1991/1991_10_05_<br />
40.pdf (Abgerufen 17.07.2019).<br />
»alfred arndt. wie ich an das bauhaus in weimar kam …«<br />
Text: Alfred Arndt, <strong>Bauhaus</strong>. Idee – Form – Zweck – Zeit, 1964<br />
»bei itten mußten wir auch nach reproduktionen alter meister kopieren,<br />
d. h. genau in schwarz-weiß nachzeichnen, entsprechend der vorlage.<br />
itten brachte einen stoß bilder (fotos) und sagte: ›heute wollen wir<br />
mal nachempfinden‹. ein jeder soll einen teil der tafel, die er erhält, genau<br />
kopieren. er schaute erst den studierenden an, blätterte dann in dem<br />
stoß seiner tafeln und reichte dann dem betreffenden ein blatt. ich bekam<br />
johannes auf pathmos, das ich sehr gerne hatte. mein freund gebhardt<br />
ein blatt, was er auch mochte. das nenne ich ›erkennen der in dividuellen<br />
anlagen‹. und ein jeder hat mit liebe und ausdauer kopiert, weil er<br />
ein blatt bekam, zu dem er beziehung hatte. das war ittens stärke.«<br />
G In: <strong>Bauhaus</strong>. Idee – Form – Zweck – Zeit. Dokumente und Äußerungen<br />
(Neumann 1964, 40).<br />
»Das <strong>Bauhaus</strong> kommt aus Weimar«<br />
Text: Karin Willen, Frankfurt-Live, 05.12.2018<br />
»Alfred Arndt hatte sich mit der Wandgestaltung im ›Haus am Horn‹ in<br />
Weimar und im ›Haus Auerbach‹ in Jena schon einen Namen als Bauhäusler<br />
gemacht, als er 1927 als Architekt in Probstzella anheuerte.«<br />
ALFRED ARNDT A 29
Grundlagenstudium zeigt, daß solche Techniken nach dem Motto ›Tun,<br />
um zu verstehen‹ wiederaufgenommen werden, nachdem Ende der sechziger<br />
Jahre alle Grundlagenlehren über Bord geworfen worden waren.«<br />
G ID 672-13 www.genios.de/presse-archiv/inhalt/RMO/20020521/1/<br />
rhein-main-zeitung.html (Abgerufen 27.06.2019).<br />
»Hoffmann(-Lederer), Hanns, Prof.«<br />
Text: Guido Heinrich, Otto-v.-Guericke-Universität Magdeburg, 30.03.2004<br />
»Als Jungmeister für künstlerische Form und Technisches (1923) studierte<br />
er 1924–25 an der privaten Kunstschule von Johannes Itten in Zürich-Herrliberg<br />
(Weberei, Teppichknüpferei) und arbeitete anschließend<br />
als Graphiker in Zürich. 1926–29 war H. auf Empfehlung Schlemmers als<br />
leitender künstlerischer Mitarbeiter am Hochbauamt der Stadt Magdeburg<br />
unter Johannes Göderitz verantwortlich für die Gestaltung und Überwachung<br />
der plastischen, malerischen, graphischen und werbegraphischen<br />
Aufgaben sowie der städtischen Ausstellungen in dieser Zeit. H.<br />
lieferte u. a. Ausmalungsentwürfe für die Magdeburger Stadthalle, Farbangaben<br />
für städtische Innenräume und Hausfassaden und gestaltete<br />
das Magdeburger Stadtwappen neu. Neben der künstlerischen Überwachung<br />
der Magistratsdruckerei entwarf er sämtliche Magistratsdrucksachen<br />
zu Repräsentationszwecken (Deutscher Städtetag usw.) sowie<br />
Sonderprospekte (Orgel der Stadthalle Magdeburg, Die Stadthalle Magdeburg,<br />
Stadttheater, Neubauprospekte), Bronzeplaketten und Festplakate.«<br />
G ID 672-441 www.uni-magdeburg.de/mbl/Biografien/1478.htm<br />
(Abgerufen 17.09.2019).<br />
Mila Hoffmann-Lederer<br />
Schülerin Student<br />
geb. née Lederer / Bouvet, Mila (Pseudonym)<br />
* 23.07.1902, Trier (de) † 19.03.1993, Murrhardt (de)<br />
hatte, kann ab Herbst 1945 in Weimar verschiedene Räume und Festdekorationen,<br />
u. a. für das Kultusministerium gestalten. Außerdem arbeitet<br />
sie als Pressereferentin des thüringischen Landeskulturamtes für Kunst<br />
und Architektur. Nach einem Umzug nach Darmstadt 1950 wird sie als<br />
Gestaltungsberaterin großer Firmen tätig und widmet sich zunehmend<br />
der Lyrik.«<br />
S. 368 »Werkbiografien – Mila Lederer […] Mila Lederer, spätere Hoff mann-<br />
Lederer (ab 1926), Künstlerinnenname ab Mitte der 1950er Jahre Mila<br />
Bouvet«.<br />
»1929 siedeln sie nach Berlin über, wo Hanns Hoffmann künstlerischer<br />
Mitarbeiter des Messe- und Ausstellungsamtes der Stadt Berlin<br />
wird. Sie [Hanns und Mila] gründen ein gemeinsames Atelier und übernehmen<br />
verschiedene Werbegestaltungsaufträge.«<br />
G NO ID https://d-nb.info/1007785551/34 (Retrieved 20.07.2019). In:<br />
<strong>Bauhaus</strong>- und Tessenow-Schülerinnen. Genderaspekte im Spannungsverhältnis<br />
von Tradition und Moderne (Bauer 2003).<br />
»Fotografie in der Werbung«<br />
Text: Patrick Rössler, novum, 2014<br />
»Für die Stadt Magdeburg hatten Hanns Hoffmann und seine Frau Mila<br />
Lederer unter anderem die Gestaltung der städtischen Drucksachen entwickelt,<br />
bevor sie sich in Berlin mit einem Atelier selbständig machten,<br />
das auch für das Messe- und Ausstellungsamt der Stadt tätig wurde. Das<br />
Gebrauchsgraphik-Portfolio aus dem September 1930 zeigt geradezu<br />
prototypisch sowohl Fotografien als auch Inserate; nach Ansicht des Herausgebers<br />
Frenzel zeugen diese ›werbegraphischen Arbeiten unter Einbeziehung<br />
der selbstgefertigten Photographie von bestem graphischen<br />
und werbetechnischem Verständnis‹. Bezeichnend scheint freilich, daß<br />
beider [sic] lange Zeit am <strong>Bauhaus</strong> und die Mitwirkung am Dessauer Neubau<br />
damals Frenzel genauso wenig erwähnenswert schienen wie ihre<br />
nach wie vor engen Kontakte zu Johannes Itten und Oskar Schlemmer.«<br />
G ID 712-852 www.arthistoricum.net/themen/textquellen/gebrauchsund-reklamegrafik/zeitschrift-gebrauchsgraphik/literatur/fotografiein-der-werbung/<br />
(Abgerufen 27.05.2019). In: novum. World of Graphic<br />
Design, Heft 7 (2014, 74–79).<br />
»<strong>Bauhaus</strong>- und Tessenow-Schülerinnen«<br />
Text: Corinna Isabel Bauer, <strong>Bauhaus</strong>- und Tessenow-Schülerinnen, 2003<br />
S. 184 »Berufseinstiege von Architekturstudentinnen der Weimarer Republik<br />
[…] Mila Hoffmann-Lederer, die seit 1924 ihren Lebensunterhalt mit<br />
Weberei und Werbegrafik bestreitet, nutzt die sich bietende Chance, ab<br />
1926 mehrere Jahre als künstlerische Mitarbeiterin des Messeamtes<br />
Magdeburg Farbgestaltungen für städtische Neubauten zu entwerfen.«<br />
S. 211 »In Magdeburg entwirft Mila [Hoffmann-]Lederer, die seit Ende<br />
1926 künstlerische Mitarbeiterin des dortigen Messe- und Hochbauam tes<br />
ist, Farbgestaltungen für neu entstehende Wohnsiedlungen sowie die<br />
Stadthalle. Ab 1929 wird sie in Berlin freiberuflich auch für Ausstellun gen<br />
tätig. 1930 präsentiert sie ›Mitteldeutschland‹ als raumgreifende Fotocollage,<br />
im folgenden Jahr zeichnet sie als Grafikerin für die Ausstel lung<br />
›Licht, Luft und Sonne für alle‹ verantwortlich.«<br />
S. 232 »›Mit fast keinen anderen Mitteln als der Farbe‹ macht Mila Hoffmann-Lederer<br />
1946 aus der Thüringischen Buchhandlung am Goetheplatz<br />
in Weimar, ›einem denkbar schlecht proportionierten, schlauchartigen,<br />
mit häßlichen Eisenregalen und Eisentheken vollgestopften Laden<br />
einen ganz neuen lichterfüllten Raum von hohem ästhetischem Reiz … 70<br />
[…] dadurch, daß sie die einzelnen Wände in verschiedene kalte und<br />
warme Farbtöne vertikal aufgeteilt und in eine neue Beziehung zueinander<br />
gebracht hat, erzielte sie eine Erweiterung und Erhöhung des Raumes<br />
(…), die überraschend und überzeugend ist.‹ 71 Einen ve[r]gleichbaren Ansatz<br />
verfolgt sie im Frühjahr 1951 in Darmstadt, wo sie ›den Saal der<br />
Christengemeinschaft im Herdweg‹ mit ›farbigem Feingefühl und tektonischem<br />
Sinn‹ umbaut. 72«<br />
70 »BHD, Hoffmann-Lederer, Zeitungsausschnitt einer ungenannten Zeitung<br />
o. A. , ›Weimar, 21.2.1946‹«.<br />
71 »Ibid.«<br />
72 »FN 70 ›prd.‹: ›Farbdynamische Raumgestaltung‹ in: Darmstädter<br />
Echo, 20.3.1951«.<br />
S. 266 »Architektinnen nach dem zweiten Weltkrieg: Berufswege nach<br />
1945 […] Mila Hoffmannlederer [sic], die ab 1942 an der Kunstgewerbeschule<br />
Posen als Dozentin Gobelin- und Teppichweberei unterrichtet<br />
»Short biographies – Milla [sic] Hoffmann-Lederer «<br />
Text: Gerda Breuer, Julia Meer, Women in Graphic Design, 2012<br />
»In an article by Hermann Karl Frenzel, editor of the trade journal Gebrauchsgraphik,<br />
the printed material designed by Hanns and Milla [sic]<br />
Hoffmann-Lederer for the city of Magdeburg in 1930 was described as<br />
follows: ›These promotional materials belong to the best advertising<br />
graphics of any German city, due to the appropriateness of their commercial<br />
aspects.‹ * [*Gebrauchsgraphik, Jg. 7, H. 9, S. 61–67, hier S. 61]«<br />
G In: Women in Graphic Design 1890–2012 (Breuer, Meer 2012, 477).<br />
»Universalkommunikation – Global gedacht, regional gemacht: zur<br />
Diffusion der neuen, funktionalen Typografie«<br />
Text: Patrick Rössler, Große Pläne!, 2016<br />
»Allerdings sind die dort beispielhaft gezeigten Arbeiten aller Leipziger<br />
Werbegrafiker traditionell-dekorativ angelegt; die einzigen modernen<br />
Gestalter in Mitteldeutschland waren demnach laut Verbandsverzeichnis<br />
Mila Hoffmann-Lederer in Magdeburg und, mit Abstrichen, Otto<br />
Pfaff aus Halle von der Burg Giebichenstein. 49«<br />
49 »Ich danke Roland Jaeger, Hamburg, für den Hinweis auf diese<br />
Fundstelle.«<br />
»Der Inhalt von Das Stichwort war zunächst an der bunten Mischung<br />
in den Magazinen jener Epoche orientiert, deren Themen mit Regionalbezug<br />
aufgearbeitet wurden: Architektur, Medien, Literatur, medizinischer<br />
Fortschritt und natürlich immer wieder Theater und Tanz. Die Umschläge<br />
waren eher simpel um eine monochrome Farbfläche organisiert,<br />
auf der eine ausgewählte Illustration zentriert platziert wurde, ergänzt<br />
um die Nummer der Ausgabe in großen Ziffern und dem jeweiligen Themenschwerpunkt,<br />
darüber der Titel in der Kopfzeile. Im Vergleich zu anderen<br />
Umschlaglayouts muten die Covers dieser 17 erschienenen Hefte<br />
eher altbacken und wenig inspiriert an. Den modernsten Eindruck innerhalb<br />
der Ausgaben [Das Stichwort Magazin], an denen auch die früheren<br />
Bauhäusler Hanns und Mila Hoffmann-Lederer als Mitarbeiter beteiligt<br />
waren, 73 die schon einen Faltprospekt für die Stadtreklame Magedburgs<br />
gestaltet hatten, hinterlassen deswegen die von Schawinsky entworfenen<br />
94 H HANNS HOFFMANN-LEDERER
Anzeigen für das Kaufhaus Barasch, das Speiselokal ›Reichshalle‹ oder<br />
die Buchdruckerei W. Pfannkuch, die das Heft als Referenzobjekt anführte<br />
[…].«<br />
73 »Vgl. hierzu Brüning 1995 (wie Anm. 28), S. 272.«<br />
G »Universalkommunikation. Global gedacht, regional gemacht: zur<br />
Diffusion der neuen, funktionalen Typografie« (Rössler 2016, 160ff).<br />
In: Große Pläne! Moderne Typen, Fantasten und Erfinder. Zur Angewandten<br />
Moderne in Sachsen-Anhalt 1919–1933 (Perren, Blume, et al.<br />
2016).<br />
»Theoretical subjects such as political aesthetics and the sociology of<br />
art supplemented the lecture programme. Thus the school had shed its<br />
old artistic past and now presented itself as a modern design school — albeit<br />
without a clear status. As a result of his autocratic leadership and lack<br />
of willingness to adopt reforms, Hüffner lost the confidence of his lecturers<br />
and students in 1969.«<br />
G ID 659-1 www.fbg.h-da.de/en/faculty (Retrieved 17.09.2019).<br />
In: Designlehren. Wege deutscher Gestaltungsausbildung (Buchholz,<br />
Theinert 2007, 94–111).<br />
»<strong>Bauhaus</strong> und neue Kunsthochschule«<br />
Text: Klaus-Jürgen Winkler, Bemerkungen zur <strong>Bauhaus</strong>rezeption an der<br />
Weimarer Hochschule unmittelbar nach dem Kriege, 1992<br />
»Im Vorfeld der Eröffnung erschien ein beachtenswerter Zeitungsartikel<br />
von Mila Hoffmann-Lederer mit dem Titel ›<strong>Bauhaus</strong> und neue Kunsthochschule‹,<br />
der eine großartige Vision von ›der Kunstschule im neuen<br />
Geiste, dem <strong>Bauhaus</strong> unserer Zeit‹ entwickelt. 17 Offenbar versuchten die<br />
ehemaligen <strong>Bauhaus</strong>angehörigen, die inzwischen an die Hochschule gekommen<br />
waren, mit diesen Mitteln auf die Formulierung des neuen Instituts<br />
Einfluß zu nehmen.«<br />
17 »Hoffmann-Lederer, Mila: <strong>Bauhaus</strong> und neue Kunsthochschule. In:<br />
Thüringer Volk, Jena 1.6.1946«.<br />
[Wissenschaftliches Kolloquium vom 18. bis 21. Juni 1992 in Weimar an<br />
der Hochschule für Architektur und Bauwesen zum Thema: »Architektur<br />
und Macht«]<br />
G ID 712-181 https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/frontdoor/deliver/<br />
index/docId/1113/file/Klaus_Juergen_Winkler_pdfa.pdf (Abgerufen<br />
20.07.2019). In: Bemerkungen zur <strong>Bauhaus</strong>rezeption an der Weimarer<br />
Hochschule unmittelbar nach dem Kriege (Winkler 1992, 279).<br />
»Vier Bücher von Mila Bouvet (Mila Hoffmann-Lederer)«<br />
Text: [o. A.], Marelibri Book Search, [o. J.]<br />
1) »mila bouvet: Die Neue Erde. Fünf Gedichte«. Rütte, 1953.<br />
2) »Der Entstellte. Ein lyrisches Spiel in 14 Bildern und einem Vor spiel«.<br />
Zürich: Origo Verlag, ohne Jahr (ca. 1960).<br />
3) »Die Harmonie des Alls und das Labyrinth der Welt. Tag und Nachtbuch<br />
meiner seltsamen Reise«. Freiburg: Wege, 1996.<br />
4) »Der Entstellte. Ein lyrisches Spiel in 14 Bildern und einem Vorspiel«.<br />
Zürich: Origo Verlag, 1957.<br />
G NO ID www.marelibri.com/search/current.seam?maximumPrice<br />
=0.0&keywords=&firstResult=0&faceted=true&ISBN=¢ury=ALL&<br />
selectedDatasources=1005&quicksearch=mila+bouvet&l=en&match<br />
TypeList=ALL&author=&title=&description=&minimumPrice=0.0&<br />
minimumYear=0&sorting=RELEVANCE&booksellerName=&ageFilter=<br />
ALL&keycodes=&pod=false&maximumYear=0&cid=6028864 (Abgerufen<br />
17.09.2019).<br />
Fritz Christoph Hüffner<br />
Schüler Student<br />
Hüffner, Friedrich G.<br />
* 16.01.1909, Erfurt (de) † 16.04.1992, Neukirchen (de)<br />
»History and profile / New beginning for design education«<br />
Text: Kai Buchholz, Justus Theinert, h-da University of Applied Sciences<br />
Darmstadt, Faculty of Design, 2007<br />
»After the war various initiators associated with the painter Paul<br />
Thesing attempted to restart art and design education at Mathildenhöhe.<br />
In February 1946 they installed the ›Lehrwerkstätten der bildenden Kunst‹<br />
(›teaching workshops for the visual arts‹), the first basic operation with a<br />
practical programme. In 1949 the school joined the Arbeitsgemeinschaft<br />
deutscher Werkkunstschulen (›federation of German art colleges‹) and<br />
was renamed Werkkunstschule (›art college‹) Darmstadt.«<br />
»In 1960 the art college acquired a new director: Friedrich G Hüffner.<br />
He systematically expanded the school with new posts for photography,<br />
commercial art and typography and developed plans for a new film class.«<br />
Poster for exhibition »Elemente des neuen Bauens«. Fritz Christoph Hüffner, 1929.<br />
»Friedrich Christoph Hüffner«<br />
Text: Kai Buchholz, Justus Theinert, Designlehren, 2007<br />
»Von 1929 bis 1931 ist Hüffner am Hochbauamt in Frankfurt a. M. tätig,<br />
die Jahre zwischen 1931 und 1938 verbringt er als Grafiker für Städtebau<br />
und Landesplanung in Asien und im europäischen Ausland. […] Von 1945<br />
bis 1956 setzt Hüffner seine freiberufliche Tätigkeit in Münster/Westfalen<br />
fort, zwischen 1956 und 1960 übernimmt er die Leitung der Gestaltungslehre<br />
an der Staatlichen Werkkunstschule Kassel. 1960 Direktor der<br />
Werkkunstschule Darmstadt, 1970 wird Hüffner an die Pädagogische<br />
Hoch schule Gießen versetzt.«<br />
G In: Designlehren. Wege deutscher Gestaltungsausbildung (Buchholz,<br />
Theinert 2007, 381).<br />
»Streiks der Darmstädter Werkkunstschule begleiten Umstrukturierungen<br />
im Lehrbetrieb, 23. Mai 1969«<br />
Text: [o. A.], Zeitgeschichte in Hessen, 23.05.2018<br />
»Der über mehrere Wochen andauernde Streik der Werkkunstschüler<br />
der Werkkunstschule Darmstadt beginnt am 23. Mai 1969. Aufgerufen<br />
hatte der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) zu einem Vorlesungsstreik,<br />
mit dem sich auch die Dozenten solidarisch erklären. Friedrich G.<br />
Hüffner, der 1960 den Posten des Direktors übernommen hatte, blockiert<br />
die Reformbestrebungen, deren Ziel erste Vorbereitungen, um die Werkkunstschule<br />
zu einer Hochschule für Design zu entwickeln bzw. diese als<br />
eigenständigen Fachbereich an die Technische Hochschule Darmstadt an<br />
FRITZ CHRISTOPH HÜFFNER H 95
flower photograms from a community member, Bertha Günther. Like<br />
Günther, Moholy’s earliest Berlin photograms are made with daylight<br />
printing-out paper, a process by which a treated piece of paper is exposed<br />
to the sun and fixed using a water bath. However, he quickly<br />
switched to darkroom photogram production, using the light from the<br />
enlarger to expose the flower and then fix the resulting image in chemi c<br />
als, allowing him greater control over the process. Günther’s photograms<br />
are artfully arranged, but static, decorative compositions featuring<br />
previously dried and pressed blooms in which the beauty and structure<br />
of the flower is the main subject matter.«<br />
G NO ID www.artesinhorto.org/?portfolio=portfolio-title-9/moholygarden<br />
(Retrieved 14.09.2019).<br />
»Eine neue Generation Weib in den Fotografien der Lichtbildwerkstatt<br />
Loheland«<br />
Text: Eckhardt Köhn, Lichtbildwerkstatt Loheland 1919–1939, 2006<br />
»Diese zwischen 1920 und 1922 entstandenen Fotogramme, von denen<br />
13 erhalten sind, stammen, wie Herbert Molderings 2003 gezeigt hat, von<br />
Bertha Günther, einer jungen Frau aus Bremerhaven, die zwischen 1914<br />
und 1926 in Loheland gelebt und gearbeitet hat. Moholy-Nagy, der zu Beginn<br />
der zwanziger Jahre seine Ferien mehrfach in der Rhön verbrachte,<br />
hatte die Fotogramme der Bertha Günther vermutlich während eines Besuchs<br />
in Loheland gesehen, da seine durch die Jugendbewegung geprägte<br />
Frau Lucia Moholy Kontakte zu den Frauensiedlungen in der Rhön hatte.«<br />
G NO ID www.loheland.de/fileadmin/downloads/siedlung/archiv/<br />
Heft_zur_Ausstellung.pdf (Abgerufen 18.09.2019). In: Dokumentation<br />
zur Ausstellung »Lichtbildwerkstatt Loheland 1919–1939« (Köhn,<br />
Mollenhauer-Klüber 2006).<br />
»Sensing the Future. Moholy-Nagy, die Medien und die Künste«<br />
Text: Oliver I. A. Botar, MuseumsJournal, 2014<br />
»Nach seiner Ankunft in Berlin lernte er über Mitglieder der ›Freideutschen<br />
Jugend‹ seine erste Frau Lucia Schulz kennen, die später unter<br />
dem Namen Lucia Moholy als Fotografin berühmt wurde. Durch sie kam<br />
Moholy-Nagy erstmals mit der Lebensreformbewegung in Kontakt, de ren<br />
Ideen und Praktiken sich bei Intellektuellen vieler Anhänger erfreu ten.<br />
Das Paar verbrachte einige Ferienaufenthalte bei Loheland und Schwarzerden,<br />
zwei Frauenkommunen in der Rhön, in deren Mittel punkt Bewegung,<br />
Naturheilkunde, ökologische Landwirtschaft und an de re Reformpraktiken<br />
standen. Obwohl Moholy-Nagy im Gegensatz zu Lucia nicht an<br />
den ›Ferienkursen‹ teilnehmen konnte, da diese Frauen vor behalten<br />
waren, war er tief beeindruckt von den reformpädago gischen und gesundheitsbezogenen<br />
Ideen der Lebensreformbewegung.«<br />
»Was aber lässt sich nun über das eingangs betrachtete Foto sagen?<br />
Aufgenommen hat es vermutlich Lucia Moholy in Schwarzerden. Die unbekannte<br />
Frau führt eine Art von Körpertherapie mit Moholy-Nagy durch.<br />
In Schwarzerden hatte er die Körperlehre kennengelernt, die auf der<br />
Selbsterkenntnis des Menschen als bewusstem Teil eines Ganzen basiert.<br />
Dieser Kontakt hinterließ einen tiefen Eindruck bei ihm. Das Foto lässt<br />
vermuten, dass Moholy-Nagy sich mit gesenktem Blick auf sein Inneres,<br />
den Mikrokosmos seines Körpers, konzentrierte, im Bewusstsein der<br />
über ihm und in ihm herrschenden Universalgesetze.«<br />
G NO ID www.museumsjournal.de/leseprobe.html?NID=20149292<br />
(Abgerufen 18.09.2019). In: Sensing the Future. Moholy-Nagy, die Medien<br />
und die Künste (Botar 2014).<br />
»Amazonen mit Mistgabel«<br />
Text: Anne Haeming, taz: die tageszeitung, 05.05.2007<br />
»Fotografie war für die Loheländerinnen zweierlei: Dokument von<br />
Tanz gebärden einerseits, andererseits ein strategisches Werbemittel für<br />
die Poster, mit denen sie ihre Fortbildungen für Gymnastiklehrerinnen<br />
bewarben. In der Dunkelkammer entstanden die Sprungbilder mit den<br />
Mitteln der Montage: Dieselbe Aufnahme wurde wieder und wieder in<br />
das eine Landschaftsbild gebaut.<br />
Doch es blieben auch Vorbehalte gegenüber dem Medium: Fotos seien<br />
›spröde‹ und ein ›wenig schätzbares Surrogat‹ der Realität, befanden die<br />
Gründerinnen Louise Langgaard und Hedwig von Rohden. Dennoch entstanden<br />
an ihrer Schule auch die ersten Fotogramme, die analogste<br />
Form der Fotografie, für eine direkte Abbildung der Natur genutzt. Blüten,<br />
Blätter, Objekte werden hier direkt auf Fotopapier gelegt, je nach Lichtdurchlässigkeit<br />
schreiben sie ihre Spuren direkt ins Papier ein. 14 Arbeiten<br />
von Bertha Günther zeigen zarte Hortensienblättchen, amöben hafte<br />
Lichtfährten. Der Bauhäusler László Moholy-Nagy rühmte die Loheländerin<br />
als Mit-Erfinderin dieser Technik, mit der auch er selbst in die Fotografie-Geschichte<br />
einzog.«<br />
G NO ID https://taz.de/!285699 (Abgerufen 18.09.2019).<br />
»Hinter den Masken des <strong>Bauhaus</strong>«<br />
Text: Antje Stahl, Deutschlandfunk, 14.05.2019<br />
»Sandra Neugärtner dokumentiert in der vorliegenden Anthologie<br />
[Bau haus Bodies. Gender, Sexuality, and Body Culture in Modernism’s<br />
Legendary Art School] deshalb, dass der Künstler László Moholy-Nagy<br />
zusammen mit seiner ersten Frau Lucia Moholy, geborene Schulz, die<br />
Frauenkommunen Schwarzerden und Loheland besuchte, die nach dem<br />
Ersten Weltkrieg gegründet wurden.<br />
›Von Mitte Juli bis Mitte September 1922 hielten sich die Moholys in<br />
ei nem Bauernhaus in Weyhers auf. Loheland war nur vier Kilometer entfernt<br />
und es steht im Grunde genommen fest, dass sie das Photogramm<br />
und seine mediumspezifischen Qualitäten während ihres Besuchs in Loheland<br />
entdeckten.‹<br />
Dort ergründete Bertha Günther zwischen 1920 und 1922 Photogramme<br />
mit Blumen, Blättern und Gräsern. Und László Moholy-Nagy notierte<br />
sogar, dass sie seine Arbeit beeinflussten. Er hielt aber die fotografischen<br />
Experimente und selbst seine Ehefrau später nicht mehr für erwähnenswert,<br />
sobald es um die Genese seines eigenen Werkes ging. Wie soll man<br />
das nennen: Intelligente Selbstvermarktung? Blasierte Selbstvermessenheit?<br />
Ignoranz oder Misogynie?«<br />
[Buchrezension: Elizabeth Otto und Patrick Rössler (Hg.): <strong>Bauhaus</strong> Bodies.<br />
Gender, Sexuality, and Body Culture in Modernism’s Legendary Art School]<br />
G NO ID www.deutschlandfunk.de/elizabeth-otto-patrick-roessler-<br />
bauhaus-bodies-hinter-den.700.de.html?dram:article_id=448683<br />
(Abgerufen 18.09.2019).<br />
»Einige brauchbare typographische Zeichen« (Some useful typographic characters).<br />
Illustration for the essay Zeitgemäße Typografie. Ziele, Praxis, Kritik (Contemporary<br />
Typography. Goals, Practice, Criticism). László Moholy-Nagy in Offset 7/1926.<br />
»<strong>Bauhaus</strong>: Drucksachen, Typografie, Reklame«<br />
Text: [o. A.], SPREAD bookshelf for typography and graphic, 05.28.2019<br />
»Einige brauchbare typographische Zeichen, Illustration zu dem Aufsatz<br />
zeitgemäße Typografie. Ziele, Praxis, Kritik von L. Moholy-Nagy in<br />
Offset 7/1926«.<br />
G NO ID http://page-spread.com/bauhaus-drucksachen-typografie-<br />
reklame-2 (Abgerufen 05.10.2019) In: <strong>Bauhaus</strong>. Drucksachen, Typografie,<br />
Reklame (Fleischmann 1995, Abbildung 5).»Das <strong>Bauhaus</strong> in<br />
Frankfurt – eine Spurensuche«<br />
Text: Stefan Beuttler, Alles Neu!, 2016<br />
»Auch Moholy-Nagy wurde nach Frankfurt eingeladen, um seine ›neuen<br />
Film-Experimente‹ im Gloria-Palast Ecke Kaiserstraße/Neue Main zer<br />
122 M LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY
straße zu zeigen. Die Einladungskarte stammt aus der Sammlung Philipp<br />
Albinus und wurde vermutlich von Albinus selbst gestaltet.«<br />
G »Das <strong>Bauhaus</strong> in Frankfurt – eine Spurensuche« (Beuttler 2016,<br />
154). In: Alles neu! 100 Jahre Typografie und Neue Grafik in Frankfurt<br />
am Main (Klemp, Wagner K 2016).<br />
»László Moholy-Nagy«<br />
Text: Gerd Fleischmann, <strong>Bauhaus</strong>, 1995<br />
»Gestaltung für einen Katalog der Ausstellung ›walter gropius, zeichnungen,<br />
fotos, modelle‹ im Kunstverein Frankfurt a. M., 16-seitiges Heft,<br />
schwarz, rot auf Kunstdruckpapier, Ergänzungsblatt gelb/hell, fette und<br />
halbfette Futura, Textschrift Gill, Druckvermerk auf der Rückseite din a<br />
5/typo: moholy-nagy, 1930«.<br />
G In: <strong>Bauhaus</strong>. Drucksachen, Typografie, Reklame (Fleischmann 1995,<br />
302).<br />
»<strong>Bauhaus</strong> Resources. <strong>Bauhaus</strong> typography collection, 1919–1937«<br />
Text: [n/a], Online Archive of California, [n.d.]<br />
»Accession # 850513«<br />
»Box 1, Folder 8: Correspondence and printed matter. […] Letter from<br />
Gropius to Michel Epstein with letterpress designed by László Moholy-<br />
Nagy [?]. Postcard designed by László Moholy-Nagy [?] inscribed by Moholy-Nagy<br />
to Walter Dexel. […] Membership card and an advertisement<br />
(two copies, one incomplete) of Kreis der Freunde des <strong>Bauhaus</strong>es, designed<br />
by László Moholy-Nagy.«<br />
»Box 2, Folder 22: Book cover designs and letterheads, 1927–1937. […]<br />
Advertising brochure for the magazine Metallwirtschaft; catalog of exhibition<br />
Ausstellung Walter Gropius Zeichnungen, Fotos, Modelle in der<br />
ständigen Bauwelt Musterschau, held at Kunstverein Frankfurt 6–18<br />
June 1930; and brochure The new <strong>Bauhaus</strong> American School of Design,<br />
published in Chicago in 1937. Also present is a letterhead of Verband so zialer<br />
Baubetriebe GmbH (letter to C. van Eesteren from 21 January 1929).«<br />
G NO ID https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt5t1nf2n2/entire_<br />
text (Retrieved 18.09.2019).<br />
Farkas Molnár<br />
Schüler Student<br />
Molnár, Farkas Ferenc<br />
* 21.06.1897, Pécs (hu) † 12.01.1945, Budapest (hu)<br />
»About Farkas Molnár«<br />
Text: [n/a], Architectuul, [n.d.]<br />
»He studied at the Technical University and the Art School in Budapest,<br />
then at <strong>Bauhaus</strong> in Weimar as a student of Walter Gropius.<br />
At the <strong>Bauhaus</strong> he designed his Red Cube House (1922) which was to<br />
be published, and is associated with Hungarian Activism. In 1929, at the<br />
invitation of Gropius, he contributed to the CIAM conference [in Frankfurt<br />
am Main, Germany] on ›The Small Apartment‹, after which he and<br />
others formed the Hungarian branch of CIAM. He built mostly villas.«<br />
G NO ID www.architectuul.com/architect/farkas-molnar (Retrieved<br />
14.09.2019).<br />
»New <strong>Bauhaus</strong> school catalog«<br />
Text: [n/a], <strong>Bauhaus</strong> Chicago Foundation, 2016<br />
»Moholy was invited to Chicago for an interview, was offered the job,<br />
and accepted it. A public announcement was made on August 22; Moholy<br />
would be director of ›the New <strong>Bauhaus</strong>, an American School of Design,‹<br />
and it was he who decided the school should be called the New <strong>Bauhaus</strong>.<br />
Thus the stage was set for the beginning of Moholy’s educational undertaking<br />
in Chicago at the New <strong>Bauhaus</strong>, which operated in 1937 and<br />
1938; this was followed by an independent school begun by Moholy in<br />
1939, the School of Design in Chicago; and this, in turn, was re-organized<br />
in 1944 and renamed the Institute of Design. The I. D. later [December,<br />
1949] became a unit of the Illinois Institute of Technology.«<br />
[…excepts from Chapter Two: Moholy-Nagy in Chicago, from the unpu b<br />
lished Chicago’s <strong>Bauhaus</strong> Legacy, Volume 1 (2013) by Lloyd C. Engelbrecht]<br />
G NO ID www.bauhauschicago.org/the-schools.html (Retrieved 12.09.<br />
2019).<br />
»Moholy-Nagy and the New Typography«<br />
Text: [n/a], Kunsthalle Darmstadt, 2019<br />
»While researching in the Berlin Art Library, the two professors Petra<br />
Eisele and Isabel Naegele from Mainz stumbled upon 78 original exhibition<br />
panels by the <strong>Bauhaus</strong> master László Moholy-Nagy, who had been<br />
sleeping in the depot for about 90 years. This rediscovery culminated in<br />
the <strong>Bauhaus</strong> year 2019 in an exhibition and a publication on ›Moholy-<br />
Nagy und die Neue Typografie‹.<br />
On the occasion of the exhibition ›<strong>Bauhaus</strong> und die Fotografie. Zum<br />
Neuen Sehen in der Gegenwartskunst‹, which also revives two historical<br />
exhibition spaces of the painter, photographer and designer László Moholy-Nagy,<br />
the editors Prof. Dr. med. Petra Eisele and Prof. Dr. Isabel Naegele<br />
discuss the project in the Kunsthalle Darmstadt in a dialogue conversation.«<br />
[Discussion: Th / 24.10.19 / 19:30]<br />
G NO ID www.kunsthalle-darmstadt.de/Programm_3_0_gid_4_pid_<br />
440.html (Retrieved 23.10.2019).<br />
Cover design of <strong>Bauhaus</strong>bücher 1, »Internationale Architektur«. Farkas Molnár, 1925.<br />
»24. Oktober 1929 – Eröffnung des zweiten Congrès Internationaux<br />
d’Architecture Moderne, C IAM, in Frankfurt«<br />
Text: [o. A.], smow Blog, [o. J.]<br />
»›Das Problem der Errichtung von Wohnungen zu tragbaren Mieten<br />
für die mindestbemittelte Schicht der Bevölkerung steht heute im Vordergrund<br />
des Interesses in fast allen zivilisierten Ländern‹. Mit diesen<br />
Worten lud der ›Congrès Internationaux d’Architecture Moderne‹, kurz<br />
CIAM, zu seinem zweiten Kongress, einem dreitägigen Event ein, das am<br />
Donnerstag, den 24. Oktober 1929, im Palmengarten Frankfurt am Main<br />
begann, und bei dem einige der führenden Vertreter der Architektur aus<br />
der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen nach potenziellen Lösungen<br />
für dieses so drängende Problem suchten. Der Erfolg des Frankfurter<br />
Kongresses wird besonders deutlich, wenn man sieht, welche Bedeutung<br />
eine Einladung heutzutage hat.«<br />
»Auch wenn das Vorhaben, einen zweiten Kongress in Frankfurt abzuhalten,<br />
bereits in La Sarraz beschlossen wurde, wurde der Ort erst durch<br />
FARKAS MOLNÁR M 123
Design of the <strong>Bauhaus</strong> signet »Sternenmännchen«. Karl Peter Röhl, 1919.<br />
»Sternenmännchen 1919«<br />
Text: Kerstin Eckstein, <strong>Bauhaus</strong>-Ideen 1919–1994, 1994<br />
»Das erste offizielle, von Peter Röhl entworfene Signet des <strong>Bauhaus</strong>es<br />
veranschaulicht die Ideale Ittens treffend. Es ist der Ausdruck für den nach<br />
innerer Harmonie mit sich und seiner Umwelt strebenden Menschen. Alle<br />
in diesem Signet verwendeten Symbole drücken gleichermaßen Vollkommenheit,<br />
Einheit und Absolutheit aus: Der immer wieder in sich selbst zurückkehrende<br />
Kreis als Grundform; die zur Harmonie zusammengeführten<br />
Hälften des Kopfes als Zeichen der polaren Kräfte Yin und Yang, die<br />
das weibliche und männliche Prinzip darstellen; die durch Kopf und Arme<br />
gestützte Pyramide als Zeugnis einer neuen Architektur, die durch die<br />
Form eines gleichschenkligen Dreiecks Ausgewogenheit verkörpert; und<br />
schließlich die Swastika als Symbol des Sonnenrades, die im buddhistischen<br />
Glauben als Schlüssel zum Paradies gilt.«<br />
G »Inszenierung einer Utopie. Zur Selbstdarstellung des <strong>Bauhaus</strong>es in<br />
den zwanziger Jahren« (Eckstein 1994, 18). In: <strong>Bauhaus</strong>-Ideen 1919–<br />
1994. Bibliografie und Beiträge zur Rezep tion des <strong>Bauhaus</strong>gedankens<br />
(Biundo, et al. 1994).<br />
Holzschnitte. Er selber war ein grosses Mass alles dessen, was er machte.<br />
Er wurde mit der Erde fett und mager. Sein Kopf nahm mit dem Monde<br />
zu. Kosmisch war der Peter. Kein Künstler. Das Licht quoll in ihm über. Es<br />
kreisten wirklich über ihn die Drachen. Er sang. In ihm lebten Vögel. Er<br />
war selbst gefiedert. Süss für alle Kinder. Zucker für die Mädchen. Künstler<br />
waren Molzahn, Herrmann, Bildhauer, Maler. Sie gingen immer<br />
schwanger. Sie gebaren. Bei jeder Geburt ging Her[r]mann beinah drauf.<br />
Er war still, verschlossen. Ihn zu sehen, war erschütternd. Ich sah die<br />
Menschen vor ihm beiseitetreten. Sie machten Platz. Unwillkürlich. Verschlossen<br />
war sein Leben und ein Wunder. Er litt. Der Christus, den er<br />
aus dem Holze schnitzte, das war sein Leiden, seine Liebe. […] Molzahn<br />
aber war der Mensch, in dem sich Röhl und Her[r]mann fanden, offenbarten.<br />
Wir schwankten lange, das zuzugeben. Aber es war nicht äusserlich,<br />
daß sich alle jeden Abend im Atelier von Molzahn in Weimar trafen, dort<br />
wo ich sie sah.‹ 60«<br />
60 »Hugo Hertwig, unpublizierte Tagebuchaufzeichnung aus dem Nachlaß.«<br />
G NO ID https://books.google.de/books?id=lX5dDwAAQBAJ&pg=PA133<br />
&lpg=PA133&dq=auriga+verlag+molzahn&source=bl&ots=5OJCULVLo2&<br />
sig=ACfU3U0fURSF0ufc8uS1FHLhfbMfBOJ58g&hl=de&sa=X&ved=2ahU<br />
KEwietYzi0fPgAhXPy6YKHS28AmkQ6AEwAHoECAMQAQ#v=snippet&q<br />
=rosenh%C3%B6he&f=false In: Der Folkwang Verlag – Auf dem Weg zu<br />
einem imaginären Museum (Stamm 1999, 53).<br />
»The <strong>Bauhaus</strong> Idea and <strong>Bauhaus</strong> Politics«<br />
Text: Éva Forgács, <strong>Bauhaus</strong>, 1991<br />
»The young people who had recently entered the <strong>Bauhaus</strong> — Karl Peter<br />
Röhl, Werner Graeff, Walter Dexel, Kurt Schmidt, Helmuth von Erffa and<br />
others — were in search of a philosophy of life just like their slightly older<br />
fellow students, but had not yet come to accept Itten’s teachings, or else<br />
were immune to them. So they, as well as others not enrolled at the <strong>Bauhaus</strong>,<br />
found a treasure trove in van Doesburg’s lectures, with their consistent,<br />
simple and incontrovertible insistence on order and harmony, heralding<br />
the coming of a new style based on modern mechanization, composed<br />
of horizontal-vertical coordinates. The masters at the <strong>Bauhaus</strong><br />
looked on at Doesburg’s activities in Weimar with growing disapproval.«<br />
[Translated by John Bátki, 1995]<br />
G ID 1757-112 https://epdf.tips/the-bauhaus-idea-and-bauhaus-poli<br />
tics.html (Retrieved 21.09.2019).<br />
»De Stijl-Kurs«<br />
Text: Gerda Breuer, Werner Graeff 1901–1978, 2010<br />
»Namen-Liste für den ersten Stijl-Kursus in Weimar durch Theo van<br />
Doesburg, Kursuszeit März – Juli. Mittwochabends von 7 bis 9 Uhr.«<br />
»Peter Röhl. Buchfahrtstr.«<br />
G In: Werner Graeff 1901–1978. Der Künstleringenieur (Breuer 2010, 39).<br />
»The <strong>Bauhaus</strong> Wall Painting Workshop: Mural Painting to Wallpapering,<br />
Art to Product«<br />
Text: Morgan Ridler, City University of New York, 2016<br />
p. 53 »Röhl is a not well known Bauhäusler; his stay at the school was brief,<br />
having left in 1922, but he continued to exuberantly support the school<br />
throughout his lifetime.«<br />
G NO ID https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=<br />
1675&context=gc_etds (Retrieved 22.09.2019).<br />
»Buchkünstlerische Arbeiten: Johannes Karl Herrmann«<br />
Text: Rainer Stamm, Der Folkwang Verlag, 1999<br />
S. 53 »Zitat von Hugo Hertwig über Karl Peter Röhl: ›Durch Johannes<br />
Auerbach lernte ich in Weimar Peter Röhl, Karl Herrmann, Johannes Molzahn<br />
kennen. Das waren in Deutschland die jüngsten und besten Künstler.<br />
Toll war der Peter immer. Der Ziegenbock war sein Symbol. Der Himmel<br />
lachte, wenn er sprach, er machte wirklich gutes Wetter. Es war der<br />
ganze Kerl ein rotes Wunder. Es liebten ihn die Kinder, weil er fliegen<br />
konnte mit den Drachen. Mit den dynamischen Kräften der Erde stand er<br />
im Kontakt. Wo ich ihn sah, auf der Strasse, im Atelier, da wirbelte der<br />
Staub. Da wuchs die Welt, der Körper. Immer war er besoffen, überfressen.<br />
Immer selig. In ihm rauschten seine Farben, seine Bilder, seine<br />
»Freitreppe« (Staircase) at the Neues Museum Weimar, 2019.<br />
»Der Internationale Kongress der Konstruktivisten und Dadaisten«<br />
Text: Gerda Wendermann, Europa in Weimar, 2008<br />
Abb. 1 »Die Teilnehmer des Kongresses auf der Freitreppe des Landesmuseums<br />
in Weimar, 25./26. September 1922. V. l. n. r.: obere Reihe: Max und<br />
Lotte Burchartz, Karl Peter Röhl, Hans Vogel, Lucia und László Moholy<br />
Nagy, Alfréd Kemény; mittlere Reihe: Alexa Röhl, El Lissitzky, Nelly und<br />
Theo van Doesburg, Bernhard Sturtzkopf; untere Reihe: Werner Graeff,<br />
Nini Smith, Harry Scheibe, Cornelis van Eesteren, Hans Richter, Tristan<br />
Tzara, Hans Arp. KPRS, Weimar«.<br />
144 R KARL PETER RÖHL
G NO ID www.klassik-stiftung.de/uploads/tx_lombkswdigitaldocs/<br />
Jahrbuch_2008_Wendermann.pdf (Abgerufen 07.03.2019). »Der Internationale<br />
Kongress der Konstruktivisten und Dadaisten in Weimar im<br />
September 1922. Versuch einer Chronologie der Ereignisse« (Wendermann<br />
2008, 375–398). In: Europa in Weimar. Visionen eines Kontinents.<br />
Jahrbuch der Klassik Stiftung Weimar (Seemann 2008).<br />
»Karl Peter Röhl, Reklame, 1923«<br />
Text: [o. A.], Kunstmarkt Media, [o. J.]<br />
»In der strengen Formalität des Weimarer De Stijl angelegter Reklameentwurf<br />
mit frei gemalten und sich zueinander in exemplarischer Farbspannung<br />
befindenden Flächen sowie einer per Schablone aquarellierten<br />
Typographie. – Auf leicht getöntem, glattem Papier. […] Ehemals: Sammlung<br />
Max Burchartz, Essen.«<br />
»Schätzpreis: 5.000,– Euro«.<br />
G NO ID www.kunstmarkt.com/pagesprz/kunst/_d287363-/show_<br />
praesenz.html?_q=%20 (Abgerufen 21.09.2019).<br />
»Das <strong>Bauhaus</strong> in Frankfurt – eine Spurensuche«<br />
Text: Stefan Beuttler, Alles neu!, 2016<br />
»Einzelne Meister des <strong>Bauhaus</strong>es konnte [Fritz] Wichert für Frankfurt<br />
gewinnen. 1925 übernahm Christian Dell, 1922 bis 1925 Werkmeister der<br />
Metallwerkstatt des <strong>Bauhaus</strong>es, die Leitung der Frankfurter Metall-<br />
Werkstatt und Josef Hartwig wurde Fachlehrer der Bildhauerei-Klasse<br />
von Richard Scheibe […]. Ab 1926 leitete Adolf Meyer die Hochbauklasse<br />
an der Kunstschule. Karl Peter Röhl bekam einen Lehrauftrag für die<br />
Grundlehre, wurde Leiter einer der beiden Vorklassen und unterrichtete<br />
Naturstudien und farbige Gestaltung in der Hochbauklasse. Somit lehrten<br />
an der Kunstschule vier ehemalige Bauhäusler, drei davon, Meyer,<br />
Hartwig, Röhl, waren stark in die grafische Erscheinung des ›Neuen<br />
Frankfurt‹ involviert.«<br />
»Unabhängig entwarf er ein Zeichensystem zur Signalisierung aller<br />
medizinischen Einrichtungen in Frankfurt, das 1926 in der Zeitschrift<br />
›das neue frankfurt‹ veröffentlicht wurde.« 13<br />
13 »Ebenda [Vgl. Eckhard Neumann, <strong>Bauhaus</strong> und Bauhäusler, Köln<br />
1985, S. 96].«<br />
G »Das <strong>Bauhaus</strong> in Frankfurt – eine Spurensuche« (Beuttler 2016, 146,<br />
148f). In: Alles neu! 100 Jahre Typografie und Neue Grafik in Frankfurt<br />
am Main (Klemp, Wagner K 2016).<br />
»Lehren und lernen«<br />
Text: [o. A.], Rhein-Main.Eurokunst.com, 17.01.2019<br />
»Adolf Meyer, Josef Hartwig, Karl Peter Röhl und Christian Dell wechselten<br />
vom Weimarer <strong>Bauhaus</strong> nach Frankfurt und arbeiteten am Main<br />
für das moderne Lehrkonzept.«<br />
[Ausstellung: Moderne am Main 1919–1933, MAK Museum Angewandte<br />
Kunst, Frankfurt am Main, 2019]<br />
G ID 1757-1162 http://rhein-main.eurokunst.com/category/bauhaus<br />
(Abgerufen 11.07.2019).<br />
Advertisement for »<strong>Bauhaus</strong>-Abende« (<strong>Bauhaus</strong> evening events), Weimar.<br />
Karl Peter Röhl, 1920s.<br />
»Werbeblatt <strong>Bauhaus</strong>-Abende – von Röhl oder Meyer?«<br />
Text: Michael Siebenbrodt, bauhaus imaginista, [o. J.]<br />
»Karl Peter Röhl, <strong>Bauhaus</strong>-Abende, Linolschnitt, 1929, <strong>Bauhaus</strong>-Archiv<br />
Berlin.«<br />
G NO ID www.bauhaus-imaginista.org/articles/2241/bauhaus-weimar-<br />
international (Abgerufen 22.09.2019). In: <strong>Bauhaus</strong> Weimar International<br />
Visionen und Projekte 1919–1925 (Siebenbrodt o. J.).<br />
»Werbeblatt <strong>Bauhaus</strong>-Abende – von Röhl oder Meyer?«<br />
Text: Karl Peter Röhl, Karl Peter Röhl. <strong>Bauhaus</strong> Weimar, 1975<br />
»Werbeblatt für die <strong>Bauhaus</strong>-Abende, 1920 – von Peter Röhl«<br />
G NO ID www.zvab.com/buch-suchen/titel/karl-peter-r%F6hl/buch<br />
(Abgerufen 04.11.2019). In: Karl Peter Röhl. <strong>Bauhaus</strong> Weimar. (Gmurzynska<br />
1975, 10).<br />
»Werbeblatt <strong>Bauhaus</strong>-Abende – von Röhl oder Meyer?«<br />
Text: [o. A.], Ketterer Kunst, 27.05.2019<br />
»<strong>Bauhaus</strong>abende. Einladung zur fortlaufenden Folge von Vortragsaben<br />
den. [Weimar 1921] [eckige Klammern im Originaltext]. Orig.-Heft<br />
(auf Karton montiert) mit typographischem Holzschnitt-Umschlag von<br />
Peter Röhl. 23 : 15 cm. Bayer/Herzogenrath 295. Sehr selten.«<br />
G NO ID www.kettererkunst.com/details-e.php?obnr=418001237&a<br />
nummer=482&detail=1 (Abgerufen 22.09.2019).<br />
»Weiterwirken der <strong>Bauhaus</strong>-Pädagogik. Aspekte und Fragmente«<br />
Text: Ekkehard Mai, <strong>Bauhaus</strong>-Moderne im Nationalsozialismus, 1993<br />
»Und dann gab es den ›Fall des Fachlehrers Karl-Peter Röhl, der, mit<br />
rotem Schal vom <strong>Bauhaus</strong> kommend, sich und andere für Avantgardismus<br />
und antifaschistische Aktion begeistert, nachher mit gleichem Enthusiasmus<br />
fürs »Völkische« ist. Er engagiert sich im NS-Studentenbund‹ – so<br />
Günter Bock über die Städel-Schule im Dritten Reich. 24 Dennoch sorgte<br />
das Selbstverständnis Frankfurts als Freie Reichsstadt für Berufungen<br />
und Besetzungen bis 1943, ›die ein Maximum an Freiheit mit einem Minimum<br />
an Konflikt verband‹. Der Bürgermeister, Dr. Krebs, ließ sogar den<br />
Namen Städels wieder aufleben – ›Städtel‹ aus dem Jiddischen vielleicht<br />
und damit Herkunftsbezeugung des alten Stifters? Tatsache ist, daß in<br />
Frankfurt jedenfalls auch der Antinazi Delavilla und der Bauhäusler Josef<br />
Hardtwig an der Städelschule überlebten.«<br />
24 »Städelschule Frankfurt am Main, S. 103« [Anm. 5: Städelschule Frankfurt<br />
am Main. Aus der Geschichte einer deutschen Kunsthochschule, hrsg.<br />
vom Verein der Freunde der Städelschule e. V., Frankfurt a. M. 1982].<br />
G ID 1757-730 https://epdf.tips/bauhaus-moderne-im-nationalsozial<br />
ismus-zwischen-anbiederung-und-verfolgung.html (Abgerufen 18.05.<br />
2019) »Weiterwirken der <strong>Bauhaus</strong>-Pädagogik Aspek te und Fragmente«<br />
(Mai 1993, 199). In: <strong>Bauhaus</strong>-Moderne im National sozialismus:<br />
Zwischen Anbiederung und Verfolgung (Nerdinger 1993b).<br />
»Frankfurt a. M. 1926–1928: Letzte Konstruktivistische Arbeiten«<br />
Text: Constanze Hofstaetter, Karl Peter Röhl und die Moderne, 2007<br />
»Innerhalb des Lehrerkollegiums [an der Frankfurter Kunstschule]<br />
verband Röhl – neben der engen Freundschaft mit Meyer – ein freund<br />
KARL PETER RÖHL R 145
»Fritz Schleifer – Architekt im Abseits«<br />
Text: Ulrich Höhns, Bauwelt, 1988<br />
»Schleifer hatte seine Ausbildung auf Anregung des Feininger-Schülers<br />
Karl Großberg 1922 am <strong>Bauhaus</strong> in Weimar begonnen und besuchte dort<br />
zwei Jahre die Vorklasse für Bildhauerei und Wandmalerei bei Kandinsky,<br />
hatte Kontakt zu Gropius, Feininger, Klee, Schlemmer, Itten, Schreyer<br />
und Moholy-Nagy.«<br />
»Sein wichtigster Erfolg dieser Jahre [1929] ist der 1. Ankauf für den Beitrag<br />
zum Wettbewerb der Telefonfabrik Fuld in Frankfurt, an dem sich<br />
über 900 Architekten beteiligen. Obwohl nicht gebaut, wird diese Arbeit<br />
prägend für Schleifers architektonisches Verständnis, ihre Ablehnung<br />
und Anerkennung beschäftigen ihn bis in die Nachkriegszeit. Dem Preisgericht<br />
unter dem Vorsitz von Ernst May gehört auch Walter Gropius an.<br />
Der ›Baumeister‹ vermutet eine einseitige Bevorzugung modernistischer<br />
Entwürfe. Für ihn fällt Schleifer vollkommen aus dem Rahmen. Trotz der<br />
›guten architektonischen Haltung‹ – so das Preisgericht – führt er diesen<br />
Entwurf in diffamierender Absicht als ein abschreckendes Beispiel falscher<br />
Baugesinnung vor. ›<strong>Bauhaus</strong>-Moskau-Graphik‹ und ›Sowjetgraphik‹<br />
habe das offenbar voreingenommene Preisgericht so geblendet, ›daß die<br />
sachlichen Fehler durch dieses Wohlgefallen wettgemacht sind‹ 3«.<br />
3 »Der Baumeister 1930, Heft 4, S. 133.«<br />
[Schleifer, Fritz / Nachrufe (Nekrologe) Bauwelt_25_1988_S_1088_1090.pdf]<br />
G NO ID www.hamburgerpersoenlichkeiten.de/hamburgerpersoenlich<br />
keiten/login/person.asp + NO ID www.hamburgerpersoenlichkeiten.de/<br />
hamburgerpersoenlichkeiten/member_file_uploads/helper.asp?id=3594<br />
(Abgerufen 23.09.2019). In: Bauwelt 1988, Heft 25, S. 1088–1090.<br />
»<strong>Bauhaus</strong>-Architekten im ›Dritten Reich‹«<br />
Text: Winfried Nerdinger, <strong>Bauhaus</strong>-Moderne im Nationalsozialismus, 1993<br />
»Mit Kriegsbeginn wurden einige Bauhäusler wie Egon Hüttmann, Fritz<br />
Schleifer oder das Parteimitglied Hans Georg Knoblauch Bauleiter und Architekten<br />
für ›Industriebauten‹, d. h. Rüstungseinrichtungen bei Luftwaffe<br />
und Wehrmacht. Ihre Tätigkeit ist heute kaum mehr zu rekonstruieren,<br />
da sie – wenn überhaupt – später nur vage Angaben dazu machten.«<br />
G ID 1230-800 https://epdf.tips/bauhaus-moderne-im-nationalsozialis<br />
mus-zwischen-anbiederung-und-verfolgung.html (Abgerufen 23.09.<br />
2019). »<strong>Bauhaus</strong>-Architekten im ›Dritten Reich‹« (Nerdinger 1993a,<br />
170ff). In: <strong>Bauhaus</strong>-Moderne im Nationalsozialismus. Zwischen Anbiederung<br />
und Verfolgung (Nerdinger 1993b).<br />
»Blue Pencil no. 8 — <strong>Bauhaus</strong> 1919–1933: Workshops for Modernity«<br />
Text: Paul Shaw, Blue Pencil Blog, 13.02.2010<br />
»The recent <strong>Bauhaus</strong> 1919–1933: Workshops for Modernity exhibition at<br />
the Museum of Modern Art included the two iconic posters by Joost<br />
Schmidt and Fritz Schleifer done for the seminal 1923 <strong>Bauhaus</strong> exhibition.<br />
It was good to see them in the flesh rather than as reproductions. They<br />
make a terrific pairing: Schmidt’s showing the influence of El Lissitsky and<br />
Schleifer’s showing the influence of Theo van Doesburg. Russian Constructivism<br />
on one hand and Dutch De Stijl on the other.«<br />
G ID 1230-209 http://paulshawletterdesign.blogspot.com/2010/02<br />
(Retrieved 23.09.2019).<br />
»Lajos Kassák, der Buch- und Werbegestalter«<br />
Text: Ferenc Csaplár, Lajos Kassák, 1999<br />
»Der Buchstabentyp mit durchweg gleicher Linienstärke, mit seiner<br />
Fundiertheit im Quadrat und im Rechteck und gerade deswegen seiner<br />
Geltung als letztendliche Variante der geometrischen Abstraktion gelangte<br />
durch Doesburgs Übersiedlung nach Weimar in den Umkreis des<br />
<strong>Bauhaus</strong>es. Der Buchstabenkreation begegnen wir auf Egon Engelins<br />
Plakatentwurf für die Kölner Messe (1922) 22 sowie in mehreren Druckerzeugnissen<br />
der von August bis September 1923 veranstalteten <strong>Bauhaus</strong><br />
Ausstellung: auf Fritz Schleifers Plakat, Joost Schmidts Reklameblatt<br />
und Paul Häberers Postkarte. 23«<br />
22 »Egon Engelin: Plakatentwurf, 1922. In: <strong>Bauhaus</strong> Utopien. Herausgegeben<br />
von Wulf Herzogenrath. Köln 1988, S. 61. Der Plakatentwurf erschien<br />
auch in der Ma, 9. Jg. Nr. 2 (15. Nov. 1923) S. 112«<br />
23 »Fritz Schleifer: Plakat der <strong>Bauhaus</strong>-Ausstellung Weimar 1923. In:<br />
<strong>Bauhaus</strong>-Utopien, S. 105.: Joost Schmidt: <strong>Bauhaus</strong>-Ausstellung. Weimar<br />
1923. In: Typographie wann wer wie. Herausgegeben von Friedrich<br />
Friedl, Nicolaus Ott, Bernhard Stein. Köln, 1998, S. 48; Paul Häberer: <strong>Bauhaus</strong>-Ausstellung<br />
Weimar 1923. [Ansichtskarte] Kassák Museum, Inv. Nr.<br />
KM-86.H«.<br />
G ID 1230-887 https://docplayer.org/50994741-Lajos-kassak-reklame-<br />
und-moderne-typografie.html (Abgerufen 23.09.2019). In: Lajos Kassák.<br />
Reklame und Moderne Typografie (Csaplár 1999b, 68).<br />
Oskar Schlemmer<br />
Meister Master<br />
Schoppe, Walter (Pseudonym)<br />
* 04.09.1888, Stuttgart (de) † 13.04.1943, Baden-Baden (de)<br />
»Themenschwerpunkte der <strong>Bauhaus</strong>rezeption von 1919 bis 1991«<br />
Text: [o. A.], bauhaus medial, 1992<br />
»Darstellungen dieser Art können aufgrund ihrer Kürze zwangsläufig<br />
immer nur lückenhaft bleiben. Dennoch: Die Institution <strong>Bauhaus</strong> erfuhr<br />
im Verlauf ihres Bestehens bekanntlich mehrfach richtungsweisende Paradigmenwechsel.<br />
An der Selbstdarstellung des <strong>Bauhaus</strong>es, die sich beispielsweise<br />
und besonders nach 1923 in Reklame, Typografie, Fotografie<br />
und Film manifestierte und entwickelte, lassen sich posthum jene Veränderungen<br />
beschreiben. Kerstin Eckstein analysiert in ihrem Aufsatz<br />
›Zwei Signets: Imagepflege und Stilverständnis am <strong>Bauhaus</strong>‹ das Signet<br />
von Peter Röhl, das von 1919 bis 1923 noch inoffizielles ›Markenzeichen‹<br />
war, während das Signet von Oskar Schlemmer nach 1923 das offizielle<br />
Diktum des <strong>Bauhaus</strong>es repräsentierte. Schlemmers stark reduziertes<br />
menschliches Profil wird in der Rezeption im Nachhinein als funktionalistisch<br />
bezeichnet, wobei natürlich der Begriff des Funktionalismus kein<br />
<strong>Bauhaus</strong>genuiner Ausdruck ist. Dieses Image, das sich an den Personen<br />
Gropius und Moholy-Nagy festmachen ließ, prägt fortan die <strong>Bauhaus</strong>-<br />
Rezeption bis zum heutigen Tag. Generell sind alle schwerpunktbildenden<br />
Tendenzen, die sich in der <strong>Bauhaus</strong>-Rezeption der Nachkriegsjahre<br />
aufspüren ließen, bereits in den 20er Jahren am <strong>Bauhaus</strong> als Idee, Konzept<br />
oder Problem formuliert worden.«<br />
[Wissenschaftliches Kolloquium vom 18. bis 21. Juni 1992 in Weimar an<br />
der Hochschule für Architektur und Bauwesen zum Thema: »Architektur<br />
und Macht«]<br />
G NO ID https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/frontdoor/deliver/index/<br />
docId/1115/file/<strong>Bauhaus</strong>_Medial_pdfa.pdf (Abgerufen 23.07.2019). »Zur<br />
Rezeption des <strong>Bauhaus</strong>es zwischen 1919–1991« (bauhaus-medial 1992).<br />
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und<br />
Bauwesen Weimar (1992).<br />
Design of the »<strong>Bauhaus</strong> Signet«. Oskar Schlemmer, 1922.<br />
»Zweite <strong>Bauhaus</strong>-Signet (Schlemmerkopf )«<br />
Text: Kerstin Eckstein, Inszenierung einer Utopie, 1994<br />
»In Schlemmers Signet sind die eingesetzten Mittel von äußerster Sparsamkeit;<br />
rein geometrische Formen bestimmen sein Aussehen. Zwar bildet<br />
auch hier der Mensch, genauer ein menschliches Profil, den Mittelpunkt,<br />
dies allerdings in einer sehr stilisierten Form. Der einfassende<br />
Schriftzug ›Staatliches <strong>Bauhaus</strong> Weimar‹ weist, anders als bei Röhl, keinerlei<br />
Berührung zum Dargestellten innerhalb des Kreises auf […].«<br />
G In: Inszenierung einer Utopie – Zur Selbstdastellung des <strong>Bauhaus</strong>es<br />
in den zwanziger Jahren (Eckstein 1994, 20f).<br />
150 S FRITZ SCHLEIFER
»Die Brückenweihe 1926«<br />
Text: [n/a], MAK Museum Applied Art, 2019<br />
»The Dedication of the New Bridge, 1926. After many years of construction,<br />
in the middle of August 1926 the moment had finally came: the new<br />
Alte Brücke and the redesigned riverfront were opened to the public in a<br />
three-day celebration. The previous bridge had to give way because the<br />
bridge arches had become too narrow for the developed shipping on the<br />
river Main and the lanes had become insufficient for the increasing motor<br />
traffic.<br />
After a solemn opening ceremony, a public festival was held for the city’s<br />
residents, featuring a large ship parade on the Main and a bridge revue<br />
staged at the fair’s festival hall. The bridge revue was an adaptation of<br />
Oskar Schlemmer’s Triadisches Ballett (Triadic Ballet) — the most avantgarde<br />
part of this major event.«<br />
[MAK Exhibition Text]<br />
G In Exhibiton: Moderne am Main 1919–1933, MAK Museum Applied<br />
Art, Frankfurt am Main, 2019.<br />
G »Moderne veröffentlichen« (Weber, Sellmann 2019, 236). In: Moderne<br />
am Main 1919–1933 (Klemp, Sellmann, et al. 2019b).<br />
»Theater-Figurinen im Stil eines Comic-Strips«<br />
Text: Patrick Rössler, Vielfalt in der Gleichschaltung, 2007<br />
»Vom Ex-<strong>Bauhaus</strong>meister Oskar Schlemmer selbst sind in der ›neuen<br />
linie‹ vier beschwingte Theater-Figurinen im Stil eines Comic-Strips abgedruckt,<br />
allerdings unter seinem Pseudonym ›Walter Schoppe‹ (einer<br />
Figur aus ›Titan‹ von Jean Paul). Es handelt sich dabei um Entwurfsskizzen<br />
für sein ›Komisches Ballett‹, für das er – als ironischer Ausdruck seiner<br />
absurden Lage im Hitler-Deutschland – als Einmann-Clown ›Mister<br />
Ey‹ mit einem Koffer durch die Lande ziehen wollte. 206«<br />
206 »Vgl. Karin von Maur: Oskar Schlemmer. Stuttgart: Württembergischer<br />
Kunstverein 1977, S. 204 und Kat.-Nr. 606–608; dort fehlt der Hinweis<br />
auf das 2. Blatt (›Herr Ey betreibt Schönheitspflege‹). Die Zeichnungen<br />
sind abgebildet in: Die neue Linie (9) Nr. 2, Oktober 1937, S. 9 / Nr. 3,<br />
November 1937, S. 8 / Nr. 4, Dezember 1937, S. 6 / Nr. 7, März 1938, S. 53.<br />
Ich danke Frau Karin von Maur herzlich für diesen wichtigen Hinweis.«<br />
G NO ID www.steiner-verlag.de/uploads/media/JBKG_2007_9_150-15_<br />
Roessler.pdf (Abgerufen 23.07.2019). »Vielfalt in der Gleichschaltung –<br />
die ›domestizierte Moderne‹ am Kiosk: Eine Lifestyle-Illustrierte<br />
zwischen <strong>Bauhaus</strong>-Avantgarde und NS-Propaganda: ›die neue linie‹<br />
1929–1943« (Rössler 2007a, 174). In: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte<br />
9 (Rössler 2007b, 150–195).<br />
»Theater der Klänge – Das Lackballett. Eine faszinierende intermediale<br />
Tanz-Produktion und Kunst-Performance nach Oskar Schlemmers<br />
Bühnenwerk«<br />
Text: [o. A.], Kulturverein Darmstädter Residenzfestspiele, 2019<br />
»Grundlage dieser Produktion ist das 1941 vom <strong>Bauhaus</strong>-Meister Oskar<br />
Schlemmer entwickelte Bühnenwerk, das anlässlich 100 Jahre <strong>Bauhaus</strong><br />
wieder aufgegriffen wird und die von Oskar Schlemmer entworfenen und<br />
realisierten Figurinen neu interpretiert. Dabei wird das Thema Lack in<br />
seiner Material- und Farbinterpretation 77 Jahre nach der Erstaufführung<br />
unter Mitwirkung von sechs Tänzerinnen und Tänzern choreographiert<br />
und mit den heutigen technischen Möglichkeiten umgesetzt.<br />
Die Umsetzung der Themen Farben, Klänge und Tanz in Verbindung<br />
mit dem Motto des Festivals ›Klangfarben‹ und dem Jugendstilensemble<br />
auf der Mathildenhöhe macht diese Kunst- und Tanz-Performance zu<br />
einem besonderen Erlebnis der Residenzfestspiele.«<br />
[Theater: Mathildenhöhe (Open Air), 04.08.2019]<br />
G NO ID https://residenzfestspiele.de/index.php/de/programm/<br />
programm-2019 (Abgerufen 23.09.2019).<br />
Cover design of <strong>Bauhaus</strong>bücher 4, »die Bühne im <strong>Bauhaus</strong>«. Oskar Schlemmer, 1925.<br />
»Das <strong>Bauhaus</strong> in Frankfurt«<br />
Text: Klaus Klemp, Grit Weber, Moderne am Main 1919–1933, 2019<br />
»Zur Einweihung des Neubaus der Alten Mainbrücke erhielt Oskar<br />
Schlemmer die Einladung, eine ›große Brückenrevue‹ mit Kostümen aus<br />
dem Triadischen Ballett zu inszenieren, die dann auch vom 15. bis zum<br />
18. August 1926 in der Festhalle stattfand. Auch das aufwendige Plakat<br />
zur ›Brückenrevue‹ stammt von Schlemmer.«<br />
»Schlemmer hielt sich vom 18. bis 22. April 1929 anlässlich eines Vortrags<br />
und der Aufführung der <strong>Bauhaus</strong>-Bühne in Frankfurt auf. Einen<br />
zweiten Besuch stattete er Willi Baumeister im März 1933 ab.«<br />
G »Netzwerke und Gesellschaften gründen« (Klemp, Weber 2019, 74).<br />
In: Moderne am Main 1919–1933 (Klemp, Sellmann, et al. 2019).<br />
»Brückenweihe 1926«<br />
Text: Grit Weber, Annika Sellmann, Moderne am Main 1919–1933, 2019<br />
»Betrachtet man die typografischen und gestalterischen Umsetzungen<br />
diverser Einladungen, Eintrittskarten und Programmankündigungen, ergibt<br />
sich ein sehr disparates Bild, was nicht wundert, wurde doch eine<br />
durchgängige und gerade für Akzidenzien konzeptuell fundierte Corporate<br />
Identity erst in den 1950er Jahren entwickelt.«<br />
»Oskar-Schlemmer-Straße«. Fulda, 2018.<br />
OSKAR SCHLEMMER S 151
Dan Reynolds<br />
Hessen Typefaces and <strong>Bauhaus</strong> Lettering:<br />
Typo graphic Equals or Worlds Apart?<br />
Introduction<br />
2019 marks the centenary of the founding of the <strong>Bauhaus</strong>,<br />
generally acknowledged as being the most signific ant<br />
centre of art and design education in Germany during the<br />
1920s and 1930s. Present-day articles, both in scholarly<br />
journals and the popular press, as well as museum exhi b<br />
itions celebrating this milestone, reinforce its cultural importance.<br />
For graphic designers and design students, the<br />
<strong>Bauhaus</strong>’ style is often synonymous with the new geometric<br />
sans serif typefaces developed in the 1920s, even<br />
though the <strong>Bauhaus</strong> did not use a unified style for all printed<br />
materials produced over the school’s fourteen-year<br />
history. Despite the Bauhäusler having not typically designed<br />
typefaces while at the school, a number of lettering<br />
experiments made there that employed sans serif<br />
styles are well known today and have planted the use of<br />
sans serifs firmly in the imagination of graphic designers.<br />
Figure 1: This design of Herbert Bayer later became known as his Universal<br />
Alphabet. Reproduced from Offset — Buch und Werbekunst (7,<br />
1926), p. 399, courtesy of Mathieu Lommen, University of Amsterdam<br />
Library. © 2019 VG Bild-Kunst, Bonn 2019.<br />
While the <strong>Bauhaus</strong>’ significance in many areas cannot be<br />
denied, the emphasis placed on typography is arguably<br />
lesser than may be presumed.1 The sans serif type faces<br />
commonly associated with <strong>Bauhaus</strong> design were not, in<br />
fact, products of the school in Weimar or Dessau but<br />
rather of type foundries in present-day Hessen. Be tween<br />
about 1919 and 1939, the manufacture of printing types<br />
in Germany was at its industrial peak.2 Its type foundries<br />
sold to printers all over the world, and several typefaces<br />
from this time are still used today. In particu lar, Bauer<br />
Bodoni, Futura, Kabel, Neuland, Stempel Gara mond, and<br />
Weiß-Antiqua all remain common choices among graphic<br />
designers. The most successful of the geo metric sans<br />
serif typefaces published during the time the <strong>Bauhaus</strong><br />
was open was the Bauer Type Foundry’s Futura, designed<br />
by Paul Renner. When trying to reconstruct the development<br />
processes behind Futura and other geo met ric sans<br />
serif »Hessen-Typefaces« like it, we are likely to stumble<br />
upon more questions than answers. This article examines<br />
the origins of Futura, in parallel with develop ments<br />
happening at the <strong>Bauhaus</strong> around the same time — from<br />
a letter-making perspective — to see what influence, if<br />
any, the school may have had on the typeface, and whether<br />
its reputation for innovation in letterform design is<br />
indeed merited.<br />
Futura and two <strong>Bauhaus</strong> lettering projects from 1926<br />
The <strong>Bauhaus</strong> serves as a starting point for many invest igations<br />
into the history of geometric sans serifs because of<br />
the experiments in style that were undertaken there. Typemaking<br />
was still an industrial activity in the 1920s/30s.<br />
Fonts were produced, sold, and distributed by large companies<br />
with hundreds of employees working in factory<br />
settings. The <strong>Bauhaus</strong>, however, did not have the facili ties<br />
Figure 2: Josef Albers’s Schablonenschrift (Stencil Alphabet). Reproduced<br />
from Offset – Buch und Werbekunst (7, 1926), n.p., courtesy of Mathieu<br />
Lommen, University of Amsterdam Library. © 2019 The Josef and Anni<br />
Albers Foundation.<br />
to accommodate this sort of activity, and it did not develop<br />
partnerships with any type foundries. Aside from<br />
the vertical »BAUHAUS« lettering on the façade of its<br />
building in Dessau, the most famous letterforms designed<br />
at the school are likely alphabets presented in the German<br />
printing magazine Offset, designed by Josef Albers<br />
and Herbert Bayer in a special <strong>Bauhaus</strong> edition.3 This<br />
1926 issue, designed by Bauhäusler, in cluded a school<br />
overview from Walter Gropius, László Moholy-Nagy’s arti<br />
cle on contemporary typography, a piece by Gunta Stölzl<br />
about the <strong>Bauhaus</strong> weaving studio, another by Oskar<br />
Schlemmer about work for the school’s stage, and articles<br />
on letterform design by Albers and Bayer.<br />
In the same issue, Bayer presented the first published ver <br />
sion of a design usually referred to as the Univer sal Alpha<br />
bet (Fig. 1): something with which conceiv ably everyth<br />
ing in the future could be printed. This was drawn in a<br />
mod ernist style, without any differentiation between majus<br />
cules and minuscules.4 Even though the Universal Alpha<br />
bet appeared in Offset before Futura was published,<br />
190 DAN REYNOLDS
I do not believe that Bayer’s design had any influence on<br />
Renner’s typeface, despite similarities between some of<br />
the letter forms present in each design. As discussed in<br />
more de ta il below, Renner had begun to work on Futura<br />
before 1926, likely making it an older design than Bayer’s<br />
to be gin with.<br />
Between 1926 and 1933, Bayer refined his Universal Alphabet<br />
design several times — but in principle, its letterforms<br />
always remained geometrically constructed. Their strokes<br />
featured none of the contrast or optical refinements commonplace<br />
in printing typefaces (then or now), even those<br />
found in seemingly geometrically-perfect typefaces like<br />
Futura. While Bayer’s Universal Alphabet would go on to<br />
inspire actual typefaces decades later in the photo-typesetting<br />
and digital eras, it did not directly influence the<br />
designs of any specific typefaces during the 1920s/30s.<br />
Its letters were too experimental for them to have worked<br />
in print at text sizes. Futura, in retrospect, is much more<br />
of a conservative design than Bayer’s Universal Alphabet.<br />
Its capital letters use classical Roman proportions, and<br />
the strokes of its letters are nicely modulated, creating an<br />
even grey colour in text blocks, and so on.<br />
In a 2016 article on the Bauer Type Foundry’s Venus typeface<br />
and Bayer’s Universal Alphabet, Ute Brüning present<br />
ed several stages of the latter’s development.5 In addition<br />
to the 1926 Offset drawing, she discussed a 1928<br />
revision with condensed letterforms (the letters’ sides<br />
had straight lines, and were not round).6 Bayer used another<br />
revision for a signage system and catalogue cover<br />
prepared for the 1930 Werkbund exhibition in Paris.7 In<br />
this revised state, the design — renamed alphabet simplifié<br />
(simpli fied alphabet) — was wider than in 1928, but<br />
still retained straight sides. Finally, Brüning presented<br />
two more vari ations Bayer made in 1933.8 One was wide<br />
and round. The other was narrow; sides of the o were<br />
straight. Some of the 1933 letterforms had completely new<br />
construc tions such as the a, which suddenly had two<br />
large coun terforms inside of it, instead of one. Throughout<br />
all of the versions, Bayer’s design remained unicameral.<br />
The second <strong>Bauhaus</strong> lettering piece published in their<br />
1926 issue of Offset was Albers’s Schablonenschrift (Stencil<br />
Alphabet) (Fig. 2).9 This was different from Bayer’s Universal<br />
Alpha bet in two ways. First, because it was a stencilletterform<br />
design, and second, because it had both uppercase<br />
and lowercase letters. Like Bayer, the 1926 Offset<br />
issue was not the only time that Albers engaged with his<br />
design. A few years later, in 1931, he revised it for a reallife<br />
use, when the Metallglas-AG in Offenburg-Baden published<br />
a glass pattern stencil series based on precise geometric<br />
shape combinations that Albers specified.10 This<br />
was simply named the Kombinationsschrift (Combination<br />
Alphabet).11<br />
Figure 3: Paul Renner’s Futura Black, published by the Bauer Type<br />
Foundry. Reproduced from an undated Bauer Type Foundry specimen<br />
brochure (circa 1950s) in the author’s collection.<br />
While it is difficult to argue that Renner was directly inspired<br />
by the <strong>Bauhaus</strong> lettering projects when it came to<br />
Futura’s design, the situation is quite different for Futura<br />
Black — a heavy stencilled extension to the Futura family,<br />
whose design was truly something of a parallel development<br />
between Dessau and Frankfurt (Fig. 3). Futura Black<br />
was al most certainly inspired by the Schablonenschrift<br />
Albers presented in his 1926 Offset piece. In a 2016 article<br />
on geo metric sans serif typefaces designed around the<br />
same time as Futura, Erik Spiekermann and Ferdinand<br />
Ulrich argue that Futura Black — whose design was registered<br />
with the Verein deutscher Schriftgießereien<br />
(Organisa tion of German Type Foundries) in September<br />
1929 — was too similar to Albers’s Schablonenschrift to<br />
be consid ered an independent design.12<br />
Two actual printing typefaces designed by Bau häusler,<br />
as opposed to lettering experiments<br />
The Universal Alphabet, alphabet simplifié, Schablonenschrift,<br />
and Kombinationsschrift were all lettering pieces —<br />
existing either as drawings on paper or as three-dimensional<br />
pieces of signage. They were not »typefaces« made<br />
for the printing industry’s general use. Neverthe less, two<br />
Bauhäusler did design proper printing typefaces during<br />
the 1930s. The first was Joost Schmidt, whose Uher-Type<br />
was a display typeface featuring geo metrically-inspired<br />
letter forms, some of which had features so exag gerated<br />
H ESSEN TYPEFACES 191
Florian Walzel<br />
<strong>Bauhaus</strong>, please return the call. Eine Polemik.<br />
»… selbst Avantgarden kommen post festum.«<br />
Odo Marquard 1<br />
Beginnen wir also mit der Frage, was zu sagen übrig<br />
bleibt. Im Fall <strong>Bauhaus</strong> ist das nicht besonders viel. Während<br />
die Festivitäten zum 100-jährigen Jubiläum jener<br />
großartigen historischen Anstalt planmäßig Fahrt auf genom<br />
men haben, ist zumindest so etwas wie eine mittelschwere<br />
Tragik zu bemerken. Sie äußert sich darin, dass<br />
über das <strong>Bauhaus</strong> nun wirklich alles gesagt zu sein<br />
scheint, zum eigenar tig en Preis, dass sein Verständnis<br />
damit zugleich ein un säg liches geworden ist. Da wäre zunächst<br />
der schiere Um fang. Eine Katalog anfrage bei der<br />
Deutschen Nationalbib liothek zum Stichwort Bau haus liefert<br />
zum Jahresanfang 5.502 Medien aus, davon 2.622<br />
Buchtitel. Bei einem ange legten Schätzwert von zwei<br />
Zentimetern durchschnittlicher Buchrückenbreite2 gehe<br />
man vor seinem geistigen Auge an einem Regalboden<br />
von zweiundfünfzigeinhalb Metern ent lang. <strong>Bauhaus</strong>! Bekanntlich<br />
sind Vergleiche eindrücklich, daher zum Vergleich:<br />
Der gesamte Jugendstil, als deutlich größere<br />
Bewe gung, bringt es gerade mal auf 1.815 Werke.<br />
»Avantgarde« als Überkategorie der klassischen Moderne<br />
schlechthin reklamiert mit 3.338 Büchern nur rund ein<br />
Drittel mehr Titel für sich. Lässt man einmal die missgüns<br />
tige Unter stellung beiseite, hier sei ein geschichtsschreibe<br />
risches Kartell am Werk, das den Markt wert anderer,<br />
nicht bau häuslerischer Zeitakteure drücke, die doch<br />
ebensolche Aufmerksamkeit verdient hätten, so ist daran<br />
erst einmal nichts Schlechtes zu finden. Fülle des Materials<br />
ist begrü ßenswert. Gemäß der alten Maxime: mehr<br />
ist mehr. Be acht lich an den exzessiven Ausmaßen des<br />
medialen An gebots ist aber seine Wirkung oder vielmehr<br />
Wirkungs losigkeit. In einem geradezu Musil’schen Sinne<br />
nämlich geht bemer kenswerter Weise nichts daraus<br />
hervor – weder im Allge meinen noch im Akademisch-<br />
Besonderen.<br />
Im Allgemeinen, also überall dort, wo sich nicht gerade<br />
aus gemachte <strong>Bauhaus</strong>-Forscher*innen auf Symposien<br />
treffen, trägt das Thema längst Züge sozialistischer Propagan<br />
da im Endstadium. Noch einmal werden die großen<br />
Heldengeschichtlein vergewissert, von der reinen, funktionalen<br />
Form, von der Versöhnung von Kunst und Technik,<br />
vom Aufbruch in ein ornamentloses (das heißt gereinigtes)<br />
Zeitalter, von der Heilung der Moderne aus dem<br />
Herzen der deutschen Provinz. Da wird von Tim Sommer<br />
eilfertig schon mal das »Wunder von Weimar« verkündet.3<br />
Von einem Ort ist die Rede, an dem noch der letzte<br />
»Türknauf eine Offenbarung der Moderne« sei. In allem<br />
fin det sich dort der Geist der Klarheit und Praktikabilität<br />
für den modernen Menschen. Gut, am Rande wird zugegeben,<br />
die eigentlichen Adressat*innen hat es nicht vom<br />
Stahlrohrsessel gehauen. Die Möbel fanden »keinen Absatz<br />
beim störrischen Proletariat«.4 Macht ja auch nichts,<br />
die zu Beglückenden waren einfach geis tig noch nicht<br />
reif für die Offenbarung. Doch die Zeit hat dem <strong>Bauhaus</strong><br />
recht gegeben: »Der Look von Dessau prägt die Welt.«5<br />
Him mel bewahre.<br />
Und noch einmal peitscht man die starken Bilder durch<br />
die Kanäle. Junge Frau mit triadischer Maske auf Breuer-Freischwinger.<br />
Walter Gropius vor der Entwurfszeich<br />
nung für die Chicago Tribune; grobes Wolljackett,<br />
ge punktete Fliege, visionärer Blick in die Ferne. Winkende<br />
Jugend mit fliegendem Haar auf den Balkonen der<br />
Süd fassade des Dessauer <strong>Bauhaus</strong>gebäudes. Damit auch<br />
Nichtleser*innen und Zuhausgebliebene mit der Heilsge<br />
schichte in Berührung kommen, sekundiert die ARD<br />
mit Fernsehbild. Das Historiendrama Lotte am <strong>Bauhaus</strong>6<br />
verschneidet vor historischer Kulisse eine generische<br />
Love story mit geradezu parodischen Szenen künstlerischer<br />
Selbstbefreiung: <strong>Bauhaus</strong>-Schülerinnen tanzen die<br />
Farbe Rot.7 In den Nebenhandlungen werden in höchstmöglicher<br />
Frequenz die Worte »Funktion«, »Gestaltung«<br />
und »Neuer Mensch« geschwurbelt. Am Ende verprügeln<br />
Nazi-Schergen die Bauhäusler. Aber Lotte entkommt und<br />
emigriert nach Jerusalem. Aus dem Off erklingt ein letztes<br />
Mal ihre Stimme, sie habe dort mitgeholfen, die Weiße<br />
Stadt zu erbauen. (Liebe Zuschauer, haben sie es auch<br />
verstanden? O-F-F-E-N-B-A-R-U-N-G).<br />
Vergleichbar dem sozialistischen Endstadium kann niemand<br />
ernstlich daran glauben, dass dies alles die Vergan<br />
genheit gewesen sein soll, noch dass die Gegen wart<br />
direkte Erbin ihres Pathos sei. Das zerfaserte Jetzt trägt<br />
schlicht zu wenig formale Ähnlichkeit mit der an geb lich<br />
so revolutionären und bis heute ausstrahlenden Potenz,<br />
als dass es irgendwie glaubwürdig wäre. Allein, anrührend<br />
ist es doch. Zugegeben, etwas hinkt der Niedergangs<br />
vergleich mit dem Sozialismus, es geht in Sachen<br />
Bau haus wohl nicht einmal mehr darum, einem zunehmend<br />
ungläubigen Volk einzuimpfen, sich weiterhin einer<br />
histo rischen Idee zu verschreiben, die das politi sche Regime<br />
selbst längst preisgegeben hat. Vielmehr geht es<br />
um … Ja, worum eigentlich? Was will man mit dem <strong>Bauhaus</strong>?<br />
Möchte man der Welt unmissverständlich klar<br />
mach en, dass die Wiege guten Designs nun mal in<br />
Deutsch land liegt, gewissermaßen den Gral heimholen?<br />
Oder geht es nur noch um historisch bonifiziertes Merchandise?<br />
Industriepolitik also? Will man vielleicht noch<br />
Größeres, etwa das Institut hochschreiben zur Korrektur<br />
funktion des deutschen 20. Jahrhunderts? Die Nation<br />
hat der Welt in kurzer Folge nicht nur zwei verheerende<br />
Kriege eingebracht – nein! –, es gab ja auch das <strong>Bauhaus</strong>.<br />
Solche möglichen Erklärungen erscheinen doch unzu reichend.<br />
Vor allem darum, weil der fortgesetzten Über stilisierung<br />
des <strong>Bauhaus</strong>es ein zentrales Element echter Propaganda<br />
fehlt: ein ideologischer Proponent. Niemand hat<br />
196 FLORIAN WALZEL
esonders viel von dieser eigenartigen Mythenbil dung. So<br />
mächtig kann die Replikenindustrie für Lam pen, Stühle<br />
und Kunstdrucke gar nicht sein, dass sie hin ter all dem<br />
steckte.<br />
Möglicherweise ist eine Erklärung schlichter. Vom <strong>Bauhaus</strong><br />
geht ja nun doch eine gewisse schätzenswerte Gemütlichkeit<br />
aus. Es ist die Gemütlichkeit alles Idealen,<br />
das, selbst wenn es unerfüllt geblieben ist, daran erinnert,<br />
dass die bessere Welt irgendwann einmal schon<br />
fast da war, oder wenigstens versucht wurde.8 Früher gab<br />
es etwas Ähnliches, das Bild vom röhrenden Hir schen. Obwohl<br />
so ein Hirsch nun wirklich nicht sonder lich ideo logieverdächtig<br />
ist, so hat man ihn doch den er klärten Spießern,<br />
die ihn als Ölschinken über dem Wohn zimmersofa<br />
hängen hatten, arg angekreidet. Kitsch! Da will sich jemand<br />
in ein Heimat- und Naturbild flüchten, das so nirgends<br />
zu finden ist, ja, das es so nie gegeben hat. Pfui,<br />
wie reaktionär, wie wirklichkeitsfremd! Auch damals sind<br />
der Hirsch und sein Bild nicht direkt von ei ner ideologischen<br />
Macht unterstützt worden. Der Hirsch hat vielmehr<br />
dazugehört, hat mitgeröhrt in der diffu sen Sehnsucht<br />
nach Utopia kleinbürgerlich-frommen Zu schnitts.<br />
Es braucht nicht viel, um einzusehen, dass das Bau haus<br />
zunehmend Hirschfunktion übernimmt. Das heißt, es<br />
stellt ein Material an abgetragenen Bildern der Ver gangen<br />
heit zur Verfügung, aus dem eine Selbstverge wisserung<br />
durch aus im Sinne von »Heimat« montiert werden<br />
kann. Eine Heimat, die ein bisschen mehr kön nen darf<br />
als die gegenwärtige Investorenmoderne.<br />
Freilich, Volkskunst mit röhrendem Zwölfender ist noch<br />
ein mal etwas anderes, so etwas ist naiver Kitsch. Aber<br />
auch Kitsch vermag sich weiterzuentwickeln. Im Fall der<br />
<strong>Bauhaus</strong>-Stilisierung erleben wir einen Geschmack von<br />
dem, was Kitsch in zweiter Potenz, gewisser maßen Kitsch<br />
mit reflexiven Einsprengseln, zu leisten vermag. Kitsch<br />
zweiter Potenz weiß die Wendung ins Negative zu vollzie<br />
hen, kommt aber am Ende immer bei etwas Heilem<br />
und Gutem heraus. Er kann sich darum einverleiben,<br />
was ein mal dem Kitsch nicht nahestand. Anders als der<br />
Hirsch, der von vorn bis hinten schön und edel anmutet<br />
und dar um selbst den Kleinbürgern mit der Zeit langweilig<br />
wur de, eignet <strong>Bauhaus</strong>-Requisiten das gewisse Etwas<br />
der teils dramatischen, teils melancho lischen Gebro chenheit<br />
des unvollendeten Projektes. In weiten Kreisen unver<br />
stan den, politisch angefeindet, von wechselnden Geschicken<br />
geplagt, der Auflösung oft nahe und im ständigen<br />
Umfirmierungs- und Umzugsstress vermochten die<br />
Bau häus ler*innen doch eine ungemein produktive Enklave<br />
aufrecht zuerhalten. Erspart blieb dieser Schule, sich<br />
zu Tode zu siegen, ideologisch zu verkrusten oder einfach<br />
morsch in sich zusammenzufallen. Stattdessen wurde sie<br />
von schändlicher Hand zu Fall gebracht wie ein zu jung<br />
gefallener Held. Und wie ein früh gestorbener Held wirkte<br />
seine Kraft, sein Geist weiter, wird alle zukünftigen Jugenden<br />
beflügeln. Über seine Hin terlassenschaft, in diesem<br />
Fall Lampen, Flachdachbauten und Klein schreibtypo<br />
grafie, legt sich ein mildes, goldenes Licht.<br />
In der Psychologie nennt man die latente Fehlleistung,<br />
auch so und so nicht wirklich zusammengehörige Fakten<br />
oder So-nicht-Gewesenes als Teil einer kohärenten Geschichte<br />
auszulegen, narrative bias. Und wenn dieses so<br />
groß ist, dass die Sehnsucht nach Geschichte die be merkten<br />
Phänomene vollkommen in Richtung des eige nen Bedürfnisses<br />
nach ein bisschen Offenbarung über zeichnet,<br />
nun ja, da ist Kitschverdacht wohl angebracht. So steht<br />
hinter der auf den ersten Blick propagandaför migen <strong>Bauhaus</strong>-Penetration<br />
wahrscheinlich keine gehei me Macht.<br />
Eher ist es ein unerfülltes Bedürfnis nach et was mehr<br />
wohltuender Beheimatung in der Moderne, die sich so gewandelt<br />
hat und jüngst so krisenhaft erscheint, ein Bedürf<br />
nis, das sein Angebot prompt bekommt.9<br />
Neutralisierung durch Überhöhung, davor hatte Tomás<br />
Maldonado noch zum 50. <strong>Bauhaus</strong>-Jubiläum gewarnt,10<br />
hatte gewarnt, dass die Mehrheit am Phänomen Bau haus<br />
nur sehen wolle, was keine Mühe im Denken be reite und<br />
der Selbstzufriedenheit nicht wider den Strich laufe. Gegen<br />
diesen Prozess muss keine Mahnung mehr ergehen.<br />
Er ist längst abgeschlossen.<br />
Ganz anders geht es derzeit im Akademisch-Besonderen<br />
zu, also dort, wo ausgemachte <strong>Bauhaus</strong>-Forscher*innen<br />
sich gegenseitig Symposien veranstalten. Da führt man<br />
das Gegenspiel auf. Und hier gibt es natürlich seit langem<br />
das differenzierte Bild, an dem es der breiten Öffent<br />
lichkeit so sehr gebricht. Das Problem ist derweil ein<br />
anderes: Das Material, das noch zu differenzieren wert<br />
wäre, es schwindet rasant. Da wird analytisch verästelt,<br />
was zu verästeln bleibt. Hier eine unbeachtete Servietten-<br />
Notiz von Josef Albers (Sensation!), dort noch vier im Provinzarchiv<br />
gefundene Grafiken eines verwehten Bau haus-<br />
Schülers (beachtlich!).11 Keine Spur bleibt unver folgt, alles<br />
muss ans Licht. Wohlgemerkt, Ausweitung der Datengrundlage,<br />
Methodenverfeinerung, Re-Itera tion, all das<br />
ist keineswegs verwerflich, sondern notwen diger und respektabler<br />
Teil der Wissenschaft – aber eben nur ein Teil<br />
davon. Thomas S. Kuhn hat in seinem viel bemerkten Buch<br />
Die Struktur wissenschaftlicher Revolu tionen aufgezeigt,<br />
dass die Erkenntnisse der Forschung sich weniger als gedacht<br />
entlang der kontinuierlichen Verästelung und Subli<br />
mierung existierender Wissens be stände nachverfolgen<br />
lassen als an den großen Tradi tionsbrüchen, den Para digmenwechseln.12<br />
Denn dort, wo zur braven Untermaue rung<br />
gesicherter Erklärungs modelle immer mehr Forschungsergebnisse<br />
angehäuft werden, kommt es am Rande auch<br />
zu inkongruenten, das heißt widersprüchlichen Daten.<br />
Wis senschaftliche Revolutionen entstehen bevorzugt dann,<br />
wenn signifi kante Abweichungen nicht länger im Lichte<br />
der her kömmlichen Theorie angesehen, sondern vollkom<br />
men neu gruppiert werden. Im Fall <strong>Bauhaus</strong> haben<br />
BAUHAUS, PLEASE RETURN THE CALL 197
© 2020 by jovis Verlag GmbH<br />
Texts by kind permission of the authors.<br />
Pictures by kind permission of the photographers/<br />
holders of the picture rights.<br />
All rights reserved.<br />
Concept & Design: Tobias Becker, Sandra Hoffmann Robbiani (eds.)<br />
Production: Becker Rapp Studio (Tobias Becker, Leonie Rapp<br />
mit Alexander Irschfeld)<br />
Student assistant: Aliena Koep<br />
Translation (Foreword): Ian Pepper<br />
Copyediting/Proofreading: Kim Bridgett, Janina Lücke,<br />
Bianca Murphy, Sven Rosig, Ute Rummel<br />
Software development: Andreas Marc Klingler<br />
Photography (Focus): Peter Wolff<br />
Lithography: Felix Scheu<br />
Typefaces: Dinamit, Mondial (Revolver Type Foundry)<br />
Paper: neobond®, Munken Lynx, Speedgloss, Vivus 60<br />
Printing and binding: Nino Druck<br />
Printed in Germany<br />
Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek.<br />
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication<br />
in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data<br />
are available on the Internet at http://dnb.d-nb.de<br />
jovis Verlag GmbH<br />
Kurfürstenstraße 15/16<br />
10785 Berlin<br />
www.jovis.de<br />
jovis books are available worldwide in select bookstores. Please<br />
contact your nearest bookseller or visit www.jovis.de for information<br />
concerning your local distribution.<br />
We have endeavored to find the owners of all the rights. If we have<br />
failed to do so in individual cases, please contact us. Naturally,<br />
all justified claims will be met within the framework of the customary<br />
agreements.<br />
ISBN 978-3-86859-601-4