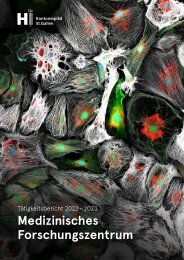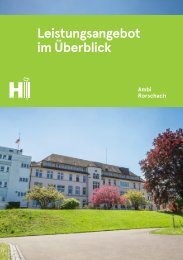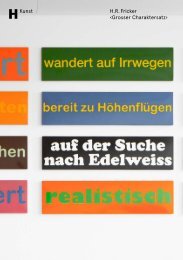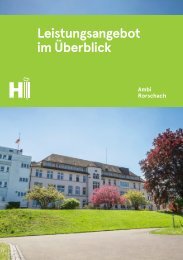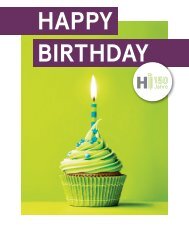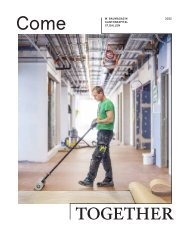DUO_14
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>DUO</strong><br />
Nr. <strong>14</strong><br />
Zuweisermagazin des<br />
Kantonsspitals St.Gallen
3<br />
Editorial<br />
Brückenbau<br />
4<br />
Fokus<br />
Starkes Wirbelsäulen-Team<br />
8<br />
12<br />
18<br />
24<br />
26<br />
Kader im Profil<br />
Kurznews zum Thema<br />
Der Brückenbauer<br />
Innovation und Entwicklung<br />
Kurznews zum Thema<br />
Wo Menschlichkeit auf Technik trifft<br />
Prozesse und Organisation<br />
Kurznews zum Thema<br />
Autologe Stammzell-Retransfusion am<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Agenda<br />
Veranstaltungen April bis August 2018<br />
Perspektivenwechsel<br />
PERFORMANCE<br />
neutral<br />
Drucksache<br />
01-18-988784<br />
myclimate.org<br />
Impressum<br />
Ausgabe Nr. <strong>14</strong>, 2018<br />
Herausgeber Unternehmenskommunikation Kantonsspital St.Gallen<br />
Gestaltung VITAMIN 2 AG, St.Gallen<br />
Druck Cavelti AG, Gossau<br />
Anregungen zum <strong>DUO</strong> nehmen wir gerne per E-Mail entgegen:<br />
redaktion@kssg.ch
Editorial 3<br />
Brückenbau<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
Wir bauen Brücken: zwischen den verschiedenen<br />
Disziplinen, zwischen Menschen und zwischen<br />
Geräten. Im Mittelpunkt dieser Verbindung stehen<br />
unsere Patienten.<br />
4<br />
<strong>14</strong><br />
Eine dieser Verbindungen findet zwischen den<br />
Kliniken für Neurochirurgie und Orthopädische<br />
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates<br />
statt: die Wirbelsäulensprechstunde.<br />
Patienten und Zuweiser profitieren von einer<br />
Anlaufstelle sowie von Wissen und Kompetenz<br />
zweier Kliniken.<br />
Wie Verbindungen zwischen Menschen entstehen,<br />
zeigt sich in der Klinik für Neurochirurgie: «Ich<br />
sehe mich als Brückenbauer zwischen alt und<br />
neu, zwischen früher und heute», so der neue Stv.<br />
Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie, Dr. Heiko<br />
Richter. Seit 2003 ist er am Kantonsspital St.Gallen<br />
tätig, damals noch unter der Leitung von Prof.<br />
Dr. Gerhard Hildebrandt. Gemeinsam mit der Chefärztin<br />
Prof. Dr. Astrid Weyerbrock verfolgt er<br />
das Ziel, für jeden Patienten die optimale Behandlung<br />
mit dem bestmöglichen Ergebnis zu erreichen<br />
(Seiten 10 – 11).<br />
20<br />
Eine enge Verbindung mit Ihnen ist uns ein wichtiges<br />
Anliegen. Durch regen Austausch soll es uns gelingen,<br />
die Patienten gemeinsam optimal zu betreuen<br />
und zu behandeln.<br />
Herzliche Grüsse<br />
Dr. Daniel Germann<br />
Direktor und Vorsitzender<br />
der Geschäftsleitung
4 Fokus<br />
Starkes<br />
Wirbelsäulen-Team<br />
Das Kantonsspital St.Gallen bietet im<br />
Bereich der Wirbelsäulenchirurgie das<br />
komplette medizinische Spektrum der<br />
Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen<br />
auf höchstem Niveau an. Patienten<br />
und Zuweiser profitieren so von einem geballten<br />
Know-how – von Experten der<br />
Klinik für Neurochirurgie sowie Orthopädische<br />
Chirurgie und Traumatologie<br />
des Bewegungsapparates.<br />
Die Wirbelsäulenspezialisten der Neurochirurgie und<br />
Orthopädie decken das gesamte Behandlungsspektrum<br />
von der komplexen Deformitätenchirurgie<br />
und Traumatologie bis zur Rückenmarksmikrochirurgie<br />
ab. So können die Zuweiser sicher sein,<br />
dass für jedes Krankheitsbild an der Wirbelsäule die<br />
passende Behandlung zur Verfügung steht. Durch<br />
den regelmässigen Austausch zwischen den Wirbelsäulenspezialisten<br />
beider Kliniken wird dafür gesorgt,<br />
dass jeder Patient beim richtigen Spezialisten<br />
landet. Unter Berücksichtigung von Krankheitsbild,<br />
Alter und Nebenerkrankungen wird die für den<br />
Patienten beste und schonendste Behandlungsmethode<br />
ausgewählt. Dabei kommt in den meisten<br />
Fällen die mikrochirurgische OP-Technik zum Einsatz,<br />
die in der Neurochirurgie Standard ist.<br />
Je nach Krankheitsbild stehen aber auch konservative<br />
Massnahmen wie Physiotherapie, Chiropraktik<br />
oder Schmerztherapie im Vordergrund, welche bei<br />
vielen Erkrankungen der Wirbelsäule einen guten<br />
Erfolg zeigen. Hier profitiert der Patient vom interdisziplinären<br />
Austausch innerhalb des Spitals, der<br />
über die Grenzen der beiden Kliniken hinausgeht. So<br />
werden beispielsweise auch das Schmerzzentrum,<br />
die Rheumatologie, die Onkologie oder die Physiotherapie<br />
für nichtoperative Behandlungen hinzugezogen.<br />
Aufgrund der medizinischen Infrastruktur<br />
am Zentrumsspital ist es möglich, komplexe Fälle mit<br />
multiplen Nebenerkrankungen und ältere Patienten<br />
optimal zu behandeln und zu betreuen.<br />
Geballtes Know-how<br />
Doch wer steckt hinter der Wirbelsäulenchirurgie?<br />
Seitens Klinik für Neurochirurgie ist es Dr. Heiko<br />
Dreeskamp, Leitender Arzt, seitens Orthopädie sind<br />
es Dr. Thomas Forster, Stv. Chefarzt der Klinik für<br />
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des<br />
Bewegungsapparates, und Dr. Fabrice Külling, Leitender<br />
Arzt in der Orthopädie und Traumatologie.
Fokus<br />
5<br />
Schnell<br />
Das Kantonsspital St.Gallen verfügt, vertreten durch<br />
Experten aus den Kliniken für Neurochirurgie und<br />
der Orthopädischen Chirurgie und Traumatologie<br />
des Bewegungsapparates, über das grösste Zentrum<br />
für die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen<br />
in der Ostschweiz. In gemeinsamen Boards, Fortbildungen<br />
und Seminaren werden Patientenfälle<br />
besprochen und neuste Studien vorgestellt.<br />
Patienten und Zuweiser profitieren so von einem<br />
geballten Know-how auf höchstem Niveau und<br />
vom breiten Behandlungsangebot von minimalinvasiv<br />
bis komplex.<br />
Geballtes Know-how aus der Neurochirurgie und Orthopädie und Traumatologie: Dr. Thomas Forster und Dr. Heiko Dreeskamp (v. l. n. r.)<br />
Sie bringen eine grosse Faszination für ihr jeweiliges<br />
Fachgebiet mit. «Jeder Fall ist anders, und es<br />
schleicht sich bestimmt keine Routine ein», so der<br />
Orthopäde. Seinen Kollegen aus der Neurochirurgie,<br />
Dr. Dreeskamp, beeindruckt vor allem das Kleine<br />
im Grossen: «Die Arbeit im Millimeterbereich hat<br />
mich schon immer beeindruckt und wird mich auch in<br />
Zukunft beschäftigen. Denn minimalinvasive und<br />
mikrochirurgische Techniken, die in der Neurochirurgie<br />
seit Jahrzehnten etabliert sind, nehmen<br />
auch in der Wirbelsäulenchirurgie einen zunehmenden<br />
Stellenwert ein. Dadurch werden Schnitte<br />
kleiner und Komplikationen geringer.»<br />
Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit im<br />
Bereich Wirbelsäulenchirurgie sehen beide als Bereicherung<br />
des Angebots an. So finde ein guter,<br />
regelmässiger Austausch in Form von wöchentlichen<br />
Boards statt. Durch Fortbildungen, Seminare und<br />
Workshops wird zudem das Know-how ständig<br />
ausgetauscht und erweitert. Künftig sollen zu den<br />
Boards auch Hausärzte eingeladen werden,<br />
um gemeinsam und an einem Tisch die Fälle zu<br />
besprechen.<br />
Kooperationen in Grabs<br />
Um die Gesundheitsversorgung im Kanton St.Gallen<br />
sicherzustellen, bietet das Kantonsspital St.Gallen<br />
seit 20<strong>14</strong> in Kooperation mit dem Spital Grabs jeweils<br />
am Freitag eine Wirbelsäulensprechstunde an. Die<br />
Sprechstunde findet im Spital Grabs statt und wird<br />
von Neurochirurgen des Kantonsspitals St.Gallen<br />
durchgeführt, wobei eine operative Tätigkeit mit den<br />
Orthopäden der SR RWS derzeit in Planung ist. In<br />
der Sprechstunde geht es um Erstabklärungen, postoperative<br />
Kontrollen von Patienten oder um Konsiliardienst<br />
für stationäre Patienten. Die Operationen<br />
selbst finden am Standort St.Gallen in einer modernen<br />
OP-Infrastruktur und auf höchstem Niveau statt.<br />
Know-how mit Vergangenheit und Zukunft<br />
Die Wirbelsäulenchirurgie hat am Kantonsspital<br />
St.Gallen eine grosse und lange Tradition, viele bewährte<br />
Techniken wurden hier entwickelt. Um<br />
diese Vorreiterrolle auch in Zukunft weiterzuleben,<br />
stehen gemeinsame Projekte der beiden Kliniken<br />
bevor. Damit der Patient auch in Zukunft eine<br />
Behandlung auf dem aktuellsten Stand von Wissenschaft<br />
und Medizintechnik erhält.
6 Fokus<br />
Kernkompetenzen<br />
Neurochirurgie<br />
– Wirbelkanalstenosen<br />
– Bandscheibenvorfälle<br />
– Degenerative Spondylolisthesen<br />
– Spondylodesen über einen dorsalen<br />
Zugang (PLIF, TLIF)<br />
– Intradurale und intramedulläre Tumore<br />
– Fehlbildungen des Rückenmarks bei<br />
Erwachsenen und Kindern<br />
– Gefässmissbildungen (AV-Fistel etc.)<br />
– Rückenmarkspathologie wie Syrinx<br />
(traumatische/nichttraumatische)<br />
und Adhäsionen (traumatische/nichttraumatische)<br />
Kontakt<br />
Klinik für Neurochirurgie<br />
Zentrales Patientenmanagement<br />
(ambulant und stationär)<br />
Tel. +41 71 494 11 99<br />
neurochirurgie@kssg.ch<br />
www.kssg.ch/wirbelsäulenchirurgie<br />
Kernkompetenzen<br />
Orthopädie und<br />
Traumatologie<br />
– Traumatologie<br />
– Skoliose<br />
– Frakturen<br />
– Infektionen<br />
– Komplexe Revisionsoperationen und<br />
Spondylodesen<br />
– Ventraler Zugang (ALIF)<br />
– Lateraler Zugang (XLIF)<br />
– Dorsaler Zugang (TLIF, PLIF)<br />
– Tumore (primäre und sekundäre) der<br />
Wirbelsäule<br />
Kontakt<br />
Klinik für Orthopädische Chirurgie und<br />
Traumatologie des Bewegungsapparates<br />
Tel. +41 71 494 13 66<br />
wirbelsaeule@kssg.ch<br />
www.kssg.ch/orthopaedie
Fokus<br />
7<br />
Dr. Thomas Forster<br />
Dr. Heiko Dreeskamp<br />
Klinischer Werdegang<br />
– 1979 – 1985: Medizinstudium in Basel<br />
– 1985: Staatsexamen in Basel<br />
– 1986 – 1987: Zürcher Krebsregister,<br />
Unispital Zürich<br />
– 1987 – 1988: Bürgerspital Solothurn,<br />
Orthopädie (Dr. P. Bamert)<br />
– 1988 – 1989: Regionsspital Interlaken,<br />
Chirurgie (Dr. R. Zürcher und Dr. B.<br />
Noesberger)<br />
– 1989 – 1991: Kantonsspital Bruderholz,<br />
Orthopädie / Traumatologie (Prof. W. Müller)<br />
– 1991: Felix-Platter-Spital Basel, Orthopädie<br />
(Prof. E. Morscher)<br />
– 1993 – 1994: Kantonsspital St.Gallen,<br />
Chirurgie (Prof. J. Lange)<br />
– 1994: Kantonsspital St.Gallen, Orthopädie/<br />
Traumatologie (Prof. A. Gächter)<br />
– 1995: Oberarzt, Kantonsspital St.Gallen,<br />
Orthopädie / Traumatologie<br />
– 1998 – 2003: Oberarzt mbF, Abteilung<br />
für Wirbelsäulenchirurgie, Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
– 2003 – 2013: Leitender Arzt für Wirbelsäulenchirurgie,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
– Seit 2013: Stv. Chefarzt, Teamleiter Wirbelsäulenchirurgie,<br />
Kantonsspital St.Gallen,<br />
Klinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie<br />
des Bewegungsapparates<br />
(Prof. Dr. B. Jost)<br />
Werdegang<br />
– 1997 – 2003: Medizinstudium, Martin-Luther-<br />
Universität Halle / Saale und Universität<br />
RWTH Aachen<br />
– 2004: Approbation, Universität RWTH<br />
Aachen<br />
– 2004: Promotion, Klinik für Neuroradiologie,<br />
Universität RWTH Aachen, «Minimal invasive<br />
endovaskuläre Therapie zerebraler Aneurysmen<br />
mittels Stents und selektiv ablösbarer<br />
Spiralen»<br />
– 2004 – 2009: Assistenzarzt, Klinik für<br />
Neurochirurgie, Kantonsspital St.Gallen<br />
(Prof. Dr. G. Hildebrandt)<br />
– 2009: Assistenzarzt, Klinik für Neurochirurgie,<br />
Universitätsspital Basel (Prof. Dr. L. Mariani)<br />
– 2010: Stv. Oberarzt, Klinik für Neurochirurgie,<br />
Universitätsspital Basel (Prof. Dr. L. Mariani)<br />
– 2010: Oberarzt, Klinik für Neurochirurgie,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
(Prof. Dr. G. Hildebrandt)<br />
– 20<strong>14</strong>: Oberarzt mbF, Klinik für Neurochirurgie,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
(Prof. Dr. G. Hildebrandt)<br />
– 2017: Leitender Arzt, Klinik für Neurochirurgie,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
(Prof Dr. A. Weyerbrock)
8 Kader im Profil<br />
Team «Fuss- und Sprunggelenk»<br />
unter neuer Leitung<br />
nur der Lernende, sondern auch der Lehrende.<br />
Privat freue ich mich sehr darauf, gemeinsam<br />
mit meiner Familie, die im Sommer in die Schweiz<br />
kommt, St.Gallen und die Umgebung zu erkunden.<br />
Dr. Andreas Toepfer<br />
Seit 1. März 2018 ist Dr. Andreas Toepfer neu Teamleiter<br />
«Fuss- und Sprunggelenk» in der Klinik für<br />
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des<br />
Bewegungsapparates.<br />
Dr. Andreas Toepfer stammt aus München, wo er am<br />
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität<br />
München von 2011 bis 2016 die Sektion Fussorthopädie<br />
der Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie<br />
leitete. Er war als einer der Hauptoperateure für<br />
die Sektion Tumororthopädie der Klinik für Orthopädie<br />
und Sportorthopädie zuständig und als Hauptoperateure<br />
mit Schwerpunkt in der modularen Megaund<br />
Tumorendoprothetik tätig. Per 1. Juli 2016<br />
wechselte er zur Schön Klinik München Harlaching,<br />
um sich ausschliesslich auf die Fusschirurgie zu<br />
konzentrieren.<br />
Wie möchten Sie die Klinik medizinisch<br />
weiterentwickeln?<br />
Die Traumatologie der Fuss- und Sprunggelenkschirurgie<br />
bewegt sich sicherlich schon auf sehr<br />
hohem Niveau. Ich freue mich als operativ ausgebildeter<br />
Orthopäde insbesondere darauf, gemeinsam<br />
mit meinen Kollegen die elektive Fusschirurgie auszubauen<br />
und weiterzuentwickeln. Dabei denke ich<br />
unter anderem an bestimmte minimalinvasive Techniken,<br />
wie sie zum Beispiel in der Korrektur von Deformitäten,<br />
bei Achillessehnenrupturen, aber auch in<br />
der Behandlung gutartiger (Fuss-)Tumoren eine<br />
Rolle spielen. In der Tumororthopädie freue ich mich,<br />
Dr. Stephan Keller unterstützen zu dürfen.<br />
Wie gestalten Sie die Zusammenarbeit mit<br />
den Zuweisern?<br />
Mir ist es ein grosses Anliegen, dass man Unklarheiten<br />
und Fragen auch telefonisch oder gar persönlich<br />
besprechen kann. Dieser offene Austausch kommt<br />
auch dem Patienten zugute. Ich freue mich auf ein<br />
persönliches Kennenlernen – ob an Veranstaltungen,<br />
Fortbildungen oder im Sprechzimmer.<br />
Herr Dr. Toepfer, wie war Ihr Start am<br />
Kantonsspital St.Gallen?<br />
Mein Start war sehr gut und angenehm. Mein Team<br />
hat mich freundlich und herzlich willkommen<br />
geheissen. Wir sind also bereit, unsere Patienten<br />
bestmöglich zu behandeln.<br />
Worauf freuen Sie sich am meisten?<br />
Auf professioneller Ebene freue ich mich auf die<br />
interdisziplinäre Zusammenarbeit, die ich vom<br />
Unispital kenne und die sich bestens für komplexe<br />
Krankheitsbilder eignet. Durch diesen wertvollen<br />
Austausch lernt man immer wieder Neues dazu<br />
und kann sein eigenes Spektrum stetig erweitern.<br />
Ausserdem freue ich mich auf die Möglichkeit<br />
der Ausbildung und Lehre. Denn dabei lernt nicht<br />
Der Brückenbauer<br />
Wer ist der neue Stv. Chefarzt der Klinik für<br />
Neurochirurgie am Kantonsspital St.Gallen und<br />
was fasziniert ihn an seinem Fachbereich?<br />
Mehr über den neuen Stv. Chefarzt auf Seite 10
Kader im Profil<br />
9<br />
Weitere Ernennungen, Wahlen<br />
und Pensionierungen<br />
KLINIK FÜR NEUROCHIRURGIE<br />
KLINIK FÜR INFEKTIOLOGIE/SPITALHYGIENE<br />
Ernennung<br />
per 24.10.2017<br />
Ernennung<br />
per 01.12.2017<br />
PD Dr. Astrid Weyerbrock<br />
zur ausserplanmässigen Professorin durch<br />
die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg<br />
Dr. Heiko Richter<br />
Stv. Chefarzt<br />
Wahl<br />
per 01.12.2017<br />
Beförderung<br />
per 01.04.2018<br />
Beförderung<br />
per 01.04.2018<br />
Prof. Dr. Christoph Hatz<br />
Leitender Arzt<br />
Dr. Carol Strahm<br />
Leitender Arzt<br />
PD Dr. Werner Albrich<br />
Leitender Arzt<br />
KLINIK FÜR RADIOLOGIE UND NUKLEARMEDIZIN<br />
Pensionierung<br />
per 31.01.2018<br />
Wahl<br />
per 01.02.2018<br />
Dr. Peter Waibel<br />
Leitender Arzt<br />
Dr. Stephan Wälti<br />
Leitender Arzt<br />
OSTSCHWEIZER GEFÄSSZENTRUM<br />
Wahl<br />
per 01.03.2018<br />
Dr. Georg Heller<br />
Leitender Arzt<br />
(Kooperationsvertrag: 60 Prozent SR RWS,<br />
Spital Grabs, 40 Prozent KSSG)<br />
INSTITUT FÜR RECHSTMEDIZIN<br />
Pensionierung<br />
per 31.01.2018<br />
Dr. Munira Haag-Dawoud<br />
Stv. Leiterin Verkehrsmedizin<br />
KLINIK FÜR ALLGEMEIN-, VISZERAL-, ENDOKRIN-<br />
UND TRANSPLANTATIONSCHIRURGIE<br />
Wahl<br />
per 01.10.2017<br />
Prof. Dr. Thomas Frick<br />
Leitender Arzt<br />
KLINIK FÜR ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE UND<br />
TRAUMATOLOGIE DES BEWEGUNGSAPPARATES<br />
Wahl<br />
per 01.03.2018<br />
AUGENKLINIK<br />
Beförderung<br />
per 01.01.2018<br />
Dr. Andreas Kurt Toepfer<br />
Leitender Arzt<br />
Dr. Josef Guber<br />
Leitender Arzt<br />
Pfizer Forschungspreis 2018<br />
für junge Wissenschaftler<br />
Dr. Cristina Gil Cruz und Dr. Christian Pérez Shibayama<br />
haben am 1. Februar 2018 den Pfizer Forschungspreis<br />
in der Kategorie «Infektiologie, Rheumatologie<br />
und Immunologie» erhalten. Die beiden jungen<br />
Wissenschaftler arbeiten am Institut für Immunbiologie.<br />
Sie wollten herausfinden, welche Rolle die<br />
sogenannten fibroblastischen Stromazellen (spezielle<br />
Darmzellen) in der Erkennung von potenziellen<br />
Krankheitserregern während einer Immunantwort<br />
spielen. Diese Erkennung ist ein wichtiger Prozess,<br />
um die Unversehrtheit des Darms zu gewährleisten.<br />
Dazu arbeiteten die Forscher mit einem Mausmodell,<br />
welches erlaubte, gezielt Zellen anzusprechen<br />
und deren Fähigkeit zu blockieren, diese mikrobiologischen<br />
Signale zu erkennen. Mithilfe des MyD88-<br />
Moleküls können fibroblastische Zellen Darmviren<br />
erkennen, um eine übertriebene Immunzellen-Aktivierung<br />
zu verhindern. Fehlen im Mausmodell<br />
die MyD88-Moleküle in den besagten Zellen, führen<br />
unkontrollierte Immunantworten zu einer schweren<br />
Schädigung des Darms. Folglich arbeiten fibroblastische<br />
Stromazellen bei Bedarf als immunologische<br />
Belastungsregler, welche die Immunantworten unter<br />
Entzündungsbedingungen regulieren und somit<br />
immunpathologische Schäden im Darm verhindern.
10 Kader im Profil<br />
Der Brückenbauer<br />
Dr. Heiko Richter ist seit Dezember<br />
2017 neuer Stv. Chefarzt der Klinik für<br />
Neurochirurgie am Kantonsspital<br />
St.Gallen. Warum er sich als Brückenbauer<br />
sieht und auch den hundertsten<br />
intraoperativen Blick in den Bereich<br />
des Sehnervs als faszinierend empfindet,<br />
können Sie nachfolgend lesen.<br />
«Seit 2003 bin ich am Kantonsspital St.Gallen tätig,<br />
damals noch unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard<br />
Hildebrandt», erzählt Heiko Richter mit einer ansteckenden<br />
Ruhe und Gelassenheit. In den letzten<br />
Jahren habe sich einiges verändert. So ist im Jahr<br />
2015 Prof. Dr. Gerhard Hildebrandt in den Ruhestand<br />
getreten und Prof. Dr. Weyerbrock leitet seitdem<br />
die Klinik als neue Chefärztin. «Ich sehe mich als Brückenbauer<br />
zwischen alt und neu, zwischen früher<br />
und heute.» Auch bei den aktuellen personellen<br />
Veränderungen stehe nach wie vor der Patient mit<br />
Erkrankungen des zentralen Nervensystems und<br />
der Wirbelsäule im Mittelpunkt. Das Ziel: für jeden<br />
Patienten die optimale Behandlung mit dem bestmöglichen<br />
Ergebnis zu erreichen. «Zudem wurden<br />
Abläufe und Strukturen verbessert, um beispielsweise<br />
Wartezeiten zu verkürzen oder Berichte in<br />
kürzerer Frist zu versenden», so Dr. Richter.<br />
Verbindung von Mensch und Technik<br />
Und worin besteht die Faszination für den Fachbereich<br />
der Neurochirurgie? «Kein Fall ist gleich und<br />
man beschäftigt sich mit Dingen, die für den Patienten<br />
eine extreme Wichtigkeit haben. So ist eine<br />
Operation am Hirn ein emotionales und heikles<br />
Thema im Bereich des menschlichen Seins. Damit<br />
verantwortungsvoll umzugehen im Wissen darum,<br />
dass ein solcher Eingriff für den Patienten einschneidende<br />
Folgen wie Funktionsverluste oder Invalidität<br />
haben kann, ist auf menschlicher Ebene eine grosse<br />
Herausforderung. Aus technischer und chirurgischer<br />
Sicht ist das alles spannend und herausfordernd<br />
zugleich. Auch wenn man zum hundertsten Mal in<br />
den Bereich des Sehnervs schaut, ist das immer<br />
noch faszinierend.»<br />
Berufung<br />
Er habe schon früh gewusst, dass er Arzt werden<br />
möchte. Während des Studiums hat ihn die Neurologie<br />
sehr interessiert und fasziniert. Er wollte aber,<br />
bevor er sich festlegte, noch den Bereich der Neurochirurgie<br />
anschauen. «Ich dachte mir: Schau doch<br />
zuerst mal, was die Neurochirurgen machen.» Seither<br />
ist er in diesem Fachbereich tätig. Die Neurochirurgie<br />
sei als Fach pragmatischer, was besser zu ihm passe.<br />
Für die Neurochirurgie von morgen<br />
Seine bisherige Karriere am Kantonsspital St.Gallen<br />
verlief Schritt für Schritt: vom Assistenzarzt im<br />
Jahr 2003 bis hin zum Stv. Chefarzt im Jahr 2017.
Kader im Profil<br />
11<br />
Schnell<br />
Dr. Heiko Richter ist seit 2003 am Kantonsspital<br />
St.Gallen, seit Dezember 2017 Stv. Chefarzt der Klinik<br />
für Neurochirurgie. Die Faszination für den Fachbereich<br />
der Neurochirurgie hat er schon früh entdeckt<br />
und schätzt die Verbindung von menschlichen Aspekten<br />
und der chirurgischen Technik. Damit möchte er<br />
für jeden Patienten die optimale Behandlung mit dem<br />
bestmöglichen Ergebnis erzielen.<br />
Die Grösse und die damit verbundene Interdisziplinarität<br />
fasziniert ihn am Kantonsspital St.Gallen.<br />
«Alles wird auf extrem hohem Niveau angeboten.»<br />
Die Komplexität sei aber auch der Grund dafür,<br />
warum das Zentrumsspital trotz aller Optimierungen<br />
kaum so spontan sein könne wie eine kleine<br />
Praxis, und dafür brauche es teilweise Verständnis<br />
seitens der Zuweiser. Zudem bildet das Kantonsspital<br />
St.Gallen die Ärzte von morgen aus – für die<br />
Neurochirurgie von morgen.<br />
Dr. Heiko Richter<br />
Werdegang<br />
– 1992 – 1999: Medizinstudium an der Charité,<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
– 1999: Promotion zum «Dr. med.» am Institut<br />
für Neurophysiologie der Charité in Berlin<br />
– 1999 – 2000: Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
am Institut für Neurophysiologie der<br />
Charité in Berlin<br />
– 2000 – 2002: Assistenzarzt am Kantonsspital<br />
Aarau (Prof. Landolt)<br />
– 2002 – 2003: Assistenzarzt (Wirbelsäulenchirurgie)<br />
an der Schulthess Klinik Zürich<br />
(Prof. Benini, PD Dr. Porchet)<br />
– 2003 – 2007: Assistenz- und Oberassistenzarzt<br />
am Kantonsspital St.Gallen (Prof. Hildebrandt)<br />
– 12 / 2006: Facharzttitel für Neurochirurgie<br />
– Seit 2007: Oberarzt am Kantonsspital St.Gallen<br />
(Prof. Hildebrandt)<br />
– Seit 2012: Oberarzt mbF am Kantonsspital<br />
St.Gallen (Prof. Hildebrandt)<br />
– Seit 2017: Leitender Arzt und Stv. Chefarzt am<br />
Kantonsspital St.Gallen (PD Dr. Weyerbrock)<br />
Weitere Funktionen<br />
– Mitglied in der Schweizerischen Gesellschaft<br />
für Neurochirurgie (SGN)
12 Innovation und Entwicklung<br />
Der SeLECT-Score<br />
Wissenschaftlern am Kantonsspital St.Gallen ist<br />
ein Durchbruch zur Vorhersage von Epilepsie<br />
nach Schlaganfall gelungen. Ein internationales<br />
Forscherteam angeführt von Prof. Dr. Barbara<br />
Tettenborn, Chefärztin der Klinik für Neurologie,<br />
hat den SeLECT-Score entwickelt. Dieser ermöglicht<br />
es Ärzten, das Risiko für Anfälle nach<br />
einem Schlaganfall abzuschätzen.<br />
«Dies ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung von<br />
prophylaktischen Therapien gegen vaskuläre Epilepsie,<br />
die häufigste Ursache für Anfälle bei Erwachsenen»,<br />
erläutert Dr. Marian Galovic, Erstautor der<br />
Studie. Die Resultate wurden im Februar 2018 in<br />
der führenden neurologischen Fachzeitschrift The<br />
Lancet Neurology veröffentlicht und stehen als<br />
Smartphone-App («SeLECT-Score») zur Verfügung.<br />
Zentrales Patientenmanagement<br />
(ZPM) in der Klinik für Neurologie<br />
Für ambulante und stationäre Zuweisungen sowie<br />
Terminvereinbarungen innerhalb der Klinik für Neurologie<br />
steht den Zuweisenden ab sofort das Team<br />
des Zentralen Patientenmanagements (ZPM) zur<br />
Verfügung. Die Zuweisungen können schriftlich via<br />
E-Mail und Online-Formular auf der Website<br />
eingegeben werden (Kontaktdaten rechts). Die Zuweisungen<br />
werden durch einen ZPM-Facharzt<br />
triagiert, der gleichzeitig auch direkter Ansprechpartner<br />
für die Zuweisenden ist. Dringende Fälle/<br />
Notfälle werden wie bis anhin direkt und zeitnah<br />
in der Zentralen Notfallaufnahme behandelt.<br />
Zusätzlich bietet die Neurologie auch Notfallsprechstunden<br />
im Ambulatorium an.<br />
Seit April 2017 werden die Berichte der Neurologie<br />
per E-Mail an die verschlüsselten E-Mail-Adressen<br />
der Zuweiser und Hausärzte versendet. Die Zuweiser<br />
erhalten folglich zeitnah eine Rückmeldung<br />
über die Beurteilung und das Prozedere.<br />
Kontakt ZPM Neurologie<br />
Montag bis Freitag<br />
08.00 bis 17.00 Uhr<br />
Tel. +41 71 494 90 30<br />
Online-Zuweisung:<br />
www.kssg.ch/neurologie/zuweisung<br />
Für externe Anmeldungen/Zuweisungen:<br />
anmeldung.neurologie@kssg.ch<br />
Für Befundergebnisse und allgemeine Anfragen:<br />
neurologie@kssg.ch<br />
Notfälle<br />
Tel. +41 71 494 11 11<br />
(Bitte verlangen Sie den Dienstarzt<br />
Neurologie.)
Innovation und Entwicklung<br />
13<br />
Das Ostschweizer Gefässzentrum<br />
erweitert sein Angebot<br />
Dr. Georg Heller und Prof. Dr. Florian Dick<br />
«So viel Service vor Ort wie möglich, so viel synergistische<br />
Zentrumsleistung wie nötig» – dies ist der Leitsatz<br />
des Ostschweizer Gefässzentrums, das nun seit<br />
über einem Jahr die gefässmedizinische Zentrumsfunktion<br />
im Kanton St.Gallen wahrnimmt. Optimierte<br />
Ressourcennutzung für Notfälle und komplexe Behandlungen<br />
kombiniert mit regionaler Verfügbarkeit<br />
der Zentrumserfahrung ist dabei das Ziel.<br />
Ab 1. März 2018 ist das Ostschweizer Gefässzentrum<br />
mit Dr. Georg Heller, FMH Chirurgie und Gefässchirurgie,<br />
und in enger Zusammenarbeit mit der Spitalregion<br />
Rheintal-Werdenberg-Sarganserland (SR RWS)<br />
neu auch im Rheintal präsent. Dr. Heller bringt seine<br />
jahrelange Erfahrung als Leitender Arzt Gefässchirurgie<br />
am Kantonsspital Graubünden mit (2006 – 2018)<br />
und ist im Rheintal bestens vernetzt. Er wird mit seiner<br />
Expertise an zwei Tagen das Zentrum am Kantonsspital<br />
St.Gallen unterstützen und während drei<br />
Tagen die Woche eine Indikationssprechstunde, gefässchirurgische<br />
Operationen und deren Nachsorge<br />
am Spital Grabs anbieten.<br />
Zuweisungen<br />
Mittels Zuweisungsschreiben an:<br />
Zentrales Patientenmanagement<br />
Ostschweizer Gefässzentrum<br />
Tel. +41 71 494 19 19<br />
gefaesszentrum@kssg.ch<br />
oder direkt an die Spitalregion Rheintal-<br />
Werdenberg-Sarganserland (SR RWS)<br />
Strahlentherapie auf höchstem Niveau<br />
Die Klinik für Radio-Onkologie bietet ein umfassendes<br />
Spektrum der modernen Strahlentherapie auf<br />
höchstem medizinischen und technologischen<br />
Niveau an. Der Artikel auf den Folgeseiten erläutert,<br />
welche Werte der Chefarzt der Klinik für Radio-<br />
Onkologie und sein Team leben, welche Arbeiten zur<br />
Durchführung einer Strahlentherapie nötig sind, wie<br />
die Klinik neue technische Entwicklungen berücksichtigt<br />
und schliesslich, was Sie als Zuweiser von der<br />
Klinik für Radio-Onkologie erwarten können.<br />
Mehr über die Strahlentherapie auf Seite <strong>14</strong>
<strong>14</strong> Innovation und Entwicklung<br />
Wo Menschlichkeit auf<br />
Technik trifft<br />
Die Klinik für Radio-Onkologie des Kantonsspitals<br />
St.Gallen sorgt dafür, dass an<br />
einem Tumor leidende Patienten geheilt<br />
werden können oder zumindest deren<br />
Lebensqualität verbessert wird. Dafür<br />
steht hochmoderne Technik und ein engagiertes<br />
Team zur Verfügung, das den<br />
Patienten und seine individuelle Situation<br />
in den Mittelpunkt rückt.<br />
«Jetzt muss ich auch noch zum Bestrahlen. Ist es<br />
denn bereits so schlimm?» Diese Reaktion auf die<br />
Zuweisung in seine Klinik sei nicht selten, erklärt<br />
Prof. Ludwig Plasswilm, Chefarzt der Klinik für Radio-<br />
Onkologie. «Patienten kommen in einer schwierigen<br />
Lebenslage mit einer ernsthaften Erkrankung zu<br />
uns und hatten meistens noch nie Kontakt mit<br />
einer Strahlentherapie.» Dass diese Therapieform<br />
in der öffentlichen Wahrnehmung häufig negativ<br />
behaftet ist und vom Patienten anfangs vielleicht nur<br />
als Verlängerung des Leidens wahrgenommen wird,<br />
ist aber alles andere als gerechtfertigt. Denn die<br />
Realität schaut anders aus: «Rund 70 Prozent der<br />
Patienten behandeln wir mit dem Ziel einer vollständigen<br />
Heilung», so Prof. Plasswilm. «Bei den verbleibenden<br />
30 Prozent beabsichtigen wir, die Lebensqualität<br />
zu verbessern.»<br />
Die Suche nach der bestmöglichen<br />
Strahlentherapie<br />
Doch wie kann die optimale Therapieform für den<br />
jeweiligen Patienten gefunden werden? «Unsere<br />
Überlegungen zur bestmöglichen Strahlentherapie<br />
für jeden einzelnen Patienten folgen der zentralen<br />
Frage in der Medizin – egal, ob die Behandlung<br />
mit Medikamenten, einer OP oder mit einer Strahlentherapie<br />
durchgeführt wird: Mit welchen Mitteln<br />
erreichen wir eine bestmögliche Heilungschance<br />
des Patienten oder können zur Verbesserung seiner<br />
Lebensqualität beitragen, und welche möglichen<br />
Nachteile für den Patienten müssen wir dabei berücksichtigen?»,<br />
erklärt Prof. Plasswilm.<br />
Nach der Anmeldung durch den zuweisenden Arzt<br />
beurteilen die Radio-Onkologen die Krankheitssituation<br />
des Patienten. Die Wahl und Kombination<br />
der möglichen Therapieformen – Chemotherapie,<br />
Operation und Strahlentherapie – wird im Rahmen<br />
interdisziplinärer «Tumorboards» diskutiert und<br />
lehnt sich wenn möglich an anerkannte Standards an.<br />
Die Radio-Onkologen legen nun die Höhe der Radiotherapiedosis,<br />
die Anzahl der Bestrahlungssitzungen<br />
und die zeitliche Koordination mit weiteren Therapie-
Innovation und Entwicklung<br />
15<br />
formen fest. Bei der Definition der optimalen Bestrahlungstechnik<br />
sind mehrere spezialisierte<br />
Berufsgruppen der Klinik für Radio-Onkologie beteiligt.<br />
Neben den Ärzten sind dies Medizinphysiker<br />
und diplomierte Radiologiefachleute (früher<br />
«MTRAs»). Dabei verfolgen sie das Ziel, den<br />
Tumor hinreichend mit Strahlendosis abzudecken,<br />
aber das umliegende Gewebe gleichzeitig optimal<br />
zu schonen.<br />
Die Bestrahlungsplanung mit spezialisierten<br />
Bestrahlungsplanungsprogrammen erfolgt auf der<br />
Basis von CT-(Computertomografie)-Bilddaten.<br />
Diese wurden am Klinik-eigenen CT-Gerät aufgenommen,<br />
das sich durch eine besonders grosse<br />
Öffnung auszeichnet und es deshalb erlaubt, den<br />
Patienten in einer geeigneten und reproduzierbaren<br />
Bestrahlungsposition zu lagern.<br />
Damit der Radio-Onkologe das zu bestrahlende Gebiet<br />
und die zu schonenden Organe exakt definieren<br />
(«einzeichnen») kann, werden den CT-Bilddaten<br />
oft MR-(Magnetresonanz)- und PET-(Positronen-Emissions-Tomografie)-Bilddaten<br />
überlagert.<br />
Die eingezeichneten Strukturen werden mit Dosisvorgaben<br />
versehen, die der Bestrahlungsplan<br />
bestmöglich erfüllen muss.<br />
Vor der eigentlichen Bestrahlung am Patienten prüft<br />
ein Medizinphysiker durch unabhängige Berechnung<br />
und Messung an einem «Phantom-Patienten» (siehe<br />
Bild), ob das Bestrahlungsgerät die vom Planungssystem<br />
berechnete Dosis wie vorgesehen abstrahlt.<br />
Mit dieser «Planverifikation» kann eine maximale Behandlungssicherheit<br />
gewährleistet werden.<br />
Mittels Fraktionierung zur optimalen<br />
Dosiswirkung<br />
Nach den Planungsvorbereitungen beginnt die<br />
eigentliche Strahlentherapie. «Diese dauert pro<br />
Sitzung meist ca. 15 Minuten und wird je nach<br />
Indikation in einem Zeitraum von einem Tag bis zu<br />
Vorbereitungen für den nächsten Patienten.
16 Innovation und Entwicklung<br />
Vereint für eine optimale Bestrahlungstechnik.<br />
Messungen an einem «Phantom-Patienten».<br />
Technische<br />
Ausstattung<br />
– zwei baugleiche Linearbeschleuniger<br />
modernster Bauart (Varian TrueBeam STX)<br />
– eine Tomotherapieanlage<br />
– eine Brachytherapieeinheit (gynäkologische<br />
Bestrahlungen, Lunge, Speiseröhre,<br />
intraoperative Bestrahlungen)<br />
– Seedimplantationen der Prostata<br />
(intraoperative Brachytherapietechnik)<br />
– ein Planungs-Computertomograf (CT)<br />
für die Bestrahlungsplanung<br />
– ein Therapiesimulator<br />
– zwei konventionelle Röntgentherapiegeräte<br />
zur Bestrahlung oberflächlicher Tumoren<br />
und benigner Prozesse<br />
– eine Bettenstation (u. a. für Radio-<br />
Chemotherapien)<br />
7 ½ Wochen durchgeführt», so Arthur Sterchele,<br />
Leitender Radiologiefachmann. Viele Patienten<br />
möchten wissen, warum sie jeden Tag, meist über<br />
mehrere Wochen, nach St.Gallen kommen müssen.<br />
«Mit dieser sogenannten Fraktionierung berücksichtigen<br />
wir, dass sich das gesunde Gewebe schneller<br />
von der Strahlenwirkung erholt als das Tumorgewebe»,<br />
erklärt Prof. Plasswilm. «Damit ist es möglich,<br />
den Tumor abzutöten, ohne dass das gesunde<br />
Gewebe bleibenden Schaden erleidet.»<br />
Vor der Bestrahlung legen die verantwortlichen<br />
Radiologiefachleute den Patienten auf den Behandlungstisch<br />
am Bestrahlungsgerät (siehe Bild) in die<br />
am CT zuvor festgelegte Bestrahlungsposition. Zur<br />
Stabilisierung dienen verschiedene Lagerungshilfen<br />
wie beispielsweise Haltegriffe und Kniefixierungen.<br />
Für Bestrahlungen im Kopf- und Halsbereich wurden<br />
schon am CT individuelle Kunststoffmasken angefertigt<br />
(siehe Bild). Mit einem am Bestrahlungsgerät<br />
angebrachten Röntgenbildsystem (CT-Bildgebung)<br />
vergleicht die zuständige Radiologiefachperson<br />
die aktuelle Patientenlage mit der am CT festgelegten<br />
Lage. Durch eine Verschiebung des Behandlungstisches<br />
kann er den Patienten nötigenfalls in die vorgesehene<br />
Position bringen. Dank der Fortschritte<br />
im Bereich der Bildgebung und verfeinerter Arbeitsprozesse<br />
erreicht die Klinik für Radio-Onkologie<br />
eine Bestrahlungsgenauigkeit im Millimeterbereich.<br />
Dann folgt die eigentliche Bestrahlung.
Innovation und Entwicklung<br />
17<br />
Schnell<br />
Die Klinik für Radio-Onkologie nimmt für die Kantone<br />
St.Gallen und beider Appenzell eine Zentrumsfunktion<br />
ein. Für jährlich gegen 1200 Krebspatienten<br />
erfüllt die Klinik die Hauptaufgabe, die Indikation<br />
zu einer Strahlenbehandlung zu prüfen und solche<br />
Behandlungen individuell durchzuführen. Zur<br />
Behandlung eines breiten Spektrums onkologischer<br />
Erkrankungen verfügt die Radio-Onkologie<br />
über qualifizierte Mitarbeitende, hochmoderne<br />
Geräte und fortschrittliche Bestrahlungsmethoden.<br />
Es ist der Klinik ein wichtiges Anliegen,<br />
die zuweisenden Ärzte vor, während und nach<br />
der Behandlung in die Versorgung der Patienten<br />
miteinzubeziehen.<br />
Strahlentherapie bei oberflächlichen Tumorerkrankungen<br />
und benignen Erkrankungen<br />
Zum therapeutischen Angebot der Klink gehört auch<br />
die Bestrahlung oberflächlicher Tumorerkrankungen.<br />
Diese wird im Vergleich zu anderen Therapieformen<br />
oft aus ästhetischen und gelegentlich auch funktionellen<br />
Gründen angeboten. Entgegen dem Wortlaut<br />
ihrer Bezeichnung ist die Radio-Onkologie auch<br />
geeignet, benigne Erkrankungen strahlentherapeutisch<br />
zu behandeln. Dazu gehören degenerative,<br />
entzündliche, hyperproliferative sowie funktionelle<br />
Erkrankungen oder Dysfunktionen. Ein bekanntes<br />
Beispiel ist der im Volksmund bekannte «Tennisellenbogen».<br />
Fortschritte der Strahlentherapie<br />
Die Reproduzierbarkeit der Patientenlagerung und<br />
die Genauigkeit der Dosisapplikation sind wesentliche<br />
Voraussetzungen, damit das Tumorgebiet und<br />
das angrenzende gesunde Gewebe möglichst differenziert<br />
bestrahlt werden können. Dazu verfügt die<br />
Klinik für Radio-Onkologie über geeignete Geräte<br />
und Behandlungstechniken.<br />
«Die Radio-Onkologie hat sich in den letzten Jahren<br />
enorm weiterentwickelt. Durch neue Verfahren und<br />
schonende Bestrahlungstechniken konnten die<br />
Heilungschancen für Krebserkrankungen verbessert<br />
und Nebenwirkungen deutlich reduziert werden»,<br />
so Dr. Hans Schiefer, Leitender Medizinphysiker. So<br />
kann das umliegende Gewebe nun noch besser<br />
geschont werden, da die Form der Strahlenfelder<br />
viel genauer an das Zielvolumen angepasst werden<br />
kann. Während sich die Strahlenquelle um den<br />
Patienten bewegt, wird die Form des Strahlenfeldes<br />
zudem permanent moduliert, was schliesslich zu<br />
einer deutlich besseren Dosisverteilung führt.<br />
Hochpräzisionsbestrahlungstechniken wie die Volumetrisch<br />
Modulierte Bogenbestrahlung (VMAT), die<br />
Intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT) und<br />
die Tomotherapie sind seit Jahren in der klinischen<br />
Routine etabliert. Auch fraktionierte stereotaktische<br />
Behandlungstechniken, die Radiochirurgie (hochgenaue<br />
Einzeitbestrahlung) und Gating-/Atemkompensationstechniken<br />
werden mittlerweile routinemässig<br />
durchgeführt. Alle Bestrahlungstechniken<br />
werden durch modernste bildgebende Systeme unterstützt<br />
(«Image Guided Radiation Therapy», IGRT).<br />
Aber auch das Ambiente im Bestrahlungsraum wurde<br />
verbessert. «Trotz der dicken Betonummantelung<br />
des ‹Strahlenbunkers› bieten wir den Patienten<br />
eine gute Atmosphäre an, welche die geballte<br />
Technik in den Hintergrund treten lässt. Farben, ein<br />
stimmungsvolles Deckenbild und Musik in den Bestrahlungsräumen<br />
tragen zu einem höheren Wohlbefinden<br />
und zur Entspannung des Patienten bei,<br />
was zu einer besseren Lagerungsstabilität und somit<br />
zu einem höheren Therapieerfolg beitragen kann»,<br />
so der Medizinphysiker. Und darum geht es in der<br />
Radio-Onkologie schliesslich: eine für jeden Patienten<br />
individuell zugeschnittene Behandlung, um den<br />
optimalen Erfolg zu erzielen – verbunden mit der<br />
Wahrnehmung des Patienten als Mensch, der eine<br />
ganzheitliche Unterstützung erfahren soll.<br />
Kontakt für Zuweiser<br />
Bitte senden Sie das ausgefüllte<br />
Formular für Zuweisungen an:<br />
Klinik für Radioonkologie<br />
Chefarztsekretariat<br />
Rorschacher Strasse 95<br />
CH-9007 St.Gallen<br />
Tel. +41 71 494 18 18<br />
sekretariat.radio-onkologie@kssg.ch
18<br />
Prozesse und Organisation<br />
Baustart Haus 07A<br />
sowie Tiefgarage<br />
Nun ist es so weit: Am 3. April 2018 haben im Innenareal<br />
in St.Gallen die Bauarbeiten für das Haus 07A<br />
sowie die zentrale Tiefgarage begonnen. Das<br />
Kantonsspital St.Gallen hat vom Amt für Baubewilligungen<br />
der Stadt St.Gallen Anfang März 2018 die<br />
Baubewilligung für den Neubau der Häuser 07A, O7B<br />
und der zentralen Tiefgarage erhalten. Ebenfalls<br />
genehmigt ist das Baugesuch für das neue Ostschweizer<br />
Kinderspital.<br />
Für Patienten und Besuchende bleibt das Kantonsspital<br />
St.Gallen uneingeschränkt erreichbar. Zudem<br />
ermöglichen spezielle, emissionsarme Bauverfahren<br />
eine Bauweise, die den Lärm und die Erschütterungen<br />
in den Bestandesbauten auf ein Minimum<br />
reduziert.<br />
Nächste Bauschritte<br />
Anfang April haben im Innenareal des Kantonsspitals<br />
St.Gallen die mehrwöchigen Vorbereitungen für die<br />
Bauarbeiten wie beispielsweise die Baustelleneinrichtung<br />
oder das Erstellen der Bauwände begonnen.<br />
Ende Juni starten dann – nach einem offiziellen<br />
Spatenstich – die eigentlichen Tiefbauarbeiten. Nach<br />
Planung werden im Jahre 2023 der Neubau 07A<br />
sowie die neue Tiefgarage mit rund 450 Parkplätzen<br />
in Betrieb gehen.<br />
Höhere Betriebseffizienz und mehr<br />
Patientenkomfort<br />
Die etappierte Erneuerung und bauliche Erweiterung<br />
des Kantonsspitals St.Gallen sieht ein modernes<br />
Spital vor mit hochinstallierten und hochintegrativen<br />
Bereichen wie Notfallaufnahme,<br />
Operationsbereiche, Intensivstationen, Radiologie<br />
und interventionelle Therapien der Kardiologie,<br />
Pneumologie und Gastroenterologie. Um diese Kernbereiche<br />
sind weitere ambulante Bereiche sowie<br />
darüber im Turmbau 07A die sechs neuen Bettenstationen<br />
angeordnet.<br />
Dank dieser Konzeption sind sowohl für die Patientinnen<br />
und Patienten als auch für die medizinischen<br />
Fachpersonen kurze und effiziente Wege sichergestellt.<br />
Dies vereinfacht den Behandlungsablauf<br />
sowie den interdisziplinären Fachaustausch. Dank<br />
der modernen Infrastruktur geniessen die Patienten<br />
mehr Komfort und grössere Zimmer. Das Kantonsspital<br />
St.Gallen schafft durch den Neubau eine<br />
Infrastruktur, die der medizinischen Entwicklung<br />
Rechnung trägt, und ist damit für die Zukunft<br />
gerüstet.<br />
Detaillierte Informationen zum Projekt:<br />
www.kssg.ch/bau
Prozesse und Organisation 19<br />
Unterstützung<br />
von Biogasanlagen<br />
gegen Methanemissionen<br />
Mit dem vorliegenden Magazin unterstützt das<br />
Kantonsspital St.Gallen das Projekt «Kleinbauern<br />
forsten Wälder auf» der Klimaschutz-Organisation<br />
myclimate.<br />
Diese Initiative ermutigt Kleinbauern in Uganda,<br />
Wald aufzuforsten und bestehende Wälder besser<br />
zu bewirtschaften. Dadurch ist das Fundament<br />
für eine langfristig nachhaltige Landnutzung gelegt,<br />
welche die Absorption von Kohlenstoff durch die<br />
Bäume und die Speicherung in deren Biomasse garantiert.<br />
Gleichzeitig wird die biologische Diversität<br />
unterstützt und das Gemeinwohl verbessert.<br />
Das Projekt schafft Einkommensmöglichkeiten<br />
für 3278 Farmer und deren Familien. Seit Projektstart<br />
wurde auf 4064 Hektar Wald aufgeforstet,<br />
das entspricht etwa 5691 Fussballfeldern.<br />
Arzneimittelsicherheit<br />
Arzneimittelsicherheit ist in Spitälern, schweizwie<br />
auch weltweit, ein wichtiges Thema. Jeder<br />
Spitalpatient kommt mit Arzneimitteln in Berührung,<br />
sei es als grundlegende Therapieform<br />
oder beispielsweise mit einem Beruhigungsmittel<br />
während eines Untersuchs. Die Sensibilisierung<br />
für das Thema «Arzneimittelsicherheit» hat in den<br />
letzten Jahren deutlich zugenommen. So auch<br />
am Kantonsspital St.Gallen. Im Sommer 2017 wurde<br />
der SanaCERT Suisse Standard 26 «Sichere Medikation»<br />
am Standort Flawil und im Herbst 2017<br />
am Standort Rorschach erfolgreich eingeführt.<br />
Am Standort St.Gallen werden bereits einzelne Aspekte<br />
des Standards umgesetzt, eine vollständige<br />
Umsetzung ist bis 2020 geplant.<br />
Autologe Stammzell-Retransfusion<br />
am Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
Seit 1991 führt das Kantonsspital intensive Chemotherapien<br />
durch, die durch die Gabe autologer<br />
Blutstammzellen unterstützt werden. Für Patienten<br />
aus den Kantonen St.Gallen, Appenzell, Thurgau,<br />
Graubünden und aus dem Fürstentum Liechtenstein<br />
ist das Kantonsspital das Zuweisungszentrum in<br />
der Ostschweiz für diese hochspezialisierte Form<br />
der Krebstherapie.<br />
Mehr über Autologe Stammzell-Retransfusion am<br />
Kantonsspital St.Gallen auf Seite 20
Prozesse und Organisation<br />
21<br />
Autologe Stammzell-<br />
Retransfusion am<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Seit 1991 führt das Kantonsspital St.Gallen intensive Chemotherapien durch, die durch die Gabe<br />
autologer Blutstammzellen unterstützt werden. Für Patienten aus den Kantonen St.Gallen,<br />
Appenzell, Thurgau, Graubünden und dem Fürstentum Liechtenstein ist das Kantonsspital das<br />
Zuweisungszentrum in der Ostschweiz für diese hochspezialisierte Form der Krebstherapie.<br />
Aus Anlassder kürzlich durchgeführten 500. autologen Stammzell-Retransfusion am KSSG soll<br />
dieses Behandlungskonzept hier näher vorgestellt werden.<br />
Bei vielen Chemotherapeutika besteht ein direkter<br />
Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung.<br />
Hohe Zytostatika-Dosierungen ermöglichen zwar<br />
eine besonders wirksame Tumortherapie, führen<br />
aber gleichzeitig zu einer starken und lange anhaltenden<br />
Hemmung der Blutbildung im Knochenmark.<br />
Um dies zu verhindern, werden vom Patienten vor<br />
einer Hochdosis-Chemotherapie blutbildende Knochenmark-Stammzellen<br />
aus dem Blut entnommen<br />
und eingefroren. Nach der Hochdosis-Chemotherapie<br />
werden die Stammzellen aufgetaut und in die<br />
Vene des Patienten infundiert, von wo sie den Weg<br />
in das Knochenmark finden. Dort nisten sie sich<br />
ein, vermehren sich, reifen aus und führen nach gut<br />
zwei Wochen wieder zu einer fast normal funktionierenden<br />
Blutbildung. Ohne die verabreichten<br />
Stammzellen würde die Blutbildung im Knochenmark<br />
aufgrund der in hohen Dosen verabreichten Chemotherapie<br />
über Wochen oder Monate ausbleiben,<br />
was wegen der dann sehr langen Neutropeniedauer<br />
lebensgefährlich wäre.<br />
Unterschied zwischen der autologen und<br />
allogenen Stammzell-Transplantation<br />
Die Verwendung blutbildender Stammzellen ermöglicht<br />
es also, Krebskrankheiten mit intensiveren und<br />
damit oft wirksameren Chemotherapien zu behandeln.<br />
Von einer autologen Blut-Stammzell-Retransfusion<br />
wird gesprochen, wenn ein Patient mit seinen<br />
eigenen Blut-Stammzellen behandelt wird, von<br />
einer allogenen Stammzell-Transplantation, wenn<br />
Zellen von einem gesunden verwandten oder unverwandten<br />
Menschen eingesetzt werden. Autologe<br />
Stammzell-Retransfusionen werden in der Schweiz<br />
an sieben Zentrumsspitälern durchgeführt, allogene<br />
Stammzell-Transplantationen dagegen nur in Zürich,<br />
Basel und Genf.<br />
Für welche Krebskrankheiten ist die autologe<br />
Stammzell-Retransfusion besonders geeignet?<br />
Die Krankheiten des blutbildenden Systems, also<br />
Leukämien, Lymphome oder Myelome, eignen<br />
sich besonders gut für eine hochdosierte Chemo-<br />
< PD Dr. Felicitas Hitz, Leitende Ärztin, und Dr. Urs Hess, Stv. Chefarzt und Leitender Arzt, Klinik für<br />
Medizinische Onkologie und Hämatologie, verfügen über eine langjährige Erfahrung mit Stammzelltherapien.
22 Prozesse und Organisation<br />
therapie mit Stammzell-Retransfusion. Die Überlegenheit<br />
dieser Therapieform gegenüber konventionell<br />
dosierten Chemotherapien konnte bei diesen<br />
Krankheiten in randomisierten Phase-III-Studien<br />
gezeigt werden. Zusätzlich sind die Hochdosistherapien<br />
auch bei Keimzelltumoren und bei pädiatrischen<br />
Tumoren wie Neuroblastomen und Ewing-<br />
Sarkomen zugelassen.<br />
Der optimale Zeitpunkt einer solchen Therapieintensivierung<br />
ist abhängig von der Grundkrankheit.<br />
Beim Multiplen Myelom gehört die Intensivierung<br />
bei unter 75-jährigen Patienten an das Ende der<br />
ersten Behandlungsphase. Dadurch lässt sich eine<br />
Verlängerung des progressionsfreien und des Gesamtüberlebens<br />
erreichen. Bei aggressiven Lymphomen<br />
und Keimzelltumoren hat die Intensivierung<br />
vor allem im Rezidiv ihren Stellenwert, sofern die<br />
Krankheit weiterhin chemotherapiesensibel ist.<br />
Für Patienten mit Lymphomen ist eine Heilung mit<br />
Hochdosistherapie und autologer Stammzell-<br />
Retransfusion ein realistisches Ziel.<br />
Wie gewinnt man Stammzellen?<br />
Die blutbildenden Stammzellen befinden sich im<br />
Knochenmark und sind im Blut nur in sehr geringer<br />
Konzentration vorhanden. Früher wurden daher<br />
die Stammzellen in Narkose im Operationssaal<br />
direkt durch eine Knochenmarkentnahme aus<br />
dem Beckenkamm entnommen. Mit Medikamenten<br />
kann man heute erreichen, dass blutbildende<br />
Stammzellen in grosser Zahl für einige Tage vom Knochenmark<br />
ins Blut wandern, wo sie mit einem Zellseparator<br />
gewonnen werden. Diese Leukapheresen<br />
führt das Ostschweizer Blutspendezentrum SRK<br />
durch. Der Zellseparator isoliert aus dem Blutstrom<br />
die Stammzellen, während die reifen Blutzellen<br />
wieder zum Patienten zurückfliessen. Normalerweise<br />
gelingt es, mit einer drei bis vier Stunden<br />
dauernden Leukapherese genügend Stammzellen<br />
zu gewinnen. Die Stammzellen werden in einem<br />
speziell gesicherten Tank bei minus 130 Grad eingelagert.<br />
So können sie jahrelang aufbewahrt<br />
werden, ohne ihre Fähigkeit zur Teilung und Ausreifung<br />
zu verlieren.
Prozesse und Organisation<br />
23<br />
Schnell<br />
Bei vielen Chemotherapeutika besteht ein direkter<br />
Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung. Hohe<br />
Zytostatika-Dosierungen ermöglichen zwar eine<br />
besonders wirksame Tumortherapie, führen aber<br />
gleichzeitig zu einer starken und lange anhaltenden<br />
Hemmung der Blutbildung im Knochenmark. Um<br />
dies zu verhindern, werden vom Patienten vor einer<br />
Hochdosis-Chemotherapie blutbildende Knochenmark-Stammzellen<br />
aus dem Blut entnommen und<br />
eingefroren. Nach der Hochdosis-Chemotherapie<br />
werden die Stammzellen aufgetaut und in die Vene<br />
des Patienten infundiert, von wo sie den Weg in das<br />
Knochenmark finden. Dort nisten sie sich ein, vermehren<br />
sich, reifen aus und führen nach gut zwei<br />
Wochen wieder zu einer fast normal funktionierenden<br />
Blutbildung. Diese Zelltherapien sind sowohl<br />
technologisch als auch in der Patientenbetreuung<br />
sehr anspruchsvoll.<br />
Ablauf einer Hochdosistherapie mit<br />
Stammzell-Retransfusion<br />
Wir führen die Hochdosistherapien am KSSG auf<br />
einer dafür speziell ausgestatteten Bettenstation<br />
durch. Einige Tage nach Gabe der myeloblativen Chemotherapie<br />
kommt es zum Absterben der Tumorzellen<br />
und ebenso der reifen Blutzellen. Diese Knochenmarksaplasie<br />
bewirkt, dass Erythrozyten und<br />
Thrombozyten in den transfusionsbedürftigen Bereich<br />
abfallen und dass aufgrund fehlender Leukozyten<br />
eine hohe Infektgefährdung besteht. Diese heikle<br />
Phase dauert etwa 2 bis 3 Wochen. Auf der Station<br />
sind diverse infektprophylaktische Massnahmen im<br />
Bereich der Pflege implementiert und es ist eine<br />
keimfiltrierte Belüftung der gesamten Station installiert.<br />
Trotz dieser Massnahmen kommt es häufig zu septischen<br />
Zustandsbildern. Eine gezielte Diagnostik und<br />
die rasche Einleitung einer breit wirksamen antibiotischen<br />
Therapie sind in dieser Situation lebenswichtig.<br />
In einem innovativen Projekt versuchen<br />
wir derzeit, eine drohende Sepsis noch früher zu<br />
erkennen und dadurch Komplikationen wie Kreislaufzusammenbruch<br />
und Multiorganversagen zu<br />
verhindern. Eine erste Analyse unserer Daten zeigt,<br />
dass dieses Projekt erfolgreich ist und weniger<br />
Patienten auf die Intensivstation verlegt werden<br />
müssen. Nach insgesamt drei bis vier Wochen kann<br />
die Mehrzahl der Patienten das Spital verlassen<br />
und in der ambulanten Nachsorge weiterbetreut<br />
werden.<br />
Enormes Potenzial der Zelltherapien<br />
Neuere Forschungen zeigen, dass immunvermittelte<br />
Therapien ein enormes Potenzial gegen Krebszellen<br />
haben. Tumorzellen können sich gegenüber den<br />
Zellen des Immunsystems tarnen und der Immunabwehr<br />
entwischen. Medikamente, welche diese<br />
Tarnung durchbrechen und die Immunzellen gegen<br />
die Krebszellen wieder scharfmachen, sind bereits<br />
auf dem Markt und bei zahlreichen Tumoren sehr<br />
wirksam.<br />
Sogenanntebispezifische Antikörper haben eine<br />
Bindungsstelle zum T-Lymphozyten und eine<br />
zweite zur Tumorzelle. Dadurch kann die Immunzelle<br />
direkt an die Krebszelle andocken und sie<br />
so bekämpfen.<br />
Mit einer absolut bahnbrechenden Wirkung gegen<br />
therapierefraktäre akute Leukämien und Lymphomen<br />
haben die CAR-T-Zellen (Chimeric Antigen<br />
Receptor T-cells) ein grosses Echo in der Fachpresse<br />
ausgelöst. Dieses technisch sehr anspruchsvolle<br />
Konzept basiert darauf, dass sehr viele T-Lymphozyten<br />
des Patienten in vitro gentechnologisch so umprogrammiert<br />
werden, dass sie sich alle gegen ein<br />
bestimmtes Antigen auf der Tumorzelle richten und<br />
diese Zelle abtöten können. Nach Expansion in<br />
vitro werden diese chimärischen Antigen-Rezeptor-<br />
T-Zellen dem Patienten zurücktransfundiert. Sie<br />
können sich dann weiter vermehren und eine immunologische<br />
Dauerwirkung gegen Tumorzellen entfalten.<br />
Die CAR-T-Zelltherapie ist in den USA für<br />
akute lymphatische Leukämien und aggressive Lymphome<br />
kürzlich zugelassen worden.<br />
Diese Zelltherapien sind sowohl technologisch als<br />
auch in der Patientenbetreuung sehr anspruchsvoll.<br />
Mit seiner nun 27-jährigen Erfahrung mit Stammzelltherapien<br />
ist das Team der Leukämiestation am<br />
KSSG bestens aufgestellt, um diese innovativen Zelltherapien<br />
auch künftig erfolgreich durchzuführen.
24<br />
Agenda<br />
Veranstaltungen<br />
April bis August 2018<br />
APRIL<br />
Do 05.04.2018 4. Neurochirurgie Update<br />
Klinik für Neurochirurgie<br />
<strong>14</strong>.00–18.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Fr 20.04.2018 Stroke Lunch: Das reversible zerebrale<br />
Vasokonstriktionssyndrom – Fallbericht und<br />
Übersicht zum Krankheitsbild<br />
Klinik für Neurologie<br />
12.00–13.00 Uhr<br />
Haus 04, <strong>14</strong>. Stock, Kursraum <strong>14</strong>11,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Fr 20.04.2018 Onkolunch<br />
Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie<br />
12.30–13.45 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 23.04.2018 Hepatologie-Kolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
17.30–18.45 Uhr<br />
Haus 21, Raum 101, Kantonsspital St.Gallen<br />
Di 24.04.2018 ZIM Lunch<br />
Zentrum für Integrative Medizin<br />
12.30–<strong>14</strong>.00 Uhr<br />
Haus 33, Raum 0<strong>14</strong>, Kantonsspital St.Gallen<br />
Do 26.04.2018 6. St.Galler Wound-Care-Symposium<br />
Klinik für Angiologie<br />
08.30–16.30 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, St.Gallen<br />
Do 26.04.2018 Zuweiser-Event 2018<br />
16.00–22.30 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 30.04.2018 8. Fit for Stroke-Days<br />
Klinik für Neurologie<br />
08.30–16.45 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 30.04.2018 Hot topics in the management of inflammatory<br />
joint diseases in 2018<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
MAI<br />
Do 03.05.2018<br />
Do 03.05.2018<br />
Sa 05.05.2018 –<br />
Sa 12.05.2018<br />
Eröffnungssymposium<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
<strong>14</strong>.00–18.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
IBD Roundtable<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
18.15–20.00 Uhr<br />
Haus 03, Raum 1201, Kantonsspital St.Gallen<br />
26. Toggenburger Anästhesie Repetitorium<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und<br />
Schmerzmedizin<br />
Hotel Stump’s Alpenrose, Schwendi, 9658 Wildhaus<br />
Mi 09.05.2018 Kardiologisches Kolloquium<br />
Klinik für Kardiologie<br />
18.00–20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo <strong>14</strong>.05.2018 Nationaler Hautkrebstag<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
12.00–18.00 Uhr<br />
Noch offen<br />
Mi 16.05.2018 Endokrine Nebenwirkungen onkologischer<br />
Therapien<br />
Klinik für Endokrinologie, Diabetologie,<br />
Osteologie und Stoffwechselerkrankungen<br />
18.30–20.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Do 17.05.2018 Essstörungen und Körperbild<br />
Klinik für Psychosomatik<br />
17.15–18.15 Uhr<br />
Haus 11, Parterre, Raum 11-045,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Fr 18.05.2018 Onkolunch<br />
Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie<br />
12.30–13.45 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Do 24.05.2018 Fortbildung für Hausärzte der Klinik für<br />
Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
<strong>14</strong>.00–18.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Do 24.05.2018 Kranke Kinder in utero –<br />
von der Diagnose zur Therapie<br />
Frauenklinik<br />
17.00–18.45 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Fr 25.05.2018 Grand Round Rehabilitation:<br />
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Kliniken Valens<br />
Klinik für Neurologie<br />
12.00–13.00 Uhr<br />
Haus 04, <strong>14</strong>. Stock, Kursraum <strong>14</strong>11,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 28.05.2018 Osteoporose, eine komplexe Erkrankung<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15–19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mi 30.05.2018 Gastro-Kolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.30–20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Do 31.05.2018 Achter St.Galler Ophtag<br />
Augenklinik<br />
09.00–17.15 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen
Agenda<br />
25<br />
JUNI<br />
AUGUST<br />
Mo 04.06.2018<br />
Hepatologie-Kolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
Mo 13.08.2018<br />
Comorbidities in Psoriatric Arthritis<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
Mo 11.06.2018<br />
Mo 11.06.2018<br />
Di 12.06.2018 –<br />
Mi 13.06.2018<br />
Fr 15.06.2018<br />
Mo 18.06.2018<br />
Mi 20.06.2018<br />
Do 21.06.2018<br />
Do 21.06.2018 –<br />
Fr 22.06.2018<br />
17.30–18.45 Uhr<br />
Haus 21, Raum 101, Kantonsspital St.Gallen<br />
52. St.Galler Anästhesie- und Intensivsymposium<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und<br />
Schmerzmedizin<br />
17.00–19.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
SASL School<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
17.30–19.00 Uhr<br />
Haus 21, Raum 101, Kantonsspital St.Gallen<br />
Euregio Kongress<br />
Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und<br />
Transplantationschirurgie<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Onko-Lunch<br />
Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie<br />
12.30–13.45 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
SLE-Kriterien zwischen praktischer<br />
Anwendung und Klassifikation<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15–19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Interdisziplinäre Viszeralmedizin<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.30–20.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Multimodale stationäre Schmerztherapie (MMST)<br />
Schmerzzentrum<br />
13.30–18.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Frühjahresversammlung SGORL<br />
Hals-Nasen-Ohren-Klinik<br />
Congress Center Basel<br />
Mi 15.08.2018<br />
Do 16.08.2018<br />
Fr 17.08.2018<br />
Mo 20.08.2018<br />
Di 28.08.2018<br />
Mi 29.08.2018<br />
Do 30.08.2018<br />
18.15–19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Wenn das Essen krank macht – Nahrungsmittelunverträglichkeiten<br />
und -allergien<br />
Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Osteologie<br />
und Stoffwechselerkrankungen<br />
18.30–20.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
IBD Roundtable<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
18.15–20.00 Uhr<br />
Haus 03, Raum 1201, Kantonsspital St.Gallen<br />
Onko-Lunch<br />
Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie<br />
12.30–13.45 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Hepatologie-Kolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
17.30–18.45 Uhr<br />
Haus 21, Raum 101, Kantonsspital St.Gallen<br />
ZIM-Lunch<br />
Zentrum für Integrative Medizin<br />
12.30–<strong>14</strong>.00 Uhr<br />
Haus 33, Raum 0<strong>14</strong>, Kantonsspital St.Gallen<br />
Gastro-Kolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
18.30–20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Pertussis-Impfung in der Schwangerschaft<br />
und Prävention des Zervixkarzinoms durch<br />
HPV-Impfung<br />
Frauenklinik<br />
17.00–18.45 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mi 27.06.2018<br />
Kardiologisches Kolloquium<br />
Klinik für Kardiologie<br />
Do 30.08.2018<br />
6. St.Galler Senologie Symposium<br />
Brustzentrum St.Gallen<br />
18.00–20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
09.30–17.00 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, St.Gallen<br />
Berneggstrasse 2, 9000 St.Gallen<br />
JULI<br />
Do 05.07.2018 Gastro Update 2018<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
12.45–18.35 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mehr Veranstaltungen und<br />
Informationen unter: www.kssg.ch
Kantonsspital St.Gallen<br />
Rorschacher Strasse 95<br />
CH-9007 St.Gallen<br />
Tel. +41 71 494 11 11<br />
Spital Rorschach<br />
Heidenerstrasse 11<br />
CH-9400 Rorschach<br />
Tel. +41 71 858 31 11<br />
Spital Flawil<br />
Krankenhausstrasse 23<br />
CH-9230 Flawil<br />
Tel. +41 71 394 71 11<br />
www.kssg.ch