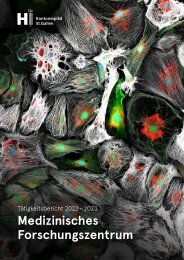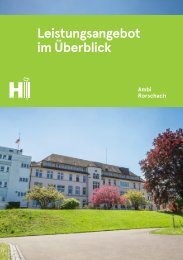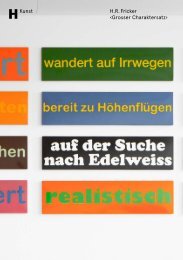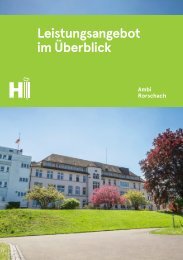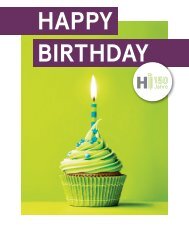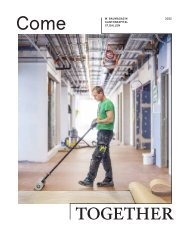DUO_13
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>DUO</strong><br />
Nr. <strong>13</strong><br />
Zuweisermagazin des<br />
Kantonsspitals St.Gallen
3<br />
Editorial<br />
Lösungsorientiert<br />
4<br />
Fokus<br />
Wenn es unter die Haut geht<br />
8<br />
12<br />
18<br />
24<br />
26<br />
Kader im Profil<br />
Kurznews zum Thema<br />
«Stillstand ist für mich etwas Quälendes»<br />
Innovation und Entwicklung<br />
Kurznews zum Thema<br />
Dünne Nerven – grosse Wirkung<br />
Prozesse und Organisation<br />
Kurznews zum Thema<br />
Untersuchungen unter den Wolken<br />
Agenda<br />
Veranstaltungen November 2017 bis April 2018<br />
Perspektivenwechsel<br />
PERFORMANCE<br />
neutral<br />
Drucksache<br />
01-17-986391<br />
myclimate.org<br />
Impressum<br />
Ausgabe Nr. <strong>13</strong>, 2017<br />
Herausgeber Unternehmenskommunikation Kantonsspital St.Gallen<br />
Gestaltung VITAMIN 2 AG, St.Gallen<br />
Druck Cavelti AG, Gossau<br />
Anregungen zum <strong>DUO</strong> nehmen wir gerne per E-Mail entgegen:<br />
redaktion@kssg.ch
Editorial 3<br />
Lösungsorientiert<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
4<br />
14<br />
Die Bautätigkeiten im Rahmen des Neubauprojekts<br />
schreiten mit grossen Schritten voran. Neue Gebäude<br />
entstehen, Kliniken ziehen um und den Patienten<br />
wird eine ihren Bedürfnissen gerechte Infrastruktur<br />
geboten. Die Veränderungen sind nicht nur in der<br />
äusseren, sondern auch in der inneren Architektur<br />
sichtbar und spürbar – wenn Schwierigkeiten auftreten,<br />
suchen wir neue Wege.<br />
Und so war es auch in der Klinik für Radiologie und<br />
Nuklearmedizin. Kapazitätsengpässe – bei 18 000 MR-<br />
Untersuchungen pro Jahr am Standort St.Gallen –<br />
mit den daraus resultierenden Wartezeiten am Kantonsspital<br />
St.Gallen mussten eliminiert werden. Das<br />
Resultat ist das neue Ambulatorium im Neubau der<br />
Regatron AG in Rorschach, das im September 2017<br />
seine Türen geöffnet hat. Das neue Angebot stärkt<br />
den Spitalstandort Rorschach und schafft Synergien.<br />
Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten 21 – 23.<br />
Stillstand soll es auch in unserer Zusammenarbeit<br />
nicht geben. Wir möchten mit Ihnen weiterhin<br />
stets lösungsorientiert handeln, damit wir gemeinsam<br />
neue und bedürfnisgerechte Wege für unsere<br />
Patienten gehen können.<br />
Herzliche Grüsse<br />
20<br />
Dr. Daniel Germann<br />
Direktor und Vorsitzender<br />
der Geschäftsleitung
4 Fokus<br />
Wenn es unter die<br />
Haut geht<br />
Die Klinik für Dermatologie, Venerologie<br />
und Allergologie erlebte in den letzten<br />
eineinhalb Jahren einen starken Wandel.<br />
Ein neuer Chefarzt wurde gewählt, Prozesse<br />
optimiert und Strukturen angepasst.<br />
PD Dr. Dr. Antonio Cozzio leitet<br />
seit Mai 2016 die Klinik und hat, nebst bereits<br />
erreichten Veränderungen, auch<br />
Zukunftspläne, damit sich das grösste<br />
Zentrum für Dermatologie und Allergologie<br />
der Ostschweiz weiterentwickeln<br />
und den Patienten eine optimale Behandlung<br />
anbieten kann.<br />
PD Dr. Dr. Antonio Cozzio, was fasziniert Sie<br />
am Fachbereich der Dermatologie?<br />
Es ist die Kombination von visueller Mustererkennung<br />
und dem intellektuellen Anspruch, die darunterliegende<br />
Immunbiologie, Genetik und auch die<br />
degenerativen Prozesse zu verstehen, die mich an<br />
der Dermatologie fasziniert. Gute Dermatologie<br />
kann nur betrieben werden, wenn wir uns von der<br />
reinen «Oberflächenbetrachtung» entfernen<br />
und den Kontext zu den anderen Organsystemen<br />
herstellen. Diesen Grundsatz gebe ich auch<br />
meinen Mitarbeitern in ihrem täglichen Handeln<br />
mit auf den Weg.<br />
Wie hat sich der Fachbereich der<br />
Dermatologie entwickelt?<br />
Man muss sich vor Augen halten, dass sich diese<br />
Spezialität von einem rein deskriptiven Fach (bis Mitte<br />
der 1980er-Jahre) zu einem stark molekular und<br />
immunologisch orientierten Fach weiterentwickelt<br />
hat. Während man früher nicht selten nach dem<br />
ABC-Verfahren – Anschauen, Beurteilen, Cortison<br />
– vorging, ist in den letzten 30 Jahren das pathogenetische<br />
Verständnis für viele Dermatosen geradezu<br />
explodiert. Davon profitieren direkt unsere<br />
Patienten. Als Beispiel erwähne ich hier die Melanomtherapie,<br />
bei welcher die zielgerichtete Antikörper-
Fokus<br />
5<br />
Schnell<br />
Die Klinik für Dermatologie, Venerologie und<br />
Allergologie des Kantonsspitals St.Gallen steht<br />
seit Mai 2016 unter der Leitung von Chefarzt<br />
PD Dr. Dr. Antonio Cozzio. Das Angebot des grössten<br />
Zentrums für Dermatologie und Allergologie<br />
der Ostschweiz entwickelt sich stetig weiter. Beispielsweise<br />
befindet sich die Klinik ab Ende 2017<br />
in neuen Räumlichkeiten, die nicht nur mehr<br />
Untersuchungszimmer, sondern auch den Vorteil<br />
der interdisziplinären Zusammenarbeit mit der<br />
Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene im gleichen<br />
Haus bieten.<br />
behandlung plötzlich z.T. sogar eine vollständige<br />
Heilung ermöglichen kann. Dieser medizinische Fortschritt<br />
durch angewandte Immunologie und Molekularbiologie<br />
hat mich schon immer fasziniert, und<br />
die Dermatologie ist eines jener Fächer, die durch<br />
diese Forschungsrichtungen wohl am meisten profitiert<br />
haben.<br />
Was konnten Sie in Ihrer bisherigen<br />
Tätigkeit erreichen?<br />
Die Neupositionierung als eigenständige Klinik in<br />
St.Gallen hat dem Fach sicherlich das nötige Gewicht<br />
gegeben, das es auch verdient. Von niedergelassenen<br />
Kollegen der Hausarztmedizin oder Pädiatrie höre<br />
ich, dass 10 bis 20 Prozent ihrer Patienten an Hautkrankheiten<br />
leiden, die zum Teil auch fachärztlich<br />
behandelt werden müssen – hier stehen wir in unse-<br />
ren neuen Räumlichkeiten im Haus 20 gerne für eine<br />
Mitbetreuung zur Verfügung.<br />
Eine Verbesserung des medizinischen Leistungsangebots<br />
am Kantonsspital St.Gallen stellt auch<br />
das neue dermatologische stationäre Angebot im<br />
Haus 02 dar, mit welcher wir Anfang 2018 ins<br />
Haus 04 umziehen werden. Diese Station wird von<br />
dermatologisch geschultem Pflegepersonal<br />
betreut, sodass wir Patienten mit beispielsweise<br />
blasenbildenden Erkrankungen, Hautinfektionen<br />
wie Erysipelen oder Erythrodemien zentral<br />
und professionell stationär behandeln können.<br />
Durch die bisher noch provisorische Anerkennung<br />
des Weiterbildungsstatus B können wir unsere Assistenzärzte<br />
neu drei anstatt eineinhalb Jahre bei<br />
PD Dr. Dr. Antonio Cozzio<br />
Die Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
des Kantonsspitals St.Gallen steht unter<br />
der Leitung von PD Dr. Dr. Antonio Cozzio, der<br />
im Mai 2016 zum Chefarzt gewählt wurde. Antonio<br />
Cozzio ist in St.Gallen aufgewachsen und zur<br />
Schule gegangen. Nach Abschluss des Medizinstudiums<br />
und der Dissertation an der Universität<br />
Bern im Jahre 1991 arbeitete er in der Chirurgie<br />
St. Leonhard und am Kinderspital St.Gallen sowie<br />
ab 1993 am Institut für Molekularbiologie der Universität<br />
Zürich, wo er 1998 das Zweitdoktorat in<br />
Molekularbiologie der Mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität Zürich erlangte.<br />
Von 1999 bis 2002 folgte ein Postdoktorat<br />
an der Stanford University School of Medicine<br />
in Kalifornien, USA. Anschliessend absolvierte er<br />
2006 den Facharzttitel für Dermatologie und<br />
Venerologie am Universitätsspital Zürich. Im selben<br />
Jahr habilitierte er als Oberarzt an der Universität<br />
Zürich. 2010 übernahm Antonio Cozzio<br />
die Leitung der dermatologischen Poliklinik am<br />
Universitätsspital Zürich. Neben der allgemeinen<br />
Dermatologie liegen zwei weitere klinische<br />
Interessen von Antonio Cozzio in der Diagnose<br />
und Behandlung schwerer entzündlicher<br />
Dermatosen sowie in der Betreuung von Patienten<br />
mit kutanen Lymphomen und seltenen<br />
Hauttumoren.
6 Fokus<br />
Das neue Gespann in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie: PD Dr. Dr. Antonio Cozzio und Prof. Dr. Barbara Ballmer-Weber.<br />
uns weiterbilden. Das verbessert die Kontinuität der<br />
Patientenbetreuung und ermöglicht es aber auch,<br />
vermehrt von unseren Weiterbildungsanstrengungen<br />
für die Assistenzärzte zu profitieren.<br />
Und was bringt die Zukunft?<br />
Einiges. Ende Jahr werden wir neue Räumlichkeiten<br />
im Haus 20 beziehen. Dadurch vergrössern wir nicht<br />
nur das Raumangebot, sondern auch unser Behandlungsspektrum.<br />
Neu können wir unter einem Dach<br />
das gesamte Spektrum der Dermatologie und Allergologie<br />
abdecken, inklusive der Dermatochirurgie<br />
und Lasertherapien (medizinisch und ästhetisch). In<br />
Zusammenarbeit mit dem Institut für Pathologie<br />
am KSSG bieten wir neu die sogenannte schnittrandkontrollierte<br />
Dermatochirurgie an, bei welcher<br />
der operative Eingriff patientenfreundlich möglichst<br />
klein, gewebeschonend und in Lokalanästhesie erfolgt.<br />
In der Allergologie möchten wir u. a. das Angebot<br />
der Ultra-Rush-Therapie weiter ausbauen.<br />
EORTC-CLTF-Kongress in St.Gallen<br />
Im September 2018 findet der internationale<br />
Hautlymphom-Kongress der EORTC zum<br />
ersten Mal in St.Gallen statt. Namhafte internationale<br />
und nationale Referenten werden<br />
in den OLMA-Hallen neueste Erkenntnisse<br />
und Studien rund um das Thema «Kutane<br />
Lymphome» präsentieren. PD Dr. Dr. Antonio<br />
Cozzio ist Sekretär dieser EORTC Gruppe.<br />
Dabei wird durch rasche Steigerung einer Allergendosis<br />
eine Toleranz bei Bienen- und Wespengiftallergien<br />
induziert. Ausserdem können wir unseren<br />
Patienten mit chronischen Hautwunden eine rasche<br />
Beurteilung im neuen interdisziplinären Wundzentrum<br />
des KSSG anbieten. Ganz besonders freuen<br />
wir uns auf die Zusammenarbeit mit der Klinik für<br />
Infektiologie/Spitalhygiene, mit welcher wir gemeinsam<br />
im Haus 20 eine STI-Sprechstunde (STI =<br />
Sexuell übertragbare Infektionen) für Geschlechtskrankheiten<br />
anbieten können.<br />
Ab Januar 2018 wird Prof. Dr. Barbara Ballmer-<br />
Weber als Chefärztin ad personam die Leitung des<br />
Fachbereichs Allergologie innerhalb Ihrer Klinik<br />
leiten. Was erwarten Sie von dieser Zusammenarbeit?<br />
(Interview auf Seite 10)<br />
Frau Prof. Dr. Ballmer-Weber und ich kennen uns<br />
schon von der langjährigen Zusammenarbeit in der<br />
Klinik für Dermatologie und Allergologie des Universitätsspitals<br />
Zürich. Dank ihrer langjährigen allergologischen<br />
Berufserfahrung sowie ihrer fundierten<br />
und breiten klinischen und wissenschaftlichen<br />
Ausbildung ist Frau Ballmer-Weber eine hoch qualifizierte,<br />
diagnostisch und therapeutisch sichere<br />
Ärztin. Ich bin sehr froh, dass wir mit ihrer Anstellung<br />
in unserer Klinik unseren Patienten, den Zuweisenden<br />
sowie den Partnerkliniken des KSSG das gesamte<br />
Spektrum der Allergologie in St.Gallen anbieten<br />
können. Eines ihrer klinischen Spezialgebiete sind<br />
die Nahrungsmittelallergien, welche auch für ein<br />
Zentrumsspital eine interdisziplinäre Herausforderung<br />
darstellen.
Fokus<br />
7<br />
Die Zukunft bringt demnach viel Neues. Was können<br />
die Zuweiser von Ihrer Klinik erwarten?<br />
Wir suchen eine enge Zusammenarbeit mit unseren<br />
Zuweisern, Kliniken oder niedergelassenen Kollegen.<br />
Im Fokus unserer gemeinsamen Bemühungen soll<br />
der Patient mit schweren Dermatosen stehen, dem<br />
wir die bestmögliche dermatologische Versorgung<br />
am Zentrumsspital anbieten möchten.<br />
Von vielen Kolleginnen und Kollegen hören wir<br />
zudem, dass ein grosses Bedürfnis für dermatologische<br />
Fortbildungen besteht. Wir haben das<br />
aufgenommen und werden ab 2018 neben<br />
fachärztlichen Schulungen zusätzlich auch für<br />
Grundversorger Nachmittagsfortbildungen<br />
anbieten – wir freuen uns auf diesen Erfahrungsaustausch.<br />
Leistungsangebot<br />
Poliklinik<br />
Auf Zuweisung bieten wir eine allgemeine<br />
dermatologische Sprechstunde sowie Spezialsprechstunden<br />
an für:<br />
– Akne vulgaris<br />
– Autoimmunerkrankungen<br />
– Dermatochirurgie<br />
– Dermatoonkologie mit:<br />
– Melanom<br />
– Epitheliale Hauttumore (spinozelluläre<br />
und Basalzellkarzinome)<br />
– Hautlymphome sowie seltene Hauttumore<br />
– Dermatopädiatrische Erkrankungen<br />
– Geschlechtserkrankungen<br />
– Haar- und Nagelerkrankungen sowie<br />
orale Dermatologie<br />
– Hidradenitis suppurativa (Akne inversa)<br />
– Hyperhidrose<br />
– Immunsupprimierten-Sprechstunde<br />
(Hautkrebsprävention und Therapie bei immunsupprimierten<br />
Patienten)<br />
– Korrigierende und ästhetische Dermatologie<br />
– Muttermalkontrolle und Hautkrebsvorsorge<br />
– Neurodermitis und andere Ekzemerkrankungen<br />
– Oberarztsprechstunde<br />
– Psoriasis<br />
– Wundsprechstunde / Verbandszimmer<br />
Allergologische Ambulanz<br />
– Allergologische Abklärungen insbesondere bei:<br />
– Nahrungsmittelallergien<br />
– Bienen-/Wespenallergien<br />
– Arzneimittelallergien<br />
– Heuschnupfen<br />
– Allgemeine und berufsspezifische<br />
Epikutantestungen<br />
– Berufssprechstunde<br />
– Urtikariasprechstunde<br />
Tagesklinik<br />
– Infusionsbehandlungen entzündlicher<br />
Hauterkrankungen (z. B. Psoriasis, Ekzem,<br />
Hidradenitis suppurativa / Akne inversa, Alopezie)<br />
– Allergologische Therapien (Desensibilisierungen,<br />
Ultra Rush)<br />
– Hauttumorbehandlungen<br />
– Ambulante Tuchtherapien entzündlicher<br />
Hauterkrankungen<br />
Stationäre Abteilung<br />
– Stationäre Betreuung von Patienten mit schweren<br />
entzündlichen Dermatosen oder von dermatochirurgischen/dermatoonkologischen<br />
Patienten<br />
Dermatologische<br />
Notfälle<br />
Patienten mit Allergien, blasenbildenden<br />
Erkrankungen, Geschlechtskrankheiten,<br />
Erysipel, Herpes zoster und andere können*<br />
Sie unter Tel. + 41 71 494 19 90 anmelden<br />
(ambulante und stationäre Behandlungen).<br />
Allgemeine Informationen finden Sie unter<br />
www.kssg.ch/dermatologie, oder<br />
kontaktieren Sie uns: Tel. +41 71 494 19 95,<br />
Fax +41 71 494 63 37, dermatologie@kssg.ch<br />
* tagsüber als Notfall
8 Kader im Profil<br />
Ernennung zum<br />
Privatdozenten<br />
Dr. Daniel Engeler und Dr. Paul Martin Putora sind<br />
durch die Universität Zürich respektive die Universität<br />
Bern zum Privatdozenten ernannt worden.<br />
Dr. Veit Sturm<br />
zum Titularprofessor<br />
ernannt<br />
Die Universität Zürich hat auf Antrag der Medizinischen<br />
Fakultät PD Dr. med. Veit Sturm,<br />
Leitender Arzt in der Klinik für Augenheilkunde<br />
am Kantonsspital St.Gallen, per 16. Juni 2017<br />
zum Titularprofessor ernannt. Prof. Sturm hat<br />
sein Studium der Humanmedizin in Greifswald,<br />
Berlin und San Francisco absolviert. Das<br />
dritte Staatsexamen legte er 1998 an der<br />
Freien Universität Berlin ab. Die Facharztausbildung<br />
für Ophthalmologie hat er am Potsdamer<br />
Klinikum Ernst von Bergmann, akademisches<br />
Lehrkrankenhaus der Charité, und am<br />
Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg<br />
absolviert. Weitere klinische Stationen<br />
waren zwischen 2007 und 2011 die Universitätsaugenklinik<br />
Zürich und die Augenklinik des<br />
Hospitals for Sick Children, Toronto. Seit 2012<br />
leitet Prof. Sturm die Abteilung für Schielerkrankungen<br />
und Neuroophthalmologie an<br />
der Augenklinik des Kantonsspitals St.Gallen.<br />
2010 habilitierte Prof. Sturm an der Universität<br />
Zürich. 2011 hat er den Ruf auf die Professur<br />
Augenheilkunde mit Schwerpunkt Strabologie,<br />
Kinder- und neurologische Ophthalmologie<br />
an die Augenklinik der Charité – Universitätsmedizin<br />
Berlin, abgelehnt. Seine Forschungsschwerpunkte<br />
beinhalten Schielerkrankungen<br />
mit eingeschränkter Muskelmechanik, den<br />
Einsatz bildgebender Verfahren in der Augenheilkunde<br />
und verschiedene Aspekte des<br />
Amblyopiescreenings.<br />
PD Dr. Daniel Engeler ist Leitender Arzt und Stv.<br />
Chefarzt der Klinik für Urologie. Sein Studium der<br />
Humanmedizin hat Dr. Engeler an der Universität<br />
Zürich absolviert. Die Facharztausbildung für<br />
Urologie FMH, spezialisiert in operativer Urologie,<br />
hat er 2004 abgeschlossen. Im Jahr 2005 folgte<br />
der Facharzttitel für Urologie FMH, spezialisiert in<br />
Neuro-Urologie. Seit 20<strong>13</strong> ist er Stv. Chefarzt<br />
der Klinik für Urologie am Kantonsspital St.Gallen.<br />
PD Dr. Paul Martin Putora, Leitender Arzt in der<br />
Klinik für Radio-Onkologie, hat an der Medizinischen<br />
Fakultät der Komenius-Universität in Bratislava<br />
studiert und später Management im Gesundheitswesen<br />
sowie Wirtschaftsinformatik studiert. Nach<br />
Assistenztätigkeiten in der Pneumo-Onkologie sowie<br />
Inneren Medizin hat er 2008 ans Kantonsspital<br />
St.Gallen gewechselt, wo er seine Facharztausbildung<br />
abgeschlossen hat und Leitender Arzt der Klinik<br />
für Radio-Onkologie ist.<br />
Mit Drive in<br />
die Zukunft der<br />
Allergologie<br />
Die Synthese von Innerer Medizin, Dermatologie<br />
und Immunologie hat sie schon immer am Fachbereich<br />
der Allergologie fasziniert. Prof. Dr. Barbara<br />
Ballmer-Weber übernimmt per 1. Januar 2018<br />
die Funktion der Chefärztin ad personam des<br />
Fachbereichs Allergologie innerhalb der Klinik für<br />
Dermatologie, Venerologie und Allergologie.<br />
Mehr über Prof. Dr. Barbara Ballmer-Weber<br />
auf Seite 10.
Kader im Profil<br />
9<br />
Weitere Ernennungen, Wahlen<br />
und Pensionierungen<br />
KLINIK FÜR DERMATOLOGIE, VENEROLOGIE UND ALLERGOLOGIE<br />
KLINIK FÜR ANGIOLOGIE<br />
Wahlen<br />
per 01.01.2018<br />
Prof. Dr. Barbara Ballmer-Weber<br />
Chefärztin ad personam, Fachbereich Allergologie<br />
Beförderung<br />
per 01.01.2018<br />
Dr. Alexander Poloczek<br />
Leitender Arzt<br />
KLINIK FÜR MEDIZINISCHE ONKOLOGIE UND HÄMATOLOGIE<br />
UND INSTITUT FÜR PATHOLOGIE<br />
Wahlen<br />
per 01.04.2018<br />
Dr. Thomas Lehmann<br />
Leitender Arzt<br />
KLINIK FÜR NEUROCHIRURGIE<br />
Beförderung<br />
per 01.11.2017<br />
Beförderung<br />
per 01.11.2017<br />
Dr. Heiko Richter<br />
Leitender Arzt<br />
Dr. Heiko Dreeskamp<br />
Leitender Arzt<br />
HALS-NASEN-OHREN-KLINIK<br />
Wahlen<br />
per 01.01.2018<br />
PD Dr. Gerhard Huber<br />
Leitender Arzt<br />
AUGENKLINIK<br />
Beförderung<br />
per 01.01.2018<br />
Dr. Josef Guber<br />
Leitender Arzt<br />
BRUSTZENTRUM<br />
Beförderung<br />
per 01.09.2017<br />
Dr. Patrik Weder<br />
Leitender Arzt<br />
Krebsforschungs-Förderpreis für<br />
Dr. Christoph Ackermann<br />
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische<br />
Krebsforschung (SAKK) und die Janssen-Cilag AG<br />
verleihen jährlich schweizweit kompetitiv einen<br />
Förderpreis für eingereichte Forschungsprojekte im<br />
Bereich der klinischen Krebsforschung. Der diesjährige<br />
Preis wurde an Dr. Christoph Ackermann der<br />
Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie<br />
des Kantonsspitals St.Gallen verliehen. Der Preis<br />
ist mit 30 000 Franken dotiert und steht für ein Stipendium<br />
für einen Forschungsaufenthalt an einer<br />
führenden onkologischen Forschungseinrichtung im<br />
Ausland und bietet jungen Onkologen die Möglichkeit,<br />
spezialisierte Kenntnisse im Bereich der klinischen<br />
Krebsforschung zu gewinnen und sich das<br />
Expertenwissen anzueignen, um erfolgreich wissenschaftliche<br />
Studien durchzuführen.<br />
Der Gewinner des Förderpreises, Dr. Christoph Ackermann (Mitte),<br />
flankiert von Dr. med. Natascha Moriconi, Medical Director<br />
Janssen-Cilag AG, und Prof. Dr. med. Roger von Moos, SAKK-Präsident.<br />
Dr. Christoph Ackermann wird im Frühling 2018 seinen<br />
Forschungsaufenthalt am renommierten Christie<br />
Hospital in Manchester, England, antreten, wo er sich<br />
in einer führenden Lungenkrebs-Forschungsgruppe<br />
in der molekularbiologischen Diagnostik, der Immunologie<br />
und der Behandlung von Lungentumoren<br />
vertiefen wird. Dr. Ackermanns Forschungsschwerpunkt<br />
wird die Analyse «zirkulierender Tumorzellen»,<br />
also die Identifikation von Krebszellspuren im Blut,<br />
sein. Diese Technik soll in Zukunft via einfacher Blutentnahme<br />
helfen, eine Krebsdiagnose sehr früh<br />
zu erkennen und je nach molekularem Tumorprofil<br />
eine individuelle zielgerichtete Therapie für den<br />
einzelnen Patienten zu finden, um somit die Prognose<br />
zu verbessern.
10 Kader im Profil<br />
«Stillstand ist für mich<br />
etwas Quälendes»<br />
Prof. Dr. Barbara Ballmer-Weber startet<br />
am 1. Januar 2018 als Chefärztin ad<br />
personam des Fachbereichs Allergologie<br />
innerhalb der Klinik für Dermatologie,<br />
Venerologie und Allergologie. Sie tritt damit<br />
die Nachfolge von PD Dr. Dr. Wolfram<br />
Hötzenecker an, der als Chefarzt an die<br />
Universitätsklinik in Linz (A) berufen wurde.<br />
Stillstand gibt es für die Powerfrau aus<br />
Winterthur nicht – ob im Job oder privat.<br />
Und diesen Drive möchte sie auch<br />
in St.Gallen weiterleben.<br />
«Ich freue mich auf meinen Start in St.Gallen», so<br />
Barbara Ballmer-Weber. Seit 2015 ist sie als Chefärztin<br />
ad personam für Allergologie am Zentrum<br />
für Dermatologie und Allergologie am Luzerner Kantonsspital<br />
(LUKS) tätig. Gleichzeitig betreibt sie<br />
als Titularprofessorin Forschung am USZ Zürich im<br />
Bereich der Nahrungsmittelallergien. Dieses<br />
Wissen bringt sie nun nach St.Gallen und möchte<br />
hier neben der Nahrungsmittelallergie das<br />
gesamte Spektrum der Allergologie stärken und<br />
ausbauen.<br />
Nah am Leben<br />
«Die Synthese von Innerer Medizin, Dermatologie<br />
und Immunologie hat mich schon immer am Fachbereich<br />
der Allergologie fasziniert, weshalb ich mich<br />
für die Spezialisierung darauf entschieden habe»,<br />
so Ballmer-Weber. Es sei sehr nahe am Leben und<br />
fast schon eine Detektivaufgabe. Anhand der Beschreibung<br />
des Alltags inklusive Hobbys, Medikamenteneinnahme<br />
und des Essverhaltens der Patienten<br />
werden mögliche Allergien ausgeschlossen oder<br />
eben weiterverfolgt und schliesslich die nächsten<br />
Behandlungsschritte festgelegt. Die Spannbreite der<br />
Diagnostik und Behandlung ist dabei sehr breit: von<br />
sehr akut (Provokationen mit Lebensmitteln und<br />
Medikamenten) über psychosomatische Aspekte bis<br />
hin zur intellektuellen Herausforderung durch<br />
das Zusammenführen der verschiedenen Befunde<br />
für die Diagnostik.
Kader im Profil<br />
11<br />
Schnell<br />
Prof. Dr. Barbara Ballmer-Weber übernimmt per<br />
1. Januar 2018 die Funktion der Chefärztin ad personam<br />
des Fachbereichs Allergologie innerhalb der<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie.<br />
Dank ihrer langjährigen allergologischen Berufserfahrung<br />
sowie ihrer fundierten und breiten klinischen<br />
und wissenschaftlichen Ausbildung ist Prof. Dr.<br />
Ballmer-Weber eine hoch qualifizierte, diagnostisch<br />
und therapeutisch sichere Ärztin. Ihr klinisches Spezialgebiet<br />
ist neben dem gesamten Spektrum der<br />
allergischen Erkrankungen und Intoleranzreaktionen<br />
u. a. die Nahrungsmittelallergie. Allergologische Erkrankungen<br />
stellen gerade an einem Zentrumsspital<br />
eine interdisziplinäre Herausforderung dar.<br />
arbeitete sie als Leitende Ärztin für Allergologie am<br />
USZ. Zudem koordinierte sie von 2008 bis 2015<br />
den Aufbau und hatte die konsiliarische Leitung der<br />
Allergologie in der Spital Thurgau AG inne. Die<br />
Forschung ist ein wichtiger Teil ihrer Arbeit, die sie<br />
auch in St.Gallen in Form von Forschungsprojekten<br />
weiterführen möchte.<br />
Prof. Dr. Barbara Ballmer-Weber<br />
Lust, etwas zu bewegen<br />
Und diese Abwechslung braucht die Mutter von<br />
zwei erwachsenen Kindern auch: «Stillstand ist für<br />
mich etwas Quälendes, ob im Job oder privat.»<br />
Diese Lust, etwas zu bewegen, möchte sie auch<br />
in St.Gallen leben und den Bereich der Allergologie<br />
ausbauen. Denn dieser sei in der Ostschweiz zu<br />
wenig präsent. «Junge Ärzte sollen nachziehen,<br />
von meinem Wissen und meinen Erfahrungen profitieren<br />
und so dazu beitragen, dass der Bereich der<br />
Allergologie am Kantonsspital St.Gallen einer der<br />
führenden in der Ostschweiz wird.» Die Strukturen<br />
dafür seien ideal, auch dank dem Chefarzt der<br />
Klinik, PD Dr. Dr. Cozzio, den Barbara Ballmer-Weber<br />
von ihrer Zeit am USZ sehr gut kennt.<br />
Gute Zusammenarbeit ist kein Lippenbekenntnis<br />
Und die Zusammenarbeit mit den Zuweisern? Eine<br />
gute Zusammenarbeit liege ihr sehr am Herzen<br />
und sei enorm wichtig. Die Patienten kommen im<br />
Schnitt zwei- bis dreimal ins Zentrumsspital und<br />
werden anschliessend wieder durch ihren zuweisenden<br />
Arzt betreut. Deshalb sei eine reibungslose<br />
und gut funktionierende Zusammenarbeit sehr wichtig.<br />
«Doch ich bin mir bewusst, dass dies Zeit und<br />
Vertrauen braucht – ich habe beides und freue mich<br />
auf Gegenseitigkeit.»<br />
Spannender Lebenslauf<br />
Das Wissen konnte sie sich an diversen Stationen<br />
ihrer Laufbahn aneignen. Den Facharzttitel für<br />
Dermatologie hat sie 1996 sowie denjenigen für Allergologie<br />
und klinische Immunologie 1999 erworben.<br />
2002 habilitierte sie an der Universität Zürich und<br />
erwarb die Venia Le gendi für das Fach Dermatologie,<br />
speziell Allergologie. Von 1997 bis 2004 war<br />
sie als Oberärztin in der Allergologie am USZ tätig, mit<br />
einer Forschungstätigkeit von 2001 bis 2003 am Paul-<br />
Ehrlich-Institut in Langen (D). Von 2004 bis 2015
12 Innovation und Entwicklung<br />
Sterberisiko wird signifikant reduziert<br />
Seit mehreren Jahren wird in der Schweiz – u. a.<br />
im Rahmen der Planung und Koordination der Hochspezialisierten<br />
Medizin (HSM) – debattiert, ob<br />
Hochrisiko-Operationen wie z. B. die Resektion von<br />
Oesophagus-, Magen- oder Pankreaskarzinomen<br />
zentralisiert werden sollen. Die zugrunde liegende<br />
Hypothese ist simpel: mehr Erfahrung, mehr Kompetenz,<br />
bessere Resultate für die Patienten. Zahlreiche<br />
Studien in den USA, Kanada und Europa konnten<br />
aufzeigen, dass Patienten, welche sich einer<br />
Karzinomresektion mit hohem Risiko unterziehen,<br />
ein geringeres Sterberisiko haben, wenn dies an<br />
einem Zentrumsspital erfolgt. Für die Schweiz fehlte<br />
allerdings bislang diese wissenschaftliche Evidenz.<br />
Eine Forschungsgruppe des Kantonsspitals St.Gallen<br />
unter Leitung von Prof. Dr. Ulrich Güller, Stv. Chefarzt<br />
der Klinik für medizinische Onkologie / Hämatologie,<br />
konnte nun aber mit einer neulich im «Swiss<br />
Medical Weekly» publizierten Studie mit über 18 000<br />
Patienten (1487 mit Oesophaguskarzinom; 4404 mit<br />
Magenkarzinom; 2668 mit Pankreaskarzinom; 9743<br />
mit Rektumkarzinom) belegen, dass in der Schweiz<br />
die Sterberate nach Krebsoperationen mit hohem<br />
Risiko allein durch Zentralisierung massiv gesenkt<br />
werden kann. Bei dieser Studie, basierend auf Daten<br />
des Bundesamtes für Statistik (BFS), wurde die Sterberate<br />
nach Hochrisiko-Krebsoperationen verglichen<br />
zwischen Zentren mit grossen Patientenzahlen<br />
und kleineren Spitälern. Dabei kam heraus, dass bei<br />
Operationen von Patienten mit Rektumkarzinom<br />
die Sterberate in grossen Institutionen um 29 % tiefer<br />
lag als in kleinen Spitälern. Bei Patienten mit<br />
Magenkarzinom konnte das Sterberisiko in grossen<br />
medizinischen Zentren im Vergleich zu kleineren<br />
Spitälern um 32 % reduziert werden, beim Oesophaguskarzinom<br />
um 49 % und beim Pankreaskarzinom<br />
gar um 68 %.<br />
Vereinfachter Zuweisungsprozess<br />
für Wundversorgung: Interdisziplinäres<br />
Wundzentrum<br />
Das Wundexperten-Team: Anke Buschor, Sarah Greuter,<br />
Susanne Bolt-Kobler und Diana Lutz-Hutter (v.l.n.r).<br />
Für die Behandlung von Patienten mit chronisch<br />
komplexen Wunden bedarf es einer qualitativ hochstehenden<br />
medizinischen Versorgung. Bereits jetzt<br />
existieren am Kantonsspital St.Gallen verschiedene<br />
Bereiche, welche Wundsprechstunden mit dipl.<br />
Wundexpertinnen anbieten. Damit die verschiedenen<br />
Fachexperten künftig die Patienten gemeinsam<br />
beurteilen und behandeln können, entsteht<br />
ein interdiziplinäres Wundzentrum. Durch die interdisziplinäre<br />
und interprofessionelle Behandlung<br />
chronischer Wundpatienten kann die Qualität der<br />
Wundversorgung weiter verbessert werden. Die<br />
Zuweiser werden aktiv in den Behandlungsprozess<br />
miteinbezogen und können wählen, ob sie ihre<br />
Patienten zur Behandlungsempfehlung oder Wundbehandlung<br />
zuweisen möchten. Durch eine zentrale<br />
Anlaufstelle für Patienten und Zuweiser im Bereich<br />
der Wundversorgung kann der Zuweisungsprozess<br />
zusätzlich vereinfacht werden.
Innovation und Entwicklung<br />
<strong>13</strong><br />
Auszeichnung<br />
für das Zentrum für<br />
Schlafmedizin<br />
Eine am Zentrum für Schlafmedizin durchgeführte<br />
Studie hat am «Joint Congress 2017» in Basel den<br />
Preis für die beste Präsentation gewonnen.<br />
Prof. Dr. Bernhard Jost<br />
«Hot Topics» am<br />
Jahreskongress<br />
2017 der swiss<br />
orthopaedics<br />
Unter dem Präsidium von Prof. Dr. Bernhard Jost,<br />
Chefarzt Orthopädie und Traumatologie des Kantonsspitals<br />
St.Gallen, fand Ende Juni der 77. Jahreskongress<br />
der Schweizerischen Gesellschaft für<br />
Orthopädie und Traumatologie «swiss orthopaedics»<br />
statt. Über 1250 Orthopäden aus der<br />
ganzen Schweiz haben den Kongress besucht.<br />
swiss orthopaedics unterstützt junge Wissenschaftler<br />
und verleiht deshalb jährlich einen Preis für<br />
die beste Publikation. «Der Venel-Preis 2017» geht<br />
an Diana Rudin, Oberärztin der Klinik für Orthopädische<br />
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates,<br />
für die beste klinische Arbeit im «Journal<br />
of Bone Joint Surgery» im April 2016. Frau Rudin<br />
wurde dabei für ihre Studie «The Anatomical Course<br />
of the Lateral Femoral Cutaneous Nerve with Special<br />
Attention to the Anterior Approach to the Hip Joint»<br />
(JBJS, April 2016, Rudin D, Manestar M, Ullrich O,<br />
Erhardt J, Grob K) ausgezeichnet.<br />
Anlässlich des Jahreskongresses 2017 wurden zudem<br />
zwei weitere Oberärzte der Orthopädie und<br />
Traumatologie des Kantonsspitals St.Gallen geehrt:<br />
Dr. Adrian Schneider für den besten Vortrag<br />
und Dr. Benjamin Martens für die beste mündliche<br />
Facharztprüfung 2016.<br />
Prof. Dr. Otto Schoch, der die Studie präsentierte,<br />
erklärt: «240 Patientinnen und Patienten mit<br />
obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom, die eine CPAP-<br />
Therapie gestartet haben, wurden in einem randomisierten<br />
Verfahren ausgewählt. Diese telemedizinisch<br />
begleiteten Patienten wurden kontaktiert,<br />
sobald bei der digitalen Datenüberprüfung Unstimmigkeiten<br />
bei der CPAP-Nutzung auftauchten.»<br />
Die Verantwortlichen der Studie kamen zum Schluss,<br />
dass die Patientengruppe, deren Therapie im ersten<br />
Behandlungsmonat telemedizinisch begleitet wurde,<br />
bezüglich der Schlafqualität stärker profitierte als<br />
die Vergleichsgruppe ohne telemedizinische Überprüfung.<br />
Die Auszeichnung unterstreicht die Relevanz<br />
der Thematik telemedizinscher Überprüfungsmöglichkeiten.<br />
Titel der Arbeit: «Telemetrically Triggered Interventions<br />
in the First Month of CPAP: 6-months Results<br />
of a Prospective Randomized Controlled Trial»<br />
QST-Labor an der<br />
Klinik für Neurologie<br />
am Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
Beinahe ein Jahr nach seiner Einführung ist das<br />
QST-Labor am Kantonsspital St.Gallen inzwischen<br />
gut etabliert – höchste Zeit, den zuweisenden<br />
Ärztinnen und Ärzten dieses wichtige Angebot am<br />
Spital umfassend zu präsentieren.<br />
Mehr über das Thema «Quantitative Sensorische<br />
Testung (QST-Labor)» lesen Sie auf Seite 14.
Innovation und Entwicklung<br />
15<br />
Dünne Nerven –<br />
grosse Wirkung<br />
Mit der Quantitativen Sensorischen Testung (QST) steht dem Kantonsspital<br />
St.Gallen ein neues Untersuchungsverfahren zur Verfügung,<br />
das mit einfachen Mitteln eine genaue und umfassende Analyse sensibler<br />
Störungen und Schmerzen ermöglicht. Die reibungslose und<br />
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Klinik für Neurologie<br />
und dem Schmerzzentrum ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor.<br />
Die QST ergänzt andere, bereits bestehende neurologische<br />
und elektrophysiologische Messverfahren,<br />
wie beispielsweise die Neurografie. Während mit<br />
Letzterer die Funktion der dickeren Nervenfasern<br />
untersucht wird, erfasst die QST darüber hinaus die<br />
Funktion der dünneren, wenig oder nicht myelinisierten<br />
Nervenfasern. «Diese spielen insbesondere<br />
bei Erkrankungen, die mit vermindertem Empfinden<br />
von Wärme und Kälte oder Berührungen einhergehen,<br />
sowie bei unklaren Schmerzen eine wichtige<br />
Rolle», erklärt Suzie Diener, Oberärztin in der Klinik<br />
für Neurologie. Die QST könne in solchen Fällen<br />
richtungsweisende Informationen für die diagnostische<br />
Einordnung und die Therapieeinleitung liefern.<br />
Und diese Diagnostik und Bestimmung der weiteren<br />
Schritte findet interdisziplinär zwischen<br />
der Klinik für Neurologie und dem Schmerzzentrum<br />
statt. Dr. Alexander Ott, Leitender Arzt im Schmerzzentrum,<br />
schätzt die Zusammenarbeit: «Das<br />
Schmerzzentrum hat sich als Aufgabe gestellt, die<br />
bestmögliche Versorgung von Patienten mit<br />
chronischen Schmerzen sicherzustellen. Und dies<br />
können wir nun mit der QST weiter ausbauen.»<br />
< Schmerzboard mit Dr. Alexander Ott, Leitender Arzt Anästhesiologie/<br />
Intensivmedizin, Dr. Suzie Diener, Oberärztin Klinik für Neurologie.<br />
Ein standardisiertes Verfahren<br />
Mithilfe der Messung von Wahrnehmungsschwellen<br />
für die unterschiedlichen Reize wie beispielsweise<br />
Kälte, Wärme, Berührung und Druck kann die Funktion<br />
verschiedener Nervenfasertypen untersucht<br />
werden. Zum Beispiel leiten ganz unterschiedliche<br />
Einsatzbereiche<br />
Krankheitsbilder, bei denen die QST als<br />
diagnostisches Instrument sinnvoll sein<br />
kann, sind unter anderem:<br />
– Neuropathische und nichtneuropathische<br />
Schmerzen<br />
– Postherapeutische Neuralgie<br />
– Schmerzen nach peripherer Nervenläsion<br />
– Sensorische Phänomene im Rahmen<br />
von Chemotherapien oder bei peripherer<br />
arterieller Verschlusskrankheit (pAVK)<br />
– Schmerzen bei Tumorerkrankungen<br />
– Komplexes Regionales Schmerzsyndrom<br />
(CRPS)<br />
– Rückenschmerzen<br />
– Gesichtsschmerzen<br />
– Psychosomatische Schmerzzustände
16 Innovation und Entwicklung<br />
Oben: Thermische Testung mit Thermotester (Thermal Sensory Analyzer TSA-II).<br />
Unten: Mechanische Testung mit Nadelreizstimulator (Pinprick Set), Von-Frey-Filamente, Druckalgometer, Vibrationsgabel.<br />
Quantitative Sensorische<br />
Testung (QST) auf einen Blick<br />
Indikation<br />
– Unklare Missempfindungen (z. B. Kribbelparästhesien,<br />
Dysästhesien, Kältegefühl)<br />
– Unklare / therapieresistente Schmerzen<br />
– Gesichtsschmerzen<br />
– Neuropathische Schmerzen<br />
– Schmerzen / Missempfindungen<br />
bei Tumorerkrankungen<br />
– Klinische Forschung<br />
Kontakt<br />
Dr. med. Suzie Diener<br />
Oberärztin Klinik für Neurologie<br />
Team Schmerzzentrum<br />
Zuweisung<br />
Ambulatorium der Klinik für Neurologie<br />
Tel. + 41 71 494 16 69, Fax + 41 71 494 28 95<br />
anmeldung.neurologie@kssg.ch
Innovation und Entwicklung<br />
17<br />
Schnell<br />
Die QST-Untersuchung stellt eine standardisierte<br />
Erweiterung der neurologischen Sensibilitätsprüfung<br />
dar. Sie wird nach dem Protokoll des Deutschen<br />
Forschungsverbunds Neuropathischer<br />
Schmerz (DFNS) durchgeführt. Die QST ergänzt<br />
andere, bereits bestehende neurologische und<br />
elektrophysiologische Messverfahren, wie beispielsweise<br />
die Neurografie. Während mit Letzterer<br />
die Funktion der dickeren Nervenfasern untersucht<br />
wird, erfasst die QST darüber hinaus die Funktion<br />
der dünneren, wenig oder nichtmyelinisierten Nervenfasern.<br />
Typen von Nervenfasern die Information für Temperatur<br />
oder für leichte Berührung. Die Untersuchung<br />
wird am Kantonsspital St.Gallen nach dem standardisierten<br />
Protokoll des Deutschen Forschungsverbunds<br />
Neuropathischer Schmerz (DFNS) durchgeführt.<br />
Die Validität, Reliabilität und Möglichkeiten zur<br />
Qualitätssicherung der Messmethode wurden im<br />
Rahmen multizentrischer Studien evaluiert und eine<br />
Normwertdatenbank erstellt.<br />
Funktionsprinzip<br />
Die standardisierte QST-Batterie besteht aus sieben<br />
Einzeltests, bei denen insgesamt <strong>13</strong> Parameter erfasst<br />
werden. Die Tests erfolgen ausschliesslich auf<br />
der Haut (z. B. Gesicht, Hand, Fuss, Schulter). Dabei<br />
werden kalibrierte Reize auf der Haut angebracht,<br />
um mittels thermischer und mechanischer Reize die<br />
Wahrnehmungs-, Schmerz- oder Schmerztoleranzschwellen<br />
zu ermitteln. Dies erlaubt eine vollständige<br />
Erfassung der Funktion (Funktionsverlust / Funktionszunahme)<br />
aller somatosensorischen nozizeptiven<br />
und nichtnozizeptiven Submodalitäten – von der<br />
Funktion einzelner Nervenfasertypen in der Haut bis<br />
hin zu einer zentral veränderten Schmerzverarbeitung<br />
in Rückenmark und Gehirn. Die Testung erlaubt<br />
eine Bewertung der Funktion von marklosen C-<br />
Fasern, dünn myelinisierten Aß-Fasern sowie dick<br />
myelinisierten Aß-Fasern mit deren Projektionswegen<br />
ins Gehirn. Der Ablauf ist in allen geschulten<br />
Zentren standardisiert.<br />
Besonderheit<br />
Anders als die konventionellen elektrophysiologischen<br />
Methoden (z. B. die Neurografie, die somatosensorisch<br />
evozierten Potenziale [SEP]) ermöglicht<br />
die QST zum einen die Untersuchung der<br />
dünnen, wenig bis nichtmyelinisierten Nervenfasern<br />
und zum anderen die Diagnose einer isolierten<br />
Small-fiber-Neuropathie bei gleichzeitiger Differenzierung<br />
in Plus- und Minuszeichen. Ein unauffälliger<br />
Neurografie-Befund schliesst eine Neuropathie<br />
nicht aus.<br />
Im Gegensatz zur Elektrophysiologie, Haut- oder<br />
Nervenbiopsie handelt es sich bei der QST um ein<br />
psychophysisches Verfahren, das massgeblich<br />
von der Mitarbeit des Patienten abhängt und daher<br />
standardisierte Instruktionen für die Messung<br />
und ein entsprechend geschultes Personal erfordert.<br />
Positiv im Vergleich zu den Biopsien stellt<br />
die QST eine nichtinvasive Methode dar.<br />
«Die QST erlaubt es, ein individuelles Sensibilitätsprofil<br />
des jeweiligen Patienten zu erstellen. Dadurch<br />
kann ein an den Patienten angepasstes Therapiekonzept<br />
im Sinne einer mechanismenbasierten Therapie<br />
erarbeitet werden», so Suzie Diener.<br />
Beispiel aus dem<br />
klinischen Alltag<br />
Eine Patientin wurde dem Kantonsspital<br />
St.Gallen aufgrund seit Jahren langsam progredienter,<br />
unspezifischer Missempfindungen<br />
der Extremitäten (beinbetont) ambulant<br />
zugewiesen. Die bislang durchgeführten Untersuchungen<br />
ergaben einen unauffälligen<br />
Befund. Der Befund der QST-Testung an den<br />
Füssen zeigte eine Funktionsstörung ausschliesslich<br />
der dünnen Nervenfasern. Zusammen<br />
mit den anamnestischen Angaben<br />
und der klinischen Untersuchung konnte die<br />
Diagnose einer Small-Fiber-Neuropathie<br />
gestellt werden. Die laborchemische Abklärung<br />
der zugrunde liegenden Erkrankung<br />
ergab eine gestörte Glukoseverwertung<br />
(oraler Glukosetoleranztest) als Hinweis für<br />
einen Diabetes mellitus.
18 Prozesse und Organisation<br />
Areal entwickelt sich in<br />
grossen Schritten weiter<br />
Haus 10: Feierliches Aufrichtfest<br />
Da im Rahmen der laufenden Bauprojekte einige<br />
Gebäude im Innenareal abgebrochen werden,<br />
benötigt das Kantonsspital St.Gallen neue Räumlichkeiten<br />
für die Bereiche der Klinik für Psychosomatik,<br />
der Klinik für Medizinische Onkologie und<br />
Hämatologie sowie der Nephrologie mit der Station<br />
«Hämodialyse». Nach einer intensiven Bauphase<br />
steht nun der dafür vorgesehene, sechsgeschossige<br />
Rohbau des Hauses 10. Aktuell laufen planmässig<br />
die Innenausbauarbeiten und die Fertigstellung der<br />
Fassade. Das neue Gebäude soll im Herbst 2018<br />
bezogen werden und mit neuen Räumlichkeiten<br />
und einer modernen Infrastruktur für die Patienten<br />
bereitstehen.<br />
Startschuss für Ersatz-Neubau Passerelle<br />
Ende März 2017 wurde die Passerelle über der Lindenstrasse<br />
abgebrochen. Geplant ist eine neue<br />
doppelstöckige Verbindung zwischen Haus 10, dem<br />
Parkhaus Böschenmühle und dem Innenareal, die<br />
während einer Bauphase von rund sieben Monaten<br />
erstellt wird. Doppelstöckig deshalb, um die Wege<br />
von Patienten von jenen der Logistik zu trennen – für<br />
reibungslose Abläufe auf beiden Seiten.<br />
Die neue Passerelle verfügt über imposante Dimensionen:<br />
Rund 125 Tonnen und 51 Meter lang wird<br />
diese neue doppelstöckige Verbindung. Im Sommer<br />
2017 wurde die neue Konstruktion aufgrund ihrer<br />
Grösse in sechs Bauteilen angeliefert und vor Ort<br />
zusammengebaut. Danach erfolgte deren Innenausbau,<br />
sodass per November 2017 der Zugang zum<br />
Parkhaus über die neue Passerelle freigegeben werden<br />
kann.<br />
Das Projekt sieht vor, dass auf der Ost- und der Westseite<br />
auf dem 1. bis 4. Obergeschoss vorfabrizierte<br />
Leichtbauelemente an das Gebäude montiert werden.<br />
In diesen Elementen sind neue 2er-Zimmer<br />
geplant. Zudem werden die beiden äusseren Zimmer<br />
im Bestand um den Elementbau auf der Südseite<br />
erweitert. Dadurch wird sich der Komfort für die<br />
Patienten in diesen 2er-Zimmern erhöhen. Die übrigen<br />
Patientenzimmer werden als 1er-Zimmer<br />
geführt. Alle Zimmer werden nach der Sanierung<br />
eigene Nasszellen haben. Im Erdgeschoss werden<br />
zusätzliche Untersuchungseinheiten für das<br />
Lungenzentrum bereitgestellt.<br />
Eröffnung Wintergarten am Kantonsspital St.Gallen<br />
Der Wintergarten des Restaurants vitamin lädt seit<br />
Sommer 2017 Mitarbeitende, Patienten und Besucher<br />
zum Sonnetanken übers ganze Jahr ein. Der<br />
helle, freundliche Raum bietet 148 Besuchern<br />
des Restaurants Platz zum Sitzen und kann bei Bedarf<br />
für Veranstaltungen umgestellt werden.<br />
Haus 20: Umnutzung für Weiterentwicklung<br />
Die Kliniken Dermatologie/Venerologie/Allergologie<br />
sowie Infektiologie/Spitalhygiene ziehen um und<br />
sind ab Dezember 2017 im Haus 20 zu finden. Nach<br />
einer eineinhalbjährigen Umbauphase – damit das<br />
Haus nach der administrativen Nutzung fit ist für den<br />
klinischen Alltag – steht die Weiterentwicklung an:<br />
So sollen die Patientenzahlen gesteigert, die Versorgungsqualität<br />
sichergestellt, der Patientenkomfort<br />
sowie die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht werden.<br />
Ebenfalls sollen Doppelvorhalteleistungen vermieden<br />
werden.<br />
Haus 02: Umfassende Sanierung und Erweiterung<br />
Das Haus 02 soll für eine weitere Generation erhalten<br />
bleiben und wird daher in den nächsten zweieinhalb<br />
Jahren einer Sanierung und Erweiterung unterzogen.
Prozesse und Organisation 19<br />
Radiologie-Netzwerk ausgebaut<br />
Mit der Aufnahme des Betriebs im Ambulatorium<br />
Rorschach können seit Anfang September MRTund<br />
PET / CT-Untersuchungen ausserhalb des Standorts<br />
St.Gallen angeboten werden – zur Entschärfung<br />
der Kapazitätsengpässe und damit verbundenen<br />
Wartezeiten. Die Einbindung ins Radiologie-Netzwerk<br />
garantiert ausserdem eine zeitnahe, ortsunab-<br />
hängige Befundung durch Experten diverser<br />
Fachgebiete und Subspezialitäten. Ein patientenund<br />
zuweiserorientierter Service steht dabei<br />
im Zentrum.<br />
Mehr zum Thema «Attraktives Ambulatorium<br />
mit Ambiente» auf Seite 20.<br />
Die Fax-Kommunikation wird<br />
2018 abgelöst<br />
Die klinikübergreifenden Prozesse werden beim<br />
Kantonsspital laufend optimiert, so auch die Kommunikation<br />
mit den Zuweisenden. Im Zuge der<br />
schweizweiten Umstellung der Analog- und ISDN-<br />
Anschlüsse auf das Internetprotokoll (IP) per<br />
Anfang 2018 wird das Kantonsspital St.Gallen die<br />
Fax-Kommunikation weitgehend ablösen. Ziel<br />
ist die vollständige Umstellung der Kommunikation<br />
via gesicherte E-Mails oder alternativ via Postweg<br />
im Laufe des nächsten Jahres.<br />
Die Zuweisenden werden mit einem Schreiben<br />
im Detail informiert.<br />
Save the date:<br />
Zuweiser-Event am 26. April 2018<br />
«Interdisziplinäre Zusammenarbeit» –<br />
Gewinn dank guter Vernetzung<br />
Um auf die gesellschaftlichen Entwicklungen<br />
und die zunehmende Spezialisierung in der Medizin<br />
zu reagieren, setzt das Kantonsspital St.Gallen<br />
weiterhin auf die Bildung von interdisziplinären<br />
Zentren. Am nächsten Zuweiser-Event zeigen wir<br />
Ihnen auf, wie das Kantonsspital St.Gallen dies<br />
umsetzt, um den Patientinnen und Patienten<br />
die bestmögliche Leistung zu erbringen. Auf die<br />
Teilnehmenden warten diverse Vorträge und<br />
Rundgänge, umrahmt von einem unterhaltsamen<br />
Programm inklusive Abendessen.
Prozesse und Organisation<br />
21<br />
Untersuchungen unter<br />
den Wolken<br />
Das neue Ambulatorium der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin<br />
des Kantonsspitals St.Gallen hat Anfang September im Neubau<br />
der Regatron AG in Rorschach seine Türen geöffnet. Den Patienten<br />
werden MRT- und PET / CT-Untersuchungen in modernstem und<br />
angenehmem Ambiente angeboten. Durch die Einbindung ins kantonale<br />
Radiologie-Netzwerk wird zudem eine zeitnahe und ortsunabhängige<br />
Befundung durch Experten der verschiedenen Fachgebiete<br />
garantiert.<br />
«Eine Erweiterung wäre bei Bedarf sehr gut denkbar»,<br />
so Simon Wildermuth im Artikel zum Thema<br />
«Radiologie-Netzwerk <strong>13</strong>4» in der Ausgabe Frühling<br />
2014 des <strong>DUO</strong>. Diese Worte haben sich innerhalb<br />
von rund drei Jahren bewahrheitet – auch mit der<br />
Eröffnung des Ambulatoriums für MRT- und<br />
PET/CT-Untersuchungen am neuen Standort in<br />
Rorschach.<br />
Das Ambulatorium in Rorschach ist Teil des Radiologie-Netzwerks<br />
des Kantonsspitals St.Gallen. Die<br />
beteiligten Standorte (siehe Übersicht auf Seite 22)<br />
profitieren vom direkten Zugang zu Fachspezialisten<br />
vor Ort und via Teleradiologie zu Dienstzeiten sowie<br />
in Notfallsituationen. Einheitliche Standards bei<br />
Untersuchung, Befundung und Berichtswesen<br />
sichern die Qualität auf hohem Level.<br />
Weniger Engpässe<br />
Doch was führte zur Eröffnung des Standorts in Rorschach?<br />
Fabian Dorner, Klinikmanager und Verantwortlicher<br />
für die Realisierung des Ambulatoriums<br />
in Rorschach, erklärt: «Ein zentrales Anliegen des<br />
Kantonsspitals St.Gallen ist einerseits die möglichst<br />
zeitnahe Terminvergabe und andererseits eine<br />
optimale Zusammenarbeit mit den zuweisenden<br />
Haus- und Spezialfachärzten. Mit der Aufnahme des<br />
Betriebs im Ambulatorium Rorschach sind nun die<br />
Voraussetzungen dafür geschaffen, ebenso können<br />
die Kapazitätsengpässe – bei 18 000 MR-Untersu-<br />
chungen pro Jahr am Standort St.Gallen – mit den<br />
daraus resultierenden Wartezeiten am Kantonsspital<br />
St.Gallen entschärft werden.»<br />
Sorgfältige Standort-Evaluation<br />
Ein Projekt, das MRT und PET / CT am Spital Rorschach<br />
zu installieren und zu integrieren, wurde aus<br />
Platzgründen abgebrochen. Es folgte schliesslich<br />
die Suche nach einem geeigneteren Ort. Unter Berücksichtigung<br />
der aktuellen Angebotsdichte<br />
im Bereich Radiologie/Nuklearmedizin in der Ost-<br />
Leistungsangebot<br />
MRT<br />
– Zentrales und peripheres Nervensystem<br />
– Muskuloskelettales System<br />
– «Body-Imaging» (Hals, Thorax,<br />
Abdomen, Becken)<br />
– MR-Angiografien<br />
– Ganzkörper-MRT<br />
PET / CT<br />
– Tumordiagnostik<br />
– Demenzabklärung<br />
– Entzündungsdiagnostik
22 Prozesse und Organisation<br />
Unter den Wolken: Modernste Geräte und ein angenehmes Ambiente dank Wand- und Deckenbildern sorgen für einen hohen Patientenkomfort.<br />
schweiz sowie dem Support des Rorschacher Stadtrats<br />
stiess man schliesslich auf den Neubau der<br />
Regatron AG. So wird das diagnostische Angebot für<br />
Patienten in der Region Rorschach und im unteren<br />
Rheintal erweitert und die wohnortnahe Versorgung<br />
qualitativ aufgewertet. Die Geschäftsleitung des<br />
Kantonsspitals St.Gallen, welche sich in den letzten<br />
Wochen selbst ein Bild vom neuen Standort machte,<br />
ist überzeugt, dass dieses neue Angebot den Spitalstandort<br />
Rorschach stärkt und Synergien schafft.<br />
Modernste Technik<br />
Das Leistungsspektrum des Ambulatoriums Rorschach<br />
umfasst MRT-Abklärungen mit einem<br />
modernsten 3-Tesla-Gerät sowie PET / CT-Untersuchungen.<br />
Die Positronen-Emissions-Tomografie<br />
kombiniert mit einer Computertomografie (PET /<br />
CT) ist ein modernes nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren,<br />
das mit hoher Präzision<br />
Tumore und Entzündungen erfassen kann und bislang<br />
nur an drei Standorten in der Ostschweiz<br />
betrieben wird. Bei dieser Untersuchung wird dem<br />
Patienten eine radioaktive Untersuchungssubstanz<br />
verabreicht, die anschliessend mit der hochempfindlichen<br />
PET-Kamera detektiert werden kann. Am<br />
häufigsten wird ein radioaktiv markierter Zucker<br />
(F18-Fluorodeoxyglukose, kurz FDG) verwendet. So<br />
kann der Zuckerstoffwechsel im Körper bildlich<br />
1<br />
5<br />
3<br />
4<br />
1 Kantonsspital St.Gallen,<br />
Geriatrische Klinik St.Gallen,<br />
Kinderspital St.Gallen<br />
2 Spitalregion Rheintal,<br />
Werdenberg, Sarganserland<br />
3 Spital Linth<br />
4 Spitalregion Fürstenland<br />
Toggenburg<br />
5 Ambulatorium Rorschach<br />
2
Prozesse und Organisation<br />
23<br />
Schnell<br />
Das Ambulatorium Rorschach ist Teil des Radiologie-Netzwerkes<br />
des Kantonsspitals St.Gallen und<br />
ermöglicht eine dezentrale, qualitativ gleichwertige<br />
Untersuchungsmöglichkeit für MRT und PET/CT<br />
wie am Hauptstandort der Klinik für Radiologie und<br />
Nuklearmedizin des Kantonsspitals St.Gallen. Eine<br />
optimale Zusammenarbeit mit den Zuweisern und<br />
die kurzfristige Terminvergabe – organisiert über<br />
ein zentrales Servicecenter – haben höchste Priorität.<br />
Zudem überzeugen ein angenehmes Ambiente<br />
sowie die gute Erreichbarkeit des Standorts ausserhalb<br />
des Spitalareals.<br />
dargestellt werden. Da Tumore und Entzündungen<br />
meistens einen erhöhten Zuckerumsatz haben,<br />
können diese identifiziert und im Verlauf auch bezüglich<br />
ihres Ansprechens auf eine bestimmte<br />
Therapie beurteilt werden. Mittels der gleichzeitig<br />
erzeugten Computertomografiebilder (CT), die mit<br />
den PET-Aufnahmen zur Deckung gebracht wird,<br />
kann eine exakte Lokalisation des erhöhten Zuckerstoffwechsels<br />
erfolgen. Während der Untersuchung<br />
liegt der Patient unter den Wolken – einem Wandund<br />
Deckenbild, das allein schon beim Betreten des<br />
Raumes für ein positives und angenehmes Ambiente<br />
sorgt.<br />
Zukunftsvisionen<br />
Der neue Standort bedeutet keineswegs Stillstand,<br />
sondern motiviert zu Weiterentwicklung im Hinblick<br />
auf noch kürzere Untersuchungszeiten, raschere<br />
Befundübermittlung und besseren Service. Geplant<br />
ist auch die Einführung eines benutzerfreundlichen<br />
elektronischen Anmeldesystems für die niedergelassenen<br />
Kollegen sowie eine Terminerinnerung für<br />
die Patienten via SMS.<br />
Patient und Zuweiser im Mittelpunkt<br />
Nebst diesen modernen Diagnostik-Techniken soll<br />
auch eine zeitnahe Versorgung gewährleistet werden.<br />
«Wir wollen unseren Patienten innerhalb der<br />
nächsten 24 Stunden einen Termin anbieten. Die<br />
Koordination aller Termine läuft über ein zentrales<br />
Servicecenter», so Jana Stinn, Standortleiterin<br />
der medizinisch-technischen Radiologieassistenten<br />
(MTRA). Um sämtlichen Anliegen von Patienten und<br />
Zuweisern schnell und kompetent gerecht zu werden,<br />
wurden die administrativen Arbeiten rund um<br />
die Untersuchungsplanung und Befundverteilung<br />
in den beiden Bereichen Radiologie und Nuklearmedizin<br />
in ein zentrales Servicecenter zusammengeführt.<br />
Von der Terminvergabe über den Empfang<br />
und die administrative Betreuung des Patienten bis<br />
hin zur Verwaltung der schriftlichen Befunde und<br />
Bearbeitung diverser Anfragen ist so eine speditive<br />
und fachkundige Abwicklung gewährleistet.<br />
Und dieser Servicegedanke wird am neuen Standort<br />
in Rorschach auch gelebt. «Wir sind für unsere<br />
Patienten, aber auch für unsere Zuweiser da und<br />
nehmen uns Zeit für Fragen und Anliegen. An Zuweiser-Fortbildungen<br />
soll künftig auch Wissen weitervermittelt<br />
und ausgetauscht werden», so PD Dr.<br />
Daniela Husarik, Doppelfachärztin für Radiologie<br />
und Nuklearmedizin.<br />
Jana Stinn, Standortleiterin der medizinischtechnischen<br />
Radiologieassistenten (MTRA).<br />
Servicecenter Bereich Radiologie<br />
Montag bis Freitag durchgehend<br />
von 07.30 bis 18.00 Uhr geöffnet<br />
und erreichbar unter:<br />
Tel. +41 71 494 66 66<br />
Fax +41 71 494 28 85<br />
anmeldung.radiologie@kssg.ch<br />
Servicecenter Bereich Nuklearmedizin<br />
Montag bis Freitag durchgehend<br />
von 08.00 bis 17.00 Uhr geöffnet<br />
und erreichbar unter:<br />
Tel. +41 71 494 22 84<br />
Fax +41 71 494 28 92<br />
nuklearmedizin@kssg.ch
24 Agenda<br />
Veranstaltungen<br />
November 2017 bis April 2018<br />
NOVEMBER<br />
Fr 17.11.2017<br />
7. Fit for Stroke – Weiterbildungstag<br />
Klinik für Neurologie<br />
08.30 – 16.30 Uhr<br />
Fr 17.11.2017 Onkolunch 2018<br />
Fr 17.11.2017 /<br />
Sa 18.11.2017<br />
Di 21.11.2017<br />
Do 23.11.2017<br />
Fr 24.11.2017 /<br />
Sa 25.11.2017<br />
Mo 27.11.2017<br />
Mo 27.11.2017<br />
Mo 27.11.2017<br />
Mo 27.11.2017 –<br />
Do 30.11.2017<br />
Mi 29.11.2017<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie<br />
12.30 – <strong>13</strong>.45 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
16. St.Galler Airway Management<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-,<br />
Rettungs- und Schmerzmedizin<br />
Fr: <strong>13</strong>.00 – 18.00 Uhr, Sa: 08.15 – 18.15 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
ZIM Lunch: Osteopathie bei gastrointestinalen<br />
Beschwerden<br />
Zentrum für Integrative Medizin<br />
12.30 – 14.00 Uhr<br />
Haus 33, Kursraum 015, Kantonsspital St.Gallen<br />
Symposium Gastroenterology/Hepatology<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
09.45 – 15.30 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, St.Gallen<br />
White Matter Dissection<br />
Schulungs- und Trainingszentrum<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Fr: 10.30 – 17.00 Uhr, Sa: 08.00 – <strong>13</strong>.00 Uhr<br />
Anatomisches Institut der Universität Fribourg,<br />
1 Route Albert-Gockel, 1700 Fribourg<br />
Hepatologiekolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.30 – 18.45 Uhr<br />
Haus 21, Raum 101, Kantonsspital St.Gallen<br />
Evaluating vasculitis for diagnosis and treatment<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Dermatologie Fokus:<br />
Spannende Fälle aus unserer Klinik<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
19.00 – 19.45 Uhr<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
47. Notarztkurs<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-,<br />
Rettungs- und Schmerzmedizin<br />
Mo – Mi: 08.00 – 18.00 Uhr, Do: 08.00 – 16.30 Uhr<br />
REA2000, Fürstenlandstrasse 100, 9014 St.Gallen<br />
Kardiologisches Kolloquium:<br />
Fälle aus der kardiologischen Praxis<br />
Klinik für Kardiologie<br />
18.00 – 20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mi 29.11.2017<br />
DEZEMBER<br />
Fr 01.12.2017<br />
Mo 04.12.2017<br />
Do 07.12.2017<br />
Fr 08.12.2017<br />
Mo 11.12.2017<br />
Mo 11.12.2017<br />
Mi <strong>13</strong>.12.2017<br />
Do 14.12.2017<br />
Do 14.12.2017<br />
Interdisziplinäre Viszeralmedizin<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.30 – 20.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Stroke Lunch: Update PFO und Schlaganfall<br />
Klinik für Neurologie<br />
11.30 – <strong>13</strong>.00 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
50. St.Galler Anästhesie- und Intensivsymposium<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-,<br />
Rettungs- und Schmerzmedizin<br />
17.00 – 19.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Burn-out und Verhaltenssüchte<br />
Kantonale Psychiatrische Dienste<br />
17.15 – 18.15 Uhr<br />
Psychiatrisches Zentrum St.Gallen,<br />
Teufenerstrasse 26, 5. Stock, Raum 527<br />
Breakfast lecture zum Thema:<br />
Palliativmedizinische Komplexbehandlung<br />
Klinik für Neurologie<br />
08.30 – 09.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
SASL School<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.30 – 19.00 Uhr<br />
Haus 21, Raum 101, Kantonsspital St.Gallen<br />
Update Systemischer Lupus erythematodes<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Kinderwunsch und Schwangerschaft bei<br />
adrenogenitalem Syndrom – diagnostische und<br />
therapeutische Aspekte<br />
Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Osteologie<br />
und Stoffwechselerkrankungen<br />
18.30 – 20.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
2. Post EADV-Meeting<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
17.00 – 20.00 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, St.Gallen<br />
Christmas Lecture mit Weihnachtsapéro<br />
Hals-Nasen-Ohren-Klinik<br />
17.30 – 19.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen
Agenda<br />
25<br />
JANUAR<br />
Di 09.01.2018 22. St.Galler IPS-Symposium 2018:<br />
Thema «Ethik & Recht»<br />
Mo 15.01.2018<br />
Mi 17.01.2018<br />
Mi 24.01.2018 /<br />
Do 25.01.2018<br />
Do 25.01.2018<br />
Mo 29.01.2018<br />
FEBRUAR<br />
Mo 05.02.2018<br />
Do 08.02.2018<br />
Fr 09.02.2018<br />
Do 22.02.2018<br />
Chirurgische Intensivstation<br />
10.00 – 17.30 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Montagsfortbildung: Patienten, die mit<br />
Doppelbildern in die Notaufnahme kommen<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 – 18.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Infoveranstaltung Studium Humanmedizin<br />
Klinik für Allgemeine Innere Medizin<br />
15.15 – 17.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Fachsymposium Gesundheit: Verstehen<br />
und verstanden werden. Kommunikation –<br />
zentrale Kompetenz von Medizin und Pflege<br />
Departement Pflege<br />
09.00 – 17.30 Uhr<br />
Olma Messen St.Gallen<br />
Fertilitätserhalt: Zukunftsperspektive bei<br />
maligner Erkrankung<br />
Frauenklinik<br />
17.00 – 18.45 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Montagsfortbildung: Funktionelle Bewegungsstörungen<br />
und der therapeutische Ansatz<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 – 18.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Montagsfortbildung: Autonomes<br />
Nervensystem – Stiefkind der Neurologie?<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 – 18.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Dermatologie Fokus<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
15.00 – 18.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Grand Round Rehabilitation:<br />
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Kliniken Valens<br />
Klinik für Neurologie<br />
12.00 – <strong>13</strong>.00 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
23. St.Galler Infekttag<br />
Klinik für Infektiologie / Spitalhygiene<br />
08.00 – 17.00 Uhr<br />
Würth Haus Rorschach<br />
Mo 05.03.2018<br />
Mo 05.03.2018<br />
Do 08.03.2018 /<br />
Fr 09.03.2018<br />
Sa 10.03.2018<br />
Sa 10.03.2018<br />
Do 15.03.2018<br />
Mo 26.03.2018<br />
APRIL<br />
Do 05.04.2018<br />
Fr 20.04.2018<br />
Do 26.04.2018<br />
51. St.Galler Anästhesie- und Intensivsymposium<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-,<br />
Rettungs- und Schmerzmedizin<br />
17.00 – 19.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Montagsfortbildung:<br />
Neuropathologische Konferenz<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 – 18.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
3rd Swiss Symposium on Peritoneal Surface<br />
Malignancies<br />
Swiss Peritoneal Cancer Group (SPCG)<br />
Do: 12.00 – 22.00 Uhr, Fr: 08.00 – 17.00 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, St.Gallen<br />
6. St.Galler Ultraschall-Workshop<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-,<br />
Rettungs- und Schmerzmedizin<br />
08.30 – 18.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Fortbildungsreihe Praktischer Einblick<br />
Integrative Psychiatrie<br />
Zentrum für Integrative Medizin<br />
09.00 – 17.30 Uhr<br />
Haus 33, Greithstrasse 22, EG, Raum 015,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Psychosomatik: Auslauf- oder Zukunftsmodell?<br />
Klinik für Psychosomatik<br />
09.00 – 16.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Montagsfortbildung: Begleitung von Menschen<br />
mit Demenz – von der Diagnosemitteilung bis zur<br />
Palliativmedizin<br />
17.30 – 18.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
4. Neurochirurgie Update<br />
Klinik für Neurochirurgie<br />
14.00 – 18.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Stroke Lunch: Das reversible zerebrale<br />
Vasokonstriktionssyndrom – Fallbericht und<br />
Übersicht zum Krankheitsbild<br />
Klinik für Neurologie<br />
12.00 – <strong>13</strong>.00 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
6. St.Galler Wound-Care-Symposium<br />
Klinik für Angiologie<br />
08.30 – 16.30 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, St.Gallen<br />
MÄRZ<br />
Do 01.03.2018<br />
11. Update Neurologie<br />
Klinik für Neurologie<br />
14.00 – 18.30 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mehr Veranstaltungen und<br />
Informationen unter: www.kssg.ch
Kantonsspital St.Gallen<br />
Rorschacher Strasse 95<br />
CH-9007 St.Gallen<br />
Tel. +41 71 494 11 11<br />
Spital Rorschach<br />
Heidenerstrasse 11<br />
CH-9400 Rorschach<br />
Tel. +41 71 858 31 11<br />
Spital Flawil<br />
Krankenhausstrasse 23<br />
CH-9230 Flawil<br />
Tel. +41 71 394 71 11<br />
www.kssg.ch