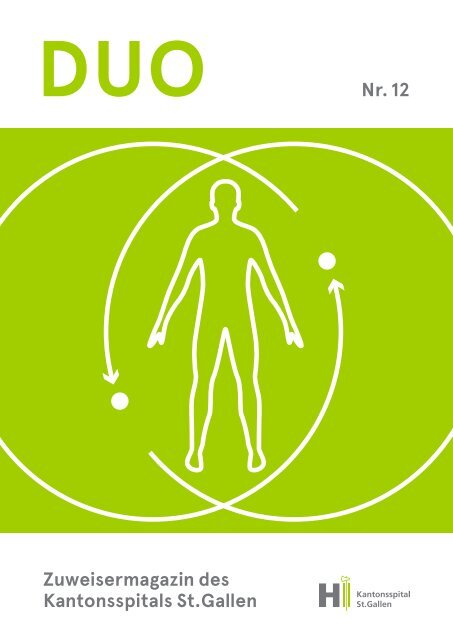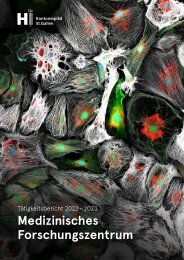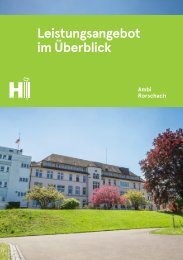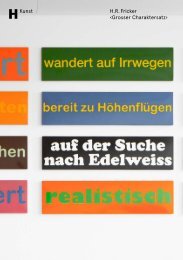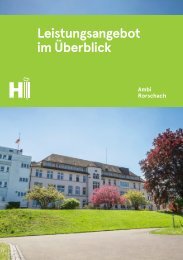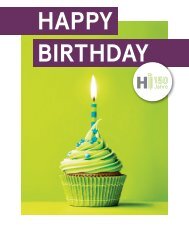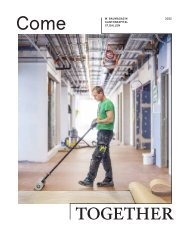DUO_12
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>DUO</strong><br />
Nr. <strong>12</strong><br />
Zuweisermagazin des<br />
Kantonsspitals St.Gallen
3<br />
Editorial<br />
Zusammenspiel<br />
4<br />
Fokus<br />
Schulmedizin gepaart mit<br />
Komplementärmedizin<br />
8<br />
<strong>12</strong><br />
18<br />
24<br />
26<br />
Kader im Profil<br />
Kurznews zum Thema<br />
Hohe Expertise in klinischer Forschung<br />
Innovation und Entwicklung<br />
Kurznews zum Thema<br />
Interdisziplinäre Ernährungsmedizin<br />
am Kantonsspital St.Gallen<br />
Prozesse und Organisation<br />
Kurznews zum Thema<br />
Auf Visite in der Orthopädie Rorschach<br />
Agenda<br />
Veranstaltungen August 2017 bis November 2017<br />
Perspektivenwechsel<br />
PERFORMANCE<br />
neutral<br />
Drucksache<br />
01-17-836879<br />
myclimate.org<br />
Impressum<br />
Ausgabe Nr. <strong>12</strong>, 2017<br />
Herausgeber Unternehmenskommunikation Kantonsspital St.Gallen<br />
Gestaltung VITAMIN 2 AG, St.Gallen<br />
Druck Cavelti AG, Gossau<br />
Anregungen zum <strong>DUO</strong> nehmen wir gerne per E-Mail entgegen:<br />
redaktion@kssg.ch
Editorial 3<br />
Zusammenspiel<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
4<br />
14<br />
Die zunehmende Spezialisierung in der Medizin<br />
und die gesellschaftlichen Entwicklungen erfordern<br />
Massnahmen und Veränderungen unsererseits.<br />
Wir reagieren darauf, indem wir unter anderem auf<br />
die Bildung von interdisziplinären Zentren setzen.<br />
Dabei steht die fächerübergreifende und interprofessionelle<br />
Zusammenarbeit verschiedener Bereiche<br />
im Fokus, um für die Patienten die bestmögliche<br />
Leistung zu erbringen.<br />
Ein Beispiel dazu ist das Zentrum für Integrative Medizin<br />
(ZIM). Was 2009 als Pilotprojekt in der Klinik für<br />
Medizinische Onkologie / Hämatologie begonnen hat<br />
und damals als einzigartig in der ganzen Schweiz<br />
galt, hat sich zu einem weiteren Leistungsangebot des<br />
Kantonsspitals St.Gallen entwickelt. Das Zusammenspiel<br />
von Schul- und Komplementärmedizin funktioniert<br />
und bietet Ihnen und Ihren Patienten ein auf die<br />
individuellen Bedürfnisse angepasstes Angebot. Der<br />
Fokus-Bericht verschafft einen kompakten Überblick.<br />
Auch auf das Zusammenspiel mit Ihnen legen wir<br />
viel Wert. Dieses soll unkompliziert, konstruktiv und<br />
so reibungslos wie möglich sein – damit wir unsere<br />
gemeinsamen Patienten auch weiterhin umfassend<br />
behandeln können.<br />
20<br />
Herzliche Grüsse<br />
Dr. Daniel Germann<br />
Direktor und Vorsitzender<br />
der Geschäftsleitung
4 Fokus<br />
Schulmedizin gepaart mit<br />
Komplementärmedizin<br />
Seit 20<strong>12</strong> leitet Dr. Marc Schläppi das Zentrum für Integrative Medizin<br />
(ZIM) des Kantonsspitals St.Gallen. Was 2009 als Pilotprojekt begonnen<br />
hat und damals einzigartig in der ganzen Schweiz gewesen ist,<br />
hat sich zu einem wichtigen Eckpfeiler im Leistungsangebot des<br />
Kantonsspitals St.Gallen entwickelt. Das Zusammenspiel von konventioneller<br />
und komplementärer Medizin funktioniert und bietet den<br />
Patienten ein zusätzliches, attraktives Angebot. Doch wie darf man<br />
sich dieses Zusammenspiel vorstellen? Wer ist alles daran beteiligt<br />
und was sind die Herausforderungen des Alltags? Darüber<br />
gibt der Zentrumsleiter des ZIM, Dr. Marc Schläppi, Auskunft.<br />
Dr. Marc Schläppi, wann und wie entstand die Idee,<br />
ein Zentrum für Integrative Medizin zu gründen?<br />
Ich bin nun seit rund 14 Jahren am Kantonsspital<br />
St.Gallen, angefangen habe ich in der Klinik für Medizinische<br />
Onkologie und Hämatologie. Mit Prof. Dr.<br />
Thomas Cerny, ehemaliger Chefarzt der Klinik für Medizinische<br />
Onkologie und Hämatologie, und Dr. Steffen<br />
Eychmüller, ehemaliger Leitender Arzt des Palliativzentrums,<br />
entstand damals die Idee einer integrativen<br />
und komplementären Medizin. Im Jahr 2009 lancierten<br />
wir ein Pilotprojekt am Spital Flawil auf der Station<br />
für Palliative Care. Der Erfolg des Pilotprojekts mündete<br />
schliesslich in der Eröffnung des ZIM im Jahr 20<strong>12</strong>.<br />
Was hat Sie an dieser Idee fasziniert?<br />
Die Komplementärmedizin hat mich schon immer fasziniert,<br />
weshalb ich kurz nach meinem Studium eine<br />
Weiterbildung in anthroposophischer Medizin begonnen<br />
habe. Nach dem Facharzt für Innere Medizin am<br />
Universitätsspital Zürich habe ich an der Ita-Wegman-Klinik<br />
in Arlesheim Erfahrungen im Bereich der<br />
anthroposophischen Medizin gesammelt und mich<br />
oft mit an Krebs erkrankten Patienten auseinandergesetzt.<br />
Das war für mich auch der Moment, mich für<br />
eine Facharztausbildung in Onkologie zu entscheiden.<br />
Und was kann Komplementärmedizin?<br />
Die Stärke einer guten Komplementärmedizin liegt in<br />
der Förderung der Selbstheilungskräfte bzw. der Ressourcen<br />
eines jeden Menschen. Diese kommt häufig<br />
zu kurz in der Schulmedizin. Wir sind in der Akutmedizin<br />
top, aber ein Patient fühlt sich beispielsweise in<br />
der Onkologie oft ausgeliefert. Auf die Biopsie folgt<br />
die Diagnose, Operation und die Chemotherapie. Dies<br />
geschieht alles mit ihm und nicht durch ihn, sogenannt<br />
«passiv». Eine gute Komplementärmedizin hat<br />
auf dieses ausgeliefert sein Antworten.<br />
Welche Antworten bietet sie?<br />
Ist der Patient von diversen Behandlungen sehr erschöpft,<br />
so bestehen die Massnahmen zuerst aus<br />
äusseren Anwendungen wie beispielsweise den Wickeln.<br />
Ziel ist, dass der Patient «empowert» wird und<br />
selbst aktiv wird. So legt er sich beispielsweise den<br />
Wickel selbst an, geht in die Mal- oder Kunsttherapie.<br />
Wie lässt sich Onkologie und Komplementärmedizin<br />
vereinen?<br />
Die Begriffsklärung scheint mir in diesem Zusammenhang<br />
ein sehr wichtiges Thema zu sein. Wir bieten<br />
keine Alternativmedizin, sondern eine Komplementärmedizin.<br />
Wir sehen uns demnach als Ergänzung<br />
zur Schulmedizin. So bieten wir beispielsweise Onkologie-Patienten<br />
häufig Behandlungen im Bereich<br />
Fatigue oder Wallungen an. Wenn Patienten zu uns<br />
kommen in der Hoffnung, dass sie die Chemotherapie<br />
nicht machen müssen, so liegen sie falsch.<br />
Werden Sie oft mit kritischen Stimmen seitens<br />
Schulmediziner gegenüber dem ZIM konfrontiert?<br />
Destruktive Kritik gegenüber dem ZIM erfahre ich<br />
nicht. Selbstverständlich gibt es Kollegen, die Mühe
Fokus<br />
5<br />
Schnell<br />
Das Zentrum für Integrative Medizin des Kantonsspitals<br />
St.Gallen bietet eine Kombination von<br />
komplementärmedizinischen Massnahmen aus den<br />
ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen<br />
Bereichen an – sowohl ambulant als auch stationär.<br />
Ein multiprofessionell zusammengesetztes<br />
Team arbeitet mit unterschiedlichen Kliniken,<br />
Institute und Zentren des Kantonsspitals<br />
St.Gallen eng zusammen.<br />
haben mit unserem Angebot. Doch auch sie bemerken<br />
in ihrem Alltag, dass die Patienten nach solchen<br />
Möglichkeiten suchen und sich über ein Angebot am<br />
Kantonsspital St.Gallen freuen. Wir können dadurch<br />
für die Sicherheit und die Qualität der komplementärmedizinischen<br />
Behandlungen sorgen. Wechselwirkungen<br />
zwischen Chemotherapien und pflanzlichen<br />
Substanzen sind hier beispielsweise ein Thema.<br />
Die Behandlungen finden zu 75 % ambulant, zu 25 %<br />
stationär statt. Wie muss man sich das vorstellen?<br />
Ambulante Behandlungen wie Kunsttherapie,<br />
Heileurythmie (eine achtsame Bewegungstherapie),<br />
Osteopathie oder Akupunktur finden bei uns<br />
im Haus 33 im Atelier oder Behandlungszimmer<br />
statt. Wichtig dabei ist, dass wir die Patienten<br />
konsiliarisch betreuen und nur für Verlaufskontrollen<br />
wieder sehen. Wir haben die Stationen in A, B<br />
und C eingeteilt. A ist rein konsiliarisch, auf einer<br />
B-Station ist das Pflegepersonal geschult bezüglich<br />
Anwendungen und Handhabung mit Substanzen<br />
der Integrativen Medizin. Auf der C-Station ist ein<br />
Kaderarzt mit doppelter Ausbildung tätig (Schulmedizin<br />
und Komplementärmedizin). So beispielsweise<br />
in der Klinik für Neurologie mit Dr. Stefan<br />
Hägele-Link.<br />
Dr. Marc Schläppi, MSc<br />
Zentrumsleiter Zentrum für<br />
Integrative Medizin (ZIM)<br />
Leitender Arzt Klinik für Medizinische<br />
Onkologie und Hämatologie<br />
1/20<strong>12</strong> Leiter Zentrum für Integrative<br />
Medizin und LA Onkologie /<br />
Hämatologie KSSG<br />
1/2009 –<br />
<strong>12</strong>/2011<br />
3/2006 –<br />
<strong>12</strong>/2008<br />
OA mbF Onkologie /<br />
Hämatologie KSSG<br />
OA Onkologie /<br />
Hämatologie KSSG<br />
4/2003 –<br />
2/2006<br />
7/2001 –<br />
3/2003<br />
4/2001 –<br />
5/2001<br />
4/1998 –<br />
3/2001<br />
4/1996 –<br />
3/1998<br />
4/1995 –<br />
3/1996<br />
11/1994 –<br />
3/1995<br />
6/1994 –<br />
11/1994<br />
4/1994 –<br />
6/1994<br />
AA, später OAA Onkologie /<br />
Hämatologie KSSG (Prof. T. Cerny)<br />
AA, später LA Ita-Wegman-Klinik<br />
Arlesheim (Dr. Ch. Schulthess)<br />
AA Radiologie (Ultraschall) Kantonsspital<br />
Baden (Prof. R. Otto)<br />
AA Innere Medizin Universitätsspital<br />
Zürich (Prof. A. Schaffner)<br />
AA Innere Medizin Hôpital de<br />
La Chaux-de-Fonds (Prof. A.<br />
de Torrenté, Prof. L. Humair)<br />
Thesis am Swiss Institute for<br />
Experimental Cancer Research<br />
ISREC Epalinges (PD Dr. B. Sordat,<br />
Prof. G. Chapuis)<br />
Allgemeinmedizin<br />
Centre Médical de Morges<br />
Militärarzt Rekrutenschule<br />
Chamblon<br />
Lukas-Seminar Arlesheim<br />
<strong>12</strong>/1993 Arztdiplom an der medizinischen<br />
Fakultät Universität Lausanne
6 Fokus<br />
Leistungsangebot<br />
Ärztliche integrativmedizinische<br />
Sprechstunde<br />
– Allgemeine integrativ- und komplementärmedizinische<br />
Beratung<br />
– Sicherheitsfragen zu Nebenwirkungen und<br />
Interaktionen<br />
– Komplementärmedizinische Therapien aus der<br />
– anthroposophischen Medizin wie z. B.<br />
Misteltherapie und Therapien mit anderen<br />
Arzneimitteln<br />
– traditionellen chinesischen Medizin wie<br />
z. B. Akupunktur und Tuina<br />
Passive Therapien:<br />
Wickel und Kompressen<br />
Wirkung<br />
– Führen u. a. zu einer verbesserten<br />
Durchblutung, wirken gegen Schmerzen und<br />
fördern die Ausscheidungsvorgänge<br />
– Vermitteln eine tiefe Entspannung<br />
– Wirkung der verordneten Substanzen (Tee,<br />
Salbe, Öl) unterstützt spezifisch bei verschiedenen<br />
Beschwerden wie Müdigkeit,<br />
Verspannung, Schmerzen, Unruhe etc.<br />
Rhythmische Einreibungen<br />
nach Wegman / Hauschka<br />
Wirkung<br />
– Behutsame Berührungen regen<br />
geschwächten Organismus an<br />
– Unterstützen den Menschen in seiner<br />
Eigenwahrnehmung<br />
– Steigern Vitalität<br />
– Verbessern das Wohlbefinden<br />
– Durchwärmen und beleben das Gewebe<br />
– Lösen Verspannungen<br />
– Rhythmische Prozesse wie Atmung<br />
oder Ausscheidungsvorgänge werden<br />
angeregt und gestärkt<br />
* CM-Theorie<br />
Weitere Informationen<br />
www.kssg.ch/integrative-medizin<br />
Osteopathie<br />
Wirkung<br />
Entspannung und Schmerzfreiheit durch<br />
– Lockerung des Gewebes<br />
– vergrösserte Bewegungsfreiheit<br />
– Haltungsnormalisierung<br />
– verbesserte Durchblutung (Verund<br />
Entsorgung von Flüssigkeiten)<br />
Regulierung und normalisierung der<br />
physiologische Funktionen durch Beeinflussung<br />
– des vegetativen Nervensystems<br />
– der Verdauung<br />
Akupunktur<br />
Wirkung<br />
Normalisiert physiologische Funktionen<br />
durch Regulation der Meridiane* bei<br />
– Müdigkeit bei verschiedenen chronischen<br />
Erkrankungen<br />
– neurologischen Erkrankungen wie<br />
Parkinsonsyndrom, Restless-Legs-Syndrom<br />
– Übelkeit, Diarrhö, Obstipation
Fokus<br />
7<br />
Aktivierende Therapien:<br />
Achtsamkeitstraining –<br />
Mindfulness-Based<br />
Stress Reduction (MBSR)<br />
Wirkung der Achtsamkeit<br />
– Stärkt die Selbstwirksamkeit<br />
– Steigert das Gewahrsein<br />
– Fördert die Fähigkeit, die Realität des<br />
gegenwärtigen Augenblicks wahrzunehmen<br />
– Löst Ängste und depressive Stimmungen<br />
– Zum Teil bessere Symptomkontrolle bei<br />
chronischen Erkrankungen<br />
Kunsttherapie<br />
Wirkung<br />
– Durchwärmt und entspannt den Organismus<br />
– Vertieft die Erlebnisqualitäten der Seele<br />
– Regt strukturierende und stabilisierende<br />
Vorgänge an<br />
– Regulative Wirkung der Malprozesse auf physische,<br />
vitale, psychische und geistige Funktionen<br />
– Hitzewallungen<br />
– Angstzuständen und Depression<br />
– einem breiten Spektrum an funktionellen<br />
Beschwerden, bei denen keine organischen<br />
Ursachen gefunden werden<br />
Führt zu Schmerzlinderung / Schmerzfreiheit<br />
durch Lösung von Blockaden bei<br />
– akuten und chronischen Schmerzen wie Migräne,<br />
Kopf-, Rücken-, Schulter- und Bauchschmerzen<br />
Heileurythmie<br />
Wirkung<br />
– Einsatz der Bewegungsformen kann auf überschiessende<br />
oder verhärtende Krankheitsprozesse<br />
regulierend und harmonisierend einwirken<br />
– Schult die innere Achtsamkeit und<br />
Körperwahrnehmung<br />
– Aktiviert die Selbstheilungskräfte<br />
Fortbildungsreihe «Praktischer<br />
Einblick integrative Medizin»<br />
Das ZIM veranstaltet seit 2017 eine Fortbildungsreihe,<br />
in der einmal pro Jahr komplementärund<br />
integrativmedizinische Behandlungskonzepte<br />
aus verschiedenen medizinischen Gebieten zu<br />
wichtigen Krankheitsbildern vorgestellt werden.<br />
Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick<br />
in komplementär- und integrativmedizinische<br />
Konzepte aus der chinesischen und anthroposophischen<br />
Medizin, der Osteopathie und<br />
der Mind-Body-Medizin. Der Tag ist praxisorientiert<br />
ausgerichtet und bietet für<br />
Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit zur<br />
Besprechung eigener Fälle.<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.kssg.ch/integrative-medizin
8 Kader im Profil<br />
St.Galler Chirurgen verhelfen<br />
europäischer Gefässchirurgie an<br />
die Weltspitze<br />
Neueste Analysen des sogenannten Impact-Faktors<br />
– ein Mass für den Einfluss von medizinischen Fachzeitschriften<br />
– zeigen, dass sich das «European<br />
Journal of Vascular and Endovascular Surgery»<br />
(EJVES) zur Weltspitze vorgearbeitet hat. Mit einem<br />
Impact von 4,061 führt es die internationale Rangliste<br />
von gefässchirurgischen Zeitschriften derzeit<br />
sogar an. Das Kantonsspital St.Gallen hat massgeblichen<br />
Anteil an diesem Erfolg. Prof. Dr. Florian Dick,<br />
Chefarzt der Klinik für Gefässchirurgie und Vorstandsmitglied<br />
der Schweizerischen und Europäischen<br />
Gesellschaft für Gefässchirurgie, ist seit 2011 assoziierter<br />
Editor und zeigt sich seit 2016 als Senior<br />
Editor mitverantwortlich für Auswahl und Publikation<br />
des Inhalts. Ab 2019 wird er das EJVES als Editor<br />
in Chief führen. Die stellvertretende Chefärztin der<br />
Klinik, PD Dr. Regula von Allmen, ist zudem Teil des<br />
Editorial Boards, einer renommierten internationalen<br />
Beratergruppe des Journals. Das EJVES erarbeitet<br />
und aktualisiert unter anderem die in Europa<br />
gültigen internationalen Behandlungsrichtlinien.<br />
Das Leitungsteam der Klinik für Gefässchirurgie hat<br />
so nicht nur unmittelbaren Zugang zu den neusten<br />
Erkenntnissen und Therapien in der Gefässmedizin,<br />
es gestaltet die Zukunft des Fachs aktiv mit,<br />
was wiederum den Patienten direkt zugute kommt.<br />
Neuer Stv. Chefarzt<br />
Prof. Dr. Ueli Güller<br />
Am 1. Mai 2017 wurde Prof. Dr. Ueli Güller zum stellvertretenden<br />
Chefarzt der Klinik für Medizinische<br />
Onkologie und Hämatologie befördert. Ueli Güller<br />
absolvierte seine chirurgische Ausbildung an der<br />
Universität Basel. Während eines Forschungsaufenthaltes<br />
an der Duke University in North Carolina/<br />
USA schloss er den Studiengang über Statistik<br />
und klinische Forschung mit einem Master of Health<br />
Sciences (MHS) ab. Seine Habilitation erfolgte im<br />
Alter von 33 Jahren. Nach einem klinischen Fellowship<br />
in Chirurgischer Onkologie an der Universität<br />
Toronto/Kanada wurde er Leitender Arzt und Leiter<br />
der kolorektalen Chirurgie am Inselspital Bern.<br />
Der medizinisch-onkologischen Weiter- und Fortbildung<br />
unterzog sich Ueli Güller am Kantonsspital<br />
St.Gallen, wo er seit Januar 2014 das Team der<br />
gastrointestinalen medizinischen Onkologie leitet.
Kader im Profil<br />
9<br />
Weitere<br />
Ernennungen,<br />
Wahlen und<br />
Pensionierungen<br />
KLINIK FÜR RADIOLOGIE UND NUKLEARMEDIZIN<br />
Dr. Ina Krull<br />
Neue Leitung<br />
Osteologie<br />
Seit Anfang 2017 leitet Dr. Ina Krull (Leitende Ärztin)<br />
den Fachbereich Osteologie der Klinik für Endokrinologie,<br />
Diabetologie, Osteologie und Stoffwechselerkrankungen.<br />
Dr. Krull hat an der Universität Ulm<br />
und München Medizin studiert und dort auch promoviert.<br />
Seit 1997 ist sie am Kantonsspital St.Gallen<br />
tätig: anfangs als Rotationsassistenzärztin (FMH-Prüfung<br />
Innere Medizin im Jahr 2000), dann als Oberärztin<br />
in der Klinik für Innere Medizin / Hausarztmedizin.<br />
2007 bis 2010 folgte die FMH-Weiterbildung Endokrinologie<br />
am Universitätsspital Bern mit einjähriger<br />
Tätigkeit als Oberärztin auf diesem Gebiet. Ab März<br />
2010 übernahm sie im Fachbereich Osteologie<br />
unter der Leitung von Dr. Hans-Ulrich Mellinghof die<br />
Stellvertretung, 2011 folgte die Beförderung zur<br />
Oberärztin mbF.<br />
Pensionierung<br />
per 31.01.2018<br />
Beförderung<br />
per 01.04.2017<br />
Beförderung<br />
per 01.04.2017<br />
Dr. Peter Waibel<br />
Leitender Arzt<br />
PD Dr. Tobias Dietrich<br />
Leitender Arzt<br />
Dr. Olaf Chan-Hi Kim<br />
Leitender Arzt<br />
KLINIK FÜR ALLGEMEIN-, VISZERAL-,ENDOKRIN- UND<br />
TRANSPLANTATIONSCHIRURGIE<br />
Wahl<br />
per 01.10.2017<br />
Prof. Dr. Thomas Frick<br />
Leitender Arzt<br />
KLINIK FÜR DERMATOLOGIE, VENEROLOGIE UND ALLERGOLOGIE<br />
Beförderung<br />
per 01.06.2017<br />
Prof. Dr. Lukas Flatz<br />
Leitender Arzt<br />
KLINIK FÜR GASTROENTEROLOGIE/HEPATOLOGIE<br />
Beförderung<br />
per 01.08.2017<br />
Beförderung<br />
per 01.08.2017<br />
Dr. Michael Sulz<br />
Leitender Arzt<br />
Dr. Gian-Marco Semadeni<br />
Leitender Arzt<br />
Hohe Expertise in klinischer Forschung<br />
Prof. Dr. Lukas Flatz, Leitender Arzt aus der Dermatologie,<br />
übernahm Anfang April 2017 die ärztlichwissenschaftliche<br />
Leitung der Clinical Trials Unit<br />
(CTU) des Kantonsspitals St.Gallen von Prof.<br />
Dr. Christoph Driessen nach dessen Ernennung<br />
zum Chefarzt Onkologie.<br />
Mehr über das Thema «Hohe Expertise in<br />
klinischer Forschung» lesen Sie auf Seite 10.
10 Kader im Profil<br />
Prof. Dr. Lukas Flatz<br />
Hohe Expertise in<br />
klinischer Forschung<br />
Auf Antrag der Forschungskommission wählte die Geschäftsleitung<br />
Prof. Dr. Lukas Flatz per 1. April 2017 zum neuen ärztlich-wissenschaftlichen<br />
Leiter der Clinical Trials Unit (CTU). Lukas Flatz trat<br />
damit die Nachfolge von Prof. Dr. Christoph Driessen an, der per<br />
1. Mai 2017 zum neuen Chefarzt der Klinik für Onkologie / Hämatologie<br />
gewählt worden ist (s. <strong>DUO</strong> Nr. 11).<br />
Er habe seinerzeit vom Unispital Lausanne nach<br />
St.Gallen gewechselt, weil er – neben seiner Tätigkeit<br />
an der Dermatologie – am Medizinischen Forschungszentrum<br />
(MFZ) eine optimale Infrastruktur<br />
vorgefunden habe, um seine eigene Forschungsgruppe<br />
aufzubauen. Dass er aber dereinst die ärztliche<br />
Leitung der CTU von Prof. Christoph Driessen<br />
übernehmen würde, sei natürlich nicht vorhersehbar<br />
gewesen, lacht Lukas Flatz. Genauso wenig habe<br />
er ahnen können, dass er einmal interimistisch die<br />
Dermatologie führen werde, ergänzt er. «Für mich<br />
war aber gerade auch diese Führungstätigkeit eine<br />
sehr gute und interessante Erfahrung, die ich nicht<br />
missen möchte. Ich konnte dabei viel lernen, was<br />
mir jetzt in meiner neuen Funktion wieder zugutekommt»,<br />
sagt der 39-Jährige.<br />
Nie grosse Gedanken gemacht<br />
Im Gespräch mit dem gebürtigen Liechtensteiner<br />
kommt schnell zum Ausdruck, mit welcher Begeisterung<br />
er seinen Beruf ausübt. Wer aber glaubt, er<br />
habe viel Wert auf eine strategische Karriereplanung<br />
gelegt, irrt sich. «Ich habe mir nie grosse Gedanken<br />
darüber gemacht, wohin meine Karriere mich<br />
führen wird. Für mich ist die Maxime im Leben, dass<br />
ich möglichst alles mit Freude angehe, und zwar
Kader im Profil<br />
11<br />
Schnell<br />
Zur Durchführung und Unterstützung von klinischen<br />
Studien gibt es in der Schweiz sechs akademische<br />
klinische Forschungszentren, sogenannte Clinical<br />
Trials Units (CTUs). Neben den Universitätsspitälern<br />
Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich ist das Kantonsspital<br />
St.Gallen das einzige nicht universitäre<br />
Spital, das über eine eigene CTU verfügt. Seit April<br />
2017 ist Prof. Dr. Lukas Flatz neuer ärztlich-wissenschaftlicher<br />
Leiter der CTU. Für ihn ist wichtig, dass<br />
auch die zuweisenden Ärzte erfahren, was genau<br />
hinter der CTU steht.<br />
sowohl im Beruf als auch im Familiären.» Freude<br />
trieb ihn auch an, als er sich nach dem Studium<br />
zuerst sechs Jahre lang der Forschung widmete.<br />
Irgendwann fehlten ihm aber die Patienten, und<br />
Lukas Flatz war sich nicht zu schade, trotz hervorragenden<br />
wissenschaftlichen Leistungsausweises<br />
nochmals als Assistenzarzt anzufangen.<br />
Ein Privileg<br />
Seit April 2014 arbeitet Lukas Flatz am Kantonsspital<br />
St.Gallen. Auch in seiner neuen Funktion als ärztlicher<br />
Leiter der CTU bleibt er weiterhin klinisch tätig.<br />
Und zwar in einem Umfang von je 20 % in der Onkologie<br />
und in der Dermatologie. Dass er eine Brücke<br />
schlagen darf zwischen klinischer Forschung, Grundlagenforschung<br />
und Kliniktätigkeit, erachtet er als<br />
Privileg. «Am meisten schätze ich es, dass ich hier<br />
am KSSG mein Wissen aus meiner Forschungstätigkeit<br />
einsetzen und andere Kliniken unterstützen<br />
kann, wenn sie eigene Forschungsprojekte angehen<br />
wollen», betont der Leitende Arzt. «Und dies<br />
unabhängig davon, ob es sich um Forschung handelt,<br />
die von Pharmafirmen gesponsert wird, oder um<br />
Forschung, die direkt von den Forschern und Klinikern<br />
am KSSG initiiert wird.»<br />
Grosse Expertise noch bekannter machen<br />
«Wir verfügen mit der CTU über ein grossartiges<br />
Instrument, das es zu nutzen gilt», sagt Lukas Flatz.<br />
Aber zu Beginn seiner Anstellung habe selbst er<br />
noch nicht so genau gewusst, wofür die CTU des<br />
KSSG denn stehe, gibt der neue ärztliche Leiter unumwunden<br />
zu. Deshalb gelte es, diese Expertise<br />
noch bekannter zu machen. Lukas Flatz ist dankbar,<br />
dass er mit Dr. Reinhard Maier einen Koleiter und<br />
operationellen Leiter der CTU neben sich hat. Dies<br />
habe ihm in den ersten Monaten sehr geholfen.<br />
Patient im Fokus<br />
Es sei sicher ein Vorteil, dass er aus eigener Erfahrung<br />
wisse, wie eine Klinik funktioniere und wie aufwendig<br />
manche Sachen sind, sagt Flatz weiter. Das<br />
fördere das gegenseitige Verständnis, wenn man<br />
Studien plane und begleite. «Im Zentrum jeder klinischen<br />
Studie steht letztlich immer der Patient.<br />
Wenn man als Forscher selber auch Patienten sieht,<br />
dann kennt man die Bedürfnisse beider Seiten.<br />
Wir müssen genau wissen, was der Patient, aber<br />
auch die Forschenden benötigen und wie man mit<br />
allen kommunizieren sollte. Mir ist es denn auch<br />
wichtig, dass die zuweisenden Ärzte wissen, dass<br />
klinische Studien am KSSG professionell betreut<br />
werden und die CTU jederzeit für sie da ist, wenn sie<br />
Fragen zu Studien oder sonst ein Anliegen zum<br />
Thema Forschung haben.»<br />
Nur mit einem guten Team möglich<br />
Das «Wechseln» zwischen seinen drei verschiedenen<br />
Arbeitsorten in der Onkologie, in der Dermatologie<br />
und dem MFZ / CTU bereite ihm keinerlei Mühe,<br />
antwortet Lukas Flatz auf die Frage, wie er denn alles<br />
unter einen Hut bringe. «Es ist ja nicht so, dass<br />
ich alleine die CTU oder meine eigene einzelne Forschungsgruppe<br />
bin. Und es ist auch nicht so, dass<br />
ich der einzige Kliniker bin, der sich in der Dermatologie<br />
oder in der Onkologie für unsere Hautkrebspatienten<br />
einsetzt. Dahinter steht immer ein Team,<br />
und ohne ein gutes Team, welches zusammenspielt<br />
und in welchem sich jeder für jeden im Alltag einsetzt,<br />
wäre das unmöglich zu machen!», betont Flatz.<br />
Clinical Trials Unit (CTU) des<br />
Kantonsspitals St.Gallen<br />
Tel. +41 71 494 35 <strong>12</strong> oder ctu@kssg.ch<br />
Öffnungszeiten Sekretariat:<br />
Mo. – Fr.: 08.15 bis 11.30 Uhr / 13.30 bis 17.00 Uhr<br />
CTU-Leitung<br />
Ärztlich / Wissenschaftlich:<br />
Prof. Dr. Lukas Flatz<br />
Operationell / Personell:<br />
Dr. rer. nat. Reinhard Maier
<strong>12</strong> Innovation und Entwicklung<br />
Save the Date: KlinFor<br />
9. / 10. November 2017<br />
Die diesjährige Fortbildungsveranstaltung KlinFor<br />
steht unter dem Motto «KlinForεver». Damit<br />
will das Organisationskomitee einerseits bekräftigen,<br />
dass auch in Zukunft anhaltend interessante,<br />
zeitgemässe Fortbildungen angeboten werden.<br />
Andererseits stellt das griechische «ε» spiegelbildlich<br />
eine «3» dar und soll die gemeinsame<br />
Fortbildung mit Beiträgen aus den drei Unternehmen<br />
Ostschweizer Kinderspital St.Gallen,<br />
Geriatrische Klinik St.Gallen und Kantonsspital<br />
St.Gallen repräsentieren. Die Hauptvorträge fokussieren<br />
auf die Schnittstellen und Übergänge<br />
der Betreuung von der Pädiatrie zur Erwachsenenmedizin<br />
und weiter zu Geriatrie. In weiteren<br />
Plenarvorträgen wird auf verschiedene Aspekte<br />
der Kampagne «smarter medicine», auf Stolpersteine<br />
in der Medizin und das aktuelle Thema der<br />
Migration und Mobilität eingegangen.<br />
Ort<br />
Geriatrische Klinik St.Gallen,<br />
Olma Messen St.Gallen und Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Tel. +41 71 494 10 02 oder www.klinfor.ch<br />
Kursangebot für Chirurgen<br />
und interventionell tätige Ärzte<br />
Das Schulungs- und Trainingszentrum des Kantonsspitals<br />
St.Gallen bietet eine ganze Reihe wissensbasiert<br />
entwickelter Kurse, in welche die Erkenntnisse<br />
der Lern- und Trainingswissenschaften eingeflossen<br />
sind und die in diesem Sinne stetig weiterentwickelt<br />
werden. Die Kurspalette reicht vom einfachen Skill-<br />
Kurs, wie beispielsweise zur Pleurapunktion, über<br />
Curriculum-relevante und komplexe Kurse, wie den<br />
zwei mal zwei Tage dauernden Laparoskopie-Basiskurs,<br />
bis hin zum mentalen Training oder zum überfachlichen<br />
Kurs, dessen Credo Lernen, Motivation<br />
und Erfolg lautet. Das Kursangebot wird stetig<br />
erweitert und sukzessive ein durchdachtes Lernund<br />
Trainingssystem aufgebaut.<br />
Gestartet ist das Schulungs- und Trainingszentrum<br />
Kantonsspital St.Gallen im Jahre 2014 als Projekt und<br />
hat im Januar 2015 seinen Betrieb aufgenommen.<br />
Weitere Informationen und aktuelle Kurse finden<br />
Sie unter www.kssg.ch/stz
Innovation und Entwicklung<br />
13<br />
Neues OP-Mikroskop in der Neurochirurgie<br />
In der Klinik für Neurochirurgie werden seit knapp<br />
einem Jahr zwei neue OP-Mikroskope des Typs Pentero<br />
900 eingesetzt. Durch den Einsatz der Geräte<br />
können u. a. verbesserte optische Eigenschaften bei<br />
Schärfeeindruck, Schärfentiefe und Farbechtheit<br />
gewährleistet werden. Zusätzlich sorgen die drei Fluoreszenzmodule<br />
für eine Behandlung auf höchstem,<br />
spezialisiertem Niveau: Infrarot 800 dient zur visuellen<br />
Beurteilung des Blutflusses und der Gefässdurchgängigkeit,<br />
z. B. während der chirurgischen Behandlung<br />
von arteriovenösen Malformationen (AVM) und<br />
Aneurysmen. Yellow 560 visualisiert Fluoreszenzfarbstoffe<br />
im Wellenlängenbereich zwischen 540<br />
und 690 nm und eröffnet zusätzliche Anwendungsbereiche.<br />
Blue 400 ermöglicht die intraoperative<br />
Erkennung von hochgradigen Gliomen.<br />
Ernährung und Gesundheit sind<br />
eng miteinander verknüpft<br />
Die Interdisziplinäre Ernährungsmedizin am<br />
Kantonsspital St.Gallen hat sich in den letzten Jahren<br />
zu einem wichtigen Angebot etabliert. Ziel<br />
ist es, eine optimale Ernährung für die Patienten<br />
im Spital sicherzustellen. Besondere Aufmerksamkeit<br />
verlangen Patientinnen und Patienten mit<br />
einer Mangelernährung.<br />
Mehr über das Thema «Interdisziplinäre<br />
Ernährungsmedizin am Kantonsspital St.Gallen»<br />
lesen Sie auf Seite 14.
14 Innovation und Entwicklung<br />
Interdisziplinäre<br />
Ernährungsmedizin am<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Rund sechs Jahre nach ihrer Einführung<br />
ist die Interdisziplinäre Ernährungsmedizin<br />
(IEM) am Kantonsspital St.Gallen<br />
inzwischen etabliert – höchste Zeit,<br />
auch den zuweisenden Ärztinnen und<br />
Ärzten dieses wichtige Angebot<br />
im und ums Spital näher vorzustellen.<br />
Die Ernährung im Spital stellt einen wichtigen Eckpfeiler<br />
einer umfassenden Behandlung dar. Ein<br />
Grossteil der Patientinnen und Patienten braucht<br />
aber gar keine spezifische Ernährungstherapie,<br />
sondern «lediglich» eine ausgewogene Ernährung.<br />
Bei diversen Krankheitsbildern stellen gezielte<br />
Ernährungsformen jedoch ein wichtiges Element in<br />
der Behandlung dar. So zum Beispiel beim Diabetes<br />
mellitus, bei Pankreatitis, beim Kostaufbau nach<br />
einer viszeralchirurgischen Operation, bei chronischer<br />
Leber- und Niereninsuffizienz oder bei<br />
Zöliakie und seltenen Stoffwechselerkrankungen.<br />
Um all diese Bedürfnisse abzudecken, bietet die<br />
Spital- bzw. Diätküche des Kantonsspitals St.Gallen<br />
37 verschiedene Grundkostformen an, welche in<br />
Zusammensetzung und Konsistenz variiert werden<br />
können. Dies ergibt schliesslich 130 verschiedene<br />
Kostformen, welche täglich für die Patienten zur<br />
Verfügung stehen.<br />
Mangelernährung ist auch im Akutspital ein Thema<br />
Besondere Aufmerksamkeit verlangen Patientinnen<br />
und Patienten mit einer Mangelernährung, welche<br />
verschiedenste Ursachen haben kann. Die Folgen<br />
einer unerkannten und unbehandelten Mangelernährung<br />
sind mannigfaltig: vermehrte Infektionen<br />
und Wundheilungsstörungen, Muskelatrophie /<br />
Kachexie mit erhöhtem Sturzrisiko und Immobilität,<br />
erhöhtes Risiko für Dekubitusbildung, erhöhte<br />
Sterblichkeit, längere Hospitalisationsdauer und<br />
ergo auch höhere Kosten. «Aus verschiedenen<br />
nationalen und internationalen Studien sowie aus<br />
eigenen Erhebungen wissen wir, dass ca. 20 bis<br />
30 Prozent aller Patienten im Akutspital bereits bei<br />
Eintritt eine Mangelernährung oder ein erhöhtes<br />
Risiko dafür aufweisen», erklärt Dr. Sarah Sigrist,<br />
Oberärztin mbF und Leiterin Klinisches Ernährungsteam.<br />
Bei nicht wenigen dieser Patienten bestehe<br />
die Gefahr, dass sich der Ernährungszustand während<br />
des Spitalaufenthaltes sogar noch verschlechtere,<br />
ergänzt sie. So beispielsweise durch lange<br />
Nüchternphasen wegen Operationen / Interventionen,<br />
bei Inappetenz aufgrund von Therapienebenwirkungen<br />
oder krankheitsbedingt bei erhöhtem<br />
Nährstoffbedarf oder -verlust. Mangelernährung<br />
bzw. ihre Prävention und Behandlung ist deshalb zu
Innovation und Entwicklung<br />
15<br />
Schnell<br />
In die Ernährung der Spitalpatienten sind sehr viele<br />
verschiedene Berufsgruppen involviert. Die Interdisziplinäre<br />
Ernährungsmedizin des Kantonsspitals<br />
St.Gallen hat das Ziel, die verschiedenen Berufsgruppen<br />
zusammenzubringen und den interprofessionellen<br />
Austausch zu fördern, um letztendlich eine<br />
optimale Ernährung für die Patienten sicherzustellen.<br />
Das Thema Mangelernährung steht dabei im Zentrum<br />
der Tätigkeiten. Es geht darum, Patientinnen und Patienten<br />
mit einer drohenden oder bestehenden Mangelernährung<br />
zu identifizieren und ihnen eine geeignete<br />
Ernährungstherapie zukommen zu lassen.<br />
nen, Hotelfachangestellte, Ernährungsberaterinnen,<br />
Logopädinnen, Spitalapotheke, Logistik, Gastronomie,<br />
Diätküche. «Da die Ernährung natürlich auch<br />
vor und nach einem Spitalaufenthalt eine Rolle<br />
spielt, kommt den Hausärzten als zuweisende und<br />
nachbetreuende Kolleginnen und Kollegen ebenfalls<br />
ein wichtiger Part zu», betont Sarah Sigrist. «Es ist<br />
uns deshalb ein grosses Anliegen, ihnen unsere<br />
Aktivitäten aufzuzeigen und den Informationsfluss<br />
diesbezüglich weiter zu verbessern.»<br />
einem wichtigen Thema nicht nur der klinischen<br />
Forschung und verschiedenen Fachgesellschaften,<br />
sondern auch der Gesundheitspolitik geworden. So<br />
wird von nationalen und internationalen Gremien<br />
ein systematisches Screening auf Mangelernährung<br />
in Akutspitälern empfohlen. Dies war letztendlich<br />
auch der Ausgangspunkt für den Aufbau der Interdisziplinären<br />
Ernährungsmedizin am KSSG. Das Mangelernährungs-Screening<br />
mit den daraus folgenden<br />
diagnostischen und therapeutischen Schritten<br />
gehört denn auch zu den Hauptaufgaben des klinischen<br />
Ernährungsteams.<br />
Viele verschiedene Berufsgruppen involviert<br />
In der Interdisziplinären Ernährungsmedizin wird –<br />
wie es der Name schon sagt – die Interprofessionalität<br />
ganz bewusst gepflegt und gelebt. Es ist ähnlich<br />
wie bei einem feinen Essen, das auch aus dem Zusammenspiel<br />
der verschiedenen Komponenten und<br />
Gängen mit ihren unterschiedlichen Farben, Gerüchen<br />
und Geschmacksnuancen lebt: In die Ernährung<br />
der Spitalpatienten sind sehr viele verschiedene<br />
Berufsgruppen involviert, welche alle mit ihrer<br />
spezifischen Fachkompetenz und Erfahrung einen<br />
wichtigen Beitrag leisten – Ärzte, Pflegefachperso-<br />
Ziel der Interdisziplinären Ernährungsmedizin<br />
Die Interdisziplinäre Ernährungsmedizin hat das Ziel,<br />
die verschiedenen Berufsgruppen zusammenzubringen<br />
und den interprofessionellen Austausch<br />
zu fördern, um letztendlich eine optimale Ernährung<br />
für die Patienten im Spital sicherzustellen.<br />
Ambulante<br />
Ernährungsberatung<br />
Standort<br />
St.Gallen, Flawil, Rorschach<br />
Anmeldung<br />
Ernährungsberatung KSSG (per Post oder<br />
E-Mail an ernährungsberatung@kssg.ch)<br />
Mögliche Indikationen<br />
Beratung bei Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen,<br />
Mangelernährung,<br />
Intoleranzen (z. B. Laktose, Fruktose), Zöliakie,<br />
angeborene Stoffwechselstörungen<br />
(z. B. PKU), Tumorpatienten vor / während /<br />
nach Therapie
16 Innovation und Entwicklung
Innovation und Entwicklung<br />
17<br />
Dafür gibt es die Ernährungskommission (Ko-Leitung:<br />
Dr. Stefan Bilz, Leitender Arzt Endokrinologie /<br />
Diabetologie und Prof. Dr. Stephan Brand, Chefarzt<br />
Gastroenterologie / Hepatologie), welche als strategisches<br />
Gremium die Aufgaben und Zielsetzungen<br />
definiert. Im klinischen Alltag sind für die direkte<br />
Patientenbetreuung vor allem die Ernährungsberatung<br />
und die Ernährungsmedizinerinnen verantwortlich.<br />
Falls nötig werden auch weitere Fachpersonen<br />
wie zum Beispiel eine klinische Pharmazeutin<br />
und die Logopädie hinzugezogen. Gemeinsam mit<br />
den Stationsärzten und der Pflege wird bei Bedarf<br />
ein individueller Ernährungsplan erstellt, der nebst<br />
einer Anpassung der Kostform und der Gabe von<br />
Trinknahrungssupplementen auch eine enterale<br />
Sondenernährung oder eine parenterale Ernährung<br />
beinhalten kann.<br />
Ambulante Nachbetreuung in<br />
ernährungsmedizinischer Sprechstunde<br />
Benötigt ein Patient auch nach dem Spitalaufenthalt<br />
eine spezifische Ernährungstherapie, z. B. eine Sondenernährung<br />
oder sogar eine heimparenterale<br />
Ernährung, wird das Stationsteam in den dafür notwendigen<br />
organisatorischen Belangen unterstützt.<br />
Unter diese Aufgaben fallen beispielsweise das<br />
Einholen einer Kostengutsprache, die Organisation<br />
und Instruktion der Spitex oder Pflege in nachbetreuenden<br />
Institutionen, die Avisierung des Homecare-Dienstes,<br />
der für die Lieferung der Ernährungsprodukte<br />
verantwortlich ist, oder die Schulung<br />
der Patienten und Angehörigen. Nicht zuletzt muss<br />
auch dafür gesorgt werden, dass die Hausärzte<br />
als nachbetreuende Kolleginnen und Kollegen die<br />
notwendigen Informationen zur Ernährungstherapie<br />
und deren Verlaufskontrolle erhalten.<br />
In einigen komplexen Fällen, insbesondere wenn<br />
längerfristig eine enterale oder parenterale<br />
Ernährung notwendig ist, macht ausserdem eine<br />
ambulante Nachbetreuung in einer ernährungsmedizinischen<br />
Sprechstunde Sinn. Hausärzte können<br />
für diese Sprechstunde gerne auch Patienten<br />
zuweisen, die spezifische Ernährungsprobleme<br />
haben. So zum Beispiel Patienten mit Mangelernährung<br />
nach Gastrektomie, kachektische Tumorpatienten<br />
(prä- oder posttherapeutisch) oder Patienten<br />
mit Ernährungsproblemen bei chronisch<br />
entzündlichen Darmerkrankungen. Weiterführende<br />
Informationen zur ernährungsmedizinischen<br />
Sprechstunde siehe Box.<br />
Sensibilisierung für das Thema<br />
(Mangel-)Ernährung verbessern<br />
Die Bemühungen und Erfahrungen der letzten<br />
Jahre zeigen, dass die Sensibilisierung für das Thema<br />
(Mangel-)Ernährung bei allen Berufsgruppen am<br />
Kantonsspital St.Gallen zugenommen hat. Mit Fortbildungen<br />
und Schulungen soll diese weiter verbessert<br />
werden, und in Zukunft sollen auch die Hausärzte<br />
vermehrt eingebunden werden.<br />
Ambulante<br />
ernährungsmedizinische<br />
Sprechstunde<br />
(in Kombination mit Ernährungsberatung)<br />
Standort<br />
St.Gallen<br />
Anmeldung<br />
Schriftliche Zuweisung an die<br />
Ernährungsmedizinerinnen:<br />
Dr. S. Sigrist,<br />
Endokrinologie/Diabetologie,<br />
oder Tel. Sekretariat: +41 71 494 31 16<br />
Dr. C. Krieger,<br />
Gastroenterologie / Hepatologie<br />
Tel. Sekretariat: +41 71 494 10 65<br />
Mögliche Indikationen<br />
Ernährungsprobleme nach ausgedehnten<br />
viszeralchirurgischen Eingriffen<br />
(z. B. Gastrektomie, Ösophagektomie,<br />
Kurzdarmsyndrom mit / ohne Stoma,<br />
intestinale Fisteln), Evaluation bezüglich<br />
oder Mitbetreuung bei heimparenteraler<br />
oder -enteraler Ernährung<br />
< Interprofessionalität wird grossgeschrieben: Eine klinische Fallbesprechung auf der Station 0141 mit Vertreterinnen/<br />
Vertretern der Ernährungsberatung, der Pflege, der Ernährungsmedizin und der Spitalapotheke.
18 Prozesse und Organisation<br />
Eingespieltes Duo<br />
Seit zehn Jahren arbeitet die Augenklinik des Kantonsspitals<br />
St.Gallen mit jener des Kantonsspitals<br />
Graubünden zusammen. So führen Hugo Niederberger,<br />
Leiter Fotodiagnostik, und Dr. Dr. Belo Török,<br />
Leiter Abteilung Fotodiagnostik (beide KSSG), zweimal<br />
pro Monat während eines Tages Untersuchungen<br />
bzw. Angiografien der Netzhaut in Chur durch.<br />
Das Ziel ist es, die Patienten aus dem Kanton Graubünden<br />
wohnortnah zu versorgen und spezialisiertes<br />
Know-how über Kantons- und Spitalgrenzen<br />
hinweg auszutauschen. Die Aufnahmen werden anschliessend<br />
in St.Gallen begutachtet, der Bericht<br />
bzw. Befund geht via niedergelassenen Arzt zurück<br />
zum Patienten. In den letzten zehn Jahren wurden<br />
mehr als 6000 Patienten auf diesem Weg in Chur<br />
untersucht und in St.Gallen befundet – eine erfolgreiche<br />
und gut funktionierende Zusammenarbeit.<br />
Orthopädie und<br />
Traumatologie am<br />
Standort Rorschach<br />
Einen Einblick in die Orthopädische Chirurgie und<br />
Traumatologie des Bewegungsapparates gewährt<br />
der Artikel auf Seite 20. Dr. Michael Badulescu und<br />
sein Team bieten am Standort in Rorschach ein<br />
breites orthopädisches Spektrum an. Die familiäre<br />
und gute Atmosphäre ist dabei spürbar.<br />
Mehr über das Thema «Orthopädie und Traumatologie<br />
Rorschach» lesen Sie auf Seite 20.<br />
Neues Servicecenter Klinik für<br />
Radiologie und Nuklearmedizin –<br />
eine zentrale Anlaufstelle<br />
Um sämtliche Anliegen von Patienten und Zuweisern<br />
in der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin<br />
schnell und kompetent gerecht zu werden, wurden<br />
die administrativen Arbeiten rund um die Untersuchungsplanung<br />
und Befundverteilung in den beiden<br />
Bereichen Radiologie und Nuklearmedizin in ein<br />
zentrales Servicecenter zusammengeführt. Von der<br />
Terminvergabe über den Empfang und die administrative<br />
Betreuung des Patienten bis hin zur Verwaltung<br />
der schriftlichen Befunde und Bearbeitung<br />
diverser Anfragen ist so eine speditive und fachkundige<br />
Abwicklung gewährleistet.<br />
Über folgende Kontaktmöglichkeiten ist das<br />
Servicecenter erreichbar:<br />
Servicecenter Bereich Radiologie<br />
Montag bis Freitag durchgehend<br />
von 07.30 bis 18.00 Uhr geöffnet<br />
und erreichbar unter:<br />
Tel. +41 71 494 66 66<br />
Fax +41 71 494 28 85<br />
anmeldung.radiologie@kssg.ch<br />
Servicecenter Bereich Nuklearmedizin<br />
Montag bis Freitag durchgehend<br />
von 08.00 bis 17.00 Uhr geöffnet<br />
und erreichbar unter:<br />
Tel. +41 71 494 22 84<br />
Fax +41 71 494 28 92<br />
nuklearmedizin@kssg.ch
Prozesse und Organisation 19<br />
Hervorragendes Ergebnis<br />
Rezertifizierungsaudit SanaCERT Suisse<br />
Das Audit-Team der SanaCERT Suisse hat das<br />
Kantonsspital St.Gallen am 14. Juni 2017 mit einem ausgezeichneten<br />
Resultat beurteilt. Sieben der acht<br />
ausgewiesenen Standards QM, Infektionsprävention<br />
und Spitalhygiene, Befragungen, CIRS, Ernährung,<br />
Akut verwirrter Patient sowie Abklärung, Behandlung<br />
und Betreuung wurden mit dem bestmöglichen<br />
Ergebnis D «vollumfänglich erfüllt, 4 Punkte» bewertet.<br />
Der Standard Sichere Medikation erhielt ein C<br />
(3 Punkte), da dieser erstmalig vorgestellt wurde. Es<br />
ist das beste Ergebnis (31 von maximal 32 Punkten),<br />
das je in der Geschichte der Zertifizierung durch<br />
SanaCERT Suisse im Kantonsspital St.Gallen erreicht<br />
wurde. Die Rezertifizierung ist bis 2020 bestätigt.<br />
Brustzentrum St.Gallen des<br />
Kantonsspitals St.Gallen<br />
modernisiert und erweitert<br />
Am Brustzentrum St.Gallen mit den beiden Standorten<br />
Kantonsspital St.Gallen und Spital Grabs werden<br />
jährlich rund 350 neue Patientinnen mit gut- und<br />
bösartigen Brusterkrankungen von einem interdisziplinären<br />
Spezialisten-Team betreut. Diagnose und<br />
Behandlung dieser häufigen Krankheit stellen hohe<br />
Anforderungen an die medizinische Expertise, aber<br />
auch an die Infrastruktur. Am Standort des Brustzentrums<br />
im Kantonsspital St.Gallen (Haus 06) wäre<br />
man unter den bisherigen räumlichen Voraussetzungen<br />
aufgrund der zu erwartenden steigenden Frequenzen<br />
zunehmend an Grenzen gestossen. Aus<br />
diesem Grund ist das Brustzentrum in den vergangenen<br />
Wochen umfassend erneuert und ausgebaut<br />
worden. Mit einem neu gestalteten Empfangsbereich,<br />
zusätzlichen Behandlungsräumen, einer offenen<br />
Disposition sowie einem grosszügigen, hellen<br />
Wartebereich, unterstützt durch eine entsprechende<br />
Farbgebung und Möblierung, wurde ein freundliches<br />
und persönliches Ambiente geschaffen. Abläufe<br />
und Prozesse im Brustzentrum konnten dadurch<br />
weiter optimiert werden.
20 Prozesse und Organisation
Prozesse und Organisation<br />
21<br />
Auf Visite in der<br />
Orthopädie Rorschach<br />
Die Orthopädische Chirurgie und Traumatologie<br />
des Bewegungsapparates*<br />
des Kantonsspitals St.Gallen ist an den<br />
drei Standorten St.Gallen, Rorschach<br />
und Flawil vertreten. Dadurch wird eine<br />
regionale Grundversorgung gepaart<br />
mit Zentrumsmedizin angeboten. Ein Tag<br />
in der Orthopädie und Traumatologie am<br />
Standort Rorschach zeigt nicht nur das<br />
breite Leistungsspektrum auf, sondern<br />
gibt auch einen Einblick in die angenehme<br />
Atmosphäre des Spitals am See.<br />
7 Uhr morgens. Der Fokus liegt im Büro von<br />
Dr. Badulescu. Dort werden derzeit aktuelle Patientenfälle<br />
von Assistenten vorgestellt, diskutiert und<br />
weitere Behandlungsschritte festgelegt. Mit dabei<br />
im Raum: Dr. Michael Badulescu, Leitender Arzt<br />
der Orthopädischen Chirurgie und Traumatologie<br />
des Bewegungsapparates (Orthopädie), der Oberarzt,<br />
die Assistenzärzte der Orthopädie sowie die<br />
diensthabenden Ärzte.<br />
Um ca 7.20 Uhr wird in die Videoübertragung des<br />
Rapports von St.Gallen eingeloggt. Die wichtigsten<br />
Beschlüsse inklusive Röntgenbilder werden via Videoübertragung<br />
zwischen St.Gallen, Rorschach und<br />
Flawil ausgetauscht, damit alle auf demselben Wissensstand<br />
sind. Egal, ob die Operation in St.Gallen,<br />
Rorschach oder Flawil stattfindet, die Prozesse sind<br />
standardisiert und die drei Spitäler gleich strukturiert.<br />
«Denn nur so können wir einen reibungslosen<br />
und sowohl für den Patienten als auch für das Spital<br />
sinnvollen Ablauf gestalten», erklärt Dr. Michael<br />
Badulescu. Anschliessend folgt eine halbstündige<br />
Weiterbildung eines Teams aus St.Gallen, Flawil oder<br />
Rorschach. Diese Weiterbildungen finden jeden<br />
< Patientenfälle werden im Team besprochen, diskutiert und weitere Behandlungsschritte festgelegt.
22 Prozesse und Organisation<br />
Morgen im Anschluss an den Morgenrapport<br />
statt, und alle Teams des Kantonsspitals inklusive<br />
der Aussenstandorte beteiligen sich daran.<br />
Breites Leistungsspektrum<br />
Die Orthopädie und Traumatologie am Spital Rorschach<br />
beschäftigt sich schwerpunktmässig mit<br />
der rekonstruktiven Gelenkchirurgie einschliesslich<br />
arthroskopischer Verfahren sowie mit der Frakturversorgung.<br />
Das Team rund um Dr. Badulescu ist<br />
darauf spezialisiert, erkrankte oder abgenützte Gelenke<br />
im Rahmen der Endoprothetik durch ein<br />
künstliches Hüft-, Knie- oder Schultergelenk (Endoprothese)<br />
zu ersetzen.<br />
Auf Visite<br />
Um solche Fälle geht es schliesslich auch auf dem<br />
alltäglichen Visitengang des Teams. Dr. Badulescu,<br />
der Oberarzt Dr. Stephan Keller, zwei Assistenzärzte<br />
sowie eine Pflegefachfrau besprechen vor dem<br />
Zimmer des Patienten kurz den aktuellen Stand:<br />
Medikation, Beschwerden des Patienten, nächste<br />
Schritte. Das Team begrüsst den Patienten und<br />
beantwortet sämtliche Fragen.<br />
Dr. Michael Badulescu<br />
Dr. Michael Badulescu hat 1995 sein Medizinstudium<br />
an der Universität Zürich abgeschlossen.<br />
Als Assistenzarzt war er am Spital Limmattal<br />
sowie am Kantonsspital Münsterlingen und<br />
St.Gallen tätig. Im Jahr 2002 folgte ein orthopädisches<br />
Fellowship in Total Joint Arthrosoplasty<br />
im Brigham and Woman’s Hospital in Boston.<br />
Nach seiner Rückkehr startete er wieder am<br />
Kantonsspital St.Gallen und am Spital Rorschach<br />
als Oberarzt. Seit 2005 ist er Teamleiter der<br />
Orthopädie am Spital Rorschach. Im Nachdiplomstudiengang<br />
erwarb er den Fähigkeitsausweis<br />
in Sportmedizin SGSM (2008), und 2009 folgte<br />
die Ausbildung zum Prüfarzt GCP.<br />
Von der Sprechstunde in den OP<br />
Nach dem Rundgang auf der Station werden die<br />
Patienten in der Sprechstunde empfangen. So auch<br />
Hans M.**, 60-jährig, aus einem Nachbardorf<br />
von Rorschach. Hans M. wurde mit belastungsabhängigen<br />
Hüftschmerzen und einer Schwellung<br />
am Oberschenkel im Kniebereich vom Hausarzt ins<br />
Spital Rorschach überwiesen. Die klinische und<br />
radiologische Abklärung am Standort St.Gallen hat<br />
ergeben, dass es sich um eine fortgeschrittene<br />
Arthrose des rechten Hüftgelenks handelt. Da die<br />
konservative Therapie beim Patienten bereits<br />
ausgeschöpft war, hat sich das behandelnde Team<br />
des Standorts Rorschach gemeinsam mit dem<br />
Patienten für eine operative Therapie mittels Implantation<br />
einer Hüftprothese in minimalinvasiver<br />
Technik entschieden. Die Raumforderung am<br />
distalen Oberschenkel wurde auf Wunsch des Patienten<br />
– und nach radiologischer Untersuchung<br />
sowie Besprechung am Tumorboard – in der gleichen<br />
Operation entfernt.<br />
Im OP<br />
Zu den häufigsten Operationen zählen neben der<br />
Endoprothetik der Kreuzbandersatz und die Meniskus-Teilresektion.<br />
Eingriffe nach Knochen- und<br />
Gelenkbrüchen sowie Operationen der Rotatorenmanschette<br />
gehören ebenso zu den Routineeingriffen<br />
wie Implantat-Entfernungen und Behandlungen<br />
bei Infektionen. Operationen werden am<br />
Standort Rorschach von Mittwoch bis Freitag durchgeführt,<br />
die Mehrzahl davon ist elektiv. Eingriffe in<br />
der Nacht oder an Wochenenden finden am Standort<br />
St.Gallen statt. Doch ob der Patient in St.Gallen oder<br />
Rorschach operiert wird, stellt für Dr. Badulescu keinen<br />
Unterschied dar: «Sowohl in St.Gallen als auch<br />
in Rorschach sehen die OP-Säle gleich aus, und es<br />
stehen dem Operateur die gleichen Instrumente zur<br />
Verfügung. Einzig der Blick aus dem Fenster macht<br />
einen Unterschied.»<br />
Tool-Sharing<br />
Dass der Austausch unter den drei Spitälern nicht<br />
nur auf fachlicher, sondern auch logistischer Ebene<br />
stattfindet, zeigt das sogenannte Tool-Sharing.<br />
So wurde beispielsweise die minimalinvasive Hüfttotalprothese<br />
von Hans M. mit dem sogenannten<br />
Extensionstisch durchgeführt, der auch in Flawil<br />
eingesetzt wird. Hierfür geht eine gute Koordination<br />
und Planung voran, die Auslastung kann dadurch<br />
optimiert, und es können Kosten gespart werden.<br />
Auch bei Schulterarthroskopien wird ein hydrauli-
Prozesse und Organisation<br />
23<br />
Schnell<br />
Das Spital am See – der Standort Rorschach des Kantonsspitals<br />
St.Gallen – bietet regionale Grundversorgung<br />
gepaart mit Zentrumsmedizin. Dazu trägt unter<br />
anderem die Orthopädische Chirurgie und Traumatologie<br />
des Bewegungsapparates bei. Das Team rund<br />
um Dr. Michael Badulescu beschäftigt sich schwerpunktmässig<br />
mit der rekonstruktiven Gelenkchirurgie<br />
einschliesslich arthroskopischer Verfahren. Ein weiterer<br />
Schwerpunkt bildet die Frakturversorgung. Dank<br />
der engen Zusammenarbeit mit der Klinik in St.Gallen<br />
kann den Patienten ein breites Fachwissen angeboten<br />
werden – professionell, wohnortnah und familiär.<br />
scher Hebearm (Spider) genutzt, der je nach Bedarf<br />
entweder in Rorschach oder Flawil eingesetzt wird.<br />
Kantonsspital St.Gallen im Vergleich zu anderen sehr<br />
positiv bewertet wurde.<br />
Ausbildungsstätte<br />
Ein Wechsel findet auch regelmässig auf personeller<br />
Ebene statt: durch die Rotation der Assistenzärzte.<br />
So trägt die Orthopädie und Traumatologie – mit der<br />
Ausbildung von Assistenzärzten – entscheidend zur<br />
Kompetenz zukünftiger orthopädisch-traumatologischer<br />
Chirurgen bei. Das kleine Team am Standort<br />
in Rorschach fordert und fördert die Assistenten und<br />
jungen Oberärzte optimal. Dies bestätigt eine aktuelle<br />
FMH-Bewertung, in der die Ausbildungsstätte<br />
Eine solche Bewertung hat auch im Jahr 2016 durch<br />
die Zuweiser stattgefunden. Vertreter der Orthopädie<br />
und Traumatologie haben damals die Zuweiser<br />
besucht, um die Zusammenarbeit sowie gegenseitige<br />
Anliegen zu besprechen. Dies wurde beidseitig<br />
geschätzt – im Sinne einer guten und konstruktiven<br />
Zusammenarbeit.<br />
* Der Klinikname wird für die bessere Lesbarkeit im weiteren<br />
Text «Orthopdädie und Traumatologie» genannt.<br />
** Name wurde geändert.
24 Agenda<br />
Veranstaltungen<br />
August 2017 bis November 2017<br />
AUGUST<br />
Mi 16.08.2017<br />
Do 17.08.2017<br />
Fr 18.08.2017<br />
Mo 21.08.2017<br />
Di 22.08.2017<br />
Fr 25.08.2017<br />
Mo 28.08.2017<br />
Mi 30.08.2017<br />
Mi 30.08.2017<br />
Do 31.08.2017<br />
Beurteilung der Fahreignung bei Diabetes<br />
unter spezieller Berücksichtigung neuer<br />
Technologien (CGMS)<br />
Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Osteologie<br />
und Stoffwechselerkrankungen<br />
18.30 – 20.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Genetische und bildgebende Diagnostik<br />
bei Innenohrerkrankungen<br />
Hals-Nasen-Ohrenklinik<br />
17.30 – 19.00 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Pathologie der neuroendokrinen Tumore:<br />
Relevanz im klinischen Alltag<br />
Klinik für Onkologie und Hämatologie<br />
<strong>12</strong>.30 – 14.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Hepatologiekolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.30 – 18.45 Uhr<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
ZIM Lunch: Herzinsuffizienz-Krankheitsverständnis<br />
und anthroposophisches Therapiekonzept<br />
Zentrum für Integrative Medizin<br />
<strong>12</strong>.30 – 14.00 Uhr<br />
Haus 33, Kursraum 014, Kantonsspital St.Gallen<br />
Grand Round Rehabilitation<br />
Klinik für Neurologie<br />
<strong>12</strong>.00 – 13.00 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Determinants of therapeutic response and<br />
the role of therapeutic adherence in RA<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Genetik-Workshop Brustzentrum St.Gallen<br />
Brustzentrum St.Gallen<br />
14.00 – 17.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Gastrokolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.30 – 22.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
St.Galler Senologie-Symposium<br />
Brustzentrum St.Gallen<br />
09.30 – 17.00 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, St.Gallen<br />
SEPTEMBER<br />
Fr 01.09.2017 Stroke Lunch: Wann mit der<br />
OAK beginnen nach Stroke?<br />
Klinik für Neurologie<br />
11.30 – <strong>12</strong>.45 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 1411,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 04.09.2017 49. St.Galler Anästhesie- und Intensivsymposium<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungsund<br />
Schmerzmedizin<br />
17.00 – 19.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Do 07.09.2017 IBD Net Talk<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.00 – 18.30 Uhr<br />
Haus 21, Raum 101, Kantonsspital St.Gallen<br />
Sa 09.09.2017 OMTRA Symposium 2017<br />
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin<br />
09.00 – 15.30 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 11.09.2017 SASL School<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.30 – 19.00 Uhr<br />
Haus 21, Raum 101, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mi 13.09.2017 Update Antikoagulation<br />
Klinik für Kardiologie, Klinik für Anästhesiologie<br />
und Klinik für Hämatologie<br />
18.00 – 20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 18.09.2017 Hepatologiekolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.30 – 18.45 Uhr<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 18.09.2017 Development of disease in RA, from fundamental<br />
understanding to strategies to prevent RA<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Do 21.09.2017 1. St.Galler Pädaudiologie-Symposium<br />
Hals-Nasen-Ohrenklinik<br />
13.30 – 17.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Do 21.09.2017 IBD Roundtable<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.15 – 20.00 Uhr<br />
Haus 03, Raum <strong>12</strong>01, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mi 27.09.2017 Interdisziplinäre Viszeralmedizin<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.30 – 20.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen
Agenda<br />
25<br />
Do 28.09.2017<br />
OKTOBER<br />
Mi 18.10.2017<br />
Mo 23.10.2017<br />
Mi 25.10.2017<br />
Do 26.10.2017<br />
Fr 27.10.2017<br />
Fr 27.10.2017 /<br />
Sa 28.10.2017<br />
Mo 30.10.2017<br />
NOVEMBER<br />
Fr 03.11.2017<br />
Fr 03.11.2017 /<br />
Sa 04.11.2017<br />
Sa 04.11.2017<br />
Insomnie und körperliche / psychische<br />
Erkrankungen – Grundlagen und Behandlung<br />
Klinik für Psychosomatik<br />
17.15 – 18.15 Uhr<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
Hypogonadismus und Infertilität beim Mann<br />
Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Osteologie<br />
und Stoffwechselerkrankungen<br />
18.30 – 20.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Update in ANCA associated vasculitis<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Update Herzklappenerkrankungen<br />
Klinik für Kardiologie<br />
18.00 – 20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Zuweiser-Event Neurochirurgie<br />
Klinik für Neurochirurgie<br />
13.30 – 18.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
7. Fit for Stroke – Weiterbildungstag<br />
Klinik für Neurologie<br />
08.30 – 16.30 Uhr<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
6. Symposium Integrative Onkologie und<br />
Forschung – Fasten und Ernährung bei Krebs<br />
Zentrum für Integrative Medizin<br />
Tag 1: 09.30 – 18.30 Uhr<br />
Tag 2: 09.00 – 13.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Hep Cup<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.30 – 19.30 Uhr<br />
Haus <strong>12</strong>, Raum 302, Kantonsspital St.Gallen<br />
Lung disease – what can be learned<br />
from physiology?<br />
Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin<br />
08.30 – 17.15 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
23. Strabologische und Neuroophthalmologische<br />
Falldemonstrationen<br />
Augenklinik<br />
08.00 – 17.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
6th Educational SSSR-Meeting<br />
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin<br />
08.15 – 15.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 06.11.2017<br />
Mi 08.11.2017<br />
Do 09.11.2017<br />
Fr 10.11.2017<br />
Do 16.11.2017<br />
Fr 17.11.2017<br />
Fr 17.11.2017<br />
Fr 17.11.2017<br />
Sa 18.11.2017<br />
Di 21.11.2017<br />
Fr 24.11.2017<br />
Sa 25.11.2017<br />
Mo 27.11.2017<br />
Mi 29.11.2017<br />
Mi 29.11.2017<br />
CIRS<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.00 – 18.00 Uhr<br />
Haus 11, Raum 049, Kantonsspital St.Gallen<br />
Gastrokolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.30 – 20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
KlinFor 2017<br />
Klinik für Allgemeine<br />
Innere Medizin / Hausarztmedizin<br />
08.00 – 18.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Systemische Therapie psychischer Störungen<br />
Klinik für Psychosomatik<br />
17.15 – 18.15 Uhr<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
7. Fit for Stroke – Weiterbildungstag<br />
Klinik für Neurologie<br />
08.30 – 16.30 Uhr<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
Nanopartikel und ihre Wirkung gegen Krebs<br />
Klinik für Onkologie und Hämatologie<br />
<strong>12</strong>.30 – 14.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
16. St.Galler Airway Management Symposium<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und<br />
Schmerzmedizin<br />
13.00 – 18.15 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, St.Gallen<br />
ZIM Lunch: Osteopathie bei<br />
gastrointestinalen Beschwerden<br />
Zentrum für Integrative Medizin<br />
<strong>12</strong>.30 – 14.00 Uhr<br />
Haus 33, Kursraum 015, Kantonsspital St.Gallen<br />
White Matter Dissection<br />
Schulungs- und Trainingszentrum Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
Fr: 10.30 – 17.00 Uhr / Sa: 08.00 – 13.00 Uhr<br />
Anatomisches Institut der Universität Fribourg,<br />
1 Route Albert-Gockel, 1700 Fribourg<br />
Evaluating vasculitis for diagnosis and treatment<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Fälle aus der kardiologischen Praxis<br />
Klinik für Kardiologie<br />
18.00 – 20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Interdisziplinäre Viszeralmedizin<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.30 – 20.00 Uhr<br />
AUGUST BIS NOVEMBER<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mehr Veranstaltungen und<br />
Informationen unter: www.kssg.ch<br />
August –<br />
November 2017<br />
Diverse Kurse<br />
REA2000 – Zentrum für Reanimationsund<br />
Simulationstraining<br />
Fürstenlandstrasse 100, 9014 St.Gallen
Kantonsspital St.Gallen<br />
Rorschacher Strasse 95<br />
CH-9007 St.Gallen<br />
Tel. +41 71 494 11 11<br />
Spital Rorschach<br />
Heidenerstrasse 11<br />
CH-9400 Rorschach<br />
Tel. +41 71 858 31 11<br />
Spital Flawil<br />
Krankenhausstrasse 23<br />
CH-9230 Flawil<br />
Tel. +41 71 394 71 11<br />
www.kssg.ch