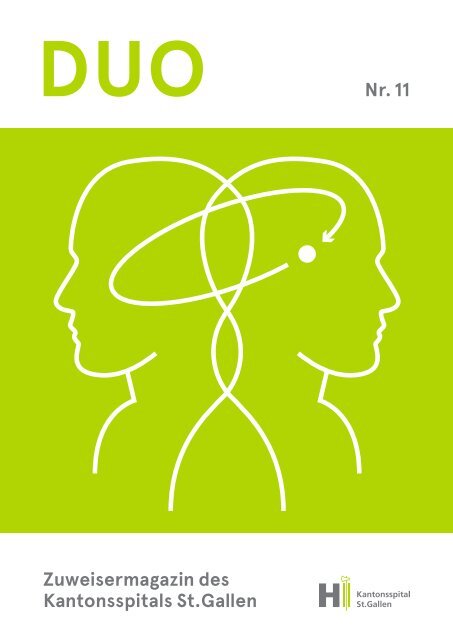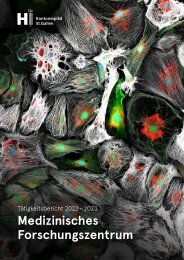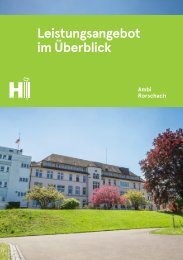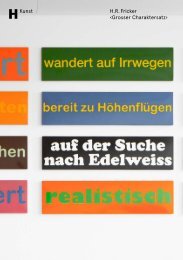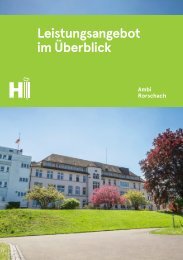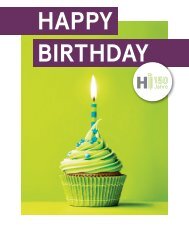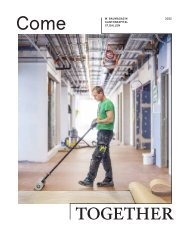DUO_11
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>DUO</strong><br />
Nr. <strong>11</strong><br />
Zuweisermagazin des<br />
Kantonsspitals St.Gallen
Editorial 3<br />
Veränderung<br />
3<br />
4<br />
8<br />
12<br />
18<br />
24<br />
26<br />
Editorial<br />
Veränderung<br />
Fokus<br />
Generationenwechsel in der Klinik für<br />
Medizinische Onkologie /Hämatologie<br />
Kader im Profil<br />
Kurznews zum Thema<br />
Die Leidenschaft für Psychosomatik<br />
Innovation und Entwicklung<br />
Kurznews zum Thema<br />
Die Nephrologie im Fokus<br />
Prozesse und Organisation<br />
Kurznews zum Thema<br />
Innere Medizin Rorschach: dezentral<br />
und breit aufgestellt<br />
Agenda<br />
Veranstaltungen April 2017 bis Juli 2017<br />
Perspektivenwechsel<br />
4<br />
14<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
Das Wort «Veränderung» ist allgegenwärtig. Die<br />
Fähigkeit, sich zu verändern und anzupassen, wird<br />
zu einem Erfolgsfaktor – sowohl für Unternehmen<br />
wie auch für Mitarbeitende. Um diese Veränderungen<br />
positiv zu nutzen, zählen wir auf Sie als starke Partner.<br />
Damit können wir unseren gemeinsamen Patienten<br />
weiterhin eine zeitgemässe und gute Behandlung<br />
anbieten.<br />
Eine Veränderung findet aktuell durch den Chefarztwechsel<br />
in der Klinik für Medizinische Onkologie/<br />
Hämatologie statt. Fast 20 Jahre prägte Prof. Dr.<br />
Thomas Cerny als Chefarzt diese Klinik durch Erfahrung<br />
und grosses Engagement. Nun folgt mit Prof.<br />
Dr. Christoph Driessen der passende Nachfolger, um<br />
die zukünftige Entwicklung erfolgreich anzugehen<br />
(ab Seite 4).<br />
Ein Wandel hat vor vier Jahren auch in der Inneren<br />
Medizin in Rorschach stattgefunden. Diese ist nun<br />
sowohl organisatorisch als auch fachlich in die Klinik<br />
für Allgemeine Innere Medizin des Kantonsspitals<br />
St.Gallen integriert. Was sie anbietet, erfahren Sie<br />
ab Seite 20.<br />
Lassen Sie uns gemeinsam die kommenden Veränderungen<br />
angehen. Dazu braucht es vor allem einfache,<br />
rasche Kommunikationswege und einen regen<br />
Austausch. Ich freue mich darauf.<br />
20<br />
Herzliche Grüsse<br />
PERFORMANCE<br />
neutral<br />
Drucksache<br />
01-17-144033<br />
myclimate.org<br />
Impressum<br />
Ausgabe Nr. <strong>11</strong>, 2017<br />
Herausgeber Unternehmenskommunikation Kantonsspital St.Gallen<br />
Gestaltung VITAMIN 2 AG, St.Gallen<br />
Druck Cavelti AG, Gossau<br />
Dr. Daniel Germann<br />
Direktor und Vorsitzender<br />
der Geschäftsleitung<br />
Anregungen zum <strong>DUO</strong> nehmen wir gerne per E-Mail entgegen:<br />
redaktion@kssg.ch
4 Fokus<br />
Fokus<br />
5<br />
Wechsel in der Klinik für<br />
Medizinische Onkologie /<br />
Hämatologie<br />
Schnell<br />
Die Klinikleitung der Medizinischen Onkologie /<br />
Hämatologie ist ab 1. Mai 2017 in neuen Händen. Der<br />
49-jährige Prof. Dr. Christoph Driessen tritt in die<br />
Fussstapfen von Prof. Dr. Thomas Cerny, der nach<br />
langjähriger Tätigkeit in Pension geht. Der erfolgreiche<br />
Kurs der Klinik soll auch zukünftig weitergeführt<br />
werden. Mit Fokus auf den individuellen Patienten<br />
und mittels Interdisziplinarität, Interprofessionalität<br />
sowie wissenschaftlicher Orientierung soll die<br />
Medizin von morgen schon heute verstanden und in<br />
klinischen Studien angeboten werden – gemeinsam<br />
mit den Zuweisern und zum Wohle unserer Patienten.<br />
Am 1. Mai 2017 übergibt Prof. Dr. Thomas<br />
Cerny – nach langjähriger und erfolgreicher<br />
Tätigkeit – die Leitung der Klinik<br />
für Medizinische Onkologie / Hämatologie<br />
an Prof. Dr. Christoph Driessen. Das<br />
folgende Gespräch beleuchtet die Entwicklung<br />
des Fachbereichs Onkologie /<br />
Hämatologie in den letzten 30 Jahren<br />
und gibt einen Ausblick auf bevorstehende<br />
Herausforderungen. Dabei wirdschnell<br />
klar, dass die Faszination sowie die Leidenschaft<br />
für die Medizin, die Onkologie<br />
und das Kantonsspital St.Gallen bei<br />
beiden Ärzten sehr gross ist.<br />
Prof. Dr. Cerny, was sind aus Ihrer Sicht die<br />
grössten Entwicklungen der letzten 30 Jahre<br />
in der Onkologie / Hämatologie?<br />
Ein besonderes Highlight in meiner Zeit am Kantonsspital<br />
St.Gallen war bestimmt die Neustrukturierung<br />
des Departements Innere Medizin vor bald 20 Jahren.<br />
Aus drei Kliniken wurde ein neues Departement<br />
geschaffen, worin sich verschiedene gleichgestellte<br />
Fachbereiche als neue Einheit zusammenschlossen.<br />
Es wurden Ressourcen gemeinsam genutzt, die<br />
Ausbildung wurde durch das Rotationsprinzip innerhalb<br />
des Departements attraktiver, neue Fachbereiche<br />
wurden geschaffen, die Patientenbetreuung<br />
wurde durch gelebte Interdisziplinarität auch<br />
effizienter und besser. Diese Neustrukturierung galt<br />
auch im Schweizer Vergleich als sehr innovativ.<br />
Eine weitere wichtige Entwicklung war die Verlagerung<br />
von der stationären hin zur ambulanten Behandlung.<br />
Für diese Entwicklung haben wir in den<br />
letzten 20 Jahren drei Vergrösserungsphasen in<br />
unserer Klinik realisiert mit neuen interprofessionellen<br />
Spezialsprechstunden.<br />
Interdisziplinarität, Interprofessionalität und Innovation<br />
sind Worte, denen in unserer Klinik grosse<br />
Bedeutung zugeschrieben wird. Um diese zu stärken<br />
und auszubauen, waren die Schaffung der Tumorboards,<br />
des Brustzentrums, des Palliativzentrums,<br />
des Zentrums für Integrative Medizin sowie der klinischen<br />
Forschungsabteilung wichtige Meilensteine.<br />
Denn nur durch diese Zusammenarbeit kann dem<br />
Patienten eine bestmögliche Therapie geboten werden.<br />
Erwähnt werden müssen hier auch die hervor-<br />
Erfolg für Forschungsteam<br />
des Kantonsspitals St.Gallen<br />
Die Arbeitsgruppe für Experimentelle Onkologie<br />
und Hämatologie am Kantonsspital St.Gallen, unter<br />
Leitung von Prof. Dr. Christoph Driessen, sucht<br />
seit einigen Jahren nach alternativen Möglichkeiten,<br />
um bei Patienten mit der Knochenmark-<br />
Krebsart Multiples Myelom therapieresistente<br />
Zellen wieder empfindlich für eine Therapie<br />
zu machen. Dabei setzt sie nicht auf die Entwicklung<br />
neuer Substanzen, sondern darauf, Medikamente,<br />
die seit Langem erfolgreich für die<br />
Behandlungen anderer Krankheiten eingesetzt<br />
werden und die daher «sicher» sind, für die<br />
Krebstherapie zu nutzen.<br />
Das St.Galler Forschungsteam hat bereits vor<br />
einigen Jahren in Laborversuchen Nelfinavir,<br />
ragende Zusammenarbeit und Weiterbildung des<br />
Ärzteteams gemeinsam mit der Pflege und der<br />
Forschung mit vielen gemeinsamen Workshops<br />
und etablierten internationalen Kongressen.<br />
Die Klinik für Medizinische Onkologie / Hämatologie<br />
ist bekannt für ihre Forschungsabteilung. Warum?<br />
In den 70er-Jahren wurden von vielen Regierungen<br />
sogenannte «National Cancer Institutes» initiiert.<br />
Der damalige Bundesrat entschied sich für eine<br />
föderale Netzwerklösung: So wurde neben den Universitätsspitälern<br />
für die Ostschweiz das Kantonsspital<br />
St.Gallen und im Tessin das Spital Bellinzona<br />
als Teil eines solchen «Zentrums» bestimmt mit dem<br />
Auftrag, gemeinsam klinische Forschung zu etablieren.<br />
Der Weg zu einer erfolgreichen Forschungsabteilung<br />
wurde also damals geebnet. Dieser Weg<br />
über viele Jahre hinweg ein Standardmedikament<br />
zur Behandlung der HIV-Infektion, als ein Medikament<br />
identifiziert, mit dem man die Resistenz<br />
bei Myelomzellen überwinden kann. Gemeinsam<br />
mit der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klinische<br />
Krebsforschung (SAKK) konnte kürzlich in<br />
einer nationalen Studie bei 65 Prozent der teilnehmenden<br />
Patienten ein Therapieansprechen<br />
nachgewiesen werden. Damit konnte auch eine<br />
deutlich höhere Rate an Wirksamkeit im indirekten<br />
Vergleich zu den neuen Medikamenten der<br />
nächsten Generation nachgewiesen werden.<br />
Finanziert wurde die Studie durch die SAKK und<br />
einen Forschungspreis der gateway / rising tide<br />
foundation (zwei Schweizer Stiftungen mit amerikanischen<br />
Wurzeln).
6 Fokus<br />
Fokus<br />
7<br />
Prof. Dr. Christoph Driessen<br />
Schwerpunkte: Multiples Myelom, Lymphome,<br />
Leukämien, Immunologie, Forschung<br />
Lebenslauf:<br />
– 1995: Abschluss Medizinstudium in Lübeck<br />
(DE), gleichzeitig Promotion mit summa cum<br />
laude im Bereich der Immunologie<br />
– Klinische Ausbildung an den Universitäten<br />
Freiburg (DE) und Tübingen (DE) in Innerer<br />
Medizin, Hämatologie, Internistischer<br />
Onkologie und Klinischer Immunologie<br />
– 1998 – 2000: Auslandsaufenthalt mit Grundlagenforschung<br />
im Bereich der Immunologie<br />
an der Harvard Medical School, Boston / USA<br />
– 2006: Habilitation an der Universität<br />
Tübingen und Ernennung zum Oberarzt<br />
– 2006: Wechsel ans Kantonsspital St.Gallen<br />
als Oberarzt Onkologie / Hämatologie mit<br />
dem klinischen Schwerpunkt Krebserkrankungen<br />
des Blut- und Lymphsystems,<br />
Etablierung einer Laborforschergruppe<br />
für experimentelle Onkologie / Hämatologie<br />
– 2006 – 2008: Leitung der Klinischen Forschungsabteilung<br />
der Klinik für Onkologie /<br />
Hämatologie<br />
– Seit 2008: Aufbau und Leitung der Clinical<br />
Trials Unit (CTU), Leitender Arzt der Klinik für<br />
Onkologie / Hämatologie am Kantonsspital<br />
St.Gallen und ausserplanmässiger Professor<br />
der Universität Tübingen<br />
Der 49-jährige Christoph Driessen wohnt mit<br />
seiner Frau und den vier Kindern in St.Gallen.<br />
wurde in in St.Gallen mit dem Aufbau der Klinischen<br />
Forschungsabteilung und der Laborforschungsabteilung,<br />
den Vorläufern des heutigen Medizinischen<br />
Forschungszentrums, konsequent und letztlich<br />
sehr erfolgreich fortgesetzt.<br />
2009 folgte dann aus diesen Strukturen heraus die<br />
Gründung der Clinical Trials Unit (CTU) – ein multidisziplinäres<br />
Kompetenzzentrum für klinische Studien.<br />
Dieses Kompetenzzentrum – geleitet von Prof.<br />
Dr. Driessen – fördert die patientenorientierte Klinische<br />
Forschung am Kantonsspital St.Gallen und<br />
stellt dafür Kompetenz, Infrastruktur und Personalressourcen<br />
zur Verfügung.<br />
Nun steht die Pension vor der Tür.<br />
Worauf freuen Sie sich am meisten?<br />
Die klinische Verantwortung abzugeben, wird sicherlich<br />
eine Entlastung im Sinne von «abschalten» sein.<br />
Privat freue ich mich darauf, Zeit mit Familie, Freunden<br />
und vor allem mit meinen Enkeln zu verbringen<br />
und wieder vermehrt zu musizieren.<br />
Prof. Dr. Driessen, in den letzten 30 Jahren hat<br />
sich einiges in der Onkologie / Hämatologie getan.<br />
Was bringt die Zukunft?<br />
Die von Prof. Dr. Cerny genannten grossen Entwicklungsschritte<br />
widerspiegeln sehr gut die Entwicklungen<br />
der Onkologie. Anfangs, also in den 70er Jahren,<br />
galt eine Krebsdiagnose als Todesurteil. Heute behandeln<br />
wir 200 verschiedene molekular definierte<br />
Erkrankungen. Für eine bestmögliche Behandlung<br />
des Patienten braucht es heutzutage Spezialisten<br />
aus fast allen Fachbereichen, Verständnis dafür und<br />
ein genügend grosses Team.<br />
All das wurde in St.Gallen in den letzten 20 Jahren<br />
modellhaft vorgelegt. Und dies wollen wir in Zukunft<br />
auch weiterführen und weiterentwickeln mit Fokus<br />
auf den individuellen Patienten, dem wir durch Interdisziplinarität<br />
(Stichwort CCC, mehr auf Seite 7),<br />
Interprofessionalität sowie wissenschaftliche Orientierung<br />
die bestmögliche Diagnostik und Therapie<br />
zukommen lassen möchten. Dabei geht es vor allem<br />
darum, die Medizin von morgen schon heute zu<br />
verstehen und anzuwenden.<br />
Sie treten die Nachfolge von Prof. Dr. Cerny an.<br />
Das sind grosse Schuhe.<br />
Das sind sehr grosse Schuhe, in denen ich (dann)<br />
hier stehe(n werde), aber auch Prof. Dr. Cerny hatte<br />
vor 20 Jahren noch kleinere Füsse. Die Generation<br />
von Prof. Dr. Cerny hat sehr viel bewegt im Fachbereich<br />
der Onkologie / Hämatologie. Jetzt geht diese<br />
Generation in den Ruhestand, und nun ist die nächste<br />
an der Reihe – mit neuen Ideen und Ansätzen.<br />
Was beinhalten diese neuen Ideen und Ansätze?<br />
Unsere Hauptaufgabe wird es auch in Zukunft sein,<br />
jeden einzelnen Patienten auf qualitativ hohem<br />
Niveau zu behandeln, zu betreuen und zu pflegen.<br />
Dafür braucht man vor allem gute Ärzte und Pflegende,<br />
denen man Entwicklungsmöglichkeiten<br />
anbietet. Ein moderner Führungsstil spielt dabei<br />
eine zentrale Rolle. Ich sehe mich als Primus inter<br />
Pares und Entscheidungen werden im Kollektiv<br />
derer gefällt, die in ihrem Gebiet spezialisiert sind.<br />
Was bieten Sie, damit ebendiese guten Ärzte<br />
nach St.Gallen kommen?<br />
Ich biete den Mitarbeitenden Entwicklungsmöglichkeiten<br />
auf fachlich sehr hohem Niveau, gebe ihnen<br />
Vertrauen und schaffe Freiräume für eigene Verantwortung<br />
und Kreativität. Das gilt übrigens auch für<br />
die Zusammenarbeit mit den Zuweisern. Zudem ist<br />
es mir wichtig, zuverlässig zu sein. Letztlich geht<br />
es auch hier um den Kernsatz: Wir kümmern uns um<br />
Menschen.<br />
Worauf freuen Sie sich am meisten?<br />
Selbst die Strukturen beeinflussen zu können, wird<br />
sicherlich eine spannende Aufgabe sein. Dabei<br />
möchte ich mein Wissen aus der Klinischen Medizin,<br />
Prof. Dr. Christoph Driessen und Prof. Dr. Thomas Cerny im Gespräch.<br />
der Laborforschung, der Klinischen Forschung sowie<br />
aus dem Bereich der Betriebswirtschaft mit dem<br />
der jeweiligen Spezialisten zusammenfassen, daraus<br />
eine gemeinsame Perspektive entwickeln und diese<br />
für unsere Region umsetzen.<br />
Das Kantonsspital St.Gallen gehört zu den<br />
nationalen Exzellenzzentren, die sich an der<br />
Versorgung von Krebspatienten beteiligen.<br />
Gebündelt werden die unterschiedlichen<br />
Kompetenzen der verschiedenen Kliniken,<br />
Institute und Zentren des Kantonsspitals<br />
St.Gallen im sogenannten Comprehensive<br />
Cancer Center (CCC). Diese Zusammenarbeit<br />
bietet sowohl den Patienten als auch<br />
den Zuweisern beachtliche Vorteile:<br />
– An Krebs erkrankte Patienten profitieren<br />
von einer Stärkung der fach- und berufsübergreifenden<br />
Versorgung.<br />
– Durch die Zentrumsbildung entsteht<br />
eine hohe und ausgeprägte Patientenorientierung.<br />
– Die Vorsorge, Früherkennung, Diagnostik,<br />
Therapie, Rehabilitation, Palliation und<br />
Nachsorge der onkologischen Patientenversorgung<br />
werden standardisiert, kontinuierlich<br />
verbessert und ständig an den höchsten<br />
internationalen Standard angeglichen.
8 Kader im Profil<br />
Kader im Profil<br />
9<br />
VR-Präsidium des<br />
Verwaltungsrates<br />
der Spitalverbunde<br />
Die St.Galler Regierung hat für die Dauer vom 1. März<br />
2017 bis 31. Mai 2018 Guido Sutter zum Präsidenten<br />
des Verwaltungsrates der Spitalverbunde des Kantons<br />
St.Gallen gewählt. Ab Mitte 2018 kann Prof. Dr.<br />
Felix Sennhauser, Direktor der Medizinischen Klinik<br />
sowie Ärztlicher Direktor am Universitäts-Kinderspital<br />
Zürich, das Präsidium nahtlos übernehmen.<br />
Dieses Vorgehen wird von der Regierungsdelegation<br />
und den Fraktionspräsidenten als optimal<br />
angesehen und gewährleistet Kontinuität im<br />
Verwaltungsrat, was in dieser Zeit der Umbruchphase<br />
(Immobilienübertragung und Bau) von<br />
grosser Bedeutung ist.<br />
Guido Sutter hat an der Universität St.Gallen Wirtschaft<br />
und an der Universität Bern Jus studiert.<br />
Er bringt ein reiches Erfahrungsfeld in Bezug auf<br />
die finanzielle Führung von Unternehmen mit. Prof.<br />
Dr. Felix Sennhauser studierte an der Universität<br />
Bern Humanmedizin. 1996 erfolgte die Berufung<br />
als ordentlicher Professor für Pädiatrie an die Universität<br />
Zürich.<br />
Neuer Fachbereichsleiter<br />
in der Verkehrsmedizin<br />
Dr. Bruno Liniger ist seit September letzten Jahres<br />
neuer Fachbereichsleiter der Verkehrsmedizin,<br />
die als einer von vier Fachbereichen zum Institut<br />
für Rechtsmedizin des Kantonsspitals St.Gallen<br />
gehört. Mit Dr. Liniger konnte einer der renommiertesten<br />
Verkehrsmediziner der Schweiz gewonnen<br />
werden. Er war lange Zeit als Stv. Abteilungsleiter<br />
«Verkehrsmedizin & Forensische Psychiatrie» am<br />
Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich tätig<br />
und ist zurzeit Präsident der Sektion Verkehrs-<br />
Research Award<br />
Der diesjährige Research Award der Schweizer Hirntumor-Stiftung<br />
geht an PD Dr. Thomas Hundsberger,<br />
Leitender Arzt der Klinik für Neurologie und Klinik<br />
für Hämatologie / Onkologie und seine Kollegen für<br />
ihre Studie zur Behandlung von Patienten mit hirneigenen<br />
Tumoren. In einer schweizweiten Analyse<br />
hat das Team mithilfe einer computerunterstützten<br />
Software (DODES) die spitalinternen Standards zur<br />
Rezidivbehandlung des Glioblastoms, dem aggressivsten<br />
hirneigenen Tumor bei Erwachsenen, verglichen<br />
und ausgewertet. Für dieses Stadium der Erkrankung<br />
existiert weltweit keine Standardtherapie.<br />
Es konnte festgestellt werden, dass die Behandlung<br />
in den Schweizer Neuro-Onkologiezentren sehr<br />
heterogen und von lokalen Behandlungsmöglichkeiten<br />
geprägt ist und es sich für Patienten lohnt, eine<br />
Zweitmeinung einzuholen. An der Studie beteiligt<br />
waren auch der Chefarzt der Klinik für Radio-Onkologie<br />
Prof. Dr. Ludwig Plasswilm sowie die beiden<br />
Leitenden Ärzte Dr. Detlef Brügge und Dr. Paul<br />
Martin Putora. Der Research Award wird jährlich<br />
vergeben.<br />
medizin der Schweizerischen Gesellschaft für<br />
Rechtsmedizin (SGRM).<br />
Die Verkehrsmedizin befasst sich schwerpunktmässig<br />
mit der Fahreignungsbegutachtung im Zusammenhang<br />
mit einer Suchtmittelproblematik, einer<br />
psychiatrischen Erkrankung oder einer somatischen<br />
gesundheitlichen Störung. Ausserdem werden Abstinenzkontrollen<br />
in enger Zusammenarbeit mit dem<br />
Fachbereich Forensische Toxikologie durchgeführt.<br />
Neue GL-Mitglieder<br />
Ende 2016 ist die Amtszeit der Vertreter der medizinischen<br />
Departemente II und III in der Geschäftsleitung<br />
des Kantonsspitals St.Gallen turnusgemäss<br />
abgelaufen. Als Nachfolger von Prof. Dr.<br />
Barbara Tettenborn (Neurologie) und Prof. Dr. René<br />
Hornung (Frauenklinik) hat der Verwaltungsrat der<br />
Spitalverbunde des Kantons St.Gallen Prof. Dr. Bruno<br />
Schmied (Chirurgie) und Prof. Dr. Sandro Stöckli<br />
(HNO) als neue GL-Vertreter bestätigt.<br />
Weitere Ernennungen,<br />
Wahlen und<br />
Pensionierungen<br />
INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN<br />
Wahl<br />
per 01.01.2017<br />
Urologische Sprechstunde<br />
am Spitalstandort Rorschach<br />
Jeweils mittwochs und freitags wird am Spital Rorschach<br />
eine urologische Sprechstunde angeboten,<br />
zudem werden jeweils am Mittwochnachmittag<br />
urologische Eingriffe durchgeführt. Neu ist hierfür<br />
Dr. Munira Haag-Dawoud<br />
Leitende Ärztin<br />
Dr. Olivia Köhle, Oberärztin Klinik für Urologie, zuständig.<br />
Sie folgt damit Dr. Christopher Schultz, der<br />
eine Praxistätigkeit im Berner Oberland aufgenommen<br />
hat. Frau Dr. Köhle studierte Humanmedizin an<br />
der Medizinischen Universität Innsbruck / Österreich.<br />
Nach der Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin<br />
absolvierte sie die urologische Facharztausbildung<br />
am Kantonsspital St.Gallen, welche sie im Jahr 2016<br />
abschloss.<br />
Zuweisungen für die urologische Sprechstunde<br />
können wie bisher via Zuweisungsschreiben direkt<br />
an die Disposition Medizinische Diagnostik Rorschach<br />
vorgenommen werden.<br />
Telefon +41 71 858 31 60<br />
E-Mail: meddiagnostik.rorschach@kssg.ch<br />
Neue Leiterin Psychosomatische Klinik<br />
Dr. med. Dagmar Schmid hat per Januar 2017 die<br />
Leitung der Klinik für Psychosomatik übernommen.<br />
Zuvor war die Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie<br />
mit Fähigkeitsausweisen in Schlafmedizin<br />
und Psychosomatischer Medizin an der Universitätsklinik<br />
Basel tätig, wo sie unter anderem traumaspezifische<br />
Angebote für somatische Belastungsstörungen<br />
etabliert hat und im Leitungsgremium<br />
des KHA-Tumorzentrums war. Am Kantonsspital<br />
St.Gallen wird die gebürtige Bayerin den Fokus vermehrt<br />
vom Konsiliar- zum Liaisondienst legen und<br />
die interdisziplinäre Zusammenarbeit ausbauen. Ein<br />
besonderes Augenmerk legt die 47-Jährige auf<br />
die Schlafmedizin und die Sensibilisierung für somatische<br />
Belastungsstörungen.<br />
Mehr zu «Die Leidenschaft für Psychosomatik»<br />
erfahren Sie auf Seite 10.
10 Kader im Profil<br />
Kader im Profil<br />
<strong>11</strong><br />
Die Leidenschaft für<br />
Psychosomatik<br />
Dr. Dagmar Schmid hat zum Jahresbeginn<br />
die Leitung der Klinik für Psychosomatik<br />
übernommen. Die Expertin für Schlafmedizin,<br />
Psychoonkologie und Traumatherapie<br />
ist fasziniert von der interdisziplinären<br />
Zusammenarbeit, bringt ihren Hintergrund<br />
als Psychiaterin ein und nimmt ihre<br />
zukünftigen Aufgaben mit viel Engagement<br />
in Angriff.<br />
Schnell<br />
Dr. med. Dagmar Schmid ist seit Jahresbeginn die<br />
neue Klinikleiterin der Psychosomatik. Mit ihrem<br />
Team richtet die Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie<br />
mit Fähigkeitsausweisen in Schlafmedizin<br />
und Psychosomatik den Fokus vermehrt vom<br />
Konsiliar- zum Liaisondienst und intensiviert die<br />
nierten Diagnose im ICD <strong>11</strong>. Diese können nach infausten<br />
Diagnosen, traumatisierenden Operationen<br />
oder Reanimationen auftreten, aber werden oft<br />
nicht erfasst. In der Traumatherapie habe ich erlebt,<br />
wie solche Störungen mit wenigen Therapiestunden<br />
wirksam behandelt wurden.<br />
Ihr Engagement wird mit jedem Wort spürbar.<br />
Wie haben Sie «Ihr» Fachgebiet gefunden?<br />
Buchstäblich über den Schlaf. Als Medizinstudentin<br />
jobbte ich in einem Schlaflabor der Psychiatrischen<br />
Uniklinik – die interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
hat mich auf Anhieb begeistert. Auch die Psychosomatik<br />
und vor allem der K+L-Dienst hat mit vielen<br />
Fachgebieten Berührungspunkte, das macht es<br />
komplex und spannend.<br />
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen<br />
Kliniken und Zentren. Zu den Spezialgebieten der<br />
gebürtigen Bayerin gehören die Schlafmedizin,<br />
die Psychoonkologie sowie somatische Belastungsstörungen<br />
und damit verbundene traumatherapeutische<br />
Angebote.<br />
Sicht der Niedergelassenen und Hausärzte ist für<br />
mich wichtig und bereichernd, als Zuweiser bleiben<br />
sie in den Behandlungsprozess eingebunden.<br />
Sie haben sich mit Hochdruck eingearbeitet<br />
und wirken trotzdem entspannt. Wo finden Sie<br />
den Ausgleich zum Beruf?<br />
In der Natur, in den Bergen und am Wasser – das<br />
alles habe ich jetzt in der Ostschweiz vor der<br />
Haustür, darüber bin ich glücklich. Ebenso, dass<br />
ich wieder näher an meiner Heimat Bayern bin.<br />
Dagmar Schmid, Sie sind erst seit wenigen<br />
Wochen als Klinikleiterin im Einsatz – wie haben<br />
Sie sich eingelebt?<br />
Sehr gut. Ich habe hier offene Türen, ein tolles<br />
Team und eine auffallend kollegiale Atmosphäre<br />
angetroffen. Es sind reichlich Ideen, Pläne,<br />
Kompetenz und Engagement vorhanden.<br />
Womit beschäftigen Sie sich hauptsächlich?<br />
Im Moment verschaffe ich mir einen Überblick über<br />
bereits etablierte Kooperationen, erweitere die<br />
Vernetzung mit anderen Kliniken, Zentren und niedergelassenen<br />
Kollegen. Mit meinem Team möchte<br />
ich den Liaisondienst ausbauen und die Bezeichnung<br />
Psychosomatik noch mehr mit Inhalt füllen.<br />
Dazu gehört auch das Sondieren und Ausbauen<br />
der vorhandenen Kompetenzen, Interessen und<br />
Fachgebieten im Team.<br />
Welche Zusammenarbeit gleisen Sie aktuell auf?<br />
Zum Beispiel die mit dem Kinderspital. Es geht um<br />
den fachlich sinnvollen Übergang und die gemeinsa-<br />
me Betreuung von betroffenen Familien. Wir sind<br />
daran, die Konzepte anzupassen für ein gemeinsames<br />
Angebot im Bereich Endokrinologie und<br />
Adipositas, auch für den Bereich Psychoonkologie<br />
gibt es eine Anfrage. Andere Kooperationen sind<br />
schon länger erfolgreich eingeführt, zum Beispiel<br />
im Schlaf- und Schmerzzentrum.<br />
Sie haben sich für Ihre Dissertation am Max-<br />
Planck-Institut in München intensiv mit<br />
der Schlafmedizin befasst. Inwiefern tangiert<br />
diese die Psychosomatik?<br />
In fast allen Bereichen. Der Einfluss des Schlafs auf<br />
körperliche und geistige Gesundheit (Schmerz,<br />
Stress, Appetit), aber auch auf den Heilungsverlauf<br />
wird massiv unterschätzt. Mit einfachen Massnahmen<br />
könnte viel bewirkt werden. Hier möchte<br />
ich einen Schwerpunkt setzen, kann mir auch<br />
begleitende Versorgungsforschung vorstellen.<br />
Grosses Potenzial sehe ich auch im Bereich «Somatische<br />
Belastungsstörungen», einer endlich defi-<br />
Täuscht der Eindruck, oder befindet sich<br />
die Psychosomatik im Aufwind?<br />
Tatsächlich etabliert sie sich gut. Nicht immer<br />
wird darunter die eigentliche Psychosomatik verstanden,<br />
häufig ist der Begriff v. a. hilfreich zur<br />
Entstigmatisierung. Psychiatrie und Psychosomatik<br />
sind in Deutschland zwei eigenständige Facharzttitel<br />
mit Überschneidungen und Synergiepotenzial.<br />
Als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
sprechen Sie aus Erfahrung.<br />
Ja, ich habe mehrfach erfahren, wie entscheidend<br />
psychiatrisch-diagnostische, psychopathologische<br />
Kompetenz in der Psychosomatik ist und andersherum<br />
u. a. ein somatisches Verständnis in der Psychiatrie.<br />
Unsere Konsiliar- und Liaisonarbeit braucht<br />
tatsächlich beide Kompetenzen und eine gute<br />
Zusammenarbeit mit den externen Institutionen und<br />
Kollegen.<br />
Apropos Synergien: Worauf legen Sie bei<br />
der Zusammenarbeit mit den Zuweisern wert?<br />
Auf einen offenen, regen Austausch auch über Fortbildungsangebote,<br />
wie wir ihn an der Universitätsklinik<br />
Basel etablieren konnten. Die Erfahrung und<br />
Dr. Dagmar Schmid<br />
Nach dem Medizinstudium in Regensburg,<br />
Montpellier und München folgte die Dissertation<br />
am Max-Planck-Institut in München.<br />
Weiterbildungen in Neurologie, Schlafmedizin,<br />
Notfallpsychiatrie sowie Konsiliar- und<br />
Liaisonpsychiatrie führten die Bayerin nach<br />
Zürich. 2005 erwarb sie den Facharzttitel in<br />
Psychiatrie und Psychotherapie, kurz darauf<br />
Zusatzqualifikationen in Schlafmedizin, Psychosomatischer<br />
Medizin und Psychoonkologie.<br />
Ab 2010 etablierte die heute 47-Jährige<br />
an der Universitätsklinik Basel unter anderem<br />
ein wissenschaftlich begleitetes Schwindelprojekt<br />
und ein traumaspezifisches Angebot<br />
für somatische Belastungsstörungen.
12 Innovation und Entwicklung Innovation und Entwicklung<br />
13<br />
SAKK / Astellas-GU-Oncology Award<br />
für Dr. Stefanie Fischer<br />
Dr. Stefanie Fischer, Assistenzärztin der Klinik für<br />
Onkologie und Hämatologie, erhielt für ihre Publikation<br />
zur Untersuchung einer speziellen Form des<br />
Hodenkrebses (Seminom) den SAKK/Astellas-GU-<br />
Oncology Award. In seltenen Fällen kommt es bei<br />
Patienten mit Seminom im Frühstadium (Stadium I)<br />
nach Operation und adjuvanter Chemotherapie<br />
mit Carboplatin zu einem Rückfall der Krankheit.<br />
Bisher lagen aufgrund der Seltenheit der Situation<br />
keine Daten dazu vor, wie diese Patienten bei einem<br />
Rückfall behandelt werden sollen und wie ihre<br />
Prognose einzuschätzen ist. Mit einer Sammlung<br />
von 185 dieser seltenen Fälle aus 31 Zentren weltweit<br />
unter Führung des KSSG gelang es, zu zeigen, dass<br />
diese Patienten mit einer Standardchemotherapie<br />
(z. B. sogennantes BEP-Schema) trotz ihrer speziellen<br />
Situation sehr gute Heilungschancen haben,<br />
Prof. Dr. Viviane Hess, Jurypräsidentin, die Award-Gewinnerin<br />
Dr. Stefanie Fischer, Gianpasquale Ruggieri, Astellas Pharma (v.l.n.r.)<br />
bei einer insgesamt höheren Rate weiterer und<br />
späterer Rückfälle jedoch längerer Nachkontrollen<br />
bedürfen. Mit dem Preisgeld können weitere<br />
urogenital-onkologische Projekte am Kantonsspital<br />
St.Gallen unterstützt werden.<br />
Informationsfilm für Stoma-Patienten<br />
QST: umfassende Analyse sensibler<br />
Störungen und Schmerzen<br />
Mit der quantitativen sensorischen Testung (QST)<br />
steht ab sofort ein neues Untersuchungsverfahren<br />
zur Verfügung, das mit einfachen Mitteln eine genaue<br />
und umfassende Analyse sensibler Störungen<br />
(Hypästhesien, Kribbelparästhesien etc.) und<br />
Schmerzen ermöglicht (Funktion des somatosensorischen<br />
Nervensystems). Die QST ergänzt andere,<br />
bereits bestehende neurologische und elektrophysiologische<br />
Messverfahren wie z. B. die Neurographie<br />
und ist aus der Zusammenarbeit der Klinik für<br />
Neurologie mit dem Schmerzzentrum entstanden.<br />
Untersucht wird die Funktion der dünneren<br />
Nervenfasern, die insbesondere bei Erkrankungen<br />
eine wichtige Rolle spielen, die mit vermindertem<br />
Empfinden von Wärme, Kälte oder Berührung einhergehen,<br />
sowie bei unklaren Schmerzen. Die QST<br />
kann in solchen Fällen wichtige Informationen<br />
für die diagnostische Einordnung und die Therapieeinleitung<br />
liefern.<br />
Anmeldung via Ambulatorium Neurologie:<br />
Tel. +41 71 494 16 69<br />
Fax +41 71 494 28 95<br />
E-Mail: neurologie@kssg.ch<br />
Fortschritte und neue<br />
therapeutische Möglichkeiten in<br />
der Klinik für Radio-Onkologie<br />
Die Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und<br />
Transplantationschirurgie hat gemeinsam mit der<br />
Stomaberatung der Krebsliga Ostschweiz einen informativen<br />
Film für Stoma-Patienten produziert.<br />
Der Film thematisiert verschiedene relevante Aspekte<br />
für Stoma-Patienten respektive für Patienten,<br />
bei denen ein Stoma geplant ist. Neben der Erklärung,<br />
was ein Stoma ist, wird aufgezeigt, was dies für<br />
die entsprechenden Patienten bedeutet. Hierzu<br />
erzählt ein betroffener Patient, wie er den Alltag mit<br />
Nephrologie stellt sich vor<br />
Die Klinik für Nephrologie und Transplantationsmedizin<br />
des Kantonsspitals St.Gallen betreut Patienten<br />
mit akuten und chronischen Nierenerkrankungen<br />
sowie Patienten, die ein Nierenersatzverfahren benötigen<br />
oder darauf verzichten, und Patienten mit<br />
Immunsuppression nach Gewebetransplantation.<br />
einem Stoma bewältigt. Ergänzend werden durch<br />
Stoma-Experten Hinweise und Tipps zur korrekten<br />
Anwendung vermittelt. Der kurzweilige und aufklärende<br />
Film soll den betroffenen Patienten Ängste<br />
nehmen. Die Produktion ist auf dem Youtube-Kanal<br />
des Kantonsspitals St.Gallen (www.youtube.com;<br />
Suchbegriff «KSSG») frei verfügbar.<br />
Bei Bedarf können zudem Informationsmappen zum<br />
Thema Stoma via redaktion@kssg.ch bestellt werden.<br />
Die Klinik hat in den letzten zehn Jahren ein grosses<br />
Wachstum erlebt und ihr Angebot in dieser Zeit<br />
strukturiert erweitert.<br />
Lesen Sie mehr zum Thema<br />
«Die Nephrologie im Fokus» auf Seite 14.<br />
Die Behandlung eines breiten Spektrums onkologischer<br />
Erkrankungen erfolgt in der Klinik für Radio-<br />
Onkologie durch hochqualifizierte Mitarbeitende<br />
unter Einsatz modernster Geräte und fortschrittlichster<br />
Bestrahlungstechniken. Neben den gängigen<br />
Methoden sind auch besonders komplexe Therapieverfahren<br />
wie die Volumetrisch Modulierte Bogenbestrahlung<br />
(VMAT), die Intensitätsmodulierte Strahlentherapie<br />
(IMRT) und die Tomotherapie bereits<br />
länger etabliert. Im Rahmen eines eineinhalb Jahre<br />
dauernden Projekts erneuerte die Klinik für Radio-<br />
Onkologie nun die bisherigen Bestrahlungsgeräte<br />
mit der Inbetriebnahme von zwei modernsten Linearbeschleunigern<br />
(Varian, TrueBeam STx). Mit dieser<br />
neuen Geräteausstattung werden jetzt zusätzlich<br />
auch stereotaktische Behandlungstechniken (hochgenaue<br />
Kleinvolumenbestrahlung) und Atemkompensationstechniken<br />
durchgeführt. Um eine<br />
optimale Präzision zu gewährleisten, werden<br />
alle Bestrahlungstechniken durch modernste bildgebende<br />
Systeme unterstützt (IGRT).<br />
Im Rahmen der technischen Erneuerung der Klinik<br />
wurden auch IT-Lösungen aktualisiert sowie der<br />
Bestrahlungs- und Wartebereich patientenfreundlicher<br />
gestaltet.<br />
Die Fortschritte und aktuellen Möglichkeiten in der<br />
Strahlentherapie des Kantonsspitals St.Gallen werden<br />
in einer der nächsten <strong>DUO</strong>-Ausgaben detailliert<br />
vorgestellt.
14 Innovation und Entwicklung<br />
Innovation und Entwicklung<br />
15<br />
Dr. Irene Koneth, Leitende Ärztin; Dr. Christian Bucher, Oberarzt mbF; Dr. Isabelle Binet, Leitende Ärztin, Klinikleiterin; Dr. Dimitrios Tsinalis,<br />
Leitender Arzt, stv. Klinikleiter; Dr. Aurelia Schnyder, Oberärztin mbF; Fehlt auf Foto: Dr. Carina Hüsler, Oberärztin (v.l.n.r.)<br />
Die Nephrologie im Fokus<br />
Die Klinik für Nephrologie und Transplantationsmedizin betreut<br />
Patienten mit akuten und chronischen Nierenerkrankungen sowie<br />
Patienten, die ein Nierenersatzverfahren benötigen oder darauf<br />
verzichten, und Patienten mit Immunsuppression nach Gewebetransplantation.<br />
Stichworte: Nierentransplantation mit Betreuung<br />
von Empfängern und Lebendspendern, Peritonealdialyse oder<br />
Hämodialyse.<br />
Ein Erstkontakt mit dem Nephrologen dient zur<br />
Standortbestimmung und Diagnosestellung einer<br />
Nierenerkrankung (vgl. Box). In der weiteren Betreuung<br />
gemeinsam mit dem Hausarzt wird der oft<br />
polymorbide, chronisch kranke Nierenpatient begleitet.<br />
Dazu gehören insbesondere Massnahmen<br />
zur Verlangsamung des Nierenfunktionsverlustes,<br />
die Behandlung der renalen Folgeerkrankungen,<br />
die Vorbereitung auf ein geeignetes Nierenersatzverfahren,<br />
aber auch die palliative Betreuung<br />
bei Dialyseverzicht.<br />
Notfallzuweisung wegen Nierenerkrankung<br />
«Als Notfälle sehen wir Patienten mit neuer akuter<br />
Niereninsuffizienz zum Beispiel im Rahmen einer<br />
akuten Glomerulonephritis, Vaskulitis oder eines<br />
kardialen Grundproblems», erklärt Klinikleiterin<br />
Dr. Isabelle Binet. Oft müsse eine Nierenersatztherapie<br />
notfallmässig eingeleitet werden, teils auch<br />
bei Patienten, bei denen eine chronisch progrediente<br />
Niereninsuffizienz vorgängig dokumentiert<br />
wurde, aber ein Kontakt mit einem Nephrologen<br />
nie stattgefunden habe, führt Isabelle Binet weiter<br />
aus. «Wir müssen immer noch bei 50 Prozent aller<br />
Patienten die Dialyse notfallmässig starten, ohne<br />
dass der Patient und seine Angehörigen darauf vorbereitet<br />
wurden oder der Patient die für ihn geeignete<br />
Therapie wählen konnte.»<br />
Chronische Nierenersatztherapie:<br />
bewusste Entscheidung<br />
Wer von einem Nierenersatz profitiert und ob eine<br />
Dialyse oder eine Transplantation geeignet sind,<br />
ist abhängig von verschiedenen Faktoren, erklärt die<br />
Leitende Ärztin Irene Koneth: «Die Komorbiditäten,<br />
das biologische Alter oder auch die Fähigkeit eines<br />
möglichst gut informierten Patienten, mit dem<br />
Behandlungsteam zusammenzuarbeiten: Alles muss<br />
genau evaluiert werden. Der Entscheid, auf eine<br />
Nierenersatztherapie zu verzichten, steht bei einigen<br />
Patienten im Vordergrund. Dieser sollte aber<br />
fundiert sein und bedeutet nicht «nichts machen»,<br />
sondern bedingt eine symptomatische und kompetente<br />
Begleitung. Besonders bei sehr alten und /<br />
oder polymorbiden Patienten ist dies eine wichtige<br />
Entscheidung, die unbedingt getroffen werden soll,<br />
bevor bei Urämie auf der Notfallstation entschieden<br />
werden muss, ob ein Nierenersatzverfahren eingeleitet<br />
werden soll.»<br />
Damit Patienten ihre chronische Krankheit dank<br />
dazugewonnener Kompetenzen besser bewältigen<br />
können, werden nicht nur somatische Aspekte<br />
bei der Betreuung berücksichtigt, sondern auch<br />
psychosoziale. Im Rahmen von Workshops und<br />
strukturierten Informationen erfolgt die Information<br />
bezüglich geeigneter Dialyseverfahren. Dabei wird<br />
versucht, möglichst viele Patienten für ein Heimverfahren<br />
(Peritonealdialyse oder Heimhämodialyse)<br />
zu gewinnen.<br />
Multidisziplinäre Arbeit unerlässlich<br />
Das Team der Nephrologie und Transplantationsmedizin<br />
arbeitet in einem ausgebauten Netz mit<br />
anderen Fachdisziplinen zusammen; insbesondere<br />
mit dem Gefässzentrum sowie den Endokrinologen,<br />
Kardiologen und Urologen. Interdisziplinäre Sprechstunden<br />
und Boards z. B. im Rahmen der Von-Hippel-<br />
Wann ist eine<br />
nephrologische<br />
Zuweisung<br />
sinnvoll?<br />
Standortbestimmung<br />
– Unklare persistierende Hämaturie<br />
und / oder Proteinurie<br />
– Unklare oder progrediente akute<br />
Niereninsuffizienz<br />
– Innert drei Monaten nach akutem<br />
Nierenschaden Stadium 3<br />
– Unklare chronische Niereninsuffizienz<br />
mit eGFR < 60 ml / min<br />
– Nierenarterienstenose<br />
– ADPKD-Patienten (polyzystische Nierenerkrankung,<br />
Evaluation Tolvaptantherapie)<br />
– rezidivierendes Nierensteinleiden<br />
(metabolische Abklärung / Metaphylaxe)<br />
Mitbetreuung<br />
– Chronische Niereninsuffizienz mit eGFR<br />
< 30 – 45 ml / min, in Abhängigkeit von<br />
Alter und Dynamik (Abklärung / Therapie<br />
Folgekrankheiten)<br />
– Chronische Niereninsuffizienz mit<br />
eGFR < 25 ml / min (Evaluation Nierenersatztherapie)
16 Prozesse und Organisation<br />
Prozesse und Organisation<br />
17<br />
Wann und wie mit<br />
der Nephrologie<br />
Kontakt aufnehmen?<br />
Im Notfall (inkl. Dialyse- oder transplantierte<br />
Patienten): immer telefonisch Dienstarzt<br />
Nephrologie via Zentrale +41 71 494 <strong>11</strong> <strong>11</strong><br />
– Hämodialysepatienten (gilt nicht für<br />
Notfälle): dialysearzt@kssg.ch<br />
– Ambulante Zuweisungen KSSG (nicht für<br />
Notfälle): schriftlich (mit bisherigen Blut-/<br />
Urinbefunden, Berichtskopien) per<br />
Mail nephrologie@kssg.ch, Post oder<br />
per Fax +41 71 494 28 77<br />
– Nephrologie inkl. Ambulatorium<br />
Spital Rorschach: Dr. Christian Bucher,<br />
christian.bucher@kssg.ch,<br />
Direkt +41 71 858 36 14,<br />
Sekretariat +41 71 858 31 48,<br />
Fax +41 71 858 35 75<br />
Lindau-Expertengruppe, mit Hepatologen oder<br />
Ophtalmologen sind eine Zentrumsbesonderheit,<br />
die bei definierten Krankheitsbildern eine hochkompetente<br />
Patientenberatung und -betreuung<br />
garantiert. Bei der Nierentransplantation gehört<br />
auch eine integrierte multidisziplinäre Evaluation<br />
und Nachbetreuung zu den heutigen Standards.<br />
Der Kern besteht aus der Nephrologie, Transplantationschirurgie,<br />
Psychosomatik, dem HLA-Labor<br />
(Transplantationsimmunologie) und der Transplantationskoordination.<br />
Aber auch die Kardiologie,<br />
Urologie, Pneumologie oder Anästhesie sind hierbei<br />
stark involviert.<br />
Choosing wisely in der Nephrologie<br />
Nach dem Beispiel des Projektes «choosing wisely»<br />
wurden zur Vermeidung einer Überbehandlung oder<br />
einer risikoreichen Therapie von der Schweizerischen<br />
Gesellschaft für Nephrologie fünf Punkte ausgesucht,<br />
welche von Patienten und betreuenden<br />
Ärzten beachtet werden sollten (vgl. Box). Die Punkte<br />
ersetzen aber keinesfalls eine spezialärztliche<br />
Beratung!<br />
Aktuelle Herausforderung – Innovation<br />
und Entwicklung<br />
Die Zunahme von Fällen mit kombiniert schwerer<br />
Herz- und Niereninsuffizienz stellt eine neue<br />
Schnell<br />
Die Klinik für Nephrologie und Transplantationsmedizin<br />
des Kantonsspitals St.Gallen hat in den letzten<br />
zehn Jahren ein grosses Wachstum erlebt und ihr<br />
Angebot in dieser Zeit strukturiert erweitert. So sind<br />
die Bereiche Dialyse, Ambulatorium und Hospitalisation<br />
heute sowohl in St.Gallen als auch am Standort<br />
Rorschach verfügbar. Spezielle Sprechstunden für<br />
Stein- und Heimdialysepatienten sowie für Cornea-<br />
Herausforderung dar. Nebst der Herzinsuffizienz-Sprechstunde<br />
profitieren diese Patienten von<br />
der spezialisierten nephrologischen Mitbetreuung,<br />
die eine höhere Lebensqualität und weniger Hospitalisationen<br />
zum Ziel setzt. Neue krankheitsspezifische<br />
Therapien können seit Kurzem eingesetzt<br />
werden, um die Krankheitsprogression zu hemmen.<br />
So zum Beispiel Tolvaptan bei ADPKD oder Antikomplement-Antikörper<br />
bei atypischem hämolytisch-urämischem<br />
Syndrom.<br />
Auch im Bereich Transplantation gibt es neue<br />
Konzepte, die die zunehmend häufige Inkompatibilität<br />
zwischen Spender und Empfänger überwinden<br />
können: Bei Blutgruppen-Inkompatibilität, kann im<br />
Falle einer Lebendspende dank spezieller immunologischer<br />
Vorbereitung trotzdem transplantiert<br />
werden. Bei Lebendspenden zugunsten eines<br />
Empfängers, welcher immunisiert ist gegen die HLA-<br />
Antigene des Spenders, kann die Kreuz-Spende<br />
Transplantierte, gemeinsam mit der Augenklinik,<br />
gehören genauso zum Angebot wie Sprechstunden<br />
für Patienten mit Leber- und Nieren-Erkrankungen<br />
in Zusammenarbeit mit der Hepatologie oder<br />
Sprechstunden für Patienten mit kardiorenalem<br />
Syndrom in Zusammenarbeit mit der Kardiologie.<br />
Zudem konnte auch das Angebot an psychonephrologischer<br />
Beratung ausgebaut werden.<br />
mit einem anderen oder allenfalls mit mehreren<br />
Spenderpaaren eine Transplantation erlauben.<br />
«Trotz vieler Fortschritte bleibt für uns als grösste<br />
Herausforderung, die Patienten adäquat zu informieren,<br />
damit sie ihre chronische Krankheit bewältigen<br />
können», betont Isabelle Binet zum Schluss.<br />
Deshalb seien strukturierte Pflege-Interventionen<br />
zu den Themen «Was ist eine Niereninsuffizienz?»,<br />
«Was kann ich als betroffener Patient dazu beitragen,<br />
dass mein Transplantat lange funktioniert?»<br />
von grosser Wichtigkeit.<br />
«Choosing wisely» in<br />
der Nephrologie 2016<br />
Fünf Dinge, die Ärzte und Patienten bedenken sollten:<br />
– Beginnen Sie keine chronische Dialyse<br />
ohne eine gemeinsame Entscheidung<br />
mit dem Patienten und dessen Familie.<br />
– Führen Sie kein onkologisches Screening<br />
für asymptomatische Patienten mit dialysepflichtiger<br />
Nierenerkrankung durch,<br />
ohne Risiken und Nutzen besprochen<br />
zu haben.<br />
– Vermeiden Sie nichtsteroidale Antirheumatika<br />
(NSAR) bei Personen mit Bluthochdruck,<br />
Herzversagen und/oder chronischer<br />
Nierenerkrankung.<br />
– Beginnen Sie keine Behandlung mit Erythropoiese-stimulierenden<br />
Wirkstoffen (ESA) bei Patienten<br />
mit asymptomatischer, chronischer Nierenerkrankung<br />
und Hämoglobinspiegeln ≥ 10 g / dl.<br />
– Vermeiden Sie, wenn möglich, Venenkatheter<br />
am Arm bei Patienten mit chronischer Nierenfunktionseinschränkung<br />
Stadium 4 – 5, wenn<br />
eine Hämodialyse geplant ist.
18 Prozesse und Organisation Prozesse und Organisation<br />
19<br />
Erweiterung<br />
MRT- und PET/<br />
CT-Angebot<br />
Das Kantonsspital St.Gallen erweitert sein Angebot<br />
im Bereich Radiologie und Nuklearmedizin. Im<br />
neu erstellten Gebäude der Firma Regatron in Rorschach<br />
werden ab der zweiten Sommerhälfte<br />
2017 in modern eingerichteten Räumlichkeiten ein<br />
3-Tesla-Magnetresonanztomograph (MRT) und ein<br />
Positronen-Emissions-Tomograph mit CT-Einheit<br />
(PET/CT) der neusten Generation betrieben. Das<br />
diagnostische Angebot für die Patientinnen und<br />
Patienten in der Region Rorschach und im unteren<br />
Rheintal wird dadurch erweitert und die wohnortnahe<br />
Versorgung qualitativ aufgewertet. Das neue<br />
Angebot ermöglicht einen Abbau der Wartezeiten<br />
am Standort St.Gallen sowohl im Bereich MRT als<br />
auch im PET / CT und eine zeitnahe Durchführung<br />
der gewünschten Untersuchung an beiden Modalitäten.<br />
Dank der Strategie des Kantonsspitals<br />
St.Gallen ist die fachärztliche Betreuung der Patientinnen<br />
und Patienten und die Beurteilung der<br />
Untersuchungen optimal gewährleistet.<br />
Gediegene Atmosphäre am<br />
ersten Zuweiser-Event<br />
Rund 80 Gäste konnten am 9. Februar 2017 am Kantontsspital<br />
St.Gallen begrüsst werden. Die Vorträge<br />
und Rundgänge, das Rahmenprogramm sowie das<br />
Nachtessen erfreuten sämtliche Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer. An diesem Abend konnten sich die<br />
geladenen Gäste für einmal ausserhalb des Praxisalltags<br />
austauschen und fanden Raum für einen<br />
regen Gedankenaustausch.<br />
Anlässlich des Events hat Daniel Germann, Direktor<br />
und Vorsitzender Geschäftsleitung, die Resultate der<br />
Zuweiserbefragung präsentiert: «Mit dem Gesamtresultat<br />
von 88,9 Prozent sind wir zufrieden, sehen<br />
jedoch an verschiedenen Stellen Verbesserungspotenzial.»<br />
Entsprechende Projekte zur Optimierung<br />
der Abläufe sind bereits initiiert.<br />
Unterstützung<br />
von Biogasanlagen<br />
gegen Methanemissionen<br />
Mit dem vorliegenden Magazin unterstützt das<br />
Kantonsspital St.Gallen das Projekt «Biogasanlagen<br />
gegen Methanemissionen» der Klimaschutz-Organisation<br />
myclimate.<br />
Landwirtschaftliche Abfallstoffe wie Mist und Gülle<br />
sind in der Schweiz eine brachliegende Ressource<br />
und werden noch kaum für die Energieproduktion<br />
genutzt. Durch den Bau und Betrieb von zwei landwirtschaftlichen<br />
Biogasanlagen werden mittels ebendieser<br />
landwirtschaftlicher Abfallstoffe Strom<br />
und Wärme produziert und gleichzeitig Methanemissionen<br />
vermieden. Das Biogas wird in einem<br />
Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme umgewandelt.<br />
Der produzierte Strom wird ins Netz eingespeist,<br />
die Wärme wird zum Heizen von Gebäuden<br />
verwendet.<br />
Aufgrund des grossen Anklangs wird das Kantonsspital<br />
St.Gallen im Jahr 2018 wiederum einen Zuweiser-Event<br />
dieser Art organisieren.<br />
Zentrales Patientenmanagement (ZPM)<br />
in der Klinik für Neurochirurgie<br />
Seit Anfang Jahr hat die Klinik für Neurochirurgie ein<br />
Zentrales Patientenmanagement (ZPM) eingeführt.<br />
Das ZPM ist zuständig für sämtliche ambulante und<br />
stationäre Anfragen mit dem Ziel, die Kontaktaufnahme<br />
für die Zuweiser und Patienten zu vereinfachen<br />
und Anfragen innerhalb von zwei Werktagen<br />
zu bearbeiten.<br />
Zudem bietet die Klinik für Neurochirurgie täglich<br />
eine Notfallsprechstunde an, in der dringliche Fälle<br />
unkompliziert und zeitnah behandelt werden. Seit<br />
Februar 2017 werden des Weiteren die Berichte<br />
nur noch per E-Mail an die verschlüsselten Adressen<br />
versendet. Die Zuweiser erhalten folglich zeitnah<br />
eine Rückmeldung über das weitere Vorgehen mit<br />
den Patienten.<br />
Kontakt ZPM Neurochirurgie<br />
Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 17.00 Uhr<br />
Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr<br />
Tel. +41 71 494 <strong>11</strong> 99<br />
neurochirurgie@kssg.ch<br />
Klinik für Neurologie ist neu Mitglied<br />
im Verein Swiss Memory Clinics (SMC)<br />
Seit Ende 2016 ist die Klinik für Neurologie des<br />
Kantonsspitals St.Gallen Mitglied im Verein Swiss<br />
Memory Clinics (SMC). Der Verein setzt sich aus<br />
schweizerischen Memory Clinics (Gedächtnissprechstunden)<br />
zusammen und verfolgt das Ziel,<br />
die Diagnose- und Behandlungsqualität bei Demenzerkrankungen<br />
schweizweit auf hohem Niveau<br />
zu etablieren. Darüber hinaus soll die Informationsund<br />
Wissensvermittlung begünstigt sowie die<br />
Interdisziplinarität gefördert werden.<br />
Das Kantonsspital St.Gallen bietet in der Klinik für<br />
Neurologie eine Gedächtnissprechstunde sowie<br />
Weiterentwicklung am<br />
Standort Rorschach<br />
Die Innere Medizin Rorschach des Kantonsspitals<br />
St.Gallen hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt.<br />
So ist sie seit vier Jahren unter der<br />
Leitung von Dr. Samuel Henz voll im Kantonsspital<br />
St.Gallen integriert und auf Wachstumskurs:<br />
Das onkologische Ambulatorium wurde erweitert,<br />
interdisziplinäre tagesklinische Abklärungen bei<br />
Demenzverdacht an. Hier werden alle notwendigen<br />
Untersuchungen (je nach Indikation: Neuropsychologie,<br />
Labor, MRI, Hippocampus-Volumetrie, PET,<br />
Lumbalpunktion, EEG) koordiniert an einem Tag<br />
durchgeführt. Dafür arbeitet ein erfahrenes interdisziplinäres<br />
Team unter der Leitung von Dr. Ansgar<br />
Felbecker, Leitender Arzt Klinik für Neurologie,<br />
eng zusammen.<br />
die Gastroenterologie und Kardiologie ausgebaut<br />
und die Nephrologie auch stationär etabliert.<br />
Mehr über das Thema<br />
«Innere Medizin Rorschach»<br />
lesen Sie auf Seite 20.
20 Prozesse und Organisation<br />
Prozesse und Organisation<br />
21<br />
Innere Medizin<br />
Rorschach: dezentral<br />
und breit aufgestellt<br />
Seit vier Jahren ist die Innere Medizin<br />
des Spitals Rorschach vollständig im<br />
Kantonsspital St.Gallen integriert und<br />
hat sich gleichzeitig weiterentwickelt.<br />
So konnte in den letzten Jahren das<br />
onkologische Ambulatorium erweitert,<br />
die Gastroenterologie und Kardiologie<br />
ausgebaut und die Nephrologie<br />
auch stationär etabliert werden.
22 Prozesse und Organisation<br />
Prozesse und Organisation<br />
23<br />
Das Spital Rorschach spielt eine wichtige Rolle im<br />
Kantonsspital St.Gallen. Als persönliches Spital<br />
am See gewährleistet es die medizinische Grundversorgung<br />
der Bevölkerung der Stadt Rorschach und<br />
der angrenzenden Regionen. Hier wird regionale<br />
Grundversorgung mit Zentrumsmedizin gepaart<br />
– innerhalb schlanker Strukturen mit kurzen Wegen.<br />
Die Verbindung zum Zentrumsspital in St.Gallen<br />
wird in der täglichen Arbeit in Rorschach nicht nur<br />
sichergestellt, sondern durch die Spezialisten vor<br />
Ort gewährleistet.<br />
Breites Angebot der Inneren Medizin<br />
Die Innere Medizin Rorschach ist – wie die Schwesterklinik<br />
in Flawil – der Allgemeinen Inneren Medizin<br />
am Standort in St.Gallen zugeordnet. Die Schwerpunkte<br />
der Inneren Medizin in Rorschach liegen auf<br />
Dr. Samuel Henz, MPH<br />
Seit April 2013 leitet Dr. Henz die Innere<br />
Medizin Rorschach.<br />
der Betreuung der Notfallstation, Bettenstation,<br />
Überwachstation sowie des Zuweisungsambulatoriums<br />
mit Schwerpunkt Sonographie. Eine enge<br />
Zusammenarbeit mit internistischen Spezialisten<br />
der jeweiligen Mutterkliniken in St.Gallen ist dabei<br />
unabdingbar. Dank dieser Zusammenarbeit kann<br />
den Patienten wohnortnah sowohl ein breites internistisches<br />
Fachwissen als auch eine familiäre<br />
Atmosphäre angeboten werden.<br />
Entwicklungen der letzten vier Jahre auf einen<br />
Blick: Onkologisches Ambulatorium<br />
Nachdem das Ostschweizer Adipositaszentrum<br />
(OAZ) des Kantonsspitals St.Gallen an den Standort<br />
Oberwaid umgezogen ist, konnten attraktive<br />
Räumlichkeiten für das ausgelastete Onkologische<br />
Ambulatorium gewonnen werden. Dort wirken<br />
unter der Leitung von Dr. Michael Giger drei Ärztinnen<br />
und ein interprofessionelles Team. Dank enger<br />
Zusammenarbeit mit den Hausärzten einerseits<br />
und der Bettenstation andererseits gelingt eine<br />
hohe Kontinuität der Betreuung für Patienten auch<br />
in schwierigen Lebenssituationen.<br />
Schaffung einer stationären Nephrologie<br />
Die Dialysestation im Spital Rorschach betreute<br />
bisher nur ambulante Patienten. Angesichts des<br />
konstanten Bettenengpasses des Departements<br />
Innere Medizin am Standort St.Gallen konnte unter<br />
der Leitung von Dr. Christian Bucher eine zusätzliche<br />
nephrologische Bettenstation eröffnet werden.<br />
Die Nephrologie bietet zudem das Angebot von<br />
Feriendialysen am Bodensee an – ein besonders<br />
geschätztes Angebot seitens der Patienten.<br />
Schnell<br />
Das Spital am See – der Standort Rorschach des<br />
Kantonsspitals St.Gallen – bietet regionale Grundversorgung,<br />
gepaart mit Zentrumsmedizin. Dank<br />
einer engen Zusammenarbeit mit den Kliniken in<br />
St.Gallen kann den Patienten wohnortnah sowohl<br />
Schwerpunkt Ultraschalldiagnostik<br />
Das Spektrum der Ultraschalldiagnostik reicht von<br />
Abdomensonographie über vaskuläre Fragestellungen,<br />
Weichteil- und Pleurasonographie bis hin zur<br />
Kontrastmittelsonographie von Lebertumoren (Dr.<br />
Mikael Sawatzki). Dr. Christian Doenecke ist Tutor,<br />
Dr. Samuel Henz Supervisor und Dr. Mikael Sawatzki<br />
Kursleiter der Schweizerischen Gesellschaft für<br />
Ultraschall in der Medizin (SGUM).<br />
Beliebte Aus- und Weiterbildungsstätte<br />
Die Klinik mit Weiterbildungsstatus B (zwei Jahre<br />
Allgemeine Innere Medizin) stellt bewusst viele Studienabgänger<br />
ein und betreut diese engmaschig<br />
durch Kaderärzte. Bei anonymen Befragungen der<br />
Assistenzärzte und Unterassistenten erhält die<br />
Klinik regelmässig Bestnoten.<br />
ein breites internistisches Fachwissen als auch eine<br />
familiäre Atmosphäre angeboten werden. Seit<br />
vier Jahren ist die Innere Medizin Rorschach voll im<br />
Kantonsspital St.Gallen integriert und hat sich<br />
dabei stets weiterentwickelt.<br />
In Rorschach werden folgende Spezialsprechstunden<br />
des Departements für Innere Medizin<br />
angeboten:<br />
– Gastroenterologie und Hepatologie<br />
– Innere Medizin<br />
– Kardiologie<br />
– Nephrologie und Hämodialyse<br />
– Onkologie<br />
– Psychosomatik (2 Tage / Woche)<br />
Weitere Spezialisten werden regelmässig konsiliarisch<br />
aus dem Kantonsspital St.Gallen beigezogen,<br />
am häufigsten aus den Kliniken der<br />
Infektiologie, Pneumologie und Endokrinologie.<br />
Vorgängig war er bereits 19 Jahre am Standort<br />
St.Gallen tätig. Neben einer breiten internistischen<br />
Ausbildung und Fremdjahren in Neurologie,<br />
Neurochirurgie, Chirurgie, Klinischer<br />
Pharmakologie und Hepatologie erwarb er<br />
2000 an der Harvard University in Boston<br />
einen Master of Public Health.<br />
Neben der klinischen Tätigkeit engagierte<br />
sich Dr. Henz stark für Prozessverbesserungen,<br />
Arzneimittelsicherheit und die Einführung<br />
einer kantonalen elektronischen Krankenakte.<br />
2016 erhielt Dr. Henz den SIWF-Award für<br />
besonderes Engagement in der ärztlichen<br />
Weiterbildung.<br />
Entwicklung Kardiologie<br />
Aufgrund steigender Nachfrage wurde die kardiologische<br />
Sprechstundentätigkeit kontinuierlich ausgebaut.<br />
Dank Renovationsarbeiten stehen den<br />
Patienten schöne und angenehme Räumlichkeiten<br />
zur Verfügung.<br />
Gastroenterologie / Hepatologie<br />
Seit die Screening-Koloskopie ab dem 50. Lebensjahr<br />
eine Krankenkassen-Pflichtleistung ist,<br />
müssen parallel zwei Endoskopieanlagen betrieben<br />
werden. Unter der Leitung von Dr. Mikael Sawatzki<br />
zusammen mit Dr. Jens Vorndamm arbeitet<br />
auch ein gastroenterologischer Fachassistenzarzt<br />
in Rorschach. Dieses Team bietet das typische<br />
Spektrum der Gastroenterologie sowie eine Hepatologie-Sprechstunde<br />
an.<br />
Dr. Georg Hafner, Dr. Michael Giger, Dr. Samuel Henz, Dr. Christian Doenecke, Dr. Mikael Sawatzki (v.l.n.r.)
24 Agenda<br />
Agenda<br />
25<br />
Veranstaltungen<br />
April 2017 bis Juli 2017<br />
APRIL<br />
Fr 07.04.2017/<br />
Fr 21.04.2017<br />
Mo 24.04.2017<br />
Fr 28.04.2017<br />
Fr 28.04.2017/<br />
Sa 29.04.2017<br />
Fr 28.04.2017<br />
Fr 28.04.2017<br />
Fr 28.04.2017<br />
MAI<br />
Mi 03.05.2017<br />
Do 04.05.2017<br />
Mo 08.05.2017<br />
Mo 08.05.2017<br />
Fit-for-Stroke Days<br />
Klinik für Neurologie<br />
08.30 – 16.15 Uhr<br />
Haus 61, Raum 001 EG, Blutspendezentrum<br />
Ostschweiz<br />
Systematische Schmerztherapie bei<br />
Rheumaerkrankungen: ein Update<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Onkolunch: «Personalisierte Medizin»<br />
Klinik für Onkologie / Hämatologie<br />
12.30 – 14.00 Uhr<br />
White Matter Dissection<br />
Schulungs- und Trainingszentrum<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Fr: 10.30 – 17.00 Uhr<br />
Sa: 08.00 – 13.00 Uhr<br />
Anatomisches Institut der Universität Fribourg,<br />
1 Route Albert-Gockel, 1700 Fribourg<br />
Breakfast Lecture: Diabetestherapie – ein Update<br />
Klinik für Neurologie<br />
08.30 – 09.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum, Kantonsspital St.Gallen<br />
Kardiolunch: Monthly Cardiology Journal Review<br />
Klinik für Kardiologie<br />
12.15 – 13.00 Uhr<br />
Haus 01, Raum U142, Kantonsspital St.Gallen<br />
Onkolunch: «Personalisierte Medizin»<br />
Klinik für Onkologie / Hämatologie<br />
12.30 – 14.00 Uhr<br />
Hep Cup<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.30 – 19.30 Uhr<br />
Haus 12, Raum 302, Kantonsspital St.Gallen<br />
Ausbilden in der Pflegepraxis<br />
08.00 – 17.00 Uhr<br />
Haus 81, Raum 203, Kantonsspital St.Gallen<br />
Impact of ultrasound in neuromuscular medicine<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 14<strong>11</strong><br />
Dermatologie Fokus: Nahrungsmittelallergien<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
19.00 – 19.45 Uhr<br />
Haus <strong>11</strong>, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mi 10.05.2017<br />
Fr 12.05.2017<br />
Fr 12.05.2017<br />
Fr 12.05.2017<br />
Sa 13.05.2017<br />
Mo 15.05.2017<br />
Di 16.05.2017<br />
Swiss Neurology Webinars - Videokonferenz<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.00 Uhr<br />
Haus 04, 4. Stock, Bibliothek, Raum 403<br />
Stroke Lunch: Diagnostik und Therapie bei<br />
Durchblutungsstörungen der vertebrobasilären<br />
Strombahn<br />
Klinik für Neurologie<br />
<strong>11</strong>.30 – 12.45 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 14<strong>11</strong><br />
Kardiolunch: Rückblick auf<br />
den EuroEcho-Kongress 2017<br />
Klinik für Kardiologie<br />
12.15 – 13.00 Uhr<br />
Haus 01, Raum U142, Kantonsspital St.Gallen<br />
Onkolunch: «Molekulare Subtypen des Lungenkarzinoms<br />
und deren klinische Bedeutung»<br />
Klinik für Onkologie / Hämatologie<br />
12.30 – 14.00 Uhr<br />
Das Ostschweizer Gefässzentrum erleben<br />
Ostschweizer Gefässzentrum<br />
10.00 – 14.00 Uhr<br />
Haus 09, 1. Stock, Kantonsspital St.Gallen<br />
Neuropathische Schmerzen – rationelle Therapie<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 14<strong>11</strong><br />
Nationaler Hautkrebstag<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
08.00 – 17.00 Uhr<br />
Haus 31, Kantonsspital St.Gallen<br />
Do 18.05.2017 Gastro-Update 2017<br />
Do 18.05.2017<br />
Sa 20.05. 2017 –<br />
Sa 27.05.2017<br />
Mo 22.05.2017<br />
Mo 29.05.2017<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
12.45 – 18.35 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Achtsamkeit in der Psychosomatik<br />
Klinik für Psychosomatik<br />
17.15 – 18.15 Uhr<br />
Haus <strong>11</strong>, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
25. Toggenburger Anästhesie-Repetitorium<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs-<br />
und Schmerzmedizin<br />
Hotel Stump’s Alpenrose, Schwendi, 9658 Wildhaus<br />
Towards prevention of autoimmune disease<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Neuropathologische Konferenz<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 14<strong>11</strong><br />
JUNI<br />
Fr 02.06.2017<br />
Mi 07.06.2017<br />
Mo 12.06.2017<br />
Mo 12.06.2017<br />
Mo 12.06.2017<br />
Mi 14.06.2017<br />
Fr 16.06.2017<br />
Fr 16.06.2017<br />
Mo 19.06.2017<br />
Mi 21.06.2017<br />
Do 22.06.2017<br />
Do 22.06.2017<br />
Kardiolunch: Hämodynamisches Assessment bei<br />
Herzinsuffizienz; Klinik-Echo-Rechtsherzkatheter<br />
Klinik für Kardiologie<br />
12.15 – 13.00 Uhr<br />
Haus 01, Raum U142, Kantonsspital St.Gallen<br />
Gastrokolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.30 – 20.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
48. St.Galler Anästhesiesymposium<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungsund<br />
Schmerzmedizin<br />
17.00 – 19.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
SASL School<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.30 – 19.00 Uhr<br />
Haus 21, Raum 101, Kantonsspital St.Gallen<br />
Dermatologie Fokus: Techniken der Defektrekonstruktion<br />
in der Dermatochirurgie<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie<br />
19.00 – 19.45 Uhr<br />
Haus <strong>11</strong>, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
Interdisziplinäres Demenz-Symposium<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.00 – 20.30 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Grand Round Rehabilitation<br />
Klinik für Neurologie<br />
12.00 – 13.00 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 14<strong>11</strong><br />
Kardiolunch: Rückblick auf den<br />
EuroPCR-Kongress 2017<br />
Klinik für Kardiologie<br />
12.15 – 13.00 Uhr<br />
Haus 01, Raum U142, Kantonsspital St.Gallen<br />
Neuroopthalmologie<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kursraum 14<strong>11</strong><br />
Swiss Neurology Webinars – Videokonferenz<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.00 Uhr<br />
Haus 04, 4. Stock, Bibliothek, Raum 403<br />
IBD Roundtable<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.15 – 20.00 Uhr<br />
Haus 03, Raum 1201, Kantonsspital St.Gallen<br />
Siebter St.Galler Ophtag<br />
Augenklinik<br />
09.00 – 17.30 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Fr 23.06.2017<br />
Mo 26.06.2017<br />
Kardiolunch: Cancer treatments and cardio-<br />
vascular toxicity developed under the auspices of<br />
the ESC Committee for Practice Guidelines<br />
Klinik für Kardiologie<br />
12.15 – 13.00 Uhr<br />
Haus 01, Raum U142, Kantonsspital St.Gallen<br />
Hepatologiekolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.30 – 18.45 Uhr<br />
Haus <strong>11</strong>, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 26.06.2017 Rheuma und Schwangerschaft –<br />
Do 29.06.2017<br />
Fr 30.06.2017<br />
JULI<br />
Mo 03.07.2017<br />
Mi 05.07.2017<br />
was der Rheumatologe wissen sollte<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
18.15 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Raum 434,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
14. Fortbildungsnachmittag<br />
Klinik für Endokrinologie<br />
13.30 – 17.30 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Kardiolunch: Monthly Cardiology Journal Review<br />
Klinik für Kardiologie<br />
12.15 – 13.00 Uhr<br />
Haus 01, Raum U142, Kantonsspital St.Gallen<br />
CIRS<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
17.00 – 18.00 Uhr<br />
Haus <strong>11</strong>, Raum 049, Kantonsspital St.Gallen<br />
Interdisziplinäre Viszeralmedizin<br />
Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie<br />
18.30 – 20.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Fr 07.07.2017 Kardiolunch: Angeborene Herzfehler –<br />
APRIL BIS JULI<br />
April – Juli 2017<br />
von einfach bis komplex<br />
Klinik für Kardiologie<br />
12.15 – 13.00 Uhr<br />
Haus 01, Raum U142, Kantonsspital St.Gallen<br />
Diverse Kurse<br />
REA2000 – Zentrum für Reanimations-<br />
und Simulationstraining<br />
Fürstenlandstrasse 100, 9014 St.Gallen<br />
Mehr Veranstaltungen und<br />
Informationen unter: www.kssg.ch
Kantonsspital St.Gallen<br />
Rorschacher Strasse 95<br />
CH-9007 St.Gallen<br />
Tel. +41 71 494 <strong>11</strong> <strong>11</strong><br />
Spital Rorschach<br />
Heidenerstrasse <strong>11</strong><br />
CH-9400 Rorschach<br />
Tel. +41 71 858 31 <strong>11</strong><br />
Spital Flawil<br />
Krankenhausstrasse 23<br />
CH-9230 Flawil<br />
Tel. +41 71 394 71 <strong>11</strong><br />
www.kssg.ch