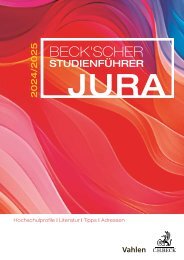BeckExtra 02/2020
Das Kundenmagazin
Das Kundenmagazin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kundenmagazin des Verlages C.H.BECK · Erscheint dreimal im Jahr · N o <strong>02</strong>.20<br />
Beckextra<br />
Das<br />
Magazin<br />
Verfassungsstaat und Corona-Krise<br />
Interview mit Prof. Dr. Jens Kersten und Prof. Dr. Stephan Rixen<br />
Aus dem<br />
Schilderwald<br />
>> Novelle der Straßenverkehrsordnung<br />
beck-aktuell<br />
>> das neue<br />
Nachrichtenportal<br />
für Juristen<br />
Thema Geld<br />
>> und seine<br />
Psychologie
impressum<br />
Redaktion:<br />
Beckextra Das Magazin<br />
Wilhelmstraße 9<br />
80801 München<br />
Tel. +49 89 38189-266<br />
Fax +49 89 38189-480<br />
Mail: beckextra@beck.de<br />
Mathias Bruchmann (v.i.S.d.P.)<br />
Kathrin Moosmang (Text)<br />
Katrin Dähn (Text)<br />
Christiane Kern (Layout/Art Direktion)<br />
Benjamin Zirnbauer (Layout)<br />
Verlag:<br />
Verlag C.H.BECK oHG<br />
Wilhelmstr. 9, 80801 München<br />
Tel. +49 89 38189-0<br />
Fax +49 89 38189-4<strong>02</strong><br />
www.beck.de<br />
Der Verlag ist eine oHG. Gesellschafter sind<br />
Dr. Hans Dieter Beck und Dr. h.c. Wolfgang Beck,<br />
beide Verleger in München.<br />
Illustrationen // Fotocollagen:<br />
Titelseite: Jozsef Zoltan Varga / Getty; Seite 6/7:<br />
visualgo / Getty; Seite 18/19: sorbetto / Getty.<br />
Druck:<br />
Mayr Miesbach GmbH<br />
Am Windfeld 15<br />
83714 Miesbach
editorial<br />
Zu<br />
Beginn<br />
Kurz nach Erscheinen der vergangenen<br />
Ausgabe gab es für uns alle<br />
nur noch ein Thema: Corona. Eine<br />
staatliche Beschränkungsmaßnahme<br />
folgte der nächsten. Jetzt, wo sich<br />
der Nebel wieder lichtet, zeigt sich, eine Reihe der<br />
ergriffenen Maßnahmen war verfassungswidrig.<br />
Die beiden Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Jens<br />
Kersten und Prof. Dr. Stephan Rixen haben das<br />
Verhalten des Rechtsstaats während der Corona-<br />
Krise von Anfang an beobachtet und ausgewertet.<br />
Ihre Erkenntnisse haben sie in einem Buch zusammengetragen,<br />
das in Kürze erscheinen wird. Im<br />
Titelinterview sprechen wir bereits vorab über die<br />
aufschlussreichen Ergebnisse.<br />
Nahezu unbemerkt sind dagegen im Frühjahr einige<br />
neue Verkehrsschilder in Kraft getreten. Welche<br />
das sind und was sie bedeuten, erklären wir in der<br />
Rubrik »Schlau durch den Alltag« – damit Sie im<br />
Straßenverkehr nicht vor Rätseln stehen.<br />
Wie Sie auch sonst über alle relevanten Rechtsentwicklungen<br />
auf dem Laufenden bleiben, erfahren<br />
Sie in unserem Beitrag über das neue, kostenfreie<br />
Nachrichtenportal »beck aktuell – Heute im<br />
Recht«.<br />
Der Ratgeberteil dieser Ausgabe befasst sich mit<br />
der Psychologie des Geldes. Ein spannendes Thema,<br />
das selbst rationale Köpfe nicht kalt lässt.<br />
Falls Sie Beckextra Das Magazin noch nicht kostenlos<br />
abonniert haben, können Sie dies ganz einfach<br />
mit dem Bestellcoupon auf der Rückseite dieser<br />
Ausgabe tun.<br />
Mathias Bruchmann<br />
Leiter Presse und Lizenzen<br />
Recht • Steuern • Wirtschaft
Zum<br />
Inhalt<br />
10<br />
titel<br />
Verfassungsstaat und Corona-Krise<br />
Interview mit Prof. Dr. Jens Kersten und Prof. Dr. Stephan Rixen<br />
4
inhalt<br />
06 schlau durch den alltag<br />
Neues aus dem<br />
Schilderwald<br />
Novelle der Straßenverkehrsordnung<br />
08 kurzinterview<br />
Entweder // Oder<br />
Fragen an<br />
Georg M. Oswald<br />
09 recht aktuell<br />
Aktuelles<br />
aus Gesetzgebung<br />
und Justiz<br />
16 C.H.BECK im web<br />
// beck-aktuell<br />
Neues Nachrichtenportal<br />
für Juristen<br />
// beck-seminare<br />
Aus Präsenz<br />
wird Online<br />
18 ratgeber<br />
Warum wir<br />
beim Thema Geld<br />
nicht rational sind<br />
20 neues aus dem verlag<br />
// COVID19 –<br />
und Recht<br />
Zeitschrift zur Krise<br />
// neue Zeitschriften<br />
// Corona-Blog<br />
22 autoren bei der arbeit<br />
Andreas Respondek<br />
am Schreibtisch<br />
23 vermischtes<br />
// Denkanstöße für<br />
einen partizipativen<br />
Sozialismus<br />
// Gewinnspiel<br />
5
Neues aus dem<br />
SCHILDERWALD<br />
Sommerzeit ist Fahrradzeit. Dieses Jahr werden vermutlich noch mehr Menschen ihre Drahtesel<br />
in Gebrauch nehmen, da in Folge von Corona und der daraus resultierenden Maskenpflicht das<br />
Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht unbedingt attraktiver geworden ist. Radfahren<br />
dagegen ist im Allgemeinen gut für die Gesundheit und natürlich für die Umwelt. Auch bei der Ende<br />
April in Kraft getretenen »54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften«<br />
wurde bevorzugt an das Wohl der Radfahrer sowie an den Umweltschutz gedacht. Die Novelle ist<br />
nicht nur der Grund für so manchen erhöhten Bußgeldbescheid, sondern auch für einige neue<br />
Schilder, über die sich der ein oder andere Verkehrsteilnehmer in den vergangenen Wochen<br />
gewundert haben dürfte. Beckextra Das Magazin stellt Ihnen sieben neue Verkehrsschilder vor,<br />
die Sie kennen sollten, ganz gleich, ob Sie mit dem Fahrrad oder dem Auto unterwegs sind.<br />
Zumal Unwissenheit bekanntlich nicht vor Strafe schützt.<br />
6
schlau durch den alltag<br />
Autofahrer kennen den grünen Pfeil an Ampeln. Wo dieses neue Schild hängt,<br />
dürfen nun Fahrradfahrer bei Rot abbiegen – aber nur sie! Autos müssen<br />
warten. Zu beachten ist, dass der grüne Pfeil keinen kompletten Freifahrtschein<br />
darstellt: Es gilt, sich sowohl mit dem Auto als auch mit dem Rad wie bei einem<br />
Stoppschild zu verhalten. Also erst anhalten, dann abbiegen.<br />
Fußgängerzonen sind bekanntlich den Menschen vorbehalten, die per Pedes<br />
unterwegs sind. Die neuen Fahrradzonen dagegen müssen sich die Drahtesel<br />
mit den Autos teilen. Allerdings haben die Fahrräder Vorrang und dürfen auf keinen<br />
Fall gefährdet werden. Für alle zusammen gilt hier Tempo 30.<br />
Praktisch und umweltfreundlich mögen sie ja sein, aber Lastenfahrräder<br />
nehmen sowohl während der Fahrt als auch in geparktem Zustand mehr Platz<br />
weg als gewöhnliche Fahrräder. Damit die Suche nach einem Abstellplatz kein<br />
Hindernis mehr für einen klimaschonenderen Transport ist, zeichnen diese<br />
Schilder jetzt spezielle Parkflächen und Ladezonen für Lastenräder aus.<br />
Schnell, schneller, Fahrradfahrer. Auf so mancher Strecke könnte man meinen,<br />
die halbe Nation übe für die Tour de France. Besonders einfach lassen sich<br />
solche Ambitionen dort ausüben, wo Markierungen auf festen Fahrbahnen diese<br />
als Radschnellwege kennzeichnen. Da die Wegeführung aber gelegentlich auch<br />
über Schotter- oder Sandpisten führt, sorgt dieses Schild nun an derlei Stellen für<br />
eine durchgängige Kennzeichnung.<br />
Dieses Schild ist die Abwandlung eines altbekannten Verbots. Radfahrer, die auf<br />
ihrem Weg regelmäßig Engstellen passieren müssen, wird es besonders freuen:<br />
Dieses Verkehrszeichen bedeutet, dass hier nicht nur Überholverbot gilt, sondern<br />
explizit keine einspurigen Fahrzeuge überholt werden dürfen. Autos und LKWs<br />
müssen also hinter den Fahr- und Motorrädern bleiben. Gleiches gilt jedoch nicht<br />
für einspurige Fahrzeuge untereinander: Sollten Sie also ein schneller Rennradler<br />
sein, dürfen Sie hier auch weiterhin untermotorisierte Mopeds umfahren.<br />
Ein halbiertes Auto um das Menschen herumtanzen? Nein, hier werden keine<br />
Schrottplätze zu Freizeitflächen erklärt, sondern Parkplätze speziell für Carsharing-<br />
Fahrzeuge ausgewiesen. Ebenfalls neu ist die dazu passende Plakette, die an die<br />
Windschutzscheibe geklebt werden muss.<br />
I<br />
n Corona-Zeiten sind Fahrgemeinschaften vielleicht nicht ganz praktikabel, aber<br />
grundsätzlich ist es ja wünschenswert, dass nicht jeder mit dem eigenen Auto<br />
unterwegs ist. Mit diesem Schild sollen PKWs, die mit mindestens drei Personen<br />
besetzt sind, Vorzüge gewährt werden, etwa indem ihnen das Befahren von Busspuren<br />
oder gesonderten Fahrspuren erlaubt wird.<br />
7
kurzinterview<br />
© Peter von Felbert<br />
Entweder // Oder<br />
Fragen an Georg M. Oswald<br />
Schriftsätze und Literatur schließen sich nicht aus.<br />
Georg M. Oswald kann beides.<br />
Er ist Schriftsteller und Rechtsanwalt zugleich.<br />
Georg M. Oswald ist Rechtsanwalt in München mit den<br />
Schwerpunkten Familien- und Erbrecht. Gleichzeitig ist er<br />
literarisch tätig. Den Durchbruch brachte im Jahr 2000<br />
der Roman »Alles, was zählt«, der ausgezeichnet und in zehn<br />
Sprachen übersetzt wurde. Im Frühjahr erschien sein Roman<br />
»Vorleben«, der die Frage aufwirft, inwieweit man jemanden<br />
verdächtigen kann, den man liebt.<br />
Herr Oswald, wie würden Sie selbst diese<br />
Frage in wenigen Sätzen beantworten?<br />
Ich stelle mir das nicht angenehm vor.<br />
Das ist in gewisser Weise die Triebfeder<br />
dieses Romans. Wie reagiert man, wenn<br />
man etwas herausfindet, was man absolut<br />
nicht herausfinden will? Dieser Zwiespalt<br />
zwischen Neugier und Furcht hat<br />
mich interessiert.<br />
Wie sind Sie vom Anwalt zum Schriftsteller<br />
geworden? Oder vielleicht war es auch anders<br />
herum?<br />
Es war eher umgekehrt. Schon als<br />
Schüler und Student habe ich geschrieben.<br />
Als ich Referendar war, bekam ich ein erstes<br />
Literaturstipendium, und mein erster<br />
Erzählungsband wurde veröffentlicht. So<br />
bin ich seither beides, Schriftsteller und<br />
Anwalt.<br />
Es gibt von Ihnen auch ein Sachbuch mit<br />
dem Titel »55 Gründe Rechtsanwalt zu werden«.<br />
Nennen Sie uns Ihren wichtigsten<br />
Grund.<br />
Weil es ein freier Beruf ist. Er bietet eine<br />
enorme Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten<br />
und große Unabhängigkeit.<br />
Kommen wir zu unserer Rubrik »Entweder –<br />
Oder«… Gerichtssaal oder Lesebühne?<br />
Da gibt es kein Entweder-Oder für<br />
mich. Im Gerichtssaal kämpft man für<br />
die Sache seines Mandanten. Auf der Lesebühne<br />
versucht man, das Publikum zu unterhalten.<br />
Beide Male versucht man, es so<br />
gut wie möglich zu machen, aber die Situationen<br />
sind doch ganz unterschiedlich.<br />
Krimi oder Liebesroman?<br />
Ein Krimi kann gut damit zurechtkommen,<br />
nicht auch ein Liebesroman zu sein.<br />
Umgekehrt gilt das, zumindest nach meiner<br />
Wahrnehmung, kaum. Vielleicht ein<br />
typisch männlicher Standpunkt, aber ich<br />
entscheide mich dann doch für den Krimi.<br />
Lesen oder Schreiben?<br />
Das eine geht nicht ohne das andere.<br />
Wer liest, ist eindeutig im Vorteil, egal, ob<br />
er gerade noch mehr liest oder selbst etwas<br />
schreibt.<br />
Auto oder Fahrrad?<br />
Definitiv Fahrrad. Keine Parkplatzsorgen,<br />
keine Strafzettel, und seit der Corona-<br />
Krise entwickle ich nun auch die Techniken<br />
des Allwetterradelns für mich weiter.<br />
Berge oder Meer?<br />
Dann doch die Berge. Sie sind von München<br />
aus besser zu erreichen. Wird Zeit,<br />
dass ich mal wieder hinfahre.<br />
Aktenkoffer oder Rucksack?<br />
Rucksack! In letzter Zeit aber noch<br />
mehr die Fahrradtasche. Siehe oben.<br />
Sommer oder Winter?<br />
Nachdem der Winter bei uns ja immer<br />
weniger stattfindet: Sommer!<br />
8
echt aktuell<br />
Aktuelles<br />
aus Gesetzgebung<br />
und Justiz<br />
Kein rechtzeitiger<br />
Eingang<br />
Kein Stern für den<br />
Anwalt<br />
Kein Dach über<br />
dem Kopf<br />
— Diesmal geht es auf dieser Seite vor allem<br />
um Anwälte, die mit Abstand größte juristische<br />
Berufsgruppe. Zunächst ein<br />
Dauerbrenner der anwaltlichen Praxis:<br />
Der verspätete Versand fristgebundener<br />
Schriftsätze. Wenn in diesem sensiblen<br />
Bereich etwas schief geht, ist es gut, einen<br />
technischen Grund vorbringen zu können,<br />
den man partout nicht beeinflussen<br />
konnte, etwa ein streikendes Fax. Eigentlich<br />
soll die Digitalisierung die Kommunikation<br />
ja erleichtern, aber betrachtet<br />
man die aktuelle Rechtsprechung, wird<br />
das Problem durch den elektronischen<br />
Rechtsverkehr eher komplexer. Der BGH<br />
erwies sich in diesem Zusammenhang zuletzt<br />
noch als sehr anwaltsfreundlich: Er<br />
gewährte erstens Wiedereinsetzung, weil<br />
der Anwalt aus Sicht des Gerichts frühzeitig<br />
genug mit dem Faxversand (der<br />
dann nicht funktionierte) begonnen hatte.<br />
Und er war zweitens der Meinung, dass<br />
der Anwalt bei einem streikenden Fax<br />
nicht verpflichtet ist, alternativ über das<br />
besondere elektronische Anwaltspostfach<br />
zu versenden (Az. X ZR 60/19). Die Linie<br />
des BGH gilt aber nicht ausnahmslos:<br />
Wer in Schleswig-Holstein im Arbeitsrecht<br />
forensisch tätig ist, sollte einen<br />
Beschluss des dortigen LAG kennen, wonach<br />
eine Berufung per Fax grundsätzlich<br />
unzulässig ist (Az. 6 Sa 1<strong>02</strong>/20).<br />
— Die Digitalisierung hat nicht nur die<br />
Kommunikation verändert, sondern auch<br />
Produkte und Dienstleistungen trans-<br />
parenter gemacht, etwa durch Bewertungsportale.<br />
Zwar gibt es, anders als für<br />
Lehrer oder Hotels, so etwas noch nicht<br />
für Anwälte. Aber Mandanten finden<br />
mitunter trotzdem einen Weg, ihrem Ärger<br />
Luft zu machen. In einem Fall, den<br />
das AG Bremen jüngst entschied, hatte<br />
der Anwalt sogar selbst dazu ermuntert,<br />
auf seiner Homepage eine Bewertung<br />
zu schreiben. Das verpflichtet ihn aus<br />
Sicht des Gerichts aber noch lange nicht,<br />
dort auch jede Form der Manöverkritik<br />
hinzunehmen. Es blieb unklar, was im<br />
Mandat schief gelaufen war. Der Anwalt<br />
habe den Fall jedenfalls in den Sand<br />
gesetzt, meinte ein Klient. Und er habe<br />
außerdem noch seinen Glauben an das<br />
Rechtssystem zerstört. Ein paar Zitate<br />
aus dem Eintrag: »Hobbyanwalt!«, »Fach-<br />
wissen sehr mangelhaft«, »Schade, dass<br />
man nicht null Sterne geben kann«. Der<br />
Anwalt erstattete daraufhin Strafanzeige,<br />
forderte den Ex-Kunden zur Abgabe einer<br />
strafbewehrten Unterlassungserklärung<br />
auf und rundete sein Maßnahmenpaket<br />
mit einer ansehnlichen Kostennote ab.<br />
Das AG Bremen bescheinigte ihm zwar,<br />
dass er sich derartige Bewertungen nicht<br />
bieten lassen müsse, wies die Klage auf<br />
Erstattung der Abmahnkosten und auf<br />
Schmerzensgeld aber ab (Az. 9 C 410/19).<br />
— In der letzten Meldung geht es um ein<br />
interessantes anwaltliches Verständnis<br />
des Mietrechts. Eine Rechtsanwältin hatte<br />
eine ihr gehörende Mietwohnung saniert.<br />
Die Art und Weise, wie die Fachanwältin<br />
für Bau- und Architektenrecht die<br />
Arbeiten anging, war aber nur bedingt im<br />
Interesse ihrer Mieter. Sie wurden nämlich<br />
nicht vorab darüber informiert und<br />
fanden ihre Unterkunft plötzlich ohne<br />
Dach und Wände vor. Wie häufig in solchen<br />
Auseinandersetzungen, gingen die<br />
Meinungen der Beteiligten weit auseinander.<br />
Die Mieter sprachen im Prozess von<br />
einer »kalten Räumung«, die Anwältin<br />
hielt die Klage für eine »reine Schikane«.<br />
Das Gericht entschied zugunsten der Bewohner:<br />
Die Vermieterin muss ihre übereilte<br />
Sanierung rückgängig machen und<br />
die Wohnung für das Mieterpaar wieder<br />
bewohnbar machen, »insbesondere durch<br />
die Wiederherstellung der Decke, der Außenwände<br />
einschließlich der Fenster sowie<br />
der Innenwände«, heißt es dazu in<br />
dem Beschluss des AG (Az. 222 C 84/20).<br />
Außerdem darf die Vermieterin nach der<br />
Entscheidung im einstweiligen Verfügungsverfahren<br />
die Wohnung nicht weitervermieten.<br />
9
Verfassungsstaat<br />
und Corona-Krise<br />
Zahlreiche Klagen von Bürgerinnen und Bürgern<br />
sowie erste Gerichtsentscheidungen zeigen: Bei den<br />
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist<br />
die Politik häufiger über das Ziel hinaus geschossen.<br />
Die Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Jens Kersten von<br />
der Ludwig-Maximilians-Universität in München und<br />
Prof. Dr. Stephan Rixen von der Universität Bayreuth<br />
analysieren in ihrem Buch »Der Verfassungsstaat in der<br />
Corona-Krise«, das im August bei C.H.BECK erscheinen<br />
wird, ganz aktuell die Auswirkungen der Corona-Krise<br />
auf das Grundgesetz. Beckextra Das Magazin sprach<br />
mit den beiden.<br />
Prof. Dr. Stephan Rixen<br />
In diesem Jahr wurde<br />
Professor Rixen in den<br />
Deutschen Ethikrat<br />
berufen. Er lehrt<br />
an der Universität<br />
Bayreuth Öffentliches<br />
Recht, Sozialwirtschafts-<br />
und<br />
Gesundheitsrecht.<br />
Sein besonderes<br />
Augenmerk gilt den<br />
verfassungsrechtlichen<br />
Auswirkungen der<br />
Corona-Pandemie.<br />
© Judith Affolter
titel<br />
© privat<br />
Prof. Dr. Jens Kersten<br />
Hinter uns liegen mehrere Monate Corona-Krise – in welchem Zustand befindet<br />
sich unsere Verfassung?<br />
Kersten: Eigentlich in einem ganz guten. Das Grundgesetz ist krisentauglich<br />
und krisenfest. Wir erleben verfassungsrechtlich keinen<br />
Ausnahmezustand, sondern insbesondere den Versuch, grundrecht<br />
liche Freiheiten und grundrechtliche Schutzpflichten mit Blick<br />
auf die Gesundheit und das Leben der Bürgerinnen und Bürger<br />
sowie ein funktionierendes Gesundheitssystem in einen angemessenen<br />
Ausgleich zu bringen.<br />
Rixen: Krisen, auch große Krisen wie die jetzige Pandemie, gehören<br />
zur Normalität des Verfassungsstaats. Normalität heißt natürlich<br />
nicht, dass die vielen Zumutungen der Krise bagatellisiert werden<br />
dürfen. Im Gegenteil: Die vielen individuellen, sozialen und ökonomischen<br />
Härten sind Teil der Krise. Aber sie müssen mit den<br />
bewährten Deutungsmustern und Lösungsansätzen des Verfassungsstaates<br />
bewältigt werden. Wir sind nicht in einem Ausnahmezustand,<br />
und wir brauchen auch keinen Ausnahmezustand, schon<br />
gar nicht in den Köpfen.<br />
Von Anfang an untersuchte<br />
der Rechtswissenschaftler<br />
die in der Corona-Krise<br />
erfolgten Grundrechtseingriffe<br />
durch<br />
staatliche Maßnahmen.<br />
Er ist Inhaber<br />
des Lehrstuhls für<br />
Öffentliches Recht<br />
und Verwaltungswissenschaften<br />
an der<br />
Ludwig-Maximilians<br />
Universität München.<br />
11
»Krisen wie die jetzige<br />
Pandemie, gehören<br />
zur Normalität des<br />
Verfassungsstaats.«<br />
Bundestagspräsident Schäuble brachte dennoch ein Notparlament<br />
ins Spiel. Eine gute Idee?<br />
Kersten: Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern stand<br />
die zentrale Bedeutung des Bundestags für die Bewältigung<br />
der Pandemie nie in Frage. Doch die Funktionsfähigkeit des<br />
Bundestags muss eben auch gesichert werden. Die Infektionsgefahr<br />
unter 709 Abgeordneten und zahlreichen Bediensteten<br />
im Reichstagsgebäude ist hoch. Der Bundestag hat sich mit<br />
der Herabsetzung der Beschlussfähigkeit auf ein Viertel seiner<br />
Abgeordneten beholfen. Dies führt aber letztlich dazu, dass<br />
viele Abgeordnete aufgrund der Pandemie auf eine Anwesenheit<br />
im Plenum verzichten. Der Bundestagspräsident hatte<br />
vorgeschlagen, dieses informell geschaffene Notparlament<br />
verfassungsrechtlich zu verankern. Doch das ist nicht nötig.<br />
So ist das Schweizer Parlament in eine Messehalle umgezogen.<br />
Das wäre auch in Berlin möglich. Besser wäre es noch,<br />
der Bundestag würde dem britischen House of Commons folgen:<br />
Mit einfachster Kommunikationstechnik wie Video- oder<br />
digitaler Bildübertragung können alle Abgeordneten – zur<br />
Not auch aus der Quarantäne – an den Parlamentssitzungen<br />
teilnehmen. Der Bundestag würde so über die Corona-Krise<br />
hinaus Anschluss an den technischen Stand elektronischer<br />
Kommunikation finden.<br />
Grundrechte waren – und sind teilweise immer noch – eingeschränkt.<br />
Zu Recht?<br />
Rixen: Ich glaube, es kommt auf den Zeitpunkt der Betrachtung<br />
an. Als die Krise zu einem regulatorischen Thema wurde, etwa<br />
Mitte März, da mussten politisch Verantwortliche und Exekutive<br />
auf einer weithin ungeklärten Wissensbasis entscheiden,<br />
da gab es tagesaktuell neue Mischungen aus Unwissen und<br />
Wissen. In dieser Lage war es vertretbar, die Grundrechte aus<br />
Gründen des Infektionsschutzes deutlich einzuschränken. Und<br />
doch sind manche Grundrechte übermäßig beschränkt worden.<br />
Denken Sie an die Versammlungsfreiheit, von der zunächst in<br />
den meisten Bundesländern ohne Not faktisch nicht mehr viel<br />
übrig blieb. Dabei wären Demonstrationen beispielsweise als<br />
Autokorso möglich gewesen.<br />
Prof. Dr. Stephan Rixen<br />
Kersten: Andere ungeeignete Maßnahmen wurden immerhin<br />
schnell wieder revidiert, wie die Berliner Ausweispflicht oder<br />
das Verbot, allein auf einer Parkbank sitzen zu dürfen. Je länger<br />
die Pandemie andauert, desto mehr werden von den meisten<br />
Bürgerinnen und Bürgern Hygieneregeln und Distanzgebote<br />
eingehalten. Damit erweisen sich Maßnahmen wie beispielsweise<br />
die Einschränkung von religiösen Zusammenkünften als<br />
nicht mehr erforderlich. Mit anderen Worten: Man muss immer<br />
den Zeitfaktor mitberücksichtigen. Maßnahmen, die zu Beginn<br />
der Krise verhältnismäßig waren, erweisen sich bei weiterer<br />
Entwicklung als nicht mehr erforderlich oder unangemessen.<br />
Die Regierungen müssen sie aufheben – oder eben die Gerichte.<br />
Die Verhältnismäßigkeit mancher Maßnahmen wurde von Bundesland<br />
zu Bundesland offenkundig unterschiedlich beurteilt. Ist das von der<br />
Verfassung gedeckt?<br />
Rixen: Der allgemeinen Öffentlichkeit ist es schwer zu vermitteln,<br />
dass die Grundrechtsgeltung von der Geografie in einem<br />
Bundestaat abhängt. Warum soll in Mainz ein Grundrecht mehr<br />
eingeschränkt werden können als jenseits des Rheins in Wiesbaden?<br />
Föderalismus ist für viele fast eine Grundrechtsgefahr.<br />
Aber ein Staat, der auf Vielfalt setzt – das ist ein Bundestaat wie<br />
der unsere – lässt auch, natürlich nicht grenzenlos, Spielräume<br />
bei der Frage der Verhältnismäßigkeit zu. Das ist auch deshalb<br />
richtig, weil die Gefahrenlage in den Bundesländern ganz unterschiedlich<br />
gewesen ist, zum Beispiel in Bayern anders als in<br />
Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem befördert die föderale<br />
Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes einen Rechtfertigungswettbewerb<br />
zwischen den Bundesländern. Denn das eine<br />
Bundesland muss begründen, warum es strenger agiert als das<br />
Nachbarbundesland. Das stärkt am Ende das Argumentieren<br />
mit der Verhältnismäßigkeit – und damit die effektive Geltung<br />
der Grundrechte.<br />
Das Corona-Virus wird uns voraussichtlich noch eine Weile begleiten.<br />
Halten Sie den Einsatz einer Corona-App für zulässig?<br />
Kersten: Eine Corona-App im Sinn einer staatlicherseits verfügten<br />
Erstellung von Mobilitätsprofilen wäre zwar mit Blick<br />
auf die Abwägung zwischen dem Recht auf informelle Selbstbestimmung<br />
und dem Gesundheits- und Lebensschutz nicht<br />
von vornherein verfassungsrechtlich ausgeschlossen. Doch sie<br />
würde in der Rechtswirklichkeit scheitern. Die Bürgerinnen<br />
und Bürger sind mit Blick auf ihre Privatsphäre sehr sensibel<br />
und würden da kaum mitmachen. Die freiwillige Tracing-App<br />
ist leider juristisch zerredet worden. Man kann nur hoffen, dass<br />
nach der Entscheidung für eine dezentrale Speicherung hier<br />
Fortschritte gemacht werden. Letztlich funktioniert die Tracing-App<br />
faktisch nur unter zwei Bedingungen: erstens einer<br />
möglichst umfassenden Covid-19-Testung in der Bevölkerung<br />
und zweitens einer möglichst hohen Beteiligung an der App.<br />
Zumindest den zweiten Punkt wird man zurückhaltend beurteilen<br />
müssen.<br />
Und auch der Gedanke an eine Impfpflicht sorgt mancherorts für Beunruhigung.<br />
Wie beurteilen Sie eine solche Maßnahme aus verfassungsund<br />
gesundheitsrechtlicher Sicht?<br />
12
titel<br />
Rixen: Der Präsident des Robert Koch-Instituts hat zu Recht betont,<br />
es gebe »keinen Anlass, an eine Impfpflicht zu denken«.<br />
Das ist schon deshalb richtig, weil zunächst einmal ein Impfstoff<br />
existieren muss, und der muss auch in ausreichendem<br />
Umfang verfügbar sein. Ist das der Fall, bin ich sicher, dass die<br />
allermeisten Menschen sich freiwillig impfen lassen werden.<br />
Eine Impfpflicht wäre also kaum erforderlich, wenn mit einer<br />
freiwilligen Nachfrage zu rechnen ist, die die nötige Durchimpfungsrate<br />
erreicht. Bei SARS-CoV-2 liegt diese Rate nach gegenwärtigem<br />
Wissensstand bei ca. 60-80% der Bevölkerung. Dann<br />
sind auch die besonders Vulnerablen geschützt, also vor allem<br />
die, deren gesundheitliche Konstitution es nicht zulässt, sich<br />
impfen zu lassen, wie Säuglinge und chronisch Kranke<br />
Welche Rolle spielt der Sozialstaat bei der Krisenbewältigung?<br />
Kersten: Die Corona-Krise führt uns die Sozialstaatsbedürftigkeit<br />
unserer liberalen Gesellschaft vor Augen. Sie macht<br />
uns wieder bewusst, dass ein Großteil unserer sozialen Infrastrukturen<br />
gerade auf kommunaler Ebene im 19. Jahrhundert<br />
überhaupt erst in Reaktion auf die Infektionskrankheiten wie<br />
die Cholera entstanden sind, und wie grundlegend sie die damalige<br />
Gesellschaft verändert und unsere heutige Gesellschaft<br />
geprägt haben: Kanalisation, Energieversorgung, Gesundheitsversorgung.<br />
Auch heute erleben wir in der Corona-Krise,<br />
was Lorenz von Stein den sozial »arbeitenden Staat« genannt<br />
hat: Nachtragshaushalt 2<strong>02</strong>0, Krankenhausfinanzierung,<br />
Sozial pakete, Kurzarbeit, Arbeits- und Mieterschutz, Wirtschaftshilfe<br />
für Unternehmen.<br />
Sie analysieren nicht nur, sondern zeigen in Ihrem Buch auch Wege aus<br />
der Krise auf. Welche sind das?<br />
Rixen: Ganz generell haben wir den Eindruck, dass die Ordnungsmodelle,<br />
Begriffe und Unterscheidungen des Infektionsschutzgesetzes<br />
nicht mehr uneingeschränkt zur pandemischen<br />
Realität passen. Deshalb ist es nicht sinnvoll, mit der Reform<br />
»Maßnahmen,<br />
die zu Beginn der<br />
Krise verhältnismäßig<br />
waren, erweisen sich<br />
bei weiterer Entwicklung<br />
als nicht mehr<br />
erforderlich oder<br />
unangemessen.«<br />
Prof. Dr. Jens Kersten<br />
des Infektionsschutzgesetzes zu warten, bis die aktuelle Corona-<br />
Krise halbwegs unter Kontrolle oder gar vollständig bewältigt<br />
ist. Das gilt nicht zuletzt für die Reform der Regelungen über<br />
den Gesundheitsnotstand (§ 5 Abs. 2 IfSG), die dem Bundesgesundheitsministerium<br />
problematisch weit gefasste Befugnisse<br />
gewährt. Neben punktuellen Reformen im Staatsorganisationsrechts<br />
sind das Parlaments- und das Gerichtsverfassungsrecht,<br />
die Prozessgesetze, aber auch das Verwaltungsverfahrensrecht<br />
im Lichte der Erfahrungen der Corona-Krise weiterzuentwickeln.<br />
Die bisherige Pandemieplanung sollte zu einer<br />
integrierten Pandemieplanung ausgebaut werden, die u.a. die<br />
aus der Sozialinfrastrukturplanung insbesondere im Gesundheitswesen<br />
bekannten Planungsinstrumente, etwa bei der<br />
Krankenhausplanung, mit jenen des Katastrophenschutzes<br />
kombiniert und weiterentwickelt. Also, kurz gesagt: Das Pandemie-Krisenrecht,<br />
soweit es um den Infektionsschutz geht, muss<br />
auf neue normative Füße gestellt werden. Die nächste Pandemie<br />
ähnlichen Zuschnitts kommt bestimmt. Da bin ich mir sicher.<br />
Noch einen Blick über die Grenzen: Besteht Europa den Corona-Test?<br />
Rixen: Das hängt davon ab, was man mit Europa meint. Soweit<br />
es um die EU als Akteurin in der Corona-Krise geht, hilft ein<br />
Blick in Art. 168 AEUV, um festzustellen, dass die EU keine operativen<br />
Befugnisse hat. Die Mitgliedstaaten haben insoweit den<br />
Hut auf, sonst niemand. Die Folgen der Krise sind in den schwer<br />
betroffenen Mitgliedstaaten fürchterlich, aber es ist unfair, das<br />
der EU in die Schuhe zu schieben. Das sind leicht zu durchschauende<br />
politische Spielchen, auch um von strukturellen<br />
Versäumnissen abzulenken, für die allein der jeweilige Mitgliedsstaat<br />
verantwortlich ist. Eine prominentere Rolle kann<br />
die EU bei der ökonomischen Bewältigung der Corona-Krise<br />
spielen. Auch hier hilft allerdings ein Blick in den AEUV.<br />
Art. 123, 125 und 127 AEUV bilden – zumal aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts<br />
– eine feste Burg, die den deutschen Staatshaushalt<br />
gegen Begehrlichkeiten mancher Mitgliedsstaaten<br />
schützt, die ihr Verständnis von Haushaltsdisziplin über eine<br />
Quasi-Bürgenhaftung wirtschaftlich starker Mitgliedsstaaten<br />
abstützen wollen. Corona-Bonds kann es danach im geltenden<br />
Rechtsrahmen nicht geben, egal ob man sie politisch oder ökonomisch<br />
für sinnvoll hält. Ob der Ausweg finanzieller Beistand<br />
nach Art. 122 Abs. 2 AEUV ist, der außergewöhnliche Notlagen<br />
wie die COVID-19-Pandemie vor Augen hat, hängt davon ab, ob<br />
damit die strikten Grenzen, die der AEUV ansonsten markiert,<br />
in zulässiger Weise umgangen werden. Dass Mitgliedsstaaten<br />
wie Italien, Spanien, aber auch Frankreich, die von der Pandemie<br />
besonders hart getroffen wurden, Hilfe benötigen, ist<br />
offensichtlich. Jetzt muss die EU in rechtskonformer Weise mit<br />
Leben füllen, was Art. 3 des EU-Vertrags betont: Die EU fördert<br />
die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten.<br />
Vielen Dank für das Gespräch.<br />
13
Antworten auf Corona<br />
Zuverlässigen Rechtsrat in Zeiten der Pandemie<br />
finden Sie unter www.beck-shop.de<br />
Covid-19-Krise = Verfassungskrise?<br />
Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist das öffentliche Leben in Deutschland durch<br />
massive Grundrechtseingriffe radikal eingeschränkt worden. Dies wirft eine<br />
Reihe fundamentaler Fragen auf:<br />
Ì Wie weit lassen sich Eingriffe in Freiheit und Gleichheit rechtfertigen?<br />
Ì Verschiebt sich die Macht zwischen Parlament und Exekutive?<br />
Ì Versagt der Föderalismus?<br />
Ì Bewährt sich der Sozialstaat?<br />
Ì Ist Solidarität jenseits des Nationalstaats eine Illusion?<br />
Das Buch bietet eine kompakte Analyse aller wesentlichen verfassungs-, verwaltungs-,<br />
europa- und internationalrechtlichen Aspekte des staatlichen Handelns in<br />
der Corona-Krise<br />
Kersten/Rixen<br />
Der Verfassungsstaat<br />
in der Corona-Krise<br />
2<strong>02</strong>0. Rund 150 Seiten.<br />
In Leinen ca. € 24,90<br />
ISBN 978-3-406-76012-9<br />
Neu im August 2<strong>02</strong>0<br />
beck-shop.de/31229582<br />
COVID-19: Auswirkungen auf das deutsche Recht<br />
Folgende Bereiche sind von Spezialisten des jeweiligen Rechtsgebiets im Hinblick<br />
auf spezifische Sachverhalte der Corona-Krise dargestellt:<br />
Ì Allgemeines Leistungsstörungsrecht<br />
Ì Kreditrecht<br />
Ì Miete<br />
Ì Wohnungseigentumsrecht<br />
Ì Heimrecht<br />
Ì Baurecht<br />
Ì Reiserecht<br />
Ì Vereins- und Genossenschaftsrecht<br />
Ì Gesellschaftsrecht<br />
Ì Sport<br />
Ì Privatversicherungsrechtliche Fragen<br />
Ì Transportrecht<br />
Ì Zivilverfahren in Zeiten<br />
des Coronavirus<br />
Ì Sanierung und Insolvenz<br />
Ì Vergabe- und EU-Beihilfenrecht<br />
Ì Öffentliches Recht<br />
Ì Entschädigungen<br />
Ì Straf- und Strafprozessrecht<br />
Schmidt<br />
Rechtsfragen zur Corona-Krise<br />
2<strong>02</strong>0. XXXVI, 718 Seiten.<br />
Kartoniert € 44,90<br />
ISBN 978-3-406-75923-9<br />
Neu seit Mai 2<strong>02</strong>0<br />
beck-shop.de/31143776<br />
14
Jetzt<br />
3 Monate<br />
gratis<br />
testen!<br />
COVuR – COVID-19 und alle Rechtsfragen zur Corona-Krise<br />
Entdecken Sie jetzt das Medium, das Ihnen zuverlässig die wirklich wichtigen<br />
rechtlichen Aspekte der Corona-Pandemie zusammenstellt. Auf hohem Niveau und<br />
praxisorientiert, ist diese Zeitschrift die perfekte Unterstützung für Ihre tägliche<br />
Arbeit. So bringt Sie die COVuR sicher durch die Krise zum Wohl Ihrer Mandanten!<br />
COVuR · COVID-19 und alle<br />
Rechtsfragen zur Corona-Krise<br />
Zeitschrift inkl. Online-Nutzung.<br />
1. Jahrgang 2<strong>02</strong>0. Erscheint zweimal<br />
monatlich inkl. Online-Modul<br />
COVuRDirekt für einen Nutzer.<br />
Jahresabonnement € 189,–<br />
beck-shop.de/go/COVuR<br />
Aktuell und nah am Geschehen<br />
Die COVuR greift zweimal im Monat die aktuell in der Diskussion befindlichen<br />
COVID-19-Themen auf und legt die rechtlichen Hintergründe in informativen Aufsätzen<br />
dar. Darüber hinaus bietet die Zeitschrift praktische Lösungen für die Herausforderungen<br />
und stellt umfassend die zu Pandemie-Themen ergangene Rechtsprechung<br />
dar.<br />
Kießling<br />
IfSG · Infektionsschutzgesetz<br />
2<strong>02</strong>0. Rund 400 Seiten.<br />
In Leinen ca. € 99,–<br />
ISBN 978-3-406-76018-1<br />
Neu im August 2<strong>02</strong>0<br />
beck-shop.de/31229588<br />
Der neue »Gelbe« zum IfSG<br />
Wegen der Covid-19-Pandemie ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) hochaktuell.<br />
Bevölkerung und Wirtschaft sehen sich behördlichen Maßnahmen von bisher nicht<br />
erreichter Tragweite und Intensität ausgesetzt. Rechtsgrundlage sind hier die Bestimmungen<br />
des Infektionsschutzgesetzes mit seinen jüngsten Änderungen und<br />
Ergänzungen. Vor dem Hintergrund der Pandemie-Krise ist dieser Kommentar als<br />
Neuerscheinung von Grund auf neu konzipiert und geschrieben worden. Im<br />
konzentriert-handlichen Stil der »gelben Kommentare« werden die Vorschriften<br />
des IfSG auf aktuellstem Gesetzesstand im Einzelnen wissenschaftlich präzise und<br />
praxisgerecht erläutert.<br />
15
© Harald Schnauder<br />
Neues<br />
Nachrichtenportal<br />
NJW-Schriftleiter Tobias<br />
Freudenberg (oben)<br />
und Stephan Lahl von<br />
beck-online sind für<br />
das neue Nachrichtenangebot<br />
beck-aktuell<br />
verantwortlich.<br />
beck-aktuell – Heute im Recht heißt ein neues<br />
Nachrichtenangebot aus dem Verlag C.H.BECK.<br />
Der Newsdienst informiert Juristen tagesaktuell<br />
über alle relevanten Rechtsentwicklungen und<br />
ist kostenfrei im Internet abrufbar. Die Beiträge werden<br />
von den Redaktionsteams der Neuen Juristischen<br />
Wochenschrift (NJW) und der Datenbank beck-online<br />
bereitgestellt.<br />
© Christian Moser<br />
»Wer die beck-aktuell-Seiten täglich mindestens einmal durchscrollt,<br />
kann sich sicher sein, nichts Wichtiges zu verpassen«, verspricht<br />
NJW-Schriftleiter Tobias Freudenberg. Das Portal setzt auf schnelle, zuverlässige<br />
und vor allem qualifizierte Rechtsinformationen. Auch was<br />
die technische und optische Darstellung angeht, legt beck-aktuell hohe<br />
Maßstäbe an. Stephan Lahl, Gruppenleiter der Internetredaktion von<br />
beck-online, ist verantwortlich für die reibungslose Ausspielung der<br />
Inhalte: »Wir wissen, dass digitale News heute meistens auf dem Smartphone<br />
konsumiert werden. Daher haben wir vor allem den mobilen<br />
Nutzer im Blick was Ladezeiten, Schriftgrößen und Bildmotive angeht.«<br />
Große Themenvielfalt<br />
Die Nachrichtenauswahl soll alle juristischen Berufsgruppen ansprechen.<br />
Entsprechend breit ist das Themenspektrum gefasst. »Um diese Informations -<br />
breite auf Dauer gewährleisten zu können, kooperieren die Redaktion<br />
16
C.H.BECK im web<br />
der NJW und die Nachrichtenredaktion von beck-online bei der<br />
Zusammenstellung des Newsfeeds ganz bewusst miteinander«,<br />
erläutert Tobias Freudenberg.<br />
Das Nachrichtenangebot gliedert sich in mehrere Rubriken.<br />
Im Zentrum steht »Heute im Recht«. Hier laufen die tagesaktuellen<br />
Nachrichten zusammen. »Je nach Informationslage können das<br />
schon mal zehn Meldungen am Tag sein«, berichtet Stephan Lahl.<br />
Einige davon sind sogenannte Top-Meldungen. Sie zeichnen sich dadurch<br />
aus, das die Texte ausführlicher und mit Hintergründen, rechtlichen<br />
Einordnungen oder Experten-Einschätzungen versehen sind.<br />
Praktische Relevanz<br />
Maßgeblich für die Auswahl der Themen und Gerichtsentscheidungen<br />
ist vor allem deren praktische Relevanz. Der Fokus liegt daher<br />
besonders auf Nachrichten zur aktuellen Rechtsprechung, gefolgt<br />
von Neuigkeiten aus den Bereichen Gesetzgebung und Rechtspolitik.<br />
An dritter Stelle stehen sonstigen Nachrichten aus der Rechtswelt.<br />
für Juristen<br />
Da viele dieser Themen prüfungsrelevant sein können, heißt es auch<br />
für Studenten und Referendare: aufgepasst!<br />
In der Rubrik »Magazin« erscheinen Beiträge außerhalb des<br />
klassischen Nachrichtenformats. »Hierunter fallen Interviews, Kurzbeiträge,<br />
Urteilsanalysen, Kommentare oder auch Gastbeiträge«,<br />
zählt Schriftleiter Freudenberg auf.<br />
Beliebter Newsletter<br />
Die Rubrik »Aktuelle Gesetzesvorhaben« verweist auf eine bereits<br />
länger bestehende, sehr hilfreiche Internetseite, auf der beck-<br />
online den Stand laufender Gesetzesentwicklungen dokumentiert.<br />
Genau genommen ist auch die Nachrichtenseite »beck-aktuell –<br />
Heute im Recht« nicht ganz neu. Sie ist eine Weiterentwicklung der<br />
früheren beck-aktuell-Seite, die vollständig überarbeitet und mit der<br />
Webseite der NJW (njw.de) verschmolzen wurde.<br />
Erhalten blieb aber der beliebte beck-aktuell-Newsletter, der<br />
seinen Abonnenten jeden Abend zwischen 17 und 18 Uhr eine Zusammenfassung<br />
des juristischen Tagesgeschehens liefert. Derzeit<br />
ist der Newsletter allerdings nur für beck-online-Kunden verfügbar.<br />
»Wir arbeiten hier an einem Relaunch mit einigen interessanten Veränderungen«,<br />
versprechen Tobias Freudenberg und Stephan Lahl.<br />
www.beck-aktuell.de<br />
Aus Präsenz wird Online<br />
Live-Webinare bilden das neue interaktive<br />
Fortbildungsformat der BeckAkademie<br />
Seminare. Da Präsenzseminare derzeit Corona<br />
bedingt nicht möglich sind, hat die Beck<br />
Akademie Seminare ihr gesamtes Programm<br />
bis Ende August auf Live-Webinare umgestellt<br />
– einschließlich der Sommerlehrgänge.<br />
»Online vermitteln wir die gleichen Inhalte<br />
mit denselben Referenten wie bei unseren<br />
Vor-Ort-Seminaren«, betont Thomas Marx,<br />
Leiter der BeckAkademie Seminare. Auch<br />
die umfangreichen Seminarunterlagen gibt<br />
es in digalter Form weiterhin, ebenso wie<br />
die Möglichkeit zum interaktiven Austausch<br />
mit Referenten und anderen Teilnehmern.<br />
Realisiert werden die interaktiven Online-<br />
Schulungen über die Software MS Teams.<br />
Ein klassischer Webinartag dauert von<br />
9:30 Uhr bis 15:00 Uhr, inkl. 30 Minuten Pause.<br />
Einen Zertifikatsnachweis nach § 15 Abs. 2 FAO<br />
gibt es am Ende ebenfalls. »Vom Kurzweb<br />
i nar mit zweieinhalb Stunden bis zum<br />
dreitägigen Lehrgang haben wir bereits alle<br />
Varianten erfolgreich durchgeführt«, berichtet<br />
Thomas Marx. Sollte es die Situation<br />
zulassen, wird die BeckAkademie Seminare<br />
im September zu Präsenzveranstaltungen<br />
zurückkehren. Aber schon jetzt steht fest:<br />
»Die Live-Webinare wird es aufgrund des<br />
großartigen Teilnehmerfeedbacks auch<br />
weiter hingeben«, so Marx.<br />
Mehr unter<br />
www.beck-seminare.de/live-webinare<br />
17
Warum wir beim<br />
THEMA GELD<br />
nicht rational sind<br />
18
atgeber<br />
Sobald Geld ins Spiel kommt, verändern sich unser Denken, unsere Gefühle, unser Handeln. Geld macht fast alles<br />
vergleichbar und berechenbar. Das erleichtert Austausch und Kooperation, lässt uns kühl kalkulieren und rational<br />
handeln. Doch sind wir längst nicht so vernünftig, wie vielfach unterstellt wird und wir vielleicht selbst glauben.<br />
Da auch Juristen in vielfältiger Form mit Finanzen zu tun haben, ist es hilfreich, über die Psychologie des Geldes<br />
Bescheid zu wissen.<br />
Geld ausgeben tut weh<br />
Wer bezahlt, erleidet eine Form von<br />
Schmerz. Die Psychologen sprechen vom<br />
»Bezahlschmerz«. Und das ist mehr als<br />
eine Metapher. Gehirnscans zeigen, dass<br />
ähnliche Areale aktiv sind wie beim körperlichen<br />
Schmerz. Dabei ist es weniger<br />
der Vorgang des Bezahlens selbst, der als<br />
unangenehm empfunden wird, als die Gedanken<br />
daran, dass wir unser Geld hergeben,<br />
also einen finanziellen Verlust erleiden.<br />
Folge: Je weniger wir an das Bezahlen<br />
denken, je weniger konkret es stattfindet,<br />
umso bereitwilliger geben wir Geld<br />
aus. Mit Bargeld zu bezahlen, schmerzt<br />
weit mehr als mit EC- oder Kreditkarte.<br />
Und das »kontaktlose« Bezahlen ist nicht<br />
nur bequem, sondern freut vor allem den<br />
Händler: Wir kaufen mehr und achten weniger<br />
auf den Preis. Wer sparen muss, sollte<br />
also lieber bar bezahlen.<br />
Einige Händler bieten an, heute zu<br />
kaufen und erst in ferner Zukunft zu bezahlen.<br />
Das mag im Augenblick entlastend<br />
wirken. Doch aus psychologischer Sicht ist<br />
dies die unangenehmste – und schmerzhafteste<br />
– Zahlungsweise: Wir müssen zu<br />
einem Zeitpunkt bezahlen, an dem wir<br />
die Sache geistig längst abgehakt haben.<br />
Den größten Genuss verspricht das umgekehrte<br />
Prinzip: Erst bezahlen – und dann<br />
schmerzfrei genießen.<br />
Unsere Preisvorstellungen<br />
sind beliebig<br />
Ob wir etwas für »günstig« oder »teuer«<br />
halten, hängt von vielen Faktoren ab. Und<br />
die deuten darauf hin, dass unser Urteil<br />
auf sehr schwankendem Grund steht. Wie<br />
viel etwas kosten sollte, darüber tappen<br />
wir im Dunkeln. Wir lassen uns von Kriterien<br />
leiten, die mit dem Produkt, das wir<br />
kaufen wollen, nicht viel zu tun haben.<br />
Äußerst wirksam ist der »Anker-<br />
Effekt«: Wir müssen unsere Preisvorstellung<br />
an irgendeiner Größe festmachen.<br />
Wie viel darf ein Paar Schuhe kosten?<br />
Nun, das hängt ganz davon ab, welche<br />
Preise wir wahrnehmen. Sogar wenn die<br />
betreffenden Schuhe für uns gar nicht in<br />
Frage kommen, ziehen wir den Preis als<br />
Vergleich heran. In dem Geschäft gibt es<br />
Luxus-Exemplare für 1.400 Euro. Dann<br />
kommt uns ein Paar für 350 Euro längst<br />
nicht so hochpreisig vor. Ganz anders,<br />
wenn dies der teuerste Schuh ist und im<br />
Regal Treter für 49 Euro stehen.<br />
Noch weit wirksamer sind Preisnachlässe.<br />
Der Psychologe Daniel Ariely hat sie<br />
den »Zaubertrank, der uns dumm macht«<br />
genannt. Sogar wenn wir den Mechanismus<br />
durchschauen, beeinflusst er unsere<br />
Preisvorstellung. Der »reguläre« Preis bestimmt<br />
unsere Wertschätzung. Wird er gesenkt,<br />
setzt unsere Vernunft aus. Wir vergleichen<br />
weniger und greifen unbekümmert zu.<br />
Teuer kaufen – billig verkaufen<br />
Auch an der Börse wirken psychologische<br />
Effekt nicht immer zu unserem<br />
Vorteil. Jedem ist klar, wie hier Gewinn<br />
zu erzielen ist: Aktien kaufen, wenn der<br />
Kurs niedrig ist, verkaufen, wenn er hoch<br />
ist. Doch unsere Gefühle verleiten uns, genau<br />
das Gegenteil zu tun. Wann lässt sich<br />
jemand überzeugen, in Aktien zu investieren?<br />
Wenn die Kurse im Keller sind? Wenn<br />
sich gerade Milliarden Euro Börsenwert in<br />
Nichts aufgelöst haben? Oder wenn Ihnen<br />
jemand vorrechnet, wie viel aus Ihren Ersparnissen<br />
geworden wären, hätten Sie die<br />
in Aktien angelegt – wenn die Kurse also<br />
hoch sind? Aktien sind attraktiv, wenn sie<br />
wertvoll und teuer sind. Stürzen die Kurse,<br />
steigt der Druck, zu verkaufen. Wir verspüren<br />
heftige Abneigung gegen Aktien.<br />
Es kostet sehr viel Überwindung, in dieser<br />
Situation Produkte zu erwerben, die uns<br />
gerade auf dem Papier um mehrere tausend<br />
oder zehntausend Euro ärmer gemacht<br />
haben. Auch wenn die Erfahrung<br />
dafür spricht, dass genau dies jetzt sinnvoll<br />
wäre.<br />
Nöllke<br />
Das Geld und<br />
seine Psychologie<br />
2<strong>02</strong>0. 128 Seiten. Softcover € 7,90<br />
ISBN 978-3-406-74913-1<br />
beck-shop.de/301<strong>02</strong>634<br />
19
Neues aus dem Verlag<br />
COVID19 – und Recht<br />
Zeitschrift zur Krise<br />
Die Rechtsentwicklungen überschlagen sich. Die COVID-19-Pandemie<br />
wirft laufend neue Fragen auf, zu denen das bisherige Recht<br />
selten eine endgültige Antwort bereit hält. Was liegt da näher, als<br />
die Entwicklungen mit einer neuen juristischen Fachzeitschrift zu<br />
begleiten? »COVID-19 und Recht» (COVuR) heißt die Zeitschrift, die<br />
der Verlag C.H.BECK gemeinsam mit der Sozietät Gleiss Lutz im<br />
Rekordtempo auf die Beine gestellt hat und die nun aktuellen<br />
Rechtsfragen sowie künftigen rechtlichen Entwicklungen im Zusammenhang<br />
mit der Corona-Pandemie ein passendes Forum bietet.<br />
»Von der ersten Konzeptidee bis zur konkreten Umsetzung vergingen<br />
kaum mehr als zwei Wochen«, berichtet Dr. Frank Lang, Programmbereichsleiter<br />
im Verlag C.H.BECK und redaktionell Verantwortlicher für<br />
die COVuR. »Dann stand das Zeitschriften-Layout und die 72 Seiten der<br />
ersten Ausgabe waren gefüllt.« Beachtlich, wenn man bedenkt, dass übliche<br />
Gründungen von Fachzeitschriften rund sechs Monate in Anspruch<br />
nehmen. »Diese Krise erfordert einfach schnelles Handeln«, ist Frank Lang<br />
überzeugt. Und die Nachfrage nach der seit Mai alle zwei Wochen erscheinenden<br />
Zeitschrift scheint ihm Recht zu geben.<br />
beck-shop.de/31238<strong>02</strong>1<br />
C.H.BECK-Programm bereichsleiter Dr. Frank Lang zeigt auf dem Verlagsflur die druckfrische<br />
Ausgabe der COVuR. Die grüne Farbgebung des Covers signalisiert Nähe zum<br />
Gesundheitsbereich.<br />
Auch die beiden für die COVuR gewonnenen Schriftleiter sind von<br />
dem Projekt und seiner Geschwindigkeit angetan. »Wir freuen uns<br />
außerordentlich, die juristische Fachdiskussion in diesem Bereich mit<br />
gestalten zu dürfen. Denn«, so die beiden Gleiss Lutz-Partner Dr. Marc<br />
Ruttloff und Dr. Eric Wagner, »wir befinden uns wie im Zeitraffermodus.<br />
Das gilt für Gesetzgebungsvorhaben, die durchgepeitscht werden ebenso<br />
wie für die dichte Reihe an Eilentscheidungen der Gerichte.« Um den<br />
Lesern die Themen zeitnah präsentieren zu können, besteht die Herausforderung<br />
darin, den Vorlauf für jede Ausgabe möglichst kurz zu halten.<br />
Die Zeitschrift behandelt alle in der Diskussion befindlichen Rechtsthemen<br />
wie Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Wettbewerbsrecht,<br />
Medienrecht, Arbeitsrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht,<br />
Steuerrecht usw. »Die Themen bereiten wir in Form von Aufsätzen mit<br />
praktischen Lösungen auf und bieten daneben aktuelle Kurznachrichten.<br />
Und natürlich ist die Rechtsprechung zur Corona-Krise umfassend dokumentiert«,<br />
schildert Programmbereichsleiter Lang das Konzept. Gut möglich,<br />
dass sich dies je nach Lage auch mal verändern wird. Frank Lang:<br />
»Das Virus zeigt sich flexibel. Wir sind es auch.«<br />
Die Zeitschrift COVuR erscheint als Printausgabe inklusive des Online-Moduls<br />
COVuRDirekt. Aus dem Modul heraus lassen sich fast alle im<br />
Heft genannten und verlinkten Quellen einsehen. Dazu zählt auch eine<br />
sortierte Liste mit den allermeisten anderen in Beck’schen Zeitschriften<br />
erschienenen Beiträgen zu Corona, die so ebenfalls ohne Zusatzkosten<br />
abgerufen werden können. Daneben ist die COVuR Bestandteil des neuen<br />
beck-online Datenbankmoduls »Corona und COVID-19«.<br />
20<br />
© Mathias Bruchmann
neues aus dem verlag<br />
Diese beiden Zeitschriften<br />
sind ebenfalls neu<br />
bei C.H.BECK.<br />
Mehr zur ErbbauZ unter<br />
Mehr zur beck.digitax unter<br />
beck-shop.de/3<strong>02</strong>27409<br />
beck-shop.de/30359916<br />
Die erste deutsche Fachzeitschrift<br />
für Erbbaurecht<br />
Gemeinsam mit dem Deutschen Erbbaurechtsverband<br />
gibt Beck die erste deutsche Fachzeitschrift für Erbbaurecht,<br />
kurz: ErbbauZ, heraus. Sie berichtet zweimonatlich<br />
über aktuelle Urteile und veröffentlicht Autorenbeiträge<br />
sowie Meldungen zum Thema.<br />
»Aktuell setzen viele Städte und Gemeinden das Erbbaurecht<br />
wieder verstärkt ein, weil es Bodenspekulationen<br />
verhindert und einen dauerhaften Einfluss auf die Nutzung<br />
städtischer Grundstücke sichern kann«, berichtet Dr. Matthias<br />
Nagel, Geschäftsführer des Deutschen Erbbaurechtsverbands<br />
sowie Mitherausgeber der ErbbauZ. Gleichzeitig erwartet<br />
er bis 2030 eine Welle auslaufender Erbbaurechte. »Insofern<br />
wird es in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Fällen und<br />
rechtlichen Fragen zum Thema geben«, so Nagel.<br />
Die Zeitschrift wendet sich vor allem an Erbbaurechtsgeber<br />
wie Kirchen, Stiftungen und Kommunen sowie<br />
Notare, Rechtsanwälte und Fachleute aus Wirtschaft und<br />
Wissenschaft. Eine Online-Nutzung der Zeitschrift, einschließlich<br />
Archiv, ist inklusive.<br />
Robotics, Big Data und Algorithmen<br />
im Steuerbereich<br />
Der Digitalisierung und Automatisierung in der Steuer-,<br />
Rechts- und Rechnungslegungspraxis widmet sich die Zeitschrift<br />
beck.digitax. Denn Robotics, Big Data und Algorithmen<br />
spielen eine immer größere Rolle in Wirtschaft und Finanzverwaltung.<br />
Im Blickpunkt von beck.digitax stehen neben rechtstheoretischen<br />
Fragen praxisnahe Berichterstattungen, Use<br />
Cases sowie neue Technologien und Tools. Damit schlägt<br />
die neue Fachzeitschrift die Brücke zwischen Tech und Tax.<br />
Sie erscheint zweimonatlich und richtet sich besonders an<br />
Steuerberatungs- und WP-Gesellschaften, größere Kanzleien<br />
sowie Steuerabteilungen in Unternehmen. Auf das<br />
aktuelle sowie die vorangegangenen Hefte kann über einen<br />
Online-Zugang zugegriffen werden.<br />
Corona-Blog<br />
Aktuelle Entwicklungen und Rechtsfragen zur Corona-Pandemie diskutieren<br />
Experten im Blog der beck-community (https://community.beck.<br />
de/category/corona). Dort finden Sie auch eine laufend aktualisierte<br />
und nach Rechtsgebieten geordnete Übersicht von Zeitschriftenbeiträgen,<br />
Fachbüchern und Online-Quellen aus den Verlagen C.H.BECK und<br />
Vahlen rund um das Thema Corona und Recht (https://community.<br />
beck.de/2<strong>02</strong>0/03/31/corona-fachliteratur-bei-chbeck-ein-aktuellerueberblick/).<br />
21
autoren bei der arbeit<br />
Andreas Respondek am Schreibtisch<br />
Unsere Autoren verbringen viel Zeit<br />
mit dem Verfassen ihrer Manuskripte.<br />
In dieser Rubrik zeigen sie uns ihren<br />
Arbeitsplatz sowie Dinge, die sie beim<br />
Schreiben umgeben.<br />
2<br />
6<br />
4<br />
5<br />
3<br />
1<br />
© privat<br />
Heute: Andreas Respondek, Rechtsanwalt (amerikanscher Attorney at law & Chartered Arbitrator)<br />
mit den Schwerpunkten Wirtschafts-, Gesellschaftsrecht und Arbitration. Hier am Schreibtisch in<br />
seiner Kanzlei im Stadtzentrum von Singapur in der 16. Etage direkt gegenüber dem Parlament.<br />
Veröffentlichungen bei C.H.BECK: Salger/Trittmann, Internationale Schiedsverfahren, 2019;<br />
Länderbericht: Respondek/Witte zu China, Hongkong, Malaysia, Singapur<br />
Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, 2019; Länderreport Myanmar<br />
22<br />
1. Büroraum ist in asiatischen Ballungszentren<br />
wie Singapur extrem teuer. Um Platz zu sparen,<br />
haben wir vor etwa zehn Jahren Papier<br />
weitestgehend aus unseren Büros verbannt<br />
und arbeiten seitdem ausschließlich mit elektronischen<br />
Dokumenten. Der Laptop ist meine<br />
Zentrale. Über ihn habe ich Zugang zu allen<br />
Dokumenten in unserer Kanzlei in Singapur sowie<br />
in unserem Büro in Bangkok – was sich in<br />
Corona-Zeiten als äußerst hilfreich erwiesen hat.<br />
2. Beide Radierungen an der Wand zeigen früheste<br />
Formen chinesischer Schriftzeichen.<br />
Auch wenn Englisch die Verkehrssprache<br />
in Singapur ist, so ist Chinesisch doch eine<br />
der vier Amtssprachen. Heutzutage unterscheidet<br />
man zwischen den 简 体 字 (»jian ·<br />
ti · zi«). Das sind vereinfachte chinesische<br />
Schriftzeichen, die Mao Dse-Tung in einer<br />
Rechtschreibreform durchsetzte. Sie sind in<br />
China und Singapur gebräuchlich. Und den<br />
繁 体 字 (»fan · ti · zi«). Diese Schriftzeichen<br />
werden in Taiwan, Hongkong und Malaysia<br />
verwendet.<br />
3. Aus der jadegrünen Celadon-Tasse trinke ich am<br />
liebsten grünen Tee. Der hält mich fit und ist<br />
mein ständiger Begleiter.<br />
4. Der kleine Reisekoffer steht immer griffbereit<br />
hinter meinem Schreibtisch. Aufgrund unserer<br />
beiden Büros in Singapur und Bangkok sowie<br />
meiner Tätigkeit als Schiedsrichter bin ich permanent<br />
unterwegs. Im vorigen Jahr waren es<br />
65% meiner gesamten Zeit, so dass ich praktisch<br />
jede Woche einmal im Flieger saß. Angesichts<br />
der vielen Flüge macht es sich zeitlich<br />
durchaus bemerkbar, wenn ich kein Gepäck<br />
einchecke, sondern lediglich Handgepäck<br />
mitnehme. Dabei gilt buchstäblich: Omnia<br />
mea mecum porto! – All meinen Besitz trage<br />
ich bei mir.<br />
5. Akten sind wie gesagt bei uns »exotisch«,<br />
aber in einigen meiner Schiedsverfahren bestehen<br />
Arbitrator-Kollegen bisweilen noch<br />
auf »hard copies«.<br />
6. In Deutschland tragen viele Berufskollegen<br />
noch immer Krawatten. Im subtropischen<br />
Singapur sind sie dagegen völlig »out« –<br />
außer bei den Verhandlungen der Schiedsoder<br />
Gerichtsverfahren. Im Büro empfiehlt<br />
sich für den Anwalt in Asien stattdessen ein<br />
leichtes Baumwollhemd.
vermischtes<br />
Denkanstöße für einen partizipativen Sozialismus<br />
M<br />
it »Kapital und Ideologie« legt der<br />
renommierte französische Ökonom<br />
Thomas Piketty nichts Geringeres<br />
vor als eine Globalgeschichte der sozialen<br />
Ungleichheit. Sein Buch ist der Versuch, aus<br />
der Geschichte der letzten 500 Jahre zu lernen<br />
und daraus Ideen für die Gestaltung eines »par-<br />
tizipativen Sozialismus des 21. Jahrhunderts«<br />
zu gewinnen. Mit mehr als 1.300 Seiten ist das<br />
neue Buch nicht nur noch umfangreicher als<br />
sein 2014 erschienenes Buch »Das Kapital im<br />
21. Jahrhundert«, sondern es reicht auch zeitlich,<br />
geografisch und inhaltlich weit darüber<br />
hinaus. Pikettys zentrale These basiert auf der<br />
Feststellung, dass Märkte und Profite nicht<br />
naturgegeben, sondern von Menschen gemacht<br />
und definiert sind, d. h. Ungleichheit ist immer<br />
eine soziale und politische Konstruktion. Sie ist<br />
durch gesellschaftliche und politische Maßnahmen<br />
veränderbar, also reduzierbar. Eine Verkleinerung<br />
ist Thomas Pikettys politisches Anliegen.<br />
Der Autor stützt seine Analyse auf überwältigendes<br />
Quellen- und Zahlenmaterial. Er<br />
untersucht die ungleiche Vermögens- und Einkommensverteilung,<br />
die ungleichen Zugangsmöglichkeiten<br />
zu Bildung und Gesundheit, die<br />
ungleichen Partizipationschancen in Politik<br />
und Gesellschaft, und er leitet daraus einen<br />
Forderungskatalog ab, die sogenannten »Elemente<br />
eines partizipativen Sozialismus für das<br />
21. Jahrhundert«. Darin schlägt Piketty neben<br />
mehr Mitbestimmung durch Angestellte in Unternehmen<br />
u. a. eine progressive Einkommensteuer<br />
vor. Aus dieser Einkommensteuer könnte<br />
eine Vermögensgrundausstattung in Höhe von<br />
120.000 Euro für jeden Bürger ab dem 25. Lebensjahr<br />
finanziert werden. Mit dieser Grundausstattung<br />
könnten sich die Machtverhältnisse<br />
ändern. Um mit der französischen Ökonomin<br />
und Nobelpreisträgerin Ester Duflo zu sprechen:<br />
Thomas Piketty führt uns vor Augen, dass es an<br />
uns ist, Geschichte zu schreiben.<br />
Piketty<br />
Kapital und Ideologie<br />
Aus dem Französischen übersetzt von André<br />
Hansen, Enrico Heinemann, Stefan Lorenzer,<br />
Ursel Schäfer und Nastasja Dresler<br />
2<strong>02</strong>0. 1312 Seiten.<br />
Hardcover € 39,95 / E-Book € 30,99<br />
ISBN 978-3-406-74571-3<br />
beck-shop.de/27786451<br />
G • e • w • i • n • n • s • p • i • e • l<br />
Wie hat sich der<br />
Bundestag in der<br />
Corona-Krise beholfen?<br />
Gewinnen Sie eines von<br />
fünf Sachbüchern Kersten/<br />
Rixen »Der Verfassungsstaat<br />
in der Corona-Krise«.<br />
Die Lösung einfach per Mail an<br />
beck extra@beck.de, Stichwort »Gewinnspiel«,<br />
schicken. Oder per Post an<br />
Verlag C.H.BECK oHG, Redaktion Beckextra,<br />
Wilhelmstaße 9, 80801 München senden.<br />
Einsendeschluss ist der 15. August 2<strong>02</strong>0.<br />
Gewinnen Sie eines von fünf Sachbüchern Kersten/<br />
Rixen »Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise«.<br />
Antwort<br />
Herzlichen<br />
Glückwunsch!<br />
Wir gratulieren den Gewinnern unseres<br />
Gewinnspiels aus Heft 01/2<strong>02</strong>0.*<br />
Den Ratgeber »Schlaf als Erfolgsfaktor<br />
für Fach- und Führungskräfte« von Klaus<br />
Kampmann haben die zehn glücklichen<br />
Gewinner bereits erhalten, darunter<br />
Rechtsanwalt Winfried Kram aus Fulda<br />
und Andreas Quintern aus Kalletal, die uns<br />
freundlicherweise ein Foto geschickt haben.<br />
* Die Lösung lautete »20 Prozent«.<br />
Hinweise zum Gewinnspiel: Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt<br />
und benachrichtigt. Von der Teilnahme ausgenommen sind Mitarbeiter der Verlage C.H.BECK<br />
und Vahlen sowie deren Angehörige. Eine Barauszahlung der Gewinne ist ebenso ausgeschlossen wie<br />
der Rechtsweg. Informationen zum Datenschutz: Die Daten werden durch den Verlag C.H.BECK<br />
selbst und nicht außerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Gewinnspiel: Nach Gewinnbenachrichtigung<br />
werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Beckextra-Abo: Die Daten werden nur für<br />
die Zwecke Ihrer Bestellung bzw. der Kundenbindung verwendet und so lange aufbewahrt, wie es die<br />
gesetzlichen Vorschriften vorsehen.<br />
Sie haben das jederzeitige Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie<br />
auf Berichtigung unrichtiger Daten und auf Löschung Ihrer Daten sowie auf Einschränkung der Verarbeitung<br />
nach den Vorschriften der DS-GVO. Sie haben das Recht, formlos jederzeit der Verarbeitung<br />
mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. Sie haben das Recht der Beschwerde gegen die<br />
Datenverarbeitung bei der für den Verlag C.H.BECK zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Landesamt<br />
für Datenschutzaufsicht in Bayern. Im datenschutzrechtlichen Sinn verantwortliche Stelle: Verlag<br />
C.H.BECK, Wilhelmstr. 9, 80801 München; der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter datenschutzbeauftragter@beck.de.<br />
23
Dreimal jährlich<br />
Wissenswertes<br />
Kundenmagazin des Verlages C.H.BECK · Erscheint dreimal im Jahr · N o <strong>02</strong>.20<br />
• direkt aus Ihrem Fachverlag<br />
• speziell für Juristen<br />
• frisch auf Ihren Schreibtisch<br />
Beckextra<br />
Das<br />
Magazin<br />
Hintergründe:<br />
z. B. zu Produkten und den Machern dahinter.<br />
Informationen:<br />
z. B. zu Gesetzesvorhaben, Veranstaltungen,<br />
oder wo Sie unser Verlagsteam persönlich<br />
treffen können.<br />
Trends:<br />
z. B. hilfreiche Apps, Neues aus dem www<br />
oder wichtige Blogs.<br />
KOSTENFREI<br />
BESTELLEN<br />
Aus dem<br />
Schilderwald<br />
>> Novelle der Straßenverkehrsordnung<br />
Verfassungsstaat und Corona-Krise<br />
Interview mit Prof. Dr. Jens Kersten und Prof. Dr. Stephan Rixen<br />
beck-aktuell<br />
>> das neue<br />
Nachrichtenportal<br />
für Juristen<br />
Beckextra Das Magazin<br />
7. Jahrgang. 2<strong>02</strong>0.<br />
24 Seiten.<br />
Erscheint dreimal jährlich<br />
Neu im Juli 2<strong>02</strong>0<br />
beck-shop.de/31642004<br />
Thema Geld<br />
>> und seine<br />
Psychologie<br />
Angebotsstand: 07. Juli 2<strong>02</strong>0<br />
Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstraße 9, 80801 München · Amtsgericht München HRA 48045<br />
P95<strong>02</strong><strong>02</strong>0<strong>02</strong><br />
BESTELL-FAX-COUPON Fax +49 89 38189-358 oder schnell im Internet: beck-shop.de<br />
Firmenanschrift<br />
Name/Vorname<br />
Firma/Kanzlei<br />
Straße<br />
Privatadresse<br />
Ja, ich möchte kostenlos abonnieren:<br />
Beckextra Das Magazin<br />
7. Jahrgang. 2<strong>02</strong>0.<br />
Erscheint dreimal jährlich.<br />
€ 0,00 + VK € 0,00<br />
Abbestellung jederzeit möglich.<br />
PLZ/Ort<br />
Mail/Kundennummer<br />
VERLAG C.H.BECK · 80791 München<br />
Telefon: +49 89 38189-750 · Fax: +49 89 38189-358 · Mail: kundenservice@beck.de<br />
Siehe Datenschutzinfo auf der Vorderseite