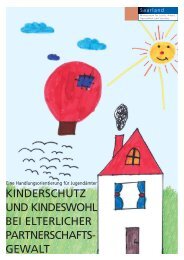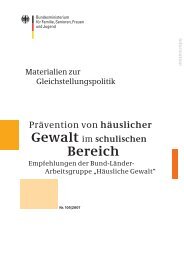Arbeitsergebnisse - BAG-Täterarbeit Häusliche Gewalt
Arbeitsergebnisse - BAG-Täterarbeit Häusliche Gewalt
Arbeitsergebnisse - BAG-Täterarbeit Häusliche Gewalt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dokumentation<br />
des<br />
2. Bundesfachaustausch der<br />
Einrichtungen der<br />
Frauenunterstützung und der<br />
<strong>Täterarbeit</strong> <strong>Häusliche</strong> <strong>Gewalt</strong><br />
21. September – 23. September 2011<br />
in Köln-Deutz
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis Seite 2<br />
bff-Grußwort zur <strong>BAG</strong> TäHG/bff/FHK-Vernetzungstagung Seite 3<br />
Lydia Sandrock; Beratungsstelle für Frauen und Mädchen Potsdam<br />
Kooperation von Frauenunterstützungseinrichtung und Seite 4 – 26<br />
<strong>Täterarbeit</strong> am Beispiel der Interventionsstelle Wien<br />
und der Männerberatung Wien<br />
Rosa Logar – Homeyra Adjudan-Garakani; Interventionsstelle Wien<br />
Dr. Heinrich Kraus; Männerberatung Wien<br />
Darstellung der Arbeitsweisen der einzelnen Bereiche und Seite 27 – 60<br />
Kooperationserfahrungen zwischen Frauenunterstützung und<br />
<strong>Täterarbeit</strong> HG<br />
Wiltrund Evers; Frauenberatung Bottrop Seite 27 – 35<br />
Birgit Gaile; AWO Frauenhaus Augsburg Seite 36 – 43<br />
Kay Wegner; Beratungsstelle im Packhaus Kiel Seite 44 – 55<br />
Birgit Schünemann-Homburg; Frauenberatung Eschwege Seite 56 – 60<br />
Christoph Lyding; <strong>Täterarbeit</strong> Eschwege<br />
Workshop-Ergebnisse Seite 61 - 77<br />
Workshop 1 Seite 61 – 64<br />
Workshop 2 Seite 65 – 66<br />
Workshop 3 Seite 67 – 68<br />
Workshop 4 Seite 69<br />
Workshop 5 Seite 70 – 77<br />
Ergebnisprotokoll vom 23.09.2011 Seite 78 - 82<br />
Workshop 1 bis 5 und Abschlussplenum<br />
2
ff Grußwort zur <strong>BAG</strong> TäHG/bff/FHK-Vernetzungstagung, 21.09.2011, Köln<br />
Lydia Sandrock<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
ich begrüße Sie heute als Verbandsrätin des Bundesverbands für Frauenberatungsstellen<br />
und Frauennotrufe recht herzlich zur zweiten gemeinsamen Tagung mit der <strong>BAG</strong> TäHG<br />
und der Frauenhauskoordinierung. Wir freuen uns außerordentlich, auch diesmal wieder<br />
an der inhaltlichen Ausgestaltung der Tagung beteiligt zu sein. Die Tagung war Ende Juli<br />
schon ausgebucht, das zeigt meines Erachtens sehr deutlich, wie wichtig uns allen das<br />
Thema der Zusammenarbeit ist.<br />
Im Bundesverband für Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe sind inzwischen über<br />
150 Fachberatungsstellen aktiv. Auf der Bundesebene hat sich schon seit vielen Jahren<br />
eine enge Zusammenarbeit zwischen der <strong>BAG</strong> TäHG und dem bff etabliert. Bei Fragen zu<br />
Standards in der <strong>Täterarbeit</strong>, zur Sicherheit der Frauen und inzwischen auch zu Standards<br />
in der Zusammenarbeit gibt es einen regen Austausch. Aber wie sieht es vor Ort aus?<br />
Wissen wir überhaupt voneinander? Wie arbeitet die jeweils andere Seite? Wie viel<br />
Ressourcen stehen für die Zusammenarbeit zur Verfügung? Was sind die<br />
Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit? Was erwarten wir von einander? Gibt es<br />
bereits eine Zusammenarbeit? Wie sieht die aus? Wo ist sie hilfreich, wo schwierig? Wo<br />
haben wir konträre Standpunkte? Wo können wir im Einzelfall gemeinsam handeln, um<br />
Frau und Kinder vor weiterer <strong>Gewalt</strong> zu schützen? Können wir gemeinsame Perspektiven<br />
entwickeln, um auch in der Öffentlichkeit gemeinsame Standpunkte gegen häusliche<br />
<strong>Gewalt</strong> zu vertreten?<br />
Dies alles und mehr wollen wir uns auf dieser Tagung erarbeiten.<br />
Fest steht, dass jede Seite eine ausgesprochen sinnvolle Arbeit gegen häusliche <strong>Gewalt</strong><br />
und zum Schutz von Frauen und Kindern leistet. Meines Erachtens ist die<br />
Zusammenarbeit zwischen <strong>Täterarbeit</strong>sstellen und Frauenschutzeinrichtungen meist<br />
sinnvoller und wirkungsvoller als jede von Gerichten oder Jugendämtern verordnete<br />
Mediation und auch langfristig wirksamer als der Täter-Opfer-Ausgleich. Denn aus der<br />
bisherigen Zusammenarbeit habe ich den Eindruck, dass wir eines gemeinsam haben: wir<br />
hinterfragen die gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen für Männer und Frauen, die es<br />
immer noch gibt und die erheblich zur Entstehung und Perpetuierung häuslicher <strong>Gewalt</strong><br />
beitragen. Und das haben wir allen anderen Ansätzen voraus. Wir arbeiten nicht nur am<br />
Einzelfall, wir wollen gesellschaftliches Umdenken bewirken.<br />
Daher freue ich mich, dass wir heute erneut zusammen gekommen sind, um unsere<br />
Zusammenarbeit weiter auszubauen und zu etablieren. Ich wünsche uns allen ein frohes<br />
Schaffen und konstruktives Miteinander.<br />
3
Workshop 1 – <strong>Arbeitsergebnisse</strong><br />
Parteilichkeit des Frauenunterstützungssystems versus Parteilichkeit der <strong>Täterarbeit</strong><br />
Lydia Sandrock, Frauenberatung Potsdam und Thomas Arend, BZFG Berlin<br />
Was ist Parteilichkeit? Welche unterschiedlichen oder sogar konträren<br />
Einschätzungen gibt es von TAEs und FUEs dazu?<br />
In den vorbereiteten Thesen zur Parteilichkeit gab es überraschende Gemeinsamkeiten in<br />
der Zustimmung oder Ablehnung der jeweiligen Thesen.<br />
Hohe, zustimmende Übereinstimmung hatten:<br />
Parteilichkeit bedeutet für mich nicht, dass ich alles gut finden muss oder alles<br />
glaube, was mir mein Gegenüber erzählt.<br />
Meine Parteilichkeit besteht darin, dass die <strong>Gewalt</strong> zwischen den Geschlechtern<br />
beendet wird.<br />
Parteilichkeit in der Arbeit bedeutet für mich, die gesellschaftlichen<br />
Rollenzuschreibungen zu reflektieren und zu hinterfragen und meinem Gegenüber<br />
darüber neue Handlungsmöglichkeiten jenseits der Erwartungen und Klischees zu<br />
ermöglichen.<br />
Parteilichkeit kann für mich auch heißen, mein Gegenüber mit seinen/ihren<br />
Verhaltensweisen zu konfrontieren, die für die Person selbst oder für andere<br />
schädlich sind.<br />
Weitgehender Konsens:<br />
Parteilichkeit in der <strong>Täterarbeit</strong> kann nur bedeuten, in der Arbeit mit dem Gefährder<br />
den höchstmöglichen Schutz für die betroffene Frau zu erwirken.<br />
Insofern ist das keine Parallele zum feministischen, politisch geprägten Begriff der<br />
Parteilichkeit oder sogar im Gegensatz zu dem Parteilichkeitsbegriff in der Männer- und<br />
Jungenarbeit.<br />
61
Es wurde deutlich, dass die regionalen Unterschiede enorm sind und vor Ort in der<br />
Kooperation Berücksichtigung finden müssen, z.B.:<br />
- In manchen Ländern bekommen die TAEs die vollständigen Justiz-Akten mit den<br />
Aussagen des Gefährders und der betroffenen Frau, sowie beider Telefonnummer<br />
und Adressen. Dies ist in anderen Ländern undenkbar.<br />
- Die FUEs bekommen in manchen Ländern ohne Einwilligung der Frau die<br />
polizeilichen Faxe, in anderen nur mit Einwilligung.<br />
- Die Finanzierungen sind komplett unterschiedlich.<br />
- Die TAEs sind völlig unterschiedlich von Justiz und Ämtern eingebunden<br />
- In einigen Ländern sind die TAEs in den Interventionsstellen dabei.<br />
- In einigen Ländern sind die Interventionsstellen die traditionellen<br />
Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern, in denen keine <strong>Täterarbeit</strong> stattfinden<br />
kann.<br />
Fazit: Es besteht ein noch erheblicher Bedarf an gemeinsamer Kommunikation und<br />
Information über die spezifischen Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten vor Ort,<br />
um eine sinnvolle Kooperation zu entwickeln.<br />
Von einigen FUEs wurden Standards wie sie die <strong>BAG</strong> TäHG hat, benannt, um eine<br />
vertrauensvolle Kooperation zu gewährleisten.<br />
Sinnvoll ist, möglichst früh gemeinsame Konzepte zu erarbeiten.<br />
Im Laufe der Diskussion wurde deutlich, dass es eine unerwartet hohe Einschätzung der<br />
Teilnehmenden über die Notwendigkeit einer gut funktionierenden Kooperation gibt. Das<br />
mündete in der Erkenntnis, dass wir einander die besten Verbündeten sind, um den<br />
höchstmöglichen Schutz der Frauen und Kinder vor weiterer <strong>Gewalt</strong> zu gewährleisten.<br />
62
Workshop 2 – <strong>Arbeitsergebnisse</strong><br />
Fragen der Sicherheit<br />
Kornelia Krieger, Frauenberatung Osnabrück und W.A.V.E.-Projekt "Protect" (bff) und<br />
Ute Rösemann, W.A.V.E.-Projekt "Protect"<br />
Im Plenum:<br />
INPUTS: WAVE Projekte PROTECT I & II, Definitionen (Hochrisiko,<br />
Sicherheitsmanagement etc.)<br />
In 4 Kleingruppen:<br />
Risikoeinschätzung und Herausarbeitung von Risikofaktoren anhand eines Fallbeispiels:<br />
Alle 4 Kleingruppen kamen zu dem Ergebnis, dass es sich in dem Beispiel um einen<br />
Hochrisikofall handele.<br />
Im Plenum:<br />
Risikofaktoren wurden aufgelistet und ergänzt (Flipchart)<br />
INPUT: Überblick der Ergebnisse zur Gefährdungseinschätzungen in der Forschung<br />
Kurze Vorstellung von Danger Assessment Instrument (Campbell) und SARA<br />
– Spousal Abuse Risk Assessment)<br />
Diskussion (intensiv) über Nutzen und Gefahren bei der Anwendung von Instrumenten<br />
In 4 Kleingruppen:<br />
Erarbeitung von Kooperation:<br />
„Instrumente“:<br />
• Fachabteilungen für <strong>Häusliche</strong> <strong>Gewalt</strong> bei Familien – und Strafgericht (Bsp.<br />
Betreuungsrichter in NRW)<br />
• Geschulte Polizeieinheit , die unmittelbar am Tatort überprüft anhand von Indizien,<br />
ob Hochrisiko ja oder nein<br />
• Institutionalisierter Fachaustausch<br />
o Fallkonferenz mit<br />
� Staatsanwaltschaft<br />
� Straf- und Familiengericht<br />
� Polizei<br />
� Gesundheitsbereich<br />
� Jugendamt<br />
� Frauenunterstützung<br />
� <strong>Täterarbeit</strong><br />
65
Vorgehen:<br />
• Wenn durch Polizei Hochrisiko bejaht wird: Untersuchungshaft oder Psychiatrie für<br />
Täter<br />
• Wenn nein und HR durch andere festgestellt, dann sofort zeitnah Fallkonferenz<br />
• In allen Fällen: Info innerhalb von 24 Std. an FU und TÄE<br />
• FU und TÄE arbeiten pro-aktiv<br />
• Automatismus bei Infoaustausch zwischen TÄE und FU<br />
FALLKONFERENZ ist ein Fachaustausch mit:<br />
• Gemeinsamer Zielsetzung<br />
o Keine neuerliche <strong>Gewalt</strong><br />
o Sicherheit für Frau und Kinder<br />
• Gemeinsame Definition von Hochrisikofällen<br />
• Spezifische Instrumente sind bekannt und werden akzeptiert<br />
• Gegenseitige Akzeptanz bei der Einschätzung von HR<br />
• Abgestimmte Handlungsabläufe<br />
Täterorientierte Intervention:<br />
Entsprechend dem Täterprofil müssen<br />
• Maßnahmen ergriffen werden (strafrechtl. Rahmen und Gewährleistung)<br />
• Inhaltliche Rückmeldung an Fallkonferenz bei Zuweisung, ob noch immer HR<br />
besteht<br />
• Risikomanagement stattfinden<br />
Opferorientierte Intervention:<br />
Selbstbestimmung, Schutz der Opfer vor Instrumentalisierung<br />
WEITERE VISIONEN / IDEEN:<br />
• In HR-Fällen:<br />
• „freiwilliges“ Begeben des Täters in eine stationäre Einrichtung zur <strong>Täterarbeit</strong> statt<br />
U-Haft<br />
• Geschulte Fachkräfte in allen Schnittstellen um zeitnah und angemessen auf HR-<br />
Fälle reagieren zu können<br />
• Elektronische Fußfessel<br />
66
Workshop 3 – <strong>Arbeitsergebnisse</strong><br />
Informationsaustausch zwischen Frauenunterstützung und <strong>Täterarbeit</strong><br />
Sigurd Hainbach, MIM München und Hedwig Blümel-Tilli, Frauenhilfe München<br />
Einführungsinfos – Wie sollte Kooperation sein?<br />
- Zeit, sich kennenzulernen<br />
- Infos über unsere berufliche Hintergründe und Ansätze notwendig geben und<br />
hinterfragen<br />
- Rechtliche GL: von Schweigepflicht entbunden sein<br />
- Struktur des Infoaustausches<br />
• Anonymisierte und individuelle/konkrete Fallberatung (Dynamiken, Rollensicht,<br />
Denkweise, Blick usw. des jeweiligen Klientels darstellen)<br />
• gemeinsame Supervision über Fallarbeit und neuralgische Punkte<br />
• gegenseitige Infos über Netzwerkarbeit, Finanzen, politische regionale Bezüge<br />
- gemeinsames Auftreten bei der Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Neugier, Offenheit, gegenseitiges kritisches Hinterfragen + pragmatisches<br />
Zusammenarbeiten<br />
- Regeln/Struktur des Austausches und Kultur des Abgleichs, der Zusammenarbeit<br />
entwickeln<br />
- Infos über Sichtweise des Klientels auf „andere Beratersicht“<br />
- Formen des Austausches: Mail, Fax, Telefonate, persönliche Gespräche, Berichte<br />
Fragen:<br />
• Wie kann Gratwanderung „Schweigepflicht entbinden“ und Vertrauensaufbau zu<br />
Klienten gelingen?<br />
• Wie kommt es zum „Opferkontakt“?<br />
• Was ist hilfreich, was sollten KollegInnen in der Zusammenarbeit mitbringen?<br />
• Was machen wir mit „Infos mit Vorbehalt“, unbeabsichtigte Infos?<br />
• Was muten wir dem Opfer in der Fülle der kontaktaufnehmenden Einrichtungen zu?<br />
• Wie kann man zeitnahe Interventionen für Opfer und Täter „einfädeln“?<br />
Besprochene Themen:<br />
• Wer übernimmt wie die Information an die Frau?<br />
• Wie arbeiten wir zusammen/ wie sieht die Kooperation aus?<br />
• Was wäre für einen Kooperationsaustausch/ Informationsaustausch wichtig?<br />
(Bräuchte es Standards zur Kooperation dazu? Oder sollten die regionalen<br />
Gegebenheiten beachten?) � Konzept erarbeiten<br />
• Zusammenarbeit auf unterschiedliche Ebenen (Fall, Kooperation)?<br />
• Welche Informationen geben wir untereinander weiter?<br />
67
Mögliche Unterarbeitsgruppenthemen:<br />
+ Struktur zum Informationsaustausch<br />
+ Stolpersteine<br />
+ Infoaustausch vor dem Hintergrund von Schutz und Sicherheit von Frauen und<br />
Kindern<br />
Fragen/ Wünsche aus dem Plenum:<br />
• gemeinsames Konzept zur <strong>Täterarbeit</strong> und zur Kooperation<br />
• fehlende Angebote für spezielle Tätergruppen, MigrantInnen<br />
• Welche Art von Information / Kooperation dient dem Opferschutz?<br />
• Wie soll die Struktur, die Ebenen vom Austausch aussehen?<br />
• Wohin wollen wir, was nehmen wir als Zieldefinition?<br />
• Risikoeinschätzung<br />
• Kooperation zur Maximierung des Schutzes von Frauen und Kinder<br />
• Auf Ortsebene Austausch zu 1. Was macht wer? 2. Was wäre einander hilfreich? 3.<br />
Welche Themen sollten wir beachten? 4. Welche Wünsche haben wir aneinander<br />
und bei der Verbesserung des Hilfesystems?<br />
• Wie kann fallbezogen ein Informationsaustausch aussehen?<br />
• Datenschutz zum Austausch<br />
• Gemeinsame Projekte (z.B. Rosenstraße)<br />
• Was hat uns denn (bisher) daran gehindert, uns näher kennenzulernen, zu<br />
kooperieren, zu informieren…?<br />
• Arbeit am Runden Tisch, in Arbeitskreisen immer noch sehr wichtig<br />
• Was gönnen wir uns dafür? Zeit zum Kennenlernen, Supervision, gemeinsame<br />
Supervision, Zeit und Energie nehmen, Atmosphäre<br />
• Gemeinsames Auftreten in der Öffentlichkeit (zum Erreichen der Ziele bei JA,<br />
Gerichten usw.)<br />
Was sind Voraussetzungen, um in Kooperation zu treten, wofür bin ich selbst<br />
bereit?<br />
- Auseinandersetzung mit sich selbst, was will ich denn eigentlich selbst?<br />
- Auseinandersetzung mit Vorurteilen, eigenen Haltungen<br />
- Erwartungen an die anderen formulieren und diskutieren<br />
- Respektvoller Umgang miteinander<br />
- Glaubenssätze hinterfragen<br />
- Offener Umgang<br />
Was sind strukturelle Voraussetzungen, um in Kooperation zu treten?<br />
- keine Verteilungskämpfe<br />
- zeitliche und finanzielle Ressourcen<br />
- Einrichtungen müssen vorhanden sein<br />
- Gemeinsame Haltung<br />
- Gemeinsame Zielerklärung<br />
- Gemeinsames Konzept mit Verbindlichkeiten (geklärte Abläufe)<br />
68
Workshop 4 – <strong>Arbeitsergebnisse</strong><br />
Umgang mit Konflikten in der Kooperation zwischen Frauenunterstützung und <strong>Täterarbeit</strong><br />
Kay Wegner, Packhaus Kiel und Inge Ruge, Frauen helfen Frauen e.V. - Marburg<br />
benannte Konflikte:<br />
• Einrichtungen werden gegeneinander ausgespielt durch unterschiedliche Aussagen<br />
an unterschiedlicher Stelle<br />
• Parteilichkeit versus systemische Sichtweise<br />
• Interessen der Frau werden gegenüber Kinderschutz hinten angestellt<br />
• nicht Konflikt, aber Problem: keine ritualisierte Kooperation<br />
• Paargespräche (Wem dienen Paargespräche? Was ist ein angemessenes Setting/<br />
eine angemessene Indikation für Paargespräche?)<br />
• Konkurrenz um finanzielle Ressourcen<br />
• Berührungsängste weshalb? (mangelndes Vertrauen, Befürchtungen?)<br />
• fehlendes gemeinsames Verständnis der Ursachen häuslicher <strong>Gewalt</strong>?<br />
• Haltung der <strong>Täterarbeit</strong> (Service für die zuweisende Stelle vs. Schutz der Frau)<br />
• Inhaltliche Bevormundung<br />
• unterschiedliche „Aufträge“ unterschiedlicher Kooperationspartner, wobei<br />
jeder einzelne sich für den eigentlich befugen Auftraggeber hält<br />
Berührungsängste überwinden:<br />
Befürchtungen auf Seiten der Fraueneinrichtungen:<br />
• Sorge, dass Frauen instrumentalisiert zu werden<br />
• Individualität der Frau droht, verloren zu gehen angesichts einer Sichtweise, die<br />
sich an Familie/ Partnerschaft… orientiert<br />
• <strong>Täterarbeit</strong> auf Kosten von Arbeit mit Frauen (Finanzen, Mehrarbeit, Zeit, öffentliche<br />
Wahrnehmung…)<br />
• <strong>Täterarbeit</strong> auf Kosten der Frau (Verantwortlichkeit für seine Teilnahme?!)<br />
• Sorge, dass <strong>Täterarbeit</strong> letztlich doch auf Kosten des Opferschutzes geht<br />
• Sorge, in den eigenen Reihen in „geschlechterpolitische oder ideologische<br />
Fettnäpfchen“ zu treten<br />
Befürchtungen auf Seiten der <strong>Täterarbeit</strong>seinrichtungen<br />
• Sorge, nicht als Opferschutz sondern schlimmstenfalls als gefährdend<br />
wahrgenommen zu werden<br />
• Sorge als „Tätersympathisant“ oder „Verräterin“ wahrgenommen zu werden<br />
• Sorge als nicht professionell wahrgenommen zu werden<br />
• nicht genug kooperieren zu können bzw. zu „dürfen“<br />
• Sorge in „geschlechterpolitische Fettnäpfchen“ zu treten – sowohl in den eigenen<br />
Reihen als auch gegenüber den Frauenunterstützungseinrichtungen<br />
69
Workshop 5 – <strong>Arbeitsergebnisse</strong><br />
Vernetzung im Jahr 2020<br />
Steffen Burger, <strong>Gewalt</strong>schutzzentrum Hamburg und Dr. Esther Lehnert, LARA Berlin (bff)<br />
Ablauf Workshop „Kooperation 2030“, 1.9.2011<br />
Brainstorming - Ziele für den Wokshop<br />
- Viele sollen partizipieren<br />
- Respektvolle Atmosphäre: zuhören, ausreden lassen, positive Bestärkungen<br />
- Keine Denkverbote: alle dürfen sagen was Ihnen im Kopf schwebt<br />
- Offenheit für das Thema Kooperation<br />
- Bereitschaft über Tellerränder zu denken<br />
- Perspektivenwechsel möglich<br />
- Visionen entwickeln<br />
- Anregung zu konkreten Handlungsschritten<br />
- Den Mut/ die Bereitschaft aus dem „Sumpf herauszublicken“ ,uns aus bestehenden<br />
Denk- und Erfahrungsstrukturen zu lösen.<br />
Ablauf<br />
1) Einführung<br />
Kurzvorstellung Plenum<br />
Reflexion: wozu bin ich hier, was wünsch ich mir von diesem Workshop?<br />
Darstellung des geplanten Ablaufs und unserer Workshop-Idee<br />
2) Vergangenheit / Gegenwart<br />
Prägnante Daten auf Karten schreiben und auf Zeitstrahl anbringen<br />
Thema:<br />
- Verhältnisse, Diskurse, Projekte, Aktionen<br />
- Im Bereich FUE, Anti-<strong>Gewalt</strong>-Bereich, Männerprojekte, Umgang mit Tätern,<br />
Kooperationen<br />
Idee: Bewusstmachen, In den Raum-Holen von Geschichte und Gegenwart der<br />
unterschiedlichen Bewegungen.<br />
3) 2030<br />
- Wunschprojekt, ideales Kooperationsprojekt 2030<br />
- Wichtigste Aspekte von Kooperation 2030<br />
Wichtig: Ausblendung des Weges dorthin,<br />
Clusterung der Projekte<br />
Bildung von Kleingruppen anhand der Cluster: Ausarbeitung der Wunschprojekte /Aspekte<br />
Evtl. Vorstellung der Kleingruppenergebnisse<br />
Hierbei wichtig: Imagination Fachaustausch 2030, jetzt bestehende Projekte werden<br />
vorgestellt.<br />
4) Erste Schritte<br />
Erarbeitung konkreter Handlungsschritte die alle (ab Morgen) einleiten können<br />
5) Abschluss/ Auswertung / Ergebnissicherung<br />
Powerpoint-Präsentation der <strong>Arbeitsergebnisse</strong> des Workshops 5<br />
70
Ergebnisprotokoll vom 23.09.2011<br />
Workshop 1 bis 5 und Abschlussplenum<br />
Protokoll:<br />
Andrea Buskotte (Andrea.Buskotte@mj.niedersachsen.de)<br />
Gisela Best (cora@fhf-rostock.de)<br />
Übergeordnete Fragestellung<br />
Was nehmen wir mit? Was ist zu tun?<br />
Diskussionsbeiträge<br />
Workshop 1 - Parteilichkeit des Frauenunterstützungssystems versus Parteilichkeit<br />
der <strong>Täterarbeit</strong>, Lydia Sandrock, Frauenberatung Potsdam (bff) – Thomas Arend,<br />
BZFG, Berlin<br />
Parteilichkeit ist kein Konzept für die Arbeit mit Tätern:<br />
• Parteilichkeit im Kontext der Jungen-/Männerarbeit muss von <strong>Täterarbeit</strong><br />
unterschieden werden<br />
• In der <strong>Täterarbeit</strong> gibt es keine täterbezogene Parteilichkeit, auch TAE müssen<br />
parteilich für die Opfer ausgerichtet sein<br />
Parteilichkeit ist ein ungeeigneter Begriff für die Arbeit mit Tätern:<br />
� Besser geeignet ist „aktiver Opferschutz“<br />
Möglicherweise hilft der Begriff der „akzeptierenden Arbeit“ (aus der Drogenarbeit und aus<br />
der Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen) mit seiner Ausrichtung auf Akzeptanz der<br />
Person und Ablehnung / Konfrontation des gewalttätigen Verhaltens:<br />
• Der Begriff kann missverstanden werden und sollte deshalb nicht übernommen<br />
werden<br />
• Es könnte sich lohnen, ihn zu diskutieren und auszuwerten<br />
Vorschlag:<br />
Die AG Standards der <strong>BAG</strong> TAE wird gebeten, diese Frage aufzugreifen. Eine Klarstellung<br />
in den Standards ist wichtig, auch weil die Standards eine wichtige „Geschäftsgrundlage“<br />
für die Kooperation zwischen TAE und FUE sind.<br />
78
Workshop 2 - Fragen der Sicherheit Kornelia Krieger, Frauenberatung Osnabrück<br />
und W.A.V.E.-Projekt "Protect" (bff) – Ute Rösemann, W.A.V.E.-Projekt "Protect"<br />
• TAE und FUE können sich gemeinsam für die Entwicklung von High-Risk-<br />
Management einsetzen<br />
• Die Umsetzung von High-Risk-Management ist z. T. von Rahmenbedingungen auf<br />
Länderebene abhängig (Polizei, Staatsanwaltschaft): In Leipzig spielen die StA. und<br />
das LKA dabei eine wichtige, konstruktive Rolle<br />
• In Frankreich werden gute Erfahrungen mit der stationären Unterbringung von<br />
Tätern gemacht.<br />
• Für die betroffenen Frauen sind Informationen über die Entlassung von Tätern aus<br />
U-Haft wichtig. In M-V wurden / werden solche Fragen in einem regelmäßigen<br />
Austausch zwischen Justizministerium, Strafvollzug und<br />
IST/Landeskoordinierungsstelle thematisiert.<br />
• TAE hat auch mit Hochrisiko-Fällen zu tun. Ist Einzelberatung ein geeignetes<br />
Setting?<br />
Vorschläge:<br />
• TAE brauchen mehr diagnostisches Know-how für die Mitwirkung an Hochrisiko-<br />
Management. Fortbildung zu diesem Thema ist dringend erforderlich und sollte auf<br />
Bundesebene organisiert werden.<br />
• TAE brauchen mehr diagnostisches Know-how für die Mitwirkung – Fortbildung zu<br />
diesem Thema ist dringend erforderlich und sollte auf Bundesebene organisiert<br />
werden.<br />
• Es sollte eine Rückkopplung der WS-Ergebnisse in das Protect-Projekt erfolgen.<br />
Workshop 3 - Informationsaustausch zwischen Frauenunterstützung und<br />
<strong>Täterarbeit</strong><br />
Sigurd Hainbach, MIM München – Hedwig Blümel-Tilli, Frauenhilfe München<br />
• Stetige Weiterentwicklung der fallbezogenen und fallübergreifenden Kooperation<br />
zwischen Frauenunterstützung und <strong>Täterarbeit</strong>.<br />
• Wie wird die Arbeit gestaltet, wenn Frauen <strong>Täterarbeit</strong> durchführen? (Frage aus<br />
NRW) Szenario: 3 Frauen (betroffene Frau, Frauenunterstützung und eine<br />
Mitarbeiterin der <strong>Täterarbeit</strong> und ein Mann/Täter).<br />
• Frauen in der <strong>Täterarbeit</strong>: wie sieht die Kooperation mit FUE aus, wenn mehrheitlich<br />
Frauen beraten? Ist das ein NO GO Bereich? Welche Erfahrungen gibt es bisher in<br />
der Zusammenarbeit (Frauen in der TÄA und FUE)? Umgang mit Vorwürfen „Wie<br />
kannst Du als Frau denn <strong>Täterarbeit</strong> machen?“ Das Thema ist bisher noch nicht<br />
besprochen. Dieser Fragestellung sollte weiter nachgegangen werden.<br />
79
Workshop 4 - Umgang mit Konflikten in der Kooperation Zwischen<br />
Frauenunterstützung und <strong>Täterarbeit</strong>, Kay Wegner, Packhaus Kiel – Inge Ruge,<br />
Marburg<br />
• Opferschutz stellt die oberste Prämisse (Ziel) in der Kooperation zwischen<br />
Frauenunterstützung und <strong>Täterarbeit</strong> dar.<br />
• Frage von Thorsten Kruse (Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und<br />
Jugend): Sollte Kooperation zwischen Frauenunterstützung und <strong>Täterarbeit</strong> auf<br />
Druck des Zuwendungsgebers erfolgen? Zum Bsp. durch die Kopplung an<br />
finanzielle Mittel?<br />
Antworten aus dem Plenum:<br />
Wichtig ist, dass Politik „Kooperationsleistungen“ in TÄA und FUE überhaupt<br />
finanziert, das findet zu wenig statt. Politik sollte die Rahmenbedingungen<br />
vorgeben. Für die Qualität der Kooperation ist Freiwilligkeit und Übereinstimmung in<br />
den Zielen wichtiger.<br />
Zustimmung findet, dass Zuwendungsgeber prüfen sollten, ob die Standards der<br />
<strong>Täterarbeit</strong> eingehalten werden, hier wird auf die Checkliste der <strong>BAG</strong>-<strong>Täterarbeit</strong><br />
verwiesen, als Orientierungshilfe zur Überprüfung der Standards.<br />
Workshop 5 - Vernetzung im Jahr 2030 Steffen Burger, <strong>Gewalt</strong>schutzzentrum<br />
Hamburg – Dr. Esther Lehnert, LARA Berlin (bff)<br />
• Die Frage „Was nehmen wir mit? Was ist zu tun?“ wurde in Workshop 5 präzisiert:<br />
„Was mache ich am Montag (nach der Tagung) ganz konkret zur Verbesserung des<br />
<strong>Gewalt</strong>schutzes?“ „Wie kommen wir den Visionen 2030 näher?“ Die Ergebnisse<br />
sind in dem Workshop Protokoll festgehalten.<br />
80
Abschluss – Fazit aus dem Plenum und den Bundesverbänden<br />
Rückmeldungen Plenum<br />
Sachsen-Anhalt / LIKO Landesintervention und -koordination bei häuslicher <strong>Gewalt</strong> und<br />
Stalking, TÄA ist in das landesweite Netzwerk in Sachsen-Anhalt integriert. Das Thema<br />
Kooperation wird auf der kommenden Klausurtagung bearbeitet.<br />
NRW; hier steht eine Förderung von neuen TÄA-Stellen an. Das JM soll aufgefordert<br />
werden die Standards der <strong>BAG</strong> TäHG zu berücksichtigen.<br />
Niedersachsen / Männerbüro Hannover: will das Thema Kooperation mit in das HAIP -<br />
Das Hannoversche-Interventions-Programm gegen Männergewalt in der Familie (kurz<br />
HAIP) nehmen um die Fallbezogene Arbeit zu verbessern.<br />
Nordrhein-Westfalen / Männerberatung KIM Paderborn: Das Justizministerium hat in<br />
Aussicht gestellt, Projekte gegen häusliche <strong>Gewalt</strong> zu finanzieren. Ein Antrag ist u. a. von<br />
der Männerberatung Paderborn gestellt. Das JM hat eine Vorauswahl von 18 möglichen<br />
Antragsberechtigen getroffen. Männerberatung KIM Paderborn will gleich mit FUE einen<br />
Termin vereinbaren, zwecks Austauschs über die Themen der Bundestagung TÄA und<br />
FUE.<br />
Hessen / Groß Gerau / Männerberatung: mit FUE systematischer kooperieren, Kontakte<br />
zu Polizei intensivieren, Kinderschutz und Kooperation mit JA verbessern, Hessenweite<br />
Treffen der Männerberatung forcieren.<br />
NRW / FUE aus Düsseldorf: Profil der Pro-Aktiven Arbeit beleuchten, Verständnis<br />
konkretisieren. TÄA und FUE Netzwerk bilden, nicht nur fallübergreifend, auch<br />
fallbezogen.<br />
Baden-Württemberg / TÄA Tübingen: sich am Wiener Modell weiterorientieren, reiben,<br />
entwickeln, konkret mit den ISTen die Kooperation verbessern.<br />
Hessen / Marburg / Frauen helfen Frauen e.V.: es wird angeregt, das Positionspapier der<br />
Frauenhauskoordinierung e.V. zur Arbeit mit Tätern von häuslicher <strong>Gewalt</strong> zu<br />
aktualisieren.<br />
Sachsen / Leipzig / FUE: Inhalte der Tagung werden unter<br />
http://ist.vernetzungsplattform.de/startseite/ (Intranet, Vernetzungsplattform der<br />
Interventions- und Beratungsstellen im Bereich häuslicher <strong>Gewalt</strong>, die nach dem pro<br />
aktiven Beratungsansatz arbeiten) eingestellt.<br />
Mecklenburg-Vorpommern / Landeskoordinierungsstelle CORA: Es gibt derzeit nur 2<br />
Vollzeitstellen für TÄÄ im Bundesland. <strong>Täterarbeit</strong> soll sich in Zukunft an den Standards<br />
der <strong>BAG</strong>-TäHG e.V. orientieren. Materielle und personelle Voraussetzungen dafür müssen<br />
noch geschaffen werden. „Arbeitskreis Täter“ ist im Bereich der der Parlamentarischen<br />
Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt.<br />
Inhalte und Ergebnisse der Tagung werden dort und in den Landesarbeitsgemeinschaften<br />
gegen häusliche und sexualisierte <strong>Gewalt</strong> / LAG Männer – und <strong>Gewalt</strong>beratung<br />
transportiert.<br />
81
Rückmeldungen Bundesverbände<br />
BUNDESVERBAND FRAUENBERATUNGSSTELLEN UND FRAUENNOTRUFE (bff)<br />
2012 wird eine Tagung zum <strong>Gewalt</strong>schutzgesetz stattfinden, die Vorbereitungs-gruppe<br />
wird über die Inhalte der Tagung TÄA und FUE informiert, sodass das Thema Kooperation<br />
Berücksichtigung findet. www.frauen-gegen-gewalt.de<br />
Frauenhauskoordinierung e.V. wird sich im Rahmen des Werkstattgesprächs mit dem<br />
Thema <strong>Täterarbeit</strong> weiter befassen und das Positionspapier der Frauenhauskoordinierung<br />
e.V. zur Arbeit mit Tätern von häuslicher <strong>Gewalt</strong> aktualisieren. Die positive<br />
Atmosphäre der Tagung mitnehmen in die Mitgliedseinrichtungen. Rechtsanspruch (siehe<br />
Workshop 5)<br />
auf Schutz vor <strong>Gewalt</strong> weiter forcieren. Thema „Interdisziplinäres Zentrum“ (siehe<br />
Workshop 5) auf der Tagung 2012 platzieren. Auf der Homepage<br />
www.frauenhauskoordinierung.de werden die Inhalte der Tagung eingestellt.<br />
Bundesarbeitsgemeinschaft <strong>Täterarbeit</strong> <strong>Häusliche</strong> <strong>Gewalt</strong> (<strong>BAG</strong> TäHG e.V.)<br />
Bundesaustausch soll in 3 Jahren erneut stattfinden, <strong>BAG</strong> TäHG e.V. wird sich<br />
diesbezüglich an das Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wenden.<br />
In den Vorstandsitzungen werden die Themen: Diagnostik, Materialien, Instrumente,<br />
Gefährdungseinschätzung, Paarberatung bearbeitet.<br />
Transparenz und regelmäßige Kooperation zwischen FUE und TÄA sowie zwischen TÄA<br />
und TÄA soll verbessert werden.<br />
Tätertypen – <strong>BAG</strong> TäHG e.V. arbeitet dazu – auch unter der Fragestellung: was wird<br />
gebraucht im Einzelfall?<br />
Standards der <strong>BAG</strong> TäHG e.V. besser umsetzen, fordern, dass die Standards genutzt<br />
werden.<br />
KLK; Bundeskonferenz der Landeskoordinierungsstellen und Interventionsprojekte<br />
gegen häusliche <strong>Gewalt</strong>: KLK ist mit Marion Ernst, Koordinierungsstelle gegen häusliche<br />
<strong>Gewalt</strong> Ministerium der Justiz, Saarland in der „AG Standards – Fortschreibung“ vertreten.<br />
<strong>Täterarbeit</strong> ist wichtiger Bestandteil in der KLK, Weiterentwicklung der täterbezogenen<br />
Intervention. Inhalte der Bundestagung werden in der nächsten KLK Sitzung Ende<br />
November reflektiert.<br />
82