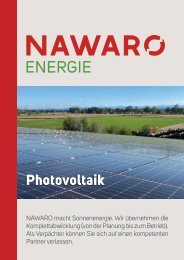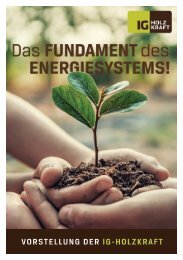HolzKraft, 04/2020
In unserer neuen Ausgabe der "HolzKraft" beschäftigen wir uns mit dem Thema "Wärme". Besonders beim Heizen gibt es in Österreich auch durchaus noch Potential hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Einen wichtigen Beitrag dazu kann die Bioenergie leisten und hier, mit Blick auf die Holzkraftwerke, vor allem die Fernwärme. Aber wie viel Fernwärme wird in Österreich eigentlich produziert und verbraucht? Aus welchen Energieträgern wird die Wärme gewonnen? Und wie hoch ist der Beitrag der Holzkraftwerke? Um diese Fragen zu beantworten, muss man sich in die Tiefen der Energiebilanzen der Statistik Austria vorwagen. Wir haben genau das getan und uns für Sie durch die Zahlen der letzten Jahre gearbeitet. Zusätzlich haben wir zum Thema biogene Wärme noch jemanden befragt, der es wirklich wissen muss: Dr. Christian Rakos, Geschäftsführer von ProPellets Austria und Präsident des Weltbiomasseverbands.
In unserer neuen Ausgabe der "HolzKraft" beschäftigen wir uns mit dem Thema "Wärme".
Besonders beim Heizen gibt es in Österreich auch durchaus noch Potential hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Einen wichtigen Beitrag dazu kann die Bioenergie leisten und hier, mit Blick auf die Holzkraftwerke, vor allem die Fernwärme.
Aber wie viel Fernwärme wird in Österreich eigentlich produziert und verbraucht? Aus welchen Energieträgern wird die Wärme gewonnen? Und wie hoch ist der Beitrag der Holzkraftwerke? Um diese Fragen zu beantworten, muss man sich in die Tiefen der Energiebilanzen der Statistik Austria vorwagen. Wir haben genau das getan und uns für Sie durch die Zahlen der letzten Jahre gearbeitet.
Zusätzlich haben wir zum Thema biogene Wärme noch jemanden befragt, der es wirklich wissen muss: Dr. Christian Rakos, Geschäftsführer von ProPellets Austria und Präsident des Weltbiomasseverbands.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>HolzKraft</strong><br />
Fernwärme aus<br />
Holzkraftwerken<br />
Der Fokus des letzten <strong>HolzKraft</strong><br />
Newsletters dieses Jahres liegt,<br />
passend zu der kalten Jahreszeit,<br />
auf dem Thema Wärme. Genauer<br />
gesagt Fernwärme, denn diese<br />
kann einen wichtigen Beitrag zur<br />
Energiewende leisten.<br />
Aus welchen Energieträgern diese<br />
Fernwärme erzeugt wird und welche<br />
Rolle die Holzkraftwerke dabei<br />
spielen, erfahren Sie in dieser Ausgabe.<br />
Einschätzungen zur<br />
Wärmewende<br />
"Die Wärmewende nimmt langsam<br />
Fahrt auf." sagt Christian Rakos,<br />
Geschäftsführer von proPellets<br />
Austria und Präsident des<br />
Weltbiomasseverbandes.<br />
Seine Überlegungen zur<br />
Wärmewende, zur Rolle von<br />
Holz als Energieträger und zur<br />
Wärmeversorgung der Zukunft<br />
lesen Sie in unserem Interview.<br />
Inhalt<br />
Vorwort von Hans-Christian Kirchmeier,<br />
Vorsitzender der IG Holzkraft<br />
........................................................... Seite 2<br />
Fernwärme aus Holzkraftwerken<br />
........................................................... Seite 2<br />
Einschätzungen zur Wärmewende<br />
........................................................... Seite 3<br />
Fröhliche Weihnachten<br />
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein<br />
frohes Weihnachtsfest und einen erfolgreichen<br />
Start ins neue Jahr!<br />
Ausgabe <strong>04</strong>/<strong>2020</strong><br />
1
Vorwort von Mag. Hans-Christian Kirchmeier, Vorsitzender des<br />
Vorstandes der IG Holzkraft<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
das Jahr <strong>2020</strong> neigt sich dem Ende zu. Das ist die letzte Ausgabe der<br />
<strong>HolzKraft</strong> für dieses außergewöhnliche Jahr. Ich weiß ja nicht, wie es<br />
Ihnen geht, aber ich zumindest habe das Gefühl, die Zeit ist verflogen.<br />
Es ist einfach unglaublich viel passiert.<br />
Wir haben in der Vorbereitung auf diese Ausgabe überlegt, welchem<br />
Thema wir uns widmen sollen. Letztendlich haben wir uns für das naheliegendste<br />
entschieden. Denn nachdem wir hier in der nördlichen<br />
Foto: IG Holzkraft/Lisa Grebe<br />
Hemisphäre angesiedelt sind, geht der bevorstehende Jahreswechsel<br />
auch immer mit dem Winter einher. Zwar werden die Winter im Durchschnitt immer milder, heizen<br />
müssen wir aber trotzdem. Besonders beim Heizen gibt es in Österreich auch durchaus noch<br />
Potential hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Einen wichtigen Beitrag dazu kann die<br />
Bioenergie leisten und hier, mit Blick auf die Holzkraftwerke, vor allem die Fernwärme.<br />
Aber wie viel Fernwärme wird in Österreich eigentlich produziert und verbraucht? Aus welchen<br />
Energieträgern wird die Wärme gewonnen? Und wie hoch ist der Beitrag der Holzkraftwerke?<br />
Um diese Fragen zu beantworten, muss man sich in die Tiefen der Energiebilanzen der Statistik<br />
Austria vorwagen. Wir haben genau das getan und uns für Sie durch die Zahlen der letzten Jahre<br />
gearbeitet.<br />
Zusätzlich haben wir zum Thema biogene Wärme noch jemanden befragt, der es wirklich wissen<br />
muss: Dr. Christian Rakos, Geschäftsführer von ProPellets Austria und Präsident des Weltbiomasseverbands.<br />
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!<br />
Fernwärme aus Holzkraftwerken<br />
Holzkraftwerke werden in der Regel als Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen betrieben. Daher sind<br />
sie häufig in Fern- oder Nahwärmenetze eingebunden. Abhängig von ihrer Leistung und ihrem<br />
Einsatzort kommen die Kraftwerke entweder zur Deckung der ganzjährigen Grundlast oder des<br />
erhöhten Wärmebedarfs im Winter zum Einsatz.<br />
Der Beitrag der Holzkraftwerke zur Fernwärmeproduktion in Österreich befindet sich seit mehreren<br />
Jahren auf einem konstanten Niveau von rund 4.000.000 Megawattstunden (MWh). Das sind<br />
in etwa 17 % der gesamten Fernwärme.<br />
Die größten Fernwärmeverbraucher in Österreich<br />
sind Privathaushalte, gefolgt vom<br />
Dienstleistungssektor und der Industrie. Insgesamt<br />
deckt die Fernwärme 13 % des Wärmebedarfs<br />
der privaten Haushalte.<br />
1<br />
FERNWÄRMEVERBRAUCH NACH<br />
SEKTOREN 2019<br />
Landwirtschaft<br />
Rund die Hälfte der Fernwärme ist in Österreich<br />
erneuerbar. Zum Einsatz kommt vorrangig Bioenergie.<br />
Industrie<br />
Dienstleistung<br />
45%<br />
Einen kleinen Anteil nehmen Geother-<br />
mie, Solarthermie und große Wärmepumpen<br />
ein. Rund ein Drittel der erneuerbaren Fernwärme<br />
stammt aus Holzkraftwerken. Die weitere<br />
Privathaushalte<br />
40%<br />
biogene Fernwärme wird hauptsächlich in Heizwerken erzeugt. Österreich verfügt mit mehr als<br />
2.000 Biomasse-Heizwerken über eine hohe Dichte an regionalen Nahwärme- und urbanen Fernwärmenetzen.<br />
Somit kommen die Vorteile der Fernwärme auch ländlichen Regionen zu Gute.<br />
1%<br />
14%<br />
2
Insgesamt machte der Wärmebedarf in<br />
Österreich mehr als die Hälfte des Gesamtenergieverbrauchs<br />
aus. Rund die<br />
Hälfte der Wärmeversorgung wird direkt<br />
aus den fossilen Energieträgern Erdgas,<br />
Öl und Kohle gewonnen. Hier besteht<br />
also noch hohes Potential zur Einsparung<br />
von Treibhausgasen.<br />
FERNWÄRMEVERBRAUCH ANTEIL DER-ENERGIETRÄGER NACH<br />
AM WÄRMEVERBRAUCH SEKTOREN 2019<br />
2019<br />
Brennbare-Abfälle<br />
Kohle Landwirtschaft<br />
Sonstige Energieträger<br />
37%<br />
Industrie<br />
45%<br />
Öl<br />
1%<br />
3% 3%<br />
14%<br />
5% 9%<br />
Gemeinsam mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz<br />
wurde am 16. September<br />
<strong>2020</strong> auch eine Novelle des Wärme- und<br />
Elektrische-Energie<br />
Dienstleistung<br />
Bioenergie Privathaushalte<br />
Gas<br />
40%<br />
Kälteleitungsausbaugesetzes in Begut-<br />
29%<br />
achtung geschickt. Dieser Entwurf sieht<br />
eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien in der Fernwärme vor. Um eine Förderung zu<br />
erhalten, müssen Fernwärmebetreiber einen Ausbaupfad zu 60 % erneuerbarer Fernwärme bis<br />
2030 nachweisen. Hier besteht auch in Zukunft noch deutliches Potential für die Holzkraftwerke.<br />
14%<br />
Interview mit DI Dr. Christian Rakos (Geschäftsführer von proPellets<br />
Austria) - Einschätzungen zur Wärmewende<br />
Wie steht es um die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Österreich?<br />
Ist die Wärmewende erfolgreich?<br />
Grundsätzlich sind wir mit einem Anteil von rund 33% erneuerbarer<br />
Energie im Wärmemarkt längst nicht soweit, wie beim Strommarkt, wo<br />
der Anteil erneuerbarer Energie ja schon bei rund 70% liegt. Ich würde<br />
aber sagen, die Wärmewende nimmt – zumindest im Raumwärmebereich<br />
- langsam Fahrt auf. In der Phase der hohen Ölpreise zwischen<br />
2006 und 2012 kam es schon zu einer Welle der Heizungsumstellungen.<br />
Leider war diese ziemlich abrupt zu Ende, als die Ölpreise wieder sanken.<br />
Es folgten einige Jahre des Stillstands, der erfreulicher Weise jetzt<br />
überwunden scheint.<br />
Foto: www.propellets.at<br />
Wir haben im letzte Jahr und auch heuer - trotz Corona - einen kräftigen Anstieg der Nachfrage<br />
nach Pelletheizungen zu verzeichnen. Dass dies trotz der niedrigen Ölpreise der Fall ist, deutet<br />
auf eine Trendwende hin. Offenbar beginnt sich doch langsam die Erkenntnis durchzusetzen,<br />
dass wir etwas gegen die Klimakatastrophe unternehmen müssen. Dazu kommt sicher auch die<br />
Angst vor dem Verbot der Ölheizung, das zwar noch nicht da ist, aber immerhin im Regierungsabkommen<br />
vereinbart wurde. Schließlich gibt es derzeit sehr hohe Förderungen und ein massiv<br />
aufgestocktes Förderbudget für die Heizungsumstellung. Auch das trägt maßgeblich zu der Bereitschaft<br />
bei umzusteigen.<br />
Noch sehr wenig tut sich der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung der Industrie. Die dort benötigten<br />
hohen Temperaturniveaus können auch nicht so einfach von erneuerbaren Energiequellen<br />
bereitgestellt werden.<br />
Welche Rolle spielt Holz als Energieträger in der Raumwärmeversorgung in Österreich?<br />
Holz ist der mit Abstand wichtigste Energieträger in der Raumwärmeversorgung. Insgesamt werden<br />
rund 37% der gesamten Raumwärme durch Holzbrennstoffe bereitgestellt – sei es in Kleinfeuerungen<br />
oder auch in Biomasse-Heizwerken. An zweiter Stelle folgt Erdgas mit 28% und an<br />
dritter Stelle Heizöl mit 18% Anteil. Solarthermie und Wärmepumpe kommen zusammen auf unter<br />
10%. Damit hat Österreich schon eine Sonderstellung in Europa. Der sehr hohe Anteil der Holzbrennstoffe<br />
am Wärmemarkt hat maßgeblich zur Entwicklung der heimischen Biomassekesselindustrie<br />
beigetragen. Diese ist heute was die Technologie und Qualität der Produkte betrifft<br />
weltweit führend.<br />
Bitte umblättern<br />
3
Fortsetzung Interview<br />
Welche großen Veränderungen erwarten uns im Bereich der Wärmeversorgung in den nächsten 10 Jahren?<br />
Es wird in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich zu einem massiven Rückgang der Nutzung von Heizöl<br />
kommen. Sehr viele Ölheizer werden auf Pellets umsteigen, weil dabei keine Umstellung der Wärmeverteilung<br />
und auch keine großen Investitionen in die Dämmung der Gebäudehülle nötig sind. Ich glaube, dass sich der<br />
inländische Pelletbedarf in den nächsten 10 Jahren verdoppeln wird – also von 1 Million Tonnen heute auf rund<br />
2 Millionen Tonnen im Jahr 2030 wachsen wird.<br />
Im Neubau spielen schon heute Wärmepumpen die dominierende Rolle. Das wird sicher auch in Zukunft so<br />
bleiben. Auch bei Gebäuden, die thermisch saniert werden, werden Wärmepumpen eine maßgebliche Rolle<br />
spielen.<br />
In den Städten wird es zu einer Verdrängung von Erdgas durch Fernwärme kommen. Erhebliche Umstellungen<br />
wird es brauchen, um die Fernwärme zu dekarbonisieren. Biomasse wird dabei sicher eine zentrale Rolle<br />
spielen, zumal zu befürchten ist, dass wir als Folge des Klimawandels enorme Mengen an Schadholz haben<br />
werden, die teilweise nur mehr energetisch genutzt werden können. Daneben könnten wir vermehrt große<br />
Solarthermie Anlagen verbunden mit Saisonspeichern sehen, ebenso Geothermie und Großwärmepumpen.<br />
Spannend wird es bei der Wärmeversorgung der Industrie. Hier könnte Biogas oder Holzgas eine Rolle spielen,<br />
wobei ich erhebliche Zweifel an den ausgewiesenen Potentialen von Biogas habe. Global gesehen wäre<br />
es sicher sinnvoll, die Stahlindustrie und andere energieintensive Grundstoffindustrien dort anzusiedeln, wo<br />
mittels Photovoltaik oder Wind große Potentiale gegeben sind um Wasserstoff billig herzustellen. Dies könnte<br />
wirtschaftlicher sein, als Wasserstoff mit großem energetischen und finanziellen Aufwand nach Europa zu<br />
transportieren. Von einer ausreichenden heimischen Produktion von Wasserstoff oder Biogas auszugehen,<br />
um die Grundstoffindustrie zu versorgen, halte ich für völlig illusionär.<br />
1Quellen:<br />
Statistik Austria, Energiebilanz Österreich 1970 bis 2019<br />
Nutzenergiekategorien Österreich 1993 bis 2019<br />
Ausblick auf die nächste Ausgabe<br />
Die nächste Ausgabe der "<strong>HolzKraft</strong>" erscheint im<br />
Februar 2021.<br />
Impressum<br />
Herausgeber: IG Holzkraft, Graben 19/5, 1010 Wien;<br />
Kontakt: Tel.: +43 1 93087-3127, Mail: office@ig-holzkraft.at; Gendering: Sämtliche<br />
personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.<br />
4