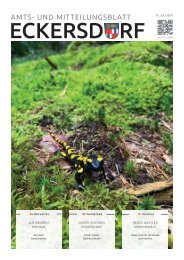2019-03-17 Bayreuther Sonntagszeitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bayreuther</strong> <strong>Sonntagszeitung</strong><br />
<strong>17</strong>. März <strong>2019</strong> 5<br />
160 Jahre die Stadt geprägt<br />
Historisches Museum: Ausstellung über Firma F.C. Bayerlein<br />
Dr. Klaus Bayerlein, Sohn des letzten Spinnereichefs Fritz Bayerlein, vor einer Schautafel mit den<br />
historischen Stationen der Firmendynastie F.C. Bayerlein, die für Bayreuth lange Zeit mit prägend<br />
war.<br />
Foto: Roland Schmidt<br />
BAYREUTH. Ein Spiegel der<br />
fränkischen Textil- und Wirtschaftsgeschichte<br />
ist die Firmenhistorie<br />
von F.C. Bayerlein.<br />
Die Geschichte des <strong>Bayreuther</strong><br />
Familienunternehmens,<br />
das über 160 Jahre die<br />
Stadt gesellschaftlich und<br />
städtebaulich mit geprägt hat,<br />
stellt den Auftakt einer neuen<br />
Ausstellungsreihe im Historischen<br />
Museum dar.<br />
Die Firmenhistorie geht bis auf<br />
das Jahr 1809 zurück. Damals<br />
ersteigerte der Pfarrersohn Johann<br />
Gotthilf Bayerlein das heutige<br />
Anwesen Maximilianstraße<br />
58 und eröffnete dort ein Geschäft<br />
für Tuche, Schnitt- und<br />
Kurzwaren, spezialisiert auf<br />
Stoffe nach der neuesten Mode.<br />
Die Lizenz für das Geschäft erhielt<br />
er „im Namen seiner Majestät,<br />
des Kaisers“, damals also<br />
Napoleon, erklärte Dr. Klaus<br />
Bayerlein, Urururenkel von Johann<br />
Gotthilf Bayerlein bei einem<br />
Rundgang durch die Ausstellung.<br />
Das Geschäft entwickelte<br />
sich gut, die Handelsbeziehungen<br />
reichten bald bis ins<br />
europäische Ausland. Seit 1826<br />
ließ Johann Gotthilf Bayerlein<br />
Merinoschafwolle aus dem<br />
Raum Erlangen von Hauswebern<br />
verarbeiten.<br />
Unter seinem Sohn Friedrich<br />
Christian (F.C.) Bayerlein<br />
wurde auch Baumwolle über<br />
Italien bezogen. Die Firma konzentrierte<br />
sich bald auf die Verarbeitung<br />
von Wolle und Baumwolle<br />
durch Hausweber, die diese<br />
Tätigkeit in der Regel neben<br />
der nicht voll zum Lebensunterhalt<br />
reichenden Landwirtschaft<br />
ausführten. Die Heimarbeiter<br />
kamen unter anderem aus<br />
Drossenfeld, Trebgast und<br />
Harsdorf. Friedrich Christian<br />
Bayerlein kaufte daher 1854<br />
das damals leer stehende Neudrossenfelder<br />
Schloss und<br />
nutzte es zunächst als Warenlager,<br />
stellte aber auch Webstühle<br />
auf und betrieb dort am Main<br />
eine Färberei.<br />
Als Bayreuth 1860 an das<br />
Eisenbahnnetz angeschlossen<br />
worden war, begann die Rückverlagerung<br />
des Unternehmens<br />
nach Bayreuth, zunächst in die<br />
Saas.<br />
Ein neues Kapitel der Firmengeschichte<br />
wurde aufge-<br />
schlagen, als 1875 eine neue<br />
Fabrik im Graben in Betrieb genommen<br />
wurde. Aus anfangs<br />
47 Beschäftigten wurden bis<br />
1894 insgesamt <strong>17</strong>2 Mitarbeiter.<br />
1894 baute Eduard Bayerlein<br />
schließlich in der Unteren<br />
Au eine neue, größere Fabrik,<br />
die sich auf Baumwollspinnerei<br />
und Zwirnerei konzentrierte. Die<br />
Weberei gab man auf.<br />
Die Fabrik wurde sukzessive<br />
weiter ausgebaut. Unter anderem<br />
kamen weitere Spinnereihochbauten<br />
und eine zusätzliche<br />
Dampfmaschine dazu. Anfang<br />
1907 waren bereits 594<br />
Personen beschäftigt, die Mehrzahl<br />
davon mit 460 Frauen. Aufgrund<br />
der vielen dort arbeitenden<br />
Frauen machte sich der<br />
Erste Weltkrieg zunächst nicht<br />
allzu stark bemerkbar, das Militär<br />
musste eingekleidet werden,<br />
was Aufträge brachte. Teile der<br />
Fabrikanlage legte man erst<br />
still, als die Rohstoff- und Kohlezufuhr<br />
geringer wurde.<br />
Umstellung von Dampfmaschinen<br />
auf Elektromotoren<br />
In den 1920er Jahren entwickelte<br />
Adolf Bayerlein die Fabrik kontinuierlich<br />
weiter. Ein wichtiger<br />
Schritt war 1927 die Umstellung<br />
vom Dampfmaschinenantrieb<br />
auf Elektromotoren an<br />
den Maschinen. Seit den 1930er-<br />
Jahren begann die Produktion<br />
von Mischgarnen mit gerissenem<br />
Leinen und Zellwolle.<br />
Auch sozial wurde für die<br />
Belegschaft viel getan. Arbeiterwohnungen<br />
wurden errichtet,<br />
schon früh eine Unterstützungskasse<br />
eingerichtet und für die<br />
Spinnereiarbeiter gab es eine<br />
eigene Kleingartenanlage. Gerade<br />
in wirtschaftlich schwierigen<br />
Zeiten konnte so manches<br />
Essbare selbst angebaut werden.<br />
1939 war mit 900 Mitarbeitern<br />
der Höhepunkt der Beschäftigung<br />
bei F.C. Bayerlein<br />
erreicht. In den insgesamt drei<br />
<strong>Bayreuther</strong> Spinnereien – neben<br />
F.C. Bayerlein gab es noch<br />
die in höchster Konkurrenz stehende<br />
Neue Spinnerei Bayreuth<br />
und die Mechanische Baumwollspinnerei<br />
– arbeiteten im<br />
Jahr des Ausbruchs des Zweiten<br />
Weltkriegs insgesamt über<br />
4.000 Menschen.<br />
Im Zweiten Weltkrieg blieb<br />
die Firma zunächst weitgehend<br />
unbeschadet. Ab 1943 nutzte<br />
das Hamburger Unternehmen<br />
AERO Lagergebäude der Spinnerei,<br />
um Getriebe und Lenksysteme<br />
für Flugzeuge und Raketen<br />
herzustellen. Dies wurde<br />
F.C. Bayerlein letztlich wohl zum<br />
Verhängnis, bei einem der großen<br />
Bombenangriffe in den letzten<br />
Kriegstagen wurde die Fabrik<br />
am 11. April 1945 zu 85 Prozent<br />
zerstört.<br />
Nach dem Krieg begann der<br />
Wiederaufbau der Firma. Kleine<br />
Teile liefen ab 1946 wieder, 1948<br />
wurden die ersten neuen Maschinen<br />
geliefert. Die Spinnerei<br />
wurde nun auf synthetische Fasern<br />
spezialisiert. So konnte ein<br />
hoher Exportanteil erzielt werden,<br />
F.C. Bayerlein wurde einer<br />
der bedeutendsten Produzenten<br />
von synthetischen Garnen<br />
in Europa. Zusätzlich wurde ein<br />
Garnhandel mit nicht selbst produzierten<br />
Garnen aufgebaut.<br />
„Die Firma war damals klein,<br />
beweglich und wir konnten mit<br />
unserer hoch motivierten Belegschaft<br />
sehr innovativ sein“, erinnerte<br />
sich Dr. Klaus Bayerlein.<br />
Die Maschinen wurden auf<br />
dem neuesten Stand gehalten,<br />
aber die Wirtschaftskrise 1967<br />
und internationale Konkurrenz<br />
brachten die deutsche Textilindustrie<br />
in eine schwierige Lage.<br />
Ende 1971 wollte die Kulmbacher<br />
Spinnerei weiter expandieren<br />
und bot eine Übernahme<br />
der Spinnerei Bayerlein mit ihrer<br />
Produktion von synthetischen<br />
Garnen als neuem Standbein<br />
an. Fritz Bayerlein und seine<br />
Söhne stimmten der Übernahme<br />
zu. Ihre Hoffnung, so die Beschäftigung<br />
für die damals vorhandenen<br />
rund 500 Mitarbeiter<br />
zu sichern, erfüllte sich aber<br />
nicht. Der Betrieb wurde 1979<br />
geschlossen, die Gebäude<br />
1980 abgerissen. Heute befinden<br />
sich auf dem Gelände die<br />
Immobilienverwaltung Bayerlein,<br />
die Agentur für Arbeit und<br />
das Arvena Kongresshotel.<br />
Die Ausstellung beinhaltet<br />
viele interessante und bislang<br />
vielfach kaum bekannte Fotos.<br />
Gegenstände und Bilder aus<br />
dem Besitz der Familie Bayerlein<br />
runden das Gezeigte ab.<br />
Die Publikumsresonanz auf die<br />
noch bis 31. März laufende Ausstellung<br />
ist bisher durchweg<br />
positiv.<br />
rs<br />
Kanalstr.<br />
Kath.<br />
Schlosskirche<br />
Bayreuth<br />
Ludwigstr.<br />
Opernstr.<br />
Hofgarten<br />
Wölfelstr.<br />
Badstr.<br />
Bayreuth<br />
Maximilianstr. Richard-Wagner-Str.<br />
Hohenzollernring<br />
B2/B85<br />
Romanstr.