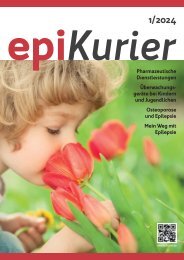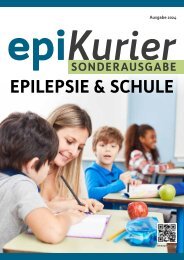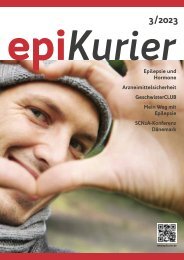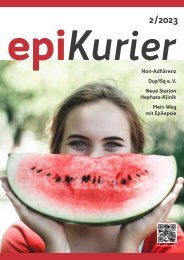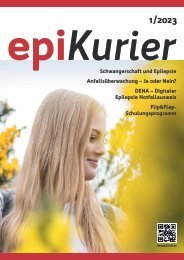EpiKurier 03-2021
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Medikamentöse Therapie bei geistiger<br />
Behinderung<br />
Einleitung<br />
Bei Menschen mit geistiger Behinderung<br />
(MmB) wird im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung<br />
(0,7 %) bis zu<br />
40-mal häufiger eine Epilepsie diagnostiziert<br />
(26 %). Bei einzelnen typischen<br />
Erkrankungen (Syndromen) ist die Häufigkeit<br />
noch höher (siehe Tabelle 1).<br />
Gemessen an der Bedeutung, die die Epilepsie<br />
demnach in dieser Patientengruppe<br />
hat, existieren wenige hochrangige<br />
Publikationen über die medikamentöse<br />
Behandlung von Epilepsie bei geistiger<br />
Behinderung. Die meisten Zulassungen<br />
der Epilepsiemedikamente erfolgten<br />
demnach ohne Erfahrungen bei<br />
MmB.<br />
Grundsätzliches zur Therapie bei<br />
Menschen mit geistiger Behinderung<br />
(MmB)<br />
Zumeist sind Epilepsien bei MmB<br />
schwieriger zu therapieren als bei anderen<br />
Epilepsie-Patienten. Tatsächlich liegen<br />
hier die Erfolgsraten einer Pharmakotherapie<br />
deutlich niedriger. Während<br />
© pixabay.com<br />
bei Epilepsie-Patienten allgemein eine<br />
Anfallsfreiheit bei etwa 63 % erreicht<br />
werden kann, ist bei MmB nur von etwa<br />
25 % Anfallsfreien auszugehen. Dabei<br />
gibt es Unterschiede je nach dem Grad<br />
der Intelligenzminderung (IM) – von<br />
22 % Anfallsfreien bei schwerster IM bis<br />
zu 44 % bei Lernbehinderung. Oft werden<br />
MmB mit einer Kombinationstherapie<br />
behandelt, was Ausdruck der eher<br />
schwer behandelbaren Epilepsie ist.<br />
Bei MmB gibt es seltene Erkrankungen<br />
(= Syndrome), die Besonderheiten aufweisen.<br />
Die genaue Kenntnis des Epilepsiesyndroms<br />
ist für den Therapieerfolg<br />
und die Patientensicherheit wichtig.<br />
Beim Dravet-Syndrom (schwere myoklonische<br />
Epilepsie der Kindheit) liegt<br />
meist eine Mutation des SCN1A-Gens<br />
vor, das eine Untereinheit eines Natriumkanals<br />
im Gehirn kodiert.<br />
Während Natriumkanalblocker wie<br />
z. B. Carbamazepin, Lamotrigin oder<br />
Oxcarbazepin die Anfallssituation meist<br />
verschlechtern, ist die Substanz Valproinsäure<br />
Mittel der Wahl beim Dravet-<br />
Syndrom. Valproinsäure kann andererseits<br />
bei Erkrankungen mit Beteiligung<br />
des Zellstoffwechsels (Mitochondriopathie)<br />
zu einem Leberversagen führen.<br />
epikurier <strong>03</strong>/<strong>2021</strong><br />
3<br />
Tabelle 1: Beispiele für das Epilepsierisiko verschiedener Erkrankungen bei Mehrfachbehinderung