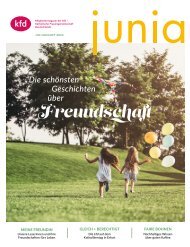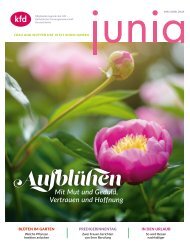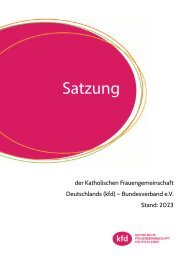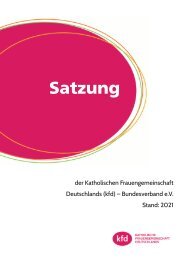Junia Ausgabe 1/2022
Junia ist das Mitgliedermagazin des kfd-Bundesverbandes. Mehr unter: www.junia-magazin.de
Junia ist das Mitgliedermagazin des kfd-Bundesverbandes.
Mehr unter: www.junia-magazin.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Geschlechtersensible Medizin – warum<br />
sie wichtig ist und Leben rettet<br />
FRAUEN<br />
WERDEN<br />
anders<br />
KRANK<br />
Die Corona-Pandemie hat es<br />
Medizinerinnen und Medizinern klar<br />
vor Augen geführt: Frauen und<br />
Männer erkranken auf<br />
unterschiedliche Art und Weise an<br />
Covid-19. Frauen erkranken häufiger,<br />
Männer schwerer. Somit zeigt das<br />
Virus eindrücklich, was die so<br />
genannte Gendermedizin schon länger<br />
fordert: Der weibliche Körper ist<br />
anders als der männliche, bis hinein in<br />
jede Zelle. Frauen und Männer<br />
brauchen unterschiedliche<br />
Anamnesen, Behandlungen, Rehas.<br />
Für eine gesündere Gesellschaft.<br />
8<br />
FRAUENFRAGEN
FRAUENFRAGEN<br />
VON ISABELLE DE BORTOLI<br />
M<br />
it dem Herzen fing alles an: Kardiologinnen<br />
in den USA fragten sich in<br />
den 1990er-Jahren, warum Männer<br />
zwar häufiger als Frauen einen Herzinfarkt<br />
erleiden, Frauen diesen aber öfter nicht<br />
überleben. Es war die Geburtsstunde der<br />
geschlechtersensiblen Medizin, auch Gendermedizin<br />
genannt. Sie läutet eine Abkehr<br />
von einer Medizin ein, in der der Mann den<br />
Standard bildet. „Geschlechtersensible Medizin<br />
bedeutet, die beste Medizin für sie und<br />
ihn, für Jung und Alt zu finden. In der differenzierten<br />
Betrachtung von der Diagnose und<br />
Behandlung von Frauen und Männern liegt<br />
eine große Chance für unsere Gesellschaft“,<br />
sagt Annegret Hofmann, Sprecherin des Netzwerks<br />
„Gendermedizin & Öffentlichkeit“,<br />
in dem sich mehr als 250 deutschsprachige<br />
Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten<br />
medizinischen Fachbereichen<br />
für geschlechtersensible Medizin miteinander<br />
austauschen. „Geschlechtersensible Medizin<br />
stellt die Frage, welche biologischen, psychologischen,<br />
sozialen Unterschiede es zwischen<br />
Mann und Frau gibt und welche Rolle sie für<br />
Gesundheit und Krankheit, für die Diagnose<br />
und Therapie von Krankheiten, für Prävention<br />
und Rehabilitation spielen.“<br />
Der vitruvianische Mensch – vor allem bekannt<br />
durch das berühmte Gemälde Leonardo<br />
da Vincis – war offensichtlich ein Mann.<br />
„Krankheitsbeschreibungen und Therapieempfehlungen<br />
galten jahrhundertelang für<br />
Männer. Noch heute werden Medikamentenstudien<br />
vor allem mit jungen, weißen Männern<br />
durchgeführt – ja, es geht sogar so weit,<br />
dass in Vorstudien, im Labor, lieber männliche<br />
Mäuse als weibliche zum Einsatz kommen“,<br />
sagt Annegret Hofmann. Dabei zeigt die<br />
Wissenschaft inzwischen deutlich die Unterschiede<br />
zwischen den Geschlechtern: „In der<br />
Gendermedizin schaut man zum Beispiel vor<br />
allem auf die Hormone und ihre Verknüpfung<br />
mit dem Immunsystem“, erklärt die Expertin.<br />
„Es hat sich gezeigt, dass hier große Unterschiede<br />
zwischen Männern und Frauen herrschen,<br />
die sich auf Erkrankungen, Verläufe<br />
und Heilung auswirken. Der weibliche Körper<br />
ist anders als der männliche, bis hinein in die<br />
Zelle. Dabei kommen immer wieder neue Fragestellungen,<br />
aber auch Erkenntnisse zutage.“<br />
Bekannt ist zum Beispiel inzwischen: Eine<br />
Tablette benötigt im weiblichen Verdauungstrakt<br />
etwa das Doppelte an Zeit, bis sie verarbeitet<br />
ist und wirken kann. Frauen brauchen<br />
daher bei bestimmten Medikamenten eine<br />
andere Dosierung. Und es sind die Erkrankungen<br />
mit den meisten Todesfällen in Deutschland,<br />
für deren Erkennung und Behandlung<br />
das Geschlecht eine entscheidende Rolle<br />
spielt: die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und<br />
vor allem der Herzinfarkt. „Bei Frauen wird<br />
ein Herzinfarkt oft erst zu spät erkannt, auch<br />
weil sie andere Symptome als die bekannten<br />
beschreiben und der Arzt diese Erkrankung<br />
deshalb bei ihnen einfach nicht vermutet“,<br />
sagt Annegret Hofmann. Das Problem: Innerhalb<br />
einer Stunde sollte man nach den ersten<br />
Symptomen eine Klinik erreichen, um so viel<br />
Herzmuskelgewebe wie möglich zu erhalten.<br />
Frauen – wie auch ihre behandelnden Ärztinnen<br />
und Ärzte – verlieren durch Zögern zu<br />
viel Zeit. „Übelkeit, Atemnot, Schmerzen im<br />
Oberbauch und in der Brust, Müdigkeit sind<br />
häufige Symptome eines Herzinfarktes bei<br />
Frauen. Den oft als typisch beschriebenen<br />
Druck auf der Brust haben sie eher selten“,<br />
sagt Hofmann. „So kommt die Diagnose oft zu<br />
spät – das ist auch heute noch so.“<br />
Unterschiede gebe es übrigens auch in der<br />
Reha: Während Männer häufig mit um die 50<br />
Jahren einen Herzinfarkt erleiden, sind Frauen<br />
eher mit um die 70 Jahre betroffen. „Diese<br />
beiden Gruppen jetzt in ein und dieselbe<br />
Reha-Therapie zu stecken, ist eigentlich völlig<br />
unsinnig, wird aber so praktiziert“, sagt Annegret<br />
Hofmann. „Dabei hat eine Studie an einer<br />
bayerischen Rehaklinik gezeigt, dass Frauen<br />
in einer eigenen, auf sie zugeschnittenen Reha<br />
sehr viel besser und schneller wieder genesen<br />
können. Dennoch wird das Thema durch die<br />
Politik, die Kassen oder die Rentenversicherung<br />
nicht vorangetrieben.“<br />
Fakten<br />
UND MEHR …<br />
Frauenmedizin – Männermedizin<br />
Der kleine Unterschied ist größer<br />
als gedacht<br />
Taschenbuch<br />
Annegret Hofmann, Rolf Hofmann<br />
Goldegg Verlag, 206 S., 17,00 €<br />
ISBN 978-3-99060-213-3<br />
Neueste Forschungsergebnisse,<br />
wichtige Köpfe und mehr aus der<br />
Gendermedizin gibt es auf<br />
www.gendermed.info<br />
Auch die kfd beschäftigt sich mit<br />
dem Thema Frauengesundheit.<br />
Mehr unter:<br />
www.kfd.de/frauengesundheit<br />
Zudem haben verschiedene<br />
Diözesanverbände Programme<br />
speziell zu diesem Thema ausgearbeitet.<br />
Der Bundesverband bietet<br />
vom 8. bis 9. Juli <strong>2022</strong> die Tagung<br />
„Ich schenke Dir mein Herz – oder<br />
lieber doch nicht? Organspende<br />
aus Frauenperspektive“ an.<br />
Auch in der Schmerztherapie würde sich<br />
ein geschlechtersensibler Blick lohnen, so<br />
die Expertinnen des Netzwerks Gendermedizin,<br />
denn Frauen und Männer beschreiben<br />
Schmerzen nicht nur unterschiedlich, sie<br />
empfinden sie Studien zufolge auch anders.<br />
Ein Grund – und daran muss weiter geforscht<br />
werden: die Hormone. Ähnliches gilt auch für<br />
psychische Erkrankungen, allen voran Depressionen:<br />
„Es gibt – so wissen wir heute – nicht<br />
mehr Frauen mit Depressionen als Männer,<br />
Frauen gehen damit aber viel offener um“, so<br />
Annegret Hofmann. „Und so haben wir dort<br />
viel mehr Diagnosen. Männer haben ähnliche<br />
psychische Sorgen wie Frauen – nur durften<br />
sie diese eben in ihrem Rollenbild lange Zeit<br />
nicht haben, bis heute.“<br />
Um Erkrankungen aufzuspüren, brauche<br />
es auch eine andere, geschlechtergerechte<br />
Ansprache der Patientinnen und Patienten.<br />
„Ärztinnen und Ärzte müssen Symptome<br />
FRAUENFRAGEN<br />
9
im Lebensalltag der Patienten verorten, egal<br />
ob Mann oder Frau. Sie müssen wissen, wie<br />
ein Mensch lebt, was ihn bewegt“, sagt die<br />
Expertin. Allerdings: In der medizinischen<br />
Ausbildung hat die Gendermedizin bisher<br />
einen eher marginalen Anteil. An der Charité<br />
in Berlin ist sie Pflichtfach, an einigen<br />
anderen Fakultäten steht sie immerhin zur<br />
Wahl. Die Charité war es auch, die 2007 das<br />
deutschlandweit erste Institut für Gendermedizin<br />
gründete, inzwischen gibt es immer<br />
mehr Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem<br />
Thema beschäftigen. „Tatsächlich sind es die<br />
Frauen in Forschung und Wissenschaft, die<br />
der Gendermedizin den entscheidenden Push<br />
geben“, sagt Annegret Hofmann. Deshalb sei<br />
es wichtig, dass Frauen in Kliniken Führungspositionen<br />
einnehmen. Gleichzeitig sei es<br />
entscheidend, dass die Erkenntnisse der Gendermedizin<br />
rasch raus aus den Laboren und<br />
Hörsälen und rein in die Arztpraxen und Kliniken<br />
kämen. Patientinnen müssten eine Behandlung<br />
einfordern, die ihrem Geschlecht,<br />
ihrer Lebenslage entspricht.<br />
Geschlechtersensible Medizin bietet<br />
Chancen für die ganze Gesellschaft: „Die<br />
Menschen wären einfach gesünder und damit<br />
zufriedener“, betont das Netzwerk Gendermedizin.<br />
Nicht zu unterschätzen sei auch der<br />
wirtschaftliche Faktor. „Medikamente wären<br />
besser an die Bedürfnisse der Menschen angepasst<br />
– und würden so weniger weggeworfen.<br />
Allein das würde sehr viel Geld einsparen.<br />
Hinzu kämen weniger falsch oder zu spät behandelte<br />
Frauen und Männer.“<br />
In einem sehen die Gender-Medizinerinnnen<br />
und -Mediziner aber keine großen Unterschiede<br />
zwischen den Geschlechtern – nämlich<br />
bei der Frage, wie man ein langes und<br />
gesundes Leben führen kann. Eine gesunde<br />
Ernährung und regelmäßiger Sport helfen,<br />
den Körper vor den Volkskrankheiten Diabetes<br />
und Herzleiden zu schützen. „Männer<br />
müssen zusätzlich noch dazu kommen, Vorsorgeuntersuchungen<br />
wahrzunehmen. Da<br />
sind Frauen ihnen schon voraus. Denn Frauen<br />
übernehmen in der Familie oft die Rolle der<br />
Gesundheits-Managerin.“<br />
Das<br />
gebrochene<br />
Herz<br />
Als der Reeder-Millionär<br />
Aristoteles Onassis sie verließ,<br />
soll Operndiva Maria Callas im<br />
Alter von nur 53 Jahren an ihrem<br />
gebrochenen Herzen gestorben<br />
sein. Alles nur Legende? Nicht<br />
unbedingt, denn das „Broken-<br />
Heart-Syndrom“ gibt es<br />
tatsächlich. Medizinisch wird<br />
es Tako-Tsubo-Kardiomyopathie<br />
genannt, und die Symptome sind<br />
mit denen eines Herzinfarkts<br />
vergleichbar – auf Grund einer<br />
massiven Ausschüttung von<br />
Stresshormonen kommt es<br />
zu einer Verkrampfung des<br />
Herzens und zu verminderter<br />
Schlagkraft an der Herzspitze.<br />
Die Betroffenen haben starke<br />
Schmerzen, ihr Blutdruck fällt<br />
ab, die Pumpleistung des Herzens<br />
lässt nach, der Körper wird nicht<br />
ausreichend mit Blut versorgt,<br />
es kommt zu heftigem<br />
Schweißausbruch und Übelkeit.<br />
Betroffen sind in der großen<br />
Mehrzahl Frauen nach den<br />
Wechseljahren, und sie alle<br />
berichten, dass den Symptomen<br />
emotionale Situationen wie der<br />
Verlust des Partners oder andere<br />
Unglücke vorausgegangen sind.<br />
Diese Erkrankung ist akut<br />
lebensgefährlich und bedarf<br />
intensiver Behandlung. Sie<br />
heilt aber in vielen Fällen ohne<br />
Folgen aus, während die meisten<br />
„echten“ Infarkte Defekte am<br />
Herzgewebe hinterlassen.<br />
Gebrochene Herzen können<br />
also tatsächlich heilen.<br />
CORONA UND<br />
DIE FOLGEN<br />
Frauengesundheit<br />
in der Pandemie<br />
Die Corona-Pandemie hat der Gendermedizin<br />
zu weiterer Bekanntheit<br />
verholfen. Wie? Weltweit stellten<br />
Ärztinnen und Ärzte fest, dass mehr<br />
Frauen als Männer an Covid-19 erkrankten,<br />
gleichzeitig aber mehr<br />
Männer schwer krank wurden und<br />
auch an dem Virus starben. Elpiniki<br />
Katsari, Fachärztin für Herzchirurgie<br />
sowie Gendermedizinerin an<br />
der Universitätsmedizin Greifswald,<br />
hat eine internationale Fachtagung<br />
zu dem Thema veranstaltet: „Die<br />
Pandemie hat gezeigt, dass das Geschlecht<br />
bei Covid-Erkrankungen<br />
eine bedeutende Rolle spielt. Man<br />
hat die Gender-Aspekte wirklich sehr<br />
schnell und offensichtlich gesehen.<br />
Die unterschiedlichen Krankheitsverläufe<br />
haben biologische wie soziale<br />
Ursachen: Frauen arbeiten stärker<br />
in Berufen im Gesundheits- und Sozialwesen<br />
und sind dem Virus daher<br />
häufiger ausgesetzt als Männer. Diese<br />
wiederum leiden häufiger an Bluthochdruck,<br />
sind Raucher oder haben<br />
Vorerkrankungen wie die Lungenkrankheit<br />
COPD.“<br />
Doch nach einer überstandenen<br />
Erkrankung ist der Leidensweg<br />
für 10 Prozent der Infizierten nicht<br />
vorbei, sie leiden an Long Covid.<br />
„Es zeigt sich, dass vor allem Frauen<br />
an Long Covid leiden. Sie kämpfen<br />
mit Atembeschwerden, Konzentrations-<br />
und Schlafproblemen, Angststörungen<br />
und Depressionen“, sagt<br />
Elpiniki Katsari. „Warum das so ist,<br />
muss noch erforscht werden, auch<br />
die volkswirtschaftlichen Folgen sind<br />
noch nicht absehbar.“ Deshalb müsse<br />
man auch notwendige Behandlungsformen<br />
finden. „Frauen sind in dieser<br />
Pandemie nicht nur gesundheitlich<br />
schwer angegriffen. Es kommt<br />
noch einiges dazu: Sie verdienen<br />
weniger, haben weniger Ersparnisse,<br />
unsichere Jobs, gleichzeitig hängt die<br />
Sorgearbeit innerhalb der Familie an<br />
ihnen: Wenn sie nun an Long Covid<br />
leiden, bricht das alles über ihnen zusammen.“<br />
10<br />
FRAUENFRAGEN
FRAUEN,<br />
die uns 2021 bewegt haben<br />
und uns (auch) <strong>2022</strong> begleiten werden<br />
Höchstleistungen und Durchhaltevermögen in Wissenschaft und Sport,<br />
Furchtlosigkeit und in Journalismus und Kirchenpolitik: Dafür stehen diese Vier<br />
VON ISABELLE DE BORTOLI<br />
1. ÖZLEM TÜRECI<br />
Wissenschaftlerin,<br />
Gründerin von BioNTech<br />
„Es funktioniert – es funktioniert<br />
fantastisch.“ Es war dieser Anruf,<br />
der nicht nur das Leben von Özlem<br />
Türeci und Ugur Sahin veränderte<br />
– sondern das von Millionen<br />
Menschen auf der ganzen<br />
Welt. Denn was da funktionierte,<br />
war der von Türeci und Sahin mit<br />
ihrem Unternehmen BioNTech<br />
entwickelte Impfstoff gegen das<br />
Corona-Virus. Und das bedeutete:<br />
der langersehnte Ausweg aus der<br />
Pandemie war endlich da. Und<br />
zuvor noch nahezu unbekannt,<br />
wurden die beiden Mediziner<br />
Özlem Türeci und Ugur Sahin<br />
weltweit gefeiert. Özlem Türeci<br />
(54) ist medizinischer Vorstand<br />
von BioNTech, außerdem ist die<br />
Ärztin Privatdozentin an der Johannes<br />
Gutenberg-Universität in<br />
Mainz. Sie kam mit vier Jahren<br />
nach Deutschland, weil ihr Vater,<br />
ein Chirurg, in einem Krankenhaus<br />
in Niedersachsen arbeitete.<br />
Türeci forscht seit mehr als 20<br />
Jahren zur mRNA-Technologie<br />
und leitete bei BioNTech die klinische<br />
Entwicklung des ersten<br />
mRNA-basierten Impfstoffs gegen<br />
COVID-19. Für ihre Leistung erhielt<br />
die Wissenschaftlerin gemeinsam<br />
mit ihrem Mann das<br />
Bundesverdienstkreuz.<br />
2. DEUTSCHE<br />
OLYMPIONIKINNEN<br />
Siegerinnen im Reiten,<br />
Weitsprung, Kajak und Co.<br />
Es waren die Frauen, die in der<br />
deutschen Olympia-Mannschaft<br />
für die Goldmedaillen in Tokio<br />
sorgten: Sieben der zehn Goldmedaillen<br />
wurden von Frauen<br />
gewonnen, wie etwa von Weitspringerin<br />
Malaika Mihambo,<br />
Jessica von Bredow-Werndl im<br />
Dressur-Einzel oder Ricarda Funk<br />
im Kajak-Einer. Dabei stellten die<br />
Frauen mit 175 Sportlerinnen den<br />
kleineren Anteil im deutschen<br />
Team mit insgesamt 432 Olympionikinnen<br />
und Olympioniken.<br />
Schaut man auf das gesamte Start-<br />
Feld, waren die Frauen immerhin<br />
mit 48 Prozent vertreten und<br />
konnten an 20 Wettbewerben<br />
mehr teilnehmen als noch 2016.<br />
3. MARIA RESSA<br />
Journalistin und<br />
Friedensnobelpreis-<br />
Gewinnerin<br />
Für ihren couragierten Kampf für<br />
die Meinungsfreiheit wurde die<br />
philippinische Journalistin Maria<br />
Ressa (58) mit dem Friedensnobelpreis<br />
ausgezeichnet. Ressa<br />
ist Mitbegründerin und Chefin<br />
der Online-Nachrichtenseite<br />
„Rappler“, die in dem südostasiatischen<br />
Land investigativen Journalismus<br />
betreibt. „Ressa hat sich<br />
als furchtlose Verteidigerin der<br />
Meinungsfreiheit erwiesen“, hieß<br />
es zur Begründung vom Nobelkomitee.<br />
Der „Rappler“ fokussiere<br />
seine Berichterstattung auf die<br />
umstrittene tödliche Anti-Drogen-<br />
Kampagne von Präsident Rodrigo<br />
Duterte, deren Opferzahl so hoch<br />
sei, dass sie einem Krieg gegen<br />
die eigene Bevölkerung gleichkomme.<br />
Zugleich dokumentierten<br />
Ressa und Rappler, wie die<br />
sozialen Netzwerke für die Verbreitung<br />
von Falschinformationen<br />
genutzt würden. Gegen Ressa hat<br />
der philippinische Staat etliche<br />
Gerichtsverfahren angestrengt,<br />
wiederholt war sie schikaniert<br />
und verhaftet worden. Die Philippinen<br />
zählen schon lange zu<br />
den gefährlichsten Ländern für<br />
Journalisten. Allein unter Duterte<br />
wurden von 2016 bis Ende 2020<br />
mindestens 19 Journalisten umgebracht.<br />
Maria Ressa ist übrigens<br />
die 18. Frau, die den Friedensnobelpreis<br />
erhalten hat – männliche<br />
Preisträger gibt es hingegen schon<br />
91.<br />
4. IRME STETTER-KARP<br />
Neue Vorsitzende des ZdK<br />
Sie steht seit Mitte November<br />
an der Spitze des höchsten katholischen<br />
Laiengremiums, dem<br />
Zentralkomitee der deutschen Katholiken<br />
(ZdK): Irme Stetter-Karp.<br />
Die Biografie der 65-Jährigen ist<br />
geprägt von ihrem Engagement<br />
im Bistum Rottenburg-Stuttgart,<br />
wo sie vier Jahrzehnte lang wirkte,<br />
etwa als Chefin des BDKJ,<br />
außerdem ist sie Vizepräsidentin<br />
des Deutschen Caritasverbandes.<br />
Als eine der Moderatorinnen des<br />
Synodalen Wegs gilt die gebürtige<br />
Ellwangerin innerkirchlich seit<br />
Jahren als bestens vernetzt.<br />
Die verheiratete Mutter zweier<br />
erwachsener Kinder will weiter<br />
leidenschaftlich für Reformen in<br />
der katholischen Kirche kämpfen,<br />
um mehr Beteiligung und Gleichberechtigung<br />
von Frauen durchzusetzen.<br />
Auch dann, wenn es<br />
mit persönlichen Konsequenzen<br />
verbunden ist. 1999 riskierte sie<br />
den Job, als sie nach dem von<br />
Papst Johannes Paul II. verordneten<br />
Ausstieg aus dem staatlichen<br />
System der Schwangerenberatung<br />
mit anderen prominenten<br />
Katholiken den Verein Donum Vitae<br />
(Geschenk des Lebens) gründete.<br />
Irme Stetter-Karp möchte<br />
die Stimme des ZdK stärken: „Wir<br />
können es uns nicht leisten, uns<br />
ins gesellschaftspolitische Abseits<br />
zu spielen. Vor allen Einzelfragen<br />
ist die Frage der Solidarität in unserer<br />
Gesellschaft zentral. Auch<br />
für die Stabilität unserer Demokratie.“<br />
ZIEMLICH BESTE FRAUEN 11
VERANSTALTUNGS<br />
TIPPS<br />
von Equal Care bis<br />
Synodaler Weg<br />
Die nächste Synodalversammlung, bei der die kfd mit vier Delegierten<br />
vertreten ist und die über die Zukunft der Katholischen Kirche in<br />
Deutschland mitbestimmen wird, findet vom 3. bis 5. Februar statt.<br />
Flankierend dazu gibt es mehrere Veranstaltungen im Bildungsprogramm<br />
der kfd:<br />
Am 14. und 15. Januar heißt es „Unterwegs auf dem Synodalen<br />
Weg - ein Zwischenhalt". Am 9. März startet eine abendliche Online-Gesprächsreihe<br />
zum Synodalen Weg mit dem Thema „Nicht von<br />
dieser Welt? Oder: Ganz in dieser Welt! Was heißt priesterliche Existenz<br />
heute?''.<br />
Alltagsrassismus begegnet uns leider immer häufiger. Wie kfd-Frauen<br />
diesem begegnen können, wird bei einem Workshop mit dem Titel<br />
„Null Toleranz für Rassismus -was Frauen tun können" vom 4. bis<br />
6. Februar erarbeitet.<br />
Ein wichtiges Thema, das vor allem Frauen betrifft: Die Sorgearbeit,<br />
die sie meist ohne große Anerkennung leisten. Auf die mangelnde Wertschätzung<br />
und unfaire Verteilung von Care-Arbeit weist der „Equal<br />
Care Day" hin, der in Schaltjahren am 29. Februar begangen wird. Die<br />
kfd lädt mit der Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands<br />
am 1. März zur Tagung „Care gerecht gestalten" ein.<br />
Mehr unter www.kfd.de/bildungsangebote<br />
Jetzt auch mit<br />
Zugang zum<br />
Digital-Angebot!<br />
Neue<br />
<strong>Ausgabe</strong><br />
--<br />
DieMita b<br />
_ ~···-.L.!!ferin<br />
DIE MITARBEITERIN<br />
HELFEN - DER DIENST<br />
AM NÄCHSTEN<br />
Hilfsbereitschaft hält unsere Gesellschaft<br />
zusammen und kann sich in vielen Formen<br />
zeigen: in praktischer Unterstützung,<br />
einem offenen Ohr oder einem lieben<br />
Wort. Ohne gegenseitige Hilfe wäre unser<br />
Leben um einiges ärmer. Lesen Sie in<br />
der neuen „Mitarbeiterin" mehr über die<br />
Kunst des Helfens - und warum es dazugehört,<br />
Hilfe auch annehmen zu können.<br />
Weitere Themen der aktuellen <strong>Ausgabe</strong>:<br />
• Vergiss mein nicht!<br />
Ein Wortgottesdienst für Menschen mit<br />
und ohne Demenz<br />
• Segenswerkstatt zum Jahresanfang<br />
• Kabarett für die kfd-Bühne<br />
• ... und weitere spannende Themen<br />
ABO-SERVICE: Dijana Galzina<br />
Tel. 021144992-34<br />
E-Mail: abo@kfd.de<br />
,'I