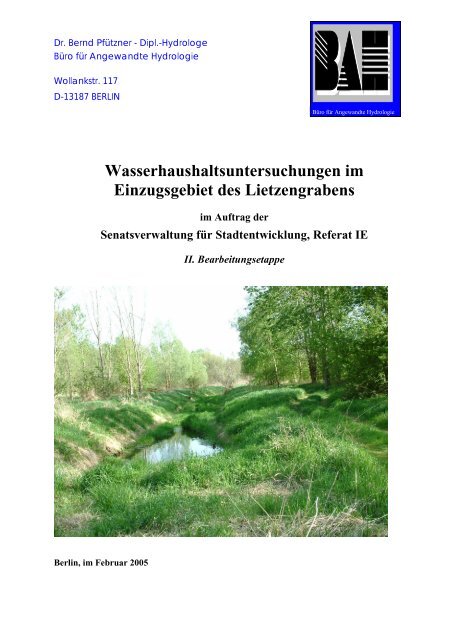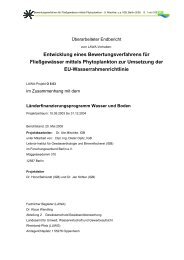Lietzengraben - IGB
Lietzengraben - IGB
Lietzengraben - IGB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr. Bernd Pfützner - Dipl.-Hydrologe<br />
Büro für Angewandte Hydrologie<br />
Wollankstr. 117<br />
D-13187 BERLIN<br />
Büro für Angewandte Hydrologie<br />
Wasserhaushaltsuntersuchungen im<br />
Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s<br />
im Auftrag der<br />
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Referat IE<br />
Berlin, im Februar 2005<br />
II. Bearbeitungsetappe
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 2<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Veranlassung 7<br />
2 Zielstellung 9<br />
3 Grundsätzliche Vorgehensweise 9<br />
3.1 Arbeitsetappen 9<br />
3.2 Modellkonzeption 11<br />
3.3 Zu untersuchende Bewirtschaftungsszenarien 13<br />
4 Raumbezogene Basisdaten 14<br />
4.1 Bodeninformationen 15<br />
4.2 Landnutzung und Vegetation 18<br />
4.3 Oberflächenmorphologie 20<br />
4.4 Grundwasserflurabstand 22<br />
4.5 Stand- und Fließgewässer, wasserbauliche Anlagen und Steuerungsmöglichkeiten 23<br />
4.6 Teileinzugsgebiete 29<br />
5 Zeitreihenanalysen 31<br />
5.1 Meteorologische Verhältnisse 31<br />
5.2 Hydrologische Verhältnisse 36<br />
6 Modellgestützte Wasserhaushaltsanalysen 39<br />
6.1 Erstellung des GIS-Datenmodells 39<br />
6.2 Modellparametrisierung 39<br />
6.2.1 Abflussbildungsmodell 39<br />
6.2.2 Abflusskonzentrationsmodell 40<br />
6.3 Modellkalibrierung und -validierung 41<br />
6.4 Modellanalysen zu einer ersten Charakterisierung des Gebietswasserhaushaltes 43<br />
7 Modellanalysen mit dem gekoppelten Grundwasser-Oberflächenwassermodell 48<br />
7.1 Modellaufbau und Parametrisierung 48<br />
7.2 Modellkalibrierung 51<br />
7.3 Modellanalysen 54<br />
7.4 Szenarienanalysen 68<br />
7.4.1 Überlehmungsszenario 68<br />
7.4.2 Wirkung der Wehrstellung 71<br />
7.4.3 Bewirtschaftung mit Zusatzwasser 81<br />
7.4.4 Beurteilung der Szenarien 84<br />
8 Offene Fragen und Ausblick 88<br />
9 Datenquellen und weitere Unterlagen 90<br />
10 Literatur 91<br />
11 Anlagen 92
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 3<br />
Abbildungen<br />
Abbildung 1-1: Landnutzung im Raum Berlin mit Kennzeichnung des oberirdischen<br />
Einzugsgebietes des <strong>Lietzengraben</strong>s 8<br />
Abbildung 4-1: Auszug aus der BÜK300 des Landes Brandenburg für das Gebiet des<br />
<strong>Lietzengraben</strong>s 15<br />
Abbildung 4-2: Einarbeitung der aktuellen und maximalen Überlehmungsbereiche in die<br />
Polygonstruktur der Bodenprofile 16<br />
Abbildung 4-3: Flächennutzung im Untersuchungsgebiet 18<br />
Abbildung 4-4: Präzisierte Flächennutzung im Untersuchungsgebiet 19<br />
Abbildung 4-5: Geländegefälle (10fach überhöht) im Gebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 20<br />
Abbildung 4-6: Digitales Geländemodell vor und nach der Präzisierung 21<br />
Abbildung 4-7: Grundwasserflurabstände im Gebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 22<br />
Abbildung 4-8: Korrigierte Fliesgewässer mit den Unterteilungen der einzelnen<br />
Gewässerabschnitte und Stau 23<br />
Abbildung 4-9: Wasservolumen und Wasseroberfläche in Abhängigkeit von der Wassertiefe für<br />
die Bogenseekette und zwei der Karower Teiche 26<br />
Abbildung 4-10: Abflussaufteilung an den Karower Teichen 27<br />
Abbildung 4-11: Gebietsgliederung in oberirdische Einzugsgebiete 29<br />
Abbildung 5-1: Lage der meteorologischen Stationen 31<br />
Abbildung 5-2: Räumliche Niederschlagsverteilung im Untersuchungsgebiet am 13.07.1999 33<br />
Abbildung 5-3: Jahreswerte wichtiger Klimagrößen für den <strong>Lietzengraben</strong> 34<br />
Abbildung 5-4: Entwicklung der klimatischen Wasserbilanz für den <strong>Lietzengraben</strong> 35<br />
Abbildung 5-5: Entwicklung der klimatischen Wasserbilanz für die Station Buch 35<br />
Abbildung 5-6: Verteilung der Messstellen im Untersuchungsgebiet 36<br />
Abbildung 5-7: Abflussmessungen für die Zeit des Rieselfeldbetriebes 37<br />
Abbildung 5-8: Abfluss nach Rieselfeldbetrieb, <strong>Lietzengraben</strong>, Schönerlinder Weg 38<br />
Abbildung 6-1: Räumliche Verteilung der Versickerung (links) und des<br />
Landoberflächenabflusses (rechts) im Untersuchungsgebiet, Mittelwerte für die<br />
Reihe 1969 bis 2002 44<br />
Abbildung 6-2: Berechnete Abflussganglinien für den <strong>Lietzengraben</strong>, Schönerlinder Weg für<br />
den Zeitraum 1969 bis 2003 45<br />
Abbildung 6-3: Berechnete Abflussganglinien für den <strong>Lietzengraben</strong>, Schönerlinder Weg für<br />
den Zeitraum 1996 bis 1999 46<br />
Abbildung 7-1: Wasserstandsanhebung durch Einstau am <strong>Lietzengraben</strong> 49<br />
Abbildung 7-2: Wasserstandsanhebung durch Einstau am Graben 2 49
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 4<br />
Abbildung 7-3: Wasserstandsanhebung durch Einstau am Graben 1 50<br />
Abbildung 7-4: Räumliche Verteilung der kF-Werte 52<br />
Abbildung 7-5: Räumliche Ausprägung des Speichereigenschaften 53<br />
Abbildung 7-6: Langzeitsimulation der Grundwasserganglinie am Pegel FB7894 54<br />
Abbildung 7-7: Langzeitsimulation der Abflüsse an Messstelle II (Schönerlinder Weg) 55<br />
Abbildung 7-8: Durch die Rieselfeldbewirtschaftung stark erhöhter Abfluss 55<br />
Abbildung 7-9: Modellierung der Abflussganglinie an der Messstelle II 57<br />
Abbildung 7-10: Modellierung der Abflussganglinie am Graben 2 57<br />
Abbildung 7-11: Mittlere Abflussverteilung im Untersuchungsgebiet 58<br />
Abbildung 7-12: Mittlere Wasserstand in den Gräben im Untersuchungsgebiet 59<br />
Abbildung 7-13: Zeitlicher Mittelwert der instationär modellierten Grundwasserhöhen<br />
(ASM/ArcEGMO) 60<br />
Abbildung 7-14: Flurabstände im Oktober 2001 und März 2002 61<br />
Abbildung 7-15: Änderung der Flurabstände vom Oktober 2001 bis März 2002 62<br />
Abbildung 7-16: Simulierte und gemessene Grundwasserstände an den Pegeln BU9, BU13, BU17,<br />
EPA 161, EPA 177A und SEN15000 63<br />
Abbildung 7-17: Korrelation der gemessenen und berechneten Grundwasserstände an den<br />
Grundwasserpegeln 64<br />
Abbildung 7-18: mittlerer Grundwasserzu- und –abstrom zu den Gräben 65<br />
Abbildung 7-19: Hydraulischer Kontakt der Bogenseekette 66<br />
Abbildung 7-20: Hydraulischer Kontakt der Karower Teiche 66<br />
Abbildung 7-21: Hydraulischer Kontakt an der Messstelle II 67<br />
Abbildung 7-22: Hydraulischer Kontakt des Seegrabens 67<br />
Abbildung 7-23: Wirkung der Überlehmung auf Grundwasserneubildung und Verdunstung 69<br />
Abbildung 7-24: Auswirkung der Überlehmung auf den Abfluss 70<br />
Abbildung 7-25: Auswirkung der Überlehmung auf den Grabenwasserstand 70<br />
Abbildung 7-26: Grundwassersenkung durch Überlehmungsmaßnahmen 71<br />
Abbildung 7-27: Einfluss der Wehre auf die Grundwasserstände und Abflüsse 72<br />
Abbildung 7-28: Gering erhöhte Abflüsse am Bogenseezufluss 73<br />
Abbildung 7-29: Verringerte Abflüsse in den Karower Teichen bei geöffnetem Wehr 12 73<br />
Abbildung 7-30: Erhöhte Wasserstände in den Karower Teichen bei geöffnetem Wehr 12 74<br />
Abbildung 7-31: Erhöhte Grundwasserstände in den Karower Teichen bei geöffnetem Wehr 12 74<br />
Abbildung 7-32: Widersprüchlicher Wasserstand im Fließgewässerabschnitt und dem<br />
Gewässerpunkt Karower Teiche 75<br />
Abbildung 7-33: Wirkung der Wehre 12 und 1a 76<br />
Abbildung 7-34: Grundwasserstände an der Bogenseekette 77
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 5<br />
Abbildung 7-35: Abflusszunahme in den Karower Teichen 77<br />
Abbildung 7-36: Wirkung der Wehre 11 und 1 78<br />
Abbildung 7-37: Grabenwasserstand am Seegraben mit und ohne geschlossenes Wehr 79<br />
Abbildung 7-38: Grundwasserzu- bzw. –abstrom vom Seegraben 79<br />
Abbildung 7-39: Grundwasserzu- bzw. –abstrom vom <strong>Lietzengraben</strong> 80<br />
Abbildung 7-40: Grundwasserstände am Seegraben 80<br />
Abbildung 7-41: Grundwasserstände am südlichen <strong>Lietzengraben</strong> 80<br />
Abbildung 7-42: Wirkung des Zusatzwassers auf Grundwasserstände und Abfluss 82<br />
Abbildung 7-43: Abflusserhöhung durch Zusatzwasser für die Karower Teiche 82<br />
Abbildung 7-44: Abflusserhöhung durch Zusatzwasser für die Bogenseekette 83<br />
Abbildung 7-45: Wirkung der geöffneten Rieselfeldstaue bei Zusatzwasser 84
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 6<br />
Tabellen<br />
Tabelle 4-1: Raumbezogene Grundlagendaten 14<br />
Tabelle 4-2: Zu Verfügung stehende Varianten der Bodentabellen 17<br />
Tabelle 4-3: Beschreibung der im Untersuchungsgebiet relevanten Staue 24<br />
Tabelle 4-4: Morphologische Kennwerte der Bogenseekette und der Karower Teiche 25<br />
Tabelle 4-5: Gebietsgliederung in oberirdische Einzugsgebiete 30<br />
Tabelle 5-1: Verwendete Klima- und Niederschlagsstationen, Beobachtungsreihen und<br />
mittlere Niederschlagsverhältnisse 32<br />
Tabelle 5-2: Niederschlagshöhen einzelner Regenereignisse im Zeitraum 1996 bis 2002 32<br />
Tabelle 6-1: Parameter des Abflussbildungsmodells 40<br />
Tabelle 6-2: Berechnete Abflussspenden im vergleich mit anderen Modellwerten 42<br />
Tabelle 6-3: Teilgebietsbezogene Wasserhaushaltsgrößen, Mittelwerte für den Zeitraum 1969<br />
bis 2003 43<br />
Tabelle 7-1: Wasserhaushaltsgrößen für das Untersuchungsgebiet 56<br />
Tabelle 7-2: Farbtabelle zur Bewertung der Abflüsse der sieben Szenarien 85<br />
Tabelle 7-3: Vergleich der Wirkung der Szenarien auf die Abflüsse zur <strong>Lietzengraben</strong>- Niederung85<br />
Tabelle 7-4: Vergleich der Wirkung der Szenarien auf die Abflüsse zur Bogenseekette 86<br />
Tabelle 7-5: Vergleich der Wirkung der Szenarien auf die Abflüsse zu den Karower Teiche 86<br />
Anlagen<br />
Bestandesformen Wald in den Revieren Blankenfelde, Buch und Gorin und deren<br />
Zusammenfassung zu Hauptbestandesformen 92<br />
Haupttabelle für den <strong>Lietzengraben</strong>, Abflussmessstelle II, Schönerlinder Weg 94<br />
Haupttabelle für den Graben 2, Abflussmessstelle IV, Schönerlinder Weg 95
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 7<br />
1 Veranlassung<br />
Der <strong>Lietzengraben</strong> liegt am nordöstlichen Stadtrand Berlins und ist ein wichtiger Zufluss zur Panke.<br />
Das oberirdische Einzugsgebiet von ca. 54 km 2 erstreckt sich von Karow bis nach Bernau in<br />
Brandenburg. In Abbildung 1-1 ist das Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s dargestellt.<br />
Umfangreiche (anthropogene) Eingriffe haben den Wasserhaushalt und das Abflussregime im<br />
<strong>Lietzengraben</strong> in den letzten Jahrzehnten mehrfach maßgeblich verändert.<br />
Zu nennen sind hier:<br />
• Die Berieselung von Anfang1900 bis ca. 1985 führte zu einer Erhöhung der Gebietsabflüsse<br />
und der Grundwasserstände, aber auch zur Einbringung von Nähr- und Schadstoffen in den<br />
Boden und das Grundwasser.<br />
• Die Einstellung der Berieselung 1985 führte zu einer massiven Verringerung der Gebietsabflüsse<br />
und zu einer Absenkung der Grundwasserstände.<br />
Die 1985 begonnene Bewaldung der ehemaligen Rieselfelder Hobrechtsfelde und Buch mit dem<br />
Ziel, einen Erholungswald auf diesen Flächen zu schaffen, wurde kombiniert mit Maßnahmen, die<br />
den Wasserhaushalt, den Bodenchemismus und die Standorteigenschaften auf diesen Flächen primär<br />
für den Bewaldungsprozeß verbessern sollten. Im Wesentlichen sind hierfür zu nennen:<br />
• Aufforstungsmaßnahmen (Bewaldung) führten zu einer Fixierung von Schadstoffen in der<br />
Bodenzone durch Verminderung der GW-Neubildung, aber auch Verringerung der Gebietsabflüsse.<br />
• Maßnahmen zur Bodenverbesserung wie die in Teilbereichen vorgenommene Überlehmung<br />
führten ebenfalls zu einer Schadstofffestlegung und hatten hinsichtlich des Wasserhaltes ähnliche<br />
Effekte wie die Aufforstung.<br />
• Mit Stauhaltungen wurde der Gebietsrückhalt erhöht, gleichzeitig kam es dadurch auch zu<br />
einer lokalen Erhöhung von Grundwasserständen.<br />
• Kurzzeitige Fremdwassereinleitungen dienten zur Untersuchung von Schadstoffverlagerungsprozessen<br />
und Grundwasserstandserhöhungen (<strong>IGB</strong>).<br />
Allen diesen Minderungsmaßnahmen ist gemein, dass sie durch die gewünschten positiven Effekte,<br />
aber auch durch negative Nebeneffekte gekennzeichnet sind. So führen Bestockung und Überlehmung<br />
zu einem verringerten Gebietsabfluss mit negativen Auswirkungen auf die Wasserbilanz<br />
der Unterlieger wie z.B. die Karower Teiche. Gleiches gilt für die Stauhaltungen, die zwar die<br />
Wasserverfügbarkeit oberhalb der Haltung verbessern, aber zu Lasten der Unterlieger gehen.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 8<br />
Oberirdisches Einzugsgebiet<br />
des <strong>Lietzengraben</strong>s<br />
Abbildung 1-1: Landnutzung im Raum Berlin mit Kennzeichnung des oberirdischen Einzugsgebietes<br />
des <strong>Lietzengraben</strong>s
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 9<br />
2 Zielstellung<br />
Aus dieser kurzen Problemanalyse ergibt sich die Notwendigkeit, aus einer ganzheitlichen Betrachtung<br />
des Gebietes und unter Beachtung externer Randbedingungen (Mindestzufluss und max.<br />
Eintrag in die Panke / Tegeler See) ein Leitbild für einen anzustrebenden nachhaltigen und damit<br />
dauerhaft stabilen Gebietszustand bzgl. der hydrologischen Verhältnisse zu entwickeln und umzusetzen.<br />
Bestandteil des Leitbildes ist die nachhaltige Sicherung der wasserabhängigen, geschützten<br />
Biotope (Gewässer, Verlandungsbereiche, Niederungsmoor, Erlenbruchwald) im Einzugsgebiet<br />
des <strong>Lietzengraben</strong>s. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht deshalb die Beantwortung folgender<br />
Fragen:<br />
1. ob die unter den früheren Wasserhaushaltsbedingungen (u.a.Rieselfeldbewirtschaftung) entstandenen<br />
und noch vorhandenen Gewässer und Feuchtgebiete, die NSG-Status haben, unter<br />
den jetzigen Nutzungs-, Dargebots-und Abflussbedingungen langfristig zu erhalten sind und<br />
2. welche Bewirtschaftungsstrategien und Maßnahmen ggf. erforderlich sind, um dies zu erreichen.<br />
Die Komplexität der Fragestellung erfordert eine modellgestützte Untersuchung, mit deren Hilfe<br />
man in der Lage ist, vorhandene und denkbare zukünftige Eingriffe in den Gebietswasserhaushalt<br />
abzubilden und im Hinblick auf die o.a. Fragen zu bewerten. (Als Eingriffe seien hier das Stauregime,<br />
die Überlehmung, Einleitung von Zusatzwasser und begrenzt auch die Waldentwicklung<br />
genannt).<br />
Als wesentlicher Erfahrungsträger insbesondere hinsichtlich der Grundwasserproblematik wurde<br />
das Institut für Gewässerökologie und Binnenfischrei (<strong>IGB</strong>, AG Prof. Nützmann) in die Untersuchungen<br />
eingebunden.<br />
3 Grundsätzliche Vorgehensweise<br />
3.1 Arbeitsetappen<br />
Die in der Zielstellung formulierte Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung des Gebietes<br />
bzgl. der hydrologischen Verhältnisse erfordert eine sehr detaillierte und umfassende Abbildung<br />
aller hydrologischen Teilkomponenten (Bodenwasserhaushalt, Grundwasser, Gewässerabfluss).<br />
Dazu sind sowohl der jetzige Zustand als auch die unter verschiedenen Randbedingungen sich<br />
ergebende zukünftigen Entwicklungen nachvollziehbar darzustellen.<br />
Aufgrund der oben erläuterten sehr anspruchsvollen fachlich-inhaltlichen Anforderungen an die<br />
notwendigen Untersuchungen liegt eine mehrstufige Bearbeitung nahe, die es erlaubt,<br />
• mit unterschiedlich komplexen Modellen verschiedene Teilaspekte in verschiedener Detailliertheit<br />
zu betrachten und<br />
• dabei zu einer sukzessiven Präzisierung der ursprünglichen Fragestellungen und der im<br />
weiteren ausgewählten Lösungsmethodik zu kommen.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 10<br />
Folgende Bearbeitungsetappen waren vorgesehen:<br />
1. Wasserhaushaltsuntersuchungen und Abflusssimulationen mit einem NA-Modell<br />
Das Ziel der im Dezember 2003 abgeschlossenen Bearbeitungsetappe war die Abbildung des hydrologischen<br />
Regimes des Gebietes für den aktuellen Gebietszustand mit einem klassischen NA-<br />
Modell (www.arcegmo.de). Damit war eine erste (grobe) Charakterisierung der hydrologischen<br />
Verhältnisse im Gebiet möglich. Ein wesentlicher Schwerpunkt dieser Etappe war die Schaffung<br />
der Datengrundlagen, insbesondere die Erstellung des GIS-Datenmodells, für die Modellierungen<br />
auch in den folgenden Etappen. Im Mittelpunkt stand der Aufbau eines Wasserbilanzmodells und<br />
erste modellgestützte Analysen zur Ermittlung des Wasserdargebotes.<br />
Erste Modellrechnungen zeigen, dass der Gebietswasserhaushalt in diesem Maßstabsbereich zumindest<br />
hinsichtlich der mittleren Dargebotsverhältnisse adäquat abgebildet werden kann.<br />
Die Ergebnisse erlaubten eine erste Quantifizierung der Gründe, die zu dem beobachteten Absinken<br />
der Gebietsabflüsse von 1,2 m 3 /s auf ca. 50 l/s führten.<br />
Defizite des derzeitigen Modells bestehen hinsichtlich der Modellierung der Wechselwirkungen<br />
zwischen Oberflächen- und Grundwasser und der Staubewirtschaftung. Die Abbildung dieser Prozesse<br />
- diese Arbeiten waren für eine zweite Leistungsphase vorgesehen – ist die Grundlage für<br />
die Ermittlung des Wasserbedarfs der Feuchtgebiete und für die Wirkungsabschätzung potenzieller<br />
Bewirtschaftungsstrategien.<br />
Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der ersten Bearbeitungsetappe gibt der damalige<br />
Arbeitsbericht.<br />
2. Bewertung verschiedener Bewirtschaftungsstrategien<br />
Gegenstand der hier vorgestellten zweiten Bearbeitungsstufe ist vorrangig die Bewertung verschiedener<br />
Bewirtschaftungsstrategien (Ein- und Überleitungen verschiedener Mengen an verschiedenen<br />
Orten, verschiedene Wehrsteuerungen etc.). Hierzu sind die Wechselwirkungen zwischen<br />
Oberflächen- und Grundwasser genauer abzubilden, als dies mit einem klassischen NA-<br />
Modell möglich wäre. Klassische NA-Modelle sind hinsichtlich ihrer Zielaussagen auf den Gebietswasserhaushalt<br />
und die Abflüsse im Gewässersystem ausgerichtet. Dafür ist es nicht notwendig,<br />
die Wasserstände im Gewässer bzw. im Grundwasser abzubilden.<br />
Für eine fundierte Bewertung verschiedener Wehrsteuerungen und Einleitungsstrategien ist es<br />
jedoch notwendig, die Wasserstände im gekoppelten System OW-GW zu simulieren, weil diese<br />
wiederum die Flüsse zwischen Grund- und Oberflächenwasser steuern. Diese Flüsse sind teils<br />
gewünscht, z.B. zur Stabilisierung von Grundwasserständen in Feuchtgebieten, führen aber auf<br />
der anderen Seite zu einer erhöhten Verdunstung und damit zu einer Reduzierung von Abflüssen<br />
mit negativen Konsequenzen für die Unterlieger.<br />
Arbeitsschwerpunkt in der zweiten Bearbeitungsstufe ist die Erweiterung des in der ersten Etappe<br />
aufgebauten NA-Modells. Diese Erweiterung besteht in folgenden Punkten:<br />
� Kopplung des NA-Modells (der ersten Etappe) mit einem Grundwasserströmungsmodell,<br />
� Integration der Gewässergeometrien, der Bauwerke und deren Steuerregeln ins Modell,<br />
� Aufbau des GW-Modells (zumindest) für den Berliner Teil des Einzugsgebietes
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 11<br />
Mit diesem erweiterten Modell können dann verschiedene Steuerungen für die Wehre und unterschiedliche<br />
Einleitungsstrategien für die Fremdwasserüberleitungen simuliert und einer ersten<br />
Bewertung unterzogen werden.<br />
Wesentliches Ergebnis dieser zweiten Etappe ist die Erarbeitung einer Vorzugsvariante für die<br />
Bewirtschaftung der beeinflussbaren Wasserhaushaltsgrößen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s<br />
mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherung der wasserabhängigen Biotope.<br />
3.2 Modellkonzeption<br />
Grundlage für die Erarbeitung einer nachhaltigen Bewirtschaftungsvariante ist eine Bilanzierung.<br />
Dazu ist das vorhandene bzw. nutzbare Wasserdargebot zur Versorgung der Feuchtgebiete und<br />
Wasserkörper jahreszeitlich differenziert zu ermitteln und dem Wasserbedarf dieser Komplexe<br />
gegenüberzustellen.<br />
Aus dieser Gegenüberstellung können sich Defizite ergeben, die zum Teil über eine zeitliche Umverteilung<br />
(Speicherung im Winter, Abgabe im Sommer) ausgeglichen werden können. Bei einem<br />
verbleibenden Restdefizit ist dann zu entscheiden, ob dies in einer Größenordnung liegt, dass es<br />
durch Zusatzwasser, d.h. Wasserimport ins Gebiet, ausgeglichen werden kann.<br />
Für die Ermittlung des Wasserdargebotes wie des Wasserbedarfs, aber auch für die Bewertung<br />
verschiedener Bewirtschaftungsstrategien (Ein- und Überleitungen verschiedener Mengen an verschiedenen<br />
Orten, verschiedene Wehrsteuerungen etc.) sind in dem grundwassergeprägten Einzugsgebiet<br />
des <strong>Lietzengraben</strong>s die Wechselwirkungen zwischen Oberflächen- und Grundwasser<br />
genauer abzubilden, als dies mit einem klassischen NA-Modell möglich wäre. Klassische NA-<br />
Modelle sind hinsichtlich ihrer Zielaussagen auf den Gebietswasserhaushalt und die Abflüsse im<br />
Gewässersystem ausgerichtet. Dafür ist es nicht notwendig, die Wasserstände im Gewässer bzw.<br />
im Grundwasser abzubilden.<br />
Für eine fundierte Bewertung verschiedener Wehrsteuerungen und Einleitungsstrategien jedoch ist<br />
es notwendig, die Wasserstände im gekoppelten System OW-GW zu simulieren, weil diese wiederum<br />
die Flüsse zwischen Grund- und Oberflächenwasser steuern. Diese Flüsse sind teils gewünscht,<br />
z.B. zur Stabilisierung von Grundwasserständen in Feuchtgebieten, führen aber auf der<br />
anderen Seite zu einer erhöhten Verdunstung und damit zu einer Reduzierung von Abflüssen mit<br />
negativen Konsequenzen für die Unterlieger.<br />
Arbeitsschwerpunkt in der zweiten Bearbeitungsstufe ist somit Erweiterung des in der ersten Etappe<br />
aufgebauten NA-Modells zu einem Instrument, mit dem Wasserdargebot und Wasserbedarf<br />
hinreichend genau ermittelt und die Bewirtschaftmaßnahmen abgebildet werden können. Die notwendigen<br />
Modellkomponenten mit ihren Verknüpfungen zeigt die folgende Abbildung.<br />
Diese Erweiterung des in der ersten Bearbeitungsetappe erstellten Modells besteht in folgenden<br />
Punkten:<br />
� Präzisierung des Wasserhaushaltsmodells durch Integration verbesserter Basisdaten (z.B. Bodenkarte),<br />
� Aufbau eines quasiinstationären Gewässermodells inklusive Integration der Gewässergeometrien,<br />
der Bauwerke und deren Steuerregeln ins bisherige NA-Modell,<br />
� Aufbau des GW-Modells (zumindest) für den Berliner Teil des Einzugsgebietes auf der Basis<br />
von MODFLOW oder ASM (Teilleistung <strong>IGB</strong>).<br />
� Kopplung der 3 Modellkomponenten gemäß der nachfolgenden Darstellung.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 12<br />
I. Mit diesem erweiterten Modell wird das für die Speisung der Feuchtgebiete zur Verfügung stehende<br />
Wasserdargebot ermittelt. Ein beträchtliches Kenntnisdefizit besteht in diesem Zusammenhang<br />
hinsichtlich des unterirdischen Einzugsgebietes. Die nördliche Abgrenzung ist weitgehend<br />
unbekannt. In einem ersten Bearbeitungsschritt sollen hier einfache Bilanzbetrachtungen<br />
zur Abschätzung der Größe des Speisungsgebietes herangezogen werden und daraus eine voraussichtliche<br />
Speisungsgebietsgrenze festgelegt werden.. In einem zweiten Bearbeitungsschritt<br />
soll dann über ein Grundwasserströmungsmodell diese unterirdische Einzugsgebietsgrenze präzisiert<br />
werden.<br />
II. Über das Grundwasserströmungsmodell sollen dann die Grundwasserstände in ihrer räumlichen,<br />
aber auch zeitlichen Verteilung (innerjährlicher Gang, Extremsituationen in mehrjährigen Zyklen)<br />
ermittelt werden. Unter Nutzung eines präzisen Höhenmodells lassen sich dann daraus<br />
Grundwasserflurabstandverteilungen (räumlich und zeitlich) ermitteln, die dann im Rahmen der<br />
gekoppelten Modellierung dazu genutzt werden, den Transpirationsbedarf und eventuelle Verdunstungsdefizite<br />
der Biotope auf Feuchtstandorten zu ermitteln.<br />
Die unter II. angerissenen Betrachtungen führen letztlich zu einem Wasserbedarf, der dem unter I.<br />
ermittelten Wasserdargebot gegenübergestellt wird.<br />
III. Zur Abminderung des sich mit Sicherheit ergebenden Defizits werden dann verschiedene Steuerungen<br />
für die Wehre und unterschiedliche Einleitungsstrategien für die Fremdwasserüberleitungen<br />
simuliert und einer ersten Bewertung unterzogen werden.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 13<br />
3.3 Zu untersuchende Bewirtschaftungsszenarien<br />
Im Rahmen der 2 Bearbeitungsetappe sind basierend auf dem gekoppelten Modell Untersuchungen<br />
in für die folgenden Szenarien vorgesehen:<br />
1.Szenario: Ist-Zustand, d.h.<br />
• Maximalstauhöhen<br />
• Kein Zusatzwasser<br />
• Vorh. Bestockung<br />
• Ohne Überlehmung<br />
1a Szenario: wie Ist-Zustand aber mit Überlehmung:<br />
• mit allen zur Überlehmung vorgeschlagenen Flächen<br />
2a. Szenario: Keine Stauhaltung<br />
• Keine Stauhaltung<br />
2a. Szenario: Stauhaltung nur für Feuchtgebiete und Wasserkörper (NSG)<br />
• Keine Stauhaltung in Rieselfeldgräben<br />
• Stauhaltung Bogenseekette<br />
• Stauhaltung Karower Teiche<br />
2b Szenario: wie 2a aber zusätzlich<br />
• Stauhaltung Seegraben(Erlenbruchwaldversorgung)<br />
• Stauhaltung <strong>Lietzengraben</strong> Stau 11<br />
3a Szenario: Zusatzwasservarianten<br />
• Einleitung von 6000m³/d<br />
• Stauhaltung im Rieselfeld und alle weiteren Staue<br />
3b Szenario: Zusatzwasservarianten wie 3a jedoch keine Stauhaltung im Rieselfeld:<br />
• Einleitung von 6000m³/d<br />
• Keine Stauhaltung im Rieselfeld<br />
• Stauhaltung im Seen, Seegraben und <strong>Lietzengraben</strong>
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 14<br />
4 Raumbezogene Basisdaten<br />
Die grundsätzliche Methodik zur Realisierung der verschiedenen Untersuchungen beruht auf einer<br />
weitestgehend GIS-gestützten hydrologischen Modellierung. Deshalb wurden in einem ersten Bearbeitungsschritt<br />
die hydrologisch relevanten GIS-Daten als Grundlage für die Modellierungen<br />
erfasst und entsprechend den Modellierungserfordernissen aufbereitet.<br />
Die folgenden raumbezogenen Grundlagendaten wurden berücksichtigt, wobei aufgrund der Lage<br />
des Gebietes in Berlin und Brandenburg teilweise verschiedene Datenquellen herangezogen werden<br />
müssen:<br />
Tabelle 4-1: Raumbezogene Grundlagendaten<br />
Datenart Berlin Brandenburg<br />
Höhenmodell DGM 25 des LVA Brandenburg<br />
Bodeninformationen BÜK300 des LGR Brandenburg<br />
Flächennutzung UIS CIR des LUA<br />
Grundwasserstände, Grundwasserflurabstände<br />
für verschiedene Zustände<br />
(feuchtes Jahr, trockenes Jahr)<br />
Interpoliert aus GW-Beobachtungen,<br />
Grundwassermodellierungen des <strong>IGB</strong><br />
Gewässersystem LUA BRB<br />
Teilgebietsgrenzen LUA BRB mit Untersetzungen (Verfeinerung)<br />
Im Ergebnis der ersten Bearbeitungsetappe steht der Großteil der für die Bearbeitung benötigten<br />
Daten zur Verfügung.<br />
Diese Grundlagendaten aus landesweiten Datenbeständen Berlins und Brandenburgs wurden für<br />
das Untersuchungsgebiet <strong>Lietzengraben</strong> partiell wie folgt präzisiert:<br />
1) Landnutzung und Vegetation durch Einbeziehung der forstlichen Standortkartierung,<br />
2) Bodenkarte durch Ergänzung bisher fehlender Attribute wie Lagerungsdichte und ohne Skelett-<br />
und Humusanteil in der BÜK300 durch das LGR und weitere geometrische Präzisierungen<br />
durch lokale Untersuchungen (Bodenaufschlüsse) und die Einarbeitung der Boden verbessernden<br />
Maßnahmen,<br />
3) Gewässergeometrien durch Ableitung von Querprofilen aus Planungsdaten und ergänzende<br />
Vermessungen,<br />
4) DHM durch lokale Vermessungen und Abgleich mit den Höheninformationen der Bauwerks-<br />
und Gewässerprofilaufnahmen.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 15<br />
In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen verwendeten Teildatenbestände kurz charakterisiert.<br />
4.1 Bodeninformationen<br />
Die Charakterisierung der bodenkundlichen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet erfolgt über die<br />
BÜK300 (Bodenübersichtskarte des Landes Brandenburg im Maßstab 1:300.000, Landesamtes für<br />
Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg, NV 15/2003). Da diese Datenbasis auch Berlin<br />
abdeckt, sind damit flächendeckend Informationen für das Gebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s gegeben.<br />
Abbildung 4-1 zeigt die Bodenkarte für das Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s.<br />
Abbildung 4-1: Auszug aus der BÜK300 des Landes Brandenburg für das Gebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s<br />
Da die BÜK300 ein landesweiter Datenbestand ist, der insbesondere in anthropogen überprägten<br />
Gebietes wie dem des <strong>Lietzengraben</strong>s durchaus Abweichungen zur Realität aufweisen kann, wurde<br />
im Rahmen dieses Projektes versucht, über Bodenaufschlüsse stichprobenhaft die Parameter<br />
der BÜK zu überprüfen bzw. bei Bedarf zu präzisieren. Außerdem wurden die Boden verbessernden<br />
Maßnahmen (Überlehmungen) als bekannte anthropogene Überprägungen eingearbeitet.<br />
Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise bei der Präzisierung der Bodendaten ist in<br />
Anlage 4 gegeben. Im Folgenden werden nur die Ergebnisse kurz charakterisiert.<br />
Es wurde insgesamt an 25 Standorten Bodenproben genommen und über eine Feldansprache sowie<br />
Laboruntersuchungen hinsichtlich der Porositäts- und Leitfähigkeitskennwerte ausgewertet.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 16<br />
Die untersuchten Bodenproben ergaben, dass alle untersuchten Profile aus reinen Sanden bestehen,<br />
lediglich ein Horizont (in 80-200 cm Tiefe) wurde als SU2 (schwach schluffiger Sand) angesprochen.<br />
In der BÜK300 werden die Böden dieser Standorte ebenfalls als reine Sandböden angesprochen,<br />
die Präzisierung der BÜK300 erfolgt darum in erster Linie über die im Gelände aufgenommenen<br />
Profile sowie über die im Labor bestimmten kF-Werte.<br />
Die Übertragung dieser Kennwerte auf die Flächen erfolgte über ein einfaches geostatistisches<br />
Verfahren (Thiessenpolygonmethode). Die so entstandenen Flächen wurden mit der BÜK300 verschnitten.<br />
Für die Berücksichtigung der überlehmten Flächen wurden diese ebenfalls mit der BÜK300 verschnitten.<br />
Bei der Überlehmung wurde unterschieden zwischen der aktuellen, d.h. derzeit realisierten<br />
und der potenziell möglichen, d.h. maximalen Überlehmung.<br />
Die folgende Abbildung 4-2 zeigt die im Ergebnis entstandene Bodenkarte, in der sich deutlich die<br />
Strukturen der Thiessenpolygone und die Überlehmungsflächen abzeichnen.<br />
Abbildung 4-2: Einarbeitung der aktuellen und maximalen Überlehmungsbereiche in die<br />
Polygonstruktur der Bodenprofile
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 17<br />
Gleichzeitig wurden diese Bodeninformationen in die Modellierungsdatenbasis integriert, so dass<br />
im Ergebnis für jede Modellfläche neben der ursprünglichen Zuordnung zur BÜK300 weitere 8<br />
Varianten der Bodenattributierung zur Verfügung stehen, die über die Modellsimulationen eine<br />
Einschätzung erlauben, wie sich die Kennwertpräzisierungen der Bodenkarte auf die Wasserhaushaltsergebnisse<br />
auswirken und welche Änderungen im Wasserhaushalt durch die Überlehmungen<br />
zu erwarten sind.<br />
Die folgende Auflistung in Tabelle 4-2 gibt einen Überblick über die verschiedenen Varianten der<br />
Bodendaten.<br />
Tabelle 4-2: Zu Verfügung stehende Varianten der Bodentabellen<br />
Attribut Beschreibung<br />
BUEK300 Geometrien und Kennwerte gemäß BÜK300<br />
Buek3_1 BÜK mit Bodenprobenpolygonen (ohne Überlehmung)<br />
Buek3_2 BÜK mit Bodenproben, aktuelle Überlehmungsflächen<br />
Buek3_3<br />
Buek3_4<br />
Buek3_5<br />
BÜK mit Bodenproben, aktuelle Überlehmungsflächen und<br />
Vorschlag für potenzielle Überlehmung von BFU<br />
BÜK mit Bodenproben, aktuelle Überlehmungsflächen und<br />
Vorschlag für potenzielle Überlehmung Berliner Forsten<br />
BÜK mit Bodenproben, aktuelle Überlehmungsflächen und<br />
Vorschlag für potenzielle Überlehmung Berliner Forsten und BFU<br />
Buek3_6 BÜK ohne Bodenproben mit aktuelle Überlehmungsflächen<br />
Buek3_7<br />
Buek3_8<br />
BÜK ohne Bodenproben, aktuelle Überlehmungsflächen und<br />
Vorschlag für potenzielle Überlehmung von BFU<br />
BÜK ohne Bodenproben, aktuelle Überlehmungsflächen und<br />
Vorschlag für potenzielle Überlehmung von Berliner Forsten
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 18<br />
4.2 Landnutzung und Vegetation<br />
Für die Einbeziehung der Flächennutzung in die Modellierung mussten Vegetations- und Landnutzungsinformationen<br />
aus zwei unterschiedliche Datenquellen homogenisiert werden. Das waren:<br />
• das Umweltinformationssystem der Stadt Berlin bzw. daraus ableitbare Informationen zur<br />
Bodenbedeckung für den Berliner Teil des Untersuchungsgebietes und<br />
• die Interpretation der ColorInfraRot (CIR)-Luftbilder aus der Befliegung des Landes Brandenburg<br />
für den Brandenburger Teil des Untersuchungsgebietes.<br />
Beide Datenbestände beziehen sich auf den Zustand Anfang bis Mitte der 90iger Jahre, also für<br />
den <strong>Lietzengraben</strong> nach Einstellung des Rieselfeldbetriebes.<br />
Abbildung 4-3 zeigt die Flächennutzung bzw. Vegetationsverteilung im Untersuchungsgebiet,<br />
basierend auf obigen Datenbeständen.<br />
Abbildung 4-3: Flächennutzung im Untersuchungsgebiet<br />
Während die CIR-Daten für den brandenburgischen Gebietsteil eine hinreichende Differenzierung<br />
der verschiedenen Vegetationstypen beinhaltet, ist für den Berliner Teil des Einzugsgebietes nur<br />
eine Untersetzung der vegetationsbestandenen Flächennutzung in Wald, Acker und Grünland<br />
möglich.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 19<br />
Da sich bei verschiedenen Baumbeständen völlig unterschiedliche Verdunstungen und Grundwasserneubildungen<br />
ergeben können, wurde für die bisher nicht weiter differenzierten Waldflächen<br />
eine Untersetzung angestrebt.<br />
Diese Untersetzung erfolgte anhand der forstlichen Standortkartierung, die für die 3 Reviere Blankenfelde,<br />
Buch und Gorin insgesamt 44 Bestandesformen unterscheidet, die in Anlage 1 aufgeführt<br />
sind.<br />
Für das Modell EGMO, das für die Wasserhaushaltsuntersuchungen in der 1. Projektphase zur<br />
Anwendung kommt, ist eine Differenzierung in Laub-, Nadel- und Mischwald möglich. Ebenfalls<br />
in Anlage 1 sind die dabei vorgenommenen Zusammenfassungen dokumentiert.<br />
Die folgende Abbildung 4-4 zeigt die so präzisierte Landnutzung. In den 3 analysierten Revieren<br />
dominieren mit ca. 1289 ha Nadelwaldbestände, die sich vor allem auf die nördlichen Gebietsteile<br />
konzentrieren. Laubwald ist mit 813 ha vertreten, Mischwald mit 270 ha.<br />
Abbildung 4-4: Präzisierte Flächennutzung im Untersuchungsgebiet
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 20<br />
4.3 Oberflächenmorphologie<br />
Das Höhenmodell DHM25 wurde vom Landesvermessungsamt Brandenburg bezogen. Daraus<br />
wurde ein DGM erstellt und die Oberflächenmorphologie abgeleitet. Insgesamt gehen in die Modellierung<br />
3 Größen ein, die unmittelbar aus dem DGM abgeleitet wurden, das Gefälle, die Hangausrichtung<br />
(Aspekt) und die Höhe selbst.<br />
Die folgende Abbildung zeigt die Gefälleverhältnisse im Einzugsgebiet, hier abgeleitet aus dem<br />
Höhenmodell in [dm], d.h. 10-fach überhöht. Zu erkennen ist die sehr geringe Reliefierung des<br />
Gebietes und bis auf einige wenige stärker geneigte, meist ring- oder linienförmige Strukturen.<br />
Abbildung 4-5: Geländegefälle (10fach überhöht) im Gebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s<br />
Das DHM hat schon durch seine Auflösung und die zugrunde liegende Datenbasis (TK10) einen<br />
gewissen Fehlerbereich, der sich in Gebieten mit Veränderungen in der Oberflächenmorphologie<br />
wie Senkungen oder Aufschüttungen noch vergrößert. Auswirkungen sind für die hier angestrebten<br />
Untersuchungen dann zu erwarten, wenn dadurch die Grundwasserflurabstände im oberflächennahen<br />
Bereich (0 bis 2,5 m) verfälscht werden.<br />
Aus diesem Grunde wurde versucht, über die Einbeziehung von Geländevermessungen, die in<br />
einem parallel laufenden Projekt (4914 UEP/OÜ5 – Wiedervernässung der Rieselfelder um<br />
Hobrechtsfelde) aufgenommen worden sind, den Fehlerbereich des DHM25 einzuschätzen und die<br />
Abweichungen zu den realen Geländehöhen zu minimieren.<br />
Leider war das nur für den Bereich der Rieselfelder um Hobrechtsfelde möglich, da nur hier neue<br />
Vermessungsdaten vorlagen und auch nur mit einem beträchtlichen Aufwand, weil die Vermessungsdaten<br />
in einer sehr schlechten Qualität hinsichtlich der Verarbeitbarkeit (keine Erläuterungen,<br />
fehlerhafte Layerzuweisungen) übergeben wurden.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 21<br />
Ausführliche Informationen zur Präzisierung des Höhenmodells sind in Anlage 4 zu finden. In der<br />
folgenden Abbildung 4-6 ist das Ergebnis visualisiert.<br />
Abbildung 4-6: Digitales Geländemodell vor und nach der Präzisierung
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 22<br />
4.4 Grundwasserflurabstand<br />
Der Grundwasserflurabstand wurde ermittelt, in dem aus für Brandenburg verfügbaren Grundwasserbeobachtungen<br />
ein mittlerer Grundwasserstand als Grundwasseroberflächenmodell interpoliert<br />
wurde. In die räumliche Interpolation wurde die Geländeoberfläche und die Gewässerlinien einbezogen.<br />
Anschließend wurde eine Differenzenkarte aus den Höhenwerten im DGM und den<br />
Grundwasserhöhen erzeugt. Abbildung 4-7 zeigt das im Ergebnis entstandene Griddatenmodell<br />
mit den Grundwasserflurabständen.<br />
Abbildung 4-7: Grundwasserflurabstände im Gebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 23<br />
4.5 Stand- und Fließgewässer, wasserbauliche Anlagen und<br />
Steuerungsmöglichkeiten<br />
Das Fließgewässernetz als wesentliche Datenbasis für den Aufbau des Abflussmodells wurde unter<br />
Einbeziehung der drei folgenden Basisbatenbestände erstellt:<br />
� WRRL-Gewässer des LUA Brandenburg<br />
� ATKIS-Gewässernetz<br />
� CIR-Gewässer<br />
Gemeinsam mit dem AG und dem <strong>IGB</strong> (Herrn Scheffler und Herrn Ginzel) erfolgte eine Festlegung,<br />
welche Gewässerstränge zukünftig als relevant hinsichtlich der in diesem Projekt zu verfolgenden<br />
Aufgabenstellung anzusehen sind. Dieses Gewässernetz wurde dann als Grundlage für die<br />
Modellierung hierarchisiert. Dazu wurden Lücken geschlossen, die Arcs in Fliessrichtung ausgerichtet<br />
und in Anlehnung an das ARC/INFO mit Nodes als zusätzliche Geometrie-Elemente und<br />
FromNode/ToNode-Informationen ergänzt.<br />
Die nebenstehende Abbildung zeigt<br />
das für die Modellierung erstellte<br />
Basisgewässernetz. In dieses wurden<br />
noch zusätzlich Knoten eingefügt,<br />
die als Besondere Gewässerpunkte<br />
(s. ArcEGMO-Dokumentation)<br />
weitere abflussrelevante<br />
Informationen wie<br />
• Nutzer (Einleitungen, Entnahmen)<br />
als bilanzverändernde<br />
Einflüsse,<br />
• Bauwerke (Staue, Wehre,<br />
Speicher) als dynamikverändernde<br />
Einrichtungen und<br />
• Abflussaufteilungen<br />
aufnehmen. Integriert ins Modell<br />
wurden insgesamt 14 Staue, die<br />
Tabelle 4-3 mit ihren Lagekoordinaten,<br />
der Bauwerkshöhe, der<br />
Rohrsohle und des Stauziels in<br />
zusammengestellt sind. Die Bauwerksdaten<br />
wurden teilweise aus<br />
Projektionsdaten abgeleitet, zum<br />
großen Teil aber neu vermessen.<br />
Genauere Informationen dazu sind<br />
in Anlage 4 zusammengestellt.<br />
Abbildung 4-8: Korrigierte Fliesgewässer mit den Unterteilungen der einzelnen Gewässerabschnitte<br />
und Stau
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 24<br />
Name X-coord Y-coord Okb RS<br />
Stauziel<br />
Überfallbreite<br />
NW<br />
Stau 1 4599518.792 5835875.210 52.45 50.75 52.00 1.20 800<br />
Stau 4 4600920.413 5836927.353 57.15 55.50 57.00 1.20 800<br />
Stau 5 4600242.500 5837002.615 55.20 53.50 54.60 1.20 600<br />
Stau 6 4599641.491 5837002.296 55.05 54.20 54.44 1.20 800<br />
Stau 7 4599779.343 5836648.922 53.30 51.22 52.50 1.20 600<br />
Stau 8 4599166.245 5837198.612 56.93 55.30 56.60 1.20 800<br />
Stau 9 4599977.381 5838610.269 57.15 55.50 56.50 1.20 800<br />
Stau 10 4602143.614 5837276.147 59.53 57.80 59.50 1.20 600<br />
Stau 11 4598975.336 5834402.798 50.75 48.90 50.30 1.20 800<br />
Stau 9a 4599951.280 5837451.470 55.60 53.35 54.80 1.20 800<br />
Stau 1a 4599055.574 5834453.052 51.90 49.95 51.44 1.20 800<br />
Stau 12 4599142.074 5833433.620 49.57 48.70 49.00 1.20 800<br />
Stau 13 4600461.591 5837538.683 57.59 55.13 56.30 1.20 800<br />
Stau 14 4600701.727 5837977.179 58.61 56.65 57.70 1.20 800<br />
Tabelle 4-3: Beschreibung der im Untersuchungsgebiet relevanten Staue<br />
Die Stauanlagen sind bautechnisch als Jalousie-Staue ausgeführt. Im abgesenkten Zustand wirken<br />
sie wie ein Überfallwehr. Das heißt, die abfließende Wassermenge kann gemäß der Poleni-Formel<br />
(Q = f (dH, Überfallbreite, Überfallbeiwert) ermittelt werden, wobei dH die Differenz aus dem<br />
Wasserstand im Oberwasser und der Wehrhöhe ist. Im gezogenen Zustand kann Wasser zwischen<br />
den einzelnen Lamellen hindurchfließen. Dies sichert eine gute Belüftung des Wassers, lässt sich<br />
aber mit gängigen Formeln nicht berechnen. Deshalb wurde für die Modellierung festgelegt, dass<br />
neben dem beschriebenen Zustand „geschlossenes Wehr“ für die Variantenuntersuchungen nur<br />
noch der Zustand „voll geöffnetes Wehr“ betrachtet wird. Hier sind die Lamellen bis auf ihre max.<br />
Höhe gezogen. Für den dafür möglichen Durchfluss wird angenommen, dass er gleich dem freien<br />
Abfluss ohne Wehr ist.<br />
Unmittelbar unterhalb der Jalousie-Staue befinden sich Rohrdurchlässe, die i.d.R. kleinere Wege<br />
unterqueren. Hier sind die Nennweiten (NW) so ausgelegt, dass davon ausgegangen werden kann,<br />
dass diese das mehrfache MQ gut abführen können, so dass von den Rohrdurchlässen erst ab einem<br />
mittleren Hochwasser ein kurzzeitiger Rückstaue erwartet werden kann.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 25<br />
Neben den Stauanlagen wurden die Standgewässer als<br />
besondere Gewässerpunkte ins Gewässernetz integriert.<br />
Die Einbeziehung von Standgewässern ins Modell ist aus<br />
folgenden Gründen notwendig:<br />
• Standgewässer sind wesentliche Retentionselemente<br />
in einem Gewässersystem. Sie nehmen<br />
Hochwasserspitzen auf und leiten sie verzögert<br />
und gedämpft, d.h. mit verringertem Scheitelwert<br />
weiter.<br />
• Sie und die umliegenden Flächen verdunsten potenziell,<br />
d.h. energiegesteuert, da von einer unbegrenzten<br />
Wassernachlieferung ausgegangen werden<br />
kann. Damit können Standgewässer als Senken<br />
den Gebietswasserhaushalt beträchtlich beeinflussen.<br />
• Standgewässer können bei Vorhandensein einer<br />
adäquaten Speicherlamelle gezielt als Retentionselemente<br />
für die Vergleichmäßigung des Abflusses<br />
und damit für die Bewirtschaftung eines Einzugsgebietes<br />
genutzt werden.<br />
Die wesentlichen Standgewässer im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s sind die Bogenseekette und<br />
die Karower Teiche. Als Grundlage für ihre modellhafte Abbildung sind vom AG Tiefenlinien im<br />
DXF-Format bereitgestellt worden, die die räumliche Verteilung der Wassertiefen in diesen Teichen<br />
abbilden (s. Abbildung rechts), allerdings nur für zwei der insgesamt 4 Karower Teiche.<br />
Für die hydrologische Modellierung reicht eine Speicherinhaltslinie zur Beschreibung der Retentionswirkung<br />
und die Wasseroberfläche zur Beschreibung der Verdunstungsverluste für jedes<br />
Teichsystem aus. Beide Charakteristika sind in Abbildung 4-9 in Abhängigkeit von der Wassertiefe<br />
für die Bogenseekette dargestellt, die morphologischen Kennwerte beider Teichsysteme in<br />
Tabelle 4-4 aufgelistet.<br />
Tabelle 4-4: Morphologische Kennwerte der Bogenseekette und der Karower Teiche<br />
Westliche Östliche<br />
Kennwert Einheit Bogenseekette Karower Teiche<br />
Fläche m 2 121.246 51.558 84.215<br />
Volumen m 3 77.073 13.459 38.800<br />
größte Tiefe m 3,17 0,75 0,70<br />
mittlere Tiefe m 0,64 0,26 0,45
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 26<br />
Wasservolumen [m 3 ]<br />
80000<br />
70000<br />
60000<br />
50000<br />
40000<br />
30000<br />
20000<br />
10000<br />
Wasservolumen Bogenseekette<br />
Wasservolumen Karower Teiche<br />
Wasseroberfläche Bogenseekette<br />
Wasseroberfläche Karower Teiche<br />
0<br />
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00<br />
Wassertiefe bzw. Wasserstand [m]<br />
2.50 3.00<br />
0<br />
3.50<br />
120000<br />
105000<br />
90000<br />
75000<br />
60000<br />
45000<br />
30000<br />
15000<br />
Abbildung 4-9: Wasservolumen und Wasseroberfläche in Abhängigkeit von der Wassertiefe<br />
für die Bogenseekette und zwei der Karower Teiche<br />
Als weitere „Besondere Gewässerpunkte“ sind dann noch die Abflussaufteilungen ins Gewässernetz<br />
zu integrieren. Dies sind im <strong>Lietzengraben</strong>gebiet die Verzweigungen<br />
a) <strong>Lietzengraben</strong> in <strong>Lietzengraben</strong> und Seegraben (20:80),<br />
b) <strong>Lietzengraben</strong> in <strong>Lietzengraben</strong> und alten <strong>Lietzengraben</strong> auf Höhe der Bogenseekette<br />
(90:10),<br />
c) <strong>Lietzengraben</strong> in <strong>Lietzengraben</strong> und alten <strong>Lietzengraben</strong> beim Eintritt in die Rieselfelder<br />
und<br />
d) der Abschlag des <strong>Lietzengraben</strong>s in die Karower Teiche.<br />
Da im Rahmen der Niederschlags-Abfluss-Modellierung in der Regel keine komplexe Gerinnehydraulik<br />
gerechnet werden kann, sind für solche Abflussaufteilungen Regeln vorzugeben, wie<br />
sich der Zufluss Abhängigkeit von der Zuflussmenge oder vom Wasserstand auf die beiden Unterlieger<br />
aufteilt. Im einfachsten Fall sind es feste prozentuale Aufteilungen wie oben, die für a) und<br />
b) durch den AG vorgegeben wurden.<br />
Der Abzweig des alten <strong>Lietzengraben</strong>s vom <strong>Lietzengraben</strong> am Eintritt in die Rieselfelder ist nur<br />
bei geschlossenem Wehr 9 relevant. Eine Sohlschwelle im alten <strong>Lietzengraben</strong> von 15 cm ist hier<br />
abflussbestimmend. Im Modell wurde an dieser Stelle eine Wasserstands - Abflussbeziehung aufgestellt,<br />
die besagt, dass bis zu einem Wasserstand von 15 cm kein Abfluss durch den Alten <strong>Lietzengraben</strong><br />
erfolgt, aber dann zunehmend mit dem sich vergrößernden Durchflussquerschnitt.<br />
Der Abfluss aus dem <strong>Lietzengraben</strong> zu den Karower Teichen erfolgt im Rückstau des Wehres 12<br />
über zwei 500er Rohre und somit in Abhängigkeit vom Wasserstand im <strong>Lietzengraben</strong>.<br />
Obwohl die potenziellen Abflussmengen über das Wehr 12 leicht über die Wehrformel nach Polleni<br />
und die potenzielle Abschlagsmenge in die Karower Teiche über Ansätze zur Rohrhydraulik<br />
Wasseroberfläche [m 2 ]
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 27<br />
leicht bestimmt werden können (s. Abbildung 4-10), ist die sich ergebende, reale Abflussaufteilung<br />
ein hydraulisches Problem, dass nur numerisch aufwendig gelöst werden kann.<br />
Im hier erstellten hydrologischen Gewässermodell wurde eine regelbasierte Abflussaufteilung wie<br />
folgt umgesetzt:<br />
• Liegt der Wasserstand unter der Wehrhoehe, so verbleibt im Hauptgerinne nur ein Mindestabfluss,<br />
verursacht durch Undichtigkeiten im Wehr, der auf 2 l/s angesetzt wurde.<br />
• Der potenzielle Abschlag in die Karower Teiche wird in Abhängigkeit vom akt. Wasserstand<br />
gemäß der in Abbildung 4-10 dargestellten Beziehung errechnet.<br />
• Die reale Abgabe in die Teiche ist dann das Minimum aus (Zufluss – Mindestabfluss) und der<br />
potenziellen Abgabe.<br />
• Übersteigt der Zufluss die potenzielle Abgabe in die Teiche (tritt erst bei Wasserständen ein,<br />
die über der Wehrhöhe liegen), wird der Abfluss im Hauptgerinne entsprechend erhöht.<br />
Q [qm/s]<br />
0.6<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
Mindestabfluss<br />
(Spaltenverlust) 2 l/s<br />
potenzieller Abfluss über das Wehr in<br />
Abhängigkeit vom Wasserstand<br />
potenzieller Abfluss über beide<br />
Rohrdurchlässe in die Karower Teiche<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Wasserstand [cm ü. Sohle]<br />
Abbildung 4-10: Abflussaufteilung an den Karower Teichen<br />
Wehrhöhe 30 cm
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 28<br />
Neben dem Gewässersystem als Vernetzung verschiedener Gewässerstränge mit Oberlieger-<br />
Unterlieger-Zuordnung, den Bauwerken, Teichen und den Abflussaufteilungen müssen auch die<br />
Gewässerstränge selbst charakterisiert werden. Dies betrifft die Gefälle- und Rauheitsverhältnisse,<br />
die Gewässergeometrien (Querprofile) und die Höhe der Gewässersohle.<br />
Die Gewässerprofile können im <strong>Lietzengraben</strong>gebiet in guter Näherung über Regelprofile, vor<br />
allem Trapezprofile beschrieben werden. Zur Festlegung der Sohlhöhe und zur Bestimmung der<br />
Formkenngrößen Sohlbreite, Profiltiefe und Böschungsneigung wurden alte Projektierungsunterlagen<br />
ausgewertet. Die über diese Altdaten nicht beschreibbaren Teilstränge des Gewässersystems<br />
wurden vermessen. Zur Überprüfung der verwendeten Altdaten wurden stichpunktartig auch hier<br />
Kontrollmessungen durchgeführt.<br />
Im Ergebnis dieser Arbeiten waren jedem Gewässerabschnitt eine Sohlhöhe und ein Profiltyp zugeordnet,<br />
wobei der Profiltyp eine typische Profilform darstellt und auf einer Klassifizierung der<br />
genannten Formkenngrößen beruht.<br />
Eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise zur Beschreibung der Gewässergeometrien<br />
ist in Anlage 4 nachzulesen, während die Vermessungsarbeiten in Anlage 5 dargestellt sind.<br />
Aus den einzelnen Sohlhöhen und den Längen der Gewässerabschnitten wurden dann die Sohlgefälle<br />
abgeleitet.<br />
Für die Kopplung des Gewässermodells mit dem Grundwassermodell war dann noch eine weitere<br />
Präzisierung des Datenmodells zur Beschreibung des Oberflächengewässersystems notwendig.<br />
Da jeder Gewässerabschnitt im Sinne der Modellierung ein homogenes Element darstellt, das über<br />
ein repräsentatives Profil und über einen Parametersatz beschrieben wird, wird jeder Gewässerabschnitt<br />
auch nur über eine (mittlere) Sohlhöhe und einen mittleren Wasserstand charakterisiert.<br />
Um hier eine Kompatibilität zur Genauigkeit des Höhenmodells und zur angestrebten Aussagegenauigkeit<br />
des Grundwassermodells herzustellen, war es notwendig, Gewässerabschnitte noch weiter<br />
zu unterteilen, wenn der Höhenunterschied im Gewässerabschnitt bzw. das Gefälle zu groß ist.<br />
Als Grenzwert wurde hierfür 40cm verwendet, d.h. alle Gewässerabschnitte mit einem Höhenunterschied<br />
von mehr als 0,4m wurden weiter unterteilt.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 29<br />
4.6 Teileinzugsgebiete<br />
Die Teilgebietsgliederung wurde erstellt unter Nutzung der LAWA-konformen Gebietsgliederung,<br />
die vom LUA Brandenburg bereitgestellt wurde. Allerdings waren u.a. durch die Hinzunahme von<br />
weiteren Gewässern, die im Rahmen dieses Projektes von Interesse sind, einige Untersetzungen<br />
erforderlich. Die folgende Abbildungen zeigt die erweiterte Gebietsgliederung in insgesamt 16<br />
Teilgebiete (rot) mit den Teilgebietsnummern (Ids), die in den weiteren Analysen zur Kennzeichnung<br />
der Teileinzugsgebiete verwendet werden und die Gebietsgliederung des LUA (grau) in 7<br />
Teileinzugsgebiete. Einen besonderen Hinweis bedarf das Teilgebiet 99, das nicht zum oberirdischen<br />
Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s gehört. Es wird hier aber als ein Bilanzgebiet mit ausgewiesen,<br />
weil es als Teil des Untersuchungsgebietes in die Wasserhaushaltsanalysen mit einbezogen<br />
wird, da Teile dieses Gebietes durchaus zum unterirdischen Einzugsgebiet gehören können.<br />
6<br />
7<br />
99<br />
10<br />
8<br />
14<br />
5<br />
2<br />
9<br />
3<br />
#<br />
#<br />
13<br />
15<br />
Abbildung 4-11: Gebietsgliederung in oberirdische Einzugsgebiete<br />
11<br />
4<br />
1<br />
12
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 30<br />
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Flächengrößen der einzelnen Teilgebiete und eine kurze<br />
Charakterisierung, von wo bis wo sich das zugeordnete Gewässer erstreckt.<br />
Tabelle 4-5: Gebietsgliederung in oberirdische Einzugsgebiete<br />
ID Fläche Gewässer von ... bis ...<br />
1 29.18 <strong>Lietzengraben</strong> von Quelle bis oberhalb Mündung Graben von Gorinsee<br />
2 2.63 Graben von Gorinsee von Quelle bis Mündung in <strong>Lietzengraben</strong><br />
3 2.58 <strong>Lietzengraben</strong> von uh. Mündung Seegraben bis Mdg. in Panke<br />
4 3.94 Seegraben von Quelle bis Mündung in <strong>Lietzengraben</strong><br />
5 1.60 Seegraben von Quelle bis Mündung in <strong>Lietzengraben</strong><br />
6 1.81 <strong>Lietzengraben</strong> von uh. Mdg. Hobrechtfelder Gewässer bis oh. Mdg. Seegraben<br />
7 1.78 <strong>Lietzengraben</strong> von uh. Mdg. Hobrechtfelder Gewässer bis oh. Mdg. Seegraben<br />
8 1.65 <strong>Lietzengraben</strong> von uh. Mdg. Hobrechtfelder Gewässer bis oh. Mdg. Seegraben<br />
9 1.25 <strong>Lietzengraben</strong><br />
10 1.61 Alter <strong>Lietzengraben</strong><br />
von uh. Mdg. Graben von Gorinsee bis oh. Mdg. Hobrechtfelder<br />
Gewässer<br />
von uh. Mdg. Graben von Gorinsee bis oh. Mdg. Hobrechtfelder<br />
Gewässer<br />
11 4.54 Hobrechtfelder Gewässer von Quelle bis Mdg. in <strong>Lietzengraben</strong><br />
12 0.08 Hobrechtfelder Gewässer von uh. Mdg. Graben 2 bis Mdg. in <strong>Lietzengraben</strong><br />
13 1.81 Graben2 von Quelle bis Mdg. in Hobrechtsfelder Gewässer<br />
14 1.44 Panke bis Mdg des <strong>Lietzengraben</strong><br />
15 0.30 Panke nach Mdg des <strong>Lietzengraben</strong><br />
99 66.63 äußerer Rand<br />
Σ 56.22 oberirdisches Einzugsgebiet<br />
Σ 122.85 Untersuchungsgebiet<br />
Σ 34.68 bis Messstelle II
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 31<br />
5 Zeitreihenanalysen<br />
Bevor im Kapitel 6.4 der Gebietswasserhaushalt auf Grundlage von Modellanalysen beschrieben<br />
wird, sollen in diesem Abschnitt<br />
� die Meteorologie als eine wesentliche Randbedingung für den Gebietswasserhaushalt und<br />
� die Abflussverhältnisse als „Ausdruck“ des hydrologischen Regimes<br />
unter Nutzung der verfügbaren Messreihen analysiert werden.<br />
5.1 Meteorologische Verhältnisse<br />
Zur Charakterisierung der meteorologischen Verhältnisse im Gebiet wurden<br />
� Tageswerte der Station Buch für den Niederschlag, die mittlere Lufttemperatur, die relative<br />
Luftfeuchte und die relative Sonnenscheindauer/Globalstrahlung,<br />
� Tageswerte des Niederschlages für die Stationen Schildow, Klosterfelde, Hohen Neuendorf,<br />
Rüdnitz und Schönow<br />
in die Untersuchungen einbezogen. Die genannten Stationen, deren Lage zum Gebiet Abbildung<br />
5-1 zeigt, können als repräsentativ für die Untersuchungen in diesem Projekt angesehen werden.<br />
Abbildung 5-1: Lage der meteorologischen Stationen
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 32<br />
In Tabelle 5-1 sind diese Stationen bzw. die zur Verfügung stehenden Beobachtungsreihen kurz<br />
charakterisiert. Über die Daten der Station Buch wird ein insgesamt 43,5 Jahre langer Zeitraum<br />
abgedeckt, der eine abgesicherte Beschreibung der derzeitigen mittleren meteorologischen Verhältnisse<br />
im Untersuchungsgebiet gestattet. Mit der Einbeziehung der weiteren 5 Niederschlagsstationen<br />
ab 1969 ist auch eine räumlich sehr differenzierte Abbildung der Gebietsmeteorologie<br />
über einen 35,5-jährigen Beobachtungszeitraum möglich. Die Beobachtungslücken für die Stationen<br />
Schildow, Rüdnitz und Hohen Neuendorf werden programmintern durch die Simulationssoftware<br />
ArcEGMO unter Nutzung statistischer Ansätze geschlossen.<br />
Tabelle 5-1: Verwendete Klima- und Niederschlagsstationen, Beobachtungsreihen und<br />
mittlere Niederschlagsverhältnisse<br />
Buch Schönow Schildow Rüdnitz Hohen Neuendorf Klosterfelde<br />
Art Klima Niederschlag<br />
Zeitraum<br />
1/1961 -<br />
6/2003<br />
1/1969 -<br />
6/2003<br />
1/1969 -<br />
12/1994<br />
1/1969 -<br />
6/2003<br />
1/1969 -<br />
6/2003<br />
1/1969 -<br />
6/2003<br />
Lücken nein nein ja ja ja nein<br />
PI (61-03) 569<br />
PI (69-94) 566 582 594 571 579 552<br />
PI (69-03) 567 578 581 579 558<br />
Auffällig ist bei Betrachtung von Tabelle 5-1, dass nur sehr geringe Unterschiede in den mittleren<br />
Niederschlagshöhen der einzelnen Stationen existieren. Daraus könnte abgeleitet werden, dass<br />
eine Betrachtung räumlichen Niederschlagsverteilung nicht notwendig ist.<br />
Es zeigt sich aber wie zu erwarten bei der Analyse von Einzelereignissen, dass sehr wohl beträchtliche<br />
Unterschiede in der Niederschlagshöhen der betrachteten Stationen existieren können, die<br />
bei den in diesem Projekt angestrebten Simulationen in hoher zeitlicher Auflösung mit einbezogen<br />
werden müssen. Tabelle 5-2 listet zu dieser Problematik einige Ereignisse im Zeitraum 1996 bis<br />
2002 auf.<br />
Tabelle 5-2: Niederschlagshöhen einzelner Regenereignisse im Zeitraum 1996 bis 2002<br />
Datum Buch Schönow Rüdnitz Hohen Neuendorf Klosterfelde Mittelwert<br />
03.05.1996 49.4 23.0 24.8 16.0 23.0 27.2<br />
03.07.1997 0.0 28.3 7.6 5.9 5.7 9.5<br />
20.07.1997 27.6 32.5 37.4 50.5 47.5 39.1<br />
12.07.1999 16.7 3.0 1.4 3.0 0.6 4.9<br />
13.07.1999 60.6 22.0 3.5 0.4 2.7 17.8<br />
20.08.1999 12.7 0.3 0.4 2.0 0.5 3.2<br />
17.06.2001 24.1 18.2 11.8 1.8 2.3 11.6<br />
20.09.2001 5.0 17.0 5.9 5.0 4.8 7.5<br />
10.06.2002 7.7 16.0 7.7 2.7 2.8 7.4<br />
16.08.2002 23.7 23.0 0.0 0.2 7.0 10.8
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 33<br />
So ist es auf den ersten Blick unverständlich, warum in Abbildung 5-8 kaum eine Reaktion des<br />
Gebietes auf den in diesem Zeitraum größten Tagesniederschlag von 60,6 mm am 13.07.1999 an<br />
der Station Buch zu verzeichnen ist, während wesentlich geringere Niederschläge beträchtlich<br />
höhere Abflüsse hervorrufen. Neben anderen Einflüssen wie Vorfeuchte etc. spielt die räumliche<br />
Niederschlagsverteilung eine entscheidende Rolle. Analysiert man z.B. den Starkregen vom<br />
13.07.1999 unter Einbeziehung der umliegenden Niederschlagsstationen, so ergibt sich die in<br />
Abbildung 5-2 dargestellte Niederschlagsverteilung mit einem Mittel von lediglich 27 mm für das<br />
Gesamtgebiet (d.h. noch wesentlich weniger im unmittelbaren Einzugsgebiet der Messstelle II) an<br />
diesem Tag, mit dem die geringe Abflussreaktion verständlicher wird.<br />
Abbildung 5-2: Räumliche Niederschlagsverteilung im Untersuchungsgebiet am 13.07.1999<br />
Für das Gebiet des <strong>Lietzengraben</strong> liegt das mittlere Gebietsniederschlagsdargebot 1 bei 625<br />
mm/Jahr und die potenzielle Verdunstung 2 bei 643 mm/Jahr. Die daraus ergebene mittlere klimatische<br />
Wasserbilanz 3 von –18mm/Jahr weist auf die angespannte Wasserhaushaltssituation des<br />
Gebietes hin.<br />
1 Gebietsmittel, korrigiert und inklusive Schneeschmelzmodellierung<br />
2 berechnet nach Turc/Ivanow mit monatsbezogener Korrektur nach Glugla, d.h. im Jahr ca. 10% Erhöhung<br />
3 Differenz zwischen Niederschlag und potenzieller Verdunstung
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 34<br />
Die folgende Abbildung 5-3 zeigt die zeitliche Variabilität des korrigierten Niederschlages, der<br />
potenziellen Verdunstung und der klimatischen Wasserbilanz als Jahressummen für den Zeitraum<br />
von 1969 bis 2002. Anhand der Wasserbilanz ist zu erkennen, dass in Einzeljahren wie 1982 mit –<br />
300 mm weit größere Defizite als die erwähnten –18 mm als Mittelwert auftreten können. Die<br />
Trendgerade zeigt, dass die einzelnen Jahreswerte das geringe Niveau halten. Eine Abnahme ist<br />
nicht zu erkennen.<br />
Niederschlag und pot. Verdunstung [mm/Jahr]<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
Niederschlag<br />
potenzielle Verdunstung<br />
klimatische Wasserbilanz<br />
Linear (klimatische Wasserbilanz)<br />
0<br />
1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999<br />
Abbildung 5-3: Jahreswerte wichtiger Klimagrößen für den <strong>Lietzengraben</strong><br />
Anders sieht es aus, wenn man die kumulative klimatische Wasserbilanz betrachtet, die sich aus<br />
der Addition der einzelnen Jahreswerte, korrigiert um den Mittelwert ergibt. Dieser kumulative<br />
Wert ist nicht so sehr auf die Darstellung extremer Einzeljahre, sondern mehr auf die ungünstige<br />
Aufeinanderfolge von bestimmten Situationen ausgerichtet. Da Einzugsgebiete Niederschlagswasser<br />
meist nicht innerhalb eines Jahres wieder komplett abgeben, ist die kumulative Wasserbilanz<br />
eine sehr geeignete Größe, um z.B. in der Speicherbewirtschaftung besonders kritische Perioden<br />
zu identifizieren.<br />
Bei Betrachtung von Abbildung 5-4 zeigt sich nun, dass durch die in den 90er Jahren gehäuft aufgetretenen<br />
„Jahrhundertsommer“ bei der kumulativen Wasserbilanz das Minimum im Jahre 2000<br />
auftritt. Die eingetragene Trendgerade deutet eine Abnahme der kumulativen Wasserbilanz um ca.<br />
100 mm in der Jahresreihe 1969 bis 2002 an.<br />
Da die bisherigen Analysen sich auf die berechneten Gebietswerte bezogen und damit auf die Reihe<br />
von 1969 bis 2002 beschränkt waren, soll nun noch die Entwicklung der klimatischen Wasserbilanz<br />
für die Station Buch und für den Zeitraum 1960 bis 2002 analysiert werden. Hier zeigt sich,<br />
wie in Abbildung 5-5 dokumentiert, ebenfalls ein starkes Absinken in den 90er Jahren mit dem<br />
Minimum im Jahre 2000. Inwiefern die eingetragene Trendgerade signifikant ist, wurde im Rahmen<br />
dieser Untersuchungen nicht geklärt. In jedem Falle verschärft diese Entwicklung der klimatischen<br />
Randbedingungen die ohnehin mit Einstellung der Abwasserverrieselung aufgetretenen<br />
Wasserhaushaltsprobleme in diesem Gebiet.<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
-200<br />
-300<br />
-400<br />
klimatische Wasserbilanz [mm/Jahr]
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 35<br />
klimatische Wasserbilanz [mm/Jahr]<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
-200<br />
-300<br />
klimatische Wasserbilanz<br />
kumulierte klimatische Wasserbilanz<br />
Linear (kumulierte klimatische Wasserbilanz)<br />
-400<br />
1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999<br />
Abbildung 5-4: Entwicklung der klimatischen Wasserbilanz für den <strong>Lietzengraben</strong><br />
klimatische Wasserbilanz [mm/Jahr]<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
-200<br />
-300<br />
klimatische Wasserbilanz<br />
kumulierte klimatische Wasserbilanz<br />
Linear (kumulierte klimatische Wasserbilanz)<br />
-400<br />
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000<br />
Abbildung 5-5: Entwicklung der klimatischen Wasserbilanz für die Station Buch
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 36<br />
5.2 Hydrologische Verhältnisse<br />
Für erste Analysen zum hydrologischen Regime des Untersuchungsgebietes und für die spätere<br />
Verifizierung des erstellten Wasserhaushaltsmodells standen Abflussbeobachtungen an verschiedenen<br />
Profilen im Einzugsgebiet zur Verfügung.<br />
Die folgende Abbildung 5-6 zeigt die Lage der beiden Abflussmessstellen am Schönerlinder Weg,<br />
auf die im weiteren noch eingegangen wird und eine weitere Abflussmessstelle im Unterlauf des<br />
<strong>Lietzengraben</strong>s, für die Abflusswerte aus den 80er Jahren vorliegen. Als violette und türkisfarbende<br />
Punkte sind die im Rahmen des ÖSP temporär eingerichteten Grund- und Oberflächenwassermeßstellen.<br />
Zu erkennen ist, dass sich sämtliche Messstellen auf den unmittelbaren Rieselfeldbereich<br />
konzentrieren.<br />
Abbildung 5-6: Verteilung der Messstellen im Untersuchungsgebiet<br />
Für die Zeit des Rieselfeldbetriebes und danach bis ca. 1994 lagen nur wenige Stichtagsmessungen<br />
vor, die allerdings das Gesamtgebiet charakterisieren, da sich die Messstelle unweit des Gebiets-auslasses<br />
befand. Diese Stichtagsmessungen wurden digitalisiert und soweit aufbereitet, dass<br />
eine Auswertung möglich wurde.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 37<br />
Aus der Abbildung 5-7 wird ersichtlich, dass sich bis 1984 der mittlere Abfluss auf einem Niveau<br />
von ca. 1 bis 1,2 m 3 /s ( 4 ) befand. Mit Einstellung des Rieselfeldbetriebes sank dann innerhalb von<br />
wenigen Jahren der Abfluss auf ein Niveau von ca. 0,2 m 3 /s. Ob es bis 1994 zu einem weiteren<br />
Absinken auf ein noch tieferes Niveau kam, kann anhand des einzelnen Messwertes von 42 l/s für<br />
den 14.07.1994 nicht geklärt werden.<br />
Von Kalk wurde 1986 im Rahmen eines Gutachtens prognostiziert, dass sich mit Einstellung der<br />
Abwasserverrieselung nach und nach die natürlichen Abflussverhältnissen von 4,4 l / (s * km 2 )<br />
gemäß NAU-Kartenwerk wieder einstellen werden. Diese Spende steht in recht guter Übereinstimmung<br />
zu den 124 mm/Jahr bzw. 3,9 l / (s * km 2 ), die sich lt. HAD als Gesamtabfluss für dieses<br />
Gebiet ergeben.<br />
Q [m 3 /s]<br />
2.0<br />
1.8<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
02.12.73 28.08.76 25.05.79 18.02.82 14.11.84 11.08.87 07.05.90 31.01.93 28.10.95<br />
Abbildung 5-7: Abflussmessungen für die Zeit des Rieselfeldbetriebes<br />
Welchen mittleren Abfluss des <strong>Lietzengraben</strong>s am Gebietsauslass diese Spendenwerte aber gewährleisten,<br />
ist schwierig zu ermitteln, weil das Speisungs- oder Bilanzgebiet nicht dem unterirdischen<br />
Einzugsgebiet entspricht.<br />
Eine Bestimmung des Bilanzgebietes ist nur über einen detaillierten Isohypsenplan möglich, der<br />
unter Nutzung der beobachteten Grundwasserstände aufzustellen wäre. Zumindest für den nördlichen<br />
Teil des Einzugsgebietes reicht die derzeit verfügbare Messstellendichte dafür allerdings<br />
nicht aus.<br />
Zumindest eine Abschätzung der Größe des Bilanzgebietes ist auch über gemessene Abflussreihen<br />
und Wasserhaushaltsanalysen möglich.<br />
Weitere Abflusswerte lagen für die beiden Abflussmessstellen am Schönerlinder Weg für den<br />
Zeitraum von 1996 bis 1998 komplett digital vor. Für das Jahr 1999 mussten die nur in Listen<br />
vorliegenden Werte digitalisiert werden.<br />
4 1,2 m 3 /s wurde aus den in der Abbildung dargestellten Messwerten ermittelt. Kalk (1986) gibt 1,05 m 3 /s an.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 38<br />
Die folgende Abbildung 5-8 zeigt die Abflussganglinie für den <strong>Lietzengraben</strong> am Schönerlinder<br />
Weg (Messstelle II) gemeinsam mit dem Niederschlag der Station Buch, die Hauptwerte sind in<br />
Anlage 2 aufgelistet.<br />
Durchfluss [l/s]<br />
300 0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Niederschlag Station Buch<br />
Durchfluss Messstelle II<br />
0<br />
100<br />
01.01.1996 29.06.1996 26.12.1996 24.06.1997 21.12.1997 19.06.1998 16.12.1998 14.06.1999 11.12.1999<br />
Abbildung 5-8: Abfluss nach Rieselfeldbetrieb, <strong>Lietzengraben</strong>, Schönerlinder Weg<br />
Der mittlere Abfluss beträgt an diesem Querschnitt 30 l/s. Bei einem (oberirdischen) Einzugsgebiet<br />
von 34,7 km 2 entspricht dies einer mittleren Abflussspende von 0,87 l/(s km²). Diese Spende<br />
liegt lediglich bei 20 bis 25% der mittleren Abflussspenden, die sich gemäß NAU-Kartenwerk und<br />
HAD-Atlas ergeben (s. Seite 37). Für diese Abweichungen kommen folgende Gründe in Frage:<br />
1. Das oberirdische Einzugsgebiet entspricht nicht dem unterirdischen, d.h. Teile der Versickerung<br />
im oberirdischen Einzugsgebiet werden nicht am Messprofil bilanzwirksam.<br />
2. Die Abflussbildungsbedingungen unterscheiden sich im Teilgebiet bis zur Messstelle II von<br />
den mittleren Bedingungen im gesamten Einzugsgebiet. So liegt der Waldanteil im Teilgebiet<br />
bei ca. 73%, im gesamten oberirdischen Einzugsgebiet bei 61%.<br />
3. Die Staubewirtschaftung bewirkt neben der (gewollten) Abflussvergleichmäßigung auch eine<br />
Erhöhung der Grundwasserstände im Staubereich, die mit einer Erhöhung der Verdunstung<br />
einhergeht.<br />
4. Der Beobachtungszeitraum 1996 bis 1999 ist nicht repräsentativ für die (derzeitigen) mittleren<br />
meteorologischen Gegebenheiten im Gebiet. So liegt die klimatische Wasserbilanz des Gebietes<br />
für den Zeitraum von 1969 bis 2002 bei –18 mm/Jahr, für die 4 Jahre des Beobachtungszeitraum<br />
bei – 63 mm/Jahr.<br />
Alle drei Faktoren bewirken eine Verringerung der Abflüsse. Die Erklärung für die sehr geringen<br />
Abflusswerte im <strong>Lietzengraben</strong> wird sicherlich im Zusammenwirken aller drei Faktoren zu suchen<br />
sein. Eine Quantifizierung der Einzeleinflüsse, insbesondere die bilanzgestützte Ermittlung der<br />
bilanzwirksamen Gebietsgröße wird eine grundlegende Frage für die Modelluntersuchungen in<br />
Kapitel 6.4 sein.<br />
10<br />
20<br />
30<br />
40<br />
50<br />
60<br />
70<br />
80<br />
90<br />
Niederschlag [mm]
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 39<br />
6 Modellgestützte Wasserhaushaltsanalysen<br />
6.1 Erstellung des GIS-Datenmodells<br />
Das GIS-Datenmodell beruht auf den im Kapitel 4 beschriebenen Grundlagendaten mit Raumbezug<br />
wie<br />
� Flächendaten wie Boden, Landnutzung, Oberflächenmorphologie und Grundwasserflurabstände,<br />
� Liniendaten wie Gewässerabschnitte und<br />
� Punktdaten wie<br />
o Klima- und Niederschlagsstationen,<br />
o Abflussmessstellen und<br />
o besondere Gewässerpunkte wie Bauwerke, Steuereinrichtungen, Einleitungen und<br />
Entnahmen aus der fließenden Welle, aber auch aus dem Grundwasser (Brunnen),<br />
die über das GIS-Datenmodell miteinander verknüpft und so für die Modellierung erschlossen<br />
werden.<br />
Das GIS-Datenmodell besteht aus folgenden Covern:<br />
� Elementarflächen EFL als Verschneidung aus Boden- und Landnutzungsinformationen,<br />
denen DGM- Informationen wie Höhe, Gefälle, Aspekt zugeordnet sind,<br />
� oberirdische Teileinzugsgebiete TG (s. Kapitel 4.6),<br />
� Fließgewässerabschnitte FGW inklusive Gewässerknoten zur Abbildung von Bauwerken<br />
etc. (s. oben) und<br />
� meteorologischen Stationen.<br />
6.2 Modellparametrisierung<br />
6.2.1 Abflussbildungsmodell<br />
Unter Nutzung des Systems ArcEGMO kann die Modellierung der Abflussbildung auf der Basis<br />
von Elementarflächen oder von Hydrotopklassen erfolgen. Die Parameter des Abflussbildungsmodells<br />
werden dabei programmintern aus der beschriebenen GIS-Datenbasis ermittelt.<br />
Tabelle 6-1 zeigt die Parameter des Abflussbildungsmodells und die für die Parameterschätzung<br />
genutzten Basisinformationen.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 40<br />
Eine zentrale Rolle innerhalb des Abflussbildungsmodells spielt die Parametrisierung der Boden-<br />
und Nutzungsinformationen. Sie steuern die Grundwasserneubildung als Eingangsgröße in die<br />
Modellebene „Grundwasser“ und damit letztlich die Größe des Grundwasserzuflusses in die<br />
Fließgewässer. Sie steuern aber auch die Simulation der Infiltration und damit die Höhe des Landoberflächenabflusses<br />
als Eingangsgröße in die Modellebene „Direktabfluss“.<br />
Für die hydrologische Modellierung der Direktabflussbildung, der Infiltration und des Bodenwasserhaushaltes<br />
werden der Kf-Wert der obersten Bodenschicht (maßgeblich für die Direktabflussbildung)<br />
und die Bodenkapillarwasserspeicherkapazität in ihrer räumlichen Verteilung benötigt.<br />
Tabelle 6-1: Parameter des Abflussbildungsmodells<br />
Modellparameter Basisinformation<br />
Muldenspeicherkapazität Gefälle<br />
Versieglungsgrad<br />
Interzeptionsspeicherkapazität Flächennutzung<br />
Wurzeltiefe<br />
Grundwassernähe Grundwasserflurabstand, Flächennutzung<br />
Bodenkapillarwasserspeicherkapazität Bodenform, Flächennutzung<br />
Kf-Wert Bodenform<br />
Die Bodenkapillarwasserspeicherkapazität wird ermittelt aus der nutzbaren Feldkapazität, bezogen<br />
auf die Mächtigkeit aller Bodenschichten innerhalb der wechselfeuchten Bodenzone. Die<br />
Mächtigkeit der wechselfeuchten Bodenzone wird als das Minimum aus effektiver Wurzeltiefe,<br />
Grundwasserflurabstand und Bodenmächtigkeit an sich geschätzt. Letztere Bedingung wird wirksam,<br />
wenn oberflächennah Fels ansteht bzw. bei geringmächtigen Lockergesteinsschichten.<br />
Den Landnutzungsklassen werden die folgenden Kennwerte als Grundlage für die Modellparametrisierung<br />
zugeordnet, wobei eigene Erfahrungen, Erkenntnisse aus der Gebietsbefahrung und Literaturwerte<br />
eingehen:<br />
- Versieglungsgrad,<br />
- Interzeptionsspeicherkapazität,<br />
- minimale und maximale Wurzeltiefe während des Vegetationszyklus,<br />
- Bedeckungsgrad,<br />
- Oberflächenrauhigkeit.<br />
6.2.2 Abflusskonzentrationsmodell<br />
Das Abflusskonzentrationsmodell umfasst die Modellebenen<br />
• Direktabfluss,<br />
• Grundwasserabfluss und<br />
• Gewässerabfluss,<br />
die jeweils getrennt parametrisiert werden.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 41<br />
In den einzelnen Modellebenen können unterschiedliche Teilmodelle parallel zur Anwendung<br />
kommen. Dies sind im Einzelnen:<br />
• kinematische Welle zur Beschreibung der Abflusskonzentration auf der Landoberfläche,<br />
• unterschiedlich detaillierte Einzellinearspeicheransätze zur Beschreibung der Abflusskonzentration<br />
im Grundwasser oder<br />
• extern in einem Grundwasserströmungsmodell berechnete Grundwasserzuflüsse zum Gewässer<br />
(Modellkopplung erforderlich),<br />
• Systemantwortfunktionen zur Beschreibung der Abflusskonzentration auf der Landoberfläche<br />
und im Gewässer,<br />
• Linearspeicherkaskaden zur Beschreibung der Abflusskonzentration im Gewässer.<br />
Da die Teilmodelle unabhängig voneinander und unter Nutzung unterschiedlicher Grundinformationen<br />
und Algorithmen parametrisiert werden, kann auch hier eine relativ hohe Modellsicherheit<br />
erreicht werden.<br />
Für die Untersuchungen in der jetzigen Bearbeitungsphase wird die Abflusskonzentration im<br />
Grundwasser und im Gewässersystem über Linearspeicheransätze modelliert.<br />
In der zweiten Bearbeitungsetappe erfolgt die Kopplung mit einem Grundwassermodell. Die Beschreibung<br />
des Gewässersystems wird dann unter Nutzung der derzeit aufgenommenen Vermessungen<br />
präzisiert und die Abbildung hier vorhandenen Steuerungseinrichtungen integriert.<br />
6.3 Modellkalibrierung und -validierung<br />
Eine Modellkalibrierung im klassischen Sinne anhand von Beobachtungsdaten war nur bedingt<br />
möglich.<br />
Für die Zeit bis ca. 1985 wird der Wasserhaushalt des Gebietes maßgeblich von der Größe der<br />
Abwasserbeschickung bestimmt, für die allerdings keine hinreichenden Angaben vorliegen.<br />
Die Abflussreihen für den Schönerlinder Weg sind, wie im Kapitel 5.2 erläutert wurde, keinem<br />
definierten Einzugsgebiet zuzuordnen.<br />
Letztlich sind damit vorerst nur Plausibilitätsbetrachtungen und eine Validierung der Modellergebnisse<br />
im Vergleich mit anderen Modellen möglich.<br />
Bessere Möglichkeiten zur Verifizierung des Modells werden sich in der zweiten Projektphase mit<br />
der dann möglichen Einbeziehung beobachteter Grundwasserstände und von Wasserständen im<br />
Gewässer ergeben.<br />
Wie schon im Kapitel 5. erläutert wurde, wurde von Kalk (1986) für das Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong><br />
als mittlere Abflussspende 4,4 l/(s*km 2 ) gemäß NAU-Kartenwerk angegeben. Der<br />
HAD liegt mit 3,9 l/(s*km 2 ) in der gleichen Größenordnung. Höhere Werte gibt mit 155 mm/a<br />
gibt Glugla an (s. UIS Berlin, Berechnungen mit ABIMO), die sich allerdings nur auf den unteren<br />
Bereich des Einzugsgebietes bis Schönow im Osten und Gorinsee im Westen beziehen.<br />
Die Modellrechnungen mit dem Wasserhaushaltsmodell ergaben für den Zeitraum von 1969 bis<br />
2003 3,65 l/(s*km 2 ) und für den Zeitraum von 1969 bis 1989 (also ohne die sehr warmen 90er<br />
Jahre) 3,75 l/(s*km 2 ). Für das Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s liegen die Abflussspenden also<br />
geringfügig unter denen des NAU-Kartenwerkes bzw. des HAD.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 42<br />
Betrachtet man allerdings das gesamte Untersuchungsgebiet, so ergaben sich für den Zeitraum<br />
1969 bis 2003 5,2 l/(s*km 2 ), die allerdings vor allem durch einen, gegenüber dem <strong>Lietzengraben</strong>gebiet<br />
beträchtlich höheren Direktabfluss hervorgerufen wird, der von den versiegelten Bereichen<br />
der östlich vom <strong>Lietzengraben</strong> liegenden Ortschaften Zepernick und Röntgenthal herrührt.<br />
Tabelle 6-2: Berechnete Abflussspenden im vergleich mit anderen Modellwerten<br />
mittlere Abflussspende<br />
(l/s/km 2 )<br />
Gesamtabfluss<br />
mm/a<br />
ArcEGMO<br />
1969 bis 2003 3.65 114<br />
ArcEGMO<br />
1969 bis 1989 3,75 118<br />
ArcEGMO<br />
1969 bis 1989 5,2 164<br />
NAU-Karten<br />
(Kalk 1986) 4.4 139<br />
HAD<br />
ABIMO<br />
(s. UIS Berlin)<br />
3.9 122<br />
155<br />
Bezugsraum<br />
oberirdisches Einzugsgebiet<br />
(54 km 2 )<br />
oberirdisches Einzugsgebiet<br />
(54 km 2 )<br />
Untersuchungsgebiet<br />
(113 km 2 )<br />
oberirdisches Einzugsgebiet<br />
(54 km 2 )<br />
unterer Teil des oberirdischen<br />
Einzugsgebietes<br />
(ca. 30 km 2 )
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 43<br />
6.4 Modellanalysen zu einer ersten Charakterisierung des<br />
Gebietswasserhaushaltes<br />
Erste Modellrechnungen mit dem Wasserhaushaltsmodell ohne Kopplung mit dem Grundwassermodell<br />
erfolgten als Tageswertsimulationen für den Zeitraum 1969 bis Juni 2003 und unter Nutzung<br />
der bisher zur Verfügung stehenden Daten und mit dem Wasserhaushaltsmodell.<br />
Die folgende Tabelle 6-3 beinhaltet die berechneten teileinzugsgebietsbezogenen Wasserhaushaltsgrößen.<br />
Tabelle 6-3: Teilgebietsbezogene Wasserhaushaltsgrößen, Mittelwerte für den Zeitraum<br />
1969 bis 2003<br />
Fläche PI EP ER GWN RO Rges<br />
TG_ID [km 2 ] [mm/Jahr]<br />
1 29.18 619 642 518 82 17 100<br />
2 2.63 620 642 516 50 52 102<br />
3 2.58 618 642 486 114 17 131<br />
4 3.94 619 642 456 102 59 161<br />
5 1.60 620 642 529 66 23 89<br />
6 1.81 622 641 424 118 77 195<br />
7 1.78 620 640 470 132 16 148<br />
8 1.65 622 642 472 141 7 147<br />
9 1.25 622 642 526 95 0 95<br />
10 1.61 622 642 524 97 0 97<br />
11 4.54 621 642 486 110 24 134<br />
12 0.08 621 641 531 89 0 89<br />
13 1.81 621 643 486 114 19 133<br />
99 58.90 619 642 459 149 60 208<br />
oberird. Einzugsgebiet 54.48 23 115<br />
Untersuchungsgebiet 113.37 42 164<br />
bis Messstelle II 34.68 100<br />
PI – korr. Niederschlag, EP und ER – pot. und reale Verdunstung,<br />
GWN – Versickerung, RO – Landoberflächenabfluss, Rges = GWN + RO<br />
Abbildung 6-1 zeigt die elementarflächenbezogene Versickerung und den Landoberflächenabfluss<br />
in ihrer räumlichen Verteilung als „Übersicht“. Auf eine Darstellung als Karte mit Legende etc.<br />
wurde auf Grund der Vorläufigkeit der Ergebnisse verzichtet.
Abbildung 6-1: Räumliche Verteilung der Versickerung (links) und des Landoberflächenabflusses (rechts) im Untersuchungsgebiet,<br />
Mittelwerte für die Reihe 1969 bis 2002
Intensivere Farben stehen in dieser Abbildung für höhere Werte. Insgesamt ist die Verteilung<br />
plausibel. Die geringsten Versickerungen sind unter Nadelwald im Norden des Einzugsgebietes<br />
und auf den grundwassernahen Flächen zu finden. Hohe Direktabflüsse korrespondieren wiederum<br />
mit der Versiegelung.<br />
Die folgende Abbildung 6-2 zeigt die Ergebnisse erster Gangliniensimulationen für den <strong>Lietzengraben</strong>,<br />
Höhe Schönerlinder Weg im Vergleich mit den Messwerten der Messstelle II.<br />
Zu erkennen ist, dass der berechnete Abfluss (blau) im Mittel beträchtlich über der gemessenen<br />
Ganglinie (rot) liegt. Dies war auf Grund der Wasserhaushaltsanalysen nicht anders zu erwarten.<br />
Der Mittelwert der simulierten Abflüsse liegt für die dargestellte Periode von 1969 bis 2003 bei<br />
109 l/s. Dies entspricht bei dem hier angesetzten Bilanzgebiet von 34,7 km 2 (Annahme: Bilanzgebiet<br />
gleich oberirdisches Einzugsgebiet) einer Abflussspende von 3,14 l/(s*km 2 ).<br />
Die geringere Abflussspende für dieses Teilgebiet gegenüber dem für das Gesamtgebiet berechneten<br />
Spendenwert von 3,65 l/(s*km 2 ) resultiert aus den unterschiedlichen Abflussbildungsbedingungen,<br />
vor allem aus den unterschiedlichen Waldanteilen (73% im oberen Gebietsteil gegenüber<br />
61% im Gesamtgebiet).<br />
Bei Betrachtung der simulierten Abflussganglinie fallen auch beträchtliche Abflussschwankungen<br />
auf, und zwar nicht nur die Ausprägung einzelner Hochwasserspitzen, sondern auch Schwankungen,<br />
die das Abflussniveau auch für längere Perioden auf unterschiedlicher Höhe halten. So<br />
schwanken die Jahresmittelwerte zwischen 50 und 200 l/s. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit,<br />
für abgesicherte Wasserhaushaltsbetrachtungen Modellrechnungen über längere Zeiträume durchzuführen<br />
(mindestens 15 bis 20 Jahre).<br />
Abfluss [l/s]<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Schönerlinder Weg<br />
gemessen<br />
0<br />
Jun. 68 Dez. 73 Mai. 79 Nov. 84 Mai. 90 Okt. 95 Apr. 01<br />
Abbildung 6-2: Berechnete Abflussganglinien für den <strong>Lietzengraben</strong>, Schönerlinder Weg<br />
für den Zeitraum 1969 bis 2003
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 46<br />
So stellen die Jahre von 1996 bis 1999, für die Messwerte vorliegen, gegenüber dem Zeitraum von<br />
1969 bis 2003 eine sehr trockene Periode dar. Die berechneten Jahresmittelwerte liegen bei 85 l/s<br />
für 1996, 48 und 45 l/s für 1997 und 1998 und erst für 1999 ist wieder ein Anstieg auf 105 l/s festzustellen,<br />
d.h. auf das Niveau des mittleren Abflusses im Gesamtzeitraum. Die sehr geringen Abflüsse<br />
in 1997 und 1998 kommen in etwa in die Größenordnung der Messwerte, die im Mittel bei<br />
30 l/s liegen.<br />
Dies bedeutet letztlich, dass der Zeitraum, der mit Abflussmessungen belegbar ist, nicht repräsentativ<br />
für die Einschätzung des mittleren hydrologischen Regimes des <strong>Lietzengraben</strong>s ist.<br />
Die folgende Abbildung zeigt nun etwas detaillierter die Simulationsergebnisse für den Zeitraum<br />
mit Messwerten von 1996 bis 1999.<br />
Abfluss [l/s]<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
01.01.1996<br />
01.03.1996<br />
01.05.1996<br />
01.07.1996<br />
01.09.1996<br />
01.11.1996<br />
01.01.1997<br />
gemessen<br />
berechnet für oberirdisches Ae<br />
berechnet für verringertes oberirdisches Ae<br />
01.03.1997<br />
01.05.1997<br />
01.07.1997<br />
01.09.1997<br />
01.11.1997<br />
Abbildung 6-3: Berechnete Abflussganglinien für den <strong>Lietzengraben</strong>, Schönerlinder Weg<br />
für den Zeitraum 1996 bis 1999<br />
Zu erkennen ist, dass phasenweise die modellierte Ganglinie (blau) die gemessene (rot) hinsichtlich<br />
der Dynamik ähnlich widerspiegelt, wenn auch auf einem wesentlich höheren Niveau, zum<br />
Teil aber auch die berechnete Ganglinie eine wesentlich höhere Dynamik aufweist als die gemessene.<br />
Für die Abweichungen sind folgende Ursachen maßgebend:<br />
1. Zum einen ist es sehr wahrscheinlich, dass nur Teile des oberirdischen Einzugsgebietes an<br />
dieser Messstelle bilanzwirksam werden. Dazu wurde das bilanzwirksame Gebiet wurde auf<br />
ca. 17 km 2 reduziert, d.h. halbiert. Die grüne Ganglinie zeigt das Ergebnis, die Ganglinie erreicht<br />
in den ersten drei trockenen Jahren das Niveau der Messwerte. Anschließend in 1999<br />
steigen die berechneten Abflüsse allerdings zu schnell wieder an.<br />
01.01.1998<br />
01.03.1998<br />
01.05.1998<br />
01.07.1998<br />
01.09.1998<br />
01.11.1998<br />
01.01.1999<br />
01.03.1999<br />
01.05.1999<br />
01.07.1999<br />
01.09.1999<br />
01.11.1999
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 47<br />
2. Ebenfalls nicht befriedigen kann die Abflussdynamik. Diese wird im <strong>Lietzengraben</strong> im Wesentlichen<br />
durch die Grundwasserdynamik geprägt. Im jetzt angewendeten Modell wird die<br />
Grundwasserkomponente über Einzellinearspeicheransätze abgebildet. Mit weiter optimierten<br />
Parametern dieses einfachen Modells wäre eine weit bessere als die hier gezeigte Abbildung<br />
der gemessenen Ganglinie möglich gewesen. Darauf wurde aber verzichtet, weil mit Einzellinearspeichern<br />
nicht die hier abzubildenden Prozesse modelliert werden können. Dazu wurde,<br />
wie in den folgenden Kapiteln beschrieben, ein Grundwasserströmungsmodells aufgebaut und<br />
dieses mit dem beschriebenen Abflussbildungsmodell gekoppelt.<br />
3. Des weiteren wird die Dynamik durch die Abflusskonzentrationsprozesse im Gewässer selbst<br />
und die hier stattfindende Bewirtschaftung durch Stauhaltungen geprägt, die diesen Berechnungen<br />
noch nicht berücksichtigt wurden.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 48<br />
7 Modellanalysen mit dem gekoppelten Grundwasser-<br />
Oberflächenwassermodell<br />
7.1 Modellaufbau und Parametrisierung<br />
Basierend auf dem im letzten Kapitel beschriebenen Niederschlags-Abfluss-Modell wurde eine<br />
Kopplung mit einem Grundwasserströmungsmodell vorgenommen. Die Kopplung erfolgt durch<br />
einen Datenaustausch zwischen NA-Modell und Grundwassermodell in definierten Zeitabständen.<br />
Als Datengrundlage dienten die, vor allem hinsichtlich der Fließprofile, Geländehöhen und Bodendaten<br />
präzisierten Ausgangsdaten (siehe Anhang 4) sowie neu parametrisierte Größen hinsichtlich<br />
des Grundwasserleiters (Aquifersohle, Durchlässigkeiten, Speichereigenschaften, hydraulischer<br />
Kontakt zwischen Oberflächen- und Grundwasser) .<br />
Austauschgrößen sind die Grundwasserneubildung und die Wasserstände im Gewässersystem, die<br />
als zeitlich veränderliche Randbedingungen für das Grundwassermodell fungieren. Das GW-<br />
Modell wiederum übergibt den Grundwasserstand und den Wasseraustausch (Zustrom oder Reinfaltration)<br />
mit dem Gewässer an das NA-Modell.<br />
Eine wesentliche Randbedingung, über die die Bewirtschaftungsmöglichkeiten abgebildet werden,<br />
sind die Wasserstände im Gewässer. Die Modellierung dieser Wasserstände inklusive der Möglichkeit,<br />
verschiedene Bewirtschaftungen (Wehrsteuerung, Einspeisung von Zusatzwasser etc.)<br />
abzubilden, erforderte wesentliche Erweiterungen für das im Kapitel 6 beschriebene Wasserhaushaltsmodell,<br />
vor allem hinsichtlich der Beschreibung der Abflussretentionsprozesse. Grundlage<br />
dafür ist die Einbeziehung der Gewässergeometrien und –rauheiten und der hydraulischen Kennwerte<br />
der wasserbaulichen Anlagen (Wehre, Staue) inklusive ihrer Steuerregeln.<br />
Die dafür notwendigen Ergänzungen der Datenbasis wurden im Kapitel 4.5 beschrieben.<br />
Weiterhin wurde für die gekoppelte Modellierung eine Reduzierung des Bilanzgebiets vorgenommen.<br />
Wie aus den Isohypsenplänen für den obersten Aquifer ersichtlich ist, ist das unterirdische<br />
Einzugsgebiet nicht identisch mit dem oberirdischen Einzugsgebiet. Im nördlichen Teil des<br />
Einzugsgebiets richtet sich die Grundwasserbewegung nach Nordwesten und wird somit nicht in<br />
das Untersuchungsgebiet abgeführt. Für die gekoppelte Modellierung wurde das Einzugsgebiet im<br />
Norden vorerst in Anlehnung an die Hydrogeologischen Karten dieser Gegend um 15,3 km² reduziert.<br />
Diese Reduzierung wurde mit den Ergebnissen aus der stationären Modellierung abgeglichen<br />
und angepasst. Die modellierten Grundwasserstände sind demnach auch nur für das reduzierte<br />
Bilanzgebiet dargestellt.<br />
Die Aquifersohle des obersten Grundwasserstockwerks wurde wie schon für das stationäre Modell<br />
(Anlage Wachholz) beschrieben aus den Bohrprofilen der Grundwasserpegel über die Fläche des<br />
Untersuchungsgebiets interpoliert.<br />
Der Wasserstand in den Gräben wurde für den Anfangszustand des Models auf 30 cm festgelegt.<br />
Im Bereich der Wehre werden die Anfangswasserstände auf das Stauziel angehoben. Jedes geschlossene<br />
Wehr gibt das Stauziel als Anfangswasserstand vor, der für alle oberhalb liegenden<br />
Gewässerabschnitte gilt, solange ihre Wasserstände niedriger liegen als das Stauziel (siehe<br />
Abbildung 7-1 bis Abbildung 7-3).
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 49<br />
Meter über NN<br />
63<br />
61<br />
59<br />
57<br />
55<br />
53<br />
51<br />
49<br />
47<br />
Stau12<br />
70<br />
1380<br />
2380<br />
3043<br />
3785<br />
<strong>Lietzengraben</strong><br />
Stauziel<br />
Uferhöhe<br />
Sohlhöhe<br />
Wasserstand bei geöffnetem Wehr<br />
Wasserstand bei geschlossenem Wehr<br />
Stau 11 Stau 7 Stau 9a Stau 9<br />
4255<br />
4675<br />
5080<br />
5388<br />
5888<br />
6353<br />
Entfernung zur Mündung [m]<br />
Abbildung 7-1: Wasserstandsanhebung durch Einstau am <strong>Lietzengraben</strong><br />
Meter über NN<br />
63<br />
62<br />
61<br />
60<br />
59<br />
58<br />
57<br />
56<br />
55<br />
54<br />
53<br />
45<br />
Graben2<br />
Stauziel<br />
Uferhöhe<br />
Sohlhöhe<br />
Wasserstand bei geöffnetem Wehr<br />
Wasserstand bei geschlossenem Wehr<br />
145<br />
Stau 5<br />
245<br />
370<br />
520<br />
660<br />
800<br />
Stau 13<br />
945<br />
1080<br />
Entfernung zur Mündung [m]<br />
Abbildung 7-2: Wasserstandsanhebung durch Einstau am Graben 2<br />
1255<br />
7428<br />
1450<br />
8143<br />
Stau 14<br />
1615<br />
8763<br />
1765<br />
9288<br />
2115
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 50<br />
Meter über NN<br />
65<br />
63<br />
61<br />
59<br />
57<br />
55<br />
53<br />
51<br />
45<br />
245<br />
346<br />
547<br />
747<br />
967<br />
Graben1<br />
Stauziel<br />
Uferhöhe<br />
Sohlhöhe<br />
Wasserstand bei geöffnetem Wehr<br />
Wasserstand bei geschlossenem Wehr<br />
1197<br />
Stau 4 Stau 10<br />
1462<br />
1842<br />
2372<br />
Entfernung zur Mündung [m]<br />
Abbildung 7-3: Wasserstandsanhebung durch Einstau am Graben 1<br />
In Abbildung 7-1 bis Abbildung 7-3 wird deutlich, dass die Grabentiefen auch bei geschlossenen<br />
Wehren ausreichend sind, um die Abflussmengen aufzunehmen. Auch die geringen Uferhöhen im<br />
Bereich der beiden Staue am Graben 1 sollten in Anbetracht der geringen Abflüsse im Graben 1<br />
keinen Problembereich darstellen.<br />
2767<br />
3102<br />
3947<br />
4297<br />
4487
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 51<br />
7.2 Modellkalibrierung<br />
Für das gekoppelte Grundwassermodell wurde eine Kalibrierung anhand der im Untersuchungsgebiet<br />
vorhandenen und in unterschiedlicher zeitlicher Auflösung gemessenen Grundwasserganglinien<br />
und der zwei Abflussganglinien an der Messstelle II und am Graben 2 auf Höhe des Schönerlinder<br />
Weges vorgenommen.<br />
Für das Grundwassermodul ASM ist die Anpassung folgender Parameter notwendig:<br />
• kf-Wert für die Durchlässigkeit des Aquifers,<br />
• S-Koeffizient, der die Speicherwirkung des Aquifers charakterisiert und<br />
• Leakagewert, der den hydraulischen Kontakt zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser<br />
beschreibt.<br />
Die Wirkung der Parameter lässt sich wie folgt beschreiben:<br />
• Eine Erhöhung des kf-Wert beschreibt die Beschleunigung der Grundwasserbewegung und<br />
bewirkt somit ein geringeres Gefälle in der Grundwasseroberfläche. Aber auch die Form<br />
der Amplitude kann dadurch beeinflusst werden, je nachdem ob der Grundwasserpegel im<br />
Abstrom oder im Zustrom zum Vorfluter liegt. Eine Verringerung bremst die Grundwasserbewegung<br />
und bewirkt somit ein höheres Gefälle der Grundwasseroberfläche.<br />
• Eine Erhöhung des Speicherkoeffizienten bewirkt einen geringeren Amplitudenausschlag<br />
der Grundwasserganglinie. D.h. je höher das speicherfähige Volumen im Substrat, desto<br />
geringer wirken sich Volumenänderungen in einer Höhendifferenz der Grundwasserganglinie<br />
aus. Eine Reduzierung des Speicherkoeffizienten verstärkt den Amplitudenausschlag.<br />
• Ein erhöhter Leakagewert begünstigt sowohl das Zuströmen des Grundwassers zum Vorfluter,<br />
als auch den Wasserverlust aus den Gräben zum Grundwasser, je nach Gefälle zwischen<br />
Grundwasserstand und Grabenwasserstand. Eine Reduzierung des Leakagewertes<br />
verringert diese Interaktion in beiden Richtungen.<br />
Der hydraulische Kontakt zwischen Grundwasser und Oberflächengewässer ist von den Durchlässigkeiten<br />
der Gräben abhängig, die sich in Leakagewerten ausdrücken lassen. Die Leakagewerte<br />
sind im Bereich der Grabensohle durch Kolmation geringer als in den Böschungen, so dass bei<br />
höheren Wasserständen im Graben mehr Wasser an das Grundwasser abgegeben werden kann, als<br />
bei geringen Wasserständen. Die aktuelle Datenbasis beinhaltet dazu eine Unterscheidung der<br />
Leakage-Raten für den Abstrom aus, und den Zustrom in das Gewässer. Die Reinfiltration aus<br />
dem Grundwasser in das Gewässer wurde um einen Faktor kleiner gewählt, da sich der Abstrom<br />
aus den Gräben zum Grundwasser bei höheren Grabenwasserständen, also vornehmlich über die<br />
Uferbereiche, und der Rückstrom bei geringeren Grabenwasserständen, also vornehmlich über die<br />
Sohlbereiche, vollzieht.<br />
Bei der Kalibrierung der Leakagewerte konnte auf die Ergebnisse der stationären Grundwassermodellierung<br />
zurückgegriffen werden. So wurde für die Leakgewerte der in der Modelllaufzeit als<br />
durchschnittlich ermittelte Wassertransfer zwischen Grundwasser und Oberflächenwasser verwendet<br />
um die Interaktion abzubilden. In welche Richtung sich die Wasserbewegung dabei vollzieht,<br />
wird in jedem Rechenschritt erneut aus dem Gefälle zwischen Grundwasser- und Oberflächenwasserstand<br />
ermittelt.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 52<br />
Die kf-Werte wurden anfangs aus der stationären Modellierung mit PMWIN (siehe Anlage<br />
WACHHOLZ) für die 20 festgelegten Regionen übernommen. Dabei ergaben sich aber zwei<br />
Probleme: in einigen der Regionen zeigten alle modellierten Grundwasserpegel Abweichungen zu<br />
den gemessenen. Für diese Regionen wurde eine zusätzliche Anpassung per Hand vorgenommen,<br />
bis die Grundwasserganglinien annähernd nachgebildet wurden. Ein weiteres Problem ergab sich<br />
an Regionsgrenzen zwei benachbarter Regionen mit sehr unterschiedlichen kf-Werten. Der kf-<br />
Wert Wechsel bewirkt ein plötzliches Ansteigen oder Abfallen der Grundwasserstände, was sich<br />
bei geringen Flurabständen auch in plötzlichem Abflussanstieg oder Abflussverringerung auswirken<br />
kann. Diese plötzlichen Wechsel beschreiben nicht die natürlichen Gegebenheiten, so dass die<br />
kf-Wert-Regionen für die gekoppelte Modellierung nicht verwendet werden konnten. Stattdessen<br />
sind die Durchlässigkeiten des Aquifers aus den Substratangaben für die Bohrprofile der Grundwasserpegel<br />
nach der KA4 abgeleitet worden und mit einer Kriging - Interpolationsmethode auf<br />
den Raum übertragen worden (siehe Abbildung 7-4). Die Bohrungen können allerdings nur punktuelle<br />
Ergebnisse liefern. In der Natur sind die kf-Werte regional sehr starken Änderungen unterlegen<br />
und können kleinräumig große Variabilität aufweisen. Um eine größere Fläche zu beschreiben<br />
wäre also ein Mittlung der auf ihr vorkommenden kf-Werte erforderlich. Flächenbezogenen<br />
Daten liefern die Pumpversuche, die aber in ihrer Durchführung aufwändig und kostenintensiv<br />
sind.<br />
Abbildung 7-4: Räumliche Verteilung der kF-Werte
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 53<br />
Für die Speicherkoeffizienten zeichnete sich eine deutlich Nord-Südteilung des Gebietes ab. In<br />
der südlichen Region wurden Speicherkoeffizienten von 0.25 kalibriert, während in den nördlichen<br />
Regionen Speicherkoeffizienten von 0.1 angepasst wurden. Eine Übergangzone zwischen<br />
den Gebieten mit hohen und niedrigen Speicherkoeffizienten konnte dabei nicht ausgemacht werden.<br />
Die scharfe Abgrenzung lässt sich durch die unterschiedliche geologische Struktur von Urstromtal<br />
mit seinen rein sandigen Sedimenten (Süden) und der Barnimhochfläche mit Geschiebemergeleinlagerungen<br />
(Norden) erklären (siehe Abbildung 7-5).<br />
Abbildung 7-5: Räumliche Ausprägung des Speichereigenschaften
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 54<br />
7.3 Modellanalysen<br />
Die Modellrechnungen mit dem gekoppelten Wasserhaushaltsmodell wurden als eine Langzeitsimulation<br />
für den Zeitraum von Januar 1969 bis Juni 2003, sowie in mehreren Szenarienrechnungen<br />
von Januar 1986 bis Juni 2003 durchgeführt.<br />
Die Langzeitsimulation erfolgte über einen Zeitraum von über 30 Jahren, um die langjährigen<br />
Mittel sowie Schwankungsperioden abzubilden. In den letzten 30 Jahren sind auf dem Rieselfeld<br />
grundlegende Veränderungen vorgenommen worden (wie z.B. Maximierung des Rieselfeldbetriebs<br />
(1960er - 1970er), Einstellung des Rieselfeldbetriebs 1985, Ausforstung (1987-1989), Überlehmungsmaßnahmen<br />
(1999-jetzt), Einleitungsversuche (1992-1994 und 2004-jetzt), die den Wasserhaushalt<br />
nachhaltig beeinflussen und nicht in der Langzeitsimulation berücksichtigt werden. So<br />
werden durch die Modellierung zwar die klimatischen Veränderungen mit abgebildet, nicht aber<br />
die Bewirtschaftungs- und Landschaftsveränderungen im Gebiet, so dass die Ergebnisse für die<br />
1970er und 1980er Jahre nicht die damals realistischen Verhältnisse nachbilden.<br />
Die Ergebnisse der Langzeitsimulation stellen die Auswirkung der klimatischen Änderung über<br />
die letzten dreißig Jahre auf den Wasserhaushalt dar. Die Abbildung 7-6 und Abbildung 7-7 zeigen<br />
deutlich, dass die Abflussverhältnisse aber auch die Grundwasserstände in der Zeit von 1969<br />
bis 1981 höher waren als in den 1990er Jahren. Die Abflüsse in den 1970er Jahren waren im Mittel<br />
doppelt so hoch wie die Abflüsse in den 1990er Jahren. Die Grundwasserstände sind seit 1981<br />
um mehr als einen halben Meter gesunken, dabei sind, wie oben schon erläutert, die Einflüsse<br />
durch die Rieselfelder nicht mit berücksichtigt. So muss davon ausgegangen werden, dass die Abflüsse<br />
und Grundwasserstände unter dem Einfluss der Rieselfeldwirtschaft bis 1985 noch wesentlich<br />
höher waren. In Abbildung 7-8 sind Abflussmessungen zur Zeit der Rieselfeldbewirtschaftung<br />
den modellierten Abflüssen (ohne Berücksichtigung der Rieselfeldbewirtschaftung) gegenübergestellt.<br />
Die gemessenen Abflüsse übersteigen die modellierten ca. um das Fünffache.<br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
59<br />
58<br />
57<br />
56<br />
Grundwasserstand gemessen Grundwasserganglinie modelliert<br />
1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# FB7894 #<br />
#<br />
#<br />
# ## #<br />
# # #<br />
##<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# # #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# #<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
Abbildung 7-6: Langzeitsimulation der Grundwasserganglinie am Pegel FB7894<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 55<br />
Abfluss [l/s]<br />
Abbildung 7-7: Langzeitsimulation der Abflüsse an Messstelle II (Schönerlinder Weg)<br />
Abfluss [m³/s]<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
01.01.1969<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
0.800<br />
0.600<br />
0.400<br />
0.200<br />
0.000<br />
01.01.1971<br />
01.01.1973<br />
Abflussganglinie modelliert Durchfluss Messstelle II<br />
01.01.1975<br />
01.01.1977<br />
01.01.1979<br />
01.01.1981<br />
01.01.1983<br />
01.01.1985<br />
Abfluss gemessen<br />
Abfluss modelliert<br />
11.06.68 02.12.73 25.05.79 14.11.84 07.05.90 28.10.95<br />
Abbildung 7-8: Durch die Rieselfeldbewirtschaftung stark erhöhter Abfluss<br />
01.01.1987<br />
01.01.1989<br />
01.01.1991<br />
01.01.1993<br />
01.01.1995<br />
01.01.1997<br />
01.01.1999<br />
01.01.2001
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 56<br />
Die Simulation des Ist-Zustandes soll die aktuellen Verhältnisse abbilden. Die Wasserhaushaltsgrößen<br />
für das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 7-1 dargestellt. Die gemessenen Niederschläge<br />
(PI) sind geringer als die potenzielle Verdunstung (EP). Die reelle Verdunstung (EP)<br />
macht aber nur ca. 80% des Niederschlags aus. Die restlichen 20% teilen sich auf die Grundwasserneubildung<br />
(GWN), den hypodermischen Abfluss (RH), den Oberflächenabfluss (RO und die<br />
Speicheränderung (S) auf.<br />
Tabelle 7-1: Wasserhaushaltsgrößen für das Untersuchungsgebiet<br />
Wasserhaushaltsgröße Gebietsdurchschnitt [mm/a]<br />
Niederschlag 625<br />
Verdunstung potenziell 663<br />
Verdunstung reell 505<br />
Grundwasserneubildung 107<br />
Hypodermischer Abfluss 6<br />
Oberflächenabfluss 9<br />
Speicheränderung -2<br />
In den Abbildung 7-9 und Abbildung 7-10 sind die Abflussmessungen von 1996-1999 am <strong>Lietzengraben</strong><br />
an der Messstelle II und am Graben 2 auf Höhe des Schönerlinder Weges den modellierten<br />
Abflüssen an diesen Stellen gegenübergestellt. Die berechneten Abflüsse (blau) unterschätzen<br />
die 1996 bis 1999 gemessenen (rot) um durchschnittlich 2 l/s, bilden aber ansonsten das Niveau<br />
und die Dynamik der gemessenen Werte sehr gut ab. Zwar ist die Abflussganglinie für den<br />
Graben 2 nicht ganz so gut nachgebildet wie die der Abflussmessstelle II, bezogen auf das kleine<br />
Einzugsgebiet des Graben 2 sind die Anpassungen aber trotzdem sehr zufrieden stellend, zumal<br />
auch das temporäre Trockenfallen des Gewässers zeitlich gut getroffen wird. Die größten Abweichungen<br />
betreffen die Abflussspitzen, so sind im Sommer 1996 die gemessenen Abflüsse von<br />
knapp 200 l/s vom Modell nicht abgebildet worden. Hierbei handelt sich aber um Extremabflüsse<br />
durch sommerliche Starkregenfälle, die lokal sehr unterschiedlich ausfallen können.<br />
Der Mittelwert der simulierten Abflüsse liegt an der Messstelle II für den modellierten Zeitraum<br />
von 1986 bis 2003 bei 36 l/s. Dies entspricht bei dem Bilanzgebiet von 6,21 km 2 einer Abflussspende<br />
von 5,8 l / (s * km 2 ). Am Gebietsauslass beträgt die mittlere Abflussspende für den gleichen<br />
Zeitraum nur noch 2,5 l / (s * km 2 ). Daran wird deutlich, dass die nördlichen Gebiete stärker<br />
zur Abflussbildung beitragen als die südlichen.<br />
Um die berechneten Abflussspenden mit den Angaben im Hydrologischen Atlas zu vergleichen,<br />
müssen die langjährigen Durchschnittswerte betrachtet werden. Für die Langzeitsimulation von<br />
1969-2003 beträgt der mittlere Abfluss 122 l/s aus dem Bilanzgebiet von 33 km², was einer Abflussspende<br />
von 3.7 l / (s * km²) entspricht. Im Hydrologischen Atlas wird die Abflussspende für<br />
dieses Gebiet mit 3,9 l / (s * km 2 ) angegebenen. Die beiden Werte liegen nah beieinander, geringe<br />
Abweichungen können durch die Betrachtung unterschiedlicher Zeiträume mit abweichenden klimatischen<br />
Verhältnissen zustande kommen.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 57<br />
Abfluss [l/s]<br />
Abbildung 7-9: Modellierung der Abflussganglinie an der Messstelle II<br />
Abfluss [l/s]<br />
140.00<br />
120.00<br />
100.00<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
80.00<br />
60.00<br />
40.00<br />
20.00<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
0.00<br />
01.05.1996<br />
01.01.1996<br />
01.07.1996<br />
01.04.1996<br />
01.09.1996<br />
01.11.1996<br />
01.07.1996<br />
Durchfluss Messstelle II modellierter Durchfluss<br />
01.01.1997<br />
01.10.1996<br />
01.03.1997<br />
01.01.1997<br />
gemessener Durchfluss Graben2/Schönerlinder Weg modellierter Durchfluss<br />
01.05.1997<br />
01.07.1997<br />
Abbildung 7-10: Modellierung der Abflussganglinie am Graben 2<br />
01.04.1997<br />
01.09.1997<br />
01.07.1997<br />
01.11.1997<br />
01.10.1997<br />
01.01.1998<br />
01.01.1998<br />
01.03.1998<br />
01.04.1998<br />
01.05.1998<br />
01.07.1998<br />
01.07.1998<br />
01.09.1998<br />
01.10.1998<br />
01.11.1998<br />
01.01.1999<br />
01.01.1999<br />
01.04.1999<br />
01.03.1999<br />
01.05.1999<br />
01.07.1999<br />
01.07.1999<br />
01.10.1999<br />
01.09.1999
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 58<br />
Die räumliche Verteilung der Abflüsse ist in Abbildung 7-11 dargestellt. Insgesamt ist ein Ansteigen<br />
der Abflüsse von Norden nach Süden abgebildet, was der natürlichen Abflussakkumulation in<br />
Fließrichtung entspricht. Der <strong>Lietzengraben</strong> ist im Bereich der ehemaligen Rieselfelder der Hauptentwässerungsgraben.<br />
Südlich der Rieselfelder stellt der Seegraben, begünstigt durch das Wehr<br />
am <strong>Lietzengraben</strong>, den Hauptabfluss dar. An den Verzweigungen teilt sich der Abfluss gemäß den<br />
vorgegeben Abflussaufteilungen auf. Eine hydraulisch korrekte Abbildung der Abflussaufteilung<br />
bei unterschiedlichen Wasserständen ist nicht im Modell berücksichtigt. Eine wasserstandsabhängige<br />
Aufteilung kann zwar an diesen Stellen eingesetzt werden, dazu müssen aber zuvor entsprechende<br />
Messungen vorgenommen werden.<br />
Abbildung 7-11: Mittlere Abflussverteilung im Untersuchungsgebiet
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 59<br />
In Abbildung 7-12 sind die mittleren Grabenwasserstände im Zeitraum von 1986-2003 in Zentimetern<br />
dargestellt. Der durchschnittliche Wasserstand liegt bei ca. 0,5 m. Im Rückstau der Wehre<br />
ist ein Anstieg der Wasserstände auf 1,5 m erkennbar. Am <strong>Lietzengraben</strong> südlich der ehemaligen<br />
Riesefelder wirkt sich der Anstau durch Wehr 11 bis zu vier Kilometer grabenaufwärts aus. Grabenaufweitungen<br />
oder Grabenverengungen beeinflussen den Wasserstand zusätzlich. Am Waldgraben<br />
ist ein sinkender Wasserstand im Zusammenhang mit einer Grabenaufweitung in Fließrichtung<br />
abgebildet. Im Graben 41 führt eine Sohlschwelle zu geringeren Wasserständen.<br />
Abbildung 7-12: Mittlere Wasserstand in den Gräben im Untersuchungsgebiet
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 60<br />
Abbildung 7-13: Zeitlicher Mittelwert der instationär modellierten Grundwasserhöhen<br />
(ASM/ArcEGMO)<br />
In Abbildung 7-13 sind die durchschnittlichen Grundwasserhöhen über den berechneten Zeitraum<br />
dargestellt. Die Zehrung des Grundwassers durch den <strong>Lietzengraben</strong> ist an den zurückspringenden<br />
Isohypsen entlang des Gewässers deutlich erkennbar. Für die dem <strong>Lietzengraben</strong> zufließenden<br />
Gräben ist eine Grundwasserzehrung nur teilweise und nicht so ausgeprägt abgebildet. An einigen<br />
Stellen (z. B. am Oberlauf des Grabens 2) ist sogar eine Grundwasseranreicherung entlang des<br />
Grabens erkennbar. Dieses Muster deckt sich mit den Ergebnissen der stationären Berechnungen<br />
mit PMWIN und der von Nützmann, et. al (1992) erstellten Grundwasserkarte (siehe dort).
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 61<br />
Die Stärke der Zehrung bzw. Anreicherung richtet sich dabei nach dem Flurabstand und der<br />
Durchlässigkeit der Gewässersohle. Daran wird deutlich, dass der <strong>Lietzengraben</strong> den Hauptkontakt<br />
zum Grundwasser darstellt, während die Seitengräben teilweise vom Grundwasser unterströmt<br />
werden. Das Grundwasser ist jahreszeitlichen Schwankungen unterlegen, mit einem<br />
Höchststand im Frühjahr (Beispiel März 2002) und einem Tiefststand am Anfang des Winters<br />
(Beispiel Oktober 2001). In der Abbildung 7-14 sind die Flurabstände im März 2002 und im Oktober<br />
2001 gegenübergestellt. Die grundwassernahen Flächen nehmen im Frühjahr deutlich zu,<br />
während im Herbst weniger als ein Drittel der Flächen im Untersuchungsgebiet grundwassernah<br />
sind.<br />
Abbildung 7-14: Flurabstände im Oktober 2001 und März 2002<br />
Die Schwankungen können um die zwei Meter betragen, werden aber mit zunehmender Nähe zum<br />
Fließgewässer ausgeglichen (siehe Abbildung 7-14). Der <strong>Lietzengraben</strong> zeichnet sich auch hier<br />
wieder als Hauptkontaktgraben zum Grundwasser ab. Vor allem die Niederungen des südlichen<br />
<strong>Lietzengraben</strong>s sind kaum durch Grundwasserschwankungen gekennzeichnet.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 62<br />
Abbildung 7-15: Änderung der Flurabstände vom Oktober 2001 bis März 2002<br />
Die Grundwasserstände sind an den einzelnen Grundwasserpegeln seit 1985 diskontinuierlich<br />
gemessen worden. Abbildung 7-16 zeigt einige Grundwasserganglinien an verschiedenen Grundwassermessrohren<br />
im Untersuchungsgebiet im Vergleich zu den modellierten Ganglinien. Die<br />
Stichtagsmessungen sind als rote Punkte in den Diagrammen gekennzeichnet, die modellierten<br />
Grundwasserganglinien sind als blaue Linien dargestellt. An der rechten Seite jedes Diagramms<br />
zeigt eine kleine Skizze die Lage des jeweiligen Pegels im Grabensystem Die gemessenen<br />
Grundwasserschwankungen werden in ihrer Größenordnung und Dynamik größtenteils gut nachgezeichnet.<br />
Für den Pegel EPA161 (links unten) sind die Abweichungen in den 1980er Jahren auf<br />
die Auswirkungen des Rieselfeldbetriebs zurückzuführen, der die Grundwasserstände künstlich<br />
erhöht hat. Pegel EPA177A (rechts oben) verzeichnet zu Anfang seiner Messungen immer den<br />
gleichen Grundwasserstand, hier muss von einem Mess- oder Datenfehler ausgegangen werden,<br />
da es entgegen der natürlichen Grundwasserdynamik hier sonst zu einer Stagnation des Grundwasserstands<br />
gekommen sein müsste.
Grundwasserstand [müNN]<br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
57.00<br />
56.00<br />
Grundwasserstand gemessen Grundwasserganglinie modelliert<br />
55.00<br />
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002<br />
53.50<br />
52.50<br />
51.50<br />
50.50<br />
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002<br />
50<br />
49<br />
48<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# ## #<br />
#<br />
# # #<br />
## #<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# BU13<br />
# # #<br />
# # Bu<br />
#<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
Grundwasserstand gemessen Grundwasserganglinie modelliert<br />
47<br />
1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# ## #<br />
# # #<br />
##<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# # #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# #<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
Grundwasserganglinie modelliert Grundwasserstand gemessen<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
EPA161<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
BU09<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# ## #<br />
# # #<br />
##<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# # #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# #<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
EPA<br />
#<br />
#<br />
Bu<br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
53<br />
52<br />
51<br />
50<br />
Grundwasserganglinie modelliert Grundwasserstand gemessen<br />
49<br />
1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001<br />
59<br />
58<br />
57<br />
56<br />
1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001<br />
54<br />
53<br />
52<br />
51<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# ## #<br />
# # #<br />
##<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# # #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# #<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# #<br />
EPA177A<br />
# EPA#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
Grundwasserganglinie modelliert Grundwasserstand gemessen<br />
50<br />
1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# ## #<br />
# BU # #<br />
##<br />
17<br />
# #<br />
Bu #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# #<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
gemessenee Grundwasserstand Szenario1_lang<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
SEN15000<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# ## #<br />
# # #<br />
##<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# # #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
# #<br />
# #<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
Abbildung 7-16: Simulierte und gemessene Grundwasserstände an den Pegeln BU9, BU13, BU17, EPA 161, EPA 177A und SEN15000<br />
SEN<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#<br />
#
Die Korrelation zwischen den an den Grundwasserpegeln gemessenen und den an diesen Punkten<br />
berechneten Grundwasserständen ist in Abbildung 7-17 dargestellt. Die Pegel BU11, BU12 und<br />
BU18 weichen am stärksten von der Korrelationsgeraden ab. Sie liegen zwischen dem Waldgraben<br />
und dem Hobrechtsfelder Gewässer (Graben1). Der Pegel BU11 liegt laut Grundwassergefälle<br />
ca. einen Meter unterhalb der Pegel 12 und 18. Seine gemessenen Grundwasserstände liegen aber<br />
ca. einem Meter über denen der Pegel 12 und 18. Dieser Bereich ist auch in der stationären Modellierung<br />
als Problembereich auffällig geworden und muss weiter untersucht werden.<br />
Grundwasserstand modelliert<br />
61<br />
59<br />
57<br />
55<br />
53<br />
51<br />
49<br />
47<br />
Bu18<br />
Bu12<br />
Bu11<br />
45<br />
45 47 49 51 53 55 57 59 61<br />
Grundwasserstand gemessen<br />
Abbildung 7-17: Korrelation der gemessenen und berechneten Grundwasserstände an<br />
den Grundwasserpegeln<br />
Um die Interaktion zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser darzustellen, sind in<br />
Abbildung 7-18 die mittleren Verluste und Speisungen der Gräben über den Zeitraum von 1986-<br />
2003 in ihrer räumlichen Verteilung dargestellt. Der <strong>Lietzengraben</strong> wird im Mittel beinah auf seinem<br />
gesamten Verlauf vom Grundwasser gespeist. Die höchsten Speisungen sind im Mittel vor<br />
dem Eintritt in die Rieselfelder abgebildet. Der Graben 2 und Graben 1 treten kaum mit dem<br />
Grundwasser in Kontakt. Verluste treten am Graben 41, am Seegraben und in der Bogenseekette<br />
auf. Die Bogenseekette ist dabei am stärksten durch Zehrungen durch das Grundwasser gekennzeichnet.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 65<br />
Abbildung 7-18: mittlerer Grundwasserzu- und –abstrom zu den Gräben<br />
Die Abbildung 7-19 bis Abbildung 7-22 zeigen den zeitlichen Verlauf des hydraulischen Kontakts<br />
an ausgewählten Gewässerabschnitten. An der Bogenseekette (siehe Abbildung 7-19) wird deutlich,<br />
dass die oben beschriebenen Zehrungen nicht über den gesamten betrachteten Zeitraum bestehen,<br />
sondern der Zu- und Abstrom vom und zum Grundwasser einem ständigen Wechsel unterliegt,<br />
der durch permanentes Angleichen des Niveaus zwischen See und Grundwasserstand zustande<br />
kommt. Für die Karower Teiche sind die Interaktionen zwischen Grundwasser und Seewasser<br />
ähnlich stark wie die der Bogenseekette, sind aber im Mittel ausgeglichen. Diese starken<br />
Wechselwirkungen sind kein realistisches Abbild der natürlichen Verhältnisse, sondern resultieren<br />
aus der Tatsache, dass im Modell die Interaktionen mit dem Grundwasser auf der gesamten Fläche<br />
der Seekörper stattfinden, während der Grundwasserkörper die Wassermenge nur mit einem<br />
schlauchförmigen Fließgewässerabschnitt mit geringem Volumen austauscht.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 66<br />
Die Wasserstands- Volumen- Beziehungen für die Seen, die deren realistische Größe einbeziehen,<br />
sind in einem Gewässerpunkt unterhab dieses Gewässerabschnitts lokalisiert und können ihrerseits<br />
keine Interaktion mit dem Grundwasser eingehen. Das Modell beschreibt die Seen also als Kombination<br />
aus Gewässerpunkt und zufließendem Gewässerabschnitt. Die einzelnen Funktionen<br />
(Grundwasserinteraktion, Seeverdunstung, Wasserstands-Abflussbeziehung) sind aber jeweils nur<br />
einem Teil zugeordnet. Die starken Schwankungen im Zu- und Abstrom vom und zum Grundwasser<br />
sind darum auf die Seen begrenzt. Die Wirkung auf den Grundwasserkörper wird aber trotz<br />
der starken Dynamik, richtig abgebildet, da die Reaktionen der modellierten seenahen Grundwasserpegel<br />
sich mit den gemessenen Grundwasserhöhen decken.<br />
Ab- Zustrom [m³/s]<br />
Abbildung 7-19: Hydraulischer Kontakt der Bogenseekette<br />
Ab- Zustrom [m³/s]<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0<br />
-0.1<br />
-0.2<br />
-0.3<br />
-0.4<br />
0.05<br />
0.04<br />
0.03<br />
0.02<br />
0.01<br />
0<br />
-0.01<br />
-0.02<br />
-0.03<br />
-0.04<br />
01.01.86<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
01.01.90<br />
Hydraulischer Kontakt<br />
01.01.91<br />
Hydraulischer Kontakt<br />
01.01.91<br />
Abbildung 7-20: Hydraulischer Kontakt der Karower Teiche<br />
01.01.92<br />
01.01.92<br />
01.01.93<br />
01.01.93<br />
01.01.94<br />
01.01.94<br />
01.01.95<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
01.01.96<br />
01.01.97<br />
01.01.97<br />
01.01.98<br />
01.01.98<br />
KarowerTeiche<br />
01.01.99<br />
Bogenseekette<br />
01.01.99<br />
01.01.00<br />
01.01.00<br />
01.01.01<br />
01.01.01<br />
01.01.02<br />
01.01.02<br />
01.01.03<br />
01.01.03
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 67<br />
An der Messstelle II ist nur vereinzelt mit einer Speisung des Grundwassers aus dem Grabenwasser<br />
zu rechnen, in den meisten Zeiten ist ein Zustrom vom GW zu erwarten (siehe Abbildung<br />
7-21). Die Abbildung 7-22 zeigt den jahreszeitlichen Gang mit einer Grundwasserzehrung im hydrologischen<br />
Sommerhalbjahr und einer Grundwasseranreicherung im hydrologischen Winterhalbjahr<br />
am Seegraben.<br />
Ab- Zustrom [m³/s]<br />
0.01<br />
0.008<br />
0.006<br />
0.004<br />
0.002<br />
0<br />
-0.002<br />
-0.004<br />
-0.006<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
Hydraulischer Kontakt<br />
01.01.91<br />
Abbildung 7-21: Hydraulischer Kontakt an der Messstelle II<br />
Ab- Zustrom [m³/s]<br />
0.025<br />
0.02<br />
0.015<br />
0.01<br />
0.005<br />
0<br />
-0.005<br />
-0.01<br />
-0.015<br />
-0.02<br />
-0.025<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
01.01.92<br />
01.01.93<br />
01.01.94<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
Hydraulischer Kontakt<br />
Abbildung 7-22: Hydraulischer Kontakt des Seegrabens<br />
01.01.91<br />
01.01.92<br />
01.01.93<br />
01.01.94<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
01.01.97<br />
01.01.97<br />
01.01.98<br />
01.01.98<br />
01.01.99<br />
01.01.99<br />
Messstelle II<br />
01.01.00<br />
01.01.00<br />
01.01.01<br />
01.01.01<br />
01.01.02<br />
Seegreaben<br />
01.01.02<br />
01.01.03<br />
01.01.03
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 68<br />
7.4 Szenarienanalysen<br />
Um die Entscheidungsfindung der Wasserbewirtschaftung und Landschaftspflege zu unterstützen,<br />
sind verschiedene Szenarien, mit zum Teil schon in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen,<br />
modelliert worden. Die untersuchten Maßnahmen sind einerseits die Überlehmung zur Bodenverbesserung,<br />
verschiedene Wehrstellungen für die gezielte Wasserverteilung im Gebiet und die Bewirtschaftung<br />
mit Zusatzwasser. Es wurden, wie in Kapitel 3.3 aufgeführt, acht verschiedene<br />
Rechnungen durchgeführt. Die Variante 1 stellt dabei den Ist-Zustand dar und wurde als Langzeitsimulation<br />
für den Zeitraum von 1969 bis 2003 und als Vergleichsrechnung für die Szenarienrechnungen<br />
für den Zeitraum von 1986 bis 2003 gerechnet. Die Ergebnisse wurden im vorigen<br />
Kapitel dargestellt.<br />
Die Szenarien werden für die Jahre 1986-2003 berechnet. Das macht einen direkten Vergleich mit<br />
dem modellierten Ist-Zustand möglich. Allerdings ist bei der Beurteilung der Ergebnisse im Bezug<br />
auf die durchzuführenden Maßnahmen zu berücksichtigen, dass die 1980er Jahre überdurchschnittlich<br />
feucht waren, während in Zukunft eher trockenere Verhältnisse zu erwarten sind, so<br />
dass die Ergebnisse nicht direkt in die Zukunft zu übertragen sind. Eine Szenarienrechnung für die<br />
Zukunft benötigt prognostizierte Klimadaten (z.B. vom PIK) für den zu modellierenden Zeitraum<br />
und kann eventuell in einer folgenden Projektphase mit angeboten werden.<br />
7.4.1 Überlehmungsszenario<br />
Auf den ehemaligen Rieselfeldern sind Überlehmungen nach dem Bucher Verfahren geplant, um<br />
die Schwermetalle im Boden zu imobilisieren. Diese Eingriffe haben auch Auswirkungen auf den<br />
Wasserhaushalt des Gebiets.<br />
Einige der Flächen sind bereits überlehmt worden. Für die Zukunft sind weitere Überlehmungen<br />
geplant. Das Ausmaß der Umsetzung richtet sich nach der verfügbaren Lehmmenge, so dass derzeit<br />
noch nicht feststeht, wie groß der zu überlehmende Flächenanteil sein wird.<br />
In dem Szenario 1a sind die potenziell als Überlehmungsflächen angedachten Bereiche als überlehmt<br />
modelliert worden. Dabei sind die ursprünglich auf diesen Flächen vorliegenden Böden mit<br />
einem lehmigen Substrat verschnitten worden und in die obere Bodenschicht bis maximal 50cm<br />
eingearbeitet worden (wie in Anhang 4 genauer beschrieben wird). Die Modellvariante mit den<br />
maximal zu überlehmenden Flächen wird im Folgenden mit der Variante des Ist-Zustans, die ohne<br />
überlehmte Bereiche gerechnet wurde, verglichen.<br />
Dazu wurde je eine Differenzenkarte zur der Grundwasserneubildung und der reellen Verdunstung<br />
beider Varianten erstellt. Die Veränderung der Grundwasserneubildung ist auf der linken Seite in<br />
Abbildung 7-23 dargestellt. Rote Farbtöne zeigen eine Abnahme und graue Farbtöne eine Zunahme<br />
der Grundwasserneubildung durch die Überlehmung an. Die potenziell für die Überlehmung<br />
angedachten Flächen zeichnen sich durch wesentlich geringere Grundwasserneubildungen (bis zu<br />
100 mm/a) von den restlichen Gebieten ab. Der Niederschlag wird in dem lehmigen oberen Bodenhorizont<br />
gespeichert und erhöht die Verdunstung, wie auf der rechten Seite der Abbildung<br />
7-23 in grünen Farbtönen dargestellt ist. Der Niederschlagsanteil, der die Grundwasseroberfläche<br />
erreicht, wird also verringert, so dass die Grundwasserstände in diesen Bereichen absinken. Die<br />
Verdunstung wird vor allem auf grundwassernahen Flächen stark erhöht.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 69<br />
Auf den benachbarten nicht überlehmten Flächen wird die Verdunstung durch das Absinken der<br />
Grundwasserstände reduziert, wenn diese durch das Absinken grundwasserfern werden (orange<br />
Farbtöne auf der rechten Seite der Abbildung 7-23), und damit die Grundwasserneubildung erhöht.<br />
Reduzierte Grundwasserstände bilden sich am stärksten (bis zu 20 cm) im Grundwasserabstrom<br />
der überlehmten Flächen aus (siehe Abbildung 7-26), sind aber mit ca. 5 cm unterhalb<br />
der gesamten überlehmten Flächen präsent.<br />
Abbildung 7-23: Wirkung der Überlehmung auf Grundwasserneubildung und Verdunstung
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 70<br />
Auf den Abfluss und den Grabenwasserstand am Graben südlich der ehemaligen Rieselfelder wirken<br />
sich die Grundwasserabsenkungen aber nicht wesentlich aus, wie in Abbildung 7-24 und<br />
Abbildung 7-25 dargestellt ist.<br />
Abfluss [m³/s]<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0<br />
01.01.1986<br />
01.01.1987<br />
01.01.1988<br />
01.01.1989<br />
01.01.1990<br />
01.01.1991<br />
01.01.1992<br />
Abbildung 7-24: Auswirkung der Überlehmung auf den Abfluss<br />
Grabenwasserstand [müNN]<br />
52.6<br />
52.4<br />
52.2<br />
52<br />
51.8<br />
51.6<br />
51.4<br />
01.01.1986<br />
01.01.1987<br />
01.01.1988<br />
01.01.1989<br />
01.01.1990<br />
01.01.1991<br />
01.01.1992<br />
01.01.1993<br />
01.01.1993<br />
01.01.1994<br />
01.01.1994<br />
01.01.1995<br />
01.01.1995<br />
01.01.1996<br />
01.01.1996<br />
01.01.1997<br />
01.01.1997<br />
mit Überlehmung<br />
ohne Überlehmung<br />
01.01.1998<br />
01.01.1998<br />
01.01.1999<br />
01.01.1999<br />
01.01.2000<br />
01.01.2000<br />
01.01.2001<br />
01.01.2001<br />
01.01.2002<br />
mit Überlehmung<br />
01.01.2002<br />
01.01.2003<br />
ohne Überlehmung<br />
Abbildung 7-25: Auswirkung der Überlehmung auf den Grabenwasserstand<br />
01.01.2003
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 71<br />
Abbildung 7-26: Grundwassersenkung durch Überlehmungsmaßnahmen<br />
7.4.2 Wirkung der Wehrstellung<br />
Um den Einfluss der Wehre auf den Wasserhaushalt darzustellen, sind drei Varianten (Variante 2,<br />
Variante 2a und Variante 2b) gerechnet worden. Die Wehrstellungen sind dabei entweder als geöffnet<br />
oder als vollständig geschlossen (Stauziel) modelliert worden. In der Variante 2 sind alle<br />
Wehre im gesamten Untersuchungsgebiet geöffnet. In der Variante 2a sind nur die Wehre 1b und<br />
12 als geschlossen modelliert worden, so dass die Bogenseekette und die Karower Teiche mit Abfluss<br />
begünstigt werden. In der Variante 2b sind die Wehre 1, 1b, 11 und 12 geschlossen, so dass<br />
hier zusätzlich zu den Seen auch die Niederungen am <strong>Lietzengraben</strong> und der Erlenbruchwald am<br />
Seegraben eingestaut werden.<br />
Variante 2<br />
In Abbildung 7-27 sind die Auswirkungen der Wehre auf die Grundwasserstände dargestellt. Die<br />
Grundwasserdifferenzenkarte vergleicht eine Variante, in der alle Wehre gezogen gerechnet wurden<br />
mit dem Ist-Zustand. Die orange bis roten Farbtöne kennzeichnen eine Grundwasserabsenkung<br />
durch geöffnete Wehre. Die grünen Farbtöne charakterisieren Bereiche, in denen das Grundwasser<br />
ansteigt. Die höchsten Absenkungen liegen im Bereich des Seegrabens.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 72<br />
Durch Öffnen des Wehres 1 kann der Grundwasserstand um 75 cm abgesenkt werden, was für den<br />
Erlenbruchwald und die am Seegraben gelegenen Feuchtgebiete nicht folgenlos bleiben würde.<br />
Aber auch der Bereich der Bogenseekette und des südlichen <strong>Lietzengraben</strong>s wäre durch geöffnete<br />
Wehre stark beeinträchtigt. Am Graben 1 und am Graben 2 werden die Grundwasserstände durch<br />
veränderte Wehrstellungen nur in direktem Umfeld (wenige 10er Meter) um die Staue wirksam.<br />
Die maximale Beeinflussung der Grundwasserstände beträgt dabei 5 cm. An den Stauen 13 und 14<br />
sind keine Grundwasserdifferenzen abgebildet worden. Dies wird als realistisches Abbild der<br />
Wirklichkeit eingeschätzt, da einerseits die Abflüsse in diesen Gräben sehr gering sind und andererseits<br />
ihr Kontakt zum Grundwasser durch höhere Flurabstände nur eingeschränkt besteht.<br />
Abbildung 7-27: Einfluss der Wehre auf die Grundwasserstände und Abflüsse<br />
In Abbildung 7-27 sind die Abflussdifferenzen als Mittelwerten über den Betrachtungszeitraum<br />
für die einzelnen Gewässerabschnitte dargestellt. Blaue Farbtöne stehen für einen Abflussanstieg<br />
und roten für eine Abflussreduzierung gegenüber dem Ist-Zustand. In den Rieselfeldgebieten und<br />
den Seitengräben zeigen sich keine gravierenden Abflussänderungen. Im Seegraben steigt der<br />
Abfluss um 6 l/s an im Bogensee nimmt er um 9 l/s zu. Aus den ehemaligen Rieselfeldern wird<br />
kein erhöhter Abfluss abgegeben. Der erhöhte Grundwasserzustrom liegt im Mittel bei 5 l/s. Eine<br />
weitere Abflusserhöhung von knapp 4 l/s kann dadurch zustande kommen, dass durch die geöffneten<br />
Wehre ein schnelleres Abfließen, und damit ein eher geringerer Austausch mit dem Grundwasser<br />
verursacht wird. Die Abflusserhöhung ist aber auf den gesamten Abfluss gesehen relativ<br />
gering.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 73<br />
Der südliche <strong>Lietzengraben</strong> zeigt dieses Phänomen nicht, hier wird sogar der Abfluss reduziert,<br />
was aber auf sein geringes Gefälle zurückgeführt werden kann. Ab Wehr 12 werden in geschlossenem<br />
Zustand die Karower Teiche über zwei Rohre gespeist. Ist es gezogen, so wird kein Wasser<br />
im Bereich der Rohre aufgestaut und die Rohre werden nur bei hohen Abflüssen durchströmt. Bei<br />
geöffnetem Wehr 12 beträgt die Abflussreduzierung im Bereich der Karower ca. 30 l/s.<br />
Die abgebildete Grundwasserstandsanhebung im Gebiet der Karower Teiche bei geöffnetem Wehr<br />
12 muss angezweifelt werden. Die in Abbildung 7-29 dargestellten gesunkenen Abflüsse erzeugen<br />
im Fließgewässerabschnitt der Karower Teiche einen erhöhten Wasserstand (siehe Abbildung<br />
7-30), der seinerseits die Grundwasseranhebung bewirkt (siehe Abbildung 7-31). Diese Fehldarstellung<br />
von gestiegenen Grabenwasserständen bei geringerem Abfluss hängt mit der unterschiedlichen<br />
Angabe der Wasserstände im Fließgewässerabschnitt und im Gewässerpunkt (die beide die<br />
Karower Teiche abbilden) zusammen (siehe Abbildung 7-32), wodurch aber dieser Widerspruch<br />
zustande kommt, ist zur Zeit noch unbekannt und muss weiter untersucht werden.<br />
Abfluss [m³/s]<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
01.01.91<br />
01.01.92<br />
Abbildung 7-28: Gering erhöhte Abflüsse am Bogenseezufluss<br />
Abfluss [m³/s]<br />
0.09<br />
0.08<br />
0.07<br />
0.06<br />
0.05<br />
0.04<br />
0.03<br />
0.02<br />
0.01<br />
0<br />
-0.01<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
01.01.91<br />
01.01.93<br />
01.01.92<br />
01.01.94<br />
01.01.93<br />
01.01.95<br />
01.01.94<br />
01.01.96<br />
01.01.95<br />
01.01.97<br />
01.01.96<br />
01.01.98<br />
01.01.97<br />
Ist-Zustand<br />
Variante 2<br />
01.01.99<br />
01.01.98<br />
01.01.00<br />
Variante 2<br />
Variante 1<br />
Abbildung 7-29: Verringerte Abflüsse in den Karower Teichen bei geöffnetem Wehr 12<br />
01.01.99<br />
01.01.01<br />
01.01.00<br />
01.01.02<br />
01.01.01<br />
01.01.03<br />
01.01.02<br />
01.01.03
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 74<br />
Seewasserstand [müNN]<br />
48.8<br />
48.6<br />
48.4<br />
48.2<br />
48<br />
47.8<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
01.01.91<br />
01.01.92<br />
01.01.93<br />
01.01.94<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
01.01.97<br />
01.01.98<br />
01.01.99<br />
Ist-Zustand<br />
Variante 2<br />
Abbildung 7-30: Erhöhte Wasserstände in den Karower Teichen bei geöffnetem Wehr 12<br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
49<br />
48.5<br />
48<br />
47.5<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
01.01.91<br />
KarowerTeiche Variante 2<br />
KarowerTeiche Ist-Zustand<br />
01.01.92<br />
01.01.93<br />
01.01.94<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
Abbildung 7-31: Erhöhte Grundwasserstände in den Karower Teichen bei geöffnetem Wehr<br />
12<br />
01.01.97<br />
01.01.98<br />
01.01.99<br />
01.01.00<br />
01.01.00<br />
01.01.01<br />
01.01.01<br />
01.01.02<br />
01.01.02<br />
01.01.03<br />
01.01.03
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 75<br />
50.00<br />
49.50<br />
49.00<br />
48.50<br />
48.00<br />
47.50<br />
47.00<br />
46.50<br />
46.00<br />
01.01.1986<br />
21.12.1986<br />
10.12.1987<br />
28.11.1988<br />
17.11.1989<br />
06.11.1990<br />
26.10.1991<br />
14.10.1992<br />
Ufer_KarowerTeiche<br />
Sohle_KarowerTeiche<br />
GWP16<br />
FGW153<br />
03.10.1993<br />
22.09.1994<br />
11.09.1995<br />
30.08.1996<br />
Abbildung 7-32: Widersprüchlicher Wasserstand im Fließgewässerabschnitt und dem Gewässerpunkt<br />
Karower Teiche<br />
Variante 2a<br />
In der Variante 2a sind die Wehre 1a und 12 geschlossen, um die Wasserversorgung der Seen als<br />
wichtige Biotope zu unterstützen. Die Ergebnisse der Variante 2a werden denen der zuvor besprochenen<br />
Variante 2 in einer Grundwasserdifferenzenkarte (siehe Abbildung 7-33) gegenübergestellt.<br />
Die grünen bis blauen Farbtöne zeigen einen Grundwasseranstieg der Variante 2a gegenüber<br />
der Variante 2, wobei die Farbintensität die stärke des Anstiegs beschreibt.<br />
Die Grundwasserstände unterhalb des Bogensees steigen durch die Stauhaltung an Wehr 1a um<br />
50-70 cm an. In der Umgebung wirkt der Einstau noch beidseitig des Sees bis zu 300 m mit einem<br />
Grundwasseranstieg um 35 cm, in 500 m Entfernung noch bis zu 25 cm. Die Grundwasseranhebung<br />
wirkt sich in westlicher Richtung mit 15 cm bis zum Modellrand aus.<br />
19.08.1997<br />
08.08.1998<br />
28.07.1999<br />
16.07.2000<br />
05.07.2001<br />
24.06.2002<br />
13.06.2003
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 76<br />
Abbildung 7-33: Wirkung der Wehre 12 und 1a<br />
Die Abflussdifferenzen der beiden Varianten sind ebenfalls in Abbildung 7-33 dargestellt. Hierbei<br />
stehen die roten Farbtöne für einen geringeren Abfluss und die blauen Farbtöne für einen höheren<br />
Abfluss der Variante 2b gegenüber der Variante 2. Ein mittlerer Abflussanstieg von 34 l/s ist im<br />
Bereich der Karower Teiche abgebildet (siehe Abbildung 7-35). Das geschlossene Wehr 12 staut<br />
den Abfluss im Bereich der Rohrüberleitung in die Karower Teiche an, so dass diese verstärkt<br />
durchflossen werden. Ein verringerter Abfluss von ebenfalls 34 l/s ist dementsprechend unterhalb<br />
des Wehres 12 am <strong>Lietzengraben</strong> und in der Panke zwischen der Mündung des <strong>Lietzengraben</strong>s<br />
und der Mündung aus den Karower Teichen berechnet worden. Der Abfluss durch den Bogensee<br />
wird um 2 l/s reduziert. Dies entspricht dem erhöhten Abstrom aus dem Oberflächenwasser zum<br />
Grundwasser durch erhöhte Wasserstände in der Bogenseekette. Am südlichen <strong>Lietzengraben</strong><br />
wurde eine Abflusszunahme von 1,5 l/s berechnet. Dieser Grabenabschnitt ist von dem Einstau<br />
der beiden Wehren nicht betroffen. Der infolge des Bogenseeeinstaus angestiegene Grundwasserstand<br />
kann aber zu einem verstärkten Grundwasserzustrom in den <strong>Lietzengraben</strong> führen.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 77<br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
52.5<br />
52<br />
51.5<br />
51<br />
50.5<br />
01.01.90<br />
01.01.91<br />
01.01.92<br />
01.01.93<br />
01.01.94<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
Pegel BU9 am Bogensee ohne Wehr<br />
Pegel BU9 am Bogensee mit Wehr<br />
Abbildung 7-34: Grundwasserstände an der Bogenseekette<br />
01.01.97<br />
01.01.98<br />
01.01.99<br />
01.01.00<br />
Die gesunkenen Grundwasserstände an der Bogenseekette werden auch am Pegel BU 9 abgebildet<br />
(siehe Abbildung 7-34). Der Anstieg des Grundwassers wirkt sich aber stärker in Zeiten von ohnehin<br />
hohen Grundwasserständen aus. In trockeneren Perioden kann der Grundwasserstand sogar<br />
kurzzeitig unter den der Variante 2 absinken. Diese erhöhte Dynamik kann durch die größere Verdunstung<br />
von der Seefläche verursacht sein.<br />
Abfluss [m³/s]<br />
0.09<br />
0.07<br />
0.05<br />
0.03<br />
0.01<br />
-0.01<br />
01.01.01<br />
01.01.02<br />
01.01.03<br />
Variante 2a Variante 2<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
01.01.91<br />
01.01.92<br />
01.01.93<br />
01.01.94<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
01.01.97<br />
01.01.98<br />
01.01.99<br />
01.01.00<br />
01.01.01<br />
01.01.02<br />
01.01.03<br />
Abbildung 7-35: Abflusszunahme in den Karower Teichen
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 78<br />
Variante 2b<br />
In der Variante 2b sollen neben den Seen auch die Feuchtgebiet in der Niederung des <strong>Lietzengraben</strong>s<br />
und im Erlenbruchwald am Seegraben eingestaut werden. Dazu wurden Wehr 1 und 11 geschlossen<br />
modelliert. Als Vergleich wird hierbei die Variante 2a herangezogen, um die direkte<br />
Auswirkung der beiden Wehre abzubilden.<br />
Die Abbildung 7-36 zeigt die Grundwasserdifferenzen dieser beiden Varianten. Der Grundwasseranstieg<br />
ist wieder in grünen bis blauen Farbtönen dargestellt. Ebenso sind die Gewässerabschnitte<br />
mit roten Farbtönen durch ein Abflussdefizit und die mit blauen Farbtönen durch eine Abflusszunahme<br />
gekennzeichnet. Die angehobenen Grundwasserstände sind jetzt am Seegraben mit bis zu<br />
90 cm und in der Niederung des <strong>Lietzengraben</strong>s mit bis zu 50 cm am stärksten. Ihr Einfluss wirkt<br />
sich aber auf der gesamten Fläche zwischen Bogensee, Seegraben und <strong>Lietzengraben</strong> mit 30 cm<br />
aus und erstreckt sich mit abnehmender Intensität bis zum westlichen Rand des Modellgebiets.<br />
Am Seegraben sind die erhöhten Grundwasserstände bis zu einer Entfernung von 1 km auszumachen.<br />
Am südlichen Modellrand sind Grundwasseranhebungen bis zu 30 cm dargestellt. Da der<br />
Modellrand mit einer „no flow“ Randbedingung belegt ist, kann diese Anhebung auf Anstaueffekte<br />
vor dem undurchlässigen Rand zurückgeführt werden, so dass in der Randregion die Ergebnisse<br />
etwas verfälscht sein können.<br />
Abbildung 7-36: Wirkung der Wehre 11 und 1
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 79<br />
Verringerte Abflüsse sind auf der gesamten Fließstrecke von Seegraben (5 l/s) und Bogenseekette<br />
(7 l/s) abgebildet. Der Wasserstand im Seegraben wird durch das geschlossene Wehr auf Höhe des<br />
Stauziels gehalten (siehe Abbildung 7-37), so dass ein erhöhter Abstrom an das Grundwasser erfolgt<br />
(siehe Abbildung 7-38) und die Grundwasserstände steigen (siehe Abbildung 7-40). Der Abfluss<br />
im <strong>Lietzengraben</strong> wird dagegen um 4 l/s erhöht, da dieser durch die Grundwassererhöhung<br />
stärker gespeist wird (siehe Abbildung 7-39). Durch die Speisung des <strong>Lietzengraben</strong>s nehmen die<br />
Grundwasserstände am <strong>Lietzengraben</strong> mit der Zeit langsam wieder ab (siehe Abbildung 7-41).<br />
Grabenwasserstand [müNN]<br />
Abbildung 7-37: Grabenwasserstand am Seegraben mit und ohne geschlossenes Wehr<br />
Grundwasserzu-/abstrom [m³/s]<br />
52.5<br />
52.0<br />
51.5<br />
51.0<br />
01.01.86<br />
0.03<br />
0.02<br />
0.01<br />
0<br />
-0.01<br />
-0.02<br />
-0.03<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
Variante 2a Variante 2b<br />
01.01.90<br />
01.01.91<br />
01.01.92<br />
01.01.92<br />
01.01.93<br />
Varainte 2a Variante 2b<br />
Abbildung 7-38: Grundwasserzu- bzw. –abstrom vom Seegraben<br />
01.01.94<br />
01.01.94<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
01.01.96<br />
01.01.97<br />
01.01.98<br />
01.01.98<br />
01.01.99<br />
01.01.00<br />
01.01.00<br />
01.01.01<br />
01.01.02<br />
01.01.02<br />
01.01.03
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 80<br />
Grundwasserzu-/abstrom [m³/s]<br />
Abbildung 7-39: Grundwasserzu- bzw. –abstrom vom <strong>Lietzengraben</strong><br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
0.003<br />
0.0025<br />
0.002<br />
0.0015<br />
0.001<br />
0.0005<br />
0<br />
-0.0005<br />
-0.001<br />
01.01.86<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.89<br />
01.01.90<br />
Abbildung 7-40: Grundwasserstände am Seegraben<br />
Grundwasserstand [müNN]<br />
54<br />
53.5<br />
53<br />
52.5<br />
52<br />
51.5<br />
51<br />
01.01.86<br />
51.5<br />
51<br />
50.5<br />
50<br />
01.01.90<br />
01.01.87<br />
01.01.88<br />
01.01.91<br />
01.01.89<br />
01.01.92<br />
01.01.90<br />
01.01.91<br />
01.01.91<br />
01.01.92<br />
01.01.92<br />
01.01.93<br />
Abbildung 7-41: Grundwasserstände am südlichen <strong>Lietzengraben</strong><br />
01.01.93<br />
01.01.94<br />
01.01.94<br />
01.01.95<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
01.01.96<br />
01.01.97<br />
01.01.97<br />
01.01.98<br />
01.01.98<br />
Varainte 2b<br />
Varainte 2a<br />
01.01.99<br />
01.01.99<br />
01.01.00<br />
01.01.00<br />
01.01.01<br />
01.01.01<br />
Pegel 8197 Variante 2a Pegel 8197 Variante 2b<br />
01.01.93<br />
01.01.94<br />
Pegel 8224 am <strong>Lietzengraben</strong> ohne Wehr<br />
Pegel 8224 am <strong>Lietzengraben</strong> mit Wehr<br />
01.01.95<br />
01.01.96<br />
01.01.97<br />
01.01.98<br />
01.01.99<br />
01.01.00<br />
01.01.01<br />
01.01.02<br />
01.01.02<br />
01.01.02<br />
01.01.03<br />
01.01.03<br />
01.01.03
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 81<br />
7.4.3 Bewirtschaftung mit Zusatzwasser<br />
Die Auswirkung des eingeleiteten Zusatzwasser auf den<br />
Wasserhaushalt im Untersuchungsgebiet<br />
ist in zwei Varianten (Variante 3a und Variante 3b) modelliert<br />
worden. Dabei beträgt die eingelei-<br />
tete Wassermenge in beiden Varianten 6000 m³/d, die sich zu jeweils 3000 m³/d in den Graben 2<br />
südlich des Feuerlöschteichs und in den <strong>Lietzengraben</strong> im Rieselfeld auf der Höhe des Teichs 13<br />
aufteilen. In der Variante 3a ist die Wehrstellung des Ist-Zustands modelliert, d.h. sowohl die<br />
intakten Rieselfeldwehre als auch die Wehre 1, 1b, 11, und 12 sind geschlossen, so dass die Seen<br />
und Feuchtgebiete eingestaut werden. In der Variante 3b sind alle Riesefeldwehre dagegen gezogen,<br />
während die Wehre im südlichen Gebiet ebenso wie in Variante 3a geschlossen sind.<br />
Variante 3a<br />
Die Variante 3a wird, da dieselbe Wehrstellung<br />
zugrunde liegt, mit dem Ist-Zustand verglichen.<br />
Die Grundwasserdifferenzenkarte<br />
(Abbildung 7-42) zeigt türkise Farbtöne, wobei der hellste<br />
Farbton den Bereich um Null darstellt und die zunehmende Farbintensität für ansteigende Grundwasserstände<br />
steht. Die blauen Farbtöne der Fließgewässerabschnitte zeigen, ebenfalls mit ansteigender<br />
Intensität, den Abflussanstieg. An beiden Einleitungsstellen steigen die Abflüsse direkt um<br />
34 l/s an. Die Grundwasserstände erhöhen sich dort um 7 cm. Beim Zusammenfluss des Graben 1<br />
und des <strong>Lietzengraben</strong> ist der Abfluss um beinah 70 l/s erhöht. Beim Abzweig des Seegrabens<br />
teilt sich der Abfluss im Verhältnis von 1:5 auf. Der Hauptanteil von 54 l/s wird durch den Seegraben<br />
und die restlichen 14 l/s durch den <strong>Lietzengraben</strong> abgeleitet. Auf der Fließstrecke des Seegrabens<br />
und der Bogenseekette versickern ca. 10 l/s. Die Grundwasserstände unterhalb der Bogenseekette<br />
steigen infolge dessen bis zu 50 cm an. Eine weitere Abflussversickerung von fast 10<br />
l/s findet im <strong>Lietzengraben</strong> nach dem Abzweig des Alten <strong>Lietzengraben</strong>s statt und bewirkt einen<br />
Grundwasseranstieg um bis zu 65 cm. Das zusätzliche Abflussvolumen des <strong>Lietzengraben</strong>s ist<br />
beim Erreichen des Wehres 11 stark dezimiert, so dass der Abfluss beim Zusammenfluss von<br />
<strong>Lietzengraben</strong> und Bogenseekette nur leicht ansteigt.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 82<br />
Abbildung 7-42: Wirkung des Zusatzwassers auf Grundwasserstände und Abfluss<br />
Die Überleitung zu den Karower Teichen nimmt das Zusatzwasser größtenteils auf, so dass im<br />
<strong>Lietzengraben</strong> unterhalb des Wehres 12 der Abfluss nur um 3 l/s erhöht ist.<br />
In Abbildung 7-43 und Abbildung 7-44 sind die Abflussganglinien mit ihrem durchschnittlichen<br />
Trends für die Karower Teiche und die Bogenseekette dargestellt, die die positive Wirkung des<br />
Zusatzwasser auf die Teichsysteme verdeutlichen.<br />
Abfluss [l/s]<br />
0.09<br />
0.06<br />
0.03<br />
0<br />
Karower Teiche<br />
01.01.86<br />
01.01.88<br />
01.01.90<br />
01.01.92<br />
mit Zusatzwasser ohne Zusatzwasser<br />
01.01.94<br />
Abbildung 7-43: Abflusserhöhung durch Zusatzwasser für die Karower Teiche<br />
01.01.96<br />
01.01.98<br />
01.01.00<br />
01.01.02
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 83<br />
Abfluss [l/s]<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0<br />
-0.1<br />
-0.2<br />
01.01.86<br />
Bogenseekette<br />
01.01.88<br />
01.01.90<br />
01.01.92<br />
mit Zusatzwasser ohne Zusatzwasser<br />
01.01.94<br />
Abbildung 7-44: Abflusserhöhung durch Zusatzwasser für die Bogenseekette<br />
Variante 3b<br />
01.01.96<br />
In der Variante 3b wurden zusätzlich zu den Einleitungen die Rieselfeldwehre als gezogen modelliert.<br />
Ein Vergleich zwischen der Variante 3a und 3b soll den Einfluss der geöffneten Rieselfeldwehre<br />
im Zusammenhang mit einem erhöhten Abfluss durch die Einleitungen zeigen. Die türkisen<br />
Farbtöne zeigen dabei einen Grundwasseranstieg in der Variante 3b gegenüber der Variante 3a.<br />
Die orangen Farbtöne stellen eine Grundwasserabsenkung dar. Die Abflussdifferenzen zwischen<br />
den beiden Varianten sind wieder wie oben im rot-blau Verlauf dargestellt.<br />
Abbildung 7-45 zeigt, dass die Abweichungen zwischen beiden Varianten sehr gering sind. Die<br />
Änderungen im Grundwasserstand liegen bei 10 cm und die Abflussänderungen nur bei maximal<br />
4 l/s. Die gezogenen Wehre im Rieselfeld wirken sich kaum auf die Grundwasserstände aus (maximal<br />
bis 2 cm). Lediglich um das Wehr 10 am Graben 1 sind Absenkungen bis zu 7 cm im Umfeld<br />
von 500 m abgebildet. Die Abflüsse aus dem Rieselfeld sind aber davon nicht betroffen.<br />
Am Grabenabzweig zwischen <strong>Lietzengraben</strong> und Seegraben ändert sich unvorhergesehenerweise<br />
die Abflussaufteilung. Im Seegraben fließen jetzt 1,5 l/s mehr ab, die im <strong>Lietzengraben</strong> fehlen.<br />
Entlang des <strong>Lietzengraben</strong>s zeichnet sich eine Grundwasseranhebung von bis zu 18 cm ab. Wodurch<br />
diese Grundwassererhöhung zustande kommt ist bislang ungeklärt. Am südlichen Modellrand<br />
sind leicht verringerte Grundwasserstände abgebildet, deren Herkunft ebenfalls noch fraglich<br />
ist.<br />
01.01.98<br />
01.01.00<br />
01.01.02
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 84<br />
Abbildung 7-45: Wirkung der geöffneten Rieselfeldstaue bei Zusatzwasser<br />
7.4.4 Beurteilung der Szenarien<br />
Die Wirkung der einzelnen Szenarien auf den Wasserhaushalt soll im Folgenden beurteilt werden.<br />
Dazu ist eine Gegenüberstellung der Abflüsse an drei Grabenabschnitten im Gewässersystem vorgenommen<br />
worden. Die drei Gewässerabschnitte sind so gewählt, dass der Zufluss zu den beiden<br />
Teichsystemen Bogenseekette (Fließgewässerabschnitt 137) und Karower Teiche (Fließgewässerabschnitt<br />
133) sowie zu den Niederungsgebieten am südlichen <strong>Lietzengraben</strong> (Fließgewässerabschnitt<br />
97) verglichen werden kann. Ziel der Untersuchung ist es dabei die Varianten zu ermittelt,<br />
die vor allem in Trockenzeiten den Wasserhaushalt in den drei ausgewählten Gebieten am besten<br />
stützen.<br />
Dazu sind der sommerlichen und winterlichen mittleren Niedrigwasserabflüsse in den folgenden<br />
Tabellen gegenübergestellt. Weiterhin betrachtet werden die Schwellenwertabflüsse, die innerhalb<br />
eines Jahres an 7 bzw. 30 aufeinander folgenden Tagen (Spaltenname: Qs(7,1) bzw. Qs(30,1))<br />
nicht unterschritten werden. Zusätzlich sind die geringsten Abflüsse die an 7 bzw. 30 aufeinander<br />
folgenden Tagen, die in einem Zeitraum von 5 Jahren nicht unterschritten werden, (Spaltenname:<br />
Qs(7,5) bzw. Qs(30,5)) ermittelt worden. Zur besseren Übersicht sind die Abflusswerte für die<br />
sieben Varianten nach folgender Hierarchie eingefärbt worden:
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 85<br />
Niedrigster Abflusswert<br />
Zweit niedrigster Abflusswert<br />
Dritt niedrigster Abflusswert<br />
Mittlerer Abflusswert<br />
Dritt höchster Abflusswert<br />
Zweit höchster Abflusswert<br />
Höchster Abflusswert<br />
Tabelle 7-2: Farbtabelle zur Bewertung der Abflüsse der sieben Szenarien<br />
Für alle 7 Szenarien erzielen die Varianten mit dem Zusatzwasser an den drei betrachteten Gewässerabschnitten<br />
durchweg die höchsten Abflüsse. Die beiden Varianten 3a und 3b sind auf unterschiedlichen<br />
Gewässerabschnitten für den höchsten Abfluss verantwortlich. Die Variante 3a liefert<br />
für die Niederung am <strong>Lietzengraben</strong> die höchsten Abflusswerte. Für die Bogenseekette (siehe<br />
Tabelle 7-4) ist dagegen die Variante 3b am abflussstärksten. Durch die geöffneten Staue im Riesefeld<br />
(bei der Variante 3b) wird offensichtlich mehr Abfluss an die Bogenseekette weitergegeben,<br />
die Abflusserhöhung macht dabei im Mittel ca. 2-3 Liter aus. Der leicht erhöhte Abfluss wird<br />
zwischen Seegraben und südlichem <strong>Lietzengraben</strong> im Verhältnis 5:1 aufgeteilt, so dass der Seegraben<br />
und damit auch die Bogenseekette stärker von dem leicht erhöhten Abfluss profitieren als<br />
der südliche <strong>Lietzengraben</strong> (siehe Tabelle 7-3). Die Abflusserhöhung im Litzengraben ist daher<br />
geringer als 1 l/s und wird durch andere Effekte, z. B. geringere Grundwasserstände und damit<br />
geringere Grundwasserzustrom in den Graben, überdeckt. Für den südlichen <strong>Lietzengraben</strong> ist<br />
darum die Variante 3a (mit Zusatzwasser und aktueller Wehrstellung) am abflussstärksten. Am<br />
dritthöchsten ist der Abfluss im südlichen <strong>Lietzengraben</strong> für den Ist-Zustand, bei dem die Wehre<br />
im Rieselfeldgebiet ebenfalls geschlossen sind. Die geringsten Abflüsse sind für die Variante 2a<br />
berechnet worden. In dieser Variante sind lediglich die Wehre, die die Seen begünstigen, geschlossen.<br />
Dadurch wird der südliche <strong>Lietzengraben</strong> benachteiligt. Fast ebenso gering sind die<br />
Abflüsse in der Variante 2, in der alle Wehre geöffnet sind. Die Variante 2b in der neben den Seen<br />
auch der <strong>Lietzengraben</strong> sowie der Erlenbruchwald durch gezielte Wehrstellungen begünstigt werden<br />
sollen, ist nur wenig besser zu beurteilen als die Variante 1a, die den Ist-Zustand mit der Überlehmung<br />
darstellt. Die Abflussdifferenzen zwischen den Varianten 1, 1a und 2b machen aber<br />
im Mittel weniger als 1 l/s aus, so dass hier nicht wirklich von einer Differenzierung gesprochen<br />
werden kann. Für den südlichen <strong>Lietzengraben</strong> lässt sich zusammenfassend sagen, dass der Ist-<br />
Zustand, abgesehen von den Zusatzwasservarianten, den Abfluss am stärksten begünstigt. Es wird<br />
aber vermutet, dass eine hier nicht gerechnete Variante, in der lediglich die Wehre 1 und 11 geschlossen<br />
sind noch bessere Ergebnisse erzielt.<br />
FGW 97 S_MNQ W_MNQ Qs(7.1) Qs(30.1) Qs(7.5) Qs(30.5)<br />
Variante 1 13.3 16.1 17.7 20.3 12.7 14.8<br />
Variante 1a 13 15.7 17.5 19.9 12.4 14.4<br />
Variante 2 9.54 12.2 14.8 16.9 8.67 10.7<br />
Variante 2a 8.83 11.9 14.1 16.2 8.45 10.5<br />
Variante 2b 13 15.8 16.9 20.1 12.5 14.4<br />
Variante 3a 27.6 30.3 31.9 34.8 27.1 29.1<br />
Variante 3b 25.5 28.7 30.7 33.6 24.9 27<br />
Tabelle 7-3: Vergleich der Wirkung der Szenarien auf die Abflüsse zur <strong>Lietzengraben</strong>- Niederung
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 86<br />
FGW 137 S_MNQ W_MNQ Qs(7.1) Qs(30.1) Qs(7.5) Qs(30.5)<br />
Variante 1 14.3 21.8 25.1 33.5 11.3 17.2<br />
Variante 1a 14 20.8 24.2 32.6 10.9 16.7<br />
Variante 2 19.7 26 32.4 38.7 20.6 24.5<br />
Variante 2a 18.8 26.1 33 39.1 20.3 24.2<br />
Variante 2b 14.9 21.8 25.5 33.8 11.3 17.6<br />
Variante 3a 68.6 76 82 90.2 67.4 73.1<br />
Variante 3b 70 77.5 83.6 92.3 68.8 74.4<br />
Tabelle 7-4: Vergleich der Wirkung der Szenarien auf die Abflüsse zur Bogenseekette<br />
Der Abfluss im Seegraben und Bogensee wird nach den Varianten mit Zusatzwasser am stärksten<br />
durch Variante 2 und 2a begünstigt (siehe Tabelle 7-4). Die Variante 2 sieht die Stauhaltung der<br />
Bogenseekette vor, so dass hier eine Abflusserhöhung zu erwarten ist. Das die Variante 2 (alle<br />
Wehre geöffnet) den Abfluss aber ähnlich begünstigt, kann damit erklärt werden, dass durch die<br />
geöffneten Wehre der Abfluss ungehindert abströmen kann (keine Rückstau) und somit aufgrund<br />
geringerer Wasserstände eine stärkere Entwässerungswirkung auf das Grundwasser ausgeübt<br />
wird. Deutlich geringer ist der Abfluss in Variante 2b, in der zusätzlich zu den Wehren 1a und 12<br />
auch die Wehre 1 und 11 geschlossen sind, so dass neben den Seen auch die Niederungen am südlichen<br />
<strong>Lietzengraben</strong> und der Erlenbruchwald am Seegraben begünstigt werden und damit den<br />
Seen einen Teil des Abflusses entziehen. Ein noch etwas geringerer Abfluss steht im Ist-Zustand<br />
der Bogenseekette zur Verfügung und am geringsten ist der Abfluss für das Überlehmungs-<br />
Szenario 1a. Für die Bogenseekette heißt das, dass der Abfluss neben der positiven Wirkung des<br />
Zusatzwassers am stärksten durch den Einstau der Bogenseekette bei ansonsten geöffneten Wehren<br />
im Rieselfeld und am <strong>Lietzengraben</strong>, begünstigt wird.<br />
FGW 133 S_MNQ W_MNQ Qs(7.1) Qs(30.1) Qs(7.5) Qs(30.5)<br />
Variante 1 28.2 46.6 68.3 93.2 37.5 50.5<br />
Variante 1a 27.7 46.9 68.2 85.8 38.7 51.7<br />
Variante 2 k.A 12.8 68.6 103 39.8 50.8<br />
Variante 2a k.A. 31.6 66.7 94.4 38.7 49.8<br />
Variante 2b 22.5 46.8 66.2 89.5 34.7 46.4<br />
Variante 3a 68 106 135 151 116 127<br />
Variante 3b 67.4 105 137 153 116 127<br />
Tabelle 7-5: Vergleich der Wirkung der Szenarien auf die Abflüsse zu den Karower Teiche<br />
Der Grabenabschnitt zwischen Wehr 11 und 12 ist mit seinem Abfluss für den Wasserhaushalt in<br />
die Karower Teiche verantwortlich, da im Rückstau von Wehr 12 die Überleitungsrohre zu den<br />
Karower Teiche in Abhängigkeit vom Wasserstand durchströmt werden. Am Wehr 11 vereinigen<br />
sich die beiden Grabenstrecken der Bogenseekette und des <strong>Lietzengraben</strong>s. Die vorher klar differenzierten<br />
Wirkungen der Szenarien auf den westlichen und östlichen Grabenverlauf vermischen<br />
sich. Während für den mittleren Niedrigwasserabfluss im Winterhalbjahr für die Variante 2 die<br />
geringsten Abflüsse ausgemacht werden, ist diese Varianten bei der Betrachtung der Schwellenwertabflüsse<br />
die Abflussstärkste nach den Einleitungsvarianten. Andersrum ist die Variante 2b für<br />
die winterlichen mittleren Niedrigabflüsse eher abflussstark, für die mittleren Abflüsse im Sommerhalbjahr<br />
auf die Schwellenwerte bezogen aber abflussschwach. Im Vergleich mit der Abflusshierarchie<br />
am südlichen <strong>Lietzengraben</strong> und am Bogensee lässt sich schließen, dass die mittleren
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 87<br />
Niedrigwasserabflüsse nach dem Zusammenfluss im Winterhalbjahr aus der <strong>Lietzengraben</strong>- Niederung<br />
und im Sommerhalbjahr aus der Bogeseekette gestützt werden.<br />
Die sommerlichen als auch winterlichen mittleren Niedrigwasserabflüsse werden für alle Biotope<br />
durch Einleitung von Zusatzwasser mindestens verdoppelt. Auch die Schwellenabflüsse werden<br />
mindestens um das doppelte heraufgesetzt. Der Abfluss zu den Karower Teichen reicht demnach<br />
auch in Trockenzeiten aus, um die Rohrüberleitungen zu den Karower Teichen auf 2/3 aufzufüllen.<br />
Die Abflusssituation wird im gesamten Gebiet durch die Einleitung von Zusatzwasser enorm<br />
gestärkt und sollte, wenn sie für die Wasserqualität unbedenklich ist, unbedingt durchgeführt werden.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 88<br />
8 Offene Fragen und Ausblick<br />
Inhalt der zweiten Projektphase war der Aufbau eines gekoppelten Modells, das den Wasserhaushalt<br />
im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s mit den Interaktionen zwischen Oberflächenwasser und<br />
Grundwasser nachbildet, als auch seinen Einsatz für bestimmte Fragestellungen zu testen.<br />
Für den Ist- Zustand wurde die Funktionsweise der Wasserhaushaltsbeziehungen, vor allem im<br />
Hinblick auf die Interaktion zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser, detailliert dargestellt.<br />
Mit einer Langzeitsimulation wurden die Abflüsse und Grundwasserstände modelliert, wie<br />
sie unter natürlichen Bedingungen, d.h. unter Berücksichtigung der meteorologischen Gegebenheiten<br />
und nicht unter Rieselfeldeinfluss, für die 1970er und 1980er Jahre ausgefallen wären. Dies<br />
ermöglicht eine Einschätzung der Intensität der Rieselfeldauswirkung auf das Gebiet.<br />
In Szenarien sind die Auswirkungen verschiedener Maßnahen modelliert worden. Dabei stellten<br />
sich die Folgen der Flächenüberlehmung auf das Grundwasser als lokal stark begrenzt dar, während<br />
das Abflussvolumen quasi unbeeinflusst blieb. Diese Maßnahme zeigt ähnlich geringe Auswirkungen,<br />
wie die Veränderung der Wehrstellung im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets.<br />
Dagegen greift eine Änderung der Wehrstellung im südlichen Einzugsgebiet, die die Seen und<br />
Feuchtgebiete einstauen, entscheidender in den Wasserhaushalt ein. Das Stauziel sollte möglichst<br />
hoch gesetzt werden, um die bestmögliche Wirkung auf die Biotope zu erzielen. Den größten positiven<br />
Einfluss auf den Wasserhaushalt hat die Einleitung von Zusatzwasser.<br />
Die oben dargestellten Ergebnisse zeigen, dass das gekoppelte Modell praktikabel ist und<br />
größtenteils realistische Ergebnisse liefert. Allerdings werden einige Bereiche noch nicht genau<br />
oder unplausibel abgebildet. Folgende Problembereiche existieren derzeit:<br />
• Leakageverluste des Aquifers an den darunter liegenden Aquifer können im Modell nicht<br />
abgebildet werden. Der Grundwasserstauer wird in den Hydrogeologischen Karten aber<br />
teilweise als durchlässig dargestellt, was auch die Ergebnisse aus der stationären Modellierung<br />
mit PMWIN beweisen. In einigen Gebieten fallen erster und zweiter Grundwasserleiter<br />
sogar zusammen.<br />
• Der Modellrand ist als „now flow boundary“ definiert. Die Festlegung der Randbedingung<br />
auf einen vorgegebenen Durchflüsse ist im Prinzip möglich, widerspricht aber dem Ansatz<br />
der instationären Modellierung, in der saisonale Schwankungen eine besondere Rolle spielen.<br />
Derzeit kann es zu Aufstaueffekten am südlichen Rand des Modellgebiets kommen.<br />
• Mangels einer Lösung zur Beschreibung des Auslasses für die Karower Teiche ist noch<br />
keine korrekte Modellierung des See-Wasserstands gelungen. Ein fester Schwellenwert für<br />
den Auslass hält den Seewasserstand permanent auf derselben Höhe, ohne jahreszeitliche<br />
Schwankungen abzubilden. Die derzeitige Beschreibung mit einer Auslasslamelle erzielt<br />
ebenfalls keine realistischen Schwankungen.<br />
• Die Abbildung hydraulischer Zusammenhänge bereitet derzeit noch Schwierigkeiten. Das<br />
betrifft einerseits die Abflussaufteilung an den Abzweigungen, die zurzeit noch als festes<br />
Verhältnis vorgegeben werden. Andererseits sind bei extremen Abflüssen plötzlich anspringende<br />
Wasserstände und ein Verbleiben auf einem hohen Niveau für Fließgewässerabschnitte<br />
mit nur geringem Gefälle aufgetreten.<br />
• Die Abflüsse aus dem nördlichen Gebiet werden, wie an den modellierten Abflussganglinien<br />
gezeigt, an der Messstelle II und am Graben 2, sehr gut abgebildet. Inwieweit die modellierten<br />
Abflüsse aus dem Gesamtgebiet den tatsächlichen Abflüssen entsprechen, sollte<br />
unbedingt durch kontinuierliche Abflussmessen am Gebietsauslass überprüft werden.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 89<br />
Um eine Bilanzierung des Wasserbedarfs der Karower Teiche durchzuführen, ist ihr Wasserstand<br />
eine notwendige Größe, solange keine Mindestdurchflüsse vorgegeben werden können. Um die<br />
Aussagefähigkeit des Modells zu erhöhen, ist eine Abbildung der Wasserstände in den Karower<br />
Teichen notwendig. Eine alternative Beschreibung des Auslasses der Karower Teiche kann über<br />
besonders hohe Rauhigkeiten des unterhalb gelegenen Gewässerabschnittes vorgenommen werden.<br />
Dazu ist aber eine längere Phase der Anpassung erforderlich, um die bestimmte Rauhigkeit<br />
zu treffen, die einen realistischen Wasserstand in den Karower Teichen erzeugt. Als hinderlich<br />
kann sich dabei das große Gefälle auf der Fließstrecke zwischen Teichen und Panke erweisen. Die<br />
hydraulische Aufteilung an Abzweigungen, kann über eine Wasserstands – Abflussbeziehung beschrieben<br />
werden. Diese setzt aber eine genaue Kenntnis der Abflussvolumina bei verschiedenen<br />
Wasserständen voraus, die in einer Messreihe ermittelt werden sollten.
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 90<br />
9 Datenquellen und weitere Unterlagen<br />
Landnutzung BRB<br />
CIR-Daten<br />
Landnutzung Berlin<br />
UIS-Daten<br />
Daten zur Umweltsituation im Land Brandenburg, GK4, Regionalausgabe<br />
Uckermark-Barnim, Ausgabe 2/2003, Lizenz DUBV11451543<br />
Umweltinformationssystem des Landes Berlin, Datenbereitstellung über<br />
SenStadt IE216<br />
Landnutzung Forst Bestandesdaten für die Reviere Buch, Gorin und Blankenfelde, Datenbereitstellung<br />
über SenStadt IE216<br />
BÜK300 Bodenkundliche Übersichtskarte M 1:300.000 des Landesamtes für Geowissenschaften<br />
und Rohstoffe Brandenburg, NV 15/2003<br />
TK10 Topografische Karten im Maßstab 1:10.000, Landesvermessungsamt Brandenburg,<br />
Kartenbereitstellung über SenStadt IE216<br />
DWD Tageswerte ausgewählter Klimagrößen für die Station Buch und Tagessummen<br />
der Niederschlagshöhe für die Stationen Schildow, Schönow, Hohen<br />
Neuendorf, Rüdnitz und Klosterfelde, Geschäftszeichen<br />
KBPD/1384/03/Th<br />
LAWA-WEGs,<br />
Gewässernetz<br />
oberirdische Einzugsgebietsgrenzen und Fließgewässersystem, Landesumweltamt<br />
Brandenburg, Bereitstellung über SenStadt IE244<br />
Kalk, B. (1986): Hydrologisches Gutachten 3/hG-4/86 Pa zur Einschätzung der Entwicklung<br />
der Grund- und Oberflächenwasserverhältnisse nach Einstellung der Abwasseraufleitung<br />
im Raum Hobrechtsfelde/Buch und Schildow/Blankenfelde,<br />
Ofm Berlin, Abt. Wasserbewirtschaftung
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 91<br />
10 Literatur<br />
AG BODENKUNDE (1995): Bodenkundliche Kartieranleitung.- 4. Auflage, Hannover 1995. ,<br />
Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung<br />
Becker, A., Klöcking, B., Lahmer, W. and Pfützner, B. (2002). The Hydrological Modelling System<br />
ARC/EGMO. In: Mathematical Models of Large Watershed Hydrology (Eds.:<br />
Singh, V.P. and Frevert, D.K.). Water Resources Publications, Littleton/Colorado.<br />
891pp. ISBN 1-887201-34-3, p.<br />
DVWK: DVWK-Regeln zur Wasserwirtschaft. Bodenkundliche Grundlagenuntersuchungen im<br />
Felde zur Ermittlung von Kennwerten. Teil 2: Ermittlung von Standortkennwerten mit<br />
Hilfe der Grundansprache der Böden.- Heft 116.<br />
DVWK (1997) : Statistische Analyse von Hochwasserabflüssen. DVWK-Regel 101, unveröffentlichter<br />
Entwurf 1997<br />
DVWK (1991): Hydraulische Berechnung von Fließgewässern; Merkblätter 220/1991, Verlag<br />
Paul Parey<br />
Dyck, S. (1980): Angewandte Hydrologie, Teil I und II, VEB Verlag für Bauwesen Berlin 1980<br />
Dyck, S.; Peschke, G. (1983) : Grundlagen der Hydrologie; VEB Verlag für Bauwesen, Berlin<br />
1983<br />
Glugla, G., Fürtig, G. (1997): Dokumentation zur Anwendung des Rechenprogramms ABIMO –<br />
Berechnung langjähriger Mittelwerte des Wasserhaushalts für Lockergesteinsbereiche.<br />
Bundesanstalt für Gewässerkunde, Außenstelle Berlin: 19 S.<br />
Pfützner, B. (ed.) (2002) : Description of ArcEGMO. Official homepage of the modelling system<br />
ArcEGMO, http://www.arcegmo.de, ISBN 3-00-011190-5.<br />
G. Nützmann, G. Ginzel, H. Handke, H. Scholz, G. Siegert, D. Schwamm (1992): Abschlußbericht<br />
über die hydrologisch-hydrogeologischen Untersuchungen der ehemaligen Rieselfelder<br />
Berlin-Buch. Im Auftrag der Berliner Forsten. Berlin.<br />
Scheffer , F. & Schachtschabel, P. (1989): Lehrbuch der Bodenkunde.- 12. Auflage, Enke-Verlag,<br />
Stuttgart.<br />
Schmidt, H. & Glos, E. (1983): Statistische Untersuchungen zu Hochwasserscheiteldurchflüssen<br />
im Flachland der DDR. In: Mitteilungen des IfW, Heft 46, Verl. f. Bauwesen.<br />
Turc, L.: Évaluation des besoins en eau d'irrigation, évapotranspiration potentielle, formule simplifiée<br />
et mise à jour. Ann agron 12: 13-49; 1961<br />
Wendling, U.; Schellin, H.G. (1986) : Neue Ergebnisse zur Berechnung der potentiellen Evapotranspiration.<br />
Z. für Meteorologie 36 (1986) 3, S. 214-217<br />
WSPWIN (1997): Anwenderbeschreibung WSPWIN - Wasserspiegellagenberechnung für gegliederte<br />
Flußprofile unter besonderer Berücksichtigung von Bewuchs- und Bauwerkseinflüssen;<br />
Programm-Service-Wasserwirtschaft Knauf & Björnsen Beratende Ingenieure<br />
GmbH
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 92<br />
11 Anlagen<br />
Anlage 1: Bestandesformen Wald in den Revieren Blankenfelde, Buch und Gorin und<br />
deren Zusammenfassung zu Hauptbestandesformen<br />
BESTID Bestandesform Fläche [ha] HAUPTFORM Fläche [ha]<br />
50 Stieleichentyp 22.9 Laubwald<br />
52 Stieleichen-Edellaubholz-Typ 6.1 Laubwald<br />
53 Stieleichen-Linden-Typ 10.8 Laubwald<br />
56 Stieleichen-Birken-Typ 5.2 Laubwald<br />
57 Traubeneichentyp 15.0 Laubwald<br />
59 Traubeneichen-Buchen-Typ 3.0 Laubwald<br />
61 Traubeneichen-Linden-Typ 1.6 Laubwald<br />
71 Buchentyp 21.0 Laubwald<br />
75 Buchen-Edellaubholz-Typ 5.1 Laubwald<br />
76 Buchen-Traubeneichen-Typ 7.7 Laubwald<br />
78 Buchen-Stieleichen-Typ 7.8 Laubwald<br />
80 Hainbuchen-typ 3.7 Laubwald<br />
81 Roteichen-Typ 0.8 Laubwald<br />
86 Edellaubholztyp 59.5 Laubwald<br />
87 Edellaubholz-Pappel-Typ 45.0 Laubwald<br />
88 Edellaubholz-Buchen-Typ 1.4 Laubwald<br />
90 Robinientyp 38.0 Laubwald<br />
91 Robinien-Eichen-Typ 0.5 Laubwald<br />
94 Erlen-Birken-Typ 33.3 Laubwald<br />
95 Erlentyp sonst. 34.9 Laubwald<br />
97 Erlen-Edellaubholz-Typ 59.2 Laubwald<br />
98 Pappeltyp 385.6 Laubwald<br />
101 Birkentyp 44.1 Laubwald<br />
104 Linden-Hainbuchen-Typ 0.7 Laubwald 812.9
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 93<br />
BESTID Bestandesform Fläche [ha] HAUPTFORM Fläche [ha]<br />
8 Kiefern-Eichen-Typ 30.0 Mischwald<br />
13 Kiefern-Buchen-Typ 7.4 Mischwald<br />
15 Kiefern-Robinien-Typ 3.6 Mischwald<br />
17 Kiefern-Birken-Typ 68.6 Mischwald<br />
32 Fichten-Eichen-Typ 2.5 Mischwald<br />
34 Fichten-Roterlen-Typ 1.4 Mischwald<br />
58 Traubeneichen-Kiefern-Typ 13.2 Mischwald<br />
72 Buchen-Kieferntyp 1.9 Mischwald<br />
102 Birken-Kiefern-Typ 33.5 Mischwald<br />
106 Sonstiges 108.4 Mischwald 270.4<br />
1 Kieferntyp 1211.6 Nadelwald<br />
2 Kiefern-Lärchen-Typ 2.2 Nadelwald<br />
3 Kiefern-Fichten-Typ 1.3 Nadelwald<br />
5 Kiefern-Douglasien-Typ 4.5 Nadelwald<br />
19 Europ. Lärchentyp 16.4 Nadelwald<br />
27 Fichtentyp 24.2 Nadelwald<br />
28 Fichten-Kiefern-Typ 2.2 Nadelwald<br />
37 Weymouthskieferntyp 1.7 Nadelwald<br />
38 Schwarzkieferntyp 0.8 Nadelwald<br />
43 Douglasientyp 23.9 Nadelwald 1288.7
Anlage 2: Haupttabelle für den <strong>Lietzengraben</strong>, Abflussmessstelle II, Schönerlinder Weg<br />
Jahr 1996 NQ -<br />
MQ -<br />
HQ -<br />
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Wi So Jahr<br />
- 19.28 10.75 23.68 30.58 28.86 20.70 17.83 13.30 13.91 23.06 21.07 19.61 20.20<br />
- 29.06 22.22 27.93 33.89 68.49 35.25 32.87 18.57 18.02 29.76 28.27 33.83 31.61<br />
- 34.70 37.79 35.25 39.60 197.60 72.43 58.77 26.27 22.66 36.39 36.84 69.02 56.15<br />
Jahr 1997 NQ 27.47 24.16 17.69 20.79 39.43 30.44 23.29 12.18 6.46 4.53 7.70 8.75 26.66 10.49 18.57<br />
MQ 31.32 34.54 21.46 43.13 46.45 38.84 29.83 16.40 20.62 10.19 9.43 12.76 35.96 16.54 26.25<br />
HQ 36.65 57.31 32.55 116.23 66.43 55.40 43.45 23.83 79.06 20.40 11.82 18.00 60.76 32.76 46.76<br />
Jahr 1998 NQ 14.99 21.53 33.36 33.99 38.11 28.40 13.15 10.08 5.85 3.98 7.97 10.88 28.40 8.65 18.52<br />
MQ 20.88 38.54 56.92 39.06 55.08 40.81 22.19 13.26 11.73 7.28 11.33 21.67 41.88 14.58 28.23<br />
HQ 45.45 64.74 108.79 50.78 95.80 54.73 33.65 16.80 17.82 12.96 15.34 65.65 70.05 27.04 48.54<br />
Jahr 1999 NQ 22.34 36.30 43.56 43.17 42.78 39.25 21.58 14.15 6.49 5.47 3.59 8.42 37.90 9.95 23.93<br />
MQ 52.99 50.07 47.89 51.25 51.60 42.91 33.05 20.92 12.98 6.77 6.30 10.95 49.45 15.16 32.31<br />
HQ 72.37 67.94 54.11 62.98 67.37 52.69 41.30 28.92 33.39 9.78 11.02 13.64 62.91 23.01 42.96
Büro für Angewandte Hydrologie Wasserhaushaltsuntersuchungen im Einzugsgebiet des <strong>Lietzengraben</strong>s 95<br />
Anlage 3: Haupttabelle für den Graben 2, Abflussmessstelle IV, Schönerlinder Weg<br />
Jahr 1996 NQ -<br />
MQ -<br />
HQ -<br />
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Wi So Jahr<br />
- - - - - 2.66 2.13 0.94 0.00 0.00 0.27 - 1.00 -<br />
- - - - - 6.97 4.23 3.38 0.55 0.11 0.80 - 2.67 -<br />
- - - - - 16.93 8.10 7.01 2.02 0.42 2.35 - 6.14 -<br />
Jahr 1997 NQ 0.76 0.05 0.00 0.00 2.87 2.57 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.32 0.68<br />
MQ 1.33 1.55 0.00 2.09 3.98 3.65 2.94 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.59 1.35<br />
HQ 2.43 3.08 0.01 7.63 6.42 5.52 4.43 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 1.06 2.62<br />
Jahr 1998 NQ 0.00 0.00 0.00 0.03 2.31 3.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.01 0.45<br />
MQ 0.00 0.00 1.46 1.58 3.96 3.96 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.25 1.04<br />
HQ 0.00 0.00 3.64 2.73 5.87 4.77 3.77 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2.84 0.64 1.74<br />
Jahr 1999 NQ 0.13 0.51 3.40 3.68 7.05 6.36 1.87 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.32 1.92<br />
MQ 1.76 3.45 4.08 5.88 8.37 7.03 4.66 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 1.01 3.05<br />
HQ 2.70 6.09 5.78 8.75 11.69 8.15 7.23 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 7.19 1.62 4.41